26. Kapitel
Heute ist also der Familientag. In meinem Wörter buch gibt es keine allgemeingültige Definition dieses Begriffs. Wenn es eine gäbe, könnte sie etwa so la u ten:
Familientag (m) Eine Tradition an englischen Internat s schulen, bei der die Schülerin Besuch em p fangen darf und die für jeden eine Qual und für niemanden eine Freude b e deutet.
Ich habe mein Haar aufgesteckt, mein Korsett festgezurrt und mein Kleid zugeknöpft, um mich in eine damenhafte Fasson zu bringen –s o g ut es eben geht Aber innerlich bin ich noch immer aufgewühlt von meinem Besuch bei Mutter und unserem Streit. Ich habe mich schrecklich benommen. Heute Nacht we r de ich zu ihr gehen, sie um Verzeihung bitten und ihre warmen Arme wieder um mich spüren.
Trotzdem, wie sehr wünschte ich, ich könnte meiner Familie – besonders Vater –erzählen, dass ich Mutter g e sehen habe. Dass sie irgendwo dort draußen in einer and e ren Welt so lebendig und liebevoll und schön ist, wie wir sie i n Erinnerung haben. Ich habe keine A h nung, was mich unten erwartet, und ich bin entzwe i gerissen zwischen Hoffnung und Furcht. Vielleicht öffnet sich die Tür und Vater kommt herein, wohlg e nährt und gepflegt in seinem eleganten schwarzen Anzug. Er hat mir ein Geschenk mi t gebracht, in glänzendes Papier eing e wickelt. Er drückt mich an sich, nennt mich sein Goldkind und bringt mit se i nen Geschichten sogar die sauertöpfische Brigid zum La chen. Vielleicht. Vielleicht. Vie l leicht. Gibt es eine Droge, die stärker ist ab dieses Wort?
»Vielleicht könnte ich ja mit dir mitkommen«, sagt Ann, während ich zum hundertsten Mal versu che, mein Haar zu bändigen. Es will einfach nicht ordentlich gelockt oben auf meinem Kopf bleiben.
»Du würdest dich nach fünf Minuten zu Tode langweilen«, sage ich und kneife mir Rosen in die Wangen, die aufblühen und sofort wieder verblassen. Ich möchte Ann nicht dabeihaben, zumal ich selbst nicht weiß, was mich erwartet.
»Wird dein Bruder heute kommen?«, fragt Ann.
»Ja, Gott steh uns bei«, murmle ich. Ich will Ann in Bezug auf meinen Bruder nicht ermutigen.
»Du hast wenigstens einen Bruder, der dich ärgert.«
Im Spiegel des Waschtischs sehe ich Ann, die verloren auf ihrem Bett sitzt, in ihrem besten Kleid, oh ne zu wissen, wohin, und ohne einen Menschen, der für sie da ist. Wä h rend ich mit gemischten Gefühlen dem Besuch meiner Fa milie entgegensehe, wird sie den ganzen Tag allein verbri n gen. Der Familientag muss für sie die reinste Qual sein.
»Na schön«, seufze ich. »Wenn du dir diese Tortur antun willst, kannst du mitkommen.«
Sie bedankt sich nicht. Wir wissen beide, dass es ein Akt der Barmherzigkeit ist, aber für wen von uns, kann ich noch nicht sagen. Ich betrachte sie. Weißes Kleid, das über einem pummeligen Körper spannt. Strähnen dünnen Haars, die sich schon aus ihrem Dutt gelöst haben und in ihre wässrigen Augen hä n gen. Sie ist nicht die Schönheit, die ich letzte Nacht im Garten gesehen habe.
»Schauen wir mal, was wir mit deinem Haar machen können.«
Ann versucht, an mir vorbei in den Spiegel zu sehen. »Was stimmt nicht mit meinem Haar?«
»Nichts, was sich nicht durch festes Bürsten und mit ein paar Nadeln beheben lässt. Halt still.«
Ich nehme ihr Haar herunter. Die Bürste rupft durch ein verfilztes Knäuel dicht an ihrem Schädel. »Au!«
»Der Preis der Schönheit«, sage ich entschuldigend, aber nicht wirklich bedauernd.
Felicity stößt die Tür auf und lehnt sich kokett in den Rahmen. »Bonjour, mes demoiselles . Ich bin ’s, die Königin von Saba. Ihr könnt euch euren Kniefall für später aufsp a ren.« Ihr Korsett ist so fest g e schnürt, dass ihre Brüste merklich vorstehen. »Was meint ihr, meine Lieben? Bin ich nicht unwiderste h lich?«
»Sehr schön«, antworte ich. Da Ann zögert, stupse ich sie mit dem Fuß an.
»Ja, sehr schön«, echot sie.
Felicity lächelt, als würde sie soeben die Welt entdecken. »Er kommt. Ich kann es kaum erwarten, was er für Augen machen wird, wenn er sieht, was für eine vollendete Dame in den vergangenen zwei Ja h ren aus mir geworden ist. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich meinen Vater seit zwei Jahren nicht mehr gesehen habe?« Sie tanzt durchs Zimmer. »Ihr müsst ihn natürlich kennenlernen. Ich bin sicher, er wird von euch allen begeistert sein. Er soll sehen, dass ich hier gut zurechtkomme. Hat jemand von euch e i nen Duft?«
Ann und ich schütteln die Köpfe.
»Keinen einzigen Tropfen Parfüm? Ich kann nicht gehen, ohne lieblich zu duften !« Felicitys Stimmung sinkt im Nu.
»Hier«, sage ich und ziehe eine Rose aus der Vase auf dem Fensterbrett. Die Blütenblätter lassen sich leicht zerreiben und hinterlassen einen süßen, klebr i gen Saft auf meinen Fingern. Ich tupfe ihn hinter Fe licitys Ohren und auf ihre Handgelenke.
Sie schnuppert daran. »Perfekt! Gemma, du bist ein Genie.« Sie umarmt mich und gibt mir einen kleinen Kuss. Diese Seite von Felicity ist ein bis s chen beunruhigend, so als würde man einen Hai als Haustier haben, der sich selbst für einen Goldfisch hält.
»Wo ist Pip?«, fragt Ann.
»Unten. Ihre Eltern sind mit Mr Bumble gekommen. Was sagt ihr dazu? Hoffen wir, dass sie ihm heute den Laufpass gibt. Nun ja«, sagt Felicity und schickt sich zum Gehen an. »Adieu, les filles . Bis sp ä ter.« Ein kleiner Knicks und schon ist sie fort, in e i ner Wolke aus Rosenduft und Hoffnung.
»Also los, komm schon mit«, sage ich zu Ann, während ich die letzten Blütenspuren von meinen Fingern wische. »Bringen wir ’s hinter uns.«
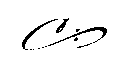
Als wir hinunterkommen, ist das vordere Empfangszimmer gedrängt voll mit Mädchen und ihren diversen Familiena n gehörigen. In den berüchtigten ind i schen Eisenbahnen habe ich eine bessere Organisation erlebt. Meine Familie ist ni r gends zu sehen.
Pippa kommt mit gesenktem Kopf zu uns herüber. Eine Frau mit einem ausladenden Hut folgt ihr auf dem Fuße. Das Kleid, das sie trägt, wäre für eine jüngere Frau und zumal für den Abend besser geei g net. Eine Pelzstola ist um ihre Schultern drapiert. Sie ist in Begleitung von zwei Mä n nern. In dem einen erkenne ich sofort den schnurrbä r tigen Mr Bumble. In dem anderen vermute ich Pippas Va ter.
»Mutter, Vater, darf ich euch Miss Gemma Doyle und Miss Ann Bradshaw vorstellen?«, sagt sie fast im Flüster ton.
»Ich bin entzückt, Pippas kleine Freundinnen kennenzulernen.« Pippas Mutter ist ebenso schön wie ihre Tochter, aber ihre Gesichtszüge sind schärfer, was sie mit reichlich Schmuck zu kaschieren ve r sucht.
Ann und ich knicksen und sagen höflich Guten Tag. Nach einem Augenblick des Schweigens räus pert sich Mr Bumble.
Mrs Cross verzieht den Mund zu einem schmalen Lächeln. »Pippa, hast du nicht jemanden vergessen?«
Pippa schluckt. »Darf ich außerdem vorstellen, der ehren w erte Mr Bartleby Bumble.« Das Folgende kommt he r aus wie ein ersticktes Schluchzen. »Mein Verlobter.«
Ann und ich sind so überrascht, dass wir kein Wort herausbringen.
»Erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen.« Mr Bumble schaut über seine Nase auf uns herunter. »Hoffentlich wird bald Tee serviert«, sagt er mit e i nem ungeduldigen Blick auf seine Taschenuhr.
Dieser ungehobelte, aufgeblasene alte Lackaffe mit seinem feisten Gesicht soll der Ehemann der wunderhübschen Pippa werden? Pippa, deren Ge danken um nichts als reine, unvergängliche, romant i sche Liebe kreisen, wurde an den Höchstbietenden verschachert; einen Mann, den sie nicht kennt, aus dem sie sich nichts macht. Sie starrt auf den Pe r se r teppich, als könnte er sich in die Lüfte erheben und mit ihr davonfliegen.
Ann und ich strecken unsere Hände zu einer matten Begrüßung aus.
»Ich sehe mit Genugtuung, dass meine Verlobte den richtigen Umgang pflegt«, näselt Mr Bumble. »Die Jugend ist leicht zu beeinflussen und neigt zu Unbesonnenheit und Respektlosigkeit. Habe ich nicht recht, Miss Cross?«
»Oh, absolut, Mr Bumble.«
Er verdient, gerädert, gevierteilt und den Geiern zum Fraß vorgeworfen zu werden.
»Oh, da ist Mrs Nightwing. Sie muss von unserer Neuigkeit unterrichtet werden. Vielleicht wird sie sie schon heute verkünden wollen.« Mit ihrem Mann im Schlepptau steuert Mrs Cross zur anderen Seite des Raums hinüber. Mr Bumble lächelt Pippas Hinterkopf an, als sei sie der Haup t preis bei dieser Mask e rade hier.
»Wollen wir?«, fragt er, ihr seinen Arm bietend.
»Kann ich noch einen Moment bei meinen Freundinnen bleiben? Um sie an meinem Glück teilhaben zu lassen?«, fragt Pippa in einem traurigen, sanften Ton. Der Trottel fühlt sich geschmeichelt.
»Selbstverständlich, meine Liebe. Aber halten Sie sich nicht zu lange damit auf.«
Als er weg ist, greife ich nach Pippas Hand. »Bitte nicht«, sagt sie. Ihre Augen schwimmen in Tränen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
»Er scheint sehr bedeutend zu sein«, meint Ann schließlich.
Pippa lacht kurz und schrill auf. »Ja. Es geht nichts über einen reichen Rechtsanwalt, der Vaters Spielschulden ab deckt und uns vor dem Ruin rettet. Ich bin ein Einsatz, nichts weiter, wirklich.« Sie sagt es nicht bitter. Das ist das Schlimme daran. Sie hat ihr Schicksal akzeptiert, ohne sich dagegen aufzule h nen.
»Ich muss gehen«, sagt Pippa mit der Begeisterung einer Frau, die ihrem Henker vorgestellt wird.
»Ihr Ring ist fantastisch«, sagt Ann nach einer Weile. Über dem allgemeinen Stimmengewirr hören wir Mrs Nightwings laute Glückwunschbekundungen und den Chor der anderen, die darin einstimmen.
»Ja, ganz fantastisch«, pflichte ich ihr bei. Wir bemühen uns beide, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Keine will sich die verzweifelte Hoffnung s losigkeit der Situation eingestehen –oder die Er leichterung, nicht selbst dieses Los gezogen zu h a ben. Wenigstens noch nicht. Ich kann nur hoffen, dass meine Familie, wenn es so weit ist, mich nicht dem erstbesten Mann andreht, der sie zu blenden ve r steht.
Felicity kommt vorbeigesaust. Sie hält ein Taschentuch in der Hand, das sie zu einem schmuddeligen Knäuel ze r drückt. »Was ist passiert? Ihr schaut drein, als wartet ihr auf den Weltuntergang.«
»Pippa ist mit Mr Bumble verlobt«, erkläre ich.
»Was? Oje, arme Pippa«, sagt sie kopfschüttelnd.
»Ist dein Vater schon da?«, frage ich, in der Hoffnung auf eine erfreulichere Nachricht.
»Noch nicht. Entschuldigt mich, aber ich bin viel zu nervös, um hier herumzustehen und zu warten. Ich gehe in den Garten hinaus, bis er kommt. Seid ihr sicher, dass ich präsentabel aussehe?«
»Zum allerletzten Mal, ja«, sage ich, mit den Augen rollend.
Felicity ist so aufgeregt, dass sie auf eine schnippische Antwort verzichtet. Stattdessen nickt sie dankbar, und mit einem Gesicht, als könnte sie ihr Frühstück keine Minute länger bei sich behalten, stürzt sie ins Freie.
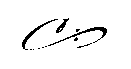
»Sieh an, das gnädige Fräulein Doyle, wenn ich nicht irre.«
Mit einer weit ausholenden Geste und einer übertriebenen Verbeugung setzt Tom seine Ankunft in Szene. Neben ihm Großmama in ihren besten schwarzen Trauerkleidern.
»Ist Vater auch da? Ist er mitgekommen?« Ich verrenke mir hektisch den Hals, um nach ihm Ausschau zu halten.
»Ja«, beginnt Tom. »Gemma …«
»Aber wo ist er?«
»Hallo, Gemma.«
Ich sehe Vater erst gar nicht. Er steht hinter Tom, fast ganz von ihm verdeckt, ein Geist in seinem schlecht sit zenden schwarzen Anzug. Tiefe Ringe liegen unter seinen Augen. Großmama nimmt seinen Arm, bemüht, sein heft i ges Zittern zu verbergen. Bestimmt hat sie ihm nur ein Mi nimum seiner üblichen Dosis gegeben, damit er durchhält, und ihm mehr davon für später versprochen. Alles was ich tun kann, ist nicht zu weinen.
Ich schäme mich, dass Ann und die anderen ihn so sehen.
Und ich schäme mich, dass ich mich schäme.
»Hallo, Vater«, stoße ich mühsam hervor und küsse seine eingefallenen Wangen.
»Wusste jemand, dass wir heute eine Königin sehen werden?«, scherzt er. Sein Lachen schlägt in heftiges Hu s ten um und Tom muss ihn festhalten. Ich kann Ann nicht ansehen.
»Im Ballsaal wird Tee serviert«, sage ich und bugsiere sie die Treppe hoch. Ich steuere einen ruhigen, allein ste henden Tisch an, abseits des Gewimmels, fern von Klatsch und Tratsch. Sobald wir Platz g e nommen haben, stelle ich Ann vor.
»Reizend, Sie wiederzusehen, Miss Bradshaw«, sagt Tom. Ann bekommt einen roten Kopf.
»Und wo ist Ihre Familie heute?«, fragt meine Großmutter und schaut dabei nach einem interessanteren Ge sprächspartner als uns beiden aus. Diese Frage war zu e r warten und sie verlangt nach einer Antwort. Und dann werden wir alle in betretenem Schweigen dasitzen oder Großmutter wird unter dem Mäntelchen der Freundlichkeit etwas Unfreundliches sagen.
»Sie sind im Ausland«, lüge ich.
Zum Glück versucht Ann nicht, mir zu widersprechen. Wahrscheinlich ist sie froh, dass es ihr erspart bleibt, erkl ä ren zu müssen, dass sie eine Waise ist, und das höfliche, schweigende Mitleid meiner Fam i lie zu ertragen. Plötzlich ist Großmutters Interesse geweckt und ich bin überzeugt, dass sie sich jetzt fragt, ob Anns Angehörige reich sind oder von Adel oder beides.
»Wie aufregend. Wohin geht die Reise?«
»In die Schweiz«, sage ich. »Nach Österreich«, sagt Ann gleichzeitig.
»Nach Österreich und in die Schweiz«, sage ich. »Es ist eine ausgedehnte Reise.«
»Österreich«, beginnt mein Vater. »Es gibt da einen sehr komischen Witz über Österreicher …« Er verstummt, wä h rend das Zittern seiner Finger überhandnimmt.
»Ja, Vater?«
»Hmmm?«
»Du sagtest etwas über die Österreicher«, erinnere ich ihn.
Er zieht seine Brauen zusammen. »Ah ja?«
Ich habe einen Kloß im Hals, der sich nicht hinunterschlu c ken lässt. Ich reiche Tom die Zuckerdose. Ann ve r folgt fasziniert jede Bewegung seiner Augen, obwohl er sie kaum beachtet.
»Und …«, beginnt Tom und lässt drei Stück Zucker in seinen Tee fallen. »Miss Bradshaw, hat meine Schwester Sie schon mit ihrer direkten Art in den Wahnsinn getri e ben?«
Ann errötet. »Gemma ist ein sehr liebenswürdiges Mädchen.«
»Liebenswürdig? Sprechen wir von ein und derselben Gemma Doyle? Großmama, Spence ist an scheinend mehr als nur eine Schule. Es ist ein Haus, in dem Wunder g e schehen.«
Alle lachen höflich auf meine Kosten, und ehrlich gesagt, es macht mir nichts aus. Ich finde es so wu n derbar, sie lachen zu hören, dass sie sich von mir aus den ganzen Nachmittag über mich lustig machen können. Vater ha n tiert mit seinem Löffel, als wüsste er nicht, was er damit tun soll.
»Vater«, sage ich zärtlich. »Soll ich dir Tee eingießen?«
Er schenkt mir ein mattes Lächeln. »Ja, danke, Virginia.«
Virginia. Ein betretenes Schweigen folgt, als er den Namen meiner Mutter ausspricht. Tom rührt in seinem Tee, als hinge sein Leben davon ab.
»Vater, ich bin es. Gemma«, sage ich ruhig.
Er blinzelt, legt seinen Kopf von einer Seite auf die andere, betrachtet mich. Langsam nickt er. »O ja. Richtig.« Dann fängt er wieder an, mit seinem Löffel zu spielen.
Mein Herz sinkt wie ein Stein zu Boden. Wir machen höfliche Konversation. Großmama erzählt uns von ihrem Gart en und ihren Gesellschaften und wer mit wem zurzeit nicht redet. Tom verbreitet sich über sein Studium und Ann hängt an seinen Lippen, als wäre jedes seiner Worte heilig. Vater hat sich völlig in sich zurückgezogen. Niemand fragt mich, wie es mir geht und was ich treibe. Ihr Interesse könnte nicht geringer sein. Wir Mädchen sind allesamt Spiegel, nur dazu da, um ihnen ihr eigenes Bild zu refle k tieren, das sie genau so zeigt, wie sie gesehen werden möchten.
In der Oberfläche des Spiegels zeigt sich ein Sprung. Ich zerberste. »Gibt es irgendetwas Neues über Mutter? Hat die Polizei neue Erkenntnisse?«
Tom lacht spöttisch auf. »Ho-ho! Schon wieder das alte Lied? Miss Bradshaw, Sie müssen meine Schwester en t schuldigen. Sie hat einen ausgeprägten Hang zur Dramatik. Unsere Mutter ist an der Cholera gestorben.«
»Sie weiß alles. Ich habe es ihr erzählt«, sage ich und beobachte ihre Reaktionen.
»Es tut mir leid, dass meine Schwester sich einen so dummen Scherz mit Ihnen erlaubt hat, Miss Brad shaw.« Und zwischen zusammengebissenen Zähnen, warnend: »Gemma, du weißt, dass unsere arme Mutter von der Ch o lera hinweggerafft wurde.«
»Ja, von ihrer persönlichen Cholera. Erstaunlich, dass die Cholera nicht uns alle getötet hat. Aber viel leicht tut sie ’s ja noch. Vielleicht verbreitet sie sich als schleiche n des Gift in unserem Blut und wir sterben Tag für Tag lan g sam vor uns hin«, gebe ich mit gleicher Miene zurück.
»Ich denke, wir wechseln besser das Thema. Miss Bradshaw i st nicht hier, um sich mit solchen Kindereien a b zugeben.« Großmama nimmt einen Schluck Tee, womit sie mir zu verstehen gibt, dass sie nichts mehr davon hören will.
»Ich finde, meine arme Mutter ist ein ausgezeichneter Gesprächsstoff. Was meinst du, Vater?«
Komm schon, Vater. Gebiete mir zu schweigen. Sag mir, ich soll mich benehmen, ich solle zur Hölle gehen, was auch immer. Zeig einen Funken deines alten Kampfgeistes.
Nur das pfeifende Geräusch der ein- und ausströ menden Luft aus seinem schlaffen Mund ist zu ve r nehmen. Er hört nicht zu. Er ist in seine eigene Welt versunken, den Teelö f fel noch immer in den Händen drehend.
Es ist mir unerträglich mitanzusehen, wie sie die Augen vor der Wahrheit verschließen. »Danke für euren Besuch. Wie ihr seht, komme ich hier ganz gut zurecht. Ihr habt eure Pflicht erfüllt und könnt jetzt alle getrost zu euren wie auch immer gearteten Be schäftigungen zurückkehren.«
Tom lacht. »Nun, das nenne ich wahre Dankbarkeit. Ich versäume deswegen ein Kricketmatch. Was ist, sollten sie dir hier nicht Manieren beibringen?«
»Gemma, du bist unverschämt und kindisch. Und noch dazu vor unserem Gast. Miss Bradshaw, bitte entschuldi gen Sie meine Enkelin. Möchten Sie noch Tee?« Großm a ma gießt ihr nach, ohne eine Antwort abzuwarten. Ann starrt auf die Tasse, froh, ihren Blick daran festhalten zu können. Sie ist entsetzt über mich. Alle sind entsetzt über mich.
Ich stehe auf. »Ich will euch nicht den netten Nachmittag verderben und verabschiede mich daher. Kommst du, Ann?«
Ann wirft einen schüchternen Blick auf Tom. »Ich bin noch nicht fertig mit meinem Tee«, sagt sie.
»Ah, wenigstens ist eine wohlerzogene junge Dame unter uns.« Tom klatscht leicht in die Hände. »Bravo, Miss Bradshaw .«
Sie lächelt in ihren Schoß hinunter. Tom bietet ihr Kuchen an und Ann, die in ihrem ganzen Leben noch nie e i nen Bissen zu essen ausgeschlagen hat, lehnt ab, wie es sich für eine wohlerzogene junge Dame aus gutem Haus gehört, wenn sie nicht als Vielfraß gelten will. Ich habe ein Monster am Busen genährt.
»Wie du willst«, brumme ich. Ich beuge mich über Vaters Knie, ergreife seine Hände und ziehe ihn vom Tisch weg. Seine Hände zittern. Schweiß tritt auf seine Stirn. »Va ter, ich gehe jetzt. Wollen wir nicht einen Spaziergang m a chen?«
»Gerne, Liebling. Den Ländereien einen Besuch abstatten, ja?« Er versucht ein Lächeln, das sich zu einer Grima s se des Schmerzes verzerrt. Was Großmama ihm auch g e geben hat, es war nicht genug. Er wird bald noch mehr brauchen und dann können wir ihn ganz abschreiben. Wir machen ein paar Schritte, doch er stolpert und muss sich an einem Stuhl fes t halten. Alle im Saal heben die Köpfe. Tom ist sofort neben mir und nimmt Vaters Arm, um ihn zum Tisch zurückzuführen.
»Da siehst du’s, Vater«, sagt er ein bisschen zu laut, s o dass es jeder hören kann. »Du weißt, dass Dr. Price gesagt hat, du darfst noch nicht auf diesem Fuß auftreten, um den Knöchel nicht zu belasten. Diese Poloverletzung muss erst verhei l en.« Die Köpfe im Saal senken sich zufrieden wi e der, bis auf einen. Ce cily Temple hat uns erspäht. Mit ihren Eltern im Schlepptau steuert sie auf unseren Tisch zu.
»Hallo, Gemma, hallo, Ann.« Anns Gesicht ist ein Bild des Entsetzens. Cecily kostet die Situation aus. »Ann, wirst du später für uns singen? Ann hat die wunderbarste Sti m me. Sie ist die Schülerin, von der ich euch erzählt habe –die Stipendiatin.«
Ann verschwindet fast unter dem Tisch.
Großmama ist verwirrt. »Ich dachte, Sie sagten, Ihre Eltern seien im Ausland …«
Anns Gesicht zuckt und ich weiß, dass sie in Tränen ausbrechen wird. Sie stürzt vom Tisch und wirft dabei e i nen Stuhl um.
Cecily mimt Betroffenheit. »Oje, ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt.«
»Sobald du den Mund aufmachst und etwas sagst, ist es das Falsche«, zische ich.
Großmama reißt der Geduldsfaden. »Gemma, was ist heute in dich gefahren. Bist du krank?«
»Ja, verzeiht mir«, sage ich und werfe meine zusammengeknüllte Serviette auf den Tisch. »Meine Cholera bricht wieder aus.«
Später werde ich mich entschuldigen müssen – es tut mir so leid, ich weiß nicht, was über mich g e kommen ist. Aber für den Augenblick pfeife ich darauf, die Maske des A n stands zu tragen. Während ich durch den Ballsaal und die Treppe hinunterstürme, muss ich eine Hand auf meinen Magen legen, u m meinen Atem zu beruhigen und nicht ohnmächtig zu werden. Zum Glück sind die Fenster geöf f net, um frische Luft hereinzulassen. Ich trete auf den Rasen hinaus, wo gerade ein Krocketspiel im Gange ist. Elegant gekleidete Mütter mit breitkrempigen Hüten schubsen mit ihren Schlaghölzern bunte Holzbälle durch kleine Tore, während ihre Ehemänner kopfschüttelnd neben ihnen st e hen und sie sanft korrigi e ren. Die Mütter lachen und treffen wieder nicht, man könnte meinen absichtlich, damit ihre Männer erneut zu Hilfe eilen müssen.
Ich gehe unbemerkt an ihnen vorbei, den Hang hinunter, wo Felicity allein auf einer Steinbank sitzt.
»Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe genug von diesem Zirkus«, sage ich, einen kumpelhaften Ton a n schlagend, der überhaupt nicht meiner Stimmung en t spricht. Eine heiße Träne rollt über meine Wange. Ich w i sche sie fort und wende meine Augen dem Spiel zu. »Ist dein Vater schon geko m men? Habe ich ihn verpasst?«
Felicity sagt nichts, sitzt nur da.
»Fee? Was ist los?«
Sie überreicht mir die Karte aus edlem weißen Karton, die sie in der Hand hält.
Meine liebste Tochter, es tut mir leid, Dir dies in aller Kü r ze mitteilen zu müssen, aber mich ruft eine anderweitige Verpflichtung, und die Pflicht gege n über der Krone ist von allergrößter Wichtigkeit, wo r in Du mir gewiss zustimmen wirst. Ich wünsche Dir einen vergnüg t en Tag und vielleicht werden wir ei n ander zu Weihnachten w iedersehen.
Herzlichst,
Dein Vater
Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
»Es ist nicht einmal seine Handschrift«, sagt sie schließlich mit tonloser Stimme. »Er hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, einen persönlichen Gruß dazuzuschre i ben.«
Draußen auf dem Rasen toben einige der jüngeren Mädchen herum, spielen Abschlagen, fallen hin und kugeln sich vor Lachen auf dem Boden, während i h re Mütter in der Nähe wachen und über verschmutzte Kleider, aufgelöste Haare, Bänder und Hauben schimpfen. Zwei Mädchen hüpfen Arm in Arm an uns vorbei, während sie ein Gedicht rezitieren, das sie für den heutigen Tag auswendig gelernt haben.
Vergessen waren Tuch und Mühn,
man sah sie hin zum Fenster gehn,
sie sah die Wasserlilien blühn,
sah seinen Hut im Lichte glühn,
sie schaute hinab nach Camelot.
Oben am Himmel kämpfen Flecken von Blau gegen bedrohliche, graue Wolkenmassen. Ab und zu bli n zelt sogar die Sonne hervor.
Das Tuch flog weit aus dem Gemach,
ihr gelber Spiegel klirrend brach;
»der Fluch, er ist gekommen«, sprach
die Lady von Shalott.
Die Mädchen werfen sorglos ihre Köpfe zurück und lachen sich halb tot über ihren dramatischen Vortrag. Der Wind hat nach Ost gedreht. Ein Sturm ist im Anzug. Ein übler; modriger Geruch hängt in der Luft. Einzelne Tropfen fa l len, lecken an meinen Händen, meinem Gesicht, meinem Kleid. Die Gäste schreien überrascht auf, wenden ihre Handflächen zum Himmel und suchen schleunigst De ckung.
»Es fängt an zu regnen.«
Felicity starrt wortlos vor sich hin.
»Du wirst nass werden«, sage ich und springe auf, um mich unter das schützende Dach der Schule zu flüchten. Felicity macht keine Anstalten, mir zu fo l gen. Also gehe ich allein, obwohl es mir nicht richtig erscheint. Als ich die Tür erreicht habe, sehe ich, dass sie immer noch dort auf der Bank sitzt und sich durchweichen lässt. Sie hat die Ka r te mit der Nac h richt von ihrem Vater auseinandergefaltet, hält sie in den Regen und beobachtet, wie jeder Federstrich von dem durchnässten Papier getilgt wird.