9. Kapitel
Als ich aufwache, ist es ein wirklicher, strahlend blauer Morgen, mit echtem Sonnenlicht, das durchs Fenster he r einströmt. Alles draußen ist golden. Ni e mand verlangt von mir, etwas zu stehlen. Keine jungen Männer in weiten schwarzen Mänteln, die krypt i sche Warnu n gen ausstoßen. Keine seltsamen, leuchtenden kleinen Mädchen, die Wache halten, während ich in finst e ren Höhlen herumstöbere. Es ist, als hätte es die vergang e ne Nacht nie gegeben. Ich str e cke die Arme über meinen Kopf und versuche, mich an meine merkwürdigen Träume zu erinnern; etwas über me i ne Mutter, aber es will mir nicht einfallen. Das Tag e buch liegt im Kleiderschrank, wo es meinetwegen verschimmeln kann. Mein erster Gedanke heute heißt Rache.
»Du bist wach«, sagt Ann. Sie sitzt vollständig angezogen auf ihrem Bett und beobachtet mich.
»Ja«, antworte ich.
»Zieh dich lieber an, wenn du ein warmes Frühstück möchtest. Es ist ungenießbar, wenn es kalt wird.« Sie ver stummt. Starrt. »Ich hab den Schlamm weggeputzt, den du hereingetragen hast.«
Ich folge ihrem Blick, und aha, da haben wir es, mein schmutziger Fuß schaut aus dem gestärkten weißen Laken heraus. Schnell decke ich ihn zu.
»Wo warst du?«
Das Gespräch behagt mir nicht. Draußen scheint die Sonne. Unten gibt es Speck. Mit dem heutigen Tag fängt mein Leben an. Das habe ich soeben beschlossen. »Eigen t lich nirgends. Ich konnte nur nicht schlafen«, lüge ich und bringe ein, wie ich meine, unschuldiges Lächeln zustande.
Ann beobachtet, wie ich Wasser aus einem mit Blumen geschmückten Krug in eine Schüssel gieße und meine schmutzverkrusteten Füße und Knöchel schrubbe. Aus Gründen der Schicklichkeit trete ich hinter den Wan d schirm und streife das weiße Kleid über meinen Kopf, zi e he die Bürste durch meine Medusalocken und stecke diese im Nacken zu einem straffen Knoten fest. Dabei sticht eine Haarnadel in meine Kopfhaut und ich wünschte, ich könnte mein Haar offen tragen, wie ich es als kleines Mädchen getan habe.
Ich habe Schwierigkeiten mit dem Korsett. Es gelingt mir nicht, die Schnüre am Rücken selbst festzu ziehen. Und es sieht ganz so aus, als sei kein Dienstmädchen da, um mir beim Ankleiden zu he l fen. Seufzend wende ich mich an Ann.
»Würde es dir etwas ausmachen?«
Sie schnürt mein Mieder so fest, dass mir die Luft wegbleibt und ich Angst bekomme, dass sie mir die Rippen bricht. »Ein bisschen lockerer, bitte«, stöhne ich. Sie g e horcht und ich fühle mich jetzt nur noch eingeengt anstatt verkrüppelt.
»Danke«, sage ich, als sie fertig ist.
»Du hast einen Schmutzfleck am Hals.« Ich wünschte, sie würde aufhören, mich so zu mustern. Ich nehme den kleinen Handspiegel vom Schrei b tisch und entdecke den Fleck, direkt unter meinem Kinn. Ich lecke meinen Finger und mache meinen Hals mit Spucke sauber. Ich hoffe, dass Ann sich a n gewidert abwendet, bevor ich mich gezwungen sehe, etwas wirklich Abscheuliches zu tun –mich kratzen, einen Pickel ausdrücken, in der Nase bohren –, damit sie mich allein lässt. Ich werfe noch einen letzten Blick in den Spiegel. Das Gesicht, das mir daraus entgegenschaut, ist nicht schön, aber auch nicht so, dass ich es verstecken müsste. Mit meinen von der Sonnenwärme geröteten Wa n gen habe ich meiner Mutter nie ähnlicher gesehen als an diesem Morgen.
Ann räuspert sich. »Du solltest hier wirklich nicht allein herumspazieren.«
Ich war nicht allein. Sie weiß es, aber ich habe keine Lust, Ann von der Demütigung zu erzählen, die mir die anderen bereitet haben. Sie könnte de n ken, es würde uns als Außenseiterinnen zusammenschweißen. Aber mein A n derssein ist zu kompliziert, um es zu teilen.
»Das nächste Mal, wenn ich nicht schlafen kann, wecke ich dich«, sage ich. »Du meine Güte, was ist denn da pas siert?« Die Innenseite von Anns Handg e lenk ist ein Schlachtfeld von dünnen roten Kratzern, wie Kreuzstiche an einem Saum. Sie sehen aus wie mit einer Nadel oder einer Reißzwecke eingeritzt. Schnell zieht Ann den Ärmel darüber.
»N-n-nichts«, sagt sie. »Es w-w-war ein Un-f-fall.«
Was für ein Unfall könnte solche Male hinterlassen? Sie s ehen aus wie absichtlich zugefügt, aber ich sage nur: »Oh«, und wende meinen Blick ab.
Ann geht auf die Tür zu. »Ich hoffe, es gibt heute frische Erdbeeren. Die sind gut für den Teint. Das habe ich in Lu cys dorniger Weg gelesen.« Sie steht auf der Schwelle und wippt auf ihren Absätzen leicht vor und zurück: »Mein Teint kann jede Hilfe gebra u chen.«
»Dein Teint ist tadellos.« Ich zupfe zum Schein an meinem Kragen herum.
Sie lässt sich nicht so einfach abspeisen. »Schon gut. Ich weiß, dass ich nicht hübsch bin. Das sagt jeder.« In ihren Augen ist ein Funken Trotz, als wollte sie mich herausfo r dern, das Gegenteil zu behau p ten. Wenn ich widerspreche, dann weiß sie, dass ich lüge. Wenn ich nichts sage, nimmt sie es als Bestät i gung.
»Erdbeeren sagst du? Das muss ich ausprobieren.«
Ihr Blick wird wieder ausdruckslos. Ann hatte auf die Lüge von mir gehofft, wollte von einem Men schen hören, dass sie schön ist. Ich habe sie en t täuscht.
»Beeil dich«, sagt sie und lässt mich endlich allein. Allein mit der Frage, ob ich in Spence jemals eine Freundin finde.
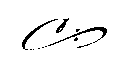
Die Zeit reicht gerade, um meine Rache vorzubereiten, dann eile ich, plötzlich hungrig, zum Früh s tück. Da ich spät dran bin, bleibt es mir erspart, Fel i city, Pippa und die anderen zu sehen. Nicht erspart ble i ben mir leider die nun lauwarmen Eier und der Po r ridge, die genauso scheußlich sind, wie Ann es vo r ausgesagt hat, wenn nicht noch schlimmer. Der Porridge klebt in zähen Klumpen an me i nem Löffel.
»Ich hab dir’s ja gesagt«, murmelt sie, während sie den letzten Bissen von einer Scheibe Speck verputzt, der mir den Mund wässrig macht.
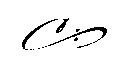
Als wir uns zur ersten Stunde, Mademoiselle LeFarges Französischunterricht, in der Klasse einfi n den, ist es mit meinem Glück vorbei. Die Mädchen von Fel i citys Clique sitzen geschlossen auf ihren Plätzen und erwarten mich. Sie besetzen die letzte Bankreihe in dem kleinen, engen Raum, sodass ich an ihnen vo r bei Spießruten laufen muss, um mir e i nen Platz zu suchen. Fabelhaft. Genauso habe ich mir das vorg e stellt.
Felicity streckt ihren zierlichen Fuß aus der Bank und stoppt mich in dem schmalen Gang zwischen ihrem und Pippas Pult. »Gut geschlafen?«
»Durchaus.« Ich lege eine Extraportion Fröhlichkeit hinein, um zu zeigen, wie wenig mich nächtliche Schulmä d chenstreiche kümmern. Der Fuß bleibt, wo er ist.
»Wie hast du das bloß geschafft? Herauszukommen, meine ich«, fragt Cecily.
»Ich habe magische Kräfte«, sage ich und muss selbst über diese zweifelhafte Erkenntnis lachen. Martha wird klar, dass sie von dem nächtlichen Spaß ausgeschlossen war. Sie will sich damit nicht abfi n den. Deshalb versucht sie mitzuhalten, indem sie mich nachäfft.
»Ich habe magische Kräfte«, trällert sie.
Meine Wangen werden heiß. »Übrigens, ich habe das Objekt in Sicherheit gebracht.«
Felicity ist elektrisiert. »Wirklich? Wo hast du’s ver steckt?«
»Ach, ich hab mir gedacht, es war nicht klug, es zu verstecken. Womöglich würd ich ’s nicht wiede r finden«, sage ich fröhlich. »Es befindet sich für j e dermann sichtbar auf deinem Sessel im Marmorsaal. Ich hoffe, das war der beste Platz dafür.«
Felicity reißt entsetzt den Mund auf. Ich gebe ihrem Fuß einen kleinen Schubs und gehe zu einem Pult in der vo r dersten Reihe. Ich spüre ihre Blicke in meinem Rücken.
»Was für ein Objekt?«, fragt Ann, während sie ihre Hände wie eine Musterschülerin ordentlich vor sich auf dem Pult faltet.
»Nicht der Rede wert«, sage ich.
»Sie haben dich in der Kapelle eingesperrt, stimmt’s?«
Ich hebe den Deckel meines Pults, um Anns Gesicht auszublenden. »Nein, natürlich nicht. Sei nicht dumm.« Aber zum ersten Mal sehe ich die Andeutung eines Lä chelns –eines wirklichen Lächelns –um ihre Mundwinkel zucken.
»Wird denen das denn nie langweilig?«, murmelt sie kopfschüttelnd.
Bevor ich antworten kann, rauscht Mademoiselle LeFarge mit ihren zweihundert Pfund Lebendg e wicht und einem munteren »Bonjour« ins Klasse n zimmer. Sie nimmt einen Lappen und wischt energisch über die bereits saubere Ta fel, wobei sie die ganze Zeit wie ein Wasserfall auf Fra n zösisch v or sich hin plappert. Schließlich macht sie eine Pause, um Fragen zu stellen, die –zu meinem Schrecken –jeweils auf Französisch beantwortet werden müssen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, um was es geht, Franz ö sisch war für mich immer eine Sprache, die undefinierbar nach Gurgeln klingt.
Mademoiselle LeFarge bleibt bei meinem Pult stehen und schlägt vor Überraschung die Hände zu sammen. »Ah, une nouvelle fille! Comment vous appellez-vous?« Ihr Ge sicht schwebt gefährlich nah vor meinem, sodass ich die Lücke zwischen ihren Vorderzähnen und jede einzelne Po re auf ihrer breiten Nase sehen kann.
»Wie bitte?«, frage ich.
Sie wackelt mit einem dicken Finger. »Non, non, non … en franç ais, s’il vous plait. Maintenant, comment vous a p pellez-vous?« Wieder schenkt sie mir dieses zuversichtl i che, strahlende Lächeln. Hinter mir höre ich Felicity und Pippa kichern. Der erste Tag meines neuen Lebens und schon bin ich Zie l scheibe des Spotts.
Es scheint Stunden zu dauern, bis mir Ann schließlich zu Hilfe kommt. »Elle s ’appelle Gemma Doyle.«
»Wie heißen Sie?« So viele übertriebene Vokale, um diese eine idiotische Frage zu stellen? Das ist die dümmste Sprache von der Welt.
»Ah, bien, Mademoiselle Bradshaw. Tres bien.« Felici ty kichert noch immer. Mademoiselle LeFarge richtet eine Frage an sie. Ich hoffe inständig, dass Felicity da r über stolpert wie ein Trampeltier, aber ihr Französisch ist abs o lut perfekt. Es gibt auf der Welt keine Gerechtigkeit.
Sooft mich Mademoiselle LeFarge etwas fragt, starre ich geradeaus und sage ein ums andere Mal »Wie bitte?«, als wäre ich entweder taub oder nicht ganz bei der Sache. Ihr lächelndes Gesicht verfinstert sich allmählich, bis sie es ganz aufgibt, mir Fragen zu stellen, was mir nur recht ist. Als die anstrengende Stunde endlich vorbei ist, habe ich gelernt, Sätze wie »Wie reizend« und »Ja, meine Erdbeeren sind sehr saftig« hervorzustottern.
Mademoiselle hebt ihre Arme und wir stehen gemeinsam von unseren Plätzen auf, um uns im Chor zu vera b schieden. »Au revoir, Mademoiselle LeFa r ge.«
»Au revoir, mes filles«, ruft sie, während wir unsere Bü cher und Tintenfässer in unseren Pulten verstauen. »Miss Doyle, könnten Sie noch einen Moment hierbleiben?« Ihr englischer Akzent ist e r frischend wie kaltes Wasser nach all dem blumigen Französisch. Mademoiselle LeFarge stammt genauso wenig aus Paris wie ich.
Felicity stolpert fast über ihre eigenen Füße, als sie Hals über Kopf zur Tür stürzt.
»Mademoiselle Worthington! Es besteht kein Grund zur Eile.«
»Pardon, Mademoiselle LeFarge.« Felicity schaut mich durchdringend an. »Mir fiel gerade ein, dass ich vor der nächsten Stunde noch etwas Wichtiges zu erledigen h a be.«
Als sich das Klassenzimmer allmählich leert und nur wir zwei übrig bleiben, lässt sich Mademoiselle LeFarge in ih rer ganzen Leibesfülle hinter dem Le h rerpult nieder. Der Schreibtisch ist leer mit Ausna h me einer Fotografie eines h übschen Mannes in Un i form. Wahrscheinlich ein Bruder oder ein anderer Verwandter. Schließlich ist sie eine Ma demoiselle und älter als fünfundzwanzig –eine alter Jun g fer, o h ne Hoffnung, noch zu heiraten. Warum wäre sie sonst auch hier, um als letzte verbleibende Möglichkeit Mädchen zu unterrichten?
Mademoiselle LeFarge schüttelt den Kopf. »Ihr Französisch bedarf noch harter Arbeit, Mademoiselle Doyle. Sie werden sich sehr anstrengen müssen, um in dieser Klasse zu bleiben. Wenn ich keine For t schritte erkenne, werde ich mich gezwungen sehen, Sie zurückzustufen.«
»Ja, Mademoiselle.«
»Sie können jederzeit die anderen Mädchen um Hilfe bitten. Miss Worthingtons Französisch ist recht gut.«
»Ja«, sage ich und schlucke schwer. Ich würde eher meine Nägel essen, als Felicity um Hilfe zu bit ten.
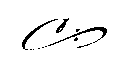
Der Rest des Tages schleppt sich langsam und ereignislos dahin. Es gibt Redeübungen, Tanzstunden, Unterricht in Benehmen und Latein. Wir haben Musik bei Mr Grün e wald, einem kleinen Österreicher mit krummem Rücken, schlaffen Zügen und einem müden, resignierten Ge sichtsausdruck. Jeder seiner Seufzer sagt, der Versuch, uns Singen und Musizi e ren beizubringen, ist nur einen Schritt davon entfernt, eines langsamen, qualvollen Todes zu ste r ben. Wir alle wetteifern, wenngleich wenig berauschend, mit unseren Gesangskünsten –ausgenommen Ann.
Als Ann an der Reihe ist, aufzustehen und ein Lied vorzutragen, strömt eine klare, liebliche Stimme aus ihr he r aus. Sie singt wunderschön, wenn auch etwas ängstlich und unsicher. Mit der nötigen Ausbildung und ein bisschen mehr Ausdruck könnte sie es wir k lich zu etwas bringen. Es ist ein Jammer, dass sie nie die Chance dazu bekommen wird. Ann ist hier, um sich darauf vorzubereiten, in Ste l lung zu gehen, sonst nichts. Als sie ihr Lied beendet hat, geht sie mit g e senktem Kopf wieder zu ihrem Platz zurück und ich frage mich, wie viele kleine Tode sie täglich stirbt.
»Du hast eine sehr schöne Stimme«, flüstere ich ihr zu, als sie sich in ihrer Bank niederlässt.
»Das sagst du nur aus Freundlichkeit«, erwidert sie und kaut dabei an einem Fingernagel. Aber eine heiße Röte steigt in ihre pausbäckigen Wangen und ich weiß, dass di e ser Moment des Singens alles für sie bedeutet, und sei er noch so kurz.
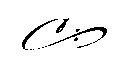
Die Woche vergeht in eintönigem Trott. Beten. Benehmen. Haltung. Von früh bis spät genieße ich den gleichen gesel l schaftlichen Außenseiterstatus wie Ann. Abends sitzen wir beide am Feuer im Marmorsaal. Nur das Gelächter von Fe licity und ihren Jüng e rinnen durchbricht die Stille, wobei sie uns absich t lich ignorieren. Ich bin überzeugt, dass ich bis sp ä testens zum Wochenende unsichtbar sein werde. Aber nicht für jedermann.
Kartik hat mir eine Botschaft hinterlassen. In der Nacht, nachdem ich das Tagebuch entdeckt habe, finde ich, mit einer kleinen Messerklinge an mein Bett geheftet, einen alten Brief von Vater. Es hatte wehgetan, den herzzerre i ßenden Brief zu lesen, und so hatte ich ihn ganz hinten in der Schublade meines Schreibtischs versteckt. Ihn nun auf meinem Bett zu sehen, mit den Worten Du wurdest g e warnt quer über Vaters Unterschrift geschmiert, lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Die Drohung ist klar. Die einzige Chance, mich und meine Familie vor Unheil zu bewahren, besteht darin, meinen Geist vor neuen Visionen zu verschließen. Doch ich stelle fest, dass ich meinen Geist nicht versperren kann, ohne mich selbst auszusperren. Vor Angst verkrieche ich mich in mich selbst.
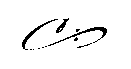
Die einzige Zeit, in der ich mich lebendig fühle, ist während des Zeichenunterrichts bei Miss Moore. Ich hatte ihn mir langweilig vorgestellt –kleine Naturskizzen von Ka ninchen, die glücklich in der engl i schen Landschaft grasen –, aber Miss Moore übe r rascht mich abermals. Sie hat das berühmte Gedicht Die Lady von Shalott von Alfred Lord Tennyson als Anregung für unsere Arbeit ausgewählt. Es handelt von einer Frau, die sterben wird, wenn sie die Si cherheit ihres Elfenbeinturms verlässt. Noch überrasche n der ist, dass Miss Moore wissen will, was wir über Kunst denken. Sie möchte, dass wir unsere Gedanken laut au s sprechen und den Mut haben, eine eigene Meinung zu ä u ßern, statt naturgetreue Abbi l der von prallen Früchten zu malen. Das stürzt die Schafe in beträchtliche Verwirrung.
»Was können Sie mir zu dieser Studie der Lady von Shalott sagen?«, fragt Miss Moore, als sie das Blatt auf ei ne Staffelei stellt. Das Bild zeigt eine Frau, die an einem großen Fenster steht und auf einen Ritter im Wald hinu n terblickt. Ein Spiegel r e flektiert das Innere des Zimmers.
Eine Weile ist es still.
»Will irgendjemand etwas sagen?«
»Es ist eine Kohlezeichnung«, antwortet Ann.
»Ja, das lässt sich kaum bestreiten, Miss Bradshaw. Noch jemand?« Miss Moore schaut unter uns Anwesenden nach einem Opfer aus. »Miss Temple? Miss Poole?« Ni e mand sagt ein Wort. »Ah, Miss Worthington, Sie sind se l ten um Worte verlegen.«
Felicity legt ihren Kopf schief, als würde sie die Zeichnung eingehend betrachten, doch ich könnte schwören, dass sie schon weiß, was sie sagen wird. »Es ist eine za u berhafte Studie, Miss Moore. Eine wundervolle Kompos i tion in ihrer Ausgewogenheit zwischen dem Spiegel und der Frau, im Stil der Pr ä raffaeliten, glaube ich.« Felicity knipst ihr Lächeln an, bereit, das Lob entgegenzunehmen. Wie sie es auf ihre raffiniert naive Art versteht, sich in Szene zu setzen, das ist hier die wahre Kunst.
Miss Moore nickt. »Eine genaue, wenn auch etwas seelenlose Beobachtung.« Felicitys Lächeln erlischt schlaga r tig. Miss Moore fährt fort. »Aber was geht Ihrer Meinung nach in dem Bild vor? Was will uns der Künstler über di e se Frau sagen? Was fühlen Sie, wenn Sie es betrachten?«
Was fühlen Sie? Diese Frage wurde mir noch nie ge stellt.
Niemandem von uns. Man erwartet von uns keine Gefühle. Wir sind Engländerinnen. Im Raum ist es vollko m men still.
»Es ist sehr ansprechend«, sagt Elizabeth und drückt damit ihre typische meinungslose Meinung aus. »Hübsch.«
»Sie fühlen sich hübsch, wenn Sie das Bild betrachten?«, fragt Miss Moore.
»Nein. Ja. Sollte ich mich hübsch fühlen?«
»Miss Poole, ich würde mir nie erlauben, Ihnen vorzuschreiben, wie Sie auf ein Kunstwerk zu reagi e ren haben.«
»Aber Bilder sind entweder ansprechend und hübsch oder sie sind Mist. Ist es nicht so? Sollten wir nicht lernen, hübsche Bilder zu malen?«, schaltet sich Pippa ein.
»Nicht unbedingt. Versuchen wir es anders. Was ereignet sich in diesem Moment auf dem Bild, Miss Cross?«
»Die Dame schaut aus dem Fenster zu Sir Lancelot?« Pippa kleidet ihre Antwort in eine Frage, als wäre sie nicht einmal sicher, was sie sieht.
»Ja. Sie alle sind mit Tennysons Gedicht vertraut. Was geschieht mit der Lady von Shalott?«
Martha meldet sich, froh, wenigstens in einem Punkt sicher zu sein. »Sie verlässt den Turm und treibt in ihrem Boot flussabwärts .«
»Und?«
Mit Marthas Sicherheit ist es schon wieder vorbei. »Und … sie stirbt.«
»Warum?«
Einige lachen nervös, aber niemand weiß eine Antwort.
Schließlich zerschneidet Felicitys messerscharfe Stimme die Stille. »Weil ein Fluch auf ihr liegt.«
»Nein, sie stirbt aus Liebe«, sagt Pippa im Brustton der Überzeugung. »Sie kann ohne ihn nicht l e ben. Es ist schrecklich romantisch.«
Miss Moore lächelt gequält. »Mehr schrecklich als romantisch.«
Pippa ist verwirrt. »Ich finde, es ist romantisch.«
»Man könnte darüber streiten, ob es romantisch ist, aus Liebe zu sterben. Denn dann ist man tot und kann nicht mehr in die Alpen reisen, um dort wie all die anderen el e ganten jungen Paare die Flitterwochen zu verbringen, was jammerschade ist.«
»Aber sie ist durch einen Fluch dem Untergang geweiht, stimmt’s?«, sagt Ann. »Nicht die Liebe ist schuld. Es liegt außerhalb ihrer Macht. Wenn sie den Turm verlässt, wird sie sterben.«
»Und trotzdem stirbt sie nicht, als sie den Turm verlässt. Sie stirbt auf dem Fluss. Interessant, nicht wahr? Hat sonst noch jemand eine Idee? Miss … Doyle?«
Ich erschrecke, als ich meinen Namen höre. Mein Mund wird trocken. Ich runzle die Stirn und starre intensiv auf das Bild, als erwarte ich, dass mir dabei eine Antwort in den Schoß fällt. Ich bin vollkommen ratlos.
»Bitte, strengen Sie Ihre Augen nicht so an, Miss Doyle. Ich möchte nicht, dass meine Mädchen im Namen der Kunst zu schielen beginnen.«
Allgemeines Gekicher. Ich weiß, ich sollte peinlich berührt s ein, stattdessen bin ich erleichtert, dass ich keine Antwort erfinden muss. Ich verkrieche mich wieder in mich selbst.
Miss Moore geht in der Klasse herum, vorbei an einem langen Tisch mit unfertigen Bildern, Farbtu ben, Bergen von Wasserfarben und Blechbechern voll Pinseln mit Ha a ren wie Stroh. In der Ecke steht ein Gemälde auf einer Staffelei. Es ist eine Naturst u die mit Bäumen, einer grünen Wiese und einem Kirchturm, haargenau die Szenerie, die wir draußen vor dem Fenster sehen. »Ich glaube, die Frau stirbt nicht deshalb, weil sie den Turm gegen die Welt dort draußen tauscht, sondern weil sie sich durch diese Welt treiben lässt, von der Strömung mitgerissen wie von einem Traum.«
Einen Moment lang ist es still, nichts ist zu hören außer dem Scharren der Füße unter den Pulten und dem leisen Trommeln von Anns Fingern auf dem Holz, als spiele sie Klavier.
»Meinen Sie, sie hätte rudern sollen?«, fragt Cecily.
Miss Moore lacht. »Sozusagen, ja.«
Ann hört auf zu trommeln. »Aber es würde keinen Unterschied machen, ob sie rudert oder nicht. Sie ist verflucht. Egal, was sie tut, sie muss sterben.«
»Und sie muss auch sterben, wenn sie im Turm bleibt. Vielleicht noch lange nicht. Aber sie muss sterben. Wie wir alle«, setzt Miss Moore leise hinzu.
Ann lässt nicht locker. »Aber sie hat keine Wahl. Sie kann nicht gewinnen.« Sie lehnt sich weit über ihr Pult und wir alle begreifen, dass sie nicht mehr nur von der Frau auf dem Bild spricht.
»Du meine Güte, Ann, es ist nur ein albernes Gedicht«, spottet Felicity und rollt mit den Augen. Die Jüngerinnen nicken und geben flüsternd ihren Senf dazu.
»Schhh, das genügt«, mahnt Miss Moore. »Ja, Miss Bradshaw, es ist nur ein Gedicht. Nur ein Bild.«
Plötzlich platzt Pippa aufgeregt heraus: »Aber Menschen können verflucht sein, oder nicht? Sie könnten irgendein Leiden haben, das sich ihrer Ko n trolle entzieht. Ist das nicht so?«
Etwas schnürt mir die Kehle zu, raubt mir den Atem. Ein Kribbeln erfasst meine Finger. Nein, ich lasse mich nicht hinunterziehen. Fort mit dir.
»Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen, Miss Cross. Ich nehme an, alles hängt davon ab, wie wir es schultern«, sagt Miss Moore sanft.
»Glauben Sie an Verwünschungen, Miss Moore?«, fragt Felicity. Es klingt wie eine Herausforderung.
Ich bin leer. Ganz leer. Ich fühle nichts, nichts, nichts. Mary Dowd oder wer immer du bist, bitte, lass mich in Ru he.
Miss Moore erforscht die Wand hinter uns, als könnte sich die Antwort dort zwischen den Pastell zeichnungen und Aquarell-Stillleben versteckt h a ben. Rotbäckige Äpfel. Saftige Trauben. Lichtgesprenkelte Orangen. Sie alle fa u len in einer Schale langsam vor sich hin. »Ich glaube …« Ihre Stimme verliert sich. Ihr Blick wirkt abwesend. Ein leichter Wind weht durch das offene Fenster herein und wirft einen Becher mit Pinseln um. Das Kribbeln in me i nen Fingern hört auf. Für diesmal bin ich gerettet. Die angeha l tene Luft strömt in einem Schwall he r aus.
Miss Moore stellt die Pinsel wieder auf. »Ich glaube … wir werden diese Woche einen Waldsp a ziergang machen und die alte Höhle erforschen, in der es einige sehr erstau n liche primitive Felszeic h nungen gibt. Die können Ihnen weit mehr über Kunst erzählen, als ich es kann.«
Die Klasse bricht in einen Sturm der Begeisterung aus. Wir können das Glück, aus dem Klassenzimmer herausz u kommen, kaum fassen. Doch beim Geda n ken an meinen eigenen Ausflug zu der Höhle und an das Tagebuch von Mary Dowd, das noch immer hinten in meinem Kleide r schrank liegt, beschleicht mich ein Gefühl des Unbeh a gens.
»Eben, es ist ein viel zu schöner Tag, um hier drinnen zu sitzen und über verwunschene Fräuleins in Booten zu dis kutieren. Sie können Ihre Pause jetzt beginnen, und wenn Sie gefragt werden, dann wollen Sie sich nur studienhalber, zur künstlerischen Insp i ration, in der freien Natur umsehen. Und dafür«, sagt sie und betrachtet prüfend ihre Zeic h nung, »ist etwas nötig.«
Mit Schwung malt Miss Moore der Lady von Shalott einen adretten Schnurrbart. »Gott findet man im Detail«, sagt sie.
Mit Ausnahme von Cecily, die mir ein stilles Wasser zu sein scheint, kichern wir über Miss Moores Kühnheit und freuen uns wie verrückt, mit ihr zusammen etwas Une r laubtes zu tun. Miss Moores Lä cheln breitet sich über ihr ganzes Gesicht aus und mein Unbehagen verflüchtigt sich.
Als ich in mein Zimmer stürze, um Mary Dowds Tagebuch hervorzuholen, knalle ich gegen die Keh r seite von Brigid, die gerade dabei ist, ein neues Zimmermädchen für die oberen Stockwerke in ihr Arbeitsgebiet einzuführen.
»Tut mir schrecklich leid«, sprudle ich so würdevoll hervor, wie es mir, mit hochgerutschten Röcken lang am Boden liegend, möglich ist. In Brigids Rü cken zu rennen ist ungefähr so, als würde man sich gegen die Breitseite eines Schiffs werfen. Mein Kopf dröhnt und ich fürchte, durch die Wucht des Au f pralls taub zu werden.
»Tut Ihnen leid? Jawoll, das soll es auch«, sagt Brigid, während sie mich auf meine Füße zerrt und meinen Rock saum auf schickliche Höhe herunterzieht. Das neue Zi m mermädchen dreht sich weg, aber ich sehe, wie ihre schm a len Schultern vor u n terdrücktem Lachen zucken.
Ich öffne den Mund, um Brigid für ihre Hilfe zu danken, aber sie hat ihre Strafpredigt gerade erst be gonnen.
»Was is’n das für eine Art, reinzugaloppieren wie ein Hengst ! Jetzt frag ich Sie, ist das ein Benehmen für eine anständige junge Dame? Hmmm? Was würde Mrs Nigh t wing sagen, wenn sie sieht, wie Sie sich hier aufführen?«
»Es tut mir leid.« Ich schaue auf meine Füße hinunter und hoffe, dass das als Zerknirschung gedeutet werden kann.
Brigid macht ein schnalzendes Geräusch. »Na, ich bin froh, dass es Ihnen leidtut. Warum hatten Sie’s denn so e i lig, hmmm? Sehn Sie bloß zu, dass Sie der alten Brigid die Wahrheit sagen. Nach mehr als zwanzig Jahren hier hab ich scharfe Augen, o ja, die hab ich.«
»Ich habe mein Buch vergessen«, sage ich und gehe rasch zum Kleiderschrank. Ich schnappe mir mein Cape und lasse das Tagebuch darin verschwinden.
»Da wird man über den Haufen gerannt, dass man schon die Engel singen hört, und alles nur wegen ei nem Buch«, brummt Brigid, als hätte sie und nicht ich vor ein paar Mi nuten benommen am Boden gel e gen.
»Tut mir leid, dass ich Sie gestört habe. Ich bin schon weg«, sage ich und versuche, an Brigid vor beizuschlüpfen.
»Halt, einen Moment noch. Wollen erst sehn, ob Sie präsentabel sind.« Brigid nimmt mein Kinn und dreht mein Gesicht zum Licht, um es zu inspizieren. Das Blut weicht aus ihren Wangen.
»Was ist denn?«, frage ich. Kann es sein, dass ich schlimmer verletzt bin, als ich dachte? Brigids Kehr seite mag zwar gewaltig sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich von dem Zusammenprall einen blutenden Kopf davongetragen habe.
Brigid lässt mein Kinn los, weicht einen Schritt zurück und wischt die Hände an ihrer Schürze ab, als wären sie schmutzig. »Nichts. Nur … Ihre Augen sind sehr grün. Das ist alles. Nun gehn Sie schon. Sehn Sie zu, dass Sie die a n dern einholen.« Und damit wendet sie ihre Aufmerksa m keit dem neuen Zimmermädchen zu, das offensichtlich se i nen Staubwedel verkehrt herum einsetzt, und ich bin en t lassen und kann meiner Wege gehen.