22. Kapitel
Ich soll meine Fähigkeiten nicht nutzen. Ich soll nicht wi l lentlich in eine Vision fallen. Das Magische Reich ist seit mehr als zwanzig Jahren verschlossen, seitdem das, was mit Mary und Sarah passiert ist, alles veränderte. Aber wenn ich diesen Weg nicht b e schreite, sehe ich meine Mu t ter niemals wieder. Werde ich nie etwas verstehen. In meiner Magengr u be, wo Vorsätze zu Entscheidungen reifen, weiß ich schon, dass ich diese u n gewisse Reise antreten werde. Diese Gedanken schwirren mir durch den Kopf, während ich mit den and e ren in der dunklen Höhle sitze. Es ist stickig und feucht. Der nächt l i che Regen hat die Luft nicht abgekühlt. Ta t sächlich hat er die ungebrochene Hitze schwül und unerträglich g e macht.
Felicity liest den nächsten Abschnitt aus Marys Tagebuch vor, aber ich kann nicht viel davon au f nehmen. Heute Nacht wird sich mein Geheimnis o f fenbaren und jede Faser meines Körpers ist erwa r tungsvoll angespannt.
Felicity klappt das Tagebuch zu. »Also schön, was ist so eilig?«
»Ja«, sagt Pippa missmutig. »Warum konnte das nicht bis morgen warten?«
»Eben darum«, sage ich. Meine Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Jedes Geräusch dröhnt doppelt laut in meinen Ohren. »Was, wenn ich euch sage, dass der Orden des au f gehenden Mondes real ist? Dass es das Magische Reich wirklich gibt?« Ich atme tief ein. »Und dass ich weiß, wie man dorthin kommt?«
Pippa rollt mit den Augen. »Deswegen hast du uns in diese fürchterliche, schwüle Nacht herausgelockt? Um Scherze mit uns zu treiben?«
Ann schnaubt und nickt Pippa zu, um ihre Solidarität mit ihrer neuen besten Freundin zu bekunden. Felicity fängt meinen Blick auf. Sie merkt, dass eine Veränderung mit mir vorgegangen ist.
»Ich glaube nicht, dass Gemma scherzt«, sagt sie ruhig.
»Ich habe ein Geheimnis«, sage ich schließlich. »Es gibt etwas, was ich euch erzählen muss.«
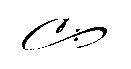
Ich erzähle ihnen alles: von der Ermordung meiner Mutter; meinen Visionen; was geschehen ist, als ich Sally Carnys Hand hielt und in einem dunklen, von Nebel erfüllten Wald landete; vom Tempel und der Stimme meiner Mutter. Das Einzige, was ich für mich behalte, ist die Sache mit Kartik. So weit bin ich noch nicht.
Als ich geendet habe, schauen sie mich an, als sei ich wahnsinnig. Oder wundervoll. Ich bin nicht si cher.
»Du musst uns mitnehmen«, sagt Felicity.
»Ich weiß nicht mit Gewissheit, wo wir dort landen werden. Ich weiß überhaupt nichts mit Gewis s heit, nicht mehr«, antworte ich.
Felicity streckt ihre Hand aus. »Ich bin bereit, es zu riskieren.«
Ich bemerke ein Symbol ganz unten an der Höhlenwand, das mir bisher noch nicht aufgefallen ist. Es ist schon zie m lich verblasst, aber im Wesentlichen noch zu erkennen. Ei ne Frau und ein Schwan. Auf den ersten Blick scheint es, als würde die Frau von dem großen weißen Vogel ang e griffen, aber bei n ä herer Betrachtung zeigt sich, dass die Frau und der Schwan zu einer Gestalt verschmolzen sind. Ein gr o ßes mythologisches Geschöpf. Eine Frau, die bereit ist zu fliegen, selbst um den Preis, ihre Beine zu ve r lieren.
Ich ergreife Felicitys ausgestreckte Hand. Ihre Finger, die sich in meine flechten, sind stark.
»Gehen wir«, sage ich.

Wir zünden Kerzen an, stellen sie in die Mitte und schließen den Kreis um die brennenden Lichter, i n dem wir uns an den Händen fassen.
»Was tun wir jetzt?«, fragt Felicity.
»Ich habe bisher nur einmal ausprobiert, es bewusst zu steuern, und das war heute Abend, als es mir gelungen ist zurückzukommen«, sage ich wa r nend. Ich möchte sie nicht enttäuschen. Was ist, wenn es misslingt und sie denken, ich habe alles nur erfunden?
Pippa macht als Erste einen Rückzieher. »Scheint mir ein bisschen brenzlig. Vielleicht sollten wir das lieber sein lassen.« Niemand antwortet ihr. »Bist du nicht auch dieser Meinung, Ann?«
Ich erwarte, dass Ann ihr zustimmt, aber sie sagt kein Wort.
»Also gut. Aber wenn sich das Ganze als ein ausgekochter Schwindel herausstellt, werde ich lachen und kein bis s chen Mitleid mit euch haben.«
»Hör nicht auf das, was sie sagt«, flüstert mir Felicity zu.
Wie sollte ich nicht darauf hören? Ich habe selbst Angst.
»Meine Mutter sagte, ich soll mich auf das Bild eines Tores konzentrieren …«, sage ich und vers u che so, meine Zweifel zu zerstreuen.
»Was für ein Tor?«, will Ann wissen. »Ein rotes Tor, ein hölzernes Tor, groß, klein …?«
Pippa seufzt. »Sag ihr schon, was für eins, sonst kann sie sich nicht konzentrieren. Du weißt, sie muss die Regeln kennen, bevor wir anfangen.«
»Ein Tor aus Licht«, sage ich. Damit ist Ann zufrieden. Ich hole tief Luft. »Schließt die Augen.«
Muss ich irgendetwas sagen, um uns auf den Weg zu bringen? Und wenn ja, was? In der Vergangenheit bin ich gefallen, wurde in jenen Tunnel hinunterg e zogen. Aber dieses Mal ist es anders. Wie soll ich anfangen? Statt nach den richtigen Worten zu s u chen, schließe ich die Augen und lasse die Worte mich finden.
»Ich will es.«
In den Ecken der Höhle beginnt es zu flüstern. Das Flüstern s chwillt zu einem lauten Summen an. In der nächsten Sekunde gähnt unter mir ein Abgrund. Fel i city hält meine Hand fester. Pippa ringt keuchend nach Luft. Sie haben Angst. Ein Kribbeln läuft meine Arme entlang, verbindet mich mit den anderen. Ich könnte jetzt aufhören. Kartik gehorchen und das hier beenden. Aber ich muss wissen, was auf der anderen Seite ist, um jeden Preis. Das Summen verstummt und schlägt um in einen Schauder, der meinen Körper wie eine Melodie durchströmt, und als ich die A u gen öffne, ist da die strahlende Silhouette eines Tors aus Licht, es flimmert und winkt, als wäre es die ganze Zeit da und wartete nur darauf, dass ich es finde.
Anns Gesicht ist völlig verklärt. »Sagenhaft …«
»Seht ihr das …?«, fragt Pippa staunend.
Felicity versucht, das Tor zu öffnen, aber ihre Hand fasst ins Leere. Das Tor ist wie eine Projektion in einer Laterna-magica-Schau. Keine von ihnen kann es öffnen.
»Gemma, versuch du es«, sagt Felicity.
Im weiß glühenden Licht des Tors erscheint meine Hand wie die eines anderen – die Hand eines Engels. In meinen Fingern fühlt sich der Knauf fest und warm an. Etwas tritt aus der Oberfläche des Tors hervor. Ein Umriss. Die Rä n der leuchten stärker und nun kann ich die vertrauten Ko n turen des Monda u ges sehen. Das Medaillon an meinem Hals glüht wie sein Spiegelbild am Tor, als begrüßten sie einander. Plötzlich lässt sich der Knauf in meiner Hand ganz leicht drehen.
»Du hast es geschafft«, sagt Ann.
»Ja, wie ihr seht, hab ich’s geschafft.« Ich lächle trotz meiner Angst.
Das Tor öffnet sich und wir betreten eine Welt, so strahlend und in so leuchtenden Farben, dass ich von ihrem A n blick geblendet bin.
Als sich meine Augen an den Glanz gewöhnt haben, erkenne ich Einzelheiten. Da gibt es Bäume, die an ihren Zweigen grüngoldene und korallenrote Blä t ter tragen. Der rötlichblaue Himmel spannt sich über einem in orangefa r bene Glut getauchten Horizont, wie ein Sonnenuntergang, der niemals verblasst. Winzige lavendelblaue Blüten schweben vorbei, von einem lauen Windhauch getragen, der schwach nach meiner Kindheit duftet –nach Lilien und Vaters Tabak und Curry in Saritas Küche. Das breite si l berne Band eines Flusses durchschneidet das Bild und trennt das taubenetzte Gras, auf dem wir stehen, von einem Sandstrand am anderen Ufer.
Pippa berührt leicht ein Blatt mit ihrem Finger. Es rollt sich von selbst ein und verwandelt sich in einen Schmetter ling, der himmelwärts flattert. »Oh, es ist alles so schön.«
»Unbeschreiblich«, sagt Ann.
Blüten regnen herab, schmelzen in unserem Haar wie dicke Schneeflocken.
Felicity wirbelt wie ein Kreisel herum, überwältigt von Glück. »Es ist wirklich! Das alles ist wirklich!« Sie bleibt stehen. »Riechst du das?«
»Ja«, sage ich und atme das tröstliche Aroma von Kindheitsgerüchen tief ein.
»Rosinenbrötchen. Die gab es jeden Sonntag. Und Seeluft. Ich roch sie immer an Vaters Uniform, wenn er von einer Reise nach Hause kam. Als er noch nach Hause kam.« Felicitys Augen schwimmen in Tr ä nen.
Pippa schüttelt den Kopf. »Nein, du irrst dich. Es duftet nach Flieder. Wie die Zweige aus dem Garten, die ich in einer Vase in meinem Zimmer hatte.«
Der intensive Geruch von Rosenwasser liegt in der Luft.
»Was ist das?«, fragt Pippa.
Eine einfache Melodie dringt an mein Ohr. Eins der Schlummerlieder meiner Mutter. Es kommt aus einem Tal zu uns herauf. Ich kann nur einen silbe r nen Torbogen und einen Weg erkennen, der in einen üppigen Garten führt.
»He, warte, wo willst du denn hin?«, ruft mir Pippa nach.
»Ich bin gleich wieder zurück«, sage ich und gehe immer schneller, laufe, renne Mutters Stimme entg e gen. Durch den silbernen Bogen lande ich inmitten hoher, von Bäumen durchbrochener Hecken. Und dort, genau in der Mitte, sitzt sie in ihrem blauen Kleid, ruhig und lächelnd. Und wartet auf mich.
Meine Stimme schwankt. »Mutter?«
Sie streckt mir ihre Arme entgegen und ich furchte, dass ich am Ende wieder einem Traum nachlaufen werde. Aber diesmal sind es wirklich ihre Arme, die mich umfangen. Ich kann das Rosenwasser auf ihrer Haut riechen.
Alles verschwimmt vor meinen Augen. »Oh, Mutter, du bist es. Du bist ’s wirklich.«
»Ja, Liebling.«
»Warum bist du so lange vor mir weggerannt?«
»Ich war die ganze Zeit hier. Du warst diejenige, die gerannt ist.«
Ich verstehe nicht, was sie meint, aber das spielt keine Rolle. Es gibt so viel, was ich sagen möchte. So viel, was ich fragen möchte. »Mutter, es tut mir leid.«
»Schhh«, sagt sie und streicht mein Haar glatt. »Das alles ist Vergangenheit. Komm. Lass uns einen Spaziergang machen.«
Sie führt mich durch eine Grotte, vorbei an einem weiten Kreis hoher, schlanker Kristalle, zerbrechlich wie Glas. Wieder draußen sehe ich ein Reh umhe r springen. Es bleibt stehen, um an den Beeren in Mu t ters hohler Hand zu schnuppern. Es nascht davon und wendet mir dabei seine sanften braunen Augen zu. Furchtlos bahnt es sich langsam seinen Weg durch hohes, üppiges Gras und lässt sich unter einem Baum mit einem breiten, knorrigen Fuß nieder. In mir streiten sich so viele Fragen, dass ich nicht weiß, mit welcher ich anfangen soll.
»Was genau ist das Magische Reich?«, frage ich. Das Gras fühlt sich so verlockend an, dass ich mich darin auf die Seite lege, den Kopf in meine Handfl ä che gestützt.
»Eine Reich aus vielen verschiedenen Welten. Ein Ort, wo alles möglich ist.« Mutter setzt sich nieder. Sie pustet die Samen eines Löwenzahns fort. Ein Schneegestöber weißer Schirmchen zerstiebt im Lufthauch. »Der Ort, wo sich der Orden des aufg e henden Mondes einfand, um in sich zu gehen und die Dinge zu überdenken; um seine Ma gie und s ich selbst anzuspornen, um durchs Feuer zu gehen und neu zu erstehen. Jeder kommt von Zeit zu Zeit hie r her –im Traum, bei der Geburt von Ideen.« Sie macht eine Pause. »Im Tod.«
Meine Beine werden schwach. »Aber du bist nicht …« Tot. Ich bringe mich nicht dazu, es auszuspr e chen. »Du bist hier.«
»Ja, jetzt.«
»Woher weißt du das alles?«
Mutter dreht sich von mir weg. Sie streichelt die Nase des Rehs mit beruhigenden, sanften Strichen. »Zuerst wusste ich gar nichts. Als du fünf warst, kam eine Frau zu mir. Ein Mitglied des Ordens. Die sagte mir alles. Dass du etwas Besonderes seist –das ihnen verheißene Mädchen, das die Zauberkunst des Magischen Reichs wiedererw e cken und dadurch dem Or den seine Macht zurückgeben könne.« Sie hält inne.
»Was ist?«
»Sie sagte mir auch, dass Circe nie aufhören würde, nach dir zu suchen, um die Macht der Magie allein für sich zu be halten. Ich hatte Angst, Gemma. Ich wollte dich beschü t zen.«
»Ist das der Grund, warum du mich nicht nach London lassen wolltest?«
»Ja.«
Magie. Der Orden des aufgehenden Mondes. Ich, das ihnen verheißene Mädchen. Mein Kopf kann das alles kaum fassen.
Ich schlucke schwer. »Mutter, was geschah an jenem Tag, in dem Laden? Was war dieses … dunkle Etwas?«
»Einer von Circes Spionen. Ihr Spürhund. Ihr Mordgeselle.«
Ich kann sie nicht ansehen. Ich falte einen Grashalm zu einer Ziehharmonika. »Aber warum hast du …«
»Warum ich mich getötet habe?« Ich schaue hoch und begegne wieder diesem durchdringenden Blick, den ich so gut kenne. »Damit er keinen Anspruch auf mich erheben kann. Hätte er mich lebend in seine Fänge bekommen, w ä re ich verloren gewesen, ein dunkler Schatten wie er.«
»Und Amar?«
Mutters Mund nimmt einen gespannten Zug an. »Er war mein Beschützer. Er hat sein Leben für mich geopfert.«
Mich schaudert, wenn ich mir vorstelle, was aus Kartiks Bruder geworden sein mag.
»Machen wir uns damit jetzt nicht das Herz schwer«, sagt Mutter, während sie mir ein paar ver irrte Haarsträhnen aus dem Gesicht streicht. »Ich werde dir sagen, was ich weiß. Wenn du alles erfa h ren willst, musst du die anderen aufsuchen, um den Orden neu zu gründen.«
Ich setze mich auf. »Es gibt andere?«
»O ja. Als das Magische Reich geschlossen wurde, sind alle Eingeweihten untergetaucht. Manche haben vergessen, was sie wussten. Andere haben sich d a von losgesagt. Aber einige sind dem Orden treu geblieben und warten auf den Tag, an dem die Pfo r ten wieder geöffnet werden und sie sich die Magie wieder zu eigen machen können.«
Schwankende Grashalme kitzeln meine Fingerspitzen. Alles scheint so unwirklich – der Sonnenuntergangshi m mel, der Blütenregen, die laue Brise und meine Mutter, zum Greifen nahe. Ich mache meine Augen zu und wieder auf. Sie ist immer noch da.
»Was ist?«, fragt Mutter.
»Ich fürchte, dass das hier nicht wirklich ist. Es ist doch wirklich, nicht wahr?«
Mutter wendet ihr Gesicht dem Horizont zu. Der warme Schein macht die harten Linien ihres Profils weich. »Reali tät ist eine Frage der Geisteshaltung. Für den Bankier ist das Geld in seinem Hauptbuch ganz real, obwohl er es nicht tatsächlich sieht oder in Händen hält. Aber für den Brahmanen ist es einfach nicht in gleicher Weise existent, wie es die Luft und die Erde, Schmerz und Verlust sind. Für ihn ist die Realität des Bankiers eine Täuschung. Für den Ba n kier sind die Ideen des Brahmanen so belanglos wie Staub.«
Ich schüttle den Kopf. »Ich bin ganz durcheinander.«
»Erscheint es dir wirklich?«
Der Wind bläst mir Haarsträhnen ins Gesicht, dass es kitzelt, und durch meinen Rock spüre ich die Feuchtigkeit des taunassen Grases. »Ja«, sage ich.
»Na also.«
»Wenn jeder von Zeit zu Zeit hierherkommt, warum spricht dann niemand darüber?«
Mutter zupft Pusteblumenflaum von ihrem Rock. Er schwebt und funkelt in der Sonne wie zerstoßene Edelstei ne. »Sie erinnern sich nicht daran, außer an Fragmente e i nes Traums, die sich nicht zu einem Ganzen zusammenf ü gen lassen, wie sehr sie sich auch bemühen. Nur die Mi t glieder d es Ordens kon n ten den Eingang durch das Tor finden. Und jetzt du.«
»Ich habe meine Freundinnen mitgebracht.«
Sie macht erstaunte Augen. »Es ist dir ganz von selbst gelungen, sie hierher zu bringen?«
»Ja«, sage ich unsicher. Ich fürchte, ich habe einen Fehler gemacht, aber langsam breitet sich ein glüc k strahlendes Lächeln über Mutters Gesicht.
»Deine magische Kraft ist sogar noch größer, als der Orden gehofft hatte.« Plötzlich runzelt sie die Stirn. »Ve r traust du ihnen?«
»Ja«, sage ich. Aus irgendeinem Grund bin ich über ihren Zweifel verärgert. Er bewirkt, dass ich mich wieder wie ein kleines Kind fühle. »Natürlich vertraue ich ihnen. Sie sind meine Freundinnen.«
»Sarah und Mary waren Freundinnen. Und sie haben einander verraten.«
In der Ferne kann ich Felicitys Freudengeschrei hören, dann das von Ann. Sie rufen meinen Namen.
»Was ist mit Sarah und Mary passiert? Ich sehe andere Geister. Warum kann ich mit den beiden kei ne Verbindung aufnehmen?«
Ein Käfer krabbelt über meine Fingerknöchel. Ich zucke zusammen. Mutter entfernt ihn sacht und er verwa n delt sich in ein Rotkehlchen, das auf zarten Beinen u m herhüpft.
»Sie existieren nicht mehr.«
»Wie meinst du das? Was ist mit ihnen geschehen?«
»Verschwenden wir nicht die Zeit damit, von der Vergang enheit zu reden«, sagt Mutter abweisend. Sie lächelt mich an. »Ich möchte dich nur ansehen. Me i ne Güte, du wirst schon eine junge Frau.«
»Ich lerne Walzertanzen. Ich bin nicht besonders gut darin, aber ich bemühe mich und ich denke, bis zu unserem ersten Tanztee sollte ich es schon einigermaßen beher r schen.« Ich möchte ihr alles sagen. Es sprudelt einfach aus mir heraus. Sie hört mir so aufmerksam zu, dass ich mir wünsche, der Tag wü r de nie zu Ende gehen.
Ein Büschel dicker, runder Blaubeeren liegt einladend in einer Mulde im Boden. Bevor ich eine Beere in den Mund stecken kann, nimmt Mutter sie mir aus der Hand. »Die darfst du nicht essen, Gemma. Sie sind nicht für die Le benden.« Mutter sieht die Ve r wirrung in meinen Augen. »Wer diese Beeren isst, wird Teil dieser Welt. Er kann nicht wieder zurück.«
Sie gibt den Beeren einen Stoß mit ihrem Fuß und sie landen vor dem Reh, das sie gierig verschlingt. Mutter blickt zu dem kleinen Mädchen –dem aus meinen Visi o nen. Es versteckt sich hinter einem Baum.
»Wer ist das?«, frage ich.
»Meine Helferin«, sagt Mutter.
»Wie heißt sie?«
»Ich weiß es nicht.« Mutter kneift ihre Augen ganz fest zu, als kämpfe sie gegen einen Schmerz.
»Mutter, was ist mit dir?«
Sie macht die Augen wieder auf, aber sie wirkt blass. »Nichts, ich bin ein wenig müde von all der Aufregung. Es ist jetzt Zeit für dich zu gehen.«
Ich rapple mich hoch. »Aber es gibt noch so vieles, was ich wissen muss.«
Mutter steht auf, legt mir ihre Arme um die Schultern. »Deine Zeit ist für heute um, Liebes. Die Kraft dieses Ortes ist sehr stark. Sie muss in kleinen Dosen aufgenommen werden. Sogar die Frauen des Ordens kamen nur hierher, wenn es notwendig war. Vergiss nicht, dass dein Platz dort draußen ist.«
Meine Kehle brennt. »Ich will nicht weg von dir.«
Ihre Finger berühren meine Wangen so leicht wie der leiseste Hauch und ich kann die Tränen nicht zu rückhalten. Sie küsst mich auf die Stirn, dann neigt sie den Kopf, um mir direkt ins Gesicht zu sehen. »Ich werde dich nie verla s sen, Gemma.«
Sie dreht sich um und steigt den Hügel hinauf, die Hand des Kindes in ihrer. Sie gehen dem Sonnenuntergang ent gegen, bis sie mit ihm verschmelzen und nichts mehr bleibt als das Reh und ich und der for t dauernde Duft von Rosen.
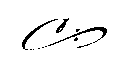
Als ich zu meinen Freundinnen zurückkomme, tollen sie herum wie glückliche Irre.
»Seht euch das an!«, sagt Felicity. Sie bläst sanft gegen einen Baum und seine Rinde wechselt von Braun zu Blau zu Rot und wieder zurück.
»Schaut her!« Ann schöpft Wasser aus dem Fluss und es wird in ihren Händen zu goldenem Staub. »Habt ihr das gesehen?«
Pippa räkelt sich in einer Hängematte. »Weckt mich, wenn es Zeit ist zu gehen. Halt, ich hab mir’s anders übe r legt, nein, weckt mich nicht. Der Traum ist zu göttlich.« Sie streckt die Arme über den Kopf, lässt ein Bein über den Rand der Hängematte baumeln und macht es sich gemü t lich.
Ich bin überdreht und erschöpft. Ich möchte auf mein Zimmer gehen und hundert Jahre schlafen. Und ich möchte zurück in das Tal und für immer dort bei meiner Mutter bleiben.
Felicity legt ihren Arm um mich. »Wir müssen einfach morgen wiederkommen. Stell dir vor, die eingebildete Ce cily könnte uns jetzt sehen. Bestimmt würde es ihr leidtun, dass sie nicht mitmachen wol l te.«
Pippa lässt einen Arm herabfallen, um ein paar Beeren zu pflücken.
»Nicht!«, schreie ich und schlage sie ihr aus der Hand.
»Warum nicht?«
»Wenn du sie isst, musst du für immer hierbleiben.«
»Kein Wunder, dass sie so verlockend aussehen«, sagt sie.
Ich strecke meine Hand aus. Unwillig lässt sie die restlichen Beeren hineinfallen und ich werfe sie in den Fluss.