21. Kapitel
Auf dem von Hand geschriebenen Plakat vor dem elegan ten Wohnhaus in Grosvenor Square steht:
Ein Abend der Theosophie und des Spiritismus
Mit Madame Romanoff, Grossseherin von
Sankt Petersburg
Sie weiss alles
Sie enthüllt alles
Nur eine Vorstellung
Die Straßen von London gleichen einem impressionistischen Gemälde, mit ihrem glitschigen Kop f steinpflaster, orangefarbenen Straßenlaternen, sorgsam gestutzten He cken und Trauben schwarzer Re genschirme. Pfützenwasser bespritzt meinen Roc k saum und zieht ihn durch die Nässe beschwert nach unten. Wir flüchten uns in das offene Haustor, unsere dünnen Ausgehschuhe hinterlassen zierl i che Abdr ü cke auf dem Pflaster.
Das Publikum hat sich herausgeputzt, man zeigt, wer man ist. Die Männer tragen Smoking und Zyli n der. Die Frauen p räsentieren ihre Edelsteine und te u re Handschuhe. Wir haben ebenfalls unsere allerbe s ten Sachen an. Es ist ein seltsames, wundervolles Ge fühl, in Seidenkleidern mit Unterröcken daherz u kommen statt in unseren gewohnten Schuluniformen. Cecily hat die Gelege n heit genutzt, einen neuen Hut auszuführen. Er steht ihr überhaupt nicht, aber er ist der letzte Modeschrei und sie hat sich in den Kopf gesetzt, ihn zu tragen. Mademoiselle LeFarge hat ihren schönsten Son n tagsstaat angelegt, ein grünes Seidenkleid mit einem hohen Rüschenkragen, eine grüne Seidenhaube und ein Paar lange Granatohrri n ge, und wir sparen nicht mit Worten der Bewund e rung.
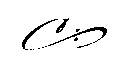
»Sie sehen einfach fantastisch aus«, sagt Pippa, als wir das eindrucksvolle, von aufmerksamen Butlern wimmelnde Marmorfoyer betreten.
»Danke, meine Liebe. Es ist immer wichtig, das Beste aus sich zu machen.«
Cecily strahlt, sie ist überzeugt, das Kompliment gelte ihr.
Durch schwere Vorhänge werden wir in einen Vortragssaal geführt, der gut zweihundert Personen fasst. Pippa ve r renkt sich den Hals, um das Publikum zu inspizieren. »Seht ihr hier irgendwelche attrakt i ven Männer? Irgendjemand unter vierzig?«
»Ehrlich«, sagt Felicity verächtlich, »dich interessiert selbst am Jenseits in erster Linie, ob du dort e i nen Mann finden kannst.«
Pippa zieht einen Schmollmund. »Mademoiselle LeFarge nimmt das sehr ernst und ich habe noch nie bemerkt, dass du dich über sie lustig machst !«
Felicity rollt mit den Augen. »Mademoiselle LeFarge hat uns aus Spence herausgeholt und an eine der vornehmsten Adressen Londons geführt. Von mir aus könnte sie sich die Augen nach Heinrich dem Achten ausschauen. Außerdem haben wir eine Mi s sion, wie du weißt.«
Mademoiselle LeFarge lässt ihre üppige Fülle in einen roten Polstersessel gleiten und wir verteilen uns um sie herum. Die Leute nehmen langsam ihre Plätze ein. Vorne ist eine kleine Bühne aufgebaut, mit einem Tisch und zwei Stühlen. Auf dem Tisch liegt eine Kristallkugel.
»Mithilfe dieser Kristallkugel nimmt sie Kontakt mit den Geistern der Verstorbenen auf«, flüstert uns Mademoiselle LeFarge zu, während sie das Pr o gramm studiert. Ein Herr hinter uns hört, was wir flüstern, und beugt seinen Kopf zu Mademoiselle LeFarge.
»Meine Gnädigste, leider muss ich Ihnen sagen, dass das alles ein Schwindel ist. Zaubertricks, sonst nichts.«
»O nein, Sir, Sie irren sich«, schaltet sich Martha ein. »Mademoiselle LeFarge hat selbst gesehen, wie Madame Romanoff in einem Trancezustand gespr o chen hat.«
»Wirklich?«, fragt Pippa und macht große Augen.
»Ich habe über ihre seherische Gabe von einer Cousine gehört, die eine enge Vertraute einer guten Freundin der Schwägerin von Lady Dorchester ist«, erklärt Mademoise l le LeFarge. »Sie ist ein wahrhaft bemerkenswertes Med i um.«
Der Herr lächelt. Sein Lächeln ist freundlich und warmherzig, genau wie Mademoiselle LeFarge. Schade, dass sie verlobt ist, denn der Mann gefällt mir und ich denke, er würde einen reizenden Eh e mann abgeben.
»Ich bedaure, liebe gnädige Frau, liebe Mademoiselle«, sagt er, das Wort in die Länge ziehend, »dass Sie getäuscht worden sind. Spiritismus ist genauso wenig eine Wisse n schaft wie Diebstahl. Kurz gesagt –für ein Fünkchen Hoffnung stehlen sehr geschickte Gauner Geld von den Hinterbliebenen. Die Me n schen sehen genau das, was sie sehen wollen, um weiterleben zu können.«
Mir zieht sich das Herz in der Brust zusammen. Sehe ich meine Mutter nur, weil ich sie sehen will? Kann Trauer so übermächtig sein? Und trotzdem, der Streifen Stoff. Ich kann nur hoffen, dass ich bis zum Ende des Abends über irgendetwas Gewissheit haben werde.
Mademoiselle LeFarges Mund ist ein dünner Strich. »Sie sind im Irrtum, Sir.«
»Ich habe Sie aus der Fassung gebracht. Bitte verzeihen Sie. Inspektor Kent von Scotland Yard.« Er überreicht ihr eine geprägte Visitenkarte, die anzunehmen sie sich we i gert. Gelassen steckt er sie in seine Brusttasche zurück. »Gewiss sind Sie hier, um Kontakt mit einem geliebten Menschen aufzunehmen? Einem Bruder oder einem ve r storbenen Co u sin, der Ihnen lieb und teuer war?« Er sucht einen Anknüpfungspunkt, aber Mademoiselle LeFarge merkt nicht, dass er an mehr interessiert ist als an ihrer Voreingenommenheit für das Okkulte.
»Ich bin lediglich aus wissenschaftlichem Interesse und als Begleiterin meiner Schützlinge hier. Und wenn Sie jetzt bitte entschuldigen wollen, die Seance scheint gleich zu beginnen.«
Männer eilen an beiden Seiten des Raums entlang, um die Lichter zu dämpfen. Sie tragen schwarze Hemden mit hohen Kragen und dunkelrote Schärpen um die Mitte. Eine stattliche Frau in einem lang fließenden, tannengrünen Gewand betritt die Bühne. I h re Augen sind kohlschwarz umrahmt und auf ihrem Kopf prangt ein Turban mit einer einzelnen Pfaue n feder. Madame Romanoff.
Sie schließt die Augen und hebt eine Hand, lässt sie über die Köpfe des Publikums wandern, als fühle sie uns. Als sie die linke Seite des großen Raums e r reicht, öffnet sie die Augen und heftet ihren Blick auf einen klobigen Mann in der zweiten Reihe.
»Sie, Sir. Die Geister wünschen mit Ihnen zu kommunizieren. Bitte kommen Sie und nehmen Sie neben mir Platz«, sagt sie mit einem schweren russ i schen Akzent.
Der Mann gehorcht und setzt sich an den Tisch. Madame Romanoff starrt in die Kristallkugel und ihre Glieder wer den schlaff. In diesem Zustand spricht sie zu dem Mann. »Ich habe eine Botschaft für Sie von der anderen Seite …«
Der Mann auf der Bühne beugt sich gespannt, vor Aufregung schwitzend, nach vorn. »Ja! Ich höre. Ist sie von meiner Schwester? Bitte, Dora, bist du es?«
Madame Romanoffs Stimme klingt hell und lieblich wie die eines kleinen Mädchens. »Johnny, bist du ’s?«
Ein Schrei der Freude und Verzückung entfährt den Lippen des Mannes. »Ja, ja, ich bin es, meine liebste, liebste Schwester!«
»Johnny, du brauchst nicht zu weinen. Ich bin sehr glücklich hier, mit all meinen Spielsachen um mich her um.«
Wir lauschen staunend, mit offenem Mund. Dort vorn auf der Bühne feiern der Mann und seine kleine Schwester eine herzzerreißende Wiedervereinigung, mit Tränen und Versicherungen unsterblicher Liebe. Ich kann kaum stil l sitzen. Ich möchte, dass es bald zu Ende ist, damit ich den Platz des Mannes einne h men kann.
Der Inspektor hinter uns beugt sich vor und sagt: »Glänzende Vorstellung. Dieser Mann ist natürlich ein Kompl i ze.«
»Wie das?«, fragt Ann.
»Sie geben ihm einen Platz im Publikum, sodass er wie ein ehrlich Betroffener erscheint. Aber in Wirklichkeit spielt er nur seine Rolle.«
»Wenn Sie erlauben, Sir?« Mademoiselle LeFarge fächert sich mit ihrem Programm Luft zu.
Inspektor Kent lehnt sich in seinen Stuhl zurück. Ich kann mir nicht helfen, er gefällt mir, mit seinen breiten Händen und dem dichten Schnurrbart, und ich wünschte, Mademoiselle LeFarge würde ihm wenigstens eine kleine Chance geben. Aber sie hält ihrem Reginald, ihrem g e heimnisvollen Verlobten, die Treue, wie es sich gehört –auch wenn wir bis jetzt nichts von ihm gesehen haben und er noch kein einziges Mal zu Besuch gekommen ist.
Nachdem sie ein Glas Wasser getrunken hat, ruft Madame Romanoff noch ein paar Leute aus dem Publikum zu sich. Bei einigen stellt sie meiner Me i nung nach ziemlich plumpe Fragen, aber die trauer n den Hinterbliebenen hegen keinen Argwohn und erzählen bereitwillig ihre Geschic h ten. Fast scheint es, als würde sie sie dazu bringen, die Antworten selbst zu liefern. Ich habe bisher noch nie ein Medium in Aktion g e sehen und bin mir nicht sicher.
Felicity beugt sich herüber und flüstert mir ins Ohr: »Bist du bereit?«
Mein Magen schlägt einen Purzelbaum. »Ich glaube ja.«
Mademoiselle LeFarge ermahnt uns, still zu sein. Elizabeth und Cecily schauen uns misstrauisch an. Madame Romanoff bittet einen letzten Kandidaten oder eine Kand i datin auf die Bühne. Blitzartig schießt Felicity von ihrem Sitz und zerrt mich am Arm hoch.
»Oh, bitte, Madame«, sagt sie, scheinbar den Tränen nahe, obwohl sie in Wirklichkeit gegen einen Lachkrampf ankämpft. »Meine Freundin ist viel zu schüchtern, um sich an Sie zu wenden. Könnten Sie bitte einem Mädchen he l fen, seine liebe verstorbene Mutter, Mrs Sarah Rees-Toome, zu erreichen?«
Ein Gemurmel, durchsetzt mit Ausrufen der Überraschung, erhebt sich. Mir stockt der Atem. »Das war unn ö tig«, zische ich.
»Du willst doch, dass es glaubhaft ist, oder nicht?«
»Mädchen, setzt euch sofort wieder hin!« Mademoiselle LeFarge zieht an meinem Rock. Aber es nützt nichts. Fel i citys flehende Bitte hat bei Mad a me Romanoff eine Saite an g eschlagen. Zwei ihrer Helfer eilen herbei und schieben mich den Gang en t lang nach vorn. Ich weiß nicht, ob ich Felicity u m bringen oder ihr dankbar sein soll. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, auch mit meiner echten Mutter Kontakt aufzunehmen. Meine Hände schwitzen bei dem Gedanken, in wenigen Augenblicken wieder mit meiner Mutter zu sprechen –sei es auch nur durch ein Medium und den Geist von Sarah Rees-Toome.
Ich höre das Rascheln der Programme, als ich die kleine Bühne betrete, das Gesumm flüsternder Stimmen, gemischt mit Seufzern der Enttäuschten, die nun keine Chance mehr haben, mit den Toten zu sprechen, weil ihnen ein rothaar i ges Mädchen zuvo r gekommen ist, dessen grüne Augen vor Hoffnung glänzen.
Madame Romanoff fordert mich auf, mich zu setzen. Auf dem Tisch steht eine aufgeklappte Taschen uhr, die 19.48 Uhr zeigt. Madame Romanoff streckt die Hände über den Tisch und birgt meine Hand in ihren beiden. »Liebes Kind, du hast großes Leid e r fahren, fürchte ich. Wir alle müssen diesem jungen Mädchen helfen, ihre geliebte Mu t ter zu finden. La s sen Sie uns die Augen schließen und uns auf die Hi l fe für unsere kleine Freundin konzentrieren. Nun sag, wie ist der Name der teuren Verblichenen?«
Virginia Doyle. Virginia Doyle. Meine Kehle ist ausge dörrt und schnürt sich zusammen, als ich sage: »Sarah Rees-Toome.«
Madame Romanoff lässt ihren Finger über die Glaskugel gleiten und senkt ihre Stimme in eine tie fere Tonlage. »Ich r ufe jetzt den Geist von Sarah Rees-Toome, über alles g e liebte Mutter. Hier ist j e mand, der Sie zu kontaktieren wünscht. Jemand, der Ihrer Anwesenheit bedarf.«
Für einen Moment erwarte ich fast, dass mir Sarah sagt, ich soll verduften, ich soll sie in Ruhe lassen, nicht länger so tun, als ob ich sie kenne. Aber haup t sächlich hoffe ich, dass ich jetzt gleich die Stimme meiner Mutter hören we r de, die über mein doppeltes Spiel lacht und mir alles ve r zeiht, sogar diesen kle i nen Schwindel.
Von jenseits des Tisches, aus Madame Romanoffs Kehle, kommt ein tiefes Brummen, das zu einem m e lodischen Singsang anschwillt. »Liebling, bist du ’s? Oh, ich habe dich so sehr vermisst.«
Jetzt erst merke ich, dass ich vor lauter Spannung vergessen habe zu atmen. Mein Herz klopft wild in meiner Brust und ich kann meinen Aufschrei nicht zurückhalten.
»Mutter, bist du es?«
»Ja, mein Schatz, ich bin es, deine dich zärtlich liebende Mutter.« Im Publikum hört man da und dort Schnäuzen und Schnüffeln. Meine Mutter würde niemals so dick au f tragen. Ich tische eine Lüge auf, um zu sehen, wie sie da r auf reagiert.
»Mutter, vermisst du unser Heim in Surrey nicht ganz schrecklich? Die Rosenbüsche hinter dem Haus, neben dem kleinen Amor?«
Ich hoffe inständig, dass sie sagt: »Gemma, hast du vielleicht einen kleinen Dachschaden erlitten, meine Liebe?« Irgend so etwas. Alles. Nur nicht das.
»Oh, ich kann es von hier immer sehen, mein Liebling. Das Grün von Surrey. Die Rosen in unserem wunde r vollen Garten. Aber trauere nicht zu sehr um mich, mein Kind. Eines Tages werden wir einander wiede r sehen.«
Die Menge schnüffelt und seufzt vor Rührung, während mir die Lüge sauer aufstößt. Madame Ro manoff ist nichts anderes als eine Schauspielerin. Sie täuscht vor, meine Mutter zu sein, eine Person n a mens Sarah Rees-Toome, die in einem kleinen Lan d haus wohnt, mit einer Amorstatue hinten im Garten, während meine Mutter, Virginia Doyle, nie einen Fuß auf den Boden von Surrey gesetzt hat. Ich möchte Madame Romanoff einen Geschmack davon g e ben, wie es wirklich auf jener anderen Seite ist, wo die Geister einen nicht freudig begrüßen. Ich merke nicht, dass ich mit meiner ganzen Kraft Madame Romanoffs Hand festhalte, weil ein plötzliches, flammendes Licht empo r schlägt, als öffnete sich die Erde. Ich falle wieder in jenen Tunnel und meine Wut zieht mich mit Macht nach unten.
Aber diesmal bin ich nicht allein.
Irgendwie ist es mir gelungen, Madame Romanoff mitzunehmen, wie es mir fast mit Pippa passiert wäre. Ich h a be nicht die leiseste Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber sie ist da, wirklich und wahrha f tig, und schreit sich die Seele aus dem Leib.
»Verdammter Mist, wo bin ich?« Zumindest Madame Romanoffs Temperament ist unzweifelhaft russisch. »Was für ein Teufel ist in Sie gefahren?«
Ich kann nicht antworten. Meine Stimme versagt. Wir befinden uns in einem dunklen, von Nebel er füllten Wald e inem Wald, den ich aus meinen Trä u men kenne. Es muss derselbe dunkle, neblige Wald sein, über den Mary Dowd geschrieben hat. Ich habe es geschafft. Ich habe das Mag i sche Reich betreten. Und es ist so wirklich wie die kre i schende, dicke Gaunerin neben mir.
»Was soll das, eh?« Sie packt mich fest am Ärmel.
In den Bäumen bewegt sich etwas. Der Nebel verzieht sich. Sie kommen langsam heraus, einer nach dem anderen, bis sie zwanzig oder mehr sind. Die Toten. Hohläugig. Mit blassen Lippen. Die Haut durchscheinend über die Kn o chen gespannt. Eine mit Lumpen bekleidete Frau trägt ein Baby an der Brust. Sie trieft von Nässe und glitschige grüne Pflanze n teile schlingen sich durch ihr Haar. Zwei Männer wa n ken mit ausgestreckten Armen vorwärts. Ich kann die Knoche n stümpfe sehen, wo ihre Hände glatt abg e hackt wurden. Sie k ommen immer näher, ihre Mü n der machen die gleichen grässlichen Murmelgeräusche wie die anderen To ten.
»Komm zu uns. Komm zu uns.«
Madame Romanoff brüllt wie am Spieß und klammert sich an meine Seite. »Was zum Teufel ist da los? Süßer Jesus, schaff mich hier raus. Bitte! Ich will keine Me n schenseele mehr beschwindeln, ich schwör ’s beim Grab meiner Mutter, ich werd ’s nie wieder tun.«
»Halt«, sage ich und hebe eine Hand. Überraschenderweise funktioniert es. »Wer von euch ist Sa rah Rees-Toome?«
Keiner der Geister meldet sich.
»Ist jemand unter euch mit diesem Namen?«
Nichts.
»Sag ihnen, sie sollen verschwinden«, bettelt Madame Romanoff. Sie hebt einen Ast vom Boden auf und fuchtelt wild damit herum, um die Geister zu verscheuchen. Und dann, durch die Bäume, sehe ich sie. Die blaue Seide ihres Kleids. Ich höre den wa r men Bernsteinton ihres Lachens.
Wo bin ich, Liebes?
Ich packe Madame Romanoff an den Schultern. »Wie ist Ihr Name? Ihr wirklicher Name.«
»Sally«, sagt sie heiser vor Angst. »Sally Carny.«
»Sally, hören Sie mir zu. Ich muss Sie für einen Augenblick verlassen, aber ich bin gleich wieder da. Es wird I h nen nichts geschehen.«
»Nein! Lass mich hier nicht allein mit denen, du kleine Schlampe, oder ich kratz dir deine unheiml i chen grünen Augen aus, wenn du zurückkommst! Wart ’s nur ab!«
Sie schreit, aber ich laufe schon durch die Bäume, dem Blau der Hoffnung nach, das mich lockt, zum Greifen nah, ohne dass ich es jemals erreiche. Und dann bin ich in e i nem halb verfallenen Tempel. Ein Buddha sitzt im Lotu s sitz auf einem Altar, umgeben von brennenden Kerzen. Es ist friedlich hier. Kein Laut ist zu hören außer dem Gurren von Vögeln. Ich fühle keine Furcht. Ich halte meine Fi n gerspitzen an die orange-blaue Kerzenflamme, aber ich spüre w e der Hitze noch Schmerz. Ein zarter Lilienduft weht durch die offene Tür herein. Ich wünschte, ich kön n te jene Blumen meiner Kindheit sehen, die Blumen meiner Mutter und Indiens, und dann, plötzlich, sind sie überall. Der Raum ist voll blühender weißer Blumen. Ich habe das gemacht –allein mit der Kraft m einer Gedanken. Es ist so schön, dass ich für i m mer hierbleiben möchte.
»Mutter?« Meine Stimme ist leise und hoffnungsvoll.
Der Raum wird heller und gleißender. Ich kann sie nicht sehen, aber ich kann sie hören. »Gemma …«
»Mutter, wo bist du?«
»Ich kann mich hier nicht zeigen oder lange bleiben. Dieser Wald ist nicht sicher. Überall sind Spi t zel.«
Ich weiß nicht, was sie meint. Ich kann es noch immer nicht fassen, dass ich hier bin. Dass sie hier ist.
»Mutter, was geschieht mit mir?«
»Gemma, du besitzt besondere Kräfte, mein Liebes.«
Ihre Stimme hallt im Tempel wider. Mein Liebes, Lie bes, Liebes …
Mein Hals ist wie zugeschnürt. »Ich verstehe es nicht. Ich kann sie nicht kontrollieren, überhaupt nicht.«
»Du wirst es lernen, mit der Zeit. Aber du musst deine Kraft nutzen, musst sie einsetzen, sonst wird sie verdorren, und sobald sie tot ist, lässt sie sich nicht mehr zurückg e winnen. Das Schicksal hat Gr o ßes mit dir vor, wenn du es annimmst.«
Das Affchen des Drehorgelspielers taucht auf. Es lässt sich auf der Schulter der Buddhastatue nieder, da sitzt es nun und beobachtet mich.
»Es gibt Leute, die nicht wollen, dass ich meine besonderen Kräfte nutze. Ich wurde gewarnt.«
Mutters Stimme ist ruhig, wissend. »Die Rakschana. Sie fürchten dich. Sie fürchten sich vor dem, was geschieht, wenn d u versagst, und noch mehr fürchten sie sich vor der Macht, die du haben wirst, wenn es dir gelingt.«
»Wenn mir was gelingt?«
»Die Magie, das geheime Wissen des Magischen Reichs, zurückzubringen. Du bist das Bindeglied zum Orden des aufgehenden Mondes. Die Kraft der Magie wohnt in dir, mein Liebes. Du bist das Ze i chen, auf das sie all die Jahre gewartet haben. Aber du bist in großer Gefahr. Sie will deine magische Kraft und sie wird nicht aufhören, nach dir zu s u chen, bis sie dich findet.«
»Wer?«
»Circe.« Circe. Circe. Circe.
»Wo ist sie? Wo kann ich sie finden?«
»Alles zu seiner Zeit, Gemma. Sie ist viel zu mächtig. Du bist ihr noch nicht gewachsen.«
»Aber …« Tränen ersticken meine Worte. »Sie ist schuld an deinem Tod.«
»Sinne nicht auf Rache, Gemma. Circe hat ihre Wahl getroffen. Du musst deine treffen.«
»Woher weißt du das alles?«
Die Blüten der Lilien beginnen sich einzurollen. Sie werden braun und die Blätter fallen auf den steinernen Bo den.
»Unsere Zeit ist um. Du bist hier nicht mehr sicher. Geh jetzt zurück.«
»Nein, noch nicht!«
»Du musst dich auf den Ort konzentrieren, den du hinter dir gelassen hast. Das Tor aus Licht wird er scheinen. Dann tritt hindurch.«
»Aber wann werde ich dich wiedersehen?«
»Du findest mich im Garten. Dort sind wir sicherer.«
»Aber wie …«
»Du musst es nur wollen, aus eigener, freier Entscheidung, und das Tor wird dich hineinlassen. Ich muss jetzt weitergehen.«
»Warte – geh nicht!«
Aber ihre Stimme verliert sich in einem Meer aus Geflüster.
Weitergehen. Weitergehen. Weitergehen.
Das Licht wird so hell, dass ich einen Arm vor meine Augen halten muss. Als ich wieder hinsehe, ist der Tempel eine öde Ruine, der Boden mit vertrockneten Blüten übe r sät. Sie ist fort.
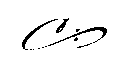
Dicker Nebel hängt in den Bäumen, als ich den Weg zurückgehe, dorthin, wo ich Sally Carny verla s sen habe. Ich kann kaum etwas sehen, aber es liegt nicht am Nebel. Es sind die Tränen. Mehr als alles in der Welt möchte ich dort in dem nach Lilien dufte n den Tempel bei meiner Mutter bleiben. Eine dunkle Ge s talt taucht verschwommen vor mir auf dem Weg auf und für einen Moment ist alles vergessen außer dem Schrecken in meinen Gliedern, der Warnung meiner Mutter, dass ich verfolgt werde.
Ein großer, breitschultriger Mann tritt aus dem Nebel. Er trägt die Militäruniform der Leibgarde Ih rer Majestät –kein Offizier, sondern ein einfacher Fußsoldat. Er kommt schüch t ern auf mich zu, seinen Hut in der Hand haltend. Seine sanften, jungenhaften Gesichtszüge kommen mir b e kannt vor. Abgesehen von seiner unirdischen Blässe könnte er der Nac h barsjunge von gegenüber sein.
»Verzeihung, aber Sie kennen doch meine Polly?«
»Polly?«, wiederhole ich. Da ich mit einem Geist spreche, wird man mir meine Unhöflichkeit nachs e hen. Ich bin sicher, dass ich ihn schon einmal ges e hen habe.
»Miss Polly LeFarge – ich habe Sie bestimmt dort bei ihr gesehen, nicht wahr?«
Ein Mann in Uniform. Ein verträumtes Lächeln. Eine verblassende Fotografie auf einem Schreibtisch. Reginald, Mademoiselle LeFarges geliebter Verlobter, ist tot und b e graben, nichts als eine Erinnerung, von der sie nicht lassen kann.
»Meinen Sie Mademoiselle LeFarge, meine Lehrerin?«, frage ich ruhig.
»Ja, Miss. Meine Polly hat oft davon geredet, Lehrerin zu werden, aber ich hab ihr versprochen, ich werd in der Armee ein gutes Stück Geld verdienen und dann komme ich nach Hause und sorge richtig für sie, mit einer Hochzeit in der Kirche und einem Häuschen in Dover. Polly liebt das Meer über alles.«
»Aber Sie sind nicht nach Hause gekommen«, sage ich. Es ist mehr eine Frage als eine Feststellung, als hoffte ich noch immer, er würde eines Tages in ihr Klassenzimmer spazieren.
»Grippe«, sagt Reginald. Er schaut auf seinen Hut hinunter, dreht ihn in den Händen wie ein Glücksrad auf dem Jahrmarkt. »Würden Sie Polly eine Bo t schaft von mir überbrin g en, Miss? Könnten Sie ihr sagen, dass Reggie sie immer lieben wird, und ich hab noch immer den Schal, den sie mir zu Weihnac h ten gestrickt hat, bevor ich abgereist bin. Er hat sich gut gehalten, wirklich.« Er lächelt mich an, ein gutes, ein ehrliches Lächeln. »Würden Sie das für mich tun, Miss?«
»Ja«, flüstere ich.
»Haben Sie Dank für Ihre Hilfe. Nun kann ich leichten Herzens hinübergehen. Aber ich denke, Sie sollten sich jetzt wieder auf den Weg machen. Man wird nach Ihnen suchen, wenn Sie noch länger hierbleiben.« Er setzt seinen Hut auf und marschiert davon, bis er vom Nebel ve r schluckt wird.
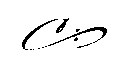
Als ich zu Madame Romanoff, alias Sally Carny, zurückkomme, singt sie mit zitternder Stimme alte Ki r chenlieder. Die Toten sind verschwunden, aber sie klammert sich noch immer an den Ast, als gelte es ihr Leben. Kaum sieht sie mich, springt sie mir fast in die Arme. »Bitte, bringen Sie mich zurück !«
»Warum sollte ich Sie zurückbringen, angesichts der Schamlosigkeit, mit der Sie Menschen behan deln, die um ihre Liebsten trauern?«
»Ich wollte niemand nicht schaden, Miss. Ich schwör’s! Sie können einem Mädchen nicht vorwe r fen, dass es von was leben muss, Miss.«
Nein, das kann ich nicht. Würde sie sich nicht auf diese Weise über Wasser halten, säße sie auf der Straße und müsste sich ihren Lebensunterhalt auf noch viel zweife l haftere, trost l osere Art verdienen. »Na schön. Ich werde Sie zurückbringen. Aber nur unter zwei Bedingungen.«
»Alles was Sie wollen. Sagen Sie’s.«
»Erstens sollen Sie niemals, unter gar keinen Umständen –auch nicht im Zustand vollständiger Trunkenheit –einer ei n zigen Menschenseele sagen, was heute Abend hier gesch e hen ist. Denn wenn Sie das tun …« Ich lasse den Satz in der Luft hängen, weil mir keine passende Drohung ei n fällt, aber das spielt keine Rolle. Sally legt ihre Hand aufs Herz.
»Gott ist mein Zeuge. Kein Sterbenswort!«
»Ich verlasse mich darauf. Und nun zur zweiten Bedingung …« In Gedanken sehe ich das liebe Gesicht von Ma demoiselle LeFarge vor mir. »Sie we r den jemandem im Publikum eine Botschaft aus der Geisterwelt übermitteln, einer Frau namens Polly. Sie sollen ihr sagen, dass Reggie seine Polly sehr liebt und dass er noch immer den Schal hat, den sie ihm zu Weihnachten gestrickt hat.« Das Näch s te f ü ge ich auf eigene Faust hinzu. »Und dass das Leben weitergeht und er ihr wünscht, dass sie glücklich wird. Merken Sie sich das?«
Die Hand wandert wieder zum Herzen. »Jedes Wort.« Sally legt einen Arm um meine Schultern. »Aber Miss … wie wär ’s, wenn Sie sich mir und meinen Jungs anschli e ßen? Sie mit Ihrer Begabung und ich mit meinen Bezi e hungen, wir könnten ein Ve r mögen machen. Überlegen Sie sich ’s. Mehr will ich nicht sagen.«
»Gut. Dann bleiben Sie hier.«
»Vergessen Sie alles, was ich gesagt habe!«, kreischt Sally und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihr einen solchen Schrecken eingejagt habe, dass sie garantiert den Mund halten wird. Und jetzt nichts wie zurück. Mutter sa g te, ich solle an den Ort de n ken, den ich hinter mir gelassen habe. Aber ich habe das noch nie ausprobiert und weiß nicht, ob ich es kann. Dann wären Sally und ich für immer in diesem nebligen Wald gefangen.
»Sie wissen doch, wie wir hier wieder rauskommen, oder nicht?«
»Natürlich weiß ich’s«, sage ich gereizt. Lieber Gott, bitte mach, dass es funktioniert. Mit Sallys Hand in meiner konzentriere ich mich auf den Vortragssaal. Nichts g e schieht. Ich mache ein Auge auf und sehe, dass wir immer noch im Wald sind, Sally neben mir in totaler Panik.
»Heilige Muttergottes! Sie können’s nicht, stimmt ’s? Süßer Jesus, rette mich!«
»Würden Sie bitte still sein?«
Sie fängt wieder an, alte Kirchenlieder zu singen. Schweißperlen bedecken meine Oberlippe. Ich konzentrie re und denke an nichts anderes als an den Vortragssaal. Mein Atem wird lauter und der Rhythmus langsamer. Ein ziehendes Gefühl stellt sich ein. Die Ränder des Waldes zerfließen im Nebel; der Nebel verdichtet sich zu einem großen Tor aus Licht und dann sind wir wieder zurück auf der Bühne des Vortragssaals. Es hat funktioniert! Das Ti cken der Ta schenuhr klingt tröstlich in meinen Ohren, es ist 19.49 Uhr. Unser ganzer Ausflug in die Geisterwelt hat nur eine Minute gedauert, obwohl das Gesicht von Sally Carny in der kurzen Zeit u m zehn Jahre gealtert zu sein scheint. Auch ich habe mich verä n dert.
»Madame Romanoff« ist zurück und sagt mit zitternder Stimme: »Ich erhalte soeben eine Nachricht aus einem a n deren Teil des Geisterreichs, für jema n den namens Polly. Reggie will, dass sie weiß, dass er sie von ganzem Herzen liebt …« Sie stockt.
»Schal«, souffliere ich ihr zwischen zusammengebissenen Zähnen.
»Dass er den Schal von Weihnachten hat und dass sie ohne ihn glücklich werden soll. Das ist alles.« Mit einem lauten Stöhnen lässt sie sich in ihren Stuhl sinken. Seku n den später »erwacht« sie.
»Die Geister haben gesprochen und jetzt muss ich meinen übersinnlichen Fähigkeiten eine Erholungspause gö n nen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute Abend geko m men sind, und möchte Sie daran eri n nern, dass ich nächsten Monat in Covent Garden wieder Verbindung mit dem Je n seits aufnehmen werde.« Unter dem Beifall des Publikums springt Sally »Madame Romanoff« von ihrem Stuhl und verschwindet hinter den Kulissen, wo ihre verwirrten La kaien auf eine Erklärung für die heutige Abwe i chung vom Programm warten.
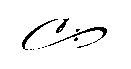
»Ich wusste, du hast irgendetwas vor!«, flüstert Cecily, mich am Arm packend. »War es sensati o nell?«
Elizabeth kommt dazu. »Hast du gesehen, wie die Geister i n Madame Romanoffs Körper eintraten? Wurde ihre Hand eiskalt? Ich habe gehört, dass das vorkommt.«
Plötzlich bin ich das beliebteste Mädchen der Schule.
»Nein. Ich habe keine Geister gesehen. Ihre Hände waren warm und viel zu feucht. Und ich bin sicher, ihre Ringe waren unecht«, sage ich und gehe schneller, um so viel A b stand wie möglich zwischen Ma demoiselle LeFarge und mich zu legen.
Elizabeth verzieht enttäuscht den Mund. »Und was soll ich meiner Mutter jetzt über dieses einmalige Ereignis schreiben?«
»Schreib ihr, sie soll aufhören, für solchen Unsinn Geld auszugeben.«
»Gemma Doyle, du bist ein absolutes Ekel«, knurrt Cecily.
»Ja«, sage ich, und damit ist meine minutenlange Regentschaft als Königin von Spence beendet.
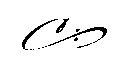
»Der reinste Schwindel«, sagt Felicity, als ich mich der Menge anschließe, die aus dem Vortragssaal hin ausdrängt. »Sie hat das wirklich geglaubt, dass Sarah der Name deiner Mutter ist. Und statt der wirklichen Sarah Rees-Toome wurde uns dann irgendein liebeskranker Reggie aufg e tischt, der nach seiner Polly schreit.«
»Was ist eigentlich in Mademoiselle LeFarge gefahren? Sie macht ein Gesicht, als hätte sie einen Geist gesehen«, flüstert Pippa.
»Wahrscheinlich ist sie sauer auf uns«, sagt Ann verstört.
»Bestimmt wird sie Mrs Nightwing erzählen, was wir getan haben, und wir werden nicht am Tanztee nächsten Monat teilnehmen dürfen.«
Da wird sogar Felicity blass und ich für meinen Teil bin sicher, im Kerker oder sonst wo zu landen. Mademoiselle ist etliche Schritte hinter uns zurüc k geblieben. Sie macht gar keinen so grimmigen Ei n druck. Stattdessen betupft sie ihre Augen mit einem Taschentuch und lächelt Inspektor Kent an, der a n bietet, uns zu unserem Wagen zu begleiten.
»Ich glaube, alles wird gut«, sage ich.
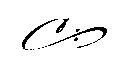
Die Besucher strömen in einer dichten Masse hinaus, alle versuchen zu ihren Kutschen zu gelangen, ohne nass zu werden. Ein älteres Paar drängelt sich zw i schen mich und die anderen, dann verlangsamt es seinen Schritt fast bis zum Stillstand. Es gelingt mir nicht, an ihnen vorbeiz u kommen, und ich sehe nur noch weit vorn Felicitys blondes Haar flattern.
»Kann ich Ihnen helfen, Miss?« Der bekannten Stimme folgt eine bekannte Hand, die mich ener gisch in eine kleine Seitenstraße zieht.
»Was tun Sie hier?«, frage ich Kartik.
»Sie beobachten«, sagt er. »Wären Sie so freundlich, mir zu sagen, was das kleine Bravourstück heute Abend zu b e deuten hatte?«
»Es war nur ein Spaß, sonst nichts. Ein Schulmädchenstreich.«
Auf der Straße rufen sie nach mir.
»Man sucht mich«, sage ich in der Hoffnung, dass er mich loslässt.
Er verstärkt den Griff um mein Handgelenk. »Irgendetwas ist heute Abend passiert. Ich konnte es spüren.«
Ich setze zu einer Erklärung an. »Es war ein Unfall …«
»Das glaube ich nicht!« Kartik tritt fest nach einem Stein und katapultiert ihn in die Luft.
»Es ist nicht, wie Sie glauben«, versuche ich mich zu verteidigen. »Ich kann es erklären …«
»Keine Erklärungen! Wir geben die Befehle und Sie sollen sie befolgen. Keine Visionen mehr. Haben Sie mich verstanden?« Seine Mundwinkel zucken drohend. Er e r wartet, dass ich zittere und wide r spruchslos gehorche. Aber heute Abend hat sich in mir etwas verändert. Und ich kann nicht mehr z u rück.
Ich beiße in seine Hand und er lässt mit einem Aufschrei mein Handgelenk los. »Sprechen Sie nie wieder so mit mir«, knurre ich. »Ich habe nicht die Absicht, noch länger das ängstliche, brave Schu l mädchen zu sein. Wie kommen Sie als ein Fremder dazu, mir zu sagen, was ich zu tun und zu lassen h a be?«
»Ich bin ein Rakschana«, schleudert er mir entgegen.
Ich lache. »Ach ja – die großen, geheimnisvollen Rak schana. Die mächtige Bruderschaft, die sich von Dingen bedroht sieht, die sie nicht versteht, und die sich hinter e i nem Grünschnabel verstecken muss.« Das Wort trifft ihn, als ob ich ihm ins Gesicht g e spuckt hätte. »Sie sind kein Mann. Sie sind ihr Lakai. Sie alle können mir gestohlen bleiben, Sie und Ihr Bru d er und Ihre lächerliche Organis a tion. Von nun an tue ich genau das, was ich will, und Sie können mich nicht aufhalten. Folgen Sie mir nicht. Be o bachten Sie mich nicht. Versuchen Sie nicht einmal, mit mir Kontakt aufzunehmen, oder es wird Ihnen leidtun. Ha ben Sie mich verstanden?«
Kartik richtet sich auf, reibt seine verwundete Hand. Er ist zu verdattert, um etwas zu sagen. Zum ersten Mal ist er stumm wie ein Fisch. Und so lasse ich ihn stehen.
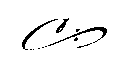
Mademoiselle LeFarge erteilt uns keinen Verweis. Auf der ganzen Fahrt zurück nach Spence sitzt sie mit geschlosse nen Augen da, ein trauriges Lächeln auf ihrem Gesicht. Aber in ihren Fingern hält sie die Visitenkarte des Inspe k tors. Eingelullt vom Rumpeln der Kutsche und müde von dem langen Abend sind alle in einen Dämmerschlaf gesu n ken. Alle außer mir.
Was ich heute Abend gesehen habe, hat mich in höchste Erregung versetzt. Alles in Mary Dowds Tagebuch ent spricht der Wahrheit. Das Magische Reich existiert wir k lich. Meine Mutter ist dort und wartet auf mich. Kartiks Warnungen lassen mich von nun an kalt. Ich weiß nicht, was ich hinter diesem Tor aus Licht noch alles finden we r de, und um ehrlich zu sein, fürchte ich mich ein bisschen davor. Das Einz i ge, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass ich die Kraft, die in mir schlummert, nicht länger ignori e ren kann. Die Zeit ist gekommen.
Meine Hand, die auf Felicitys Schulter liegt, rüttelt sie sanft wach.
»W-was ist? Sind wir schon da?«, fragt sie und reibt sich die Augen.
»Nein, noch nicht«, flüstere ich. »Ich muss ein Treffen des Ordens des aufgehenden Mondes einbe rufen.«
»Ja, fein«, sagt sie benommen und dann fallen ihr wieder die Augen zu. »Morgen.«
»Nein, es ist wichtig. Wir müssen uns noch heute Nacht treffen.«