19. Kapitel
»Da bist du ja endlich«, ruft mir Felicity von dem kleinen Tisch, an dem sie und Ann mit der alten Zi geunerin sitzen, zu. »Mutter Elena hat uns gerade die höchst interessante Geschichte erzählt, dass Ann eine große Schönheit wird.«
»Sie hat gesagt, ich werde einmal viele Bewunderer haben«, ergänzt Ann aufgeregt.
Mutter Elena krümmt einen Finger. »Komm näher, Kind. Mutter Elena wird dir deine Zukunft voraussa gen.«
Ich bahne mir einen Weg durch das Chaos aus Bücherstapeln, bunten Schals, Töpfen mit Kräutern und allen möglichen Salbentiegeln. Hinter der alten Frau hängt eine Laterne an einem Haken. In dem harten Licht sehe ich, wie zerfurcht und dunkel ihr Gesicht ist. Ihre Ohren sind durc h stochen und sie trägt Ringe an allen zehn Fingern. Sie hält mir einen Korb hin, in dem ein paar Schillinge liegen.
Felicity räuspert sich und flüstert: »Gib ihr ein paar Pence.«
»Aber dann habe ich nichts mehr bis zum Besuch meiner Familie«, flüstere ich zurück.
»Gib. Ihr. Das. Geld«, presst Felicity zwischen lächelnden Lippen hervor.
Mit einem tiefen Seufzer lasse ich meine letzten Kupfermünzen in den Korb fallen. Mutter Elena schüttelt ihn. Zufri e den mit dem Geklimper leert sie den Korb in ihre Geldbö r se.
»Also, was nehmen wir? Die Karten? Die Hand?«
»Mutter Elena, ich glaube, unsere Freundin würde sich sehr für die Geschichte interessieren, die du uns erzählt hast –über die zwei Mädchen von Spence.«
»Ja, ja, ja. Aber nicht, solange Carolina hier ist. Carolina, hol jetzt einen Eimer Wasser.« Es ist ni e mand sonst im Raum. Langsam fühle ich mich unb e haglich. Mutter Elenas Hände klopfen auf die Ka r ten. Sie legt den Kopf schief, als lausche sie auf e t was, was sie vergessen hat –die Melodie eines Li e des oder eine Stimme aus der Vergangenheit. Und als sie zu mir hochblickt, ist es, als seien wir alte Freundi n nen, die wieder vereint sind.
»Ah, Mary, was für eine nette Überraschung. Nun sag, was kann Mutter Elena heute für dich tun? Ich hab köstli che Honigkuchen. Hier.«
Ihre Hände legen unsichtbare Kuchenstücke auf ein unsichtbares Tablett. Wir tauschen neugierige Blicke. Ist es ein Spiel oder ist die arme Alte wir k lich übergeschnappt? Sie hält mir das vermeintliche Tablett hin.
»Mary, Liebes, sei nicht so schüchtern. Nimm ein Stück. Du trägst dein Haar anders. Es steht dir.«
Felicity nickt, drängt mich mitzuspielen.
»Danke, Mutter Elena.«
»Und wo ist unsere muntere Sarah heute?«
»Unsere Sarah?«, stammle ich.
Felicity springt in die Bresche. »Sie übt das Zaubern, das sie bei dir gelernt hat.«
Mutter Elena runzelt die Stirn. »Das sie bei mir gelernt hat? Mutter befasst sich nicht mit solchen Dingen. Nur mit Kräutern und Zauberformeln für Liebe und Schutz. Du meinst sie.«
»Sie?«, wiederhole ich.
Mutter Elena flüstert: »Die Frauen, die in den dunklen Wald kommen. Und euch ihre Kunst lehren. Die Ordens schwestern. Das bringt nichts Gutes. Mary, lass dir das g e sagt sein.«
Wir bauen ein Kartenhaus. Eine falsche Frage kann den ganzen Turm zum Einsturz bringen, bevor wir die Spitze erreicht haben.
»Woher weißt du, was für Dinge sie uns lehren?«, frage ich.
Die alte Frau tippt sich mit einem knorrigen Finger an den Kopf. »Mutter weiß. Mutter sieht. Sie sehen die Zu kunft und die Vergangenheit. Sie formen sie.« Sie beugt sich zu mir. »Sie sehen die Geisterwelt.«
Der ganze Raum dreht sich um sich selbst, wird unscharf und dreht sich wieder zurück. Obwohl die Nacht kalt ist, rinnt mir der Schweiß am Hals hinu n ter und tränkt meinen Kragen. »Meinst du das Mag i sche Reich?«
Mutter Elena nickt.
»Kannst du das Magische Reich betreten, Mutter?«, frage ich. Die Frage hallt in meinen Ohren w i der. Mein Mund ist trocken.
»O nein. Nur einen Blick darauf erhaschen. Aber du und Sarah, ihr wart dort, Mary. Meine Carolina hat mir gesagt, ihr habt ihr duftendes Heidekraut und Myrte aus dem Ga r ten dort mitgebracht.« Mutters Lächeln schwindet. »Aber es gibt noch andere Orte. Die Wi n terwelt. Oh, Mary, ich habe Angst vor dem, was dort lebt … Angst um Sarah und dich …«
»Ja, was ist mit Sarah …«, hakt Felicity ein.
Mutter Elena runzelt wieder die Stirn. »Sarah ist eine Unersättliche. Sie will mehr als Wissen. Sie will Macht, o ja. Wir müssen Sarah davon abhalten, den falschen Weg einzuschlagen, Mary. Halte sie von der Winterwelt und den dunklen Wesen, die dort leben, fern. Ich fürchte, sie wird sie herbeirufen, sie an sich binden. Und es wird ihren Geist verderben.«
Sie tätschelt meine Hand. Ihre Haut fühlt sich an meinen Fingerknöcheln rau und rissig an. Ich habe das Gefühl, ohnmächtig zu werden. Es kostet mich große Anstrengung, die nächste Frage zu stellen.
»Was für … dunkle Wesen?«
» Gekränkte Geister voller Wut und Hass. Sie wollen zurück in diese Welt. Sie werden deine Schwäche erkennen und ausnutzen.«
Felicity glaubt kein Wort davon. Hinter Mutter Elenas Rücken schneidet sie eine Fratze. Aber ich habe das dunkle Etwas gesehen, habe gesehen, wie es sich bewegte, habe es krächzen gehört.
»Wie könnte sie solch ein Wesen zu sich rufen?« Kalter Schweiß dringt mir aus allen Poren.
»Es verlangt ein Opfer und dann gehört ihr die Macht«, flüstert Mutter Elena. »Aber sie wird für immer an das Dunkle gebunden sein.«
»Was für ein Opfer?«, frage ich mit rauer Stimme. Mutter Elenas Augen werden glasig. Sie kämpft mit ihrer Eri n nerung. Ich frage noch einmal, energischer. »Was für ein Opfer?«
»Steigere dich nicht so hinein … Mary«, sagt Ann leise zwischen zusammengebissenen Zähnen.
Mutters abwesender Blick kehrt in die Gegenwart zurück. Sie betrachtet mich argwöhnisch. »Wer bist du?«
Felicity versucht, sie wieder zurück in die Vergangenheit zu versetzen. »Es ist deine Mary, Mutter Elena. Erinnerst du dich nicht?«
Mutter wimmert wie ein erschrecktes Tier. »Wo bleibt Carolina mit dem Wasser? Carolina, sei nicht ungezogen. Komm zu mir.«
»Mary kann dich zu ihr bringen«, wirft Felicity ein.
»Hör auf damit!«, brülle ich.
»Mary, bist du nach all der Zeit zu mir zurückgekommen?« Mutter Elena nimmt mein Gesicht in ihre welken Händen.
»Ich bin Gemma«, bringe ich mühsam hervor. »Gemma, nicht Mary. Es tut mir leid, Mutter.«
Mutter Elena zieht ihre Hände zurück. Ihr Schultertuch öffnet sich und enthüllt den Glanz des Mond auges, das sie um ihren runzligen Hals trägt. Sie weicht zurück. »Du. Du hast uns das angetan.«
Ihre anschwellende Stimme bringt die Hunde zum Bellen.
»Ich glaube, wir sollten lieber gehen«, warnt Ann.
»Du hast uns vernichtet. Alles zerstört …«
Felicity wirft noch einen Schilling auf den Tisch. »Danke, Mutter. Du hast uns sehr geholfen. Die Ho nigkuchen waren köstlich.«
»Du warst es!«
Ich halte mir die Ohren zu, um ihren Aufschrei auszusperren. Die Wälder hallen davon wider, dem Heulen eines Muttertiers, das um sein Junges trauert. Ich fliehe, vorbei an den Zigeunern, die nun zu b e trunken sind, um uns zu verfolgen, vorbei an der pr o testierenden Felicity und an Ann, die ich beide hinter mir lasse. Ich laufe, ohne anz u halten, bis tief ins Dunkel des Waldes hinein. Als ich en d lich stehen bleibe, bekomme ich kaum noch Luft und habe das Gefühl, ohnmächtig zu werden. Dieses verdammte Korsett. Mit klammen Fingern zerre ich an den Schnüren, kann sie aber nicht öffnen. Schließlich sinke ich hilflos schluchzend auf die Knie. Ich spüre seinen Blick, bevor ich ihn tatsächlich sehe. Aber er ist da und beobachtet mich –steht nur da und be o bachtet mich, sonst nichts.
»Lassen Sie mich in Ruhe!«, rufe ich.
»Das ist ja eine feine Art, uns zu behandeln«, sagt Felicity, die schnaufend hinter mir auftaucht. Ann folgt ihr ke u chend auf den Fersen. »Was zum Teufel ist auf einmal in dich gefahren?«
»Ich … ich bin plötzlich in Panik geraten«, sage ich, ebenfalls nach Atem ringend. Kartik ist immer noch da. Ich spüre es.
»Mutter Elena mag verrückt sein, aber sie ist harmlos. Möglicherweise ist sie auch gar nicht ve r rückt. Wenn du nicht weggerannt wärst, hätte sie ihre kleine Vorstellung vielleicht beendet und wir hätten uns von ihr die Zukunft vorhersagen lassen können, statt unser Geld für nichts und wieder nichts zu ve r schwenden.«
»T-tut mir leid«, stammle ich. Hinter dem Baum ist niemand mehr. Er ist weg.
»Was für eine Nacht«, murmelt Felicity. Sie macht sich wieder auf den Weg und lässt mich einfach zu rück.
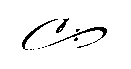
Im Traum laufe ich, meine Füße sinken bei jedem Schritt in die kalte, matschige Erde ein. Als ich an halte, stehe ich am Eingang von Kartiks Zelt. Er schläft, die Bettdecke ist zurückgeschlagen, seine Brust entblößt wie der Oberkörper einer römischen Statue. Eine Linie dunkler Haare zieht sich über einen straffen Bauch. Sie verschwindet im Bund se i ner Hose, in eine Welt, die ich nicht kenne.
Sein Gesicht. Seine Wangen-Nase-Lippen-Augen. Unter seinen Lidern mit den dichten Wimpern bewegen sich sei ne Augen im Traum hin und her. Die Na se ist kräftig und gerade. Der volle Mund darunter ist nur leicht geöffnet, um seinen Atem ein - und au s strömen zu lassen.
Dieser Mund, ich möchte ihn wieder schmecken. Das Verlangen durchfährt mich wie ein Blitz, löscht jeden an deren Gedanken aus. Wenn ich meine Li p pen an seine bringe, schmelze ich dahin. Die Auge n lider flattern, die schwarzen Augen öffnen sich, sehen mich. Die Statue e r wacht zum Le b en. Jeder Muskel seiner Arme spannt sich, als er sich aufric h tet, mich an sich zieht, auf mich gleitet. Und dann ist sein Mund wieder auf meinem, eine Hitze, ein Druck, ein Versprechen von mehr, ein Versprechen, das eingelöst werden will.
Seine Fingerspitzen sind wie ein Flügelschlagen auf meiner Haut. Ein Daumen wandert zu meiner Brust, erkun det sie mit kreisförmigen Bewegungen. Mein Mund sucht die salzige Haut seines Halses. Ein Knie schiebt sich zw i schen meine Beine. Ich halte für einen Moment den Atem an.
Die warmen Finger tasten sich nach unten, zögern, streifen eine Körperregion, die mir noch fremd ist, einen Ort, den zu erforschen ich mir noch nicht e r laubt habe.
»Warte …«, flüstere ich.
Er hört nicht oder will nicht hören. Die Finger, stark und sicher und nicht ganz unerwünscht, tasten sich weiter vor. Ich will weg. Ich will bleiben. Ich will beides zugleich. Sein Mund findet meinen. Ich bin wehrlos. Ich könnte i m mer so dahintreiben, mich in ihm verlieren und neu geb o ren als eine andere herauskommen. Der Daumen auf me i ner Brust lässt meine gesamte Haut prickeln, als hätte ich sie noch nie zuvor wirklich gespürt. Mein ganzer Körper bäumt sich auf, seinem Druck entgegen. Er könnte mich verschlingen, wenn ich nur loslasse. Lass los. Lass los. Lass los.
Nein.
Meine Hände gleiten an seiner schweißnassen Brust hinauf und stoßen ihn weg. Er fällt zur Seite. Befreit von se i nem Gewicht habe ich das Gefühl, als fehlte mir eins me i ner Glieder, u nd das Verlangen, ihn zurückzuziehen, übe r wältigt mich fast. Feine Schweißperlen glänzen auf seiner Stirn, während er –verwirrt und erschöpft –kurz blinzelt und dann in seinen Schlafzustand zurücksinkt. Er liegt da, gena u so, wie ich ihn gefunden habe. Eine Statue, knapp außer Reichweite.
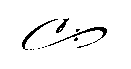
Es war nur ein Traum, nichts als ein Traum. Das sage ich zu mir selbst, als ich schwer atmend aufwa che, in meinem eigenen Bett in meinem eigenen Zimmer, mit Ann, die w e nige Meter von mir entfernt zufri e den schnarcht.
Es war nur ein Traum.
Aber es war so wirklich. Ich betaste mit den Fingern meine Lippen. Sie sind nicht geschwollen vom Küssen. Ich bin noch ganz. Unversehrt. Eine make l lose Ware. Kartik ist meilenweit entfernt, versunken in einen Schlaf, mit dem ich nichts zu tun habe. Der Teil meines Körpers jedoch, den ich nicht erforscht habe, tut weh und ich muss mich auf die Seite legen, die Knie fest aneinandergepresst, um den Schmerz nicht zu spüren.
Es war nur ein Traum.
Aber das Allererschreckendste ist, dass ich mir sehnlich wünsche, es wäre anders.