25. Kapitel
Drei Tage lang geht es so. Wir halten einander an den Händen und treten hinaus in unser privates Par a dies, wo wir die Herrinnen unseres eigenen Lebens sind. Unter der Anleitung der Jägerin wird Felicity eine vorzügliche Bogenschützin, flink und ausda u ernd. Anns Stimme wird von Tag zu Tag kräftiger. Und Pippa ist nicht mehr ganz so die verwöhnte Prinzessin, die sie noch vor einer Woche war. Sie ist liebenswürdiger, w e niger schrill. Oft genug war ich genervt von ihrem pause n losen Geplapper. Aber der Ritter hört ihr so hi n gebungsvoll zu wie niemand sonst.
Hier fürchten wir uns nicht davor, uns näherzukommen. Unsere Freundschaft schlägt Wurzeln, sie blüht und g e deiht. Wir erzählen uns schlimme Witze, lachen und schreien, gestehen unsere Ängste und Hoffnungen. Wir rülpsen ungeniert. Es gibt niema n den, der uns zurechtweist. Niemanden, der uns sagt, dass das, was wir denken und fühlen, falsch ist. Der springende Punkt ist nicht, tun zu können, was wir wollen. Der springende Punkt ist, dass es uns erlaubt ist, überhaupt etwas zu wollen.
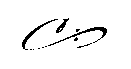
»Passt auf!«, sagt Felicity. Sie schließt die Augen und im nächsten Moment fällt ein warmer Regen aus diesem im merwährenden So n nenuntergangshimmel. Er durchnässt uns bis auf die Haut und es ist ein her r liches Gefühl.
»Das ist nicht fair!«, schreit Pippa, lacht aber dabei.
Ich habe noch nie einen so wunderbaren Regen erlebt. Ich möchte ihn trinken, darin baden.
»Ha!«, ruft Felicity triumphierend. »Ich hab das ge macht! Ich!«
Wir kreischen und rennen, platschen in Pfützen und wieder heraus. Schlammbespritzt bewerfen wir uns gegen seitig mit Matsch. Jedes Mal, wenn wir eine Handvoll na s ser Erde abkriegen, brüllen wir und schwören Rache. Aber ehrlich gesagt, wir genießen das Gefühl, dermaßen ve r dreckt zu sein, und verge s sen alle Skrupel.
»Ich bin völlig durchweicht«, ruft Pippa, nachdem wir ihr tüchtig zugesetzt haben. Sie ist von oben bis unten voll Schlamm.
»Also gut.« Ich schließe die Augen, denke an die heiße Sonne Indiens und binnen Sekunden hört der Regen auf. Wir sind sauber, trocken und ordentlich angezogen, bereit für die Abendandacht oder um Besuch zu empfangen. Je n seits des silbernen Torbogens, in ihrem weiten Rund, st e hen die Kristallrunen, die Kraft in ihrem Innern fest ve r schlossen.
»Wäre es nicht toll, den anderen zu zeigen, was wir alles tun können?«, überlegt Ann laut.
Ich nehme ihre Hand und stelle fest, dass ihr Handgelenk keine neuen Wundmale aufweist, nur noch die verblasse n den Narben ihrer alten Verle t zungen.
»Ja, allerdings.«
Wir strecken uns im Gras aus, wie eine große Windmühle, die Köpfe in der Mitte einander berührend. Und so li e gen wir, glaube ich, sehr lange, ha l ten uns an den Händen und spüren unsere Freundschaft in allen Fingern, bis irgen d jemand auf die Idee kommt, es wieder regnen zu la s sen.
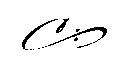
»Sag mir noch einmal, wie die Magie der Kristallstäbe funktioniert.« Ich liege neben meiner Mutter im Gras und beobachte die wechselnden Formen der Wolken. Eine d i cke, flaumige Ente zieht sich in die Länge und verwandelt sich in etwas anderes.
»Es erfordert monate-, ja, jahrelange Übung, bis man sie beherrscht«, antwortet Mutter.
»Das ist mir klar. Aber was geschieht dabei? Singen sie? Sprechen sie? Stimmen die Runen zuerst God save the Queen an?« Ich weiß, dass diese Be merkung eine Frechheit ist, aber sie hat mich dazu herausgefordert.
»Ja. In E-Dur.«
»Mutter!«
»Ich glaube, ich habe das schon erklärt.«
»Sag’s mir noch einmal.«
»Du berührst die Kristalle mit den Händen und die Kraft strömt in dich ein. Eine Zeit lang ist sie in dir lebendig.«
»Das ist alles?«
»Im Wesentlichen, ja. Aber zuerst musst du imstande sein, die Kraft zu kontrollieren. Sie wird von deiner Gei s teshaltung beeinflusst, deiner Absicht, deiner inneren Stä r ke. Es ist eine gewaltige Kraft. Eine Magie, mit der man nicht spielen darf. Oh, schau nur, da, ich sehe einen Elefa n ten.«
Die Entenwolke über uns hat sich in etwas verwandelt, was einem Klecks mit einem Rüssel ähnelt.
»Er hat nur drei Beine.«
»Nein, da ist das vierte.«
»Wo?«
»Genau da, wo es hingehört. Du schaust nicht richtig.«
»Doch, tu ich!«, sage ich erbost. Die Wolke hat sich schon wieder verwandelt. »Wie lange hält die magische Kraft an?«
»Kommt drauf an. Einen Tag. Manchmal kürzer.« Mutter richtet sich auf und schaut zu mir herunter. »Aber, Gemma, du darfst …«
»Die Magie noch nicht anwenden. Ja, ich glaube, das hast du bereits erwähnt.«
Mutter schweigt einen Moment. »Meinst du wirklich, du bist schon reif dafür?«
»Ja!« Ich schreie es fast heraus.
»Schau dir diese Wolke dort an. Die genau über uns. Was siehst du?«
Ich sehe die Umrisse von Ohren und einem Schwanz. »Ein Kätzchen.«
»Bist du sicher?« Sie betrachtet mich prüfend.
»Ich erkenne ein Kätzchen, wenn ich eins sehe. Dazu bedarf es keiner magischen Kräfte.«
»Schau noch einmal«, sagt Mutter.
Plötzlich ist der Himmel über uns in Aufruhr. Die Wolken wirbeln durcheinander und sprühen Blitze. Das Kät z chen ist verschwunden und an seiner Stelle taucht ein b e drohliches Gesicht aus einem Albtraum auf. Es starrt mit einem abscheulichen Grinsen auf uns herunter, bis ich meinen Arm schützend vor meine Augen halten muss.
»Gemma!«
Ich nehme meinen Arm fort. Der Himmel ist friedlich. Das Kätzchen ist jetzt eine große Katze.
»Was war das?«, flüstere ich.
»Eine Demonstration«, sagt Mutter. »Du musst imstande sein zu sehen, was wirklich da ist. Circe wird versuchen, dir ein Monster vorzuspiegeln, wo in Wirklichkeit nur ein Kätzchen ist, und umgekehrt.«
Ich zittere immer noch. »Aber es schien so wirklich.«
Sie nimmt meine Hand in ihre und wir liegen ganz ruhig da, ohne uns zu bewegen. In der Ferne singt Ann ein altes Volkslied, das von einer Muschelve r käuferin erzählt. Es ist ein trauriges Lied und hinte r lässt ein seltsames Gefühl. Als würde ich etwas ve r lieren, aber ich weiß nicht, was.
»Mutter, was ist, wenn ich das nicht kann? Wenn sich herausstellt, dass alles ein Irrtum war?«
Die Wolken ballen sich und lösen sich wieder auf. Nichts nimmt einstweilen Gestalt an.
»Schau. Da oben entsteht etwas, was ein Zeichen der Hoffnung sein könnte.«
Die Wolken über uns sind auseinandergetrieben und bilden einen schmalen Ring, ohne Anfang und Ende, mit e i nem vollkommenen Rund makellosen Blaus in der Mitte.
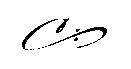
Am Freitag bekomme ich überraschend Besuch. Mein Bruder Tom wartet im Empfangszimmer auf mich. Eine schnatternde Mädchenschar treibt sich unter fadenschein i gen Vorwänden draußen herum, um einen Blick auf ihn zu erhaschen. Ich schließe die Tür hinter mir, um Tom von der Herde seiner Be wunderinnen abzuschneiden, bevor mir übel wird.
»Sieh an, mein dickköpfiges Schwesterlein, wenn ich nicht irre!«, sagt Tom, sich erhebend. »Hast du schon eine passe n de Frau für mich gefunden? Ich bin nicht wählerisch –ei n fach nur eine Hübsche, Stille, mit einem kleinen Ve r mögen und ihren eigenen Zä h nen im Mund. Eigentlich bin ich in allen Punkten flexibel, ausgenommen das kleine Verm ö gen. Es sei denn, es handelt sich um ein großes, n a türlich.«
Irgendwie erfüllt es mich mit einem warmen, wohligen Gefühl der Freude, Tom, den zuverlässigen, versnobten, oberflächlichen Tom, zu sehen. Mir war nie klar gewesen, wie sehr ich ihn vermisste. Ich umarme ihn fest. Er ve r steift sich einen Moment, dann drückt auch er mich an sich.
»Die müssen dich ja wie einen Hund behandeln, wenn du dich so freust, dass ich hier bin. Ich muss sagen, du siehst gut aus.«
»Es geht mir gut, Tom. Ehrlich.« Ich möchte ihm so gern von Mutter erzählen, aber ich weiß, dass das nicht möglich ist.
Noch nicht. »Hast du etwas von Großmutter gehört? Wie geht es Vater?«
Toms Lächeln schwindet. »Doch, ja. Sie sind wohlauf.«
»Wird er zum Familientag kommen? Ich kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen und ihn allen meinen Freun dinnen hier vorzustellen.«
»Nun, darauf würde ich lieber nicht bauen, Gemma. Es könnte sein, dass er nicht wegkann.« Tom richtet seine Manschetten. Ein Zeichen von Nervosität. Ich habe festg e stellt, dass er das immer dann macht, wenn er lügt.
»Ich verstehe«, sage ich ruhig.
Jemand klopft an die Tür. Es ist Ann, die hereinstürmt und überrascht innehält. Sie ist schockiert, dass ich mit ei nem Mann allein im Empfangszimmer bin, und wendet den Blick ab. »Oh, es tut mir schrecklich leid. Ich wollte Gemma, ich meine Miss Doyle, nur wissen lassen, dass jetzt unsere Übung s stunde im Walzertanzen beginnt.«
»Ich kann jetzt nicht. Ich habe Besuch.«
Tom steht erleichtert auf. »Du sollst meinetwegen das Walzertanzen nicht vernachlässigen. Was ist mit Ihnen, fühlen Sie sich nicht wohl?«, fragt er mit e i nem schiefen Blick auf Ann, die immer noch betr e ten dreinschaut.
»Oh, um Himmels willen«, murmle ich lautlos, als es mir einfällt. »Miss Ann Bradshaw, darf ich vor stellen, Mr Thomas Doyle. Mein Bruder. Ich begleite ihn nur hinaus, dann können wir uns an unser ve r dammtes Walzertanzen machen.«
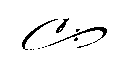
»Das war dein Bruder?«, fragt Ann schüchtern, während ich sie im Walzerschritt durch den Ballsaal b e wege.
»Ja. Ein echtes Scheusal.« Ich bin noch immer ziemlich erschüttert über die Nachricht vom Zustand meines Vaters. Ich hatte gehofft, es ginge ihm inzw i schen besser.
»Er scheint sehr freundlich zu sein.« Ann tritt mir auf beide Füße und ich zucke vor Schmerz zusam men.
»Tom? Hal Er macht nur den Mund auf, um anzugeben. Er ist von einer unerträglichen Selbstgefä l ligkeit. Das Mädchen, das ihn bekommt, kann einem leidtun.«
»Trotzdem finde ich ihn sehr nett. Ein richtiger Gentleman.«
Gütiger Himmel. Sie hat sich in meinen Bruder verguckt. Es ist so lächerlich, dass es gleichzeitig fast zum Weinen ist, wie eine schwarze Komödie.
»Ist er … verlobt?«
»Nein. Anscheinend kann sich niemand mit seiner ersten Liebe messen.«
Ann macht ein enttäuschtes Gesicht. Sie bleibt abrupt, ohne Vorwarnung stehen und verrenkt mir fast den Arm. »Oh?«
»Mit ihm selbst.«
Es dauert eine Weile, bis sie den Scherz kapiert, aber dann lacht sie und bekommt wieder einen roten Kopf. Ich habe nicht das Herz, ihr zu sagen, dass Tom eine reiche Frau sucht, die dazu auch noch hübsch ist, und dass Ann überhaupt keine Chance hat. Wenn er sie nur so hören und sehen könnte, wie sie im Magischen Reich ist. Es ist zum Wahnsinni g werden, dass all das, wozu wir dort fähig sind –all die Kraft, die wir besitzen –, einstweilen auch dort ble i ben muss.
»Ich kann keinen Schritt mehr mit dir tanzen, sonst werde ich für eine Woche grün und blau sein.«
»Du bist diejenige, die aus dem Rhythmus gekommen ist«, schimpft Ann, während sie mir hinaus in den Gang folgt.
»Und du kannst meine Füße nicht vom Fußboden unterscheiden.«
Ann will etwas erwidern, aber da taucht Felicity auf und stürzt uns entgegen. Sie schwenkt ein Blatt Papier über ih rem Kopf.
»Er kommt! Er kommt!«
»Wer kommt?«, frage ich.
Sie fasst unsere Hände und tanzt mit uns im Kreis herum. »Mein Vater! Soeben habe ich eine Nachricht erhalten. Er kommt zum Familientag! Oh, ist das nicht wundervoll?« Sie hält inne. »Meine Güte, ich muss mich beeilen. Ich muss Vorbereitungen treffen. Nun kommt schon –steht nicht einfach nur herum! Wenn ich nicht bis Sonntag lerne, ordentlich Walzer zu tanzen, dann bin ich verloren!«
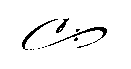
Das Paradies hat seinen Glanz verloren. Mutter und ich streiten uns.
»Aber warum können wir die Magie nicht dorthin mitnehmen, wo sie etwas wirklich Gutes bewirken kann?«
»Ich habe es dir gesagt – weil es gefährlich sein könnte. So b ald du das tust, sobald du die Magie durch das Tor mi t nimmst, steht dieses völlig offen. Jeder, der darüber Be scheid weiß, könnte hierherkommen.« Sie macht eine Pa u se, während sie um ihre Beherrschung ringt. Jetzt erinnere ich mich wi e der an diese Kämpfe zwischen uns –die dazu füh r ten, dass ich anfing, Mutter zu hassen.
Ich reiße ein Büschel Beeren aus, drehe es in meinen Händen. »Du könntest mir dabei helfen. Dann wäre es s i cher.«
Mutter nimmt mir die Beeren weg. »Nein, das kann ich nicht. Ich kann nicht zurück, Gemma.«
»Du willst Vater nicht helfen.« Ich weiß, dass ihr diese Worte wehtun, und das sollen sie auch.
Sie holt tief Luft. »Das ist unfair.«
»Du vertraust mir nicht. Du glaubst nicht, dass ich es kann!«
»Um Himmels willen, Gemma.« Ihre Augen blitzen. »Letztes Mal konntest du zwischen einer Wolke und einer Illusion nicht unterscheiden. Der dunkle Geist in Circes Diensten hat ganz andere Mittel, dich zu täuschen. Wie willst du ihn bannen?«
»Warum sagst du es mir nicht?«, fauche ich.
»Weil ich es nicht weiß! Es gibt keine starre Regel, verstehst du? Es geht darum, den betreffenden Geist und se i nen wunden Punkt zu kennen. Es geht darum, ihm deine Schwächen nicht zu zeigen, damit er sie nicht gegen dich verwenden kann.«
»Was wäre, wenn ich nur ein klein wenig Magie mitnehme, gerade genug, um Vater und meinen Freundinnen zu helfen –weiter nichts.«
Sie fasst mich an den Schultern wie ein Kind. »Gemma, bitte hör mir zu. Versprich mir, dass du die Magie nicht aus ihrem angestammten Reich herau s holst.«
»Ja, ja, ist gut!«, sage ich, während ich mich von ihr losreiße. Ich kann nicht glauben, dass wir uns schon wieder streiten. Ich kämpfe mit den Tränen. »Tut mir leid. Morgen ist der Familientag. Ich bra u che Schlaf.«
Sie nickt. »Kommst du morgen wieder?«
Ich bin zu wütend, um zu antworten. Wortlos kehre ich ihr den Rücken und laufe meinen Freundinnen nach. Felici ty steht vollkommen ruhig auf der Kuppe des Hügels und spannt den Bogen. Sie sieht aus wie die Statue einer Göttin. Mit einem scharfen Zischen fliegt der Pfeil los und spaltet ein Stück Holz säube r lich in zwei Hälften. Die Jägerin gibt ihren Komme n tar ab und die beiden stecken zur Beratung die Köpfe zusammen. Ich kann nicht umhin, mich zu fr a gen, worüber sie auf ihren Jagdausflügen reden oder w a rum mir Felicity immer weniger darüber erzählt. Vie l leicht war ich zu sehr von meinen eigenen Angelegenhe i ten in Anspruch genommen, um mich nach ihren zu e r kundigen.
Pippa liegt in der Hängematte, während der Ritter sie mit Schilderungen seiner galanten Taten erbaut, die er ihretwe gen begangen hat. Er himmelt sie an, als wäre sie das ei n zige Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie labt sich daran wie an Ambrosia. Ann gibt sich ihrem Gesang hin, dabei starrt sie in den Fluss, wo sie sich eine hundertfache Zuh ö rerschaft zusammengeträumt hat, die ihr applaudiert und seu f zend Bewunderung zollt. Ich bin die Einzige hier, die mit ihrem Schicksal hadert, die sich unzufrieden und machtlos fühlt. Der anfängliche Reiz dieses Abe n teuers nutzt sich mehr und mehr ab. Wozu ist es gut, diese a n gebliche Kraft zu besitzen, wenn man sie nicht nutzen darf?
Pippa kommt schließlich herübergeschlendert, eine Rose in ihren Händen drehend. »Am liebsten würde ich für i m mer hierbleiben.«
»Aber das geht nicht«, erkläre ich.
»Warum nicht?«, fragt Ann, die hinter mir die Böschung heraufkommt. Ihr Haar fällt lose und sanft gewellt über ihre Schultern.
»Weil das hier kein Ort zum Verweilen ist«, antworte ich abweisend. »Es ist ein Ort der Träume.«
»Was ist, wenn ich mich für den Traum entscheide?«, fragt Pippa. Es ist typisch Pippa, so etwas zu fragen –dumm und unüberlegt.
»Was ist, wenn ich mich das nächste Mal weigere, euch hierher zu bringen?«
Felicity hat es geschafft, ein kleines Kaninchen zu töten. Es hängt schlaff und leblos an ihrem Pfeil. »Was gibt’s?«
Pippa verzieht den Mund. »Gemma will uns nicht wieder hierher bringen.«
Felicity hält noch immer den blutigen Pfeil in der Hand. »Was soll das, Gemma?« Ihr Gesicht ist hart und ent schlossen und sie durchbohrt mich mit ihrem Blick, bis ich nachgebe und das Wettstarren beende, indem ich die A u gen abwe n de.
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Aber du hast es angedeutet«, mault Pippa.
»Können wir diesen ganzen blödsinnigen Streit nicht einfach vergessen?«, sage ich scharf.
»Gemma.« Pippa schiebt ihre Unterlippe zu einem übertriebenen Schmollmund vor. »Sei nicht böse.«
Felicity nimmt den gleichen lächerlichen Gesichtsausdruck an. »Gemma, bitte hör auf. Es ist sehr schwer, mit solch einem Mund zu sprechen.«
Ann legt noch ein Schäufelchen nach. »Ich verziehe keine Miene, bevor Gemma nicht lächelt. Ihr könnt mich nicht dazu bringen.«
»Ja.« Felicity kichert hinter ihrem Bulldoggengesicht. »Und überall werden die Leute sagen: ›Sie könnten ja so hübsch sein. Ein Jammer, dass sie dieses Lippenproblem h a ben. ‹«
Ich kann mir das Grinsen nicht mehr verkneifen. Und bald kugeln wir uns vor Lachen auf dem Boden und schneiden die unmöglichsten Gesichter, bis wir völlig e r schöpft sind und es Zeit ist zu gehen.
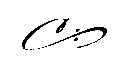
Das Tor erscheint und wir schlüpfen eine nach der anderen hinaus. Ich bin die Letzte. Meine Haut fängt unter dem ge waltigen Energiestrom des Tors an zu kribbeln. Da erblicke ich meine Mutter, mit dem kleinen Mädchen an der Hand. Das Kleid der Kle i nen unter ihrer großen weißen Schürze ist bunt und ungewöhnlich. Nichts, was man an einer engl i schen Mädchenschule sehen würde. Interessant, dass mir das noch nie aufgefallen ist.
Die beiden sehen mich aufmerksam an; hoffnungs-und erwartungsvoll. Als könnte ich die Dinge für sie ändern. Aber wie kann ich ihnen helfen, wenn ich mir selbst nicht zu helfen weiß?