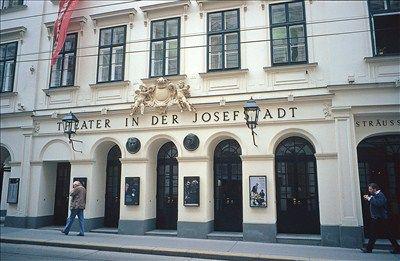Spaziergang 8: Alsergrund und Josefstadt
Sehenswertes
Votivkirche: Der Entwurf für den wegen der angestrebten Fernwirkung etwas erhöht gebauten und von Freiflächen umgebenen ersten Wiener Sakralbau im Stil einer französischen Kathedrale stammt von Heinrich Ferstel und wurde zwischen 1856 und 1879 realisiert. Attraktion in seinem Innern ist das Grabmal von Niklas Graf Salm, der sich im Zuge der ersten Türkenbelagerung (1529) um die Verteidigung Wiens verdient gemacht hatte und ursprünglich in der inzwischen abgerissenen Dorotheerkirche bestattet gewesen war.Besichtigung: Di–Sa 9–13, 16–18 Uhr, So 9–13 Uhr.
Sigmund-Freud-Museum: Es ist ein bisschen so, als sei er gerade hereingekommen, um die Patienten im original eingerichteten Wartezimmer zu begrüßen, denn an der Garderobe hängen noch Hut und Mantel des (Wahl-)Wiener Arztes, der hier seine weltweit beachteten Erkenntnisse über das menschliche Seelenleben gewann. Neben dem Wartezimmer bietet das von der privaten Sigmund-Freud-Gesellschaft unterhaltene Museum eine Dokumentation zum Lebenswerk Freuds, die vor der Kulisse persönlicher Gegenstände präsentiert wird. In einem Nebenraum werden private Filmaufnahmen der Familie gezeigt, und in der ehemaligen Praxis seiner Tochter Anna, die als Kinderanalytikerin in die Fußstapfen des Vaters trat, engagieren sich auf Initiative des amerikanischen Konzeptkünstlers und Freudianers Joseph Kosuth zeitgenössische Künstler für die Foundation for the Arts, Sigmund Freud Museum Vienna. Fachleute finden darüber hinaus eine Bibliothek und ein Archiv zur Geschichte der Psychoanalyse in Österreich vor. 9–17 Uhr, Juli–Sept. bis 18 Uhr, 7 €. Berggasse 19, Tel. 3191596, www.freud-museum.at.
Rossauer Kaserne: Der respekteinflößende Gebäudekomplex der Rossauer Kaserne ist ebenso wie das Arsenal als steinerne Reaktion auf die 1848er-Revolution zu deuten, also als Schutzmaßnahme und Drohgebärde gegen das eventuell stadteinwärts stürmende Proletariat. Sie wurde zwischen 1865 und 1870 unter der Anleitung von Militärs erbaut und gleicht mit ihrer turm- und zinnenreichen Dachlinie einer mittelalterlichen Trutzburg. Heute beherbergt sie u. a. das Verteidigungsministerium und eine Verkehrsleitzentrale.
Liechtenstein
Museum: Das von
einem großen Park umgebene barocke Anwesen derer von Liechtenstein,
dessen Innenausstattung mit (Decken-)Gemälden und Fresken von
Marcantonio Franceschini, Andrea Pozzo und Johann Michael Rottmayr
glänzt, wurde mit großem Finanz- und Arbeitsaufwand zum Museum
umgebaut. Ziel war es, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Vaduz
ausgelagerten fürstlichen Sammlungen nach Wien zurückzuholen, wo
sie nun seit Frühjahr 2004 der staunenden Öffentlichkeit
präsentiert werden. So sind in der Dauerausstellung von Weltrang
u. a. Gemälde von Rubens, Raffael, Cranach und van Dyck sowie
Skulpturen von Massimiliano Soldani oder Andrea Mantegna zu sehen.
Bewundern kann man darüber hinaus erlesenes Porzellan, kostbare
Möbel und Jagdwaffen sowie – als Tüpfelchen auf dem hochkarätigen I
– einen goldenen Wagen des früheren kaiserlichen Botschafters Fürst
Joseph Wenzel von Liechtenstein. Außerdem lädt das privat
betriebene „Haus des Hochbarock“ regelmäßig zu Sonderausstellungen
und an Sonntagen zu klassischen Konzerten im prachtvollen
Herkulessaal ein.

Fr–Di 10–17 Uhr, 10 € für die Dauerausstellung, 4 € für die Sonderausstellungen. Sonntagskonzerte 11–15 Uhr. Fürstengasse 1, Tel. 3195767, www.liechtensteinmuseum.at.
Josephinum/Museum der Medizinischen Universität Wien: Das Josephinum wurde zwischen 1783 und 1785 erbaut und diente seinerzeit als Ausbildungsstätte für Militärärzte. Heute beherbergt das stattliche Gebäude das Pharmakologische Institut für Medizin und das Institut für Geschichte der Medizin, das in seinem gleichnamigen Museum auch Laien Einblick in die Gegenstände seiner Forschung gewährt. Ausgestellt sind Dokumente zum Lebenswerk verdienter Wiener Ärzte, medizinisches Instrumentarium und – wohl die größte Attraktion des Hauses – eine umfangreiche Sammlung in Wachs gefertigter anatomischer Modelle, die ihr detailliert gestaltetes Innenleben preisgeben. Schöpfer dieser Kunstwerke im Dienste der Wissenschaft waren florentinische Bildhauer, bei denen Joseph II. die überaus eindrucksvollen Wachspräparate in den 1780er Jahren in Auftrag gegeben hatte. Schließlich wird dort in einer gerade neu konzipierten Abteilung die mehr als 600jährige Geschichte der Wiener Medizinischen Fakultät dokumentiert.
Mo, Di 9–16, Do–So 10–18 Uhr, 2 €. Führung: Do 11 Uhr (3 €). Währinger Straße 25 (rechter Flügel, 1. Stock), Tel. 4016026000, www.meduniwien.ac.at.
Zahnärztliches Museum: Speziell an Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Interessierte finden gleich nebenan das entsprechende Lehr- und Anschauungsmaterial und Instrumentarium aus mehreren Jahrhunderten.
Mi, Do 10–18 Uhr. Währinger Straße 25a.
Altes und Neues Allgemeines Krankenhaus (AKH): Mit dem Bau des im barock-klassizistischen Stil gehaltenen Alten Allgemeinen Krankenhauses, mit dem Joseph II. den berühmten Architekten Isidore Canevale betraute, leitete der Reformkaiser quasi eine neue Periode der Sozialpolitik ein. In dem Krankenhauskomplex, der auch der medizinischen Ausbildung diente, konnten 2.000 Menschen behandelt werden. Ein absolutes Novum war, dass jeder Patient ein eigenes Bett bekam und psychisch Kranke nicht – wie bis dato üblich – lediglich isoliert, sondern auch (im sog. Narrenturm, s. o.) therapiert wurden.
Das im Laufe seiner Geschichte mehrfach umgebaute und -strukturierte Mammutkrankenhaus war bis in die 1960er Jahre hinein in Vollbetrieb und wurde dann entsprechend den Baufortschritten des seit 1964 errichteten Neuen Allgemeinen Krankenhauses sukzessive geräumt und 1990 endgültig aus seiner medizinischen Verantwortung entlassen. Seither läuft der Betrieb in den ebenso gigantischen, hoch über Wien hinausragenden schwarzen Blöcken des Neuen Allgemeinen Krankenhauses auf vollen Touren.
Das weit ausladende historische Gebäudeensemble des Alten Allgemeinen Krankenhauses wurde 1998 von der Universität Wien bezogen, die dort Institute und interuniversitäre Einrichtungen einquartiert hat. Drum herum haben sich mittlerweile Geschäfte, Restaurants und Studentenkneipen angesiedelt.
Pathologisch-anatomisches Bundesmuseum: Das schon allein wegen seines skurrilen Domizils erlebenswerte Museum besitzt 50.000 Präparate und ist damit eines der größten pathologischen Museen der Welt. Es lagert Feuchtpräparate (in Formalin eingelegte originale Leichenteile, Föten, Tumoren etc.), sog. Mazerationspräparate (per Trocknung konservierte Weichteilpräparate, z. B. Staublungen), Tausende von Wachsnachbildungen vorwiegend dermatologischer Deformationen und Krankheitsbilder (sog. Moulagen) sowie medizinische Geräte.
Mi 15–18, Do 8–11 Uhr, Sa 10–13 Uhr, 2 €. 13. Hof, Spitalgasse 2 (Zugang Von-Swieten-Gasse), Tel. 4068672, www.narrenturm.at.
Österreichisches Museum für Volkskunde: Das 1895 gegründete Museum zog 1917 aus dem Börsengebäude in das zwischen 1706 und 1711 nach Plänen von Johann Lukas von Hildebrandt erbaute Gartenpalais Schönborn an der Laudongasse um. Es zeigt Sammlungen zur historischen Volkskultur Österreichs und seiner Nachbarländer, sprich Ackergeräte und Handwerkszeug, Möbel und Alltagsgegenstände aller Art, Gemälde, Kunst- und Kultobjekte und stets spannende Sonderausstellungen.
Di–So 10–17 Uhr, 5 €. Laudongasse
15–19, Tel. 4068905, www.volkskundemuseum.at.