
Kapitel 4
Prominente
Extremreisende
Grizzly an der Angel
Sie reisen zu Fuß oder mit dem Fahrrad um die Welt, klettern auf die anspruchsvollsten Berge, suchen die Grenzerfahrung in den abgelegensten Regionen der Erde. Zu Hause sein ist für echte Weltenbummler Urlaub, unterwegs sein ist Arbeit. In ihrem Job müssen sie ständig mit Situationen fertig werden, die Otto Normalurlauber als mittlere Katastrophe bezeichnen würde. Sei es eine Schlechtwetterfront, die für Tage sämtliche Pläne zunichtemacht, ein kaputter Reifen oder eine Zwangsübernachtung im Freien, weil keine Unterkunft zu finden ist.
Aber auch Extremreisende geraten hin und wieder in eine Situation, die so erstaunlich ist, dass sie ihnen ewig im Gedächtnis bleibt. Wir haben einige von ihnen nach ihren skurrilsten Erlebnissen unterwegs gefragt. Zu Wort kommen: ein Reisebuchautor, ein Tierfilmer, eine Kajak-Rekordfahrerin, ein Weltwanderer, ein Extremkletterer, ein Wildnis-Fotograf und eine Eiswüsten-Bezwingerin.
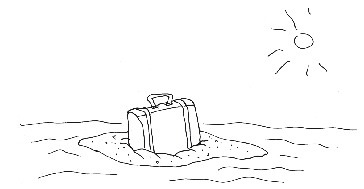
Andreas Kieling, Jahrgang 1959, ist einer der bekanntesten deutschen Tierfilmer. Der Abenteurer hat viel Zeit mit Grizzlys in Alaska verbracht und ist den seltensten Tieren der Welt nahe gekommen: von den Komodowaranen in Indonesien bis zu den Berggorillas in Ruanda.
Bei Reisen nach Alaska haben mir schon Grizzlys die Schuhe vor dem Zelt geklaut oder mein Gummi-Kanu zerbissen. Doch den größten Schreckmoment, den ich je mit Bären erlebt habe, bescherte mir ein junger Küstenbraunbär auf der Inselkette der Aleuten: Mit meinem Segelboot »Tardis« erreichten eine Kollegin und ich im August einen Fjord an der Bärenküste, die ich seit zehn Jahren immer wieder ansteuere. Die Bären dort erkennen mich an Stimme und Geruch – so wie ich die Tiere an ihrem Verhalten erkenne. »Lass uns angeln gehen«, schlug meine Mitseglerin vor, und wir kämpften uns vom Boot aus mit Stiefeln durch das hohe Gras zum Fluss vor, der in die Bucht mündet. Im Hintergrund erhob sich eine Bergkette aus erloschenen Vulkanen.
Wie sich zeigte, war der Fluss voll mit verschiedenen Lachs-arten. Dreimal fing ich einen der wenig schmackhaften Hundslachse, die – wie der Name schon sagt – höchstens an Hunde verfüttert werden. Dreimal ließ ich sie wieder schwimmen. Endlich hatte ich einen leckeren Silberlachs an der Angel, die Schnur straffte sich, die Rute bog sich, und im richtigen Moment zog ich den Fisch an Land. Gerade wollte ich mit einem Stück Holz das zappelnde Tier betäuben, da tauchte direkt neben uns ein Grizzly auf. Blitzschnell schnappte er sich den Lachs unter dem Holzknüppel weg.
Erschrocken schrie ich auf, und der tierische Dieb flüchtete mit dem Fisch im Maul. Im wilden Lauf durch die Graslandschaft zog er die Angelrute an der Schnur hinter sich her und verschwand. Das junge, über 300 Kilogramm schwere Männchen hatte sich zuvor von hinten an uns herangeschlichen und bis auf zwei Meter genähert. Die Hundslachse hatten auch seine Gourmetzunge nicht gelockt – erst bei der Silberlachsdelikatesse schlug er gezielt zu.
Am nächsten Tag fanden wir den Fischkopf im Gras, das Hirn säuberlich ausgeleckt, den Blinker noch im Maul. Daneben lag die Angel mit der gerissenen Schnur. Meine junge Kollegin, die während des Überfalls zur Salzsäule erstarrt war, beschloss nach insgesamt drei Monaten auf der »Tardis«, dass das mit der Tierfilmerei doch nichts für sie ist.
Tony Wheeler, Jahrgang 1946, reiste als 26-Jähriger zusammen mit seiner Frau Maureen über Land von Europa nach Asien. Danach waren sie pleite – und veröffentlichten den Reiseführer »Across Asia on the Cheap«. Es war das erste Lonely-Planet-Buch und der Beginn einer einzigartigen Erfolgsgeschichte. Ihren Verlag haben die Wheelers inzwischen verkauft, sind aber weiterhin jedes Jahr mehrere Monate unterwegs.
Ich war schon seit ein paar Monaten in Indien, um unseren Reiseführer für das Land zu überarbeiten. Allmählich rückte der Abgabetermin näher, und ich musste noch mehrere Orte im Bundesstaat Himachal Pradesh besuchen. Im Kolonialstädtchen Shimla mietete ich für drei Tage ein Auto mit Fahrer – unvermeidlich war, dass der einen Assistenten mitnahm. Die Rundreise sollte über Manali und Dalhousie nach Dharamsala und zuletzt Chandigarh führen.
Wir handelten einen Preis aus und vereinbarten, dass ich eine Anzahlung für Benzin und andere Kosten leisten würde. Der Restbetrag sollte dann am Zielort beglichen werden. Am nächsten Morgen kletterte ich auf den Rücksitz des ehrwürdigen Hindustan-Ambassador-Kleinwagens. Bevor wir die Stadtgrenze erreicht hatten, hielt der Fahrer an, um einen weiteren Vorschuss fürs Benzin zu erbitten. »Ich habe euch eine Anzahlung für Benzin gegeben«, protestierte ich. »Wir haben ausgemacht, dass ich den Rest zahle, wenn wir nach Chandigarh kommen, warum braucht ihr jetzt schon mehr Geld?« Eine umständliche Erklärung folgte. Nach einigen Minuten wurde mir klar, dass wir nirgendwohin fahren würden, wenn ich nicht die Tankfüllung bezahlte, also rückte ich widerwillig das Geld heraus. Anschließend folgten wir weiter der Straße, bis wir nach einigen Kilometern den ersten Platten hatten.
Das Ersatzrad wurde aus dem Kofferraum gewuchtet. Der Reifen war – natürlich – ebenfalls platt, und der Fahrer und sein Assistent setzten sich an den Straßenrand, um beide zu reparieren. Dieser Ablauf wiederholte sich in den nächsten drei Tagen immer wieder: Die beiden fragten nach Cash für Benzin, wir fuhren ein bisschen, dann gab es eine Reifenpanne, und die beiden flickten wieder.
Am zweiten Tag erreichten wir nach Einbruch der Dunkelheit endlich Dharamsala. Und wieder einmal bat das unerschrockene Duo um einen Obulus. »Wir haben kein Geld für Essen und keinen Schlafplatz für die Nacht«, winselte der Assistent. »Ich auch nicht«, antwortete ich mit einem Gefühl boshafter Befriedigung – die Benzin-Vorschüsse hatten in Kombination mit einem kompletten Fehlen von Banken an der Strecke dazu geführt, dass ich keine Rupie mehr in der Tasche hatte.
Bis die Banken am nächsten Morgen öffneten, war ich völlig mittellos und ganz sicher nicht in der Stimmung, zwei Extramahlzeiten in meinem Hotelrestaurant zu ordern. Ich war ziemlich zuversichtlich, dass Fahrer und Assistent es bis zum Morgen am Taxistand aushalten würden. Am nächsten Tag erreichten wir Chandigarh. Nach dem Abschied fuhren die beiden ohne ein Dankeswort davon. Das war vor zwanzig Jahren, aber ich bezweifle, dass eine solche Fahrt heute anders abliefe.
Cecilie Skog, Jahrgang 1974, war als erste Frau an beiden Polen und den sieben höchsten Gipfeln der Kontinente (Seven Summits). Im Januar 2010 vollendete die Norwegerin nach 70 Tagen die erste Durchquerung der Antarktis nur mit Muskelkraft – ohne Unterstützung durch Windsegel oder ähnliche Hilfsmittel.
Fast hätte ich im Jahr 2006 mit meinen Begleitern Rolf Bae und Per Henry Borch die kürzeste Nordpolexpedition aller Zeiten erlebt. Es fehlte nicht viel, und unser Ausflug wäre schon in der ersten Nacht zu Ende gewesen. Wir waren an unserem Startpunkt auf Ellesmere Island. Um bei einer Temperatur von minus 51,7 Grad Schnee zu schmelzen, wollten wir unseren Kocher im Zelt anwerfen. Der wird mit extrem leicht entzündlichem Heptan betrieben, in seinem Tank war fast ein Liter Treibstoff. Weil jedoch eine Gummidichtung eingefroren war, leckte der Tank, und nach und nach verteilte sich flüssiges Heptan auf unseren drei Matten auf dem Boden. Wir merkten davon nichts, wegen der Kälte konnten wir es nicht riechen.
Plötzlich gab es eine Explosion. Der ganze Boden brannte, einen halben Meter hoch loderten die Flammen. Wie die Irren sprangen wir aus dem Zelt. Per und ich schafften es als Erste durch die einander gegenüberliegenden Ausgänge, wobei Pers Wimpern und Augenbrauen Opfer der Flammen wurden. Rolf, der als Letzter herauskam, schaffte es irgendwie, die brennenden Matratzen in den Schnee zu werfen und so das Zelt zu retten. Leider fing dabei seine Hose Feuer, doch im Schnee konnte er die Flammen ersticken.
Im Zelt selber – unserem einzigen – war wie durch ein Wunder nur das Moskitonetz verbrannt. Nachdem wir uns alle von dem Schrecken erholt hatten, reparierte Rolf mit Gaffa-Klebeband seine Hose. Die hat er dann noch die nächsten zwei Monate getragen.
Jean Beliveau, Jahrgang 1955, brach im August 2000 im kanadischen Montréal auf, um zu Fuß um die Welt zu laufen. Im Februar 2011 erreichte er nach mehr als 70 000 Wanderkilometern und Touren durch Afrika, Europa und Asien wieder die Ostküste seines Heimatlandes.
Als ich im Juli 2003 in dem winzigen Dörfchen Swellendam in Südafrika ankomme, ist es bereits dunkel. Da ich nicht weiß, wo ich unterkommen soll, beschließe ich, bei der örtlichen Polizeistation um einen Schlafplatz zu bitten. Auf der Wache muss ich erst einmal warten, weil der Beamte noch einen anderen Besucher abfertigt. Dann hört er sich meine ungewöhnliche Bitte an. Er bringt mich zu einer Gefängniszelle im hinteren Teil des Gebäudes. Leider müsse er die Türen immer verschließen, das sei Vorschrift, sagt der Polizist. Nachdem er mich also eingesperrt hat, geht er nach vorne und verschließt außerdem noch die schwere Metalltür der Station.
Hier bin ich nun also eingekerkert, um mich herum sind drei Betonwände und ein Gitter aus schweren Eisenstäben. Die Ausstattung besteht aus einem Betonbett und einer Toilette aus Edelstahl, die furchtbar stinkt. In der Nachbarzelle ist auch jemand untergebracht.
Ich schlafe trotz allem wie ein Stein und wache erst auf, als der nächste Tag längst begonnen hat. Als ich meinen Schlafsack zusammenrolle, öffnet der Polizist die Tür und fragt, ob ich bereit zum Aufbrechen bin. Ich bitte noch um eine Viertelstunde, um zu packen. Er geht also wieder weg, diesmal verschließt er nur die Außentür der Wache. 30 Minuten vergehen, eine Stunde – langsam gerate ich in Panik. Ich blicke mich um, suche nach einer Fluchtmöglichkeit. Eine der Wände hat ein Drahtgitter als Fenster, und ich sehe draußen Polizeibeamte herumlaufen. Ich brülle hinaus: »Hey! Lasst mich raus! Ich bin kein Häftling! Ich habe hier nur übernachtet. Ich bin ein Kanadier, der um die Welt läuft. Bitte, lasst mich raus!«
Ob es an meinen absurd klingenden Worten liegt oder daran, dass ich schlicht zu leise bin – es kommt keine Reaktion. Ich rufe noch einmal, diesmal begleitet von der Stimme des Gefangenen nebenan, der natürlich auch rauswill.
Nach mehr als eineinhalb Stunden kann ich endlich den Polizisten ausmachen, der mich eingeschlossen hat. Seine Schicht scheint zu Ende zu sein, er macht Anstalten, nach Hause zu gehen. Als er mich rufen hört, eilt er zur Tür und schließt sie auf. »Haben Sie mich vergessen?«, frage ich. »Ich musste eine Anzeige aufnehmen«, sagt er ausweichend. »Wie auch immer – vielen Dank für die Gastfreundlichkeit!« Endlich wieder frei, wandere ich guten Mutes weiter.
Freya Hoffmeister, Jahrgang 1964, umrundete 2010 als erster Mensch auf einer Solotour den Kontinent Australien mit dem Seekajak. Für die 13 714 Kilometer entlang der Küsten brauchte die Husumerin 332 Tage.
Ein einziges Mal habe ich an meinem Plan, ganz Australien zu umpaddeln, gezweifelt. Und überlegt, ob es das Risiko wirklich wert ist. Das war an der Nordküste, etwa auf halber Strecke: Ich war um Mitternacht vom Ninety-Mile-Beach kurz hinter Broome gestartet, da es dort einen großen Tidenhub von zwölf Metern gibt und ich mich nach den Gezeiten richten musste. Um sechs Uhr morgens, es wurde gerade hell, gab es einen kräftigen Ruck am Heck. Ein Haiangriff! Ich musste aufpassen, dass ich mit meinem Seekajak in dem milchigen Wasser nicht kenterte.
Ich war das schon gewohnt: In diesen tropischen Gewässern hatte ich zwei bis drei Raubfischattacken am Tag. Wenn die Haie längere Zeit hinter mir hergeschwommen waren, stießen sie einfach mal ins Heck rein, um meine Futtertauglichkeit zu testen. Zunächst bekam ich jedes Mal einen Riesenschreck, es wackelte, und ich musste das Kajak mit dem Paddel stützen. Es ging aber immer glimpflich ab, und irgendwann habe ich mich nur noch umgedreht und gerufen: Verpiss dich!
Diesmal aber wurde mein Boot immer schwerer. Wahrscheinlich bist du nach rund zwölf Stunden Paddeln einfach müde, dachte ich und landete mittags an. Da bemerkte ich, dass der hintere Teil mit Wasser vollgelaufen war. Zudem entdeckte ich am Heck jede Menge Kratzer und Löcher in der Bootshaut. Bissspuren! In einem Loch ganz oben fand ich sogar einen kleinen Haizahn. Dem Kieferabdruck nach muss der Hai etwa fünf Meter groß gewesen sein und mit weit aufgerissenem Maul in mein Boot gebissen haben. Hätte ich ein weniger stabiles Boot gehabt, wäre es vielleicht zerbrochen. Nach dieser Erkenntnis saß ich erst einmal zwei Stunden lang am Strand, um mich von dem Schock zu erholen. Anschließend habe ich einfach die Löcher geflickt und gedacht: Weiter geht’s!
Nach dem Angriff muss es sich wohl rumgesprochen haben, dass mein Fiberglasboot nicht essbar ist – denn an der ganzen restlichen Küste bin ich nie wieder von Haien attackiert worden.
Michael Martin, Jahrgang 1963, reist seit über 30 Jahren in die heißesten Regionen der Erde. Der Münchner Fotograf und Geograph hat mit seinem Motorrad alle Wüsten der Welt durchquert und mehr als 20 Bücher veröffentlicht.
Die Piste zum Ol Doinyo Lengai, einem aktiven Vulkan im Norden Tansanias, ist mit Motorrädern schwierig zu befahren. Meine drei Mitfahrer und ich kommen langsamer vorwärts als gedacht und müssen in der halbwüstenartigen Landschaft übernachten – eine Fahrstunde vom letzten Massai-Dorf entfernt.
Als ich am nächsten Morgen aus dem Zelt krieche, um den Morgenkaffee zu kochen, fällt mir auf, dass unsere beiden Ersatzreifen fehlen. Hatten wir in der Nacht etwa Besuch von Dieben? Kurze Zeit später stehen zwei hochgewachsene Massai, junge Moran-Krieger mit Speeren, im Lager und beobachten unsere Frühstücksvorbereitungen. Mein Freund Kay mustert die beiden von oben bis unten. Sein verblüffter Blick bleibt an den Schuhen unserer Besucher hängen. Sie sind nagelneu – und aus Reifengummi!
Mittlerweile sind noch zwei Moran dazugekommen, wortlos beobachten auch sie uns und winken dann weitere Krieger herbei. Bevor wir uns über die Motive unserer Besucher im Klaren sind, bemerkt Kay, dass seine Kamera weg ist. Einer der Massai weicht zurück und versucht, unauffällig etwas unter seiner Shuka, seinem roten Umhang, zu verbergen. Als Kay ihn darauf anspricht, greifen sich die Krieger alles Mögliche vom Boden und verschwinden.
Auf dem felsigen Gelände wäre eine Verfolgungsjagd per Motorrad völlig sinnlos. Stattdessen machen wir eine Bestandsaufnahme: »Mir fehlt das Waschzeug!« »Meine Kamera haben sie auch geklaut!« Auch ein paar Töpfe und zwei Schlafmatten sind gestohlen. Was tun? Wir fahren die Piste weiter und treffen bald an einem Brunnen auf die Diebe. Die Massai begrüßen uns freundlich und benehmen sich zunächst, als wüssten sie von nichts. Auf unsere Drohung, dass wir in Mondule die Polizei verständigen, folgt lautes Gelächter.
Bald ist klar: Sie wollen Geld. Wir sollen ihnen alles wieder abkaufen. 1000 Schilling, das entspricht ungefähr 15 Euro, soll die Herausgabe von Kays Kamera kosten, die zweite Kamera »nur« 500 Schilling. Der Waschbeutel hat offensichtlich den größten Wert. Für ihn verlangen sie 10 000 Schilling, 500 für die Töpfe, 100 für die Matten. Abgesehen vom teuren Waschbeutel lösen wir alles ein und setzen unsere Reise fort.
Für uns ein klarer Fall von Diebstahl und Erpressung, für die Massai aber anscheinend eine legitime Methode, Tribut einzukassieren. Immerhin hatten wir ohne Erlaubnis unsere Zelte auf ihrem Land aufgeschlagen. Als ich zu Hause die Filme entwickle, entdecke ich einige verwackelte Bilder. Die Massai haben sich gegenseitig geknipst, als sie im Besitz der Kamera waren.
Alexander Huber, Jahrgang 1968, ist einer der besten Extremkletterer der Welt. Berühmt wurde er vor allem durch seine enorm riskanten Free-Solo-Aufstiege ohne Seil. Manch einer in Deutschland kennt ihn auch aus einem Werbespot für einen Snack.
Überhängende Kalkfelsen, phantastische Steilwände, weicher Sandstrand und Dschungel: Der Ton Sai Beach in Thailand ist ein Traumziel für Kletterer. Ich wollte dort vor ein paar Jahren in den Weihnachtsferien meinen Freund Peter Schäffler zum Klettern treffen. Normalerweise alles ganz einfach: Flug nach Bangkok, weiter nach Krabi und dann mit dem Boot zum Ton Sai Beach. Leider hatte ich nur noch einen Flug nach Phuket gekriegt. Doch dürfte das kein allzu großes Problem sein, wurde mir im Reisebüro versichert, denn von dort könne man sich gut per Boot über die Andamanensee durchschlagen.
In Phuket angekommen, fragte ich am Hafen nach dem nächsten Boot zu dem bekannten Strand und bekam ein Ticket für die Passage zum Ton Sai Beach auf Koh Phi Phi Island. Die Reise war ein echtes Erlebnis, immer wieder passierten wir steile Felsinseln, die wie Pilze aus dem Meer schauten. Wie ein kleines Gebirge, bei dem nur die höchsten Spitzen aus dem Wasser ragen. Auf der Insel angekommen, machte ich mich auf die Suche nach dem Dream Valley Resort, wo wir uns für den Abend verabredet hatten. Auf der Straße fragte ich mehrfach nach dem Hotel. Ich wurde von den Leuten erst in die eine, dann in die andere Richtung geschickt. Aber irgendwie sahen die Insel-Unterkünfte viel zu nobel aus, nicht nach etwas, wo Bergsportler hausten.
Ich fand einen Klettershop im Ort, nur hatte der leider schon geschlossen. Der Laden bot Kurse an, und es waren auch rundherum überall Felsen zu sehen, aber so atemberaubend sah das Ganze nicht aus. Das konnte unmöglich das Ton Sai sein, von dem all die Kletterer redeten. Schließlich fand ich einen Einheimischen, der Bescheid wusste: Der Strand, den ich suchte, war nicht auf Koh Phi Phi, sondern vier Bootsstunden entfernt auf dem Festland direkt neben dem berühmten Railay Beach bei Ao Nang. Wie hätte ich ahnen sollen, dass es in der Andamanensee gleich zwei Strände mit dem gleichen Namen gibt?
Es war schon Abend, und es fuhren keine Fähren mehr. Also musste ich wohl oder übel auf Koh Phi Phi übernachten. Aber nach zwei ausgedehnten Bootsfahrten kam ich schließlich mit einem Tag Verspätung doch noch am Ziel an – der Peter hat sich totgelacht.
 |
Die fünf nervigsten Tiere |
Affen
Sie klauen, was ihnen in die Krallen gerät: Ob Paviane am Kap der Guten Hoffnung, Totenkopfaffen in Costa Rica oder Berberaffen auf Gibraltar – sobald die tierischen Langfinger nahen, sollten Rucksäcke und Autos gesichert sein. Vorsicht vor Mafia-artiger Bandenbildung an idyllischen Stränden! Schnell findet man sich in einem Wirbel von kratzenden Pfoten und scharfen Zähnen wieder, nur weil man Sandwich oder Cola-Dose nicht gleich seinen vierfüßigen Verwandten spenden will.
Mücken
Das fiese Sirren im Ohr – und an Schlaf ist nicht zu denken, meist ist nach einer blutigen Mückenattacke auch der nächste Tag im Eimer. Die winzigen Fieslinge können Urlaubern etwa in Skandinavien oder Kanada glatt den Urlaub verderben und in den Tropen sogar tödliche Krankheiten übertragen. Am Grad der Nervigkeit gemessen, sollte es eigentlich heißen: Mach doch keine Mücke aus einem Elefanten!
Keas
Schlau, schnell und mit scharfen Schnäbeln: Die neuseeländischen Bergpapageien (Nestor notabilis) sind extrem neugierig und vernarrt in Gummi jedweder Art. Die mit olivgrünem Federkleid getarnten Zerstörer hacken Fenster- und Türdichtungen aus Autos, bearbeiten Lack und löchern Fahrradreifen. Selbst geschlossene Rucksäcke zupfen Keas gekonnt auf und bedienen sich am Inhalt. Zum Glück beschränken sie sich – noch – auf die Bergregionen des Inselstaates.
Quallen
Was kann die Qualle dafür, wenn jemand gegen sie schwimmt? Die wabbeligen Tiere sind weder auf menschliche Beute aus noch angriffslustig – aber echt lästig. Obwohl letztlich harmlos, ist es doch eklig, wenn sie sich mit ihren gallertartigen Körpern auf dem Ostseestrand breitmachen. Schmerzhaft wird es, wenn Badende sich eine Portion Nesselgift abholen. In Australien, dem Land der giftigsten Tiere weltweit, kann so eine Begegnung sogar tödlich enden.
Kakerlaken
Das nächtliche Trappeln ihrer kleinen Füße im Zimmer gehört eindeutig zu den Horror-Urlaubserlebnissen: Die platten, schwarzen, äußerst flinken Schaben verseuchen Unterkünfte weltweit, knabbern sich durch jedes Lebensmittel und sind wahre Überlebenskünstler. Selbst nach Atombombentests auf dem Bikini-Atoll erfreuten sich die zähen Insekten noch bester Gesundheit. Immerhin gibt es sie seit über 300 Millionen Jahren – keine guten Aussichten für Kakerlakenhasser!