Zuweilen scheint ein einziges Jahr unsere Welt ins Wanken zu bringen. Im Westen war 1776 ein solcher Augenblick. In Amerika wuchs sich ein Steuerboykott zur Revolution aus; in Glasgow vollendete Adam Smith seinen Wohlstand der Nationen, das erste und größte Werk der politischen Ökonomie; in London kam Edward Gibbons Verfall und Untergang des Römischen Reiches in die Buchläden und wurde über Nacht zur Sensation. Große Männer vollbrachten große Taten. Am 22. März selbigen Jahres indes befand sich James Boswell – neunter Gutsherr auf Auchinleck, verhinderter Literat und ehrgeiziger Schmeichler der Reichen und Berühmten – nicht in einem Salon voll sprühender Geister, sondern in einer Kutsche auf dem matschigen Weg nach Soho, einem Anwesen vor Birmingham in den englischen Midlands (Abbildung 10.1).
Aus der Ferne mochten der Uhrenturm, der Kutschweg und die palladianische Fassade geradewegs den Anschein jener Art von Gutshof erwecken, in die Boswell gern zu Tee und Artigkeiten einkehrte, doch beim Näherkommen zerstreuten das Lärmen und Klirren niederfahrender Hämmer, quietschender Drehbänke und fluchender Arbeiter jede solche Anwandlung. So sah kein Schauplatz eines Jane-Austen-Romans aus. Was sich hier darbot, war eine Fabrik. Und trotz seiner Stellung und Ambitionen wollte Boswell sie sehen, denn nichts auf der Welt war mit Soho vergleichbar.
Alles an der Fabrik erfüllte Boswells Erwartungen: ihre Hunderte von Arbeitern, die »ungeheure Größe und geniale Konstruktion einiger Maschinen«, und vor allem ihr Besitzer, Matthew Boulton ( »ein Eisenhäuptling«, wie Boswell ihn titulierte). Seinem Tagebuch vertraute Boswell an: »Ich werde niemals Mr. Boltons [sic] Ausspruch zu mir vergessen: ›Ich verkaufe hier, wonach alle Welt verlangt – Kraft.‹«11*
Es waren Männer wie Boulton, welche die düsteren Vorhersagen politischer Ökonomen Lügen straften. Als sich Boswell und Boulton 1776 begegneten, hatte sich die gesellschaftliche Entwicklung des Westens seit den eiszeitlichen Jägern und Sammlern, die auf Nahrungssuche die Tundra durchstreift hatten, gerade einmal mühsam auf 45 Punkte nach oben gearbeitet. Binnen der folgenden 100 |474|Jahre schoss sie indes um weitere 100 Punkte in die Höhe. Die Verwandlung war schier unglaublich, sie stellte die Welt auf den Kopf. 1776 lagen Osten und Westen immer noch Kopf an Kopf, nur geringfügig oberhalb der alten massiven Decke von 43 Punkten, an der bislang jede weitere Entwicklung abgeprallt war. Ein Jahrhundert später hatte der Verkauf von Kraft den westlichen Vorsprung in westliche Vorherrschaft verwandelt. Der Dichter William Wordsworth schrieb 1805:

Abbildung 10.1: Der Verkauf von Kraft
Die Wiege der Industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts.
Es war nun wirklich
Damals die Stunde allgemeiner Gärung:
Die Sanftesten erschienen aufgerührt,
Und Aufstand, Streit der Leidenschaften und
Der Meinungen erfüllten selbst die Räume
Der friedlichsten Behausungen mit Unruh’
Und lärmendem Disput. Zu einer Zeit
Schien uns der Boden unseres Alltagsdaseins
Zu heiß geworden, um darauf zu treten.
Oft sagt’ ich da (und später, in Erinnerung
An damals, oft): »Welch eine Parodie
Auf die Geschichte, auf Vergangenheit
Und Zukunft, ist dies hier!«2
|475|Fürwahr, was für eine Parodie – zumindest der Vergangenheit, allerdings durchaus nicht dessen, was die Zukunft noch bringen sollte. Die allgemeine Gärung stand in Wirklichkeit erst am Beginn, und im Lauf des folgenden Jahrhunderts geriet die westliche Entwicklung außer Rand und Band. In jeder Grafik (wie Abbildung 10.2), deren vertikale Achse ausreichend Raum für die 906 Punkte bietet, bei denen der Westen gegenwärtig angelangt ist, schrumpft das Auf und Ab, schrumpft jeder Vorsprung und Rückstand, schrumpfen alle Triumphe und Tragödien, die in den ersten neun Kapitel dieses Buches ausgebreitet wurden, zur Bedeutungslosigkeit zusammen. Und alles dank dessen, was Boulton verkaufte.
Die Welt hatte natürlich schon vor Boulton »Kraft« gehabt. Was er verkaufte, war bessere Kraft. Über Jahrmillionen hinweg war nahezu die gesamte Kraft, mit der sich Gegenstände oder Erdreich bewegen ließen, Muskelkraft gewesen. Muskeln leisten zwar Bemerkenswertes – mit ihrer Hilfe wurden die Pyramiden und der Grand Canal in Irland gebaut –, doch sie haben ihre Grenzen. Am offenkundigsten ist, dass Muskelkraft von Arbeitstieren und menschlichen Arbeitskräften stammt, und diese benötigen Nahrung, Schutz, häufig Brennstoff und Kleidung. All dies wird aus Pflanzen oder anderen Tieren gewonnen, die ebenfalls Nahrung, Schutz etc. brauchen. Und alles in dieser Kette erfordert letztlich Land. Während sich also in den Kerngebieten des 18. Jahrhunderts Land in ein knappes Gut verwandelte, wurde Muskelkraft teuer.
Jahrhundertelang hatten Wind und Wasser die Kraft der Muskeln verstärkt, hatten Schiffe angetrieben und Mühlsteine bewegt. Doch Wind und Wasser stoßen ebenfalls an Grenzen. Sie sind nur an bestimmten Orten verfügbar; Flüsse können im Winter zufrieren oder im Sommer versiegen, und wann immer die Luft drückend wird, geraten Windmühlenflügel ins Stocken.
Was man brauchte, war eine Kraft, die transportabel war, sodass man sie zum Ort der Arbeit bringen konnte, statt die Arbeit zu ihr zu tragen; sie musste verlässlich sein, sodass sie nicht von den Wetterverhältnissen abhing; und raumneutral, sodass sie nicht Abertausende von Hektar Wald- und Ackerland verschlang. Die Eisenhüttenmeister von Kaifeng erkannten im 11. Jahrhundert, dass Kohle eine Antwort bot, aber auch die hatte ihre Grenzen: Sie konnte Energie nur als Hitze freisetzen.
Der Durchbruch – Hitze in Bewegung zu verwandeln – gelang im 18. Jahrhundert und begann in den Kohlebergwerken selbst. Entwässerung, im Bergbau Wasserhaltung genannt, war dort ein stetes Problem. Die Stollen ließen sich zwar mit Muskelkraft und Eimern entwässern (ein findiger englischer Zechenbesitzer spannte 500 Pferde vor eine Eimerkette), aber diese Methode war ungemein teuer. Im Rückblick erscheint die Lösung offenkundig: Verwende zur Wasserhaltung |476|Maschinen, die mit Kohle aus der Mine gefüttert werden, statt Tiere, die Hafer fressen. Doch das war leichter gesagt als getan.

Abbildung 10.2. Allgemeine Gärung
Die gesellschaftliche Entwicklung in den letzten beiden Jahrtausenden zeigt den vom Westen angeführten rasanten Aufstieg seit Beginn des 19. Jahrhunderts, der dem ganzen Drama der vorangegangenen Weltgeschichte spottete.
Die östlichen und westlichen Kerngebiete benötigten im 18. Jahrhundert Kohle, und beiden machte das Grubenwasser zu schaffen, doch es waren britische Maschinenbauer, die eine Antwort darauf fanden. Wie in Kapitel 9 gesehen, begünstigte die atlantische Wirtschaft hier, am äußersten Nordwestsaum Europas, eine halbwissenschaftliche Maschinentüftelei. Aus ihr erwuchsen genau die richtigen Fachleute, die zur Lösung des Problems erforderlich waren, verband sich bei ihnen doch Geschäftstüchtigkeit mit praktischer Erfahrung in Metallverarbeitung und einigen physikalischen Grundkenntnissen. Solche Männer gab es auch in China und Japan, aber sie waren selten, und soweit wir wissen, hat keiner von ihnen je an einer mit Kohle befeuerten Maschine gebastelt.
Die erste funktionstüchtige Pumpe im Westen namens »Miner’s Friend« wurde 1698 in England patentiert. Sie verbrannte Kohle, um Wasser zum Kochen zu bringen, und ließ den Dampf in einem Behälter kondensieren, sodass Unterdruck entstand. Per Hand wurde dann ein Ventil geöffnet und über eine Saugleitung Wasser aus der Grube in den Behälter gehoben. Nun schloss man das Ventil wieder und heizte ein, um das Wasser, wiederum mit Dampfkraft, über den Auslass in eine Druckleitung zu pressen. Dieser der Schwerkraft trotzende |477|Prozess von Verdampfung und Kondensation wiederholte sich ein ums andere Mal.
Die Miner’s Friend war langsam, bewältigte nur einen Wasserhub von zwölf Metern und hatte die entschieden unfreundliche Neigung zu explodieren, aber sie war (gewöhnlich) immer noch billiger, als Hunderte von Pferden zu füttern. Sie inspirierte auch weitere Konstruktionsexperimente, doch selbst die verbesserten Maschinen blieben wahre Energieschleudern. Weil ein und derselbe Kessel zum Verdampfen wie zur Kühlung des Wassers benutzt wurde, um den Unterdruck zu erzeugen, musste der Behälter für jeden Hub wieder neu erhitzt werden. Selbst die besten Maschinen wandelten weniger als ein Prozent der Kohleenergie in Kraft zum Wasserpumpen um.
Jahrzehntelang beschränkte dieser geringe Wirkungsgrad die Dampfkraft auf die alleinige Aufgabe der Grubenentwässerung, und selbst hier forderte ihr Einsatz einen erheblichen Preis: »Der hohe Brennstoffverbrauch dieser Maschinen stellt einen gewaltigen Nachteil für die Gewinne unserer Bergwerke dar«, klagte ein Minenfachmann, »diese hohe Belastung kommt fast einem Verbot gleich.«3 Wer als Unternehmer die Kohle erst aus den Bergwerken zu seinen Fabriken schaffen musste, für den waren Dampfmaschinen schlicht zu teuer.
Dafür waren Maschinen ein Plaisier für Gelehrte. Die Universität Glasgow kaufte die Miniaturversion einer Dampfmaschine, doch als keiner der Professoren sie in Gang zu bringen vermochte, landete sie 1765 in der Werkstatt von James Watt, der für die Universität mathematische Instrumente fertigte. Watt bekam sie in Gang, doch ihr schlechter Wirkungsgrad war dem tüchtigen Handwerker ein Gräuel. Fortan machte er sich neben seinen anderen Arbeiten besessen auf die Suche nach besseren Wegen zur Wasserverdampfung und -kondensation, bis ihm eines schönen Sonntagnachmittags
der Gedanke in den Kopf schoss, dass der Dampf als elastischer Körper in ein Vakuum strömen würde und, falls eine Verbindung zwischen dem Zylinder und einem ausgepumpten Kessel hergestellt würde, er in diesen einströmen und dort kondensieren würde, ohne den Zylinder abzukühlen. … Beim Golfhaus angelangt, hatte ich die ganze Sache in meinem Kopf fertig.4
Da es Sonntag war, blieb dem gottesfürchtigen Mann zunächst nichts anderes übrig, als Däumchen zu drehen, doch am Montagmorgen machte sich Watt sofort daran, ein neues Modell zusammenzuschrauben, bei dem der Kondensator vom Verdampfungszylinder getrennt war. Statt einen Zylinder abwechselnd zu erhitzen und zu kühlen, blieb der Kessel nun heiß, der Kondensator dagegen kalt, was den Kohleverbrauch um beinahe vier Fünftel senkte.
Dies warf ein Bündel neuer Probleme auf, doch Watt werkelte Jahr um Jahr unbeirrt weiter. Seine Frau starb, sein Finanzier ging Bankrott, und immer noch schaffte er es nicht, einen verlässlichen Betrieb der Maschine zu gewährleisten. Doch 1774, gerade als Watt die Tüftelei für eine beständigere Arbeit an den Nagel |478|hängen wollte, kam ihm der Eisenhäuptling Matthew Boulton zu Hilfe, indem er die Beteiligung von Watts verschuldetem Finanzier erwarb und den Maschinenbauer nach Birmingham verfrachtete. Boulton brachte nicht nur Geld mit, sondern auch den genialen Eisenspezialisten und Erfinder John »Iron Mad« Wilkinson. (Wilkinson glaubte, dass alles aus Eisen gemacht werden sollte, einschließlich seines eigenen Sarges.)
Nur sechs Monate später schrieb Watt seinem Vater – für mich die zweitgrößte Untertreibung aller Zeiten (zur größten komme ich noch weiter unten in diesem Kapitel) –, dass seine Maschine nun »recht erfolgreich« sei5. Bei einer großen öffentlichen Vorführung im März 1776 pumpte die Maschine von Watt und Boulton in genau 60 Minuten eine Wassersäule von 20 Meter aus einem Schacht herauf und verbrannte dabei nur ein Viertel so viel Kohle wie ältere Dampfmaschinen.
Kein Wunder, dass Boulton überschwänglich war, als Boswell in jenem Monat Soho besuchte. Nun, da die Maschinen auch außerhalb der Zechen selbst kosteneffizient waren, konnten die Bäume in den Himmel wachsen. »Wenn wir … 100 kleine Maschinen … und 20 große fertig hätten, so könnten wir sie alle leicht losschlagen«, schrieb Boulton an Watt. »Fahren wir das Heu ein, solange die Sonne scheint.«6
Und das taten sie, obwohl selbst sie wahrscheinlich über einige der Kunden erstaunt waren, die an ihre Tür klopften. Die ersten Fabrikanten, die sich auf die Dampfkraft stürzten, waren Hersteller von Baumwolltuch. Baumwolle gedieh in Westeuropa nicht, und bis zum 17. Jahrhundert hatten die Briten gewöhnlich das ganze Jahr über kratzende, schweißtreibende Wolle getragen, wobei sie im Allgemeinen auf Unterwäsche ganz verzichteten. Als Händler daher leichtes, bunt bedrucktes Baumwolltuch aus Indien importierten, war es nicht erstaunlich, dass sie damit reißenden Absatz fanden. »Es kroch in unsere Häuser, unsere Schränke, unsere Schlafzimmer«, erinnerte sich Daniel Defoe, der Autor von Robinson Crusoe, im Jahr 1708. »Vorhänge, Kissen, Stühle und schließlich die Betten selbst waren nichts als Kattun oder Indiennes.«7
Die Importeure machten ein Vermögen damit, aber Geld, das für indische Baumwolle ausgegeben wurde, konnte natürlich nicht ein zweites Mal zum Kauf britischer Wolle verwendet werden. Die Lobby der Wollmagnaten sorgte im britischen Parlament daher für ein Einfuhrverbot von Baumwolltuch, woraufhin andere Briten Rohbaumwolle importierten (was legal blieb) und ihr eigenes Tuch woben. Leider war es nicht so gut wie das indische, und noch in den 1760er Jahren betrug der Markt für britisches Baumwolltuch nur ein Dreißigstel des britischen Wollmarktes.
Baumwolle hatte allerdings einen großen Vorzug: Die arbeitsaufwändige Aufgabe, ihre Fasern zu Garn zu spinnen, ließ sich mechanisieren. Etwa 10 000 Jahre lang waren in der Textilproduktion flinke Frauenfinger vonnöten gewesen, um Büschel von Wolle oder Fasern auf Spindeln zu drehen. Wir haben in Kapitel 7 gesehen, dass chinesische Spinnereien seit Beginn des 14. Jahrhunderts ihre Produktivität |479|mit Maschinen erhöhten, die von Wasser und Zugtieren angetrieben wurden. Diese Maschinen wurden in den folgenden Jahrhunderten gebräuchlicher und vermehrten den Ausstoß stetig, doch der britische Schritt zur Mechanisierung machte alle überkommenen Techniken überflüssig. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts brauchte eine Spinnerin mit einem pedalgetriebenen Spinnrad 200 Stunden, um ein Pfund Garn herzustellen.1* Ein Jahrhundert später schafften außergewöhnliche Geräte mit noch außergewöhnlicheren Namen – Hargreaves’ Jenny, Arkwright’s Throstle, Crompton’s Mule – dieselbe Arbeit in drei Stunden. Und die Selfaktor, die selbsttätige Spinnmaschine von Richard Roberts, erfunden 1824, benötigte dazu gerade einmal eine Stunde und 20 Minuten. Aufgrund ihrer immer gleichen Bewegungsabläufe eigneten sich die Maschinen ideal für den Einsatz von Dampfkraft und die Konzentration in großen Fabriken, und die erste Spinnerei, die gänzlich mit Dampfmaschinen betrieben wurde (geliefert selbstverständlich von Boulton und Watt), eröffnete 1785.
Maschinen machten britisches Baumwolltuch noch billiger, feiner, fester und gleichmäßiger als selbst indisches. Die britischen Baumwolltuchexporte stiegen zwischen 1760 und 1815 um das Hundertfache, wodurch sich das Baumwollgeschäft von einer nachrangigen Industrie zur Quelle von beinahe einem Zwölftel des Nationaleinkommens mauserte. 100 000 Frauen, Männer und (besonders) Kinder schufteten zwölf und mehr Stunden am Tag an sechs Tagen in der Woche in den Fabriken und überfluteten den Markt mit so viel Baumwolle, dass der Garnpreis von 38 Schilling pro Pfund 1786 auf unter sieben Schilling 1807 absackte. Obwohl die Preise purzelten, schossen die Profite dennoch weiter nach oben, weil schlicht die Märkte expandierten.
Die geographischen Gegebenheiten machten Baumwolle zur perfekten Industrie für Großbritannien. Weil der Rohstoff in Übersee wuchs, vermehrte er daheim nicht die Konkurrenz um Land. Stattdessen wandelten die Amerikaner, begierig auf britisches Bargeld, Millionen von Hektar Land in Baumwollplantagen um und ließen Hunderttausende von Sklaven auf ihnen arbeiten. Die Produktion schoss von 3000 Ballen 1790 auf 178 000 Ballen 1810 und 4,5 Millionen Ballen im Jahr 1860 in die Höhe. Britische Innovationen in der Tuchindustrie regten amerikanische Innovationen auf den Plantagen an, wie Eli Whitneys Egreniermaschine, die Cotton Gin, mit der sich die Baumwollfasern noch preisgünstiger von den klebrigen Samen reinigen ließen als selbst durch Sklavenfinger. Das amerikanische Baumwollangebot stieg gleichauf mit der britischen Nachfrage, was die Preise niedrig hielt, die Spinnerei- und Plantagenbesitzer reich machte und auf beiden Seiten des Atlantiks riesige neue Arbeiterarmeen entstehen ließ.
Daheim in Großbritannien sprangen die technischen Innovationen von einer Industrie auf die nächste über. Der wichtigste Sprung ereignete sich in der Eisenverarbeitung, |480|jener Industrie, die andere neue Industrien mit Ausrüstungsgütern versorgte. Britische Eisenfabrikanten kannten die Eisenschmelze mit Koks seit 1709 (sieben Jahrhunderte nach den Chinesen), hatten jedoch Schwierigkeiten, die bei der Koksverhüttung benötigte hohe Hitze in ihren Öfen kontinuierlich zu halten. Nach 1776 ermöglichten die Maschinen von Boulton und Watt die Lösung des Problems durch dampfgetriebene Gebläse, und binnen einer Dekade konnten durch das Puddel- und das Walzverfahren von Henry Cort (so wohlklingend benannt wie irgendeine Technik der Baumwollspinnerei) die verbleibenden technischen Schwierigkeiten überwunden werden. Die Eisenfabrikation befand sich auf demselben Pfad wie die Baumwollindustrie: Die Arbeitskosten stürzten in den Keller, während Beschäftigung, Produktivität und Gewinne explodierten.
Boulton und seine Konkurrenten hatten die Grenzen der Energieausbeutung gesprengt. Obwohl ihre Revolution mehrere Jahrzehnte benötigte, um sich zu entfalten (um 1800 produzierten britische Fabrikanten immer noch dreimal mehr Energie mit Wasserrädern als mit Dampfmaschinen), war es dennoch die größte und schnellste Transformation der gesamten Weltgeschichte. In drei Generationen sprengte der technologische Wandel jene harte Decke, an der jede weitere Entwicklung bislang gescheitert war. Bis 1870 produzierten britische Dampfmaschinen bereits vier Millionen Pferdestärken, das Äquivalent von 40 Millionen Arbeitern, die – wäre die Industrie noch von Muskelkraft abhängig gewesen – mehr als das Dreifache der britischen Jahresgetreideproduktion verzehrt hätten. Fossiler Brennstoff machte das Unmögliche wahr.
Die Einwohner nennen meine Heimatstadt, Stoke-on-Trent in den englischen Midlands, gerne die Wiege der industriellen Revolution. Diesen Ruhm beansprucht sie als Herz der britischen Töpferei-Industrie, wo Josiah Wedgwood in den 1760er Jahren die Vasenherstellung mechanisierte. Die industriemäßige Töpferei durchdrang in Stoke alles. Selbst meine eigenen frühesten archäologischen Erfahrungen als Jugendlicher standen gänzlich in Wedgwoods Schatten, als ich beinahe zwei Jahrhunderte später Ausschusskannen aus einer riesigen Schutthalde hinter der Fabrik von Thomas Whieldon rekonstruierte, wo Wedgwood sein Handwerk gelernt hatte.
Stoke war auf Kohle, Eisen und Ton erbaut, und als ich jung war, standen die meisten seiner Arbeiter noch vor Tagesanbruch auf und gingen auf die Zeche, ins Stahlwerk oder in die Töpferei. Mein Großvater war Stahlarbeiter, und mein Vater ging noch vor seinem 14. Geburtstag von der Schule ab, um im Bergwerk zu arbeiten. In meiner Schulzeit betete man uns unablässig vor, wie unsere Vorfahren mit Beherztheit, Charakterfestigkeit und Erfindungsreichtum Großbritannien groß gemacht und die Welt verändert hatten. Doch soweit ich mich entsinne, erzählte |481|uns niemand, warum es gerade unsere Hügel und Täler und nicht andere an fremden Orten gewesen waren, die zur Wiege der jungen Industrie wurden.
Genau an dieser Frage scheiden sich im Streit um die große Divergenz zwischen West und Ost die Geister. War es tatsächlich unausweichlich, dass sich die industrielle Revolution in Großbritannien ereignete (tatsächlich in und um Stoke-on-Trent) und nicht irgendwo anders im Westen? Falls nicht, war es unvermeidlich, dass sie im Westen und nicht irgendwo anders stattfand? Oder auch nur: dass es überhaupt dazu kam?
Ich habe in der Einleitung dieses Buches bemäkelt, dass die Experten, die Antworten auf diese Fragen anbieten, nur selten weiter als vier oder fünf Jahrhunderte zurückblicken, obwohl sie tatsächlich darum kreisen, ob die westliche Vorherrschaft nicht bereits seit noch fernerer Zeit vorgezeichnet war. Ich hoffe, es ist bis hierhin klar geworden, dass wir bessere Antworten erhalten, wenn wir die industrielle Revolution in die lange historische Perspektive rücken, die ich in den ersten neun Kapiteln dieses Buches umrissen habe.
Die industrielle Revolution war einzigartig darin, wie stark und schnell sie die gesellschaftliche Entwicklung vorantrieb, doch im Übrigen war sie all den anderen Aufschwüngen der früheren Geschichte sehr ähnlich. Wie all jene Phasen (relativ) schneller Entwicklung ereignete sie sich auf einem Territorium, das bis kurz zuvor eher am Rande der Hauptschauplätze gelegen hatte. Seit den Ursprüngen der Landwirtschaft hatten sich die maßgeblichen Kerngebiete durch verschiedene Kombinationen von Kolonialisierung und Nachahmung ausgebreitet, wobei Bevölkerungen an der Peripherie übernahmen, was im Kerngebiet funktionierte, und es an zuweilen sehr unterschiedliche Verhältnisse in den Randgebieten anpassten. Manchmal offenbarte dieser Prozess Vorteile der Rückständigkeit, wie im 5. Jahrtausend v. u. Z., als Bauern erkannten, dass die einzige Überlebensmöglichkeit in Mesopotamien die Bewässerung war, wodurch sich die Region in der Folge zu einem neuen Kerngebiet ausbildete; oder als sich Städte und Staaten im 1. Jahrtausend v. u. Z. in den Mittelmeerraum ausdehnten und neue Muster des Seehandels entwickelten; oder als nordchinesische Bauern nach 400 u. Z. nach Süden flohen und die Region jenseits des Jangtse in ein neues vorgeschobenes Reisanbaugebiet verwandelten.
Als das westliche Kerngebiet sich im 2. Jahrtausend u. Z. aus dem Mittelmeerraum heraus nach Norden und Westen ausdehnte, entdeckten die Westeuropäer schließlich, dass sich ihre geographische Isolation, die so lange Quelle ihrer Rückständigkeit gewesen war, durch neue Schifffahrtstechniken in einen Vorteil ummünzen ließ. Eher zufällig als planvoll begründeten sie neue Arten von Seereichen, und als ihre neuartige atlantische Wirtschaft die gesellschaftliche Entwicklung vorantrieb, erwuchsen aus ihr gänzlich neue Herausforderungen.
Es gab keine Garantie, dass die Europäer ihnen gewachsen sein würden. Weder die Römer (im 1. Jahrhundert u. Z.) noch die Chinesen der Song-Dynastie (im 11. Jahrhundert) hatten es vermocht, die Decke zu einer neuartigen Entwicklungsdynamik |482|zu durchbrechen. Alle Anzeichen sprachen dafür, dass Muskelkraft die endgültige Energiequelle bleiben würde; dass nicht mehr als zehn bis 15 Prozent der Menschen je würden lesen können; dass Städte niemals über etwa eine Million Einwohner, Armeen nie über etwa ebenso viele Soldaten hinauswachsen würden, und dass – als Folge davon – der Index der gesellschaftlichen Entwicklung niemals einen Wert erreichen würde, der den Bereich der unteren 40er überschritte. Doch im 18. Jahrhundert setzten sich die Menschen im Westen über diese Schranken hinweg. Indem sie Kraft verkauften, spotteten sie allem, was es bis dahin gegeben hatte.
Die Westeuropäer hatten Erfolg, wo die Römer und die Chinesen der Song-Zeit scheiterten, weil sich dreierlei verändert hatte. Erstens hatte sich die Technologie weiter angereichert. Einige Fertigkeiten gingen stets verloren, wann immer die gesellschaftliche Entwicklung zusammenbrach, doch die meisten blieben erhalten, und mit den Jahrhunderten gesellten sich neue hinzu. Das Prinzip, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann, blieb in Kraft: Jede Gesellschaft, die sich zwischen dem 1. und dem 18. Jahrhundert der entwicklungshemmenden Decke näherte, unterschied sich von ihren Vorgängern. Jede wusste und vermochte mehr als die jeweils Vorangegangene.
Zweitens standen den Agrarreichen – hauptsächlich aufgrund der Akkumulation von Technologie – nun wirkungsvolle Feuerwaffen zu Gebote, sodass die Russen und die Chinesen der Qing-Zeit den Steppenschnellweg abriegeln konnten. Als folglich die gesellschaftliche Entwicklung im 17. Jahrhundert gegen die eherne Decke presste, war der fünfte Reiter der Apokalypse – die Migration – von seinem Pferd gestiegen. Es war ein zähes Ringen, aber den Kerngebieten gelang es, mit den anderen vier Reitern fertig zu werden und einen Zusammenbruch abzuwenden. Ohne diesen Wandel hätte das 18. Jahrhundert ein ebenso vernichtendes Los ereilen können wie das 3. oder das 13. Jahrhundert.
Drittens – wiederum weitgehend aufgrund der Akkumulation von Technologie – konnten Schiffe nun jedes gewünschte Ziel erreichen, was es den Westeuropäern ermöglichte, eine atlantische Wirtschaft zu entwickeln, die mit nichts Vorangegangenem vergleichbar war. Weder die Römer noch die Chinesen der Song-Zeit waren in der Lage gewesen, eine solch enorme Triebkraft des Wirtschaftswachstums zu entfesseln, daher waren sie auch nicht mit den Problemen konfrontiert, die sich den Westeuropäern im 17. und 18. Jahrhundert aufdrängten. Newton, Watt und ihre Kollegen waren wohl keine größeren Geister als Cicero, Shen Kuo und ihre Kollegen; sie grübelten nur über anderen Problemen.
Die westeuropäische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts war besser in der Lage als alle anderen, um die massive Decke fortzusprengen, die ihrer Entwicklungsdynamik Schranken setzte. Innerhalb von Westeuropa war der Nordwesten – mit seinen schwächeren Königen und freieren Händlern – besser darauf vorbereitet als der Südwesten. Und innerhalb des Nordwestens war es Großbritannien, das sich in der besten Ausgangsposition von allen befand. Bis 1770 hatte es nicht nur |483|höhere Löhne, mehr Kohle, eine größere Finanzkraft und wohl auch offenere Institutionen (zumindest für Menschen aus der Mittel- und Oberschicht) als alle anderen Länder, sondern – dank der Siege in seinen Kriegen mit den Niederländern und Franzosen – auch mehr Kolonien, ein größeres Handelsvolumen und mehr Kriegsschiffe.
Eine industrielle Revolution konnte sich in Großbritannien eher ereignen als anderswo, doch besaß das Land keine ausschließliche Anwartschaft darauf. Wenn es französische und nicht britische Glocken gewesen wären, die 1759 vor lauter Siegesläuten dünner wurden, und wenn es Frankreich gewesen wäre, das Großbritannien seiner Marine, seiner Kolonien und seines Handels beraubt hätte statt umgekehrt, wäre ich als Kind von den Älteren nicht mit Geschichten gefüttert worden, wie Stoke-on-Trent zur Geburtshelferin der industriellen Revolution geworden war. Stattdessen hätten vielleicht die Alten in einer ebenso rußgeschwärzten französischen Stadt wie Lille diese Geschichte erzählt. Frankreich verfügte schließlich über eine Fülle von Erfindern und Unternehmern, und selbst eine kleine Verschiebung in den Produktionsfaktoren des Landes oder Entscheidungen von Königen und Generälen hätte einen großen Unterschied machen können.
Große Männer, vertrottelte Stümper und schieres Glück hatten eine Menge damit zu tun, warum die industrielle Revolution britisch statt französisch war, aber sie waren in weit geringerem Maße dafür verantwortlich, warum dem Westen überhaupt eine industrielle Revolution gelang. Um dies zu erklären, müssen wir auf größere Kräfte schauen. Sobald nämlich ausreichend Technologie akkumuliert war, sobald der Steppenschnellweg verschlossen und die Seeschifffahrtswege über die Ozeane gebahnt waren – um, sagen wir, 1650 oder 1700 herum –, ist es nur schwer vorstellbar, was noch hätte verhindern sollen, dass sich irgendwo in Westeuropa eine industrielle Revolution ereignete. Wenn Frankreich oder die Niederlande zur Werkbank der Welt geworden wären statt England, wäre die industrielle Revolution vielleicht langsamer zum Durchbruch gekommen und hätte womöglich erst in den 1870er statt den 1770er Jahren begonnen. Die Welt, in der wir heute leben, wäre anders, doch Westeuropa hätte dennoch die ursprüngliche industrielle Revolution gehabt, und der Westen hielte trotzdem noch die Vorherrschaft inne. Dann hätte ich zwar immer noch guten Grund, dieses Buch zu schreiben, aber vielleicht auf Französisch statt auf Englisch.
Es sei denn, der Osten hätte sich auf eigene Weise zuerst industrialisiert. Hätte das geschehen können, wenn die westliche Industrialisierung langsamer verlaufen wäre? Hier häufe ich natürlich Hypothese auf Hypothese, doch ich glaube, die Antwort müsste ziemlich klar ausfallen: wahrscheinlich nicht. Obwohl die gesellschaftliche Entwicklung von Ost und West bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gleichauf lag, deuten nur wenige Anzeichen darauf hin, dass der Osten, wäre er auf sich gestellt geblieben, schnell genug in Richtung Industrialisierung |484|vorangekommen wäre, um sich im 19. Jahrhundert aus eigener Kraft emporzuschwingen.
Der Osten verfügte über große Märkte und einen lebhaften Handel, doch funktionierten diese nicht so wie in der atlantischen Wirtschaft des Westens. Gewöhnliche Menschen im Osten waren zwar nicht so arm, wie Adam Smith in Wohlstand der Nationen behauptete ( »Die Armut der Unterschicht übertrifft in China die in den allerärmsten Ländern Europas noch bei weitem.«8), aber, wie Abbildung 10.3 zeigt, alles andere als wohlhabend. Arbeiter in Beijing1* hatten es nicht schlechter als Florentiner, waren aber wesentlich schlechter dran als Londoner. Da Arbeit in China und Japan (und Südeuropa) so billig war, boten sich örtlichen Unternehmern vom Schlage Boultons kaum Anreize, in Maschinen zu investieren. Noch 1880 betrugen die Vorlaufkosten für die Eröffnung eines Bergwerks mit 600 chinesischen Arbeitern schätzungsweise fast 4300 Dollar – grob gerechnet der Preis einer einzigen Dampfpumpe. Selbst als sich ihnen die Wahl bot, zogen kluge chinesische Investoren billige Muskelkraft teurem Dampf vor.
Angesichts eines so geringen Gewinns aus der Maschinentüftelei zeigten weder östliche Unternehmer noch Gelehrte an den kaiserlichen Akademien großes Interesse an Dampfkesseln und Kondensatoren, geschweige denn an Spinnereimaschinen wie den Jennys oder Throstles oder an Verhüttungsverfahren wie dem Puddeln. Um seine eigene industrielle Revolution loszutreten, hätte der Osten eine der atlantischen vergleichbare Wirtschaft gebraucht: mit höheren Löhnen und neuen Herausforderungen, also mit einer Stimulation des ganzen Pakets von wissenschaftlichem Denken, Maschinentüftelei und billiger Kraft.
Abermals: Mit ausreichend Zeit hätte sich auch dies ereignen können. Bereits im 18. Jahrhundert gab es in Südostasien eine blühende chinesische Diaspora. Bei sonst vergleichbarer Ausgangslage hätte sich hier im 19. Jahrhundert jene Art von geographischer Interdependenz entwickeln können, von der die atlantische Wirtschaft geprägt war. Doch die Ausgangslage war eben nicht vergleichbar. Die Menschen im Westen brauchten 200 Jahre, um von Jamestown zu James Watt zu gelangen. Wenn der Osten in glänzender Isolation verblieben wäre, wenn er im 19. und 20. Jahrhundert den gleichen Weg eingeschlagen hätte wie der Westen und eine geographisch diversifizierte Wirtschaft geschaffen hätte und wenn er sich ungefähr in demselben Tempo entwickelt hätte wie der Westen, dann hätte vielleicht ein chinesischer Watt oder ein japanischer Boulton seine erste Dampfmaschine in Shanghai oder Tokio enthüllt. Doch keine dieser hypothetischen Möglichkeiten wurde Wirklichkeit, weil die industrielle Revolution des Westens, nachdem sie einmal begonnen hatte, den Rest der Welt verschlang.

Abbildung 10.3: Arbeiter aller Länder, seid gespalten!
Trotz ihrer Misere verdienten britische Arbeiter zwischen 1780 und 1830 viel mehr als ihre Kollegen in anderen Ländern und stellten sich nach 1830 noch besser. Die Grafik vergleicht die Reallöhne der ungelernten Arbeiter in London, Florenz (recht typisch für die niedrigen Löhne Südeuropas) und Beijing (stellvertretend für die chinesischen und japanischen Löhne).
Noch 1750 waren die Ähnlichkeiten zwischen den östlichen und westlichen Kerngebieten auffallend. Beide waren fortgeschrittene Agrarwirtschaften mit komplexer Arbeitsteilung, ausgedehnten Handelsnetzen und wachsenden Manufaktursektoren. An beiden Enden Eurasiens geboten reiche landbesitzende Eliten, im festen Vertrauen auf die Stabilität, die Traditionen und den Wert ihrer Ordnung, souverän über alles, was sie überblickten. Jede dieser Eliten verteidigte ihre Position mit ausgefeilten Regeln der Ehrerbietung und Etikette, und jede schuf und konsumierte Kultur von hoher Verfeinerung und Gediegenheit. Hinter all den offenkundigen Unterschieden in Stil und Erzählweise fällt es schwer, nicht eine gewisse Verwandtschaft zwischen den ausufernden Sittenromanen des 18. Jahrhunderts wie Samuel Richardsons Clarissa und Cao Xuequins Der Traum der roten Kammer zu erkennen.
Bis 1850 waren all diese Ähnlichkeiten von einem großen Unterschied fortgespült worden: der Aufstieg einer neuen dampfkraftgetriebenen Klasse von |486|Eisenhäuptlingen, die ihren berühmtesten Kritikern zufolge »die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen« hatten. Diese neue Klasse, so fuhren Karl Marx und Friedrich Engels fort, habe »die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt«9.
Die Meinungen darüber, was genau diese neue Klasse tat, unterschieden sich – und zwar radikal –, doch die meisten waren sich einig, dass sie alles umkrempelte. Für einige waren die Millionäre, die Kraft anzapften und verkauften, Helden, die sich durch »Energie und Ausdauer, geleitet von gesundem Urteil, [lediglich] ihr gewöhnliches Verdienst sicherten«. So urteilte Samuel Smiles, Verfasser des viktorianischen Klassikers Selbsthilfe. »In früher Zeit«, so erläuterte er, »waren die Produkte geschulten Fleißes größtenteils Luxuswaren, für die wenigen bestimmt, während heute« – dank der Industriekapitäne – »die vorzüglichsten Werkzeuge und Maschinen in Dienst genommen werden, um der großen Masse der Gesellschaft Artikel des gewöhnlichen Konsums zur Verfügung zu stellen.«10
Für andere jedoch waren die Industriellen fiese, fracktragende Rohlinge, wie Dickens’ Mr. Gradgrind in Harte Zeiten. »Tatsachen allein sind die Dinge, die man im Leben braucht«, insistiert Gradgrind. »Pflanzen Sie nichts anderes ein, und rotten Sie alles andere aus.«11 Dickens hatte die industrielle Revolution von ihrer harten Seite kennen gelernt, als er in einer Schuhpoliturfabrik arbeiten musste, während sein Vater im Schuldgefängnis schmachtete, und hegte entschiedene Ansichten über die Gradgrinds. Seiner Meinung nach laugten sie dem Leben alle Schönheit aus, indem sie die Arbeiter in deprimierende Städte wie sein imaginäres Coketown trieben, diesen »Triumph der Tatsache …, eine Maschinenstadt und eine Stadt der hohen Essen, aus denen sich endlose Rauchschlangen immer und ewig emporringelten und niemals abgewickelt wurden«12.
Es gab im echten Leben zweifellos Gradgrinds zuhauf. Der junge Friedrich Engels beschrieb, wie er in den 1840er Jahren einem davon über den Weg lief und ihm einen Vortrag über das schwere Los der Arbeiter eines realen Coketown hielt: »Der Mann hörte das alles ruhig an, und an der Ecke, wo er mich verließ, sagte er: And yet, there is a great deal of money made here – und doch wird hier enorm viel Geld verdient – guten Morgen, Herr!«13
Der Geschäftsmann hatte Recht: Indem sie die in fossilen Brennstoffen eingeschlossene Energie anzapften, hatten die Maschinen von Boulton und Watt einen Sturm des Geldmachens ausgelöst. Doch auch Engels hatte Recht: Die Arbeiter, die diese Geldwerte produzierten, sahen selbst herzlich wenig davon. Zwischen 1780 und 1830 nahm der Ausstoß je Arbeiter um 25 Prozent zu, während die Löhne nur um kaum fünf Prozent stiegen. Der Rest wurde als Profit abgeschöpft. In den Elendsvierteln braute sich Wut zusammen. Die Arbeiter gründeten Gewerkschaften und verlangten nach einer Volkscharta (People’s Charter). Radikale schmiedeten ein Komplott, um die Regierung in die Luft zu sprengen. Landarbeiter, die |487|sich durch mechanische Drescher in ihrer Existenz bedroht sahen, zertrümmerten 1830 Landmaschinen, steckten Heuschober in Brand und unterzeichneten Drohbriefe an Grundbesitzer mit dem piratenhaft klingenden Namen »Captain Swing«. Überall witterten Richter und Geistliche den Hauch von Jakobinertum, ihr Überbegriff für aufrührerische Umtriebe französischen Stils. Die Besitzenden gingen dagegen mit der ganzen Wucht des Staates vor: Berittene Polizei trampelte Demonstranten nieder; Gewerkschafter kamen hinter Schloss und Riegel; Maschinenstürmer wurden in Strafkolonien an die äußersten Ränder des British Empire verschifft.
Für Marx und Engels war der Fall glasklar: Die westliche Industrialisierung trieb die gesellschaftliche Entwicklung schneller voran denn je zuvor, doch sie stürzte sie auch mit Lichtgeschwindigkeit in das Entwicklungsparadox.1* Indem sie Menschen zu bloßen Lohnarbeitern degradierten, zu Zahnrädchen aus Fleisch und Blut in Stahlhütten und Fabriken, vergesellschafteten die Kapitalisten sie auch zum Proletariat und machten sie zu Revolutionären. Die Bourgeoisie, so folgerten Marx und Engels, »produziert vor allem ihren eigenen Totengräber. … Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!«14
Marx und Engels glaubten, dass die zitternden Kapitalisten sich dieses düstere Los selber eingebrockt hatten, indem sie die Enteigneten vom Land ausgesperrt und als Lohnsklaven in die Städte vertrieben hatten. Doch da irrten sie sich. Tatsächlich wurde die Landbevölkerung nicht von reichen Landbesitzern vertrieben, sondern sie wanderte aus Gründen ab, die mit ihrer Sexualität zu tun hatten. Die intensive Landwirtschaft des 19. Jahrhunderts benötigte mehr Feldarbeiter, nicht weniger, und der wahre Grund, warum die Menschen vom Land in die Stadt zogen, war die Fortpflanzungsrate. Die Lebenserwartung stieg zwischen 1750 und 1850 um etwa drei Jahre. Die Historiker sind sich zwar nicht einig, warum dies geschah (ob dafür weniger Pestausbrüche, nahrhafteres Essen, eine bessere Wasserversorgung und Kanalisation, ein klügeres Verhalten während der Schwangerschaft, Baumwollunterwäsche oder völlig andere Gründe verantwortlich waren), doch diese gewonnenen Jahre bedeuteten, dass Frauen drei Jahre länger schwanger werden konnten. Sofern sie nicht später heirateten, ihre Sexualpraktiken änderten, ihre Kinder abtrieben oder verhungern ließen, hatten sie mehr Nachwuchs großzuziehen. Tatsächlich änderten Frauen ihr Verhalten, doch nicht genug, um ihre höhere Lebenserwartung auszugleichen, und so kam es zwischen 1780 und 1830 grob gerechnet zu einer Verdoppelung der britischen Bevölkerung auf etwa 14 Millionen. Etwa eine Million dieser zusätzlichen |488|Menschen blieb auf dem Land, doch sechs Millionen suchten Arbeit in den Städten.
Diese harten demografischen Tatsachen lassen das Glas der industriellen Revolution als halb gefüllt statt halb leer erscheinen. Die Industrialisierung war traumatisch, doch die Alternativen wären schlimmer gewesen. Im 16. Jahrhundert waren die Löhne überall im Westen eingebrochen, weil die Bevölkerung wuchs, doch nach 1775 stiegen die britischen Löhne tatsächlich und zogen allen anderen davon (Abbildung 10.3). Als die Briten wirklich hungerten, wie während der entsetzlichen irischen Hungersnot in den 1840er Jahren, hatte dies mehr mit der Kartoffelfäule, mit gierigen Landbesitzern und dummen Politikern als mit der Industrie zu tun (von der in Irland kaum die Rede sein konnte).
Die Ironie ist, dass sich eben in jenen Jahren, als Marx und Engels ihre Doktrinen formulierten, das Blatt zugunsten der Arbeiter zu wenden begann. Seit 1780 hatten die Kapitalisten einen erheblichen Teil ihrer Profite auf Landhäuser, Adelstitel und andere Statussymbole für Emporkömmlinge verwendet, doch noch größere Beträge hatten sie in neue Maschinen und Hütten zurückgesteckt. Bis etwa 1830 machten diese Investitionen die mechanisch gesteigerte Arbeit jedes dreckstarrenden, schlecht ernährten und ungebildeten Lohnarbeiters so profitabel, dass es die Bosse häufig vorzogen, Abmachungen mit Streikenden zu treffen, als sie zu feuern und mit anderen Fabrikherren um neue Arbeiter zu konkurrieren. In den folgenden 50 Jahren wuchsen die Löhne so schnell wie die Gewinne, und 1848, als Marx und Engels das Kommunistische Manifest veröffentlichten, eroberten die Löhne der britischen Arbeiter wieder jene Höhen zurück, die sie nach dem Schwarzen Tod erklommen hatten.
In den 1830er Jahren brach sich, wie es in jeder Epoche geschieht, das Denken Bahn, das die Zeit brauchte, und als die Arbeiter wertvoller wurden, entdeckten die Mittelschichten eine – gewisse – Sympathie für die Unterdrückten. Einerseits erschien Arbeitslosigkeit bald als entschieden verwerflich, und Arme wurden (zu ihrem eigenen Besten, wie die Mittelschichten sagten) ins Arbeitshaus gesteckt; andererseits machte Dickens’ Bild eines solchen Arbeitshauses seinen Roman Oliver Twist zu einem Bestseller. Reformen wurden zur Losung der Stunde. Offizielle Kommissionen prangerten städtisches Elend an, das Parlament verbannte Kinder unter neun Jahren aus den Fabriken und beschränkte die Arbeit für unter 13-Jährige auf eine 48-Stunden-Woche, und es wurden die ersten holprigen Schritte zur Bildung der Massen unternommen.
Diese frühen Reformer der viktorianischen Epoche mögen uns heute heuchlerisch vorkommen, doch schon die bloße Idee, praktische Schritte zur Verbesserung des Lebens der Armen zu unternehmen, war revolutionär. Der Gegensatz zum östlichen Kerngebiet ist besonders stark. In China, wo Gradgrinds, Coketowns und Fabrikarbeiter auffällig selten blieben, fuhren gelehrte Herren mit der jahrhundertealten Tradition fort, handbemalte Schriftrollen mit utopischen Reformvorschlägen an kaiserliche Bürokraten zu schicken, die sie nach ebenso |489|alter Sitte zu ignorieren pflegten. Möchtegernreformer rekrutierten sich weiterhin weitgehend aus den Rändern der Elite. Hong Liangji (der wegen »höchster Unschicklichkeit« zum Tode verurteilt wurde, nachdem er die Untätigkeit der Regierung in sozialen Fragen kritisiert hatte) und Gong Zizhen (ein Exzentriker, der sich seltsam kleidete, sich einer wilden Kalligraphie bediente und wie ein Verrückter dem Spiel frönte), vielleicht die konstruktivsten Sozialkritiker, scheiterten beide mehrfach am höchsten Beamtenexamen und entfalteten keine große Wirkung. Selbst eminent praktische Vorhaben wie das in den 1820er Jahren aufgelegte Programm zur Verschiffung von Reis nach Beijing auf dem Seeweg, um der schlechten Schiffbarkeit und Korruption auf dem Kaiserkanal auszuweichen, ließ man schluren.
Nur im Westen, nirgendwo sonst, wurde eine schöne neue Welt aus Kohle und Eisen geboren, und zum ersten Mal in der Geschichte schienen die Möglichkeiten wahrhaft grenzenlos. »Wir betrachten es als Glück und Privileg, dass uns das Los beschieden war, in den ersten 50 Jahren dieses Jahrhunderts zu leben«, frohlockte die britische Zeitung The Economist 1851; »die Periode der letzten 50 Jahre … erlebte einen rascheren und erstaunlicheren Fortschritt als alle Jahrhunderte, die ihr vorangingen. In mehreren entscheidenden Punkten ist der Unterschied zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert, soweit es das zivilisierte Europa betrifft, größer als der zwischen dem 1. und dem 18. Jahrhundert.«15 Im Westen beschleunigte sich die Zeit, der Rest der Welt blieb auf der Strecke.
London, 2. Oktober 1872, 7.45 Uhr. Es ist eine berühmte Szene. »Hier bin ich, meine Herren!«, ruft Phileas Fogg aus, als er in den Club stürmt.16 Obwohl in Ägypten mit einem Bankräuber verwechselt, in Nebraska von Sioux angegriffen und in Indien in die Rettung einer schönen Witwe vor dem erzwungenen Selbstmord verwickelt (Abbildung 10.4), hatte Fogg Wort gehalten: Er war in 80 Tagen um die Erde gereist und auf die Sekunde pünktlich zurückgekehrt.
Es ist nur ein Stück Literatur, doch die Reise um die Erde in 80 Tagen stand, wie alle Erzählungen von Jules Verne, fest auf dem Boden der Fakten. Der mit einem so trefflichen Namen ausgestattete George Train war 1870 tatsächlich in 80 Tagen um die Welt gereist, und obwohl die Romanfigur Fogg auf Elefanten, Schlitten und Segelschiffe zurückgriff, wenn ihn die Technik im Stich ließ1*, hätten weder er noch Train ihre Reisen ohne die brandneuen Triumphe der Ingenieurskunst bewältigen können – den Suezkanal (eröffnet 1869), die Bahnverbindung San Francisco–New York (fertiggestellt im selben Jahr) und die Eisenbahnstrecke Bombay–Kalkutta2* (in Dienst genommen 1870). Die Welt, wie Fogg vor seiner Abreise bemerkte, war nicht mehr so groß wie früher.
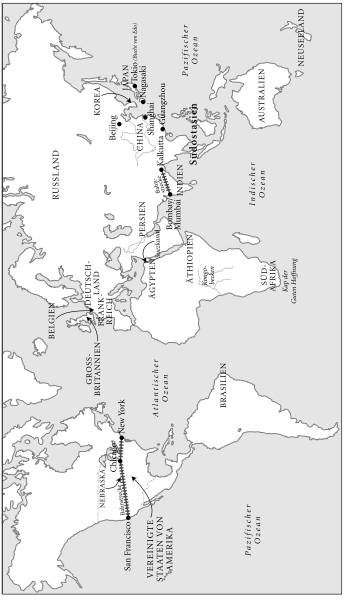
Abbildung 10.4. Reise um die
Erde
Die Vorherrschaft des Westens lässt die Welt schrumpfen.
|491|Eine aufstrebende gesellschaftliche Entwicklung und expandierende Kerngebiete waren immer Hand in Hand gegangen, wenn Kolonisten die neuen Lebensstile nach außen trugen und ihnen Menschen an den Peripherien nacheiferten, widerstanden oder vor ihnen flüchteten. Das 19. Jahrhundert unterschied sich davon nur in Ausmaß und Geschwindigkeit, doch diese Unterschiede veränderten den Lauf der Geschichte. Vor dem 19. Jahrhundert hatten große Reiche diesen oder jenen Teil der Welt dominiert, nur einzelne Territorien ihrem Willen unterworfen, doch die neuen Technologien rissen alle Grenzen ein. Zum ersten Mal ließ sich ein Vorsprung in gesellschaftlicher Entwicklung in globale Vorherrschaft verwandeln.
Die Umwandlung von fossiler Energie in Bewegung löschte Entfernungen aus. Bereits 1804 demonstrierte ein britischer Ingenieur, dass leichte Hochdruckdampfmaschinen Kutschen auf eisernen Schienen antreiben konnten, und ab den 1810er Jahren trieben ähnliche Maschinen Raddampfer an. Nach einer weiteren Generation begnadeter Tüftelei schnaubte George Stephensons berühmte Rocket mit 46 Stundenkilometern 3*den Schienenstrang der Liverpool-Manchester-Eisenbahn entlang, und Raddampfer überquerten den Atlantik. Die gesellschaftliche Entwicklung überwand die geographischen Zwänge schneller als je zuvor: Nicht länger abhängig von Wind und Wellen, konnten Schiffe nicht nur jeden beliebigen Ort anlaufen, sondern auch in See stechen, wann immer sie wollten, und sofern für die Schienen gesorgt war, ließen sich Güter auf dem Landweg beinahe so günstig transportieren wie über Wasser.
Die Technik verwandelte die Kolonisierung. Über fünf Millionen Briten (aus einer Bevölkerung von 27 Millionen) wanderten zwischen 1851 und 1880 aus, meist nach Nordamerika, die letzte neue Grenzregion. Zwischen 1850 und 1900 rodete diese »weiße Plage«, wie Niall Ferguson sie nennt,17 67 Millionen Hektar Wald, mehr als das Zehnfache der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche Großbritanniens. Bereits 1799 notierte ein Reisender über die amerikanischen Pioniere: »Überhaupt haben sie einen unüberwindlichen Widerwillen gegen Bäume; wo sich jemand anbaut, werden sie alle weggehauen, und nicht einer wird übrig gelassen.«18 Hundert Jahre später war diese Abneigung noch gewachsen, unterstützt von Entwurzelungsmaschinen, Flammenwerfern und Dynamit.
Ein beispielloser Aufschwung der Landwirtschaft ernährte nicht minder erstaunliche Städte. 1800 gab es 79 000 New Yorker, 1890 waren es 2,5 Millionen. Unterdessen wurde Chicago zum Weltwunder: 1850 eine Präriestadt von 30 000 Einwohnern, war es 1890 die sechstgrößte Stadt der Welt mit über einer Million|492|Menschen. Chicago ließ Coketown vornehm aussehen. Ein erstaunter Kritiker schrieb:
Für sie und durch sie waren die gesamten Mittelstaaten, war der gesamte Große Nordwesten erfüllt vom Widerhall lebhaften Handels und Gewerbes; Sägemühlen kreischten, Fabriken, deren Rauch den Himmel verdunkelte, rasselten und flammten; Räder drehten sich, Kolben schossen in ihren Zylindern auf und nieder; Zahnräder griffen in Zahnräder; Treibriemen legten sich fest um die Scheiben von riesigen Rädern; und Bessemerbirnen in Eisenhütten spien ihren Sturmhauch flüssigen Stahls in die Atmosphäre. Es war die Herrschaft, die widerstandslose Unterwerfung dieser ganzen zentralen Welt der Seen und Prärien.19
Bei der Ausbreitung der Industrialisierung gen Osten nach ganz Europa bewirkte Nachahmung weit mehr, als es die Kolonialisierung vermocht hätte. 1860 war Großbritannien noch die einzige durchindustrialisierte Wirtschaft und sorgte für die Hälfte der weltweiten Eisen- und Textilproduktion, doch zuerst in Belgien (das über gute Kohle- und Erzvorkommen verfügte) und dann entlang eines Bogens von Nordfrankreich durch Deutschland bis nach Österreich brach das Zeitalter des Dampfes und der Kohle an. Bis 1910 hatten die ehemaligen Peripherieländer Deutschland und USA die Vorzüge ihrer Rückständigkeit entdeckt und ihren Lehrmeister überflügelt. Die Deutschen, mit weniger Kohle gesegnet als die Engländer, lernten, den Brennstoff effizienter zu nutzen, und da es ihnen an Arbeitern mangelte, die – hervorgegangen aus Generationen der praktischen Ausbildung am Arbeitsplatz – einen sechsten Sinn dafür entwickelt hatten, wann genau ein Ventil zu schließen oder ein Klöppel anzuziehen war, führte das Kaiserreich technische Ausbildungsgänge ein.
Die Amerikaner, denen alte, kapitalstarke Familienunternehmen fehlten, entdeckten einen anderen Vorteil. Die Veräußerung von Anteilen, um Geld für große moderne Unternehmen aufzunehmen, trennte die Eigentümer wirkungsvoll von den angestellten Managern, die sich frei fühlten, mit Zeit- und Bewegungsstudien, Fließbändern und der neuen Wissenschaft vom Management zu experimentieren. All dieses Buchwissen kam den Engländern ziemlich lächerlich vor, doch in neuen Hochtechnologiesektoren wie der optischen und chemischen Industrie ließen sich mit etwas Wissenschaft und Managementtheorie bessere Ergebnisse erzielen als durch Intuition. Nach 1900 war es Großbritannien mit seinem Glauben an Improvisation, Durchwurstelei und begnadete Amateure, das langsam lächerlich auszusehen begann.
Deutschland und die Vereinigten Staaten bahnten der zweiten industriellen Revolution, wie sie von Historikern häufig genannt wird, den Weg, indem sie in systematischerer Weise wissenschaftliche Erkenntnisse für den technischen Fortschritt nutzbar machten. Sie ließen Phileas Foggs Großtaten bald alt aussehen und verwandelten das 20. Jahrhundert in ein Zeitalter des Öls, der Automobile und Flugzeuge. 1885 entdeckten Gottlieb Daimler und Carl Benz, wie man mit |493|Benzin (bislang ein geringwertiges Nebenprodukt von Lampenkerosin) effizient einen Verbrennungsmotor befeuern konnte, und im selben Jahr perfektionierten britische Mechaniker das Fahrrad. Mit einer Kombination von leichten neuen Maschinen und robusten neuen Chassis ließen sich Autos und Flugzeuge bauen. 1896 waren Automobile noch so langsam, dass ihnen Zuschauer beim ersten amerikanischen Autorennen hinterherriefen: »Holt euch Pferde!«20 1913 indes verließen eine Millionen Autos die amerikanischen Fabriken. Bis dahin hatten zwei Fahrradmechaniker aus North Carolina, die Brüder Wilbur und Orville Wright, Flügel an einen Verbrennungsmotor geschraubt und das Ganze zum Fliegen gebracht.
Öl verwandelte die geographischen Bedingungen. »Die Entwicklung des Verbrennungsmotors ist das Größte, was die Welt je gesehen hat«, sagte ein englischer Ölunternehmer 1911 voraus, »denn so sicher, wie ich diese Zeilen schreibe, wird er den Dampf ablösen, und das mit fast tragischer Geschwindigkeit.«21 Weil Öl leichter und energiereicher als Kohle ist und höhere Geschwindigkeiten ermöglicht, blieben diejenigen, die sich an die Dampfkraft klammerten statt in die neuen Maschinen zu investieren, unausweichlich auf der Strecke. »Die allererste Notwendigkeit«, erklärte der höchste britische Admiral 1911, »ist Geschwindigkeit.«22 Englands Marineminister Winston Churchill fügte sich ins Unvermeidliche und stellte die Royal Navy von Kohle auf Öl um. Großbritanniens endlose Kohlevorräte fingen an, weniger ins Gewicht zu fallen als der Zugang zu Ölfeldern in Russland, Persien, Südostasien und vor allem Amerika.
Die Kommunikationsmittel änderten sich ebenso rasch. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts bestand die schnellste Methode, eine Nachricht um die Welt zu schicken, darin, einen Brief per Schiff zu versenden, doch 1851 konnten Briten und Franzosen erstmals Nachrichten über die elektrischen Signale eines Unterwasserkabels austauschen. 1858 telegraphierten die britische Königin Victoria und der amerikanische Präsident James Buchanan über den Atlantik, und mehr als einmal hing nun alles von einem rechtzeitig eintreffenden Telegramm ab. Zwischen 1866 und 1911 fielen die Kosten transatlantischer Telegramme um 99,5 Prozent, doch mittlerweile nahm man solche Einsparungen für selbstverständlich. Die ersten Telefone klingelten 1876, gerade einmal drei Jahre, nachdem Jules Vernes Reise um die Erde in 80 Tagen erschienen war; 1895 kam die drahtlose Telegraphie; 1906 folgte das Radio.
Schnellere Verkehrs- und Kommunikationsmittel befeuerten ein explosives Wachstum der Märkte, und die Herolde des Freihandels übertönten mit der Zeit die Verfechter des Protektionismus. Letzteren kam die Begeisterung für freie Märkte wie blanker Wahnsinn vor. Britische Hersteller exportierten Eisenbahnen, Schiffe und Maschinen, und britische Finanziers liehen Ausländern das Geld, um sie zu kaufen. Großbritannien baute letztlich ausländische Industrien auf, die seine wirtschaftliche Vorherrschaft herausfordern würden. Für die Freihändler jedoch steckte in dem Wahnsinn Methode. Indem das Vereinte Königreich |494|allenthalben seine Produkte verkaufte und Geld verlieh, selbst an seine Rivalen, schuf es einen so großen Markt, dass es sich auf jene industriellen (und zunehmend finanziellen) Kompetenzen konzentrieren konnte, die den größten Profit abwarfen. Und nicht nur das: Britische Maschinen halfen den Amerikanern und Kontinentaleuropäern, jene Nahrungsmittel zu produzieren, die Großbritannien zukaufen musste, und mit den Profiten daraus wiederum noch mehr britische Waren zu erwerben.
Die Verfechter des Freihandels argumentierten, dass jeder – jeder zumindest, der gewillt war, die harte Gradgrind-Logik der Liberalisierung zu schlucken – dabei gewinnen würde. Wenige Länder waren so enthusiastisch wie Großbritannien (besonders Deutschland und die Vereinigten Staaten schotteten ihre jungen Industrien vor britischer Konkurrenz ab), aber bis zu den 1870er Jahren war das westliche Kerngebiet praktisch zu einem einzigen Finanzsystem verflochten. Seine verschiedenen Währungen waren mit festen Wechselkursen an den Goldstandard gebunden, was den Handel verlässlicher machte und die Regierungen verpflichtete, sich an die Marktregeln zu halten.
Doch das war erst der Anfang. Die Liberalisierung machte an den Schlagbäumen nicht halt, sie wischte die Grenzen zwischen den Nationen beiseite und riss die überkommenen sozialen Barrieren in ihrem Innern nieder. Die Liberalisierung war ein Pauschalarrangement, wie Marx und Engels sehr hellsichtig erkannten:
Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen die erste Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor allen anderen aus. Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neu gebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen.23
Wenn überkommene Regeln und Festlegungen, wie sich die Menschen zu kleiden hatten, zu wem sie beten sollten und welche Arbeit sie ausüben durften, mit der Produktivität und dem Marktwachstum in Konflikt gerieten, dann mussten diese Traditionen weichen. Der liberale Denker John Stuart Mill folgerte, dass »der einzige Grund, aus dem die Menschheit, einzeln oder vereint, sich in die Handlungsfreiheit eines ihrer Mitglieder einzumengen befugt ist, der ist: sich selbst zu schützen. … Über sich selbst, über seinen eigenen Körper und Geist ist der Einzelne souveräner Herrscher.«24 Alles andere stand nunmehr zur freien Disposition.
|495|Leibeigenschaft, Handwerkszünfte und andere rechtliche Beschränkungen der Bewegungs- und Berufsfreiheit zerbröckelten. Es bedurfte eines Krieges, eines furchtbaren Krieges mit mehr als 600 000 Toten, um die amerikanische Sklaverei 1865 zu beenden, doch innerhalb einer Generation erließen die anderen Sklavenhalterstaaten des Westens Gesetze, um mit dieser kollektiven Freiheitsberaubung friedlich (und häufig gewinnbringend) Schluss zu machen. Arbeitgeber trafen mit den Arbeitern zunehmend Übereinkünfte, und nach 1870 legalisierten die meisten Länder Gewerkschaften und sozialistische Parteien, gewährten Männern das allgemeine Wahlrecht und sorgten für eine freie, verpflichtende Grundschuldbildung. Als die Löhne und der Lebensstandard stiegen, führten einige Regierungen öffentliche Gesundheitsprogramme, Renten- und Arbeitslosenversicherungen ein. Im Gegenzug waren die Arbeiter zum vaterländischen Dienst in Armee und Marine bereit.
Die Liberalisierung nagte selbst an den ältesten Vorurteilen. Beinahe 2000 Jahre lang hatten die Christen Juden und sonstige Andersgläubige verfolgt, doch plötzlich erschien der Glaube der Menschen als ihre Privatsache. Die Anbetung fremder Götter war kein Grund mehr, ihnen den Erwerb von Eigentum oder das Wahlrecht vorzuenthalten. Tatsächlich schien für eine wachsende Zahl von Menschen der Glaube überhaupt kein Thema mehr zu sein, und neue Glaubensüberzeugungen wie Sozialismus, Evolutionismus und Nationalismus füllten den Platz aus, den die Religion so lange eingenommen hatte. Und als wäre die Entthronung Gottes noch nicht genug, geriet das ehernste Vorurteil von allen, die Minderwertigkeit der Frau, ebenfalls unter Beschuss. So war John Stuart Mill überzeugt, dass »das Prinzip, nach welchem die jetzt existierenden sozialen Beziehungen zwischen den beiden Geschlechtern geregelt werden – die gesetzliche Unterordnung des einen Geschlechtes unter das andere –, an und für sich ein Unrecht und gegenwärtig eines der wesentlichsten Hindernisse für eine höhere Vervollkommnung der Menschheit« sei. Kein »Sklave ist Sklave in solcher Ausdehnung und in so vollem Sinne des Wortes, wie es die Frau ist«25.
Film und Literatur stellen die Viktorianische Zeit häufig als eine behagliche, von Kerzen erleuchtete Welt knisternder Kamine dar, bevölkert von Menschen, die ihren Platz in der Gesellschaft kannten, doch Zeitgenossen erlebten sie ganz anders. Der Westen des 19. Jahrhunderts glich einem »Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor«, wie es Marx und Engels formulierten.26 Einige Künstler und Intellektuelle schwelgten darin, die Konservativen stemmten sich dagegen. Die Kirchen bezogen – einige plump, andere klug – Stellung gegen Sozialismus, Materialismus und Wissenschaft; Großgrundbesitzer verteidigten ihre Privilegien. Immer wieder kann es zu Zusammenstößen, und die konnten auch gewaltsam sein.
Die westliche Gesellschaft entledigte sich in raschem Tempo jener Züge, die sie noch um 1750 herum dem Osten so ähnlich gemacht hatte. Wie so häufig offenbart sich dies nirgends so deutlich wie in der Literatur. Man sucht in der chinesischen |496|Belletristik des 19. Jahrhunderts vergeblich nach durchsetzungsfähigen Heldinnen der Art, wie sie zur gleichen Zeit die Seiten europäischer Romane füllen. Einem Protest gegen die Unterjochung der Frau am nächsten kommt vielleicht die bizarre Satire Im Land der Frauen von Li Ruzhen, in der ein Kaufmann zwangsweise bis hin zum Fußbinden feminisiert wird:
Zwar wurden sie [seine Füße] vor jedem Einbinden mit Fußbalsam gebadet und mit Alaunpulver bestreut, dennoch begann das Fleisch an den Zehen langsam wegzufaulen, und täglich tropfte neues, mit Eiter vermischtes Blut durch die Bandagen. Er lebte noch keinen Monat im Wohnturm, da waren seine Füße bereits so krumm wie Mondsicheln.27
Helden, die einen sozialen Aufstieg schaffen, wie bei Dickens, sind schwer zu finden, noch weniger der Schlag des Selfmademan, den Samuel Smiles beschrieb. Die Stimmung von Shen Fus herzergreifenden Sechs Aufzeichnungen über ein unstetes Leben ist mit seiner romantischen und bewegenden Schilderung eines Lebens, dessen Aspirationen einer rigiden Hierarchie zum Opfer fallen, weitaus typischer.
Das wirklich Neue am Westen war jedoch, dass er, je mehr er sein Entwicklungstempo beschleunigte und Pfade hinunterjagte, die sich so gänzlich von jenen unterschieden, auf denen der Rest der Welt dahintrottete, desto stärker diese übrige Welt zwang, seiner Richtung und seiner frenetischen Geschwindigkeit zu folgen. Der Markt duldete kein Rasten. Er musste expandieren, immer mehr Aktivitäten in sich aufsaugen, oder das rasende Ungeheuer der Industrie würde sterben. Das ätzende liberale Säurebad zerfraß nicht nur die Schranken innerhalb von Gesellschaften, sondern auch die Grenzen zwischen ihnen, und kein Maß an Sitten, Traditionen oder kaiserlichen Edikten vermochte jene althergebrachte Ordnung zu retten, an der Shen Fu so gelitten hatte. Bereit oder nicht, die Welt war eins geworden.
Die Globalisierung offenbarte das Geheimnis des Zeitalters: Es ist einfach unsinnig, angesichts dieser neuen Verhältnisse davon zu sprechen, dass der Westen die übrige Welt in der gesellschaftlichen Entwicklung lediglich anführte.
Jahrtausendelang hatten sich die ursprünglichen landwirtschaftlichen Kerngebiete in mehreren Teilen des Planeten weitgehend unabhängig voneinander ausgedehnt, doch die aufwärtsgerichtete Bewegung der gesellschaftlichen Entwicklung transformierte die geographischen Bedingungen stetig und band die Kerngebiete der Welt zusammen. Bereits im 16. Jahrhundert ermöglichten neue Schiffstypen den Europäern, die Azteken und Inkas zu überwältigen und aus den zuvor unabhängigen Kerngebieten der Neuen Welt die weiträumige Peripherie eines enorm erweiterten Westens zu machen. Im 18. Jahrhundert begannen die |497|Europäer, das südasiatische Kerngebiet in eine weitere solche Peripherie zu verwandeln, und im 19. Jahrhundert verschafften Dampfschiffe, Eisenbahnen und die Telegraphie dem Westen eine weltweite Reichweite und sprengten abermals die geographischen Beschränkungen. Großbritannien, die Großmacht des Westens, konnte seinen Willen nun beinahe überall auf dem Planeten durchsetzen, und als die Westler ihre Energieausbeute steigerten, schoss der Anteil, den sie für den Krieg verausgabten, exponentiell in die Höhe. Die Energieausbeute des Westens stieg zwischen 1800 und 1900 um das Zweieinhalbfache, seine militärischen Fähigkeiten dagegen um das Zehnfache. Die industrielle Revolution verwandelte die westliche Führungsrolle bei der gesellschaftlichen Entwicklung in eine westliche Vorherrschaft.
Es war daher sehr ärgerlich, dass die östlichen Großmächte diesen Umstand ignorierten und die westlichen Händler auf winzige Enklaven in Guangzhou und Nagasaki beschränkten. Als der britische Lord Macartney, wie in Kapitel 9 erwähnt, 1793 nach Beijing reiste, um die Öffnung der Märkte zu verlangen, wies ihn Kaiser Qianlong brüsk zurück – obwohl, wie Macartney in seinem Tagebuch säuerlich bemerkte, die gewöhnlichen Chinesen »alle Händlerseelen sind, und es schien in den Seehäfen, in denen wir anlegten, dass sie nichts lieber sähen, als wenn unsere Schiffe gar häufig ihre Häfen anliefen«28.
In den 1830er Jahren spitzte sich die Lage zu. Drei Jahrhunderte lang waren westliche Kaufleute nach Guangzhou gereist, um Silber – für die chinesischen Beamten anscheinend die einzige Ware von Interesse im Angebot der weißen Händler – gegen Tee und Seide zu tauschen. Schon in den 1780er Jahren waren jedes Jahr annähernd 700 Tonnen westliches Silber nach Guangzhou geflossen. Die Britische Ostindienkompanie hatte jedoch entdeckt, dass – mochten die chinesischen Beamten sagen, was sie wollten – viele Chinesen auch die in Indien angebaute Wunderdroge Opium begehrten. Die westlichen Händler (insbesondere die Briten) puschten die Droge aggressiv. Bis 1832 strömte genug davon nach Guangzhou – beinahe zwölf Tonnen –, um zwei bis drei Millionen Süchtige das ganze Jahr über high sein zu lassen (Abbildung 10.5). Durch den Kauf von Narkotika wurde China vom Silberimporteur zum Nettoexporteur von jährlich annähernd 400 Tonnen des Edelmetalls. Das war ein Haufen Drogen und eine Menge Geld.
Die britischen Händler beharrten darauf, dass Opium »für die oberen Schichten der chinesischen Gesellschaft schlicht das war, was Brandy und Champagner für die gleichen Schichten in England« bedeuteten,29 doch das war nicht wahr, und sie wussten es. Opium hinterließ eine Spur zerbrochener Leben, so trostlos wie jede Drogenkarriere in den heutigen Innenstädten. Es schadete auch den Bauern, die nie eine Opiumpfeife gesehen hatten, weil der Abfluss von Silber an die Drogenbarone den Wert des Metalls nach oben trieb und die Bauern zwang, größere Anteile ihrer Ernte zu verkaufen, um das nötige Silber zur Begleichung ihrer Steuern zu erwerben. Bis 1832 waren die Steuern praktisch doppelt so hoch wie 50 Jahre zuvor.
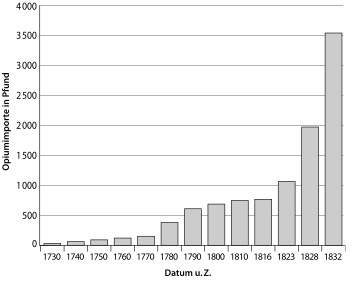
Abbildung 10.5: Ein Haufen Drogen
Die steil ansteigenden Opiumverkäufe der Britischen Ostindienkompanie in Guangzhou, 1730–1832.
Einige von Kaiser Daoguangs Ratgebern empfahlen eine zynische Marktlösung: Legalisierung des Opiums, um mit einheimischem Mohn die britischen Importe auszubieten, die Silberausfuhr zu drosseln und die Steuereinnahmen zu steigern. Doch Daoguang war ein guter Konfuzianer und wollte seine Untertanen vor sich selbst retten, statt ihren niederen Trieben freien Lauf zu lassen. 1839 erklärte er den Drogen den Krieg.
Ich habe in der Einleitung ein paar Worte über diesen Ersten Opiumkrieg verloren. Zuerst ging alles gut. Daoguangs oberster Drogenwächter Lin Zexu konfiszierte tonnenweise Opium, verbrannte es und versenkte die Reste im Meer (nachdem er ein gehöriges klassisches Gedicht an den Meeresgott verfasst hatte, um für die Verunreinigung seines Reiches Abbitte zu leisten). Doch dann lief es nicht mehr so gut. Der britische Handelskommissar kam zu dem Schluss, dass, wenn die Magie der Märkte versagte, der Zauber der Feuerwaffen vielleicht mehr ausrichten würde, und zog seine widerwillige Heimat in eine kriegerische Auseinandersetzung mit China hinein.
Was folgte, war eine schockierende Demonstration der Macht der Kriegführung im Industriezeitalter. Die britische Geheimwaffe war die Nemesis, ein brandneuer, ganz aus Eisen erbauter Dampfer. Selbst die Royal Navy befiel angesichts dieser |499|so radikalen Waffe ein gewisses Unbehagen: »Wie die Schwimmeigenschaften von Holz dieses, ungeachtet der Form oder Gestaltung, zum natürlichsten Material für den Schiffsbau machten, so erweckten die Sinkeigenschaften von Eisen auf den ersten Blick den Anschein, dass es höchst ungeeignet für einen ähnlichen Zweck wäre«, räumte ihr Kapitän ein.30
Diese Sorgen waren wohlbegründet. Der Eisenrumpf führte zur Fehlfunktion des Kompasses. Die Nemesis kollidierte mit einem Felsen, noch bevor sie England verließ, und hätte vor dem Kap der Guten Hoffnung beinahe zwei weitere gerammt. Inmitten eines tosenden Sturms konnte das Schiff nur vor dem Kentern gerettet werden, indem der Kapitän seiner Mannschaft befahl, über Bord hängend die Schiffswände mit überschüssigen Planken und Eisenplatten zu verstärken. Bei der Ankunft in Guangzhou jedoch war alles vergessen und vergeben. Die Nemesis machte ihrem Namen alle Ehre, schnaufte enge, von großen Holzschiffen nicht zu befahrende Flusspassagen hinauf und schoss jeden Widerstand in Stücke.
1842 schlossen britische Schiffe den Kaiserkanal und brachten Beijing an den Rand einer Hungersnot. Generalgouverneur Qiying, mit Friedensverhandlungen beauftragt, versicherte seinem Kaiser, dass er »unserem großen Plan zuliebe über solche Kleinigkeiten hinwegsehen« wolle,31 doch tatsächlich öffnete er, wie verlangt, für die Briten – dann für die Amerikaner, später für die Franzosen, schließlich auch für andere Westler – die chinesischen Häfen. Und als die Feindseligkeit der Chinesen gegenüber diesen ausländischen Teufeln (Abbildung 10.6) den erwarteten Profit aus diesen Konzessionen schmälerte, stellten die westlichen Mächte Nachforderungen.
Die Westler trieben sich auch gegenseitig an, in steter Furcht, ein Handelsrivale könnte eine Konzession erhalten, mit der die eigenen Händler von dem neuen Markt ausgeschlossen würden. 1853 schwappte ihre Rivalität nach Japan über. Kommodore Matthew Perry lief in die Bucht von Edo ein und verlangte für amerikanische Dampfer das Recht, dort auf dem Weg nach China Brennstoff nachzuladen. Er brachte nur vier moderne Schiffe mit, doch diese Flottille war von größerer Feuerkraft als alle Kanonen Japans zusammengenommen. Seine Schiffe waren »Festungen, die sich frei über das Wasser bewegten«, bemerkte ein erstaunter Augenzeuge. »Was wir für eine Feuersbrunst auf dem Meer gehalten hatten, war tatsächlich schwarzer Rauch aus ihren Schloten.«32 Japan gewährte den Amerikanern das Recht, in zwei Häfen Handel zu treiben. Großbritannien und Russland verlangten prompt für sich dasselbe Recht – und erhielten es.
Das Gerangel um die besten Plätze machte hier nicht Halt. Im Anhang zum englisch-chinesischen Vertrag von 1842 hatten die Anwälte der britischen Seite ihrem Land den frisch erfundenen Status einer »meistbegünstigten Nation« gesichert, was bedeutete, dass China alles, was es einer anderen westlichen Macht gewährte, auch Großbritannien zugestehen musste. Der Vertrag, den die USA 1843 mit China geschlossen hatten, enthielt eine Bestimmung, die eine Neuverhandlung |500|nach zwölf Jahren erlaubte, und so beanspruchten britische Diplomaten 1854 dasselbe Recht für sich. Die Qing sträubten sich, und Großbritannien zog abermals in den Krieg.

Abbildung 10.6: Kulturelle Dissonanz
Chinesische Karikatur eines feuerspeienden englischen Seemanns, 1838.
Selbst dem britischen Parlament war das ein bisschen zu viel. Es tadelte Premierminister John Henry Palmerston, dessen Regierung daraufhin stürzte, nur um bald darauf mit einer noch größeren Mehrheit der Wählerstimmen ins Amt zurückzukehren. 1860 besetzten Großbritannien und Frankreich Beijing, brannten den Sommerpalast nieder und verfrachteten das Pekinesenhündchen Looty nach Balmoral. Der amerikanische Generalkonsul wollte sich, was Neuverhandlungen anging, nicht ausstechen lassen und kujonierte Japan zu einem neuen Vertrag mit der Drohung, britische Schiffe würden andernfalls das Land für Opium öffnen.
Der Westen donnerte um 1860 wie ein Koloss durch die Welt, dessen langer Arm anscheinend überallhin reichte. Das alte östliche Kerngebiet, das sich nur ein Jahrhundert zuvor der höchsten gesellschaftlichen Entwicklung auf der Welt hatte rühmen können, wurde, ebenso wie die ehemaligen Kerngebiete in Südasien und Amerika, zu einer neuen Peripherie des westlichen Kerngebiets. Und Nordamerika, mittlerweile stark von Europäern besiedelt, drängte nun selbst ins |501|Kerngebiet. In Reaktion auf diese durchgreifende geographische Neuorganisation stießen die Europäer in immer neue Grenzregionen vor. Ihre Dampfschiffe trugen die weiße Plage der Siedler nach Südafrika, Australien und Neuseeland und kehrten mit Frachträumen voller Getreide und Schafen zurück. Afrika, auf westlichen Landkarten noch 1870 weitgehend ein weißer Fleck, war bis 1900 beinahe vollständig unter europäische Herrschaft gebracht.
Der Ökonom John Maynard Keynes erinnerte sich 1919 an jene Jahre als ein goldenes Zeitalter zurück:
Denn für jeden irgend über Durchschnitt Fähigen und Willenskräftigen war der Aufstieg in die Mittel- und Oberklasse möglich, denen das Leben mit geringen Kosten und sehr wenig Mühe Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten weit hinaus über den Gesichtskreis der reichsten und mächtigsten Monarchen anderer Zeitalter bot. Der Bewohner Londons konnte, seinen Morgentee im Bette trinkend, durch den Fernsprecher die verschiedenen Erzeugnisse der ganzen Erde in jeder beliebigen Menge bestellen und mit gutem Grund erwarten, dass man sie alsbald an seiner Tür ablieferte. Er konnte im selben Augenblick und auf demselben Wege seinen Reichtum in den natürlichen Hilfsquellen und neuen Unternehmungen jeder Weltgegend anlegen und ohne Anstrengung, ja ohne Mühe, an ihren künftigen Erträgen und Vorteilen sich beteiligen. Oder er konnte sich entschließen, die Sicherheit seines Vermögens dem Kredit der Bürger irgendeiner bedeutenderen Stadtgemeinde in irgendeinem Erdteil anzuvertrauen, den seine Einbildungskraft oder Kenntnis ihm empfahlen. Er konnte nach Wunsch sofort billige und bequeme Verkehrsgelegenheiten nach jedem Lande oder Klima ohne Pässe und andere Förmlichkeiten bekommen … und dann nach fremden Gegenden reisen, ohne ihre Religion, ihre Sprache oder ihre Sitten zu kennen, nur mit seinem gemünzten Reichtum in der Tasche, und sich bei dem geringsten Hindernis schwer beleidigt und höchlich überrascht dünken.33
Dem Romancier Joseph Conrad stellte sich das ganz anders dar, nachdem er 1890 ein Jahr im Kongobecken verbracht hatte. »Die Eroberung der Erde, und das bedeutet meistens, sie denen wegzunehmen, die eine andere Hautfarbe haben oder etwas plattere Nasen als wir, ist bei genauerem Hinsehen nicht gerade ein Kinderspiel«,34 bemerkte er in seinem antikolonialistischen Klassiker Herz der Finsternis.
Der Kongo war ein Extremfall. König Leopold II. von Belgien nahm ihn als persönliches Eigentum in Besitz und wurde zum Milliardär, indem er über fünf Millionen Kongolesen foltern, verstümmeln und ermorden ließ, um die übrige Bevölkerung zu zwingen, ihm Kautschuk und Elfenbein zu liefern. Er war jedoch kaum ein Einzelfall. In Nordamerika und Australien rotteten die weißen Siedler die Eingeborenen fast aus, und einige Historiker machen den europäischen Imperialismus dafür verantwortlich, dass die schwachen Monsunregenfälle der Jahre 1876–1879 und 1896–1902 Katastrophen heraufbeschworen. Trotz ausbleibender Ernten exportierten die Landeigentümer weiter Nahrungsmittel auf die westlichen Märkte, und von China bis Indien, von Äthiopien bis Brasilien |502|verwandelte sich Hunger in Hungersnot. Ruhr, Pocken, Cholera und selbst der Schwarze Tod folgten ihnen auf dem Fuße und rissen womöglich an die 50 Millionen geschwächte Menschen in den Tod. Einige Westler sammelten Geld für die Hungernden; andere taten so, als wäre nichts geschehen; und manche, wie das Magazin The Economist, mokierten sich, Hilfe lehre die Hungernden nur, »es sei die Pflicht der Regierung, sie am Leben zu erhalten«35. Kein Wunder, dass der letzte Seufzer des sterbenden Mr. Kurtz, jenes Unmenschen, der in Conrads Roman im Dschungel ein privates Königreich errichtet, zur Grabinschrift des europäischen Imperialismus geworden ist: »Das Grauen! Das Grauen!«361*
Der Osten wendete das Schlimmste ab, doch Niederlagen, Demütigungen und Ausbeutung durch den Westen blieben ihm nicht erspart. China und Japan zerfielen, als zusammengewürfelte Haufen von Patrioten, Dissidenten und Kriminellen, die ihren Regierungen für alles die Schuld gaben, zu den Waffen griffen. Religiöse Fanatiker und Milizen ermordeten Westler, wenn sie sich außerhalb ihrer befestigten Stützpunkte verirrten, und Beamte, die diesen Eindringlingen begütigend zu Willen waren. Westliche Marineschiffe bombardierten zur Vergeltung Hafenstädte, rivalisierende Parteiungen spielten die westlichen Eindringlinge gegeneinander aus. Europäische Waffen überfluteten Japan, wo eine von den Briten unterstützte Fraktion 1868 die legitime Regierung stürzte. In China kostete der Bürgerkrieg 20 Millionen Menschenleben, bevor westliche Finanziers beschlossen, dass ein Regimewechsel die Gewinne schmälern würde, woraufhin eine »stets siegreiche Armee« mit amerikanischen und britischen Offizieren und Kanonenbooten half, die Qing zu retten.
Westler diktierten östlichen Regierungen, was sie zu tun hatten, rissen ihre Reichtümer an sich und umgaben sie mit ihren eigenen Beratern. Wenig überraschend sorgten diese dafür, dass die Zölle auf westliche Importe und auf Güter, an deren Kauf der Westen interessiert war, niedrig blieben. Manchmal überkam selbst Westler dabei ein ungutes Gefühl. »Ich habe Dinge gesehen, die mich zur Weißglut getrieben haben, so wie die europäischen Mächte die asiatischen Nationen zu erniedrigen versuchen«, gestand der ehemalige US-Präsident Ulysses S. Grant dem japanischen Kaiser 1879.37
Die meisten Westler befanden indessen, dass alles genau so war, wie es sein sollte, und vor diesem Hintergrund des östlichen Zusammenbruchs verfestigte sich ein Denken, das in der westlichen Vorherrschaft eine von jeher angelegte Zwangsläufigkeit erkannte. Der Osten mit seinen korrupten Kaisern, auf dem Bauch rutschenden Konfuzianern und Abermillionen halbverhungerter Kulis schien immer schon zur Unterwerfung unter den dynamischen Westen bestimmt. Aus westlicher Perspektive sah es so aus, als würde nun die Welt ihre letzte, vorherbestimmte Form erreichen.
In ihrer Anmaßung und Selbstbeweihräucherung übersahen die Herolde unverbrüchlicher westlicher Vorherrschaft im 19. Jahrhundert etwas ganz Wichtiges: die Logik ihres eigenen, von Marktkräften angetriebenen Imperialismus. Genau wie der Markt die britischen Kapitalisten zur Schützenhilfe beim Aufbau der industriellen Infrastruktur ihrer erbittertsten Rivalen Deutschland und USA genötigt hatte, belohnte er nun Westler, die Kapital, Innovationen und Know-how über den Osten ausschütteten. Die Westler zinkten die Karten, wo immer es ging, doch der unerbittliche Drang des Kapitals hin zu neuen Profiten bot auch den östlichen Unternehmern Gelegenheiten, die bereit waren, sie beim Schopf zu packen.
Die Geschwindigkeit, mit der die Asiaten dies taten, war verblüffend. In den 1860er Jahren machten sich die chinesische Selbststärkungsbewegung und die japanische Bewegung für »Zivilisation und Aufklärung« daran, das zu kopieren, was sie als das Beste am Westen ansahen. Sie übersetzten westliche Bücher über Wissenschaft, Staatsführung, Recht und Medizin ins Chinesische und Japanische und schickten Delegationen in den Westen, um sich selbst ein Bild zu machen. Die Westler beeilten sich, den Asiaten ihre neuesten technischen Maschinen zu verkaufen, und chinesische und japanische Gradgrinds verdreckten die Landschaft mit ihren Fabriken.
In gewisser Weise war das gar nicht so überraschend. Als die Ostler nach den Werkzeugen griffen, die im Westen die gesellschaftliche Entwicklung in solche Höhen getrieben hatten, taten sie schlicht das Gleiche, was die Westler sechs Jahrhunderte zuvor mit den Werkzeugen und Techniken aus dem Osten – wie etwa Kompass, Gusseisen und Feuerwaffen – gemacht hatten. Doch in anderer Hinsicht war es höchst erstaunlich: Der Osten reagierte auf die westliche Herrschaft entschieden anders als die ehemaligen Kerngebiete in der Neuen Welt und Südasien, die sich der Westen in den vorangegangenen drei Jahrhunderten als Peripherien einverleibt hatte.
Die amerikanischen Ureinwohner entwickelten nie einheimische Industrien, und die Südasiaten waren darin weit langsamer als die Ostasiaten. Einige Historiker sehen die Erklärung dafür in den unterschiedlichen kulturellen Mustern: Die westliche Kultur ermutige sehr stark zu harter Arbeit und Rationalität, und dies sei in der östlichen Kultur kaum, in der südöstlichen noch weniger und in wieder anderen Kulturen überhaupt nicht der Fall. Doch diese Theorie, Relikt einer kolonialistischen Geisteshaltung, kann nicht stimmen.
Wenn wir die Reaktionen auf die westliche Vorherrschaft in eine längere zeitliche Perspektive rücken, lassen sich tatsächlich zwei frappierende Korrelationen erkennen. Erstens neigten jene Regionen, die, wie das östliche Kerngebiet, vor den Zeiten westlicher Vorherrschaft eine relativ weit gediehene gesellschaftliche Entwicklung aufwiesen, zu einer rascheren Industrialisierung als jene, deren Entwicklung relativ schwach geblieben war. Zweitens vollzog sich die Industrialisierung |504|rascher in Regionen, die einer direkten europäischen Kolonialisierung entgingen, als in den Kolonien selbst. Japan hatte vor 1853 eine hohe gesellschaftliche Entwicklung und wurde nicht kolonialisiert; seine Modernisierung setzte in den 1870er Jahren ein. China hatte einen hohen Entwicklungsstand und wurde teilkolonialisiert; seine Modernisierung begann in den 1950er Jahren. Indien wies vor den Europäern eine moderate gesellschaftliche Entwicklung auf und wurde vollständig kolonialisiert; seine Modernisierung setzte nicht vor den 1990er Jahren ein. Das subsaharische Afrika wurde bei einem geringen Entwicklungsstand vollständig kolonialisiert und beginnt erst heute damit, seinen Rückstand aufzuholen.
Weil der Osten des 19. Jahrhunderts (an vorindustriellen Maßstäben gemessen) eine Welt fortschrittlicher Landwirtschaft, großer Städte, weit verbreiteter Bildung und mächtiger Armeen war, fand seine Bevölkerung zu großen Teilen Mittel und Wege, die westlichen Methoden den eigenen Verhältnissen anzupassen. Die Ostasiaten übernahmen selbst westliche Industrialisierungs- und Sozialdebatten. Auf jeden östlichen Kapitalisten kam ein alternder Samurai, der murrte: »Nutzlose Schönheit hatte einen Platz im alten Leben, doch das neue verlangt nur nach hässlicher Nützlichkeit.«38 Und obwohl (oder weil) die Reallöhne in den Städten um die Wende zum 20. Jahrhundert gemächlich anstiegen, gründeten Oppositionelle in China und Japan sozialistische Parteien. Bis 1920 gehörte zu ihren Mitgliedern auch Mao Zedong.
Die östlichen Industrialisierungsdebatten unterschieden sich von Land zu Land. Genau wie im Westen gab es wenig bis gar nichts, was große Menschen oder närrische Stümper, was Kultur oder schieres Glück noch hätten ausrichten können, um eine industrielle Initialzündung zu verhindern, als sich die Möglichkeit dazu bot. Doch bestimmten diese Kräfte – wieder in Parallele zum Westen – ganz und gar darüber, welches Land dabei die Führung übernahm.
Als William S. Gilbert und Arthur Sullivan 1885 ihre Operette Der Mikado in London uraufführten, präsentierten sie Japan als Urbild des exotischen Orients, als ein Land, in dem die Vöglein aus Liebe starben und sich der Scharfrichter erst selbst einen Kopf kürzer machte, bevor er andere hinrichtete. Tatsächlich jedoch war Japan damals bereits dabei, sich weit schneller zu industrialisieren als irgendeine andere Gesellschaft in der Geschichte. Mit der geschickten Inthronisierung des jungen Kaisers, des Meiji-Tennos, 1868 nach dem Bürgerkrieg gelang es klugen Strippenziehern in Tokio, ihr Land aus Kriegen mit den westlichen Mächten herauszuhalten, die Industrialisierung weitgehend aus heimischem Kapital zu finanzieren und wütende Menschen von provozierenden Angriffen auf Ausländer abzuhalten. Unbeholfene Strippenzieher in Beijing dagegen duldeten und ermutigten sogar Gewalt gegen Missionare, stolperten 1884 in einen Krieg mit Frankreich (wobei sie einen Großteil ihrer teuren neuen Flotte binnen einer Stunde verloren) und liehen sich – und veruntreuten – ruinös hohe Summen.
Japans Elite sah der Tatsache ins Auge, dass die Liberalisierung nur im Paket zu haben war. Die Herren setzten sich Zylinder auf, die Damen stülpten sich Reifröcke |505|über; einige diskutieren, ob man nicht die lateinische Schrift übernehmen solle; andere wollten Japan zu einem englischsprachigen Land machen. Die japanische Elite war bereit, alles in Erwägung zu ziehen, was funktionieren könnte. Chinas Qing-Herrscher waren im Gegensatz dazu die personifizierte Zwietracht. 40 Jahre lang hatte die Kaiserinwitwe Cixi hinter dem Bambusvorhang regiert und sich gegen jede Modernisierung gesträubt, die ihre Dynastie gefährdet hätte. Ihr einziger Flirt mit westlichen Ideen bestand darin, Geld, das für den Wiederaufbau der Flotte bestimmt war, für die Marmorkopie eines Mississippi-Dampfers für ihren Sommerpalast abzuzweigen (das Werk steht bis heute dort und lohnt einen Besuch). Als ihr Neffe Guangxu 1898 versuchte, in 100 Tagen ein Reformprogramm durchzupauken (Verschlankung des öffentlichen Dienstes, Aktualisierung der Prüfungsaufgaben, Schaffung eines modernen Schulsystems, Koordinierung der Tee- und Seidenproduktion für den Export, Förderung von Bergbau und Eisenbahn sowie eine Heeres- und Marinereform nach westlichem Vorbild), gab Cixi bekannt, dass Guangxu sie gebeten habe, wieder die Regentschaft zu übernehmen, sperrte ihn im Palast ein und ließ seine modernisierungsfreudigen Minister hinrichten. Guangxu blieb ein Reformer bis zu seinem bitteren Ende – er wurde mit Arsen vergiftet, als Cixi 1908 selbst im Sterben lag.
Während China auf die Modernisierung zustolperte, legte Japan einen Sprint hin. 1889 erließ das Land eine Verfassung, die wohlhabenden Männern das Wahlrecht verlieh, politische Parteien nach westlichem Vorbild erlaubte und moderne Regierungsministerien schuf. China nahm erst in den letzten Tagen Cixis eine Verfassung an und gewährte 1909 Männern ein eingeschränktes Wahlrecht. Japan räumte der Bildung der Massen Priorität ein. Bis 1890 erhielten zwei Drittel der japanischen Jungen und ein Drittel der japanischen Mädchen eine kostenlose Grundschulbildung. China dagegen unternahm praktisch nichts zur Förderung der Volksbildung. Beide Länder verlegten 1876 ihre ersten Eisenbahntrassen, doch Shanghais Gouverneur ließ 1877 die Geleise wieder herausreißen, aus Angst, Rebellen könnten sie benutzen. 1896 verfügte Japan über 2300 Kilometer Schienenwege, China hingegen nur über 370. Ganz ähnliche Feststellungen ließen sich über Eisen, Kohle, Dampfkraft oder Telegrafenlinien treffen.
Im Verlauf der gesamten Geschichte löste die Ausweitung von Kerngebieten häufig grausame Kriege an den Peripherien aus, in denen sich entschied, welcher Teil des Randes den Widerstand gegen (oder die Assimilation an) die Großmächte anführen würde. Im 1. Jahrtausend v. u. Z. zum Beispiel bekriegten sich an den Rändern des Perserreiches Athen, Sparta und Makedonien eineinhalb Jahrhunderte lang; und Chu, Wu und Yue taten dasselbe in Südchina, als das Kerngebiet im Tal des Gelben Flusses wuchs. Im 19. Jahrhundert u. Z. wiederholte sich der Prozess, als der Osten zu einer Peripherie des Westens wurde.
Seit Japans gescheitertem Eroberungsversuch Chinas in den 1590er Jahren waren die Herrscher im östlichen Kerngebiet davon ausgegangen, dass die Kosten von Kriegen zwischen großen Reichen den Nutzen überwogen, doch die Ankunft |506|des Westens stellte nun diese Annahme auf den Kopf. Welche östliche Nation sich als Erstes industrialisierte, sich am schnellsten reorganisierte und neu bewaffnete, würde in der Lage sein, nicht nur die westlichen Imperialisten auf Distanz, sondern auch den Rest des Ostens niederzuhalten.
Es war letzten Endes die japanische Industrialisierung, nicht die britische Kriegsflotte, die zu Chinas Nemesis wurde. Japan mangelte es an Ressourcen, China hatte reichlich davon. Japan brauchte Märkte, China bot sie zur Genüge. Der Streit in Tokio, welcher Kurs eingeschlagen werden sollte, war grimmig und sogar mörderisch, aber im Laufe zweier Generationen reifte im Land langsam die Vorstellung, dass es von Vorteil sei, sich gewaltsam der Rohstoffe und Märkte Chinas zu bemächtigen. Bis zu den 1930er Jahren hatte sich im japanischen Offizierskorps der unbedingte Impetus durchgesetzt, das gesamte östliche Kerngebiet zu übernehmen, China und Südostasien in Kolonien zu verwandeln und die westlichen Imperialisten hinauszuwerfen. Ein Krieg des Ostens hatte begonnen.
Der große Unterschied zwischen dem Krieg des Ostens und dem im 18. Jahrhundert ausgetragenen Krieg des Westens war jedoch, dass sich Ersterer in einer Welt zutrug, die bereits unter westliche Vorherrschaft gefallen war. Das machte alles komplizierter. Als Japan 1895 den chinesischen Widerstand bei seinem Einmarsch in Korea brach, reagierte Deutschlands Kaiser Wilhelm II., indem er seinem Cousin Zar Nikolaus II. von Russland eine ziemlich grauenvolle Lithographie mit dem Titel »Völker Europas, wahret Eure heiligsten Güter!« zukommen ließ (Abbildung 10.7) und ihn drängte, »seine Aufmerksamkeit dem asiatischen Kontinent zuzuwenden und Europa gegen die Eingriffe der großen gelben Rasse zu verteidigen«.39 Nikolaus antwortete, indem er Japan einen Großteil des Territoriums wieder abjagte, das das Inselreich China entrissen hatte.
Andere Westler sahen jedoch Vorteile in einer Zusammenarbeit mit Japan und bedienten sich seiner wachsenden Macht, um den übrigen Osten im Zaum zu halten. Die erste Gelegenheit dazu bot sich im Jahr 1900, als sich eine chinesische Geheimgesellschaft mit dem schönen Namen »In Rechtschaffenheit vereinigte Faustkämpfer« (im Westen: Boxer) gegen den westlichen Imperialismus erhob (wobei sie unter anderem behauptete, dass 100 Tage Kampfkunsttraining ihre Mitglieder gegen Kugeln imprägnieren würden). Es waren 20 000 ausländische Soldaten nötig, um sie niederzuringen, und ein Großteil dieser Truppen bestand – auch wenn man es aus westlichen Darstellungen nicht erfährt (am wenigsten aus dem Hollywood-Kassenschlager 55 Tage in Peking von 1963) – aus Japanern. So zufrieden war Großbritannien mit dem Ausgang dieser Intervention, dass es 1902 eine Flottenallianz mit Japan schloss und damit dessen Großmachtstatus im Osten anerkannte. Der britischen Neutralität gewiss, nahm Japan 1904 an Russland Rache, versenkte dessen Fernostflotte und überwältigte in der größten bis dato jemals ausgetragenen Landschlacht die russische Armee. Als Zar Nikolaus seine Hauptflotte 20 000 Seemeilen um die Welt schickte, um die Dinge zu richten, versenkten die japanischen Schlachtschiffe auch diese.

Abbildung 10.7: Die »gelbe Gefahr«
Diese Lithographie von 1895 nach Skizzen Wilhelms II. sollte, wie der Kaiser erläuterte, die Europäer ermutigen, sich im Widerstand »gegen das Eingreifen des Buddhismus, des Heidentums und der Barbarei zur Verteidigung des Kreuzes [zu] vereinigen«.40
Weniger als 50 Jahre waren vergangen, seit man Looty nach London verfrachtet hatte, doch das alte östliche Kerngebiet hatte so dynamisch reagiert, dass es bereits ein westliches Reich besiegen konnte. »Was 1904/05 in der Mandschurei geschehen ist, war nicht mehr als ein Geplänkel mit der Vorhut«, folgerte der blamierte russische Kommandeur Alexei Nikolajewitsch Kuropatkin. »Nur wenn wir gemeinsam anerkennen, dass es für ganz Europa wichtig ist, Asien ruhig zu halten …, können wir die ›gelbe Gefahr‹ in Schach halten.«41 Doch Europa schlug seinen Rat in den Wind.
Zwischen 1914 und 1991 trug das westliche Kerngebiet die größten Kriege der Geschichte aus: Im Ersten Weltkrieg zwischen 1914 und 1918 und im Zweiten Weltkrieg zwischen 1939 und 1945 ging es jeweils um die Frage eines deutschen Festlandsimperiums in Europa und im Kalten Krieg zwischen 1947 und 1991 um die Frage, welcher Anteil der Beute den Vereinigten Staaten und welcher der Sowjetunion zustand (Abbildung 10.8). Zusammen summierten sie sich zu einem neuen Krieg des Westens, der seinen Vorläufer im 18. Jahrhundert weit in den Schatten |508|stellte. Er schloss den Krieg des Ostens ein, hinterließ 100 Millionen Tote und bedrohte das Überleben der Menschheit selbst. 1991 herrschte der Westen noch immer, doch immer mehr Zeitgenossen dünkte es, dass sich Kuropatkins Befürchtungen schließlich bewahrheiten könnten: Der Osten stand bereit, ihn zu überholen.
Die Geschichte, wie der neue Krieg des Westens begann, ist oft erzählt worden: wie der lange Niedergang des Osmanischen Reiches im Balkan Tausende von Terroristen respektive Freiheitskämpfern auf den Plan rief; wie es durch Stümperei und Pech einer Bande namens Schwarze Hand gelang, im Juni 1914 den österreichisch-ungarischen Thronfolger zu ermorden (die vom ersten Attentäter geworfene Bombe prallte vom Auto des österreichischen Erzherzogs Franz Ferdinand ab, sein Fahrer nahm jedoch später eine falsche Straße, musste wenden und hielt direkt vor einem zweiten Attentäter, der sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ); und wie das Netz von Verträgen, die den Frieden in Europa wahren sollten, alle Mächte gemeinsam in den Abgrund zog.
Was folgte, ist ebenso gut bekannt: wie Europas modernisierte Staaten ihre jungen Männer in beispielloser Zahl mobilisierten, sie mit unerhörten Waffen ausrüsteten und die enormen Kräfte ihrer Armeen zu einem nie gekannten Gemetzel missbrauchten. Vor 1914 hielten optimistische Intellektuelle Kriege zwischen den Großmächten für unmöglich: Die Volkswirtschaften seien nun so stark miteinander verflochten, dass sie im Kriegsfall alle zusammenbrechen müssten und der Konflikt ein rasches Ende fände. 1918 jedoch schien die Lehre des Ersten Weltkriegs eher zu sein, dass nur solche Staaten, die ihre riesigen, komplexen Wirtschaften wirkungsvoll für ihre Zwecke einzuspannen vermochten, den totalen Krieg des 20. Jahrhunderts mitsamt seinen Folgen und Belastungen überstehen konnten.
Der Krieg hatte offenbar gezeigt, dass der Vorteil bei den liberalen, demokratischen Staaten lag, deren Bürger am überzeugtesten in die Schlacht zogen. Einst, im 1. Jahrtausend v. u. Z., hatten die Menschen im Osten und Westen gleichermaßen gelernt, dass dynastische Reiche die zur Kriegführung effektivsten Organisationen waren. Nun, im Laufe einer einzigen Dekade, erfuhren sie, dass diese dynastischen Reiche – die beständigste Regierungsform der Geschichte, deren nahtloses Erbe auf Assyrien, Persien und das Qin-Reich zurückging – nicht länger mit dem Krieg vereinbar waren.
Als Erste verabschiedete sich die Qing-Dynastie in China. Im Sumpf von Schulden, Niederlage und Chaos verloren die Minister des Kindkaisers Pu Yi bereits 1911 die Kontrolle über das Heer, doch als sich der Rebellengeneral Yuan Shikai 1916 selbst zum Kaiser ausrief – wie es Rebellengeneräle seit 2000 Jahren getan hatten –, musste er feststellen, dass auch er das Land nicht mehr zusammenhalten konnte. Eine andere Militärclique setzte Pu Yi 1917 wieder ein, doch war das Ergebnis nicht besser. Chinas imperiale Geschichte endete ein paar Tage darauf, wenn schon nicht sang- und klanglos, so doch nur mit einem sehr mäßigen Knall:
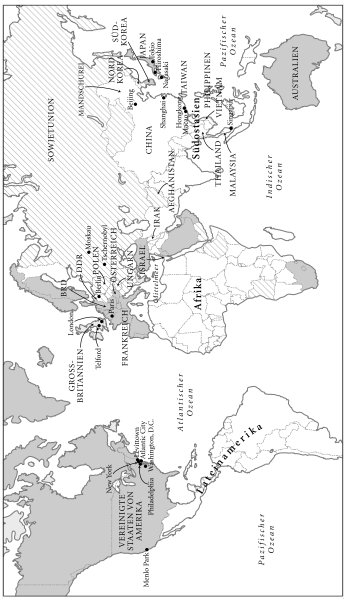
Abbildung 10.8: Die Welt im
Krieg, 1914–1991
Grau eingezeichnet sind die Vereinigten Staaten und ihre
wichtigsten Alliierten um 1980, schraffiert die Sowjetunion und
ihre Hauptverbündeten.
|510|Ein einziges Flugzeug ließ eine Bombe auf die Verbotene Stadt in Beijing fallen, Pu Yi wurde abermals abgesetzt, und das Land verfiel in Anarchie.
Als Nächste kam Russlands Romanow-Dynastie an die Reihe. Die Niederlage gegen Japan hatte 1905 fast schon zum Sturz von Zar Nikolaus II. geführt, doch das erledigte dann der Erste Weltkrieg. 1917 wurde seine Familie erst von den Liberalen gestürzt, dann 1918 von den Bolschewiken erschossen. Deutschlands Hohenzollern und Österreichs Habsburger folgten rasch und entgingen dem Schicksal der Romanows nur, weil sie aus ihrer Heimat flohen. In der Türkei schleppten sich die Osmanen weiter dahin, doch nur bis 1922.
Trotz aller Verwüstungen stärkte der Erste Weltkrieg die westliche Vorherrschaft, indem er die archaischen dynastischen Reiche Europas hinwegfegte und China schwächer denn je zurückließ. Als große Gewinner traten zunächst Frankreich und Großbritannien auf, die sich die deutschen Kolonien einverleibten und ihre Seereiche noch weiter nach Afrika, in den Pazifik und zu den Ölfeldern des alten Osmanischen Reiches vortrieben. Um 1919 wurde ein Drittel der Landmasse des Planeten und nahezu ein Drittel der Weltbevölkerung entweder von London oder von Paris aus regiert.
Doch die ausgedehnten Schraffurflächen, die diese Reiche in älteren Atlanten zu meiner Schulzeit noch markierten, waren irreführend. Der Krieg stärkte nicht nur die westliche Macht, er verteilte sie auch um. Europa hatte über seine Verhältnisse gekämpft, und die Quittung dafür sprengte selbst die britische Kreditlinie. Die Inflation erreichte 1920 im Vereinten Königreich 22 Prozent, im folgenden Jahr überstieg die Arbeitslosigkeit elf Prozent. 68 Millionen Arbeitstage gingen durch Streiks verloren. Die Sonne ging noch immer nicht unter im Britischen Empire, doch sie hatte ihre liebe Not, während der Geschäftszeiten zu strahlen.
Zur Zahlung seiner Schulden musste Großbritannien bluten. Das Kapital floss zumeist über den Atlantik. Der Krieg war die Hölle gewesen, aber die Vereinigten Staaten hatten einen höllisch erfolgreichen Krieg gehabt und sich nicht nur zur Werkbank, sondern auch zum Bankhaus der Welt gemausert. Im 15. Jahrhundert hatte sich das westliche Kerngebiet vom Mittelmeer nach Westeuropa verlagert und sich im 17. Jahrhundert nochmals weiter zu den Seemächten im Nordwesten des Kontinents verschoben. Nun, im 20. Jahrhundert, bewegte es sich abermals, als die bankrotten Seemächte des europäischen Nordwestens gegenüber dem nordamerikanischen Imperium ins Hintertreffen gerieten.
Die USA hatten sich in eine neue Art von Organisation verwandelt, die man Subkontinentalreich nennen könnte. Anders als traditionelle dynastische Reiche hatte es keine alte Aristokratie, die über unterdrückte Bauern herrschte; anders als die europäischen Seereiche war es kein kleines, liberales, industrialisiertes Land, dessen Herrschaftsgebiet die Welt umspannte. Stattdessen hatten Euro-Amerikaner, nachdem sie die indigene Bevölkerung nahezu ausgerottet, einen brutalen Bürgerkrieg ausgefochten und Millionen ehemaliger Sklaven praktisch in die Leibeigenschaft zurückgestoßen hatten, demokratische Bürgerrechte von |511|einem Ozean zum anderen verbreitet, mit wohlhabenden Farmern, die ein riesiges industrielles Kernland im Nordosten und nördlichen Mittleren Westen versorgten und von dort wiederum ihre Waren bezogen. Bis 1914 konnte sich dieses subkontinentale amerikanische Reich bereits mit den europäischen Seereichen messen, und nach 1918 waren seine Geschäftsleute weltweit unterwegs.
Mit welch einem gewaltigen Schmatzgeräusch die Vereinigten Staaten den europäischen Reichtum verputzten, erstaunte die Zeitgenossen. »Das Finanzzentrum der Welt, das Tausende von Jahren brauchte, um von den Ufern des Euphrat an Themse und Seine zu wandern«, bemerkte der amerikanische Außenminister John Hay schon vor dem Ersten Weltkrieg, »scheint zwischen Morgengrauen und Abenddämmerung zum Hudson überzusiedeln.«42 Bis 1929 hielten die Amerikaner über 15 Milliarden Dollar Auslandsinvestitionen, beinahe so viel wie die Briten 1913, und verfügten über einen 50 Prozent größeren Anteil am Welthandel.
Das goldene Zeitalter des Kapitalismus schien unter amerikanischer Führung eine Wiedergeburt zu erleben, doch da gab es einen entscheidenden Unterschied. Vor 1914 war nach Meinung von John Maynard Keynes »der Einfluss Londons auf die Kreditbedingungen der ganzen Welt so überragend, dass die Bank von England beinahe Anspruch darauf erheben konnte, der Dirigent des internationalen Orchesters zu sein«.43 Doch nach 1918 waren die USA unwillig, diese Aufgabe zu übernehmen. Die amerikanischen Politiker nahmen nach 1918 vor den ansteckenden Rivalitäten und Kriegen Europas Reißaus, ließen das Dirigentenpult verwaist zurück und zogen sich in eine politische Isolation zurück, die dem chinesischen oder japanischen Reich des 18. Jahrhunderts alle Ehre gemacht hätte. Zu guten Zeiten improvisierte das Orchester und wurstelte sich durch, doch als die Zeiten schlecht wurden, verwandelte sich seine Musik in Kakophonie.
Im Oktober 1929 sorgten ein wenig Stümperei, ein Haufen Pech und die Abwesenheit eines Dirigenten dafür, dass eine Blase am amerikanischen Aktienmarkt zu einem internationalen Finanzdesaster wurde. Die Ansteckung raste um die kapitalistische Welt: Banken stürzten, Kredite verdampften und Währungen brachen zusammen. Nur wenige litten Hunger, doch Weihnachten 1932 war jeder vierte amerikanische Arbeiter ohne Job. In Deutschland war es eher jeder zweite. Die Schlangen fahlgesichtiger Arbeitsloser, »die ihrem Schicksal mit der gleichen stummen Verwunderung entgegensahen wie ein Tier in der Falle«44, wie der englische Journalist George Orwell schrieb, wurden immer länger.
Zumindest bis Mitte der 1930er Jahre machte alles, was die liberalen Demokratien taten, die Lage nur noch schlimmer. Nicht nur schienen die westlichen Kerngebiete über das Entwicklungsparadox gestolpert zu sein, es sah auch so aus, als kämen nun anderswo die Vorteile der Rückständigkeit ins Spiel. Russland, jahrhundertelang ein sehr zurückgebliebenes Land an der Peripherie, hatte sich als kommunistische Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken neu konstituiert. Wie die Vereinigten Staaten fügte es einem riesigen landwirtschaftlichen Hinterland einen aufstrebenden industriellen Kern hinzu, doch anders als jene betrieb |512|es eine Politik der Verstaatlichung und Kollektivierung der Landwirtschaft unter zentralistischer Planung. Die Sowjetunion mobilisierte ihre Menschen eher wie ein moderner westlicher Staat als ein altes dynastisches Reich, aber ihre Autokraten Lenin und Stalin regierten mehr wie Zaren denn demokratische Präsidenten.
Die Sowjetunion war eine Art Anti-Amerika: ein subkontinentales, aber entschieden illiberales Reich. Während Stalin Gleichheit predigte, schuf er durch Zwangsumsiedlung von Millionen seiner Genossen innerhalb seines Reiches und die Inhaftierung einer weiteren Million in Gulags eine zentralistische Wirtschaft. Ideologisch verdächtige ethnische Gruppen und Klassenfeinde (was häufig dasselbe war) fielen Säuberungen zum Opfer. Und anders als die scheiternden kapitalistischen Wirtschaften ließ die erfolgreiche Sowjetunion tatsächlich zehn Millionen ihrer Untertanen verhungern. Dennoch machte Stalin eindeutig etwas richtig, denn während die kapitalistische Industrie zwischen 1928 und 1937 zusammenbrach, vervierfachte sich die sowjetische Produktion. »Ich habe die Zukunft gesehen, und sie funktioniert«45, verkündete der Journalist Lincoln Steffens in einem berühmt gewordenen Ausspruch seinen amerikanischen Landsleuten nach einem Besuch der Sowjetunion.1*
Anfang der 30er Jahre schien vielen die wahre Lektion des Ersten Weltkriegs nicht darin zu liegen, dass der liberalen Demokratie die Zukunft gehörte. Die anglo-franko-amerikanische Allianz, so glaubten sie, hatte vielmehr trotz, nicht wegen ihres Liberalismus gewonnen. Die wahre Antwort schien ein subkontinentales Reich zu sein, je weniger liberal, desto besser. Japan, das so sehr von der Nachahmung liberaler Modelle profitiert hatte, änderte seinen Kurs, als die Weltmärkte und ihre handelsorientierte Wirtschaft ins Trudeln gerieten. Angesichts einer stark anschwellenden Arbeitslosigkeit, einer wackeligen Demokratie und zunehmender kommunistischer Agitation traten Militaristen auf den Plan und forderten lauthals ein Reich, von dem Japan leben könnte. Die Armee – insbesondere ihre radikalen jüngeren Offiziere – liefen völlig aus dem Ruder und nutzten die Verwirrung der westlichen Demokratien und den Bürgerkrieg in China, um die Mandschurei zu annektieren und auf Beijing zuzumarschieren. »Nur durch die Herbeiführung einer japanisch-mandschurischen Kooperation und japanisch-chinesischer Freundschaft«, erklärte ein Oberstleutnant, »kann das japanische Volk zum Herrscher Asiens werden und darauf vorbereitet sein, den letzten und entscheidenden Krieg gegen die verschiedenen weißen Rassen zu führen.«46
Bis zu einem gewissen Grad funktionierte der Militarismus. Japans Wirtschaft wuchs in den 1930er Jahren um 72 Prozent, allein die Stahlproduktion stieg um das Achtzehnfache. Aber auch hier waren die Kosten hoch. »Kooperation« und |513|»Freundschaft« bedeuteten häufig Sklaverei und Massaker, und selbst nach den niedrigen, unlauteren Maßstäben jener Zeit war die Brutalität der Japaner schockierend. Des weiteren war 1940 klar, dass die Eroberungen die Probleme Japans nicht gelöst hatten, da der Krieg die Ressourcen noch schneller verschlang, als sich neue erbeuten ließen. Von fünf Litern Treibstoff, die ein Kriegsschiff oder Bomber verbrauchte, mussten vier vom Westen gekauft werden. Der Plan der Armee, mit den Eroberungen fortzufahren, brachte keine Besserung, und als die Lage in China immer verfahrener wurde, gewann ein noch alarmierenderer Plan an Boden: nach Südostasien vorzustoßen und die dortigen Ressourcen Öl und Kautschuk aus den Händen der westlichen Imperialisten zu befreien, selbst wenn das Krieg mit Amerika bedeutete.
Am alarmierendsten war der Plan, der in Deutschland heranreifte. Niederlage, Arbeitslosigkeit und finanzieller Zusammenbruch hatten bei den Erben von Goethe und Kant so tiefe Wunden gerissen, dass sie bereit waren, selbst einem Verrückten ihr Ohr zu leihen, der alle Schuld den Juden gab und mit dem Allheilmittel der Eroberung hausieren ging. »Die erste Ursache des Gleichbleibens unserer Währung ist das KZ«, versicherte Adolf Hitler seinem Finanzminister, als er jüdische Geschäftsleute brutal verfolgen und verbannen und Gewerkschafter ins Gefängnis werfen ließ.47 Hitlers Wahnsinn hatte Methode: Defizitfinanzierung, staatliche Lenkungseingriffe und die Wiederaufrüstung beseitigten in den 1930er Jahren die Arbeitslosigkeit und verdoppelten die Industrieproduktion.
Hitler posaunte seinen Plan, die Westflanke Deutschlands durch die Besiegung der Seereiche zu sichern und dann die osteuropäischen Slawen und Juden durch arische Bauern zu ersetzen, offen heraus. Weit mehr als bloß illiberal, war seine Vision eines um Deutschland zentrierten subkontinentalen Reiches unumwunden völkermörderisch, doch nur wenige Menschen im Westen konnten glauben, dass er es ernst meinte. Ihr Selbstbetrug beschwor herauf, was die meisten vermeiden wollten: einen weiteren umfassenden Krieg. Einige wenige dunkle Monate lang sah es – zum ersten Mal seit 1812 – so aus, als würde es ein Kontinentalreich doch noch schaffen, Europa zu vereinigen, aber wie in einem unheimlichen Echo auf Napoleon wurde Hitler am Ärmelkanal, im Schnee Moskaus und in der Wüste Ägyptens zurückgeschlagen. Mit dem Versuch, Japans Ostkrieg in seinen eigenen Westkrieg einzubeziehen, überdehnte er die deutschen Kräfte und zog, statt Großbritannien aus dem Feld zu schlagen, nur die Vereinigten Staaten mit ins Spiel. Der Krieg machte das liberale amerikanische und das illiberale sowjetische Reich zu Bettgenossen, und trotz der Ausplünderung von Bodenschätzen und Arbeitskräften in Europa und im Osten konnten Deutschland und Japan der kombinierten Finanzstärke, Arbeitskraft und Fabrikationsmacht dieser Reiche nicht standhalten.
Im April 1945 reichten sich amerikanische und sowjetische Soldaten bei Torgau die Hände, umarmten sich, stießen auf den Sieg an und tanzten zusammen. Wenige Tage darauf erschoss sich Hitler, und Deutschland kapitulierte. Im August, |514|als Feuer vom Himmel regnete und Atombomben Hiroshima und Nagasaki in Schutt und Asche legten, brach Japans Gottkaiser mit allen Traditionen und sprach direkt zu seinem Volk. Mit einer Erklärung, die meine Stimme für die größte Untertreibung der Geschichte bekommt, informierte er seine Untertanen per Radioansprache: »Der Kriegsverlauf hat sich nicht unbedingt zu Japans Vorteil entwickelt.«48 Selbst da noch versuchten unverbesserliche Generäle einen Putsch in der Hoffung auf eine Fortführung des Kampfes, doch am 1. September ergab sich auch Japan.
Das Jahr 1945 beendete sowohl den Versuch Japans, den Krieg des Ostens zu gewinnen und die westlichen Imperialisten hinauszuwerfen, als auch das Bestreben Deutschlands, in Europa ein subkontinentales Reich zu schaffen, doch setzte es überdies den westeuropäischen Seemächten ein Ende. Zu ausgelaugt durch den totalen Krieg, um noch nationalistischen Revolten oder antikolonialistischen Erhebungen zu widerstehen, schmolzen sie innerhalb einer Generation dahin. Europa war am Ende seiner Kräfte. Sein wirtschaftlicher, sozialer und politischer Zusammenbruch ließ sich bestenfalls mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches vergleichen.
Die gesellschaftliche Entwicklung im Westen brach 1945 jedoch nicht zusammen, weil das Kerngebiet mittlerweile so ausgedehnt war, dass nicht einmal der größte je ausgefochtene Krieg es zur Gänze ruinieren konnte. Die Sowjets hatten ihre Industrie jenseits der Reichweite der Deutschen wiederaufgebaut, und Bomben hatten kaum einmal das Gebiet der Vereinigten Staaten erreicht.2* Im Gegensatz dazu hatten die Verwüstungen, die von Japan in China und von den USA in Japan angerichtet worden waren, das östliche Kerngebiet gründlich demoliert, mit der Folge, dass der Zweite Weltkrieg – wie der Erste – die westliche Vorherrschaft noch stärkte. Es schien kaum einen Zweifel zu geben, dass die westliche Dominanz von Dauer sein würde – die Frage war nur, ob unter sowjetischer oder amerikanischer Führung.
Diese beiden Imperien teilten das alte europäische Kerngebiet unter sich auf und trieben einen Keil mitten durch Deutschland. Amerikanische Finanzfachleute diskutierten in der Folge eingehend über ein neues internationales Finanzsystem für den Kapitalismus und entwarfen den Marshallplan, vielleicht das beste Beispiel für aufgeklärtes Eigeninteresse, das die Geschichte zu bieten hat. Wenn die Europäer Geld hätten, so der Hintergedanke, könnten sie amerikanische Nahrungsmittel kaufen, amerikanische Maschinen importieren, um ihre eigene Industrie wieder aufzubauen, und würden davon Abstand nehmen, ihre Stimme den Kommunisten zu geben. So schob ihnen Amerika einfach 13,5 Milliarden Dollar zu, etwa ein Zwanzigstel seines Bruttoinlandsprodukts von 1948.
|515|Die meisten Westeuropäer griffen nach dem Geld, akzeptierten Amerikas Führungsrolle und traten einer demokratischen, marktfreundlichen Kontinentalgemeinschaft bei oder näherten sich ihr an.3* (Die Ironie, dass die USA die Europäer mit sanftem Druck zu einer blassen Version eines Landimperiums unter der industriellen Vorherrschaft der Westdeutschen drängten, konnte eigentlich niemandem entgehen.) Die osteuropäischen Führungen beugten sich der militärischen Vormacht der Sowjetunion und schlossen sich einem kommunistischen, nach innen gerichteten Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe an. Statt Ressourcen nach Osteuropa zu pumpen oder etwa auch die Demokratie zu fördern, zapften die Sowjets Ressourcen daraus an und warfen Gegner ins Gefängnis oder erschossen sie. Trotzdem erreichte die osteuropäische Produktion bis 1949 wieder Vorkriegsniveaus. In der amerikanischen Einflusssphäre lief es noch besser: Ohne nennenswerte Inhaftierungen oder Erschießungen gelang dort von 1948 bis 1964 eine Verdoppelung der Produktion.
Das amerikanische und sowjetische Imperium waren nicht die Ersten, die sich das westliche Kerngebiet teilten, doch aufgrund ihrer Nuklearwaffen unterschieden sie sich von all ihren Vorgängern. Die Sowjets testeten 1949 eine Atombombe, und bis 1954 verfügten beide über Wasserstoffbomben mit einer 1000-fach größeren Vernichtungskraft als die Waffe, die Hiroshima ausradiert hatte – so viel gewaltiger als diese, wie Churchill in sein Tagebuch schrieb, dass sie sich davon unterschieden wie die »Atombombe selbst von Pfeil und Bogen«.49 Ein Kreml-Bericht kam zu dem Schluss, dass ein Krieg »auf dem gesamten Planeten Bedingungen schaffen könnte, unter denen kein Leben mehr möglich ist«.50
Doch hinter der Atompilzwolke zeichnete sich ein Silberstreif ab. »So sonderbar es erscheinen mag«, sagte Churchill vor dem britischen Parlament, »die Universalität der potenziellen Zerstörung ist, denke ich, der Grund, weshalb wir mit Hoffnung und sogar Zuversicht in die Zukunft blicken können.«51 Mit der Doktrin der »wechselseitig zugesicherten Zerstörung« war das Gleichgewicht des Schreckens geboren, und obwohl eine Kette angsteinflößender Fehlleistungen die Welt mehrfach an den Rand der Apokalypse brachte, trug der Westen keinen dritten Weltkrieg aus.
Stattdessen kämpfte er einen Krieg in der Dritten Welt um die Überreste der westeuropäischen und japanischen Reiche, ausgetragen zumeist durch Stellvertreter (gewöhnlich bäuerliche Revolutionäre auf Seiten der Sowjets und brutale Diktatoren auf Seiten der Amerikaner). Dem Anschein nach hätte dies ein Heimspiel für die Vereinigten Staaten werden müssen, die nun mit noch kolosshafterem Schritt den Globus durchmaßen als die Briten ein Jahrhundert zuvor. Besonders im Osten hatte Washington scheinbar die besten Karten. Die USA pumpten eine |516|halbe Milliarde Dollar nach Japan und zogen sich einen loyalen, wohlhabenden Verbündeten an die Brust. Gestützt von großzügiger amerikanischer Hilfe, schien außerdem die nationalchinesische Armee gut gerüstet, Mao Zedongs Kommunisten zu besiegen und endlich den chinesischen Bürgerkrieg zu beenden.
Der abrupte Zusammenbruch der Guomindang 1949 veränderte alles und verwandelte den Osten in den heißesten Brandherd des nunmehr Kalten Kriegs des Westens. Stalin ermutigte Nordkorea, in Amerikas Klientelstaat Südkorea einzumarschieren, und als das schiefging, griff auch Mao ins Kampfgeschehen ein. Als der Krieg 1953 ins Stocken kam, waren vier Millionen Menschen umgekommen (einschließlich einer von Maos Söhnen), und Guerillakriege wüteten auf den Philippinen, in Malaysia und Indochina. Die amerikanischen Stellvertreter entschieden die ersten beiden Konflikte ebenso wie den Kampf in Indonesien für sich, aber bis 1968 stand eine halbe Million Amerikaner in Vietnam – und unterlag (wenn auch der ebenso endgültige wie fluchtartige Abzug erst 1975 erfolgte).
Diese Kämpfe waren zugleich Frontabschnitte im sowjetisch-amerikanischen Krieg des Westens und nationale Befreiungskriege, jedoch in keiner Weise eine Neuauflage des Kriegs des Ostens. China und Japan, die Großmächte des Ostens, versprachen sich nach 1945 wenig von einer Expansion. China hatte genug Probleme im Inneren, während Japan auf friedlichem Wege viele der Ziele erreichte, die es 1941 gewaltsam angestrebt hatte – eine in jeder Hinsicht ebenso befremdliche Ironie wie die Erfolge Westdeutschlands in Europa. Japan bediente sich der amerikanischen Unterstützung überaus geschickt und nutzte die Zerstörung seiner alten Industrien zu seinem Vorteil, indem es sie neu organisierte, mechanisierte und profitable Nischen für sie fand. 1969 überrundete die japanische Wirtschaft die westdeutsche und holte in den 1970er Jahren stetig gegenüber der amerikanischen auf.
Mittlerweile spürten die USA die Belastung des an vielen Fronten geführten Kalten Kriegs. Obwohl sie mehr Bomben auf Vietnam abwarfen als auf Deutschland während des Zweiten Weltkriegs, erlitten die Amerikaner eine demütigende Niederlage und schwächten ihren Einfluss im Ausland. Die sowjetischen Stellvertreter begannen, Kriege in Afrika, Asien und Lateinamerika zu gewinnen, und selbst die Erfolge der USA zerfielen zu Staub. Ihren beharrlich von ihnen aufgebauten asiatischen Klientelstaaten ging es nun so gut, dass sie die amerikanischen Märkte eroberten, während die europäischen Verbündeten, die Amerika zu so hohen Kosten verteidigte, anfingen, von Abrüstung und Bündnisfreiheit zu sprechen. Und indem die USA Israel unter ihren Schutz stellten, trieben sie die arabischen Regierungen in die Arme der Sowjets. Nachdem Israel 1973 den Überraschungsangriff Ägyptens und Syriens zurückschlug, entfesselten arabische Ölembargos und Preissprünge das neue Ungeheuer der Stagflation – Stagnation gepaart mit Inflation.
Als Teenager im England der 1970er Jahre sprach ich mit meinen Freunden beiläufig über den kommenden Zusammenbruch Amerikas, während wir herumsaßen |517|und amerikanische Jeans trugen, amerikanische Filme sahen und amerikanische Gitarren spielten. Soweit ich mich erinnere, sah niemand von uns jemals einen Widerspruch darin. Ich bin mir zudem ziemlich sicher, dass es uns nie in den Sinn kam, dass wir beileibe nicht Zeugen des Untergangs des amerikanischen Imperiums waren, sondern unseren Teil dazu beitrugen, den Krieg des Westens für Amerika zu gewinnen. Die entscheidende Front, so sollte sich bald herausstellen, lag nicht in Vietnam oder Angola. Sie lag in den Einkaufszentren.
»Seien wir ehrlich«, rief Harold Macmillan, der englische Premierminister, 1957 seinen Wählern zu, »den meisten Menschen bei uns ist es noch nie so gut gegangen.«52 Die Briten mochten ein Imperium verloren und noch keine neue Rolle für sich gefunden haben, doch sie hatten, wie immer mehr Menschen auf der ganzen Welt, zumindest eine Fülle von materiellen Dingen. In den 1960er Jahren waren Luxusgüter, die noch ein Jahrhundert zuvor nicht einmal existiert hatten – Radios, Fernseher, Plattenspieler, Autos, Kühlschränke, Telefone, elektrisches Licht und (woran ich mich am besten erinnere) Plastikspielzeug–, im westlichen Kerngebiet alltäglich geworden (Abbildung 10.9).
Manch einem erschien es wie ein Zeitalter der Vulgarität. Vororte und Satellitenstädte breiteten sich um jede Autobahnabfahrt und Ortsumgehung aus, vom amerikanischen Levittown über das britische Telford bis hin zur Gropiusstadt in Westberlin, und beleidigten mit ihrer schachtelhaften Eintönigkeit das Auge der Ästheten. Aber sie verschafften den Menschen, was sie wollten: ein bisschen Platz, sanitäre Einrichtungen im Gebäudeinnern und Garagen für ihre glänzenden Fords und VWs.
Das 20. Jahrhundert war ein Zeitalter der Fülle, eines materiellen Überflusses, der die kühnsten Träume übertraf. Preisgünstige Kohle und billiges Öl generierten Elektrizität für alle, ließen auf Knopfdruck Maschinen laufen und Häuser beleuchten. Über 2000 Jahre zuvor hatte Aristoteles bemerkt, dass es immer Sklaven geben würde, es sei denn, die Menschen hätten automata – sich selbsttätig bewegende Maschinen –, die für sie die Arbeit erledigten. Nun wurde seine Fantasievorstellung wahr, und die elektrische Energie verschaffte selbst dem Niedrigsten unter uns Dutzende von Sklaven, die unser tägliches Verlangen nach Unterhaltung, Wärme und – insbesondere – Essen stillten.
Diese Energierevolution verwandelte die Märchen des 16. Jahrhunderts von endlosen Festen in Realität. Zwischen 1500 und 1900 hatte sich der Weizenertrag im westlichen Kerngebiet dank eines optimierteren Ackerbaus, vermehrter Zugtiere und besseren Düngers ungefähr verdoppelt, aber dann stießen die Bauern an die Grenzen ihres Einfallsreichtums. Durch noch mehr Tiere ließ sich die Produktivität nur bis zu einem gewissen Grad steigern, und um 1900 wurde ein |518|Viertel des nordamerikanischen Ackerlands allein zum Füttern der Pferde benötigt. Dann kamen Benzin und Diesel zu Hilfe. Amerikas erste Traktorenfabrik öffnete 1905, und bis 1927 stellten Trecker auf amerikanischen Farmen ebenso viel Arbeitskraft bereit wie Pferde.

Abbildung 10.9: Es ging uns noch nie so gut
Der Autor und sein Spielzeug, Weihnachten 1964.
Alles hat seine Schattenseiten. 1875 war es die Hälfte aller Amerikaner, die auf dem Feld arbeitete, doch ein Jahrhundert später nur noch einer von 50. Maschinen fraßen Menschen, der Traktor entvölkerte auf dem Land ganze Gemeinden, war es doch profitabler, den Boden mit ein paar angeheuerten Tagelöhnern und Dieselmaschinen zu bewirtschaften. »Stumpfnasige Ungeheuer, die den Staub durchwühlten und ihre Schnauzen hineinsteckten«, nannte der Schriftsteller John Steinbeck die Traktoren. »Sie durchzogen kreuz und quer das Land, kamen durch Zäune, durch Höfe und durch Gräben.«53
Steinbeck sah eine Revolution der Verdammten dieser Erde voraus, doch als die Flutwelle der Enteignung und Verarmung, die überschüssige Menschen aus dem Mittleren Westen ganz nach Westen und schwarze Baumwollpflücker nach Norden spülte, wieder abebbte, fanden die meisten Migranten in der Stadt eine Arbeit, die besser bezahlt war als die Plackerei in der Landwirtschaft, die sie hinter sich gelassen hatten. Die Agrogeschäftsleute, die sie vertrieben hatten, verkauften ihnen nun billige Nahrungsmittel und investierten die Gewinne in chemische Düngemittel und Herbizide, elektrische Pumpen zur Bewässerung trockener |519|Felder und schließlich genveränderte Feldfrüchte, die nahezu allen Umweltbedingungen trotzten. Bis zum Jahr 2000 schluckte jeder Hektar amerikanischen Farmlands achtzigmal mehr Energie als 100 Jahre zuvor und warf einen vierfach höheren Ertrag an Nahrungsmitteln ab.
Wohin Amerika heute ging, dorthin folgte ihm morgen die Welt. Eine »grüne Revolution« vervierfachte zwischen 1950 und 2000 die Weltnahrungsmittelproduktion. Die Preise fielen stetig, Fleisch rückte bei der Ernährung an die Stelle von Getreide, und der Hunger wurde kontinuierlich zurückgedrängt – außer dort, wo Katastrophen, Dummheit und Gewalt dazwischenfunkten.
Wie alle anderen Organismen, so verwandeln auch Menschen überschüssige Energie in Nachkommenschaft, und so kam es im 20. Jahrhundert zusammen mit der Nahrungsmittelproduktion annähernd zu einer Vervierfachung der Weltbevölkerung. Aber in anderer Hinsicht wichen die Menschen von der Norm ab. Statt ihren gesamten unerwarteten Energiezugewinn in Nachkommen zu stecken, horteten sie etwas davon in ihrem eigenen Körper. Ein Erwachsener hatte im Jahr 2000 im Durchschnitt 50 Prozent mehr Körpermasse als hundert Jahre zuvor. Die Menschen wurden zehn Zentimeter größer, wurden fülliger und hatten mehr Energie für die Arbeit zu Verfügung. Diese größeren Menschen entwickelten robustere Organe und legten Fett zu (in reichen Ländern zu viel) und wurden damit widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Verletzungen. Heutige Amerikaner und Westeuropäer leben üblicherweise 30 Jahre länger als ihre Urgroßeltern und genießen ein bis zwei zusätzliche Jahrzehnte, bevor ihre Augen, Ohren und anderen Organe schwächer werden und Arthritis ihre Gelenke lahmlegt. In einem Großteil der übrigen Welt einschließlich China und Japan ist die Lebenserwartung eher um 40 Jahre gestiegen. Selbst in Afrika, das von AIDS und Malaria heimgesucht wird, war die durchschnittliche Lebenserwartung 2008 um 20 Jahre höher als um 1900.
Der menschliche Körper hat sich in den letzten 100 Jahren stärker verändert als in den vorangegangenen 50 000, und die Menschen haben – insbesondere in reichen Ländern – gelernt, in ihn einzugreifen, um seine verbliebenen Mängel zu beheben. Europäer haben seit Beginn des 14. Jahrhunderts Brillen getragen, die sind nun längst über den ganzen Globus verbreitet. Ärzte haben neue Techniken entwickelt, um das Gehör zu erhalten, das Herz weiterschlagen zu lassen, abgetrennte Gliedmaßen wieder anzunähen und sogar in die Zellen einzugreifen. Öffentliche Gesundheitsvorsorge und, mehr noch, bessere sanitäre Verhältnisse haben die Pocken, Masern und andere Infektionskrankheiten als Ursache massenhaften Sterbens ausgerottet.
Abbildung 10.10 zeigt, unter welchen chronischen Krankheiten Veteranen der US-Armee litten. Sie vermittelt einen Eindruck davon, wie sehr sich die allgemeine Gesundheit verbessert hat. Veteranen mögen angesichts der Gewaltsamkeit ihres Berufs als Untersuchungsobjekt (und weil sie vornehmlich Männer sind) keinen idealen Ausschnitt der Menschheit darstellen, doch dank der besessenen |520|Dokumentationstätigkeit des Militärs ist keine Gruppe besser untersucht. Die Verbesserungen, die sich an ihr ablesen lassen, sind verblüffend.
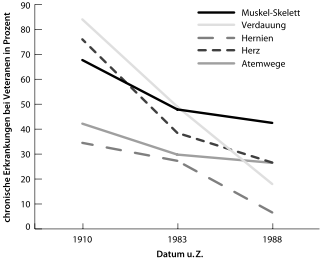
Abbildung 10.10: Sei alles, was du sein kannst
Die Gesundheit von Veteranen der US-Armee, 1919–1988.
Das Leben der Frauen hat sich sogar noch mehr verändert. Durch die gesamte Geschichte hindurch waren Frauen Gebärmaschinen gewesen. Weil die Hälfte ihrer Kinder im ersten Lebensjahr starb (die meisten davon tatsächlich bereits in der ersten Lebenswoche) und nur die Hälfte der überlebenden Nachkommen es bis zu ihrem 40. Geburtstag schafften, war es zur Aufrechterhaltung einer stabilen Bevölkerung (je Paar zwei erwachsene Nachkommen, die Mutter und Vater ersetzen) notwendig, dass eine Frau durchschnittlich etwa fünfmal niederkam und einen Großteil ihres Erwachsenenlebens als Schwangere und/oder Stillende verbrachte. Das 20. Jahrhundert indes hob diese von hoher Mortalität regierte Welt aus den Angeln.
Bereits vor der Wende zum 20. Jahrhundert gebaren besser genährte, stärkere Frauen kräftigere Babys, fütterten sie mehr und hielten sie sauberer. Die Kindersterblichkeit nahm ab, sodass die Bevölkerung explosionsartig wuchs – bis die Frauen ihre Fruchtbarkeit unter Kontrolle brachten. Die Menschen hatten zwar schon immer Mittel und Wege der Verhütung gefunden (der Legende nach gebrauchte Casanova im 18. Jahrhundert zu diesem Zweck Zitronenhälften), auch waren die Geburtenraten in den reichsten Ländern bereits um 1900 rückläufig, doch im 20. Jahrhundert nahmen sich Technik und Wissenschaft in den USA auch dieser Herausforderung an: 1920 kam das Latexkondom, 1960 die Antibabypille. |521|In den reichen Ländern fiel die Geburtenrate bald unter die Erhaltungsrate von zwei Kindern pro Paar.
Während gesündere Kinder und die Pille die Frauen vom lebenslangen Gebärzwang befreiten, enthob sie die Erfindung preisgünstiger Heizspiralen für Bügeleisen und Toaster und kleiner Elektromotoren für Waschmaschinen und Staubsauger der beschwerlichsten Schinderei im Haushalt. Ein Knopfdruck erledigte Aufgaben, die zuvor Stunden mühsamer Arbeit erfordert hatten. Frauenhände kamen noch immer nicht zur Ruhe, aber ab 1960 konnte eine Frau ins Auto springen (fast jede amerikanische Familie besaß eins), zum Supermarkt fahren (wo zwei Drittel der im Land produzierten Nahrungsmittel verkauft wurden), anschließend ihre Einkäufe im Kühlschrank deponieren (98 Prozent der Haushalte hatten einen) und die Waschmaschine einschalten, bevor ihre zwei oder drei Kinder von der Schule heimkamen und sich vor dem Fernseher niederließen.
Diese Veränderungen befreiten die Frauen für Tätigkeiten außerhalb des Heims. Und sie wurden dringend gebraucht. Der rasche Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft setzte Kolonnen klassischer Arbeiter frei und ließ den Bedarf an Angestellten im Tertiärsektor in die Höhe schießen. In den reichsten Ländern stieg nach 1960 der Anteil der Frauen in bezahlten Beschäftigungsverhältnissen und den Hochschulen stetig, und wie jedes Zeitalter vor ihm bekam auch dieses das Denken, das es brauchte. Bücher wie Der Weiblichkeitswahn oder Die Mystifizierung der Frau von Betty Friedan und Sexus und Herrschaft von Kate Millett drängten Frauen der Mittelklasse, Erfüllung außerhalb ihrer traditionellen Rollen zu suchen. 1968 sprengten etwa 100 Demonstrantinnen die Miss-Amerika-Wahl in Atlantic City. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts beteiligten sich die Männer stärker an der Hausarbeit und Versorgung der Kinder (auch wenn ihre Ehefrauen und Partnerinnen im Allgemeinen immer noch mehr leisteten als sie).
1958 kamen die Sowjetunion und die USA überein, Leistungsschauen im jeweils anderen Land abzuhalten, waren doch beide zuversichtlich, mit der Stärke ihrer Industrieproduktion den Gegner einschüchtern zu können. Bei der ersten Ausstellung in New York führten die Sowjets Traktoren, Lastwagen und Raketenattrappen ins Feld, um die Kapitalisten zu überzeugen, dass Widerstand zwecklos war. 1959 schlugen die USA mit Bravour zurück und entsandten den damaligen Vizepräsident Richard Nixon nach Moskau, um auf einer Ausstellungsfläche von 15 000 Quadratmetern Haushaltsgeräte vorzustellen, einschließlich der exakten Kopie eines Reihenhausneubaus auf Long Island. Unter den Augen verblüffter Moskowiter gingen Nixon und Nikita Chruschtschow an beiden Seiten einer Westinghouse-Waschmaschine in Kampfstellung.
»Was immer Frauen die Arbeit erleichtert, ist gut«, eröffnete Nixon die Partie, doch Chruschtschow war vorbereitet. »Sie wollen Ihre Frauen in der Küche halten«, parierte er. »Wir denken nicht so über Frauen. Wir haben eine höhere Meinung von ihnen.« Da mochte etwas dran sein, schließlich arbeiteten in der Sowjetunion mehr Frauen außerhalb des Haushalts als in den USA. Andererseits |522|sollte ein weiteres Jahrzehnt vergehen, bis auch nur die Hälfte der sowjetischen Haushalte eine Waschmaschine besaß. Nachdem sie mit dem Bus von ihrer Fabrikarbeit heimgekommen war, leistete die typische sowjetische Ehefrau zusätzlich 28 Stunden pro Woche Hausarbeit. Nur in einer von acht Wohnungen gab es einen Staubsauger, wenngleich ihn sich die Genossen, allesamt gute Kommunisten, vielleicht teilten.
Nixon antwortete mit einer Lobrede auf das freie Unternehmertum. »Bei uns wird nicht eine einzelne Entscheidung an der Spitze einer Regierungsbehörde gefällt«, erklärte er. »Wir haben viele verschiedene Hersteller und viele verschiedene Arten von Waschmaschinen, damit die Hausfrauen eine Wahl haben. … Wäre es nicht besser, bei der Leistung von Waschmaschinen zu konkurrieren als bei der Stärke von Raketen? … Wir drängen Ihnen [unseren Lebensstil] nicht auf«, schloss er, »aber Ihre Enkel werden ihn erleben.«54
Da hatte Nixon Recht. 1959 bestritt Chruschtschow noch schlicht, dass amerikanische Arbeiter in solchen Häusern lebten, doch spätestens in den 1980er Jahren musste seinen Enkeln klar geworden sein, dass man ihnen etwas vormachte. In gewisser Weise war diese verspätete Einsicht wiederum dem Entwicklungsparadox geschuldet: Die meisten Sowjetbürger besaßen mittlerweile Waschmaschinen und Staubsauger, aber sie hatten auch Radios, Fernsehgeräte und Schallplatten mit Rockmusik vom Schwarzmarkt. So konnten sie selbst sehen, dass die Amerikaner ihnen sogar noch weiter davonzogen.
Ein Witz begann die Runde zu machen: Ein Zug fährt ehemalige Sowjetführer durch die Steppe und bleibt plötzlich stehen. Wie erwartet, springt Stalin auf und ruft: »Peitscht den Lokführer aus!« Der Lokführer wird ausgepeitscht, aber der Zug bewegt sich nicht weiter. Daraufhin befiehlt Chruschtschow: »Rehabilitiert den Lokführer!« Dies geschieht, doch wieder regt sich nichts. Da lächelt Breschnew und schlägt vor: »Tun wir doch einfach so, als würde der Zug fahren.«55
Schlimm genug, dass die Untertanen des Sowjetimperiums, wenn sie ihre Fernseher einschalteten, darin manchmal auch Leute wie mich mit ihren Gitarren und Jeans zu Gesicht bekamen, doch wirklich katastrophal war, dass sie mit ansehen konnten, wie mit der Informationstechnologie als Treibsatz eine ganz neue Phase der industriellen Revolution begann. Und diese Phase verhalf einem Großteil derer, die auf der richtigen Seite des Eisernen Vorhangs lebten, zu noch größerem Wohlstand. Der erste amerikanische Computer, der Electronic Numerical Integrator and Calculator, kurz: ENIAC, war 1946 enthüllt worden. Er wog 30 Tonnen und verbrauchte so viel Strom, dass die Lichter in ganz Philadelphia sich verdunkelten, wenn er eingeschaltet wurde. Im Verlauf der folgenden 30 Jahre verkaufte die Firma International Business Machines, kurz: IBM, den westlichen Unternehmen kleinere, doch immer noch monströse Rechner, bis mit der Erfindung des Mikroprozessors 1971 der wahre Durchbruch gelang.
Wie so oft kamen die Erneuerer nicht aus der Mitte, sondern aus dem Dunstkreis der etablierten Elite – in diesem Fall eben nicht von einem hochrespektablen |523|Unternehmen wie IBM. Steve Wozniak, Steve Jobs und ein paar befreundete Computerfreaks bastelten in ihrer Garagenfirma in Menlo Park, einem kalifornischen Kleinstädtchen, mit einem eher lächerlichen Startkapital ihren Heimcomputer Apple I zusammen und brachten ihn 1976 auf den Markt. Bis 1982 erreichte der Umsatz von Apple 583 Millionen Dollar. IBM entwickelte, um konkurrenzfähig zu bleiben, den Personal Computer. Mittlerweile hatten zwei Studienabbrecher der Universitäten Harvard und Washington State, Bill Gates und Paul Allen, Microsoft gegründet und waren an die Westküste gezogen. Computer hielten Einzug in jedes Büro und jedes Heim. Sie wurden Jahr für Jahr preisgünstiger und bedienungsfreundlicher – und sogar zum Spaßfaktor.
Computer veränderten im westlichen Kerngebiet alles: die Unterhaltung, die Arbeit, den Handel, die Kriegführung. Bis 1985 gab es keinen Bereich des westlichen Lebens, der nicht mit Computern in Berührung gekommen wäre – anders im Sowjetimperium. So zu tun, als ob der Zug führe, war keine Option mehr.
Im Osten, wo Amerikas Klientelstaaten rasch das kommunistische China hinter sich ließen, war das nicht anders. Japan kletterte, gefolgt von Taiwan und Südkorea, schnell die wirtschaftliche Leiter hinauf, vom Plastikspielzeug der 60er Jahre, das mir als Kind so gefallen hatte, hin zu Schwerindustrie und Elektronik. Und während diese Staaten aufstiegen, übernahmen andere asiatische Nationen – Singapur, Malaysia, Thailand – ihre Plätze. Im ganzen Osten stiegen die Löhne, die Lebenserwartung nahm zu, die Säuglinge wurden kräftiger, größere Wohnungen füllten sich mit technischen Geräten. Es gab weit weniger Fernsehgeräte in China als in der Sowjetunion, aber die Politiker in Beijing erkannten nur zu klar die Gefahr, die sich durch die entlang ihrer Ostküste verteilten Außenposten des Wohlstands aufbaute. Diese »asiatischen Tiger«, wie man sie bald nannte, waren ein Affront. Alle hatten mehr oder weniger ein Ein-Parteien-Regime, und alle teilten Chinas konfuzianischen und buddhistischen Hintergrund. Wenn also weder Autoritarismus noch östliche Kulturtradition ein meteoritenhaftes Wachstum verhinderten, wo konnte das Problem wohl liegen, wenn nicht beim Kommunismus selbst?
Das Jahrhundert des Bürgerkrieges und der Parteikämpfe zwischen den 1840er und den 1940er Jahren hatte es China unmöglich gemacht, Japans rascher Industrialisierung zu folgen, aber nach seinem Sieg 1949 beeilte sich Mao Zedong, in Lenins Fußstapfen zu treten, und baute sein Reich als subkontinentales Imperium wieder auf. Der Frieden brachte eine enorme Dividende, und genau wie bei der Sui-Dynastie, die China im 6. Jahrhundert geeint hatte, bei den Song im 10. und den Ming im 14. Jahrhundert erholte sich die Wirtschaft wieder. Der Fünfjahresplan im sowjetischen Stil, den Mao auf den Weg brachte, als sich der Koreakrieg in einem Waffenstillstand verlaufen hatte, war weit weniger effektiv als der Kapitalismus |524|der asiatischen Tiger, aber immerhin verdoppelte er die Industrieproduktion und hob die Reallöhne um ein Drittel an. Die Lebenserwartung bei der Geburt stieg steil, von 36 Jahren im Jahr 1950 auf 57 Jahre 1957.
Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass die chinesische Wirtschaft in den 1960er und 1970er Jahren weiter stark gewachsen wäre, allein Mao, wie so viele chinesische Kaiser vor ihm, misstraute seinen Beamten. Die falschen Gesetze der Ökonomie, so verkündete er, müssten den wahreren Gesetzen des Marxismus weichen, doch seine Planer – mit ihren Rechenschiebern und Grafiken – kamen ihm verdächtig bourgeois vor. Erst durch Entfesselung des unbezwingbaren Volkswillens, befand Mao, würde das Paradies des Volkes errichtet werden können.
Mao war um 1915, als er Marx (und Herbert Spencer) las, zu geistiger Reife gelangt. Er war ein Anhänger der Theorie langfristiger Determiniertheit und davon überzeugt, dass die Unterlegenheit des Ostens seit Jahrhunderten in Stein gemeißelt sei. Die Antwort, so folgerte er, bestand darin, die »Vier Alten« – alte Sitten, alte Gewohnheiten, alte Kulturen und altes Denken – hinwegzufegen. Selbst die Familie musste weichen: »Die liebsten Menschen auf der Welt sind unsere Eltern«, erläuterte eine chinesische Jugendzeitung, »aber sie lassen sich nicht mit dem Vorsitzenden Mao und der Kommunistischen Partei vergleichen …, die uns alles gegeben hat.«56 Beim »Großen Sprung nach vorn«, mit dem er den Westen einholen wollte, steckte Mao 99 Prozent der Bevölkerung in Volkskommunen mit mehreren tausend Mitgliedern. In so manchem dieser Produktionskollektive lief der Utopismus Amok:
Der Parteisekretär der Stadt Paoma gab im Oktober 1958 bekannt, dass der Sozialismus am 7. November enden und der Kommunismus am 8. November beginnen würde. Nach der Versammlung strömten alle sofort auf die Straßen und fingen an, sich Waren aus den Läden zu schnappen. Als die Regale leer waren, gingen sie in die Häuser anderer Leute und nahmen deren Hühner und Gemüse zum Essen mit nach Hause. Die Leute hörten sogar auf, zu unterscheiden, welches Kind zu wem gehörte. Nur Ehefrauen blieben vor einem allgemeinen Zugriff bewahrt, weil sich der Parteisekretär in dieser Sache unsicher war.57
Andernorts herrschte Zynismus vor. Einige nannten es die Iss-alles-auf-Periode: Jedes Anreizes beraubt, arbeiten zu gehen oder zu sparen, verzichteten viele Leute auf beides.
Die Parteifunktionäre beugten sich dem Druck von oben und wiesen immer größere Ernteerträge aus. Dabei sanken diese Erträge in Wirklichkeit, weshalb die Funktionäre dazu übergingen, immer größere Anteile zu konfiszieren, um ihre Zahlen zu rechtfertigen. »Es ist nicht so, dass es keine Nahrung gibt«, beharrte ein Kommissar. »Es gibt eine Menge Getreide, aber 90 Prozent der Menschen haben ideologische Probleme.«58
Zu allem Übel entzweite sich Mao auch noch mit Chruschtschow. Von sowjetischer |525|Hilfe abgeschnitten, versuchte er, das Niveau der westlichen Stahlproduktion zu erreichen, indem er 40 Millionen Bauern vom Land abzog, um in Hinterhöfen Volkshochöfen zu bauen. In denen wurde dann zur Herstellung hausgemachten Stahls geschmolzen, was immer sich vor Ort an Eisenerz auftreiben ließ, sogar Töpfe und Pfannen. Wenig von dem, was dort produziert wurde, war verwendbar, doch niemand wagte es auszusprechen.
Das Leben auf dem Land wurde zunehmend surreal. »Helle, aus einem Lautsprecher über dem Gelände tönende Melodien lokaler Opern erfüllen die Luft«, berichtete ein Reporter, »begleitet von dem Gesumm der Gebläse, dem Keuchen von Benzinmotoren, dem Hupen schwerbeladener Lastwagen und dem Gebrüll der Erz und Kohle ziehenden Rinder.«59
»Der Kommunismus ist das Paradies«, sollten die Bauern singen. »Die Volkskommunen sind die Brücke dorthin.«60 Es war jedoch ein Paradies voller Drangsal und Ungemach. Wenn das Volk nicht gerade sang, hungerte es. Ein Informant berichtete:
Das Schlimmste, das während der Hungersnot geschah, ist dies: Eltern fällten den Entschluss, die Alten und Kleinen zuerst sterben zu lassen. … Eine Mutter sagte dann zu ihrer Tochter: »Du musst gehen und deine Oma im Himmel besuchen.« Sie hörten auf, dem Mädchen zu essen zu geben, sie gaben ihm nur noch Wasser. … Eine Frau wurde angezeigt und vom Amt für Öffentliche Sicherheit verhaftet. Niemand im Dorf kritisierte sie, als sie ein paar Jahre später aus einem Arbeitslager zurückkehrte.61
Zwischen 1958 und 1962 verhungerten etwa 20 Millionen Chinesen (die düstersten Schätzungen belaufen sich sogar auf über 40 Millionen Tote). Nach Maos Tod kam das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas offiziell zu dem Schluss, dass der große Steuermann zu 70 Prozent Recht und zu 30 Prozent Unrecht gehabt hatte, aber um 1960 hätten viele hohe Parteikader die Anteile von Recht und Unrecht gewiss umgekehrt gewichtet. Eine Gruppe von Technokraten umging Mao und führte in gewissem Umfang wieder Privateigentum ein. Bis 1965 hatten die Ernten wieder das Niveau von 1957 erreicht.
Mao war jedoch nicht geschlagen. Nach dem Krieg hatte China, wie der Westen, einen Babyboom erlebt. Diese Kinder waren mittlerweile zu einer riesigen Kohorte ungeduldiger Teenager herangereift. Wohlhabende Jugendliche im liberalen westlichen Kerngebiet verwandten ihre Energie (und ihre Kaufkraft) darauf, sich ihrer Musik hinzugeben, mit ihrer Haartracht und ihren Klamotten zu provozieren sowie die Bastionen der überkommenen Sexualmoral zu stürmen. Doch in China lenkte Mao die Energie zorniger Jugendlicher auf seine eigenen Mühlen. 1966 predigte er eine permanente »große proletarische Kulturrevolution« und stachelte die Jungen zu einem Angriff auf alles Bestehende auf.
Millionen von Heranwachsenden verließen ihre Schulen und Universitäten und verwandelten sich in randalierende Rotgardisten, die zuerst ihre Lehrer schlugen und erniedrigten und dann alle anderen, die ihnen reaktionär vorkamen. Während |526|westliche Jugendliche die Revolution beschworen, lebten die jungen Chinesen sie aus. Ein Literaturstudent verkündete stolz per Wandzeitung:
Es war Klassenhass, der mich dazu veranlasste, [meine Klassenkameradin] Li Jianping zu denunzieren, und das entflammte den Zorn der Massen. Sie schlugen sie – ein konterrevolutionäres Element, das vom alten kommunalen Parteikomitee so viele Jahre beschützt worden war – mit ihren Knüppeln zu Tode. Es war ein ungeheuer befriedigendes Ereignis, das revolutionäre Volk zu rächen, die toten Märtyrer zu rächen. Als Nächstes werde ich einige Rechnungen mit jenen Bastarden begleichen, die Verrätern Schutz gewähren.62
Mao versuchte, den Zorn der Roten Garden gegen seine Rivalen zu richten, doch er bekam sie nie wirklich unter Kontrolle. Da niemand davor sicher war, als Konterrevolutionär denunziert zu werden, beeilten sich die Leute, mir ihrer Kritik die Ersten zu sein. Für viele war es einfach verwirrend. So murrte ein Latrinenwärter, dass er seine Arbeit verloren habe, weil zu viele Professoren im Rahmen ihrer Umerziehung zur Reinigung von Toiletten gezwungen wurden. Viele fanden es jedoch berauschend. Die Fabriken kamen knirschend zum Stillstand, als junge Arbeiter sich zusammenrotteten, um zu den Studenten zu stoßen. Rotgardisten luden Filmteams ein, um zu dokumentieren, wie sie buddhistische Statuen, konfuzianische Tempel und Relikte der Han-Dynastie zertrümmerten. Eine Bande besetzte sogar das Außenministerium und ernannte ihre eigenen, durch und durch proletarischen Diplomaten.
1969, als die Ereignisse offenbar auf ein Desaster vom Ausmaß des Großen Sprungs zutaumelten, riss selbst Mao der Geduldsfaden. Tausende waren umgekommen, Millionen Leben ruiniert. Die asiatischen Tiger zogen der Volksrepublik stetig davon. Die Beziehungen zu den Sowjets waren so schlecht, dass mittlerweile 800 Chinesen bei Zwischenfällen an der Grenze getötet worden waren. Mao distanzierte sich nachträglich von den Radikalen und sah sich nach einem Rettungsanker um.
Beistand erwuchs ihm von der vielleicht denkbar unwahrscheinlichsten Person: dem scharf antikommunistischen US-Präsidenten Richard Nixon. Für Nixon war ein Abkommen mit China ein willkommener Trumpf, um die Sowjets im Kalten Krieg strategisch an die Wand zu spielen, und 1972, nach allerlei Ballwechseln im Rahmen der Ping-Pong-Diplomatie, flog er nach Beijing und schüttelte Mao die Hand. »Das war die Woche, die die Welt verändert hat«, triumphierte Nixon am Ende seines mehrtägigen Besuchs, und in gewisser Weise hatte er Recht.63 Die Aussicht auf eine Achse Washington–Beijing jagte Breschnew einen solchen Schrecken ein, dass Nixon drei Monate nach seinem Chinabesuch in Moskau saß und dort das Rüstungsbegrenzungsabkommen SALT1 unterzeichnete.
Mao profitierte beinahe genauso viel. Durch sein Treffen mit Nixon signalisierte er den Pragmatikern, die nach westlicher Technologie hungerten, Unterstützung |527|zu und stellte sich den Radikalen entgegen, die Chinas gebildete Schichten zerschlagen hatten. In einem berühmten Fall hatte ein Bewerber einen begehrten Studienplatz ergattert, weil er ein leeres Prüfungsheft mit der Notiz abgegeben hatte, revolutionäre Reinheit sei wertvoller als »Bücherwürmer, die es sich jahrelang leichtgemacht und nichts Nützliches geleistet haben«64. Mit einem Dünkel, den sowjetische Spaßvögel wohl zu goutieren gewusst hätten, argumentierten hohe Radikale (angeblich), dass »ein sozialistischer Zug mit Verspätung besser ist als ein fahrplanmäßig verkehrender revisionistischer«65.
Nach 1972 gewannen die Pragmatiker Boden zurück, auch wenn sich erst nach Maos Tod 1976 das Blatt endgültig zu ihren Gunsten wendete. Deng Xiaoping, unter Mao zweimal als rechter Abweichler ins Umerziehungslager gesteckt und zweimal rehabilitiert, stieß nun seine Rivalen beiseite und zeigte sein wahres Gesicht. Demonstrativ machte er sich Maos altes Mantra »Suche die Wahrheit in den Fakten« zu eigen und ging die unangenehmste Wahrheit in China frontal an: Die Bevölkerung wuchs schneller als die Wirtschaft. Um all die leeren Mägen zu füllen, die jedes Jahr ins arbeitsfähige Alter kamen, musste Chinas Wirtschaft mindestens eine Generation lang jedes Jahr um sieben Prozent wachsen. Andernfalls drohten Hungersnöte, die selbst den Großen Sprung in den Schatten gestellt hätten.
Aller historischen Erfahrung nach würde auch China, wenn es nur Frieden und eine geeinte Regierung hätte – was beides seit den 1840er Jahren nicht mehr der Fall gewesen war –, innerhalb der westlich dominierten globalen Ökonomie prosperieren können. Deng allerdings ging noch weiter: Um den Druck auf die Ressourcen zu mindern, führte er die berüchtigte Ein-Kind-Politik ein, die (theoretisch) von Frauen mit zwei Kindern verlangte, sich sterilisieren zu lassen.1* Und um die Verfügbarkeit der Ressourcen zu erhöhen, machte er sich stark für die Integration Chinas in die Weltwirtschaft. China trat der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds bei, eröffnete Sonderwirtschaftszonen, um Kapitalisten aus Macao, Hongkong und Taiwan anzulocken, und genehmigte sogar ein Coca-Cola-Werk in Shanghai.
Bis 1983 hatte Deng Xiaoping die Volkskommunen Maos praktisch eliminiert. Die Bauern gingen »Nebenbeschäftigungen« nach, deren Gewinn in ihre eigene Tasche fließen durfte, und auch Geschäftsleuten war es nun gestattet, einen Teil ihrer Profite einzubehalten. Das Ackerland gehörte immer noch den Kollektiven, aber Familien konnten nun Parzellen auf 30 Jahre pachten und sie privat bewirtschaften. In den Städten durfte Wohneigentum erworben und sogar mit Hypotheken belastet werden. Die Produktion stieg steil an, und obwohl die Liberalisierung die Konservativen entsetzte, gab es kein Zurück. Deng erklärte:
|528|Während der Kulturrevolution herrschte die Auffassung, dass ein armer Kommunismus einem reichen Kapitalismus vorzuziehen sei. … Weil ich gegen diese Auffassung war, wurde ich gestürzt. … Die Hauptaufgabe des Sozialismus ist die Entwicklung der Produktivkräfte, die stetige Verbesserung der Lebensbedingungen des Volkes und die Mehrung des materiellen Wohlstands der Gesellschaft. … Reich werden ist keine Sünde.66
Von ähnlichen Gedanken wurden, 6000 Kilometer entfernt, auch die Kommunisten in Moskau geplagt. Nach dem Schock der Chinareise Nixons war es für die Sowjetunion in den 1970er Jahren recht gut gelaufen. Als die arabischen Staaten die Ölpreise in die Höhe trieben, profitierte davon – als großer Erdölexporteur – auch die Sowjetunion. Mit dem hereingespülten Geld finanzierte und gewann Moskau eine Reihe von Stellvertreterkriegen und überflügelte 1978 das amerikanische Atomwaffenarsenal. Dann artete eine Intervention zur Stützung eines Satellitenregimes in Afghanistan in einen Zermürbungskrieg aus, der sich durch die 1980er Jahre zog, die Ölpreise fielen um zwei Drittel und die USA erhöhten ihre Militärausgaben drastisch, besonders für High-Tech-Waffen.
Das Politbüro trug sich bereits mit der Sorge, dass den gewöhnlichen Sowjetbürgern der Stillstand ihres Zuges aufgefallen war. Die sowjetische Staatswirtschaft konnte Panzer und Kalaschnikows am laufenden Band produzieren, aber keine Computer und Autos.2* Überall gärte Regimekritik. Beim Gedanken an ein neues Wettrüsten befiel die Herrscher des Sowjetimperiums das Grauen.
»So kann man nicht weiterleben«68, gestand Michail Gorbatschow seiner Frau Raissa, als sie 1985 durch ihren Garten schlenderten. Gorbatschow sollte wenige Stunden später zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei und damit zum neuen Führer der Sowjetunion ernannt werden, doch der Garten war der einzige Ort, an dem er der Schnüffelei seiner eigenen Spitzel entging. Wie Deng wusste Gorbatschow, dass er der Realität ins Auge sehen musste. Die Explosion eines antiquierten Atomreaktors in Tschernobyl offenbarte 1986, dass die Sowjetunion nicht nur zurückfiel, sondern auseinanderbrach. Unter den Schlagworten Öffnung (Glasnost) und Umbau (Perestroika) setzte Gorbatschow mit Hochdruck Reformen in Gang – nur um zu entdecken, was Marx und Engels schon anderthalb Jahrhunderte zuvor erkannt hatten: Die Liberalisierung fegt alle festen, eingerosteten Verhältnisse beiseite – nicht nur jene, die uns missfallen.
Alles Feste verdampfte, und Deng und Gorbatschow mussten beide lernen, dass wirtschaftliche Freiheiten nur den Appetit auf politische vergrößern. Manchmal erblickte Deng in Protestierenden nützliche Verbündete gegen kommunistische Betonköpfe; dann wieder ging er gegen sie vor. Gorbatschow dagegen befürchtete, dass die Anwendung von Gewalt das ganze Regime zum Einsturz bringen könnte. |529|Im Frühjahr 1989 genehmigte er offene Wahlen zum Kongress der Volksdeputierten. Und als bei dessen erster Sitzung der Deputierte Andrej Sacharow vor laufenden Kameras die Abschaffung des Machtmonopols der KPdSU forderte, ließ Gorbatschow zwar die Mikrophone ausschalten, lehnte es aber ab, den Kongress aufzulösen. Stattdessen flog er nach Beijing, wo ihm die Aktivisten der Demokratiebewegung zujubelten.
Deng war nicht amüsiert und rief einen Tag nach Gorbatschows Abreise das Kriegsrecht aus. Bis Anfang Juni 1989 drängten sich eine Million Demonstranten auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Viele von ihnen tanzten und sangen, einige traten in Hungerstreik. Deng brandmarkte sie als »sozialen Abschaum«, als Umstürzler, die eine »dem Westen hörige bürgerliche Republik … errichten«69 wollten, und schickte die Armee vor. Bilder von zerfetzten Leibern, plattgewalzten Fahrrädern und einem unbekannten Demonstranten, der sich allein einem heranrollenden Panzer entgegenstellte, gingen um die Welt.
In China siegte die Repression, doch Gorbatschow widerstand der Versuchung, es Deng nachzutun, selbst dann, als Ungarn und Polen Mehrparteienwahlen ankündigten. Stattdessen überließ er es den sowjetischen Satellitenstaaten, ihre eigenen Wege zu beschreiten. Vor lauter Erstaunen darüber fiel der frischgebackene polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki bei seiner Amtseinführung in Ohnmacht. Ungarische Soldaten testeten, wie weit sie gehen konnten, und bauten den Stacheldrahtzaun entlang der Grenze zu Österreich ab. Tausende von Ostdeutschen »auf Urlaub« in Ungarn ließen ihre Autos stehen und marschierten zu Fuß über die Grenze in die Freiheit.
Und immer noch rührte Gorbatschow keinen Finger. Als er im Oktober Ostberlin besuchte, wurde er abermals von Menschenmengen umjubelt und zum Bleiben aufgefordert. Einige Wochen darauf tanzten die Ostdeutschen auf der Berliner Mauer und schlugen mit Hämmern und Meißeln Stücke aus ihr heraus. Als niemand auf sie schoss, strömten Tausende nach Westberlin. Das ostdeutsche Regime, verwirrt und unfähig, brach auseinander. In den folgenden Monaten erging es den kommunistischen Diktaturen in ganz Osteuropa ähnlich. Als auch die Nationen, die in der Sowjetunion vereint gewesen waren, ihre Unabhängigkeit erklärten, reagierte Gorbatschow doch einmal mit militärischer Gewalt. Aber auch der »Blutsonntag« in Vilnius konnte den baltischen Freiheitsdrang nicht mehr aufhalten. Ein halbes Jahr später schlug Boris Jelzin, der Präsident der Teilrepublik Russland, einen kommunistischen Putschversuch in Moskau nieder, womit die Sowjetunion faktisch von der Russischen Föderation abgelöst wurde. Gorbatschow blieb als Präsident eines Imperiums zurück, das nicht mehr existierte. Am ersten Weihnachtsfeiertag 1991 beugte er sich dem Druck und unterzeichnete ein Dekret über seine förmliche Auflösung. Das Ende war beinahe zu perfekt: Sein sowjetischer Federhalter versagte, und er musste sich den Stift eines amerikanischen Kameramanns leihen.
Die USA hatten den Krieg des Westens gewonnen.
Als die dynastischen Imperien dem totalen Krieg nicht standgehalten hatten und zwischen 1917 und 1922 nahezu völlig verschwunden waren, waren die USA ein sehr widerwilliger Leviathan gewesen, doch als der Kommunismus zwischen 1989 und 1991 zusammenbrach und sich als ebenso überlebtes Regime erwies, standen die Amerikaner bereit, die Lücke zu füllen. Es zeichnete sich eine Welt ab, deren alleinige Supermacht die USA werden würden.
Die alte Sowjetunion implodierte unter der wilden Plünderung ihrer Vermögenswerte. Der Zusammenbruch war nicht so schlimm wie der Bürgerkrieg, der dem Sturz der Romanows gefolgt war, dennoch erlebte Russland, der eigentliche Erbe der UdSSR, in den 90er Jahren einen Einbruch der Produktion um 40 Prozent und der Reallöhne um 45 Prozent. In den 1970er Jahren war der durchschnittliche Sowjetbürger mit 68 gestorben, nur vier Jahre früher als der durchschnittliche Westeuropäer; bis zum Jahr 2000 starb der durchschnittliche Russe mit 66, zwölf Jahre früher als Einwohner der Europäischen Union. Zwar war Russland immer noch riesig, reich an Ressourcen und die größte Atommacht der Welt, zwar hatten das autoritäre Regime von Wladimir Putin und steigende Energiepreise das Land bis 2008 machtpolitisch wieder so weit gestärkt, dass es die anderen ehemaligen Sowjetrepubliken unter Druck setzen und die Europäische Union erpressen konnte. Doch stellte Russland mitnichten eine Bedrohung vom Schlage der alten Sowjetunion dar.
Auch die Europäische Union war weit davon entfernt, die Vorherrschaft Amerikas über das westliche Kerngebiet herauszufordern. Einigen Beobachtern erschien der europäische Schlingerkurs in Richtung wirtschaftlicher und politischer Integration wie ein Stück für Stück beschrittener Weg zu einem mächtigen subkontinentalen Imperium, das endlich friedlich erreichen würde, was die Habsburger, Bourbonen, Napoleon und Hitler durch Gewalt nicht vermocht hatten. Doch in Wirklichkeit blieb Europa aufgrund seiner fortdauernden Meinungsverschiedenheiten, seines nachlassenden Wirtschaftswachstums, seiner alternden Bevölkerung und seiner militärischen Schwäche weit unterhalb des Status einer Supermacht.
Der Nahe Osten spielte im Denken der amerikanischen Planungsstäbe seit dem Zweiten Weltkrieg vor allem deshalb eine Rolle, weil sie befürchteten, dass ein feindseliger Staat die Ölfelder der Region erobern könnte, wie es der Irak 1990 versucht hatte. Sie ignorierten den islamistischen Extremismus, der seit den 1970er Jahren gewachsen war, und waren daher (wie die meisten ihrer Mitbürger auch) von den Attentaten des 11. September 2001 völlig überrascht. Ihr spektakulärstes Fehlurteil fällten die Planer jedoch im Hinblick auf den Osten. Sie hatten nicht erwartet, dass Japan gegen Ende der 1980er Jahre in eine Rezession stürzen würde (und seitdem immer noch mit Stagnation und Deflation zu kämpfen hat), während sein östlicher Hauptrivale China zu einem Höhenflug ansetzte.
|531|150 Jahre waren vergangen, seit der Westen begonnen hatte, das alte östliche Kerngebiet in eine Peripherie zu verwandeln – und nun offenbarten sich allmählich die Lehren, die daraus zu ziehen waren. Unter der Voraussetzung von Frieden, verantwortlicher Regierungsführung und der Bereitschaft, sich der westlichen Vormacht unterzuordnen, konnte der Osten die kapitalistische Weltwirtschaft für seine eigenen Zwecke nutzbar machen und seine riesigen Bevölkerungen und gelehrten Eliten, die den Westlern des 19. Jahrhunderts als Ausweis der Rückständigkeit erschienen waren, in Triebkräfte des Wirtschaftswachstums verwandeln. Seit den 1840er Jahren hatte China herzlich wenig Frieden, verantwortliche Regierungsführung oder Flexibilität genossen, aber in den 1990er Jahren fing es an, seinen rechtmäßigen Platz in der globalen Ordnung einzunehmen.
1992 bereiste Deng Xiaoping die Sonderwirtschaftszonen in Südchina und legte dort in mehreren Reden sein Vermächtnis einer »sozialistischen Marktwirtschaft« dar. Einmal kletterte er inmitten eines Freizeitparks auf einen Golfwagen und verkündete von diesem Podium herab:
Man muss etwas mehr Mut bei der Reform- und Öffnungspolitik an den Tag legen, Mut zum Experiment, nicht wie Frauen mit gebundenen Füßen. Wenn man das Ziel erkannt hat, dann mutig versucht, dann mutig drauflos! … Das Zulassen von Versuchen ist viel besser als jeder Zwang. … Man muss die Gelegenheit beim Schopfe packen, und jetzt ist so eine Gelegenheit.70
Die Hindernisse, die einem roten Kapitalismus entgegenstanden, zerbröckelten. Als Mao und Nixon sich Anfang der 1970er Jahre getroffen hatten, war der durchschnittliche amerikanische Arbeiter beinahe um das Zwanzigfache produktiver als der durchschnittliche Arbeiter in einem unterkapitalisierten chinesischen Betrieb, und die USA hatten einen Anteil von 22 Prozent an der globalen Warenproduktion, China hingegen nur von fünf Prozent. In den folgenden 30 Jahren stieg die amerikanische Produktivität zwar weiter, doch durch Investitionen schoss die chinesische dreimal so schnell in die Höhe. Im Jahr 2000 waren amerikanische Arbeiter um weniger als das Siebenfache produktiver als chinesische. Der Anteil der USA an der Weltproduktion hatte sich kaum verändert und lag bei 21 Prozent, aber der Anteil Chinas hatte sich auf 14 Prozent verdreifacht.
China bezahlte einen schrecklichen Preis für dieses Wachstum. Praktisch unregulierte Fabriken verseuchten mit ihren giftigen Abwässern nach Belieben große Flüsse; die Krebsraten entlang dieser Wasserwege waren häufig doppelt so hoch wie im nationalen Durchschnitt. Andere Flüsse, deren Wasser für eine ebenso unregulierte Landwirtschaft abgezapft wurde, versiegten vollständig. Die Abholzung kannte keine Einschränkungen mehr, die Wüsten breiteten sich doppelt so schnell aus wie in den 1970er Jahren. Die Proteste gegen die Inkompetenz der Regierung und eine endemische Korruption wurden zunehmend gewalttätig; seit der Jahrtausendwende verzeichnete die Polizei pro Jahr etwa 25 000 »Massenvorkommnisse« und weit mehr kleinere Krawalle.
|532|Andererseits besiegte Dengs Programm den Hunger und legte den Grundstein für große Einkommenszuwächse. Die Landbevölkerung, die noch immer zwei Drittel der chinesischen Bevölkerung ausmacht, erlebte im nationalen Schnitt ein Reallohnplus von etwa sechs Prozent im Jahr. Allerdings konzentrierten sich Gewinne auf die Regionen entlang der Ostküste, in schmutzstarrenden Dörfern des Hinterlandes kamen sie nicht an oder wurden gar durch den Niedergang von Maos rudimentärer, aber freier Bildung und Gesundheitsversorgung häufig zunichte gemacht. Ein Ergebnis war die größte Migration der Geschichte: Seit den 1990er Jahren sind 150 Millionen Menschen in die Städte gezogen, diese Wanderarbeiter haben jedes Jahr das Äquivalent eines neuen Chicagos geschaffen. Der Umzug in die Stadt erhöhte das Einkommen eines durchschnittlichen Bauern um 50 Prozent, während die Fabriken auf diese Weise Arbeitskräfte zu einem Bruchteil der Arbeitskosten von reichen Ländern bekamen.
Zwischen 1992 und 2007 stiegen Chinas Exporte um das Zwölffache und sein Überschuss im Handel mit den USA explodierte von 18 auf 233 Milliarden Dollar. Im Jahr 2008 füllten chinesische Waren in amerikanischen Discountern wie Wal-Mart gewöhnlich 90 Prozent der Regalflächen. Ein Amerikaner, der morgens nicht zumindest ein in China hergestelltes Kleidungsstück anzog, hatte Seltenheitswert. Das Magazin Business Week schrieb: »Der chinesische Preis« – diese drei Wörter seien die furchterregendsten in der amerikanischen Industrie. »Senke deine Preise um mindestens 30 Prozent oder du verlierst deine Kunden.«71
Ein halbes Jahrhundert früher hatte Mao behauptet: »Gegenwärtig … übertrifft der Westwind nicht mehr den Ostwind, sondern der Ostwind hat über den Westwind die Oberhand gewonnen.«72 Damals machte er sich etwas vor. In den 1950er Jahren stand der Osten stark unter den Fittichen des Westens, der zwischen sowjetischer und amerikanischer Sphäre geteilt war. Doch bis zum Jahr 2000 begannen Maos Worte wahr zu werden, wenn auch nicht so, wie er gedacht hatte. Die gesellschaftliche Entwicklung im Westen war jener des Ostens weiter voraus denn je – um über 300 Punkte –, aber während das Verhältnis zwischen der westlichen und östlichen Punktzahl zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch bei etwa zweieinhalb zu eins gelegen hatte, betrug es ein Jahrhundert später, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, nur etwas über anderthalb zu eins. Das 20. Jahrhundert war zugleich der Gipfel des westlichen Zeitalters und der Beginn seines Endes.