Auch wenn die Höhlenmenschen, die vor 20 000 Jahren bibbernd um ihre Lagerfeuer hockten, davon nichts ahnten, so hatte doch ihre Welt begonnen, sich zurückzubewegen in Richtung Wärme. Im Verlauf der nächsten 10 000 Jahre sollte das Zusammenwirken von Klimawandel und den schnellen Superhirnen von Homo sapiens die Geographie verändern, und in diesem Prozess entstanden regional unterschiedene Lebensweisen, die sich bis heute erhalten haben. »Osten« und »Westen« bekamen eine Bedeutung.
Die Folgen der globalen Erwärmung waren unvorstellbar. Um 17 000 v. u. Z. schmolzen in nur zwei oder drei Jahrhunderten die Gletscher, die Nordamerika, Europa und Asien bedeckt hatten. Im Gebiet zwischen der heutigen Türkei und der Krim, dort, wo heute die Wellen des Schwarzen Meeres rollen, erstreckte sich während der Eiszeit ein tiefes Becken (Abbildung 2.1). Der Abfluss der Gletscher verwandelte es nun in das weltweit größte Süßwasserbecken. Das geschah mit einer Flut, die einer Arche Noah würdig gewesen wäre1*: In bestimmten Phasen stieg das Wasser täglich um 15 Zentimeter. Jedesmal, wenn sich die Sonne über den Horizont hob, war das Seeufer um weitere anderthalb Kilometer landeinwärts gewandert. Kein Ereignis der jüngeren Erdgeschichte kam dem gleich.
Die sich verschiebende Umlaufbahn der Erde löste ein wildes Auf und Ab von Erwärmung und Abkühlung, von Überfluss und Hunger aus. Abbildung 2.2 zeigt die extremen Schwankungen des Verhältnisses zweier Sauerstoffisotope in den antarktischen Eisbohrkernen, von denen in Kapitel 1 die Rede war. Diese Schwankungen folgen den Sprüngen des Klimas. Erst nach 14 000 v. u. Z., als kein eisiges Gletscherwasser mehr in die Meere strömte, machte die Welt für jeden Schritt, der zurück in die Kälte führte, spürbare zwei hin zur Wärme. Um 12 700 v. u. Z. wurde daraus ein Galopp: In nur einer Generation erwärmte sich die Erde um etwa drei Grad Celsius und war damit nur mehr um ein, zwei Grad von den Temperaturen entfernt, die wir aus unserer jüngeren Vergangenheit kennen.
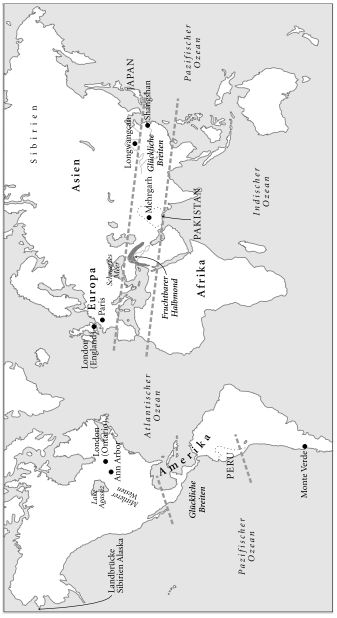
Abbildung 2.1: Das Gesamtbild
Die Veränderungen, die dieses Kapitel thematisiert, im globalen Überblick.
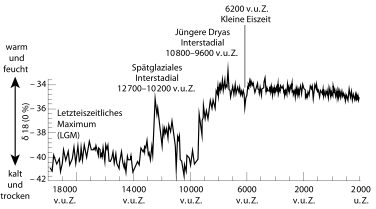
Abbildung 2.2: Ins Eis geschriebene Geschichte Das Verhältnis zwischen Sauerstoffisotopen in den Luftblasen, die im arktischen Eis eingeschlossen wurden. Sie zeigen, wie das Klima in den letzten 20 000 Jahren zwischen warm & feucht und kalt & trocken schwankte.
Die Christen des Mittelalters haben sich das Universum gerne als »Große Kette des Seins« vorgestellt, als eine Hierarchie, von Gott herab bis zum geringsten Wurm. Der reiche Mann in seinem Schloss, der Arme vor dessen Tor – alle hatten ihren vorbestimmten Platz in einer zeitlos-unwandelbaren Ordnung. Wir können uns eine »Große Kette der Energien« vorstellen, sollten uns allerdings hüten, auch diese als zeitlos und unwandelbar zu denken. Gravitationsenergie strukturiert den Kosmos; sie war es, die die kosmische Ursuppe in Wasserstoff und Helium umgewandelt hat – und diese einfachen Elemente schließlich zu Sternen. Unsere Sonne arbeitet wie ein riesiger Fusionsreaktor, der Gravitationsenergie in elektromagnetische Energie umwandelt. Aus einem kleinen Teil davon machen die Pflanzen auf der Erde durch Photosynthese chemische Energie. Tiere fressen die Pflanzen, ihr Stoffwechsel wandelt chemische um in kinetische Energie. Das Zusammenspiel zwischen den Schwerkräften von Sonne und Planeten formt die Umlaufbahn der Erde und entscheidet darüber, wie viel elektromagnetische Energie wir auf der Erde empfangen, wie viel chemische Energie die Pflanzen produzieren und wie viel kinetische Energie die Tiere daraus machen. Und daraus folgt alles andere.
Um 12 700 v. u. Z. vollführte die Erde einen Sprung hinauf in der Großen Kette der Energie. Mehr Sonnenlicht bedeutete mehr Pflanzen, mehr Tiere, mehr Auswahl |91|und Möglichkeiten für die Menschen, was ihre Nahrung, ihre Arbeit und ihre Reproduktion anbelangte. Jedes Individuum und jede kleine Gruppe – alle werden ihre Möglichkeiten auf eigene Weise kombiniert und genutzt haben. Insgesamt gesehen jedoch reagierten die Menschen auf den Aufwärtssprung in der Großen Energiekette nicht viel anders als die Pflanzen und Tiere, von denen sie lebten: Sie vermehrten sich. Auf jedes Menschenwesen, das um 18 000 v. u. Z. gelebt hatte (möglicherweise eine halbe Million), kam um 10 000 v. u. Z. ein ganzes Dutzend.
Welche Wirkung die globale Erwärmung auf die Menschen hatte, war abhängig davon, wo sie lebten. In der südlichen Hemisphäre milderten die großen Meere die Folgen des Klimawandels, doch im Norden kam es zu heftigen Gegensätzen. Für die Sammler in der Tiefebene, die dem Schwarzen Meer vorausging, war die Erwärmung eine Katastrophe; nicht viel besser erging es den Menschen in den Küstenebenen. Während der Eiszeit hatten sie in den reichsten Vorratskammern der damaligen Welt gelebt, doch eine wärmere Welt bedeutete einen steigenden Meeresspiegel. Jedes Jahr mussten sie sich weiter vor den Wellen zurückziehen, die ihre alten Jagdgründe überfluteten, bis diese schließlich völlig versunken waren.2* Für die meisten Menschen der nördlichen Halbkugel jedoch war der Aufwärtssprung in der Energiekette ungetrübtes Glück. Sie konnten den Pflanzen und Tieren nach Norden folgen, in Regionen, die zuvor zu kalt gewesen waren, um sie zu ernähren. Gegen 13 000 v. u. Z. (der genaue Zeitpunkt ist umstritten) hatten sich die Menschen in Amerika verbreitet, wohin bislang noch kein Affenmensch den Fuß gesetzt hatte. Um 11 500 v. u. Z. erreichten sie die Südspitze des Kontinents, kletterten dessen Berge hinauf, drangen in die Regenwälder vor. Die Erde stand der Menschheit offen.
Die größten Nutznießer der globalen Erwärmung lebten in einem Band, das »Glückliche Breiten« genannt wird; gemeint ist in der Alten Welt der Streifen zwischen dem 20. und 35. Grad nördlicher Breite, in der Neuen Welt zwischen |92|dem 15. Grad südlicher und 20. Grad nördlicher Breite. Pflanzen und Tiere, die es während der Eiszeit in diese gemäßigten Zonen getrieben hatte, vermehrten sich nach 12 700 v. u. Z. gewaltig, insbesondere an beiden Enden Asiens (vgl. Abbildung 2.1), wo wilde Getreidearten – Vorläufer von Gerste, Weizen und Roggen in Südwestasien, von Reis und Hirse in Ostasien – große Samenkörner entwickelten, die Sammler zu Grütze kochen oder mahlen und zu Brot backen konnten. Sie mussten bloß warten, bis die Samen reif waren, die Körner herausschütteln und einsammeln. Experimente mit heutigem Wildgetreide in Südwestasien ergaben, dass man mit dieser Methode auf 10 000 Quadratmetern eine Tonne essbare Samen gewinnen kann; jede Kalorie Energie, die für die Ernte eingesetzt wurde, ergab eine Ausbeute von 50 Kalorien in der Nahrung. Es war die »Goldene Zeit der Wildbeuter« in diesen Weltgegenden.
Eiszeitliche Jäger und Sammler hatten die Landschaft in kleinen Gruppen durchstreift, denn die Nahrung war knapp; ihre Nachfahren konnten ihre Lebensweise nun ändern. Wie andere Tierarten mit großem Gehirn (Bienen etwa, Delphine, Papageien oder unsere nächsten Verwandten, die Affen) scheinen die Menschen instinktiv große Gruppen zu bilden. Wir sind gesellige Wesen.
Das mag damit zusammenhängen, dass Tiere mit großem Gehirn gescheit genug sind zu erkennen, dass sie in der Gruppe über mehr Augen und Ohren verfügen als ein Einzelwesen, und so früher auf ihre Fressfeinde aufmerksam werden. Es könnte allerdings, wie manche Evolutionstheoretiker behaupten, auch umgekehrt gewesen sein, und das Zusammenleben in Gruppen ging dem Wachstum des Gehirns voraus. Mit dem Zusammenleben habe begonnen, was der Hirnforscher Steven Pinker »kognitives Wettrüsten«1 genannt hat1* – ein Prozess, in dem die Tiere, die sich daran zu erinnern begannen, wer von ihresgleichen ihnen freundlich gesonnen war oder feindlich, wer mit ihnen teilte und wer nicht, solchen überlegen waren, deren Gehirn dazu nicht in der Lage war.
Wie auch immer, wir haben uns dazu entwickelt, Gesellschaft zu mögen, und unsere Vorfahren reagierten auf den Aufwärtssprung, den die Erde in der Energiekette vollführte, indem sie größere Gruppen bildeten. Um 12 500 v. u. Z. war es in den Glücklichen Breiten nicht mehr selten, dass 40 oder 50 Menschen zusammen lebten; es wurden sogar Spuren von Gruppen gefunden, die über 100 Individuen zählten.
Während der Eiszeit bauten die Menschen in der Regel ein Lager, aßen die Pflanzen, jagten die Tiere, die sie im Umkreis finden konnten, zogen dann weiter zum nächsten Ort und so immer weiter. Bis heute singen wir Lieder vom Wandern, vom Umherziehen frei wie die Vögel, doch als es der Große Sprung in der Energiekette unseren Vorfahren ermöglichte, sich niederzulassen, fanden sie Haus und Herd wohl attraktiver. Menschen in China begannen bereits um 16 000 v. u. Z. damit, Tongefäße herzustellen (keine gute Idee, wenn man vorhat, alle |93|paar Wochen weiterzuziehen). Im Hochland von Peru errichteten Sammler und Jäger um 11 000 v. u. Z. Wälle und Mauern – eine sinnlose Anstrengung für hochmobile Gruppen, aber vernünftig, wenn man vorhat, für Monate an einem Platz zu bleiben.
Die eindeutigsten Hinweise auf Gruppenbildung und beginnende Sesshaftigkeit stammen aus einer Gegend, die als Fruchtbarer Halbmond bekannt ist, aus dem Hügelland entlang der Flusstäler von Jordan, Euphrat und Tigris in Südwestasien. In diesem Kapitel werde ich vor allem über diese Region sprechen, in der Menschen die ersten Schritte unternahmen, die sie wegführten von den Lebensformen der Sammler und Jäger – und die zugleich die Wiege des Westens ist.
Die Fundstätte von Ain Mallaha im heutigen Israel (Abbildung 2.3; auch bekannt als Eynan) gibt das beste Beispiel für das Geschehen. Um 12 500 v. u. Z. baute dort ein heute namenloses Volk halb unterirdische Rundhäuser, gut neun Meter im Durchmesser; die Wände waren aus Kalkstein aufgesetzt, behauene Baumstämme trugen das Dach. Verbrannte Nahrungsreste zeigen, dass die Leute aus Ain Mallaha eine erstaunliche Vielfalt von Nüssen und Pflanzen sammelten, die zu unterschiedlichen Zeiten des Jahres reif waren, und diese in Gruben aufbewahrten, die sie mit Mörtel wasserdicht gemacht hatten. Steinmörser dienten zum Zerreiben der Früchte. Um die Siedlung verstreut fand man die Knochen von Rotwild, Füchsen, diversen Vogelarten und vor allem von Gazellen. Archäologen freuen sich, wenn sie Gazellenzähne finden, denn diese haben eine wunderbare Eigenschaft: Sie produzieren im Sommer und im Winter unterschiedlich gefärbten Zahnschmelz, und der erleichtert es festzustellen, wann die Tiere getötet wurden. In Ain Mallaha wurden Zähne beider Farben gefunden, woraus man wohl schließen kann, dass die Menschen das ganze Jahr über in dieser Siedlung lebten. Außerhalb des Fruchtbaren Halbmonds wurden keine Siedlungen dieser Art gefunden.
Wenn Menschen in größeren Gruppen sesshaft wurden, wird dies die Beziehungen zwischen ihnen und zu ihrer Umgebung verändert haben. Zuvor mussten sie ihrer Nahrung folgen, also ständig in Bewegung bleiben. Ganz sicher werden sie sich zu jedem Platz, an dem sie für eine Weile Rast machten, Geschichten erzählt haben: Das ist die Höhle, in der mein Vater starb; da drüben hat unser Sohn die Hütte niedergebrannt; an jener Quelle dort sprechen die Geister, und so weiter. Ain Mallaha jedoch war nicht einfach ein Ort unter anderen entlang eines Rundwegs – für die Menschen, die dort lebten, war es der Ort. Hier waren sie geboren worden, aufgewachsen, hier würden sie sterben. Statt die Toten irgendwo zurückzulassen, wohin sie vielleicht jahrelang nicht wieder kommen würden, begruben sie ihre Angehörigen nun zwischen ihren Häusern oder auch in diesen; sie verwurzelten auch die Vorfahren an diesem bestimmten Ort. Die Menschen investierten in ihre Häuser, bauten sie wieder und wieder um.
Sie begannen auch, sich über ihre Abfälle Gedanken zu machen. Die eiszeitlichen Sammler waren ziemlich unordentliche Leute gewesen, die ihre Nahrungsreste einfach an ihren Lagerstätten verstreuten. Was sprach auch dagegen? Bis Maden kamen oder Aasfresser auftauchten, waren die Gruppen längst weitergezogen, auf der Suche nach neuen Nahrungsquellen. In Ain Mallaha war das etwas ganz anderes. Die Leute dort zogen nirgendwohin weiter, sie mussten mit ihren Abfällen leben. Die Ausgräber fanden Tausende von Ratten- und Mäuseknochen – Tiere, die es in der uns bekannten Form während der Eiszeit nicht gegeben hatte. Frühere Aasfresser hatten menschliche Abfälle in eine breitere Ernährungsstrategie einbauen müssen. Es war für sie nur ein angenehmes Zubrot, wenn Menschen Knochen oder Nüsse auf dem Boden einer Höhle zurückließen, doch jede Protoratte, die sich auf diese Nahrungsquelle spezialisiert hätte, wäre, bis sich die nächste Gruppe in der Höhle zeigte und für Nachschub sorgte, längst verhungert gewesen.

Abbildung 2.3: Die Wiege des Westens
Fundstätten im Fruchtbaren Halbmond, von denen dieses Kapitel handelt
|95|Dauersiedlungen dagegen veränderten die Lebensbedingungen für Nagetiere. Ununterbrochen waren köstlich duftende Müllhaufen erreichbar, und wenn Ratten und Mäuse klein blieben und heimlich umherhuschten, konnten sie den Menschen auf der Nase herumtanzen, hatten unter den neuen Verhältnissen bessere Chancen als große aggressive Exemplare, die sofort Aufmerksamkeit auf sich zogen. Innerhalb einiger Dutzend Generationen (ein Jahrhundert ist bereits ein großer Zeitraum, schließlich vermehren sich Mäuse eben wie Mäuse) verwandelten sich Nagetiere genetisch so, dass sie mit den Menschen zusammenleben konnten. Verstohlen umherschleichende, angepasste Schädlinge lösten ihre großen wilden Vorgänger so vollständig ab wie Homo sapiens die Neandertaler.
Die unfreiwillig domestizierten Nagetiere bedankten sich für das Geschenk des unablässigen Abfallnachschubs, indem sie ihre Eingeweide in die Nahrungsmittel- und Wasserspeicher entleerten und die Verbreitung von Krankheiten beschleunigten. Bald fanden Menschen Ratten aus eben diesem Grund unerträglich; manchen von uns sind sogar Mäuse unheimlich. Die unheimlichsten Aasfresser, die menschliche Abfälle ebenfalls unwiderstehlich fanden, waren allerdings Wölfe. Die meisten Menschen finden es unbehaglich, wenn furchterregende Monster – so wie in Jack Londons Roman Ruf der Wildnis – um ihre Behausungen schleichen, und so kamen auch hier, wie bei den Nagetieren, kleine und weniger bedrohliche Tiere besser zurecht.
Lange haben Archäologen vermutet, dass die Menschen Hunde aktiv domestiziert haben, indem sie Wolfswelpen zähmten, zu Haustieren machten und die zahmsten von ihnen miteinander kreuzten, um noch zahmere Welpen hervorzubringen, die Menschen fast so sehr lieben wie diese sich selbst und ihresgleichen. Doch wie jüngere Studien ergeben haben, war auch hier die natürliche Zuchtwahl am Werk, ohne viel bewusstes Zutun der Menschen. So brachte das Zusammenwirken von Wölfen, Abfällen und Menschen die Tiere hervor, die wir Hunde nennen. Sie konnten die Krankheiten übertragenden Nagetiere töten, die mit ihnen um Reste konkurrierten, konnten sogar mit den wirklichen Wölfen kämpfen und sich so ihren Platz als bester Freund des Mannes verdiene – und der Frau: Um |96|11 000 v. u. Z. wurde in Ain Mallaha eine ältere Frau so beigesetzt, dass eine ihrer Hände auf einem Welpen lag, beide waren zusammengerollt, als schliefen sie.2*
Fortschritt, hat der Science-Fiction-Autor Robert Heinlein geschrieben, werde von »faulen Menschen« gemacht, die nach Wegen suchen, ihre Dinge leichter zu erledigen; in der Einleitung habe ich das weiter ausgesponnen zu einer allgemeinen soziologischen Theorie. Geschichte, habe ich gesagt, wird gemacht von faulen, gierigen, furchtsamen Menschen (die sich dessen, was sie tun, kaum bewusst sind), die versuchen, ihre Angelegenheiten immer einfacher, profitabler und sicherer zu regeln. Zum ersten Mal zeigte dieses Prinzip seine Wirkung im Fruchtbaren Halbmond gegen Ende der Eiszeit, und damit entstand eine eindeutig westliche Lebensweise, die eine höhere gesellschaftliche Entwicklung nach sich zog als in jedem anderen Teil der Welt.
Vermutlich können wir die Frauen dafür loben (oder tadeln). In den heutigen Jäger-Sammler-Gesellschaften erledigen vor allem Frauen das Sammeln von Pflanzen, während die Männer fürs Jagen zuständig sind. Wenn wir bedenken, dass die Gräber von Männern mehr Speer- und Pfeilspitzen enthalten, die von Frauen dagegen eher Mahlwerkzeuge, ist das wohl auch in vorgeschichtlichen Zeiten nicht anders gewesen. Dann aber wird sich die Antwort auf die Frage, der wir bislang vor allem nachgegangen sind – ab wann und von wo an wir von einer westlichen Lebensweise sprechen sollten, die sich von anderen definitiv unterscheidet –, wohl aus der Erfindungskraft der Frauen ergeben, die vor nahezu 15 000 Jahren im Fruchtbaren Halbmond gelebt haben.
Wildgetreide sind einjährige Pflanzen. Das heißt, in einer Saison wachsen sie, produzieren Samen und sterben ab, erst im nächsten Jahr werden aus den Samen neue Pflanzen. Wenn eine Pflanze reift, wird die Rhachis (die Hauptachse der Fruchtstände) schwächer, und eines nach dem anderen fallen die Samenkörner auf die Erde, wo ihre Schutzhaut zerplatzt und sie keimen können. Die einfachste Methode, mit der Sammler vor 15 000 Jahren solche Samen ernten konnten, bestand darin, die Pflanzen zu schütteln und die fast reifen Samen in einem Korb aufzufangen. Dabei gab es jedoch eine Schwierigkeit. Die Samen der unterschiedlichen Wildpflanzen wurden zu unterschiedlichen Zeiten reif, auch der jeweilige Standort spielte dabei eine Rolle. Kamen die Sammler zu spät an einen Standort, waren die meisten Samen bereits zu Boden gefallen, und hatten gekeimt, oder aber Vögel hatten sie gefressen. Kamen die Sammler zu früh, ließen sich die Samen noch nicht aus den Fruchtständen schütteln. In beiden Fällen war ein Großteil |97|der Ernte verloren. Natürlich konnten die Sammler einen Standort wiederholt besuchen, dann aber blieb ihnen weniger Zeit, um an andere Plätze zu ziehen.
Wir wissen nicht, was hinter der entscheidenden Idee stand, ob Trägheit (der Unwille, von Standort zu Standort zu ziehen), Gier (der Wunsch, mehr zu ernten und zu essen) oder Furcht (vor Hunger oder davor, dass der eigenen eine andere Gruppe zuvorkommt) – irgendwer aber, wahrscheinlich eine Frau, wird den Einfall gehabt haben: Warum sollte man nicht die besten Samen aufheben und sie an einem fruchtbaren Ort aussähen? Dann, so wird sie weiter gedacht haben, könnten wir auch nach den Pflanzen schauen – die Erde umgraben, Unkraut ausziehen, die Pflanzen vielleicht sogar wässern – und uns darauf verlassen, dass die Pflanzen jedes Jahr wieder an diesem Ort auskeimen und vielleicht sogar höhere Erträge bringen werden. Das Leben wäre schön.
Auch der erste direkte Beleg hierfür kommt aus dem Fruchtbaren Halbmond, und indirekt haben wir das der Baath-Partei zu verdanken. Denn die Bathisten, besser bekannt als Saddam Husseins mörderische politische Bewegung im Irak, haben die Macht zunächst, nämlich 1963, im Nachbarland Syrien übernommen. Nachdem sie ihre Rivalen ausgelöscht hatten, wollten sie Syrien modernisieren. Ein damit verbundenes Großprojekt war der Bau eines Staudamms am Euphrat. So entstand der über 75 Kilometer lange Assad-Stausee, der noch heute den größten Teil des Stroms für Syrien liefert. Weil absehbar war, dass der Stausee das Herz des Fruchtbaren Halbmonds überfluten würde, startete das syrische Generaldirektorat der Altertümer eine internationale Kampagne, um die Siedlungsplätze zu untersuchen, die zerstört werden würden. 1971 erkundete ein britisches Team den Grabhügel von Abu Hureyra. Funde an der Oberfläche ließen erkennen, dass dort um 7000 v. u. Z. ein Dorf gestanden haben muss, was die Archäologen detailliert dokumentierten. In einem der gezogenen Gräben sah man, dass diese Siedlung auf den Ruinen einer älteren errichtet worden war, die auf 12 700 v. u. Z. zu datieren war.
Eine unglaubliche Chance, und die Ausgräber begannen einen Wettlauf mit der Zeit, denn das Wasser stieg; 1973 wurde daraus auch ein Kampf gegen den Krieg, denn die syrische Armee mobilisierte viele der Grabungsarbeiter für den Yom-Kippur-Krieg gegen Israel. Als die Fundstätte schließlich überflutet wurde, hatte das Team etwas mehr als 45 Quadratmeter der ältesten Siedlung ausgegraben: eine winzige Fläche, doch archäologisch eine der bedeutsamsten. Man fand die Überreste eingetiefter runder Holzhütten, Mahlsteine, Feuerstätten und tausende verkohlte Samen. Die meisten davon stammten von Wildgräsern, doch man fand auch eine Handvoll plumper, schwerer Roggenkörner.
Aus diesen Körnern war zu schließen, dass die Leute von Abu Hureyra Hacken nutzten, um den Boden zu bestellen. Sie warfen die Samen nicht einfach auf die Erde, sondern arbeiteten sie unter die Oberfläche. Und das verschaffte größeren Sämlingen, die besser in der Lage waren, dem Licht entgegen zu wachsen als kleinere Pflanzen, Vorteile. Hätten die prähistorischen Bauern einfach alles verzehrt, |98|was sie ernteten, wäre dies ohne Bedeutung gewesen. Wenn sie aber Samen zurückbehielten, um sie im nächsten Jahr auszusäen, dann wären großkörnige Samen leicht überrepräsentiert gewesen. Zunächst dürfte der Unterschied wohl kaum bemerkt worden sein, aber als die Bauern dies oft genug wiederholt hatten, muss sich, weil die Durchschnittsgröße der Samenkörner langsam wuchs, ihre Vorstellung von »normal« nach und nach geändert haben. Archäobotaniker (sie studieren, was von alten Pflanzen blieb) nennen diese größeren Samen »kultiviert«2, um sie von wilden Samen einerseits und von den vollends domestizierten Formen andererseits zu unterscheiden, die wir heute verzehren.
Um 11 000 v. u. Z., als die Leute von Ain Mallaha die alte Frau und ihr Hündchen bestatteten, hatten die Bewohner von Abu Hureyra ihren Roggen so oft erneut ausgesät, dass er größere Körner trug. Selbst wenn dieser Unterschied zunächst eher gering gewesen sein mag, erwiesen sich diese Körner (um eines der schlechten Wortspiele von Archäologen aufzugreifen) als die Saat, aus dem der Westen wachsen sollte.
Unbeeindruckt von Welpen und Roggen schmolzen einen halben Erdumfang entfernt die Gletscher noch immer. 100 000 Jahre zuvor hatte ihr Vormarsch Nordamerika flach gescheuert und die riesigen Ebenen des Mittelwestens geformt; der Rückzug der Gletscher machte aus diesen zunehmend bewaldeten Ebenen eine sumpfige, mückengeplagte, unwirtliche Gegend. »Drunken woodland« nennen Ökologen das, denn der Boden ist so aufgeweicht, dass Bäume sich nicht aufrecht halten können. Felskämme und Eis, das noch nicht geschmolzen war, fingen das Tauwasser der Gletscher in riesigen Seen. Den größten davon haben Geologen Lake Agassiz (vgl. Abbildung 2.1) genannt, nach dem Schweizer Wissenschaftler, der in den 1830er Jahren als Erster erkannt hat, dass es so etwas wie eine weltweite Eiszeit gegeben haben muss. Um 10 800 v. u. Z. bedeckte Lake Agassiz über 500 000 Quadratkilometer der Western Plains, war also viermal größer als der Obere See unserer Tage. Da geschah, was geschehen musste: Steigende Temperaturen und steigende Wasserspiegel unterminierten den Eisriegel, der die Wassermassen im Lake Agassiz noch zurückhielt.
Nachdem dieser Damm gebrochen war, folgte eine endlos lange Überschwemmung. In The Day After Tomorrow, diesem so eindrucksvoll unplausiblen Film, spielt Dennis Quaid den Wissenschaftler Jack Hall – im Film wohl der Einzige, der erkannt hat, dass die globale Erwärmung über kurz oder lang die Eiskappen wird schmelzen lassen. Der Mann wird ins Weiße Haus bestellt, er erklärt dem Präsidenten, dass ein Supersturm für Temperaturen von minus 100 Grad sorgen und auch den Golfstrom abschalten werde, der die Küsten Nordeuropas mit tropischem Wasser umspült, weswegen in London an der Themse nicht das gleiche |99|Klima herrscht wie in London in Ontario. Eine neue Eiszeit werde der Supersturm auslösen, den größten Teil Nordamerikas unbewohnbar machen. Wie nicht anders zu erwarten, bleibt der Präsident skeptisch. Nichts geschieht. Stunden später bricht der Sturm los, und Halls Sohn sitzt in New York fest. Es folgen die üblichen Heldentaten.
Ich möchte den Plot nicht vollends verderben, indem ich das Ende des Films verrate, nur so viel sagen, dass Lake Agassiz den Golfstrom tatsächlich ausgeschaltet hat, woraufhin sich die Dinge um 10 800 v. u. Z. allerdings etwas anders entwickelt haben als im Film. Es gab keinen Supersturm, doch die Welt glitt für 1200 Jahre – so lange, wie sich der See in den Atlantik ergoss – in eiszeitliche Bedingungen zurück. (Geologen nennen die Periode von 10 800 bis 9600 v. u. Z. das Jüngere Dryas, nach dem botanischen Namen der Weißen Silberwurz, einer Pflanze, die damals in allen Torfmooren verbreitet war.) Die wilden Graspflanzen, die die Dauersiedlungen im Fruchtbaren Halbmond ernährt und uns Mäuse und Hunde beschert hatten, wuchsen nun kleiner und trugen auch weniger und kleinere Samenkörner.1*
Die Menschen waren verstoßen worden aus dem Garten Eden. Sie mussten die ganzjährigen Siedlungen aufgeben, sich wieder in kleinere Gruppen aufteilen und erneut ihre Wanderungen durch das Hügelland aufnehmen, stets auf der Suche nach der nächsten Mahlzeit – sie lebten also nicht viel anders als ihre Vorfahren in den kältesten Etappen der Eiszeit. Knochenfunde aus dem Fruchtbaren Halbmond zeigen, dass um 10 500 v. u. Z. auch die Gazellen weniger wurden, ein Zeichen dafür, dass die Menschen die Bestände überjagt hatten. Außerdem weist der Schmelz menschlicher Zähne nun Grate auf, die dafür sprechen, dass Menschenkinder zu dieser Zeit chronisch unterernährt waren.
Und es ereignete sich noch eine weitere Katastrophe von ähnlichem Ausmaß. Wieder müssen wir, um eine anschauliche Parallele zu finden, auf Science-Fiction zurückgreifen. 1941 hat Isaac Asimov, damals am Anfang seiner Karriere, im Magazin Astounding Science Fiction die Kurzgeschichte Und Finsternis wird kommen… veröffentlicht, die er auf Lagash spielen ließ, einem Planeten mit sechs Sonnen. Wohin die Lagashianer auch gehen, mindestens eine Sonne scheint ihnen immer, und es ist stets Tag auf ihrem Planeten – mit Ausnahme jenes einen, alle 2049 Jahre wiederkehrenden Tages, an dem die Sonnen sich so aufreihen, dass der vorüberziehende Mond sie alle auf einmal verdecken und eine totale Sonnenfinsternis erzeugen kann. Der Himmel wird schwarz, plötzlich sieht man die Sterne. |100|Die verstörte Bevölkerung läuft Amok: Am Ende der Sonnenfinsternis haben die Lagashianer ihre gesamte Zivilisation zerstört und sich selbst in den Zustand der Barbarei zurückversetzt. In den nun folgenden 2049 Jahren bauen sie ihre Kultur langsam wieder auf, bis sich die Nacht erneut über ihren Planeten senkt und der ganze Prozess von vorne beginnt.
Jüngeres Dryas – das klingt wie Lagash revisited: Die Umlaufbahn der Erde erzeugt ein wildes Hin und Her zwischen Frost- und Tauwetter, was im Abstand von einigen Jahrtausenden zu Katastrophen wie dem Auslaufen des Lake Agassiz führt und damit wohl auch zum völligen Neuanfang der Geschichte. Doch Asimovs Und Finsternis wird kommen … mag eine großartige Erzählung sein (die Science Fiction Writers of America wählten sie gar zur besten Science-Fiction-Geschichte aller Zeiten), ein gutes Beispiel für historisches Denken liefert sie nicht. Denn in der wirklichen Welt konnte selbst eine Periode wie das Jüngere Dryas nicht immer wieder zum historischen Nullpunkt zurückführen wie auf Lagash. Wir sollten besser Heraklit folgen, der 2500 Jahre bevor sich Asimov ans Schreiben setzte festhielt, dass man nie zweimal in denselben Fluss steigen könne.3 Es ist ein berühmtes Paradox. Die Wirbel, die man beim ersten In-den-Fluss-Steigen erzeugt hat, sind längst ins Meer geflossen, wenn man sich das zweite Mal hineinwirft; der Fluss ist tatsächlich nicht mehr derselbe.
In diesem Sinn kann man auch die gleiche Eiszeit nicht zweimal erleben. Die Gesellschaften im Fruchtbaren Halbmond waren, als um 10 800 v. u. Z. die Dämme des Lake Agassiz brachen, nicht mehr die gleichen wie die während der früheren Eiszeiten. Anders als Asimovs Lagashianer drehten die Erdlinge auch nicht durch, als die Natur ihre Welt durcheinanderbrachte. Vielmehr nutzten sie die einzigartige menschliche Fähigkeit ihrer Erfindungsgabe, und bauten auf dem auf, was sie bereits erreicht hatten. Das Jüngere Dryas hat die Uhr nicht zurückgedreht. Keine Epoche hat das getan.
Einige Archäologen behaupten gar, das Jüngere Dryas habe, im Gegensatz zur Sonnenfinsternis in Asimovs Geschichte, die Neuerungen noch beschleunigt. Wie bei allen wissenschaftlichen Methoden muss man auch bei der Datierung der ersten kultivierten Roggenarten aus Abu Hureyra mit einer in der Sache liegenden Fehlerspanne rechnen, worauf die Ausgräber der Stätte selbst hinweisen. Die bereits erwähnten 11 000 Jahre v. u. Z. sind nur die Mitte eines Zeitraums, in dem die großen Roggenkörner auftauchen, und dieses Datum liegt vor Beginn des Jüngeren Dryas. Doch könnte der Zeitpunkt auch 500 Jahre später liegen und damit bereits in die Katastrophenzeit fallen. Vielleicht haben weder Trägheit noch Gier die Frauen von Abu Hureyra dazu gebracht, sich intensiver um den Roggen zu kümmern, vielleicht war es allein die Furcht. Als die Temperaturen fielen und die wild wachsenden Futterpflanzen weniger wurden, könnten die Frauen von Abu Hureyra experimentiert und herausgefunden haben, dass sich mit entsprechender Sorgfalt mehr und größere Samen erzielen ließen. Einerseits wird das kalte trockene Wetter den Anbau von Getreide erschwert, andererseits aber auch alle Anstrengungen |101|verstärkt haben, eben das zu tun. Einige Archäologen stellen sich vor, dass die Wildbeuter des Jüngeren Dryas Säcke voller Samen herumschleppten, die sie an aussichtsreich erscheinenden Stellen ausstreuten – als Versicherung gegen eine Natur, die sie immer mehr im Stich ließ.
Weitere Grabungen werden zeigen, ob es sich tatsächlich so verhielt. Inzwischen wissen wir immerhin, dass nicht alle Populationen des Fruchtbaren Halbmonds auf die Klimakatastrophe reagierten, indem sie wieder auf Wanderschaft gingen. In Mureybet, flussaufwärts von Abu Hureyra gelegen, haben französische Ausgräber eine neue Siedlung gefunden, die um 10 000 v. u. Z. entstanden ist. Sie konnten nur 2,5 Quadratmeter der ältesten Schichten freilegen, dann überflutete der Assad-Stausee auch diese Stätte; doch schon anhand dieser Funde ließ sich zeigen, dass die Dorfleute genügend Wildpflanzen und Gazellen zusammenbrachten, um das ganze Jahr hindurch an Ort und Stelle bleiben zu können. In einem Haus, das die Archäologen zwischen 10 000 und 9500 v. u. Z. datieren, gelang ihnen ein überraschender Fund: In einer Tonschicht waren die Hörner eines wilden Auerochsen eingebettet, des grimmigen, 1,80 Meter hohen Vorfahren heutiger Stiere, dazu die Schulterblätter zweier weiterer Exemplare.
Keine Fundstätte aus Zeiten vor dem Jüngeren Dryas hat derart Erstaunliches preisgegeben. In Grabungshorizonten, die jünger sind als 10 000 v. u. Z., häufen sich die Überraschungen. So zum Beispiel in Qermez Dere im Nordirak, das 1986 bei Planierarbeiten freigelegt wurde. Nur zwei kleine Notgrabungen konnten niedergebracht werden, eine davon traf auf ein Areal, das der Zubereitung von Wildnahrung gedient hatte, ganz ähnlich der, die aus Ain Mallaha oder Abu Hureyra bekannt ist. Der andere Graben dagegen erbrachte keine Hinweise auf häusliche Aktivitäten, offenbarte stattdessen aber eine Folge rundlicher Kammern mit einem Durchmesser zwischen 3,60 und 4,50 Metern, die etwa 1,50 Meter tief in die damalige Erdoberfläche eingelassen worden waren. Die erste Kammer war gepflastert, auf dem Boden standen vier Säulen in einer Reihe so dicht beieinander, dass man sich in diesem Raum nur schwer hätte bewegen können. Eine der Säulen war noch intakt: ein Steinkern, der mit Lehm und Gips so überformt war, dass er sich verjüngte und an der Spitze seltsame Ausbuchtungen zeigte – das Ganze wirkt wie ein stilisierter menschlicher Torso mit Schultern. Der Raum war, wohl absichtlich, mit einigen Tonnen Erde gefüllt worden, die Gruppen großer Tierknochen sowie Steinperlen und andere ungewöhnliche Objekte enthielt. Dann war ein neuer Raum gegraben worden, ganz so wie der erste und am fast gleichen Ort. Auch dieser wurde gepflastert und anschließend mit Tonnen von Erde gefüllt. Und noch ein dritter Raum wurde gegraben, gepflastert und verfüllt. Nachdem die Erbauer ein paar Körbe Erde in diese letzte Kammer geleert hatten, legten sie kurz über dem Boden sechs menschliche Schädel ohne Unterkieferknochen ab. Die Schädel waren in miserablem Zustand; es sah aus, als seien sie lange Zeit hin und her getragen worden, bevor sie hier bestattet wurden.
|102|Was nur haben diese Leute getan? Es ist unter uns Archäologen ein stehender Witz, alle Grabungsfunde, auf die wir uns keinen rechten Reim machen können, zu etwas Religiösem zu erklären. (Ich habe gerade die Ausgrabung einer Stätte auf Sizilien abgeschlossen, von der ich tatsächlich annehme, dass sie religiöse Bedeutung hat; darum muss ich bekennen, dass ich diesen Witz nicht mehr wirklich lustig finde.) Natürlich können wir untergegangene Religionen nicht ausgraben, das aber heißt nicht, dass sich Archäologen die Dinge einfach zurechtlegen, wenn sie über prähistorische Religionen sprechen.
Wenn wir von einer einigermaßen vernünftigen Definition von Religion ausgehen – wenn wir also etwa sagen, Religion sei der Glaube an mächtige, übernatürliche, normalerweise unsichtbare Wesen, die sich um die Menschen kümmern, aber auch erwarten, dass die Menschen sich ihrerseits um sie kümmern2* –, dann sind wir wohl auch in der Lage, Relikte von Ritualen (von rituellen Einrichtungen), mittels derer Menschen mit einer göttlichen Welt kommuniziert haben, als solche zu erkennen. Was nicht heißen muss, dass wir sie auch verstehen oder deuten können.
Rituale sind bekanntlich kulturspezifisch. Abhängig davon, in welcher Zeit und Gegend man sich befindet, kann es sein, dass die Übermächtigen einem nur dann zuhören, wenn man das Blut einer lebenden weißen Ziege über die rechte Flanke dieses einen bestimmten Steins rinnen lässt; oder nur dann, wenn man die Schuhe auszieht und sich zum Gebet in einer bestimmten Himmelsrichtung niederkniet; oder wenn man seine Missetaten einem schwarz gekleideten Mann erzählt, der keinen Geschlechtsverkehr hat. Und so weiter, die Liste ist endlos. Doch trotz ihrer wundersamen Vielfalt haben Rituale gewisse Züge gemeinsam. Viele verlangen bestimmte Orte (Berggipfel, Höhlen, ungewöhnliche Bauwerke), Objekte (Bilder, Statuen, wertvolle oder fremde Güter), Bewegungen (Prozessionen, Pilgerreisen), Kleidung (von äußerst förmlich bis völlig zerlumpt). Das alles sind Mittel zur Verstärkung des Empfindens, nun den Bereich des Alltäglichen zu verlassen. Auch das Feiern von Festen, häufig mit ganz besonderem Essen, dient diesem Zweck, ebenso das Fasten, mit dem man sich in einen anderen Bewusstseinszustand versetzen kann. Schlafentzug, Schmerzen, repetitives Singen oder Tanzen oder auch (am beliebtesten) die Einnahme von Drogen – alles wirkt in die gleiche Richtung und kann wirklich fromme Menschen in Trance, Verzückung versetzen, sie »sehend« machen.
Die beschriebenen Fundstätten haben eine Menge davon: merkwürdige Räume halb unter der Erde, menschenähnliche Säulen, kieferlose Schädel – und selbst wenn in der Religionsarchäologie alles spekulativ ist, ich finde es schwer, jene Stätten nicht als religiöse Antworten auf das Jüngere Dryas zu sehen. Die Welt erstarrte im Frost, Pflanzen starben ab, die Gazellen zogen davon – was wäre in |103|einer solchen Situation naheliegender, als Götter, Geister oder Ahnen um Hilfe zu bitten? Was läge näher, als bestimmte Menschen auszuwählen und besondere Orte zu schaffen, um die Verständigung mit den übernatürlichen Wesen zu erleichtern? Der Schrein in Qermez Dere wirkt wie ein Verstärker, der die Lautstärke des Hilferufs erhöht.
Als sich dann, gegen Ende des Jüngeren Dryas, um etwa 9600 v. u. Z. die Welt wieder erwärmte, war der Fruchtbare Halbmond nicht mehr die Gegend, die er 3000 Jahre zuvor am Ende der Haupteiszeit gewesen war, als die Welt schon einmal wärmer geworden war. Auch globale Erwärmung trifft nicht zweimal auf die gleiche Gesellschaft. Fundstätten aus früheren Wärmeperioden wie Ain Mallaha vermitteln den Eindruck, als hätten die Menschen die Wohltaten der Natur gerne und unbedenklich angenommen. In den Siedlungen jedoch, wie sie nach 9600 v. u. Z. im Fruchtbaren Halbmond aus dem Boden schossen, steckten die Menschen beträchtliche Ressourcen in religiöse Anlagen und Aktivitäten. Viele der nach 9600 v. u. Z. entstandenen Ansiedlungen enthalten Zeugnisse dafür, dass es mit Schädeln von Menschen oder Auerochen eine besondere Bewandtnis gehabt haben muss. Zu einigen der Siedlungen gehören große unterirdische Kammern, die wie gemeinschaftlich genutzte Schreine wirken. Im syrischen Jerf al-Ahmar, das nun wie viele andere Stätten unter den Wassern des Assad-Stausees vor sich hin schlummert, fanden französische Archäologen zehn Häuser, die eine Vielzahl von Räumen aufwiesen und um eine unterirdische Kammer gruppiert waren. Ein Menschenschädel lag auf einer Bank, in der Mitte des Raumes saß ein Skelett ohne Kopf. Ein beunruhigender Fund, der eigentlich nur mit Menschenopfern zu tun haben kann.
Die spektakulärste dieser Siedlungen ist Göbekli Tepe, das zusammengedrängt auf einem Berggipfel liegt und einen die Gegend beherrschenden Blick bietet, weit über den Südosten der Türkei. Seit 1995 haben deutsche und türkische Ausgräber dort vier versunkene Kammern freigelegt, bis zu drei Meter tief und mit einem Durchmesser bis zu neun Metern; die Stätte wird auf 9000 v. u. Z., wenn nicht sogar früher, datiert. Wie die kleineren älteren Kammern in Qermez Dere waren auch diese absichtlich verfüllt worden. In jeder befanden sich T-förmige Steinsäulen, manche über zwei Meter hoch und mit eingeritzten Tieren geschmückt. Geomagnetischen Messungen zufolge gibt es dort 15 weitere, bislang nicht ausgegrabene Kammern. Insgesamt gehören zu dieser Stätte wohl 200 Steinsäulen, viele sind über acht Tonnen schwer. Eine sechs Meter lange Säule, die unvollendet in einem Steinbruch entdeckt wurde, wog alleine 50 Tonnen.
Die Menschen, die das zustande brachten, hatten Feuersteinwerkzeuge, mehr nicht. Warum gerade dieser Berggipfel heilig war, werden wir wohl nie herausfinden, doch die Anlage wirkt wie ein regionales Heiligtum. Vielleicht war es ein Ort, an dem sich Hunderte von Menschen gleichzeitig und über Wochen zu bestimmten Feiern versammelten, die Säulen meißelten, diese in die Kammern zogen und dort aufstellten. Eines scheint jedoch gewiss zu sein: Nie zuvor in der Geschichte hatte eine so große Gruppe zusammengearbeitet.
|104|Menschen waren keine passiven Opfer des Klimawandels. Sie nutzten ihre Erfindungskraft, arbeiteten, um Götter und Ahnen im Kampf gegen die widrigen Umstände auf ihre Seite zu ziehen. Und selbst wenn heute viele von uns bezweifeln, dass Götter und Ahnen tatsächlich existieren, die Rituale könnten gleichwohl positive Folgen gehabt haben, nicht zuletzt als Mittel sozialer Bindung. Menschen, die ernsthaft daran glaubten, dass aufwändige Rituale in reich ausgestatteten Heiligtümern die Hilfe der Götter sichern könnten, werden zusammengehalten und nicht so leicht aufgegeben haben, so hart die Zeiten auch wurden.
Um 10 000 v. u. Z. hat der Fruchtbare Halbmond den Rest der Welt wohl weit übertroffen. Fast überall sonst zogen die Menschen noch immer zwischen Höhlen und Lagerplätzen hin und her, Plätzen wie dem, der seit 2004 in Longwangcan in China ausgegraben wird. Die einzigen Spuren, die dort von menschlichen Aktivitäten blieben, sind kleine Kreise gebrannter Erde, die von Lagerfeuern stammen. Ein zerschlagener Ölschiefer könnte ein einfacher Steinspaten gewesen sein, vielleicht ein Hinweis, dass die Kultivierung von Getreide begonnen hatte, doch nichts dort gleicht den ergiebigen Roggenkörnern von Abu Hureyra oder gar den Monumenten in Mureybet oder Qermez Dere. Das in beiden Amerikas einzig ernstzunehmende Bauwerk ist eine kleine Hütte aus gebogenen Baumschösslingen, über die Häute gespannt waren; gründliche Ausgräber haben sie im chilenischen Monte Verde entdeckt. In ganz Indien dagegen haben Archäologen nicht einmal eine solche Hütte finden können, die einzigen Zeugen menschlicher Aktivitäten hier sind verstreute Steinwerkzeuge.
Eine spezifisch westliche Welt nahm Gestalt an.
Um 9600 v. u. Z. erwärmte sich die Erde erneut, und diesmal wussten die Leute aus dem Fruchtbaren Halbmond bereits, wie man aus Graspflanzen das meiste herausholen kann. Rasch (zumindest nach Maßstäben der Vorzeit) nahmen sie deren Kultivierung wieder auf. Um 9300 v. u. Z. fielen die Saaten von Weizen und Gerste aus dem Jordan-Tal deutlich größer aus als die ihrer wilden Varianten, und die Menschen waren dabei, Feigenbäume zu veredeln, um deren Erträge zu verbessern. Im Jordan-Tal fanden sich auch die weltweit ältesten bekannten Kornspeicher, jeweils drei Meter breite und hohe Kammern, um 9000 v. u. Z. aus Lehm errichtet. Damals war in zumindest sieben Gebieten des Fruchtbaren Halbmonds die Kultivierung im Gange, vom heutigen Israel bis in den Südosten der Türkei; um 8500 v. u. Z. dann war großkörniges Getreide in der gesamten Region normaler Standard.
Legt man moderne Maßstäbe an, vollzog sich der Wandel langsam, aber in den nächsten 1000 Jahren war er doch ausgeprägt genug, dass sich der Fruchtbare Halbmond zunehmend von jedem anderen Weltteil unterschied. Ohne es zu wissen, |105|sorgten seine Bewohner über Generationen hinweg dafür, Pflanzen genetisch zu verändern und dadurch vollständig domestizierte Getreidesorten heranzuziehen, die sich ohne menschliches Zutun nicht mehr vermehren konnten. Wie die Hunde brauchten auch diese Pflanzen uns Menschen ebenso sehr wie wir sie.
Pflanzen, nicht anders als Tiere, durchlaufen Evolutionsprozesse, weil es zu zufälligen Mutationen kommt, wenn die DNA von einer Generation zur nächsten weitergegeben, also kopiert wird. Immer mal wieder erhöht eine solche Mutation die Reproduktionschancen einer Pflanze. Und das gilt vor allem dann, wenn sich gleichzeitig auch die Umwelt ändert. Dies war etwa der Fall, als dauerhafte Siedlungen Nischen schufen, in denen kleine zahme Wölfe gegenüber großen wilden im Vorteil waren. Oder dann, wenn Kultivierung die Reproduktionschancen großer Sämlinge erhöhte. Wie bereits dargestellt, reproduzieren sich wilde Getreidepflanzen, indem jedes Samenkorn reift und zu seiner Zeit zu Boden fällt, woraufhin die Hülle platzt und der Samen keimen kann. Wenn nun einige Pflanzen – nur eine unter ein bis zwei Millionen normaler Pflanzen – eine zufällige Mutation durchlaufen haben, die den Fruchtstand, der die Samen mit der Pflanze verbindet, und die Samenhaut, die den Samen schützt, stärkt, dann fallen deren Samen nach der Reifung nicht zu Boden und die Samenhülle kann nicht aufplatzen. Diese Samen verlangen geradezu nach jemandem, der oder die zum Ernten kommt und die Körner einsammelt. Bevor es solche Erntehelfer gab, sind die mutierten Pflanzen jedes Jahr ausgestorben, denn ihre Samen gelangten nicht auf die Erde, keimten nicht – die Mutation brachte also einen Nachteil mit sich. Das Gleiche geschah, so lange die Menschen die Pflanzen nur schüttelten und die Samen auffingen. Auch dann fielen die mutierten Samen nicht auf den Boden, und die Pflanze starb aus.
Was musste geschehen, um diese Situation zu ändern? Archäobotaniker streiten leidenschaftlich darüber. Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass die gute alte Gier mit von der Partie war. Nachdem sie ihre Energie in Hacken, Jäten und Bewässern der besten Standorte für Graspflanzen investiert hatten, könnte den Frauen (wir nehmen an, dass sie es waren) der Gedanke gekommen sein, aus ihren Pflanzen auch noch das letzte bisschen Nahrung herauszuholen. Sie werden also nicht nur einmal, sondern mehrfach gekommen sein, um die Fruchtstände der Grasbüschel auszuschütteln – und hätten dabei gewiss bemerkt, dass einige widerspenstige Pflanzen ihre Samen einfach nicht losließen: nämlich die Mutanten mit der widerstandsfähigen Rhachis. Was hätte dann näher gelegen, als die widerständigen Stiele auszurupfen und die ganze Pflanze mit nach Hause zu nehmen? Die Stiele von Weizen und Gerste wiegen nicht viel, und ich bin mir ziemlich sicher, wie zumindest ich auf Getreidepflanzen reagiert hätte, die ihre Samen nicht rausrücken wollten.
Wenn die Frauen nun eine zufällige Auswahl der nach Hause gebrachten Saaten wieder ausstreuten, dann brachten sie mit den normalen auch mutierte Samen aus; womöglich waren die Samen mutierter Pflanzen sogar leicht in der Überzahl, |106|weil zumindest einige Samen normaler Pflanzen bereits aus den Fruchtständen gefallen und damit verloren gegangen wären. Jedes Jahr, in dem die Frauen ihre Saat ausbrachten, müssen sie so an ihren kultivierten Standorten den Anteil der Mutanten leicht vergrößert haben. Auch das war natürlich ein lähmend langsamer Prozess, der den Beteiligten zudem verborgen blieb, und doch setzte er eine evolutionäre Spirale in Gang, die nicht weniger dramatische Folgen hatte als das, was den Mäusen in den Abfallgruben widerfuhr. Innerhalb von einigen Jahrtausenden wartete pro Feld mit einer oder zwei Millionen nicht mehr nur eine Pflanze auf den erntenden Menschen, sondern so gut wie alle. Denn inzwischen waren alle Pflanzen genetisch modifiziert. Die ausgegrabenen Siedlungsstätten zeigen, dass noch um 8500 v. u. Z. die Funde von vollständig domestiziertem Getreide wie Weizen oder Gerste kaum der Rede wert sind. In den Stätten des Fruchtbaren Halbmonds aus der Zeit um 8000 dagegen weisen bereits fast die Hälfte der Fruchtstände feste Rhachis auf. Sie haben offensichtlich nur darauf gewartet, von Menschen geerntet zu werden, um sich reproduzieren zu können. Und um 7500 v. u. Z. sind es so gut wie alle.
Bequemlichkeit, Gier und Furcht sorgten immer wieder für Verbesserungen. Die Menschen entdeckten, dass es dem Boden gut tut, wenn sie das eine Jahr Getreide, das nächste proteinreiche Bohnen pflanzten, zudem sorgte das für Abwechslung auf dem Speiseplan. Mit diesem Verfahren domestizierten sie Linsen und Kichererbsen. Das Zerstoßen von Weizen und Hafer auf groben Mahlsteinen ließ Steingries ins Brot gelangen, was die Zähne der Menschen zu Stümpfen abschliff – also versuchten sie Verunreinigungen aus dem Mehl herauszusieben. Außerdem fanden sie heraus, dass sich Getreide auch auf andere Art zubereiten ließ. Sie mussten nur Ton zu wasserfesten Kochtöpfen brennen. Sofern es zulässig ist, Analogien zu heutigen Ackerbauern herzustellen, dann waren für die meisten dieser Neuerungen Frauen verantwortlich. Sie waren es auch, die Leinen zu Kleiderstoffen webten – Häute und Pelze hatten ausgedient.
Während Frauen Pflanzen kultivierten, kümmerten sich Männer (wahrscheinlich) um die Tiere. Um 8000 v. u. Z. gelang es Hirten im heutigen Westiran, ihre Ziegen so effektiv zu bewirtschaften, dass sich größere, ruhigere Rassen entwickelten. Noch vor 7000 v. u. Z. hatten Hirten den wilden Auerochsen in die sanften Rinder verwandelt, die wir heute kennen, und sie zähmten wilde Schweine. In den nächsten Jahrtausenden lernten sie, nicht alle Tiere noch als Jungtiere zu schlachten und zu verzehren, sondern sie aufwachsen, Milch und Wolle produzieren zu lassen – und, die nützlichste Neuerung, sie auch vor Radkarren zu spannen.1* Zuvor hieß Transport stets, sich die Dinge selbst aufzupacken und sie zu tragen. Ein Rind im Geschirr aber entwickelt etwa die dreifache Zugkraft |107|eines Mannes. Um 4000 v. u. Z. konvergierte die Domestizierung von Pflanzen und Tieren in die Entwicklung eines von Rindern gezogenen Pfluges. Und die Menschen hörten nicht auf, zu basteln und zu experimentieren, doch sollten nun fast 6000 weitere Jahre vergehen, bis es ihnen gelang, darüber hinaus bedeutende neue Energiequellen zu erschließen, indem sie die Kraft aus Kohle und Dampf in den Dienst der industriellen Revolution nahmen.
Die ersten Ackerbauern im Fruchtbaren Halbmond veränderten die Lebensweise der Menschen. Diejenigen unter uns, denen es ein Graus ist, auf einer langen Flugreise neben einem plärrenden Baby zu sitzen, sollten ein wenig Mitgefühl für die Frauen der Wildbeuter aufbringen, die ihre Kleinkinder stets bei sich tragen und doch tausende Kilometer im Jahr zurücklegen, um Pflanzen, Früchte und Wurzeln zu sammeln. Es ist alles andere als überraschend, dass sie, ob bewusst oder unbewusst, nicht zu viele Kinder haben wollen und ihre Schwangerschaften regeln, indem sie ihre Kinder bis ins dritte oder vierte Lebensjahr stillen (die Milchproduktion verhindert die Eireifung). Die eiszeitlichen Wildbeuterinnen befolgten wahrscheinlich ähnliche Strategien, doch je sesshafter sie wurden, desto weniger Grund gab es, sich entsprechend zu verhalten. Vielmehr erwies sich eine höhere Zahl von Kindern als Segen, der zusätzliche Arbeitskraft bescherte, und so sprechen denn jüngere Skelettstudien dafür, dass die Frauen in den frühen Ackerbausiedlungen, die bei entsprechender Vorratshaltung an einem Ort bleiben konnten, im Durchschnitt sieben oder acht Kinder zur Welt brachten (von denen wahrscheinlich vier das erste Lebensjahr überstanden und drei ein fortpflanzungsfähiges Alter erreicht haben); die zuvor umherziehenden Frauen hatten dagegen nur fünf oder sechs Lebendgeburten. Je mehr Nahrungsmittel die Menschen anbauten, desto mehr Nachkommen konnten sie ernähren. Allerdings gilt umgekehrt ebenso, dass sie umso mehr Nahrungsmittel erzeugen mussten, je mehr Babys zur Welt kamen.
Die Bevölkerung explodierte. Um 8000 v. u. Z. hatten einige Siedlungen vermutlich bis zu 500 Einwohner, waren damit zehnmal größer als Weiler wie Ain Mallaha aus der Zeit vor dem Jüngeren Dryas. Um 6500 v. u. Z. lebten in Çatalhöyük in der heutigen Türkei etwa 3000 Menschen. In diesen Großsiedlungen stellten sich alle möglichen Probleme ein. Mikroskopische Untersuchungen von Sedimenten aus Çatalhöyük zeigen, dass die Menschen ihre Abfälle und Fäkalien auf Haufen zwischen den Häusern warfen. Gestank und Schmutz hätten Sammler und Jäger gewiss abgestoßen, Ratten, Fliegen und Flöhe dagegen werden wohl begeistert gewesen sein. Aus kleinen, in die Fußböden eingetretenen Exkrementspuren können wir sehen, dass die Bewohner der Siedlungen auch domestizierte Tiere in ihren Häusern hielten; Skelette aus der Grabungsstätte Ain Ghazal lassen erkennen, dass der Tuberkuloseerreger um 7000 v. u. Z. von Rindern auf Menschen übergesprungen ist. Die Sesshaftwerdung und die Erzeugung größerer Nahrungsmengen ließen die Fruchtbarkeit steigen, bedeuteten aber auch, dass mehr Münder zu stopfen und mehr Keime zu teilen waren, was wiederum die |108|Sterblichkeit steigen ließ. Jede neue Ackerbausiedlung wuchs zunächst einige Generationen lang sehr schnell, bis dann Fruchtbarkeit und Sterblichkeit einander ausglichen.
Doch allem Schmutz zum Trotz, es war eine Lebensweise, die den Menschen gefiel. Die kleinen Sammler-und-Jäger-Gruppen hatten einen weiten geographischen Horizont gehabt, dafür aber einen sehr engen sozialen: Die Landschaften wechselten, die Gesichter blieben dieselben. In der Welt der ersten Ackerbauern verhielt sich das genau umgekehrt. Möglicherweise verbrachten sie ihr ganzes Leben im Umkreis von einem Tagesmarsch rund um die Siedlung, in der sie geboren worden waren. Aber was für ein Ort war das! Es gab Heiligtümer, in denen die Götter sich offenbarten, Feste und Feiertage, die die Sinne erfreuten, schwatzhafte laute Nachbarn in festen Häusern mit gepflasterten Fußböden und regendichten Dächern. Diese Bauwerke erscheinen den meisten heutigen Menschen als qualvoll enge, verrauchte und stinkende Löcher, doch es war ein großer Schritt, wenn man nicht länger feuchte Höhlen mit Bären teilen oder sich bei Regen unter aufgespannten Tierhäuten zusammenkauern musste.
Die ersten Ackerbauern bändigen auch die Landschaft, schnitten konzentrische Kreise hinein. Deren Mittelpunkt, der engste Kreis, war das Haus, darum herum kamen die Nachbarn, dann die bestellten Felder, weiter draußen die Weideplätze, wo Hirten und Herden zwischen Sommer- und Winterweiden hin- und herzogen; und ganz draußen die Wildnis, die erschreckende, unkontrollierbare Welt furchterregender Tiere, wilder Jäger und aller nur denkbaren Ungeheuer. Bei einigen Grabungen wurden Steintafeln gefunden, auf die Linien geritzt waren, die, zumindest in den Augen von Optimisten, aussehen wie Landkarten mit Feldern, die von schmalen Pfaden unterteilt waren. Um 9000 v. u. Z. haben die Siedler von Jerf al-Ahmar und einiger benachbarter, heute allesamt im Assad-Stausee versunkener Stätten anscheinend mit einer Art Protoschrift experimentiert, indem sie Bilder von Schlangen, Vögeln, domestizierten Tieren und abstrakte Zeichen auf kleine Steinmarken geritzt haben.
Indem sie ihrer Welt solche mentalen Strukturen aufprägten, haben sich die Bewohner des Fruchtbaren Halbmondes, so könnte man sagen, selbst domestiziert. Sie erfanden sogar neu, was Liebe bedeutete. Die Liebe zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern ist etwas Natürliches, in uns hineingelegt seit Jahrmillionen, doch Ackerbau und ein entsprechendes Leben verliehen diesen Beziehungen neue Kräfte. Wildbeuter haben ihr Wissen stets mit den Jungen geteilt, haben sie gelehrt, reife Pflanzen zu finden, jagdbares Wild aufzuspüren und sichere Höhlen; Ackerbauern hatten viel Konkreteres weiterzugeben. Damit es ihnen gut erging, brauchten die Menschen nun Eigentum – ein Haus, Felder und Herden, gar nicht zu sprechen von Investitionen in Brunnen, Mauern und Werkzeuge. Die ersten Ackerbauern lebten anscheinend sehr gemeinschaftlich, teilten die Nahrung und kochten vielleicht auch gemeinsam. Doch um 8000 v. u. Z. begannen sie größere, komplexere Häuser zu bauen, jedes mit eigenen Vorratsräumen und Herd beziehungsweise |109|Küche; vielleicht teilten sie damals bereits auch das Land in Einzelbesitz auf. Das Leben konzentrierte sich zunehmend auf kleine Familiengruppen, vermutlich die Grundeinheit, in der Eigentum zwischen den Generationen weitergegeben wurde. Kinder waren auf dieses materielle Erbe angewiesen, ohne dieses drohte Armut. Die Übertragung von Eigentum wurde zu einer Frage von Leben und Tod.
Nach manchen Funden zu urteilen, bekam die Beschäftigung mit den Ahnen etwas geradezu Obsessives. Wir finden solche Hinweise sehr früh, vermutlich um 10 000 v. u. Z., nämlich in den kieferlosen Schädeln von Qermez Dere. Und je weiter sich der Ackerbau entwickelte, desto weiter steigerte sich das. Die Bestattung mehrerer Generationen von Toten unter dem Boden des Hauses verbreitete sich, was auf eine direkte, physische Art die Beziehung zwischen Eigentum und Herkunft zum Ausdruck brachte. Einige Gruppen gingen weiter, sie gruben die Skelette wieder aus, nachdem das Fleisch vermodert war, entfernten die Schädel und beerdigten das kopflose Skelett erneut. Mit Gips modellierten sie den Schädeln Gesichter, steckten Muscheln in die Augenhöhlen und malten Einzelheiten wie Haare auf.
Kathleen Kenyon, die große alte (inzwischen geadelte) Dame in der Männerwelt der Archäologie der 1950er Jahre, war die Erste, die diese Sitte, die einem Horrorfilm entnommen sein könnte, mit ihren Ausgrabungen der berühmten Fundstätte Jericho am Westufer des Jordan dokumentiert hat. Doch inzwischen wurden auch an Dutzenden anderer Siedlungen mit Gips modellierte Schädel gefunden. Was die Menschen mit diesen Schädeln taten, ist unklar, gefunden wurden nämlich nur solche, die erneut bestattet worden waren, die meisten davon in Gruben. In Çatalhöyük allerdings ist um 7000 v. u. Z. eine junge Frau bestattet worden, die einen Schädel an ihre Brust presst, der nicht weniger als drei Mal mit Gips nachgeformt und rot angemalt worden war.
Dieser innige Umgang mit den Toten wird die meisten von uns schauerlich anmuten, den ersten Ackerbauern des Fruchtbaren Halbmonds aber muss diese Sitte viel bedeutet haben. Nach Ansicht der meisten Archäologen galten Ahnen als die bedeutendsten übernatürlichen Wesen. Sie hatten Eigentum weitergegeben, ohne das die Lebenden verhungert wären, und wurden dafür von den Lebenden verehrt. Vermutlich haben die Ahnenkulte der Weitergabe von Eigentum eine Aura des Heiligen verschafft; zugleich ließ sich mit ihnen rechtfertigen, warum einige mehr besitzen als andere. Möglicherweise wurden die Schädel genutzt, um die Toten zu beschwören, ihren Rat zu erbitten, wann die Saat ausgebracht werden musste, wo man zum Jagen gehen, ob man die Nachbarn überfallen sollte.
Ahnenkulte blühten überall im Fruchtbaren Halbmond. In Çatalhöyük fanden sich Körperskelette unter nahezu jedem Haus, die Schädel der Ahnen in Wände und Oberflächen eingegipst. In Ain Ghazal entdeckte man zwei Gruben mit lebensgroßen Statuen und Büsten, die aus mit Gips überzogenen Schilfbündeln angefertigt worden waren. Manche hatten Zwillingsköpfe, den meisten waren große |110|aufgerissene Augen aufgemalt worden. Am verblüffendsten aber ist das Bauwerk, das die Bewohner um 8000 v. u. Z. in Çayönü im Südosten der Türkei errichteten und das die Archäologen das »Haus der Toten« genannt haben: Hinter einem Altar versteckt fanden sich 66 Schädel und über 400 Skelette. In den Ablagerungen auf dem Altar identifizierten Chemiker Hämoglobinkristalle aus Menschen- und aus Tierblut; weiteres Menschenblut war auf Tonschalen verkrustet. In noch zwei weiteren Gebäuden stieß man auf blutbefleckte Altäre; in einen der beiden war das Abbild eines Menschenkopfs eingeritzt. Eine entsetzliche Vorstellung, wie aus einem Slasher-Film: zappelnde Opfer auf Altäre gebunden, Priester, die deren Venen mit rasiermesserscharfen Steinklingen aufschlitzen, ihre Köpfe abtrennen, Menschen, die ihr Blut trinken.
Kann, muss aber nicht sein. Die archäologischen Funde können solche Fantasien weder bestätigen noch widerlegen. Allerdings legen die Statuetten und das Haus der Toten wohl nahe, dass in den Siedlungen inzwischen so etwas wie Spezialisten für Religiöses am Werk waren – Menschen, die alle anderen davon überzeugen konnten, dass sie über einen privilegierten Zugang zum Übernatürlichen verfügten. Vielleicht litten sie unter Anfällen, konnten sich in Trance fallen lassen, vielleicht ihre Visionen auch nur besser beschreiben als andere. Aus welchem Grund auch immer, Priester waren wohl die ersten Menschen, die sich einer institutionalisierten Autorität erfreuten. Möglicherweise liegen hier auch die Anfänge tief verwurzelter Hierarchien.
Am schnellsten werden sich solche Hierarchien innerhalb der gemeinsam wirtschaftenden Familien entwickelt haben. Wie bereits bemerkt, hatten Männer und Frauen in den Sammlergemeinschaften unterschiedliche Aufgaben; erstere waren aktiver beim Jagen, letztere beim Sammeln. Allerdings legen Studien zeitgenössischer Wildbeutergruppen nahe, dass sich die geschlechtliche Arbeitsteilung mit der Domestizierung verfestigte und die Frauen immer mehr ans Haus band. Um hohe Sterblichkeit und hohe Fruchtbarkeit auszubalancieren, mussten Frauen die meiste Zeit ihres Lebens schwanger sein und/oder sich um die Aufzucht kleiner Kinder kümmern. Und die Veränderungen im Ackerbau – wahrscheinlich von den Frauen selbst angeregt – werden dies noch verstärkt haben. Die Verarbeitung von domestiziertem Getreide ist aufwändiger als die der meisten Wildgemüse, und weil das Dreschen, Mahlen und Backen im Haus geschehen können, gleichzeitig mit dem Kinderhüten, wurden sie zu Aufgaben der Frauen.
Wenn es Land im Überfluss gibt, Arbeitskräfte jedoch knapp sind (wie in den ersten Zeiten des Ackerbaus), bearbeiten die Menschen in der Regel eher große Gebiete und diese nicht sehr gründlich, wobei Männer und Frauen das Hacken und Ausreißen des Unkrauts gemeinsam erledigen. Wenn die Populationen wachsen, aber kein zusätzliches Land kultiviert werden kann, so wie im Fruchtbaren Halbmond nach 8000 v. u. Z., wird es ratsam, das Land intensiver zu bearbeiten und durch Düngen, Pflügen und manchmal auch Bewässern größere Erträge aus jeder Fläche zu holen. Alle diese Aufgaben erfordern Kraft und starke |111|Armmuskeln. Zwar sind viele Frauen genauso stark wie Männer, dennoch dominieren mit Intensivierung des Ackerbaus die Männer in der Arbeit unter freiem Himmel, die Frauen übernehmen die Hausarbeit. Erwachsene Männer arbeiten auf den Feldern, Jungen hüten die Herden, Frauen und Mädchen kümmern sich um den immer genauer definierten häuslichen Bereich. Eine Studie an 162 Skeletten aus Abu Hureyra, die aus der Zeit um 7000 v. u. Z. stammen, ergab auffällige Differenzen zwischen den Geschlechtern. Männer wie Frauen hatten im oberen Bereich verstärkte Wirbelsäulen, vermutlich vom Tragen schwerer Lasten auf dem Kopf, doch nur Frauenskelette wiesen jene arthritischen Verformungen der Zehen auf, die von längerem Arbeiten in kniender Haltung herrühren, wobei sie die Zehen wohl gerade beim Mahlen des Korns in den Boden stemmten, um Halt und Kraft zu gewinnen.
Unkraut hacken, Steine vom Feld auflesen, düngen, bewässern und pflügen – alles Tätigkeiten, die den Ertrag steigern. Und es machte einen gewaltigen Unterschied, ob ein Haushalt ein wohlbestelltes Feld erbte oder einfach ein Stück Land. Die Art, in der sich die Religion nach 9600 v. u. Z. entwickelte, lässt erkennen, dass sich die Menschen Gedanken machten um die Ahnen und das Erbe, und wir können als gesichert annehmen, dass sie die Rituale in dieser Situation durch weitere Institutionen untermauert haben. Wenn so viel auf dem Spiel stand, wollten Männer in modernen Bauernkulturen sicher sein, dass sie wirklich Väter der Kinder waren, die ihren Besitz einmal erben würden. Die eher lockere Haltung der Sammler zum Sex wandelte sich zur zwanghaften Sorge um die voreheliche Jungfräulichkeit ihrer Töchter und zur Angst vor außerehelichen Aktivitäten ihrer Frauen. In traditionellen Bauerngesellschaften heirateten Männer, wenn sie etwa 30 Jahre alt waren und damit die Verfügung über ihr Erbe erlangt hatten, Frauen dagegen mit 15, damit ihnen nicht viel Zeit zum Herumstreunen blieb. Wir können nicht sicher sein, ob solche Muster tatsächlich mit Beginn des Ackerbaus entstanden sind, es ist jedoch wahrscheinlich. Um etwa 7500 v. u. Z. wuchs ein Mädchen in der Regel unter der Autorität ihres Vaters auf, die sie noch als Teenager gegen die des Ehemanns eintauschte, der von seinem Alter her auch ihr Vater hätte sein können. Das Heiraten wurde zu einer Quelle des Reichtums, insofern diejenigen, die bereits über gutes Land und Herden verfügten, diejenigen heirateten, deren Familien in der gleichen glücklichen Situation waren, womit sich Besitz konsolidieren ließ. Die Reichen wurden noch reicher.
Werte, die zu erben sich lohnte, waren auch wert, gestohlen zu werden. Insofern ist es bestimmt kein Zufall, dass sich im Fruchtbaren Halbmond die Hinweise auf Befestigungsbauten und organisierte Kriegführung nach 9600 v. u. Z. häufen. Das Leben der Jäger und Sammler war bekanntlich von Gewalt bestimmt; es gab keine Hierarchien, die Leidenschaften in Zaum gehalten hätten, und für junge Angehörige dieser Gruppen war häufig auch Mord ein akzeptiertes Mittel, Streitigkeiten zu entscheiden. Um aber in Siedlungen zusammenleben zu können, mussten die Menschen lernen, die Gewalt zwischen den Siedlungsmitgliedern |112|in Grenzen zu halten. Wem das gelang, dem ging es besser – und er konnte seine aggressiven Impulse gegen andere Gemeinschaften einsetzen, um deren Reichtümer zu rauben.
Die bemerkenswertesten Zeugnisse dazu stammen aus Jericho, der Stadt, deren Mauern dem Bericht der Bibel zufolge einstürzten, als Josua seine Posaune blies. Vor 50 Jahren, bei ihren Grabungen dort, fand Kathleen Kenyon tatsächlich Befestigungsmauern – allerdings nicht die Josuas. Denn der lebte um 1200 v. u. Z., die von Kenyon entdeckten Befestigungsanlagen aber sind gut 8000 Jahre älter. Sie interpretierte, was sie fand, als Verteidigungsanlagen – immerhin waren die um 9300 v. u. Z. errichteten Bauwerke 3,60 Meter hoch und 1,50 Meter dick. Weitere Grabungen in den 1980er Jahren erwiesen, dass sich Kenyon wahrscheinlich geirrt hatte, denn ihre »Befestigung« bestand aus mehreren kleinen Mauern, die zu unterschiedlichen Zeiten gebaut worden waren, vermutlich um einen Fluss einzudämmen. Ihr zweiter großer Fund, ein über sieben Meter hoher Turm aus Stein, diente dann wohl doch der Verteidigung. In einer Welt, in der die bedrohlichste Waffe eine mit einem spitz zugeschlagenen Stein bewehrte Stange war, war ein solcher Turm schon ein mächtiges Bollwerk.
Nirgendwo sonst außerhalb des Fruchtbaren Halbmonds hatten die Menschen so viel zu verteidigen. Noch um 7000 v. u. Z. waren die meisten Menschen außerhalb jener Region Wildbeuter, die jahreszeitlich bedingt wanderten. Und selbst wenn sie begonnen hatten, sich in Siedlungen wie Mehrgarh im heutigen Pakistan oder Shangshan im Jangtse-Delta niederzulassen, waren dies, verglichen mit Jericho, einigermaßen primitive Plätze. Hätte man Jäger und Sammler aus anderen Weltregionen nach Çayönü oder Çatalhöyük einfliegen können, dann hätte sie, angesichts dessen, was sie dort zu sehen bekommen hätten, wohl der Schlag getroffen. Keine Höhlen, keine Ansammlung kleiner Hütten, sondern geschäftige Großsiedlungen mit stabilen Häusern, Nahrungsvorräten, mächtigen Artefakten und religiösen Monumenten. Allerdings hätten sie dort auch hart arbeiten müssen, hätten es mit einer Menge heimtückischer Mikroben aufnehmen müssen und wären wohl jung gestorben. Sie hätten Seite an Seite mit Reichen und Armen gelebt, hätten sich aufgerieben an der Herrschaft der Männer über die Frauen, der Eltern über die Kinder, vielleicht aber auch ihre Freude daran gehabt. Möglicherweise wären sie einigen Menschen begegnet, die das Recht gehabt hätten, sie in Ritualen zu opfern. Wahrscheinlich hätten sie sich gefragt, warum sich Menschen all das antaten und weiter antun.
Ein rascher Sprung über 10 000 Jahre hinweg: von den Ursprüngen von Hierarchie und Plackerei im prähistorischen Fruchtbaren Halbmond ins Paris des Jahres 1967.
|113|Den Herren mittleren Alters, die den Campus der Pariser Universität in der trübseligen Vorstadt von Nanterre zu verwalten hatten – also den Erben der patriarchalischen Traditionen, die zurückreichen bis nach Çatalhöyük –, erschien es als selbstverständlich, dass man den jungen Damen in ihrem Verantwortungsbereich nicht erlauben sollte, in ihren Wohnheimzimmern junge Männer zu empfangen (das Gleiche galt umgekehrt). Den jungen Menschen werden solche Regeln nie ganz eingeleuchtet haben, doch seit 300 Generationen hatten sich Teenager damit arrangieren müssen. Doch jetzt – 1967 – sollte damit Schluss sein. Als es Winter wurde, stellten die Studenten das Recht der Älteren in Frage, sich in ihre Liebesdinge einzumischen. Im Januar 1968 verglich Daniel Cohn-Bendit, heute als Abgeordneter der Grünen geachtetes Mitglied des Europäischen Parlaments, damals als »roter Dany« ein bekannter Aktivist, die Ansichten des für die Jugend zuständigen Ministers mit denen der Führung der Hitlerjugend. Im Mai lieferten sich die Studenten Straßenschlachten mit der bewaffneten Polizei, bauten Barrikaden, zündeten Autos an und legten die Pariser Innenstadt lahm. Präsident de Gaulle traf sich insgeheim mit seinen Generälen, um zu hören, ob die Armee im Falle eines erneuten Sturms auf die Bastille hinter ihm stünde.
Das war die Situation, in der auch Marshall Sahlins in Erscheinung trat, ein junger Professor für Sozialanthropologie von der Universität Michigan. Er hatte sich einen Namen gemacht mit einer Reihe brillanter Essays zur sozialen Evolution, aber auch als Kritiker des Vietnamkriegs. Nun hatte er Ann Arbor ( »eine kleine Universitätsstadt, die ausschließlich aus Nebenstraßen besteht«, hatte er sie unfreundlich, aber nicht unzutreffend genannt4) verlassen, um zwei Jahre bei Claude Lévi-Strauss am Collège de France zu arbeiten, dem Mekka sowohl der Ethnologie und Kulturanthropologie als auch des studentischen Radikalismus. Zur Zeit des Höhepunkts der politischen Krise sandte Sahlins ein Manuskript an die Redaktion von Les temps modernes, der Zeitschrift, die damals jeder lesen musste, der in der intellektuellen Szene Frankreichs etwas gelten wollte. Der Aufsatz – »La première société d’abondance« – wurde zu einer der einflussreichsten anthropologischen Schriften, die je veröffentlicht wurden.
»Öffnet die Kindergärten, Universitäten und andere Gefängnisse«, hatten die radikalen Studenten an eine Wand in Nanterre gepinselt, und: »Dank der Lehrer und der Examen beginnt die Konkurrenz bereits mit sechs.«5 Sahlins’ Aufsatz hatte den Studenten etwas zu bieten, zwar keine Antwort – die Anarchos hätten das wahrscheinlich auch nicht gewollt: »Sei Realist, verlange das Unmögliche«, war einer ihrer Slogans –, aber Argumente und eine gewisse Ermutigung. Nach Sahlins besteht das zentrale Problem der bürgerlichen Gesellschaft darin, dass diese »ein Heiligtum für das Unerreichbare: nämlich für unendliche Bedürfnisse« errichtet habe. Wir Zeitgenossen würden uns der kapitalistischen Disziplin unterwerfen, um Verdienstmöglichkeiten konkurrieren, damit wir uns Dinge kaufen könnten, die wir nicht wirklich wollten. Dabei, so Sahlins, könnten wir von den Jägern und Sammlern durchaus etwas lernen: »Die primitivsten Völker der |114|Welt haben wenig Besitz und sind trotzdem nicht arm.« Das klinge paradox, sei es aber nicht: Sammler, so Sahlins, arbeiteten nur 21 bis 35 Stunden die Woche – weniger als die Industriearbeiter in Paris; weniger auch, wie zu vermuten steht, als seine eigenen Studenten. Wildbeuter besäßen weder Autos noch Fernsehapparate, aber sie wüssten auch nicht, dass sie sich solche Dinge wünschen sollten. Gewiss hätten sie wenig Mittel, aber eben auch weniger Bedürfnisse, darum, so Sahlins’ Schluss, lebten sie in der »ursprünglichen Wohlstandsgesellschaft«.6
Und dann stellte Sahlins die entscheidende Frage: Warum hat der Ackerbau das Sammeln und Jagen überhaupt ablösen können, wenn dabei nur mehr Arbeit, Ungleichheit und Kriege heraussprangen? Und genau das ist geschehen. Um 7000 v. u. Z. herrschte der Ackerbau überall im Fruchtbaren Halbmond vor. Bereits um 8500 v. u. Z. hatten sich die kultivierten Getreidesorten bis nach Zypern verbreitet, gegen 8000 das zentrale anatolische Hochland erreicht. Um 7000 hatten sich in allen diesen Gebieten die vollständig domestizierten Pflanzen durchgesetzt und verbreiteten sich ostwärts nach Pakistan (wo sie sich aber auch unabhängig entwickelt haben könnten). Sie erreichten um 6000 Griechenland, den Süden des heutigen Irak und Zentralasien, um 5500 Ägypten und Mitteleuropa, bis 4500 v. u. Z. die Altantikküste (Abbildung 2.4).
Jahrzehntelang haben Archäologen über das Warum dieser Verbreitung diskutiert, konnten sich aber nicht einig werden. Am Ende eines kürzlich veröffentlichten, autoritativen Überblicks konnte sich Graeme Barker von der Universität Cambridge nur zu einer höchst allgemeinen Formulierung durchringen: Bauern hätten die Sammler ersetzt, schreibt er, »auf unterschiedliche Weisen und in unterschiedlichem Maß und aus unterschiedlichsten Gründen, aber unter vergleichbaren Bedingungen und Herausforderungen an die Welt, die sie kannten«7.
Der Vorgang mag unübersichtlich sein – vollzog er sich doch über Jahrtausende und ganze Kontinente hinweg –, aber er lässt sich ganz gut nachvollziehen. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass es in letzter Hinsicht um nichts anderes geht als um den Aufwärtssprung, den die Erde in der Großen Kette der Energie vollführt hat. Die Veränderung der Erdumlaufbahn hatte zur Folge, dass die Erde mehr elektromagnetische Strahlung der Sonne einfing; die Photosynthese verwandelte einen Teil dieses Zuwachses in chemische Energie (es gab mehr Pflanzen); der Stoffwechsel wiederum verwandelte Teile der nun größeren Vorräte an chemischer Energie in kinetische (es gab mehr Tiere); und der Ackerbau erlaubte es den Menschen, für den eigenen Bedarf erheblich mehr Energie aus Pflanzen und Tieren zu ziehen. Auch wenn Mikroben, Parasiten und Raubtiere den Bauern so viel dieser neu gewonnenen Energie entzogen, wie sie nur konnten, blieb diesen noch immer reichlich davon.
Nicht anders als andere Tiere und Pflanzen fanden auch die Menschen ein Ventil für diese überschüssige Energie in der Reproduktion. Hohe Geburtenraten ermöglichten ein rasches Wachstum neuer Siedlungen, bis jeder Quadratmeter des verfügbaren Bodens bestellt war. Von da an nahmen Hunger und Krankheiten zu, bis sie die erhöhte Fruchtbarkeit wettmachten. Energiezufuhr und Energieverbrauch erreichten eine ungefähre Balance. Einige Siedlungen fanden ihr Gleichgewicht, das stets bedroht war von Elend und Mangel; in anderen fassten einige mutige Geister den Entschluss, einen Neuanfang zu wagen. Möglicherweise zogen sie nur eine Stunde weiter zu einem unbesiedelten (vielleicht weniger geeigneten) Platz im selben Tal oder auf derselben Ebene – vielleicht zogen sie auch Hunderte von Kilometern weiter: auf der Suche nach grünen Weiden, von denen sie gehört hatten. Selbst Meere waren kein Hindernis für sie. Viele dieser Abenteurer müssen gescheitert sein und haben sich dann wohl abgerissen und halb verhungert wieder zurückgeschleppt, völlig entmutigt. Andere überwanden alle Hindernisse. Wieder wuchsen die Populationen, bis die Todesfälle mit den Geburten gleichzogen oder die Kolonien ihrerseits neue Kolonien ausgliederten.

Abbildung 2.4: Gehet hin und mehret euch, Version I
Ausbreitung der domestizierten Pflanzen vom Fruchtbaren Halbmond nach Westen bis zum Atlantik, 9000–4000 v. u. Z.
Die meisten Ackerbauern, die in neue Gebiete zogen, trafen auf dort lebende Wildbeuter. Es ist verlockend, sich Szenen wie aus alten Western-Filmen auszumalen, Überfälle auf die Herden, Skalpjagden und Schießereien (Pfeil und Bogen auf beiden Seiten). Die Wirklichkeit wird weniger dramatisch gewesen sein. Archäologische Befunde zeigen, dass sich die ersten Ackerbauern meist nicht dort |116|niederließen, wo sich bereits Wildbeuter aufhielten, vor allem aus dem Grund, dass das beste Ackerland und der beste Grund für Sammler und Jäger selten zusammenfielen. Zumindest zu Beginn werden Bauern und Wildbeuter einander wenig Beachtung geschenkt haben.
Irgendwann aber verschwand die Lebensweise der Wildbeuter dann doch. Man wird heute wenige Jäger und Sammler finden, die die gepflegten Landschaften der Toskana oder die Vorstädte Tokios durchstreifen. Ackerbauende Populationen wuchsen rasch, brauchten nur wenige Jahrhunderte, bis sie das beste Land besiedelt hatten und dann keine andere Möglichkeit mehr sahen, als in die (in ihren Augen) wenig attraktiven Territorien der Sammler vorzustoßen.
Es gibt zwei Haupttheorien über das, was daraufhin geschah. Der ersten zufolge zerstörten die Ackerbauern die ursprünglichen Überflussgesellschaften. Dabei können Krankheiten eine Rolle gespielt haben; Ratten, das Leben mit den Herden und in dauerhaften Siedlungen werden die Bauern kränker gemacht haben als die Sammler und Jäger. Wir sollten uns aber nicht solche großen Epidemien vorstellen wie die, die die amerikanischen Ureinwohner nach 1492 zu Millionen dahinrafften. Die Erregerpools von Bauern und von Wildbeutern waren nur durch einige Kilometer Wald und nicht durch zunächst unüberwindliche Meere voneinander getrennt gewesen, hatten sich darum auch nicht sehr weit auseinanderentwickelt.
Doch auch ohne Massensterben spielten Größenordnungen eine Rolle. Waren die Wildbeuter entschlossen, um ihr Land zu kämpfen, wie dies zu Zeiten des modernen Kolonialismus in vielen Grenzgebieten geschah, dann mochten sie die Siedlungen der Fremden zerstören. Doch weitere Kolonisten würden nachkommen und den Widerstand hinwegspülen. Möglicherweise entschlossen sich die Wildbeuter aber auch zum Rückzug, doch so weit sie auch vor der neuen Kultur zurückwichen, es würden neue Ackerbauern kommen, noch mehr Wälder roden und ihre Keime überall hinpusten, bis den Wildbeutern zuletzt nur noch Gegenden wie Sibirien etwa oder die Sahara blieben, mit denen Ackerbauern partout nichts anfangen konnten.
Der zweiten Theorie zufolge ist nichts von all dem geschehen, weil die Ackerbauern in den meisten der in Abbildung 2.4 gezeigten Regionen keine Nachkommen von Auswanderern aus dem Fruchtbaren Halbmond gewesen seien, sondern lokale Sammler und Jäger, die sich niederließen und zu Ackerbauern wurden. In Sahlins’ Darstellung erscheinen Ackerbau und das damit verbundene Leben als äußerst unattraktiv, zumindest im Vergleich mit der ursprünglichen Überflussgesellschaft; aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch standen Wildbeuter selten vor der Wahl zwischen zwei Lebensformen. Bauern, die ihren Pflug Pflug sein ließen und sich zum Weiterziehen entschlossen, werden dabei keine regelrechte Grenze zum Territorium der Wildbeuter überschritten haben, vielmehr werden sie auf Siedlungen gestoßen sein, deren Bewohner den Ackerbau weniger intensiv betrieben als sie selbst, ihre Felder vielleicht nur hackten, nicht pflügten und düngten. |117|Dann wieder werden sie Leute getroffen haben, die das Land noch weniger intensiv bearbeiteten, vielleicht ein Stück Wald niederbrannten, das gerodete Land solange bearbeiteten, bis der Wald es zurückerobert hatte, und dann an eine andere Stelle zogen; zuletzt sind sie vielleicht auf Menschen gestoßen, die ausschließlich vom Sammeln und Jagen lebten. In dieser breiten Zone möglicher Kontakte bewegten sich Menschen, Ideen und Mikroben hin und her.
Wenn die Sammler mitbekamen, dass Nachbarn mit ihren intensiveren Praktiken die Wildpflanzen ausrotteten und auch die Tiere vertrieben, von denen ihr Wildbeuterleben abhing, dann hatten sie nicht nur die Wahl, diese Vandalen zu bekämpfen oder vor ihnen zu fliehen. Genauso konnten sie sich ihrem Vorbild anschließen und ihre eigene Bearbeitung des Bodens intensivieren. Das heißt, die Menschen haben nicht den Ackerbau vorgezogen, Sammeln und Jagd gelassen, sondern sie werden sich entschlossen haben, weniger zu sammeln und ein wenig mehr ihrer Zeit dem Anbau von Pflanzen zu widmen. Irgendwann tauchte die Frage auf, ob sie Unkraut hacken wollten oder nicht, dann ging es ums Pflügen, Düngen und so weiter. Es war also eine Folge kleiner Schritte und nicht der große Sprung, der sie ein für alle Mal aus der ursprünglichen Überflussgesellschaft heraus und zu mühsamer Plackerei und chronischen Krankheiten geführt hätte. Aufs Ganze gesehen und über Hunderte von Jahren und Tausende von Kilometern hinweg haben sich die, die intensiviert haben, auch vermehrt; während die anderen, die an ihrem alten Leben festhielten, schwanden. Es war ein Prozess, während dessen die Grenze des Ackerbaus sich langsam vorwärtsschob. Niemand entschied sich bewusst für hierarchische Verhältnisse und längere Arbeitszeiten; die Frauen haben arthritische Zehen weder bewusst noch freudig in Kauf genommen, so etwas ergab sich nach und nach.
Ganz gleich, wie viele Steinwerkzeuge, verbrannte Körner oder Gebäudefundamente Archäologen noch ausgraben, sie werden niemals in der Lage sein, die eine oder die andere Theorie zu beweisen beziehungsweise zu verwerfen. Doch auch hier kam ihnen die Genetik zu Hilfe, zumindest ein Stück weit. In den 1970er Jahren startete Luigi Luca Cavalli-Sforza von der Stanford University eine groß angelegte Untersuchung in Europa vorhandener Blutgruppen und Zellkern-DNA. Sein Team fand ein von Südosten nach Nordwesten durchgängiges Gefälle von Genhäufigkeiten (Abbildung 2.5), das sich, wie die Forscher darstellten, sehr gut mit den in Abbildung 2.4 dargestellten archäologischen Befunden vereinbaren lässt. Ihr Schluss: Nachdem Auswanderer aus Westasien den Ackerbau nach Europa gebracht hatten, verdrängten deren Nachkommen die eingeborenen Wildbeuter weitgehend, deren letzte Gruppen sich in den Norden und Westen Europas zurückzogen.
Dem Archäologen Colin Renfrew zufolge wird Cavalli-Sforzas Szenario auch durch linguistische Befunde gestützt: Die ersten Ackerbauern, so seine Vermutung, haben nicht nur die europäischen Gene durch solche aus Südwestasien ersetzt, sondern auch die in Europa heimischen Sprachen durch indoeuropäische |118|aus dem Raum des Fruchtbaren Halbmondes; nur in kleinen abgeschiedenen Gebieten hätten sich ältere Sprachen erhalten, etwa das Baskische. Das Drama der Enteignung, das der ursprünglichen Überflussgesellschaft ein Ende setzte, ist den Körpern der Europäer eingeschrieben und wiederholt sich, sobald eine oder einer von ihnen den Mund aufmacht.
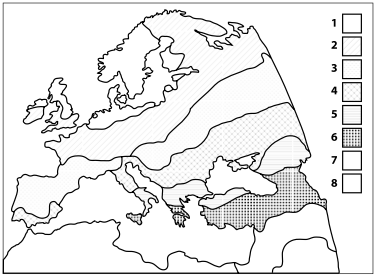
Abbildung 2.5: Ins Blut geschriebene Geschichte
Luigi Luca Cavalli-Sforzas Auswertung der genetischen Befunde in Europa, die auf einem umfangreichen Fundus von Zellkern-DNA basiert. Die Karte zeigt den Grad genetischer Ähnlichkeit moderner Populationen mit den hypothetischen Kolonisten aus dem Fruchtbaren Halbmond, wobei Muster 8 komplette Überseinstimmung anzeigt, Muster 1 den geringsten Ähnlichkeitsgrad. Diese Karte zeige, so Cavalli-Sforza, dass Kolonisten, die aus dem Fruchtbaren Halbmond stammen, den Ackerbau quer durch Europa verbreitet haben. Aber viele Archäologen und auch einige Genetiker widersprechen dem.
Zunächst haben diese neuen Beweise den Streit der Gelehrten nur angeheizt. Linguisten widersprachen Renfrew mit dem Argument, dass die modernen europäischen Sprachen deutlicher voneinander abweichen müssten, wenn sie sich bereits seit sechs oder sieben Jahrtausenden aus einer einzigen Ursprache entwickelt hätten. 1996 dann stellte ein Team aus Oxford, das von Bryan Sykes geleitet wurde, Cavalli-Sforzas genetische Überlegungen in Frage. Sykes’ Team betrachtete – im Unterschied zu Cavalli-Sforza – nicht Zellkern-DNA, sondern mitochondriale DNA und fand keine Südost-Nordwest-Verbreitung, sondern ein derart kompliziertes Muster, dass es sich nicht ohne Weiteres in einer Karte darstellen lässt. Das |119|Team identifizierte sechs Gruppen genetischer Abstammung, von denen sich nur eine plausibel mit Ackerbauern verbinden ließ, die aus Westasien ausgewandert waren. Die anderen fünf sind nach Sykes sehr viel älter und lassen sich auf die ursprüngliche, vor 25 000 bis 50 000 Jahren aus Afrika heraus erfolgte Besiedelung Europas zurückführen. Insofern könnten Europas erste Ackerbauern nicht Nachkommen von Auswanderern aus dem Fruchtbaren Halbmond sein, sondern seien vor allem eingeborene Wildbeuter gewesen, die zu sesshaften Lebensweisen gefunden hätten.
Die Teams von Cavalli-Sforza und Sykes setzten den Streit 1997 im American Journal of Human Genetics zunächst erbittert fort, doch haben sich ihre Positionen seither immer weiter angenähert. Cavalli-Sforza schätzt nun, dass 26 bis 28 Prozent der europäischen DNA von aus Westasien eingewanderten Ackerbauern stammen; Sykes rückt ihren Anteil näher an 20 Prozent. Wenn man also sagt, auf einen der ersten Bauern Europas, der von Einwanderern aus Südwestasien abstammt, kommen drei oder vier, die Nachkommen der Ureinwohner sind, mag man die Angelegenheit vereinfachen, liegt aber nicht ganz falsch.
Weder Cavalli-Sforzas und Renfrews Behauptung noch die von Sykes angebotene Alternative – nicht einmal der sich abzeichnende Kompromiss zwischen beiden – hätte die Studenten von Nanterre sonderlich glücklich gemacht, denn beide Theorien betrachten den Sieg des Ackerbaus als unausweichlich. Konkurrenzverhalten hat, wie Genetik und Archäologie zeigen können, wenig mit Examen oder Lehrern zu tun, es begleitet uns immer schon. Die Dinge hätten sich also gar nicht viel anders entwickeln können, als sie es tatsächlich taten.
Doch stimmt das wirklich? Schließlich haben Menschen einen freien Willen. Faulheit, Gier und Furcht mögen Motoren der Geschichte sein, doch jeder von uns kann sich doch zwischen ihnen entscheiden. Wenn drei Viertel oder mehr der europäischen Ackerbauern von sammelnden Ureinwohnern abstammten, dann hätten die es doch in der Hand gehabt, das Projekt Ackerbau zu stoppen, wenn sich nur genügend von ihnen dazu entschlossen hätten. Warum also kam es nicht dazu?
Mancherorts kam es sehr wohl dazu. Nachdem sich die Welle des agrikulturellen Fortschritts innerhalb weniger Jahrhunderte von der Gegend des heutigen Polen bis ins Pariser Becken ausgebreitet hatte, kam sie um 5200 v. u. Z. zum Stillstand (Abbildung 2.4). 1000 Jahre lang drang so gut wie kein Ackerbauer in den letzten, 80 bis 100 Kilometer breiten Streifen vor, der sie noch von der Ostsee trennte, und auch nur wenige Wildbeuter dort nahmen eine intensivere Bestellung des Bodens auf. Hier kämpften sie um ihre Lebensweise. Entlang der Grenzlinie zwischen Sammlern und Bauern finden wir eine bemerkenswerte Zahl befestigter |120|Siedlungen und auch Skelette junger Männer, die durch Verletzungen von Stirn oder linker Schädelseite gestorben sind, die ihnen mit stumpfen Instrumenten zugefügt wurden – was darauf hindeutet, dass sie ihr Leben in Zweikämpfen mit Steinäxte schwingenden Rechtshändern verloren haben. Einige Massengräber könnten durchaus Relikte schauerlicher Metzeleien sein.
Wir werden nie herausfinden, zu welchen Akten von Heroismus und Barbarei es vor 7000 Jahren an der Grenze der nordeuropäischen Ebenen gekommen ist, doch hatten Geographie und Wirtschaftlichkeit mindestens so großen Einfluss darauf, wo und wie die Grenze zwischen Ackerbauern und Sammlern fixiert wurde, wie Kultur und Gewalttaten. Im Raum der Ostseeküste lebten Wildbeuter wie in einem Garten Eden; es mochte dort frostig-kühl sein, doch die reichen Ressourcen des Meeres sicherten ihnen, die relativ dicht ganzjährige Siedlungen bewohnten, den Lebensunterhalt. Archäologen haben große Mengen Muschelschalen ausgegraben, die Reste von Festgelagen, die sich um die Hütten auftürmten. Die Natur war offenbar so reich, dass die Leute dort den Pudding (das Seegetier) behielten, auch wenn sie ihn aßen. Es gab so viele Wildbeuter, dass sie den Ackerbauern Widerstand leisten konnten, aber sie waren auch nicht so zahlreich, dass sie es den Bauern hätten gleichtun müssen, damit alle satt wurden. Umgekehrt mussten die Ackerbauern feststellen, dass Pflanzen, die im Fruchtbaren Halbmond domestiziert worden waren, hier im Norden nicht besonders gut gediehen.
Warum sich der Ackerbau ab 4200 v. u. Z. dennoch weiter nach Norden ausgebreitet hat, wissen wir nicht. Manche Archäologen vermuten, dass der Druck wuchs, als sich die Bauern so stark vermehrt hatten, dass sie die Sammler einfach niederwalzten. Andere denken an Sogwirkungen: Eine Krise in den Sammlergemeinschaften könnte den Norden für eine Invasion geöffnet haben. Was auch immer geschah, die Ausnahme in der Küstenregion der Ostsee scheint die Regel zu bestätigen, dass die ursprüngliche Überflussgesellschaft einfach nicht überleben konnte, nachdem der Ackerbau im Fruchtbaren Halbmond erst einmal entstanden war.
Indem ich das feststelle, bestreite ich jedoch nicht Existenz und Wirksamkeit des freien Willens. An jedem ihm gegebenen Tag hätte jeder prähistorische Wildbeuter sich entscheiden können, den Ackerbau nicht zu intensivieren; so wie jeder Bauer seine Felder, jede Bäuerin ihre Mahlsteine hätte verlassen können, um Wild zu jagen oder Nüsse zu sammeln. Manche werden das auch getan haben, mit spürbaren Konsequenzen für ihr jeweiliges Leben. Auf lange Sicht aber hat das nichts geändert, denn die Konkurrenz um Ressourcen führte dazu, dass Menschen, die beim Ackerbau blieben und diesen vielleicht noch intensiver betrieben, eine höhere Energieausbeute erzielten als jene, die das nicht taten. Bauern konnten weiterhin mehr Kinder und mehr Vieh ernähren, sie rodeten neue Felder und gewannen immer weitere Vorteile vor den Sammlern. Unter entsprechenden Bedingungen, solchen nämlich, wie sie um 5200 v. u. Z. an der Ostsee herrschten, |121|konnte aus dem Vormarsch des Ackerbaus ein Kriechen werden. Doch diese Bedingungen änderten sich auch wieder.
Auch lokale Rückschläge wird der Ackerbau erlitten haben. Überweidung etwa hat das Jordan-Tal zwischen 6500 und 6000 v. u. Z. zu einer Wüste gemacht. Doch wenn sich keine Klimakatastrophe, kein neues Jüngeres Dryas ereignete (und dazu kam es nicht), dann hätte aller freie Wille der Welt nicht ausgereicht, um zu verhindern, dass Ackerbau und die entsprechende Lebensweise alle geeigneten Nischen eroberte. Das Zusammenwirken von intelligentem Homo sapiens und warmem, feuchtem und stabilem Wetter plus Pflanzen und Tieren, die sich zu domestizierten Formen entwickeln konnten, machte das so unausweichlich, wie nur irgendetwas in dieser Welt unausweichlich sein kann.
Um 7000 v. u. Z. waren die dynamischen, expandierenden Ackerbaugesellschaften am westlichen Ende Eurasiens mit nichts anderem auf dem Globus vergleichbar, und an genau diesem Punkt ist es sinnvoll, den »Westen« von der übrigen Welt zu unterscheiden. Allerdings war dieser Unterschied nicht von Dauer, und im Verlauf einiger Jahrtausende machten sich Menschen in etwa einem halben Dutzend anderer Regionen der Glücklichen Breiten ihrerseits daran, den Ackerbau zu erfinden (Abbildung 2.6).
Am frühesten und eindeutigsten geschah das im heutigen China. Im Jangtse-Tal begannen Anbau und Züchtung von Reis zwischen 8000 und 7500 v. u. Z.; seit 6500 wurde in Nordchina Hirse kultiviert. Völlig domestiziert war Hirse um 5500, Reis um 4500 v. u. Z. Zwischen 6000 und 5500 waren Schweine domestiziert. Jüngste Funde haben gezeigt, dass der Ackerbau fast ebenso früh auch in der Neuen Welt begonnen hat. Ab 8200 v. u. Z. wurden im peruanischen Nanchoc-Tal und zwischen 7500 und 6000 v. u. Z. im mexikanischen Oaxaca-Tal aus kultivierten Kürbisarten domestizierte Pflanzen. Erdnüsse tauchen in Nanchoc um 6500 auf. Nach archäologischen Funden in Oaxaca hat sich das Wildgras Teosinte erst um 5300 v. u. Z. in domestizierten Mais verwandelt; Genetiker vermuten aber, dass der Prozess der Kultivierung und Domestizierung bereits um 7000 v. u. Z. begonnen haben muss.
Die Domestizierungen in China und der Neuen Welt geschahen definitiv unabhängig vom Geschehen im Fruchtbaren Halbmond; weniger eindeutig liegen die Dinge im Indus-Tal. In der archäologisch bedeutsamen Siedlungsgruppe Mehrgarh tauchten um 7000 v. u. Z. Hafer, Weizen und Schafe in kultivierter beziehungsweise domestizierter Form auf – und zwar so plötzlich, dass viele Archäologen glauben, dass sie mit Migranten aus dem Fruchtbaren Halbmond dorthin kamen. Dafür spricht vor allem der Weizenfund, denn bis jetzt hat noch niemand lokale Wildformen identifiziert, aus denen irgendwo in der Nähe von Mehrgarh Weizen hätte kultiviert werden können. Allerdings haben Botaniker die Region nicht sehr gründlich untersucht (nicht einmal der pakistanischen Armee ist danach zumute, in diesen wilden Stammesgebieten herumzustöbern), es könnte also durchaus noch Überraschungen geben. Bis jetzt aber sprechen die Funde dafür, dass die Agrikultur des Indus-Tals ein Ableger aus dem Fruchtbaren Halbmond ist. Doch dann sollten wir sofort festhalten, dass der Ackerbau dort rasch eigene Entwicklungsschritte ging. So wurde das indigene Zeburind um 5500 v. u. Z. domestiziert, und um 2500 v. u. Z. gab es dort eine hochentwickelte städtische Kultur mit eigener Schrift.

Abbildung 2.6: Gelobtes
Land
Sieben Regionen rund um die Welt, in denen zwischen 11 000 und 5000 v. u. Z. unabhängig voneinander die
Domestizierung von Pflanzen und Tieren begonnen haben könnte.
|123|Der Osten der Sahara war um 7000 v. u. Z. feuchter als heute, jeden Sommer füllten starke Monsunregen die Seen der Region. Insgesamt aber waren die Lebensbedingungen in der Wüste sehr hart, gleichzeitig wird man die Lebensfeindlichkeit dieser Wildnis als Mutter von Erfindungen betrachten müssen: Rinder und Schafe hatten dort alleine keine Chance, aber die Wildbeuter konnten ihr Leben verbessern, wenn sie Tiere von Wasserstelle zu Wasserstelle trieben. Zwischen 7000 und 5000 v. u. Z. wurden die nomadischen Wildbeuter zu Hirten und aus ihren wilden Rindern und Schafen größere und zahmere Tiere.
Um 5000 v. u. Z. entwickelte sich der Ackerbau auch in zwei Hochlandzonen: zum einen in Peru, wo Lamas und Alpakas domestiziert wurden und der Inkareis (Quinoa) sich so veränderte, dass die Körner nicht mehr zu Boden fielen; zum anderen in Neuguinea. Die Funde dort wurden so kontrovers diskutiert wie die aus dem Indus-Tal, doch inzwischen steht fest, dass die Leute im Hochland von Neuguinea um 5000 v. u. Z. Brandrodungen durchführten, Sümpfe trockenlegten, Bananen und Taro (Wasserbrotwurzel) domestizierten.
Es sind dies Regionen mit einer sehr unterschiedlichen Geschichte, doch waren sie, wie der Fruchtbare Halbmond auch, Ausgangspunkte für eine jeweils eigene wirtschaftliche, soziale und kulturelle Tradition, die sich bis in unsere Tage erhielt. Hier nun können wir die Frage beantworten, die uns von Anfang an verfolgt, wie nämlich »Westen« zu definieren sei. Im ersten Kapitel haben wir die Kritik des Historikers Norman Davies kennen gelernt, der die kursierenden Definitionen des Westens »elastisch« genannt hat, ersonnen nur, um den Interessen derer zu dienen, die sie jeweils in Umlauf bringen. Mit seiner Weigerung allerdings, überhaupt vom Westen zu sprechen, schüttete er das Kind mit dem Bade aus. Dank der zeitlichen Tiefe, die die Archäologie erreicht hat, sind wir inzwischen ein wenig weiter.
Alle großen Zivilisationen der heutigen Welt gehen auf die Episoden ursprünglicher Domestizierung am Ende der Eiszeit zurück. Wir müssen uns von den intellektuellen Kabbeleien, die Davies beschrieben hat, den Begriff »Westen« nicht länger madig machen lassen. Es ist eine analytische, genauer: eine geographische Kategorie, die sich auf solche Gesellschaften bezieht, die sich vom westlichsten Kerngebiet der Domestizierung ableitet, dem Fruchtbaren Halbmond. Es ist unsinnig, vom »Westen« als einer abgrenzbaren Region zu sprechen, wenn es um Zeiträume vor 11 000 v. u. Z. geht; erst danach, und zwar durch die Vorgänge rund um die Domestizierung, entwickelt sich der Fruchtbare Halbmond zu einer ungewöhnlichen Region. Zu einem wirklich analytischen Werkzeug wird der Begriff »Westen« erst nach 8000 v. u. Z., als sich agrikulturelle Kerngebiete herausbildeten. Um 4500 v. u. Z. hatte sich der Westen vergrößert und umfasste nun |124|auch den größten Teil Europas. In den letzten 500 Jahren trugen Kolonisten diese Kultur nach Nord- und Südamerika, zu den Antipoden und nach Sibirien. Dementsprechend sind mit »Osten« jene Gesellschaften gemeint, die vom östlichsten Kerngebiet der Domestizierung abstammen, das sich ab 7500 v. u. Z. in China entwickelt hat. Wir können auch von vergleichbaren Traditionen der Neuen Welt, Südasiens, Neuguineas und Afrikas sprechen. Die Frage nach der Vorherrschaft des Westens zielt eigentlich auf die Gründe, aus denen die Gesellschaften, die sich vom agrikulturellen Kernland im Fruchtbaren Halbmond herleiten, dazu kamen, den Planeten zu beherrschen, und nicht solche, die in den Entwicklungskernen in China, Mexiko, im Indus-Tal, in der Ostsahara, Peru oder Neuguinea ihren Ausgang nahmen.
Eine der Erklärungen, die von langfristiger Determination ausgehen, kommt einem an dieser Stelle sofort in den Sinn: Die Menschen aus dem Fruchtbaren Halbmond – die ersten »Westler« also – hätten den Ackerbau Tausende von Jahren vor allen anderen deshalb entwickelt, weil sie einfach klüger und geschickter gewesen wären. Mit ihren Genen und ihren Sprachen hätten sie ihre Intelligenz weitergegeben, während sie sich in Europa verbreiteten; Europäer hätten sie mitgenommen, als sie ab 1500 u. Z. andere Erdteile kolonisierten. Und aus diesem Grund regiere der Westen die Welt.
Das ist falsch, nicht anders als die in Kapitel 1 diskutierten rassistischen Theorien. Und zwar aus Gründen, die der Evolutionstheoretiker und Geograph Jared Diamond in seinem Klassiker Arm und reich. Die Schicksale menschlicher Gesellschaften so überzeugend dargestellt hat. Die Natur, so Diamond, sei einfach ungerecht. Nicht weil die dort lebenden Menschen einzigartig intelligent gewesen wären, wurde der Ackerbau im Fruchtbaren Halbmond nachweislich tausende Jahre früher entwickelt als irgendwo anders, sondern weil die geographischen Bedingungen diesen Menschen gute Startchancen boten.
Es gibt derzeit, wie Diamond feststellt, etwa 200 000 Pflanzenarten auf der Welt, doch nur einige 1000 davon sind essbar und nur einige 100 würden sich zur Domestizierung eignen. Tatsächlich stammt die Hälfte der heute konsumierten Kalorien von Getreidearten, vor allem von Weizen, Mais, Reis, Gerste und Hirse. Die Wildgräser, aus denen sich diese Getreidearten entwickelt haben, existieren nicht gleichmäßig über den Globus verteilt. Von den 56 Gräsern mit den größten, nahrhaftesten Samen waren 33 Arten wild in Südwestasien und im Mittelmeerraum heimisch. In Ostasien gibt es nur sechs wilde Arten, in Mittelamerika fünf, in Afrika südlich der Sahara vier, ebenfalls nur vier in Nordamerika, in Südamerika und Australien jeweils zwei und in Westeuropa eine. Wenn Menschen (in großen Gruppen betrachtet) einander ziemlich gleich sind und Wildbeuter überall in der Welt gleichermaßen träge, gierig und ängstlich waren, dann ist es einfach wahrscheinlich, dass die Menschen aus dem Fruchtbaren Halbmond diejenigen waren, die als erste Pflanzen und Tiere domestiziert haben, denn sie hatten das aussichtsreichere Ausgangsmaterial zur Hand.
|125|Der Fruchtbare Halbmond bot noch weitere Vorteile. Um wilde Gerste und Weizen zu domestizieren, brauchte es gerade mal eine genetische Mutation, um dagegen Teosinte in etwas Maisähnlichliches zu verwandeln, waren Dutzende von Mutationen erforderlich. Die Menschen, die um 14 000 v. u. Z. nach Nordamerika kamen, waren nicht fauler oder dümmer als irgendwer sonst, und sie machten sicher nicht den Fehler, Teosinte anstelle von Weizen zu domestizieren. Es gab schlicht keinen Weizen in der Neuen Welt. Die Einwanderer hätten aber auch keine Getreidesamen aus der Alten Welt mitbringen können, denn sie konnten nur so lange in die Neue Welt gelangen, wie eine Landbrücke nach Asien bestand. Als sie über diese Landbrücke zogen – bevor der steigende Meeresspiegel die Landverbindung überspülte, also um 12 000 v. u. Z. –, gab es noch gar keine domestizierten Pflanzen, die sie hätten mitbringen können; und als es diese Pflanzen gab1*, war die Landbrücke längst überflutet.
Nicht weniger begünstigt war der Fruchtbare Halbmond im Hinblick auf die dort lebende Tierwelt. Weltweit gibt es derzeit 148 Arten großer (über 50 Kilogramm schwerer) Säugetiere. Um 1900 u. Z. waren gerade 14 dieser Arten domestiziert, und sieben davon stammen aus Südwestasien. Alle der weltweit wichtigsten Haustiere (Schafe, Ziegen, Rinder, Schweine und Pferde) hatten – das Pferd ausgenommen – wilde Vorformen im Fruchtbaren Halbmond. In Ostasien gab es fünf, in Südamerika gerade eine dieser domestizierbaren Arten. Nicht eine dieser Arten lebte in Nordamerika, Australien oder in Afrika südlich der Sahara, dabei wimmelte es dort von großen Tieren. Doch sind der Domestizierung von Arten wie dem gefräßigen Löwen oder der haushohen Giraffe offensichtlich Grenzen gesetzt.
Darum sollten wir auch nicht davon ausgehen, dass die Menschen im Fruchtbaren Halbmond den Ackerbau erfunden haben, weil sie anderen genetisch oder kulturell überlegen gewesen wären. Sie teilten einfach den Lebensraum mit vielen (und leichter als anderswo) zu domestizierenden Pflanzen und Tieren, nur darum gelang es ihnen als Ersten, sich zu deren Herren zu machen. Das Angebot wilder Pflanzen und Tiere in den diversen Regionen Chinas war nicht ganz so günstig, aber immer noch gut; zur Domestizierung kam es hier rund zwei Jahrtausende später. Hirten in der Sahara, denen nur Schafe und Rinder zur Verfügung standen, brauchten weitere 500 Jahre, und weil Feldfrüchte in der Wüste nicht gediehen, wurden sie nie zu Ackerbauern. Die Menschen im Hochland Neuguineas standen vor dem umgekehrten Problem: Hier gab es nur eine schmale Auswahl an Pflanzen und keine domestizierbaren großen Tiere. Sie benötigten weitere 2000 Jahre und wurden niemals Viehzüchter. Die agrikulturellen Kerngebiete in der Sahara und Neuguinea brachten – im Unterschied zum Fruchtbaren Halbmond, |126|zu China, dem Indus-Tal, Oaxaca und Peru – keine eigenen Städte und auf Schrift basierende Kulturen hervor: nicht weil sie minderwertig gewesen wären, sondern weil ihnen die natürlichen Ressourcen fehlten.
Den Ureinwohnern Amerikas standen mehr Angebote zur Verfügung, mit denen sie etwas anfangen konnten, als den Afrikanern und Neuguinesen, aber weniger als den Menschen im Fruchtbaren Halbmond oder in China. Die Menschen in Oaxaca und in den Anden entwickelten sich rasch, indem sie Pflanzen (aber keine Tiere) kultivierten, innerhalb von 25 Jahrhunderten ab Ende des Jüngeren Dryas. Für Truthühner und Lamas, die – von Hunden abgesehen – einzigen Tiere, die sich dort domestizieren ließen, brauchten sie Jahrhunderte länger.
Die schmalsten Ressourcen überhaupt hatten die australischen Ureinwohner. Ausgrabungen in jüngerer Zeit ergaben, dass sie mit der Züchtung von Aalen experimentierten, und sie hätten, wenn ihnen einige weitere ungestörte Jahrtausende vergönnt gewesen wären, auch sesshafte Lebensweisen entwickelt. Stattdessen aber wurden sie im 18. Jahrhundert von europäischen Kolonisten überwältigt, die Weizen und Schafe importierten, Abkömmlinge der ursprünglichen Ackerbaurevolution im Fruchtbaren Halbmond.
Die Menschen aller Weltregionen waren, soweit wir das wissen können, einander tatsächlich ziemlich gleich. Allen bot die Erderwärmung neue Wahlmöglichkeiten: Sie konnten entweder weniger arbeiten oder gleich viel arbeiten und mehr essen, sie konnten aber auch mehr Nachkommen haben, selbst wenn dies mehr Arbeit bedeutete. Mit der neuen Klimalage war es ihnen möglich, in größeren Gruppen zu leben und weniger herumzuziehen. Überall in der Welt, wo sich die Menschen entschieden, sesshaft zu werden, mehr Kinder zu haben und auch mehr zu arbeiten, übertrafen sie jene anderen, die diesen Weg nicht gingen. Es ist allein der Natur zu verdanken, dass dieser Prozess im Westen früher begann als anderswo.
Dem könnte ein Vertreter der Theorie langfristiger Determiniertheit durchaus zustimmen. Vielleicht, würde er sagen, waren die Menschen tatsächlich überall weitgehend gleich, vielleicht hat es die Geographie denen im Westen nur leichter gemacht. Aber, wird er fortfahren, Geschichte ist mehr als Wetter und Größe des Saatguts. Schließlich mache es einen Unterschied, welchen Weg die Menschen einschlagen. Wollten sie weniger arbeiten oder wollten sie mehr essen und größere Familien durchbringen? Wie eine Geschichte ausgeht, ist häufig mit deren Beginn schon festgelegt. Vielleicht regiere der Westen heute die Welt, weil vor über 10 000 Jahren im Fruchtbaren Halbmond eine bestimmte Kultur entstanden ist, die zum Vorfahren aller späteren westlichen Gesellschaften wurde. Sie könnte doch einfach größere Potenziale haben als die Kulturen, die in anderen Kernregionen der Welt geschaffen wurden.
|127|Betrachten wir die am besten dokumentierte, älteste und (in unseren Tagen) mächtigste Kultur, die außerhalb des Westens entstanden ist: China. Was wir herausfinden müssen, ist, wie sehr sich die ersten dortigen Ackerbaukulturen von denen im Westen unterschieden und ob diese Unterschiede dazu führten, dass sich der Osten und der Westen auf unterschiedlichen Bahnen entwickelt haben – was wiederum erklären könnte, warum westliche Gesellschaften rund um die Welt zur Herrschaft kamen.
Bis vor kurzem wussten die Archäologen sehr wenig über den frühen Ackerbau in China. Viele Gelehrte glaubten sogar, dass der Reis, dieser Inbegriff der chinesischen Küche, seine Geschichte nicht dort, sondern in Thailand begonnen hat. Erst als 1984 entdeckt wurde, dass auch im Jangste-Tal wilder Reis wuchs, war klar, dass er auch hier hat domestiziert werden können. Das allerdings lässt sich archäologisch nur schwer bestätigen. Das Problem liegt im Unterschied der Verarbeitung: Während Bäcker stets etwas von ihrem Brot anbrennen und damit den Archäologen verkohlte Weizen- oder Hirsekörner übrig lassen, kommt es beim Kochen, der sinnvollsten Art der Reiszubereitung, selten zu solchen Zwischenfällen. Entsprechend schwerer lassen sich Spuren alter Reisarten finden.
Doch mit ein bisschen Erfindungskraft konnten die Archäologen dieses Hindernis bald umgehen. 1988 stellten Ausgräber in Pengtoushan im Jangste-Tal (Abbildung 2.7) fest, dass Töpfer um 7000 v. u. Z. begonnen hatten, Reisschrot und -stängel unter den Ton zu mischen, damit ihre Töpfe im Brennofen nicht so leicht sprangen, und nähere Untersuchungen brachten dann den eindeutigen Nachweis, dass diese Zusätze von kultivierten Pflanzen stammten.
Der eigentliche Durchbruch begann 1995, als sich Yan Wenming von der Peking University1* mit dem amerikanischen Archäologen Richard MacNeish zusammentat – einem Feldforscher, wie er im Buche steht.2*MacNeish brachte nicht nur eine jahrzehntelange Erfahrung im Studium des frühen Ackerbaus mit nach China, sondern auch die Archäobotanikerin Deborah Pearsall, und die wiederum hatte eine neue wissenschaftliche Technik im Gepäck. Reis bleibt in archäologischen Sedimenten nur selten erhalten, doch wie alle Pflanzen nimmt auch er geringe Mengen Kieselerde aus dem Grundwasser auf. Diese füllt einige Pflanzenzellen, und wenn die Pflanze verwest, hinterlässt sie in der Erde mikroskopische, zellenartig geformte Versteinerungen, Phytolithen genannt. Deren gründliche Untersuchung vermag nicht nur zu zeigen, ob die Leute an der Fundstätte Reis gegessen haben, sondern auch, ob die Pflanzen bereits kultiviert waren.
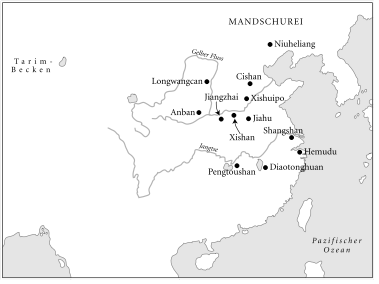
Abbildung 2.7: Die Wiege des Ostens
Stätten im heutigen China, die in diesem Kapitel erwähnt werden.
Yan und MacNeish ließen in der Diaotonghuan-Höhle, Provinz Jiangxi, einen 4,80 Meter tiefen Graben ziehen, und Pearsall konnte anhand der dabei gefundenen Phytolithen nachweisen, dass Menschen um 12 000 v. u. Z. Wildreis ausgerissen und in die Höhle gebracht haben. Wie im Fruchtbaren Halbmond, wo, als sich die Erde erwärmte, Weizen, Gerste und Roggen gediehen, war auch im Jangtse-Tal eine goldene Zeit für Jäger und Sammler angebrochen. Die Phytolithen lieferten keinen Hinweis darauf, dass beim Reis, so wie beim Roggen in Abu Hureyra, eine Evolution hin zu domestizierten Formen stattgefunden hat, doch das Jüngere Dryas hatte im Jangtse-Tal die gleichen verheerenden Folgen wie im Westen. Um 10 500 v. u. Z. war Wildreis fast völlig aus Diaotonghuan verschwunden, kehrte aber zurück, als sich nach 9600 v. u. Z. das Klima wieder besserte. Um diese Zeit (und damit 2500 Jahre früher als im Fruchtbaren Halbmond) tauchen auch Fragmente grober Keramikgefäße auf, vermutlich Relikte von Kesseln, in denen Körner gekocht worden waren. Ab 8000 v. u. Z. werden die Phytolithen größer, ein sicheres Zeichen dafür, dass die Menschen Wildreis kultivierten. Um 7500 v. u. Z. waren in Diaotonghuan Körner vollständig wilder und solche kultivierter Reispflanzen gleichermaßen verbreitet; um 6500 v. u. Z. war der wilde Reis verschwunden.
Ausgrabungen, die seit 2001 im Jangtse-Delta unternommen werden, bestätigen diese zeitliche Abfolge. Und wir wissen, dass die Menschen im Tal des Gelben |129|Flusses um 7000 v. u. Z. begonnen hatten, Hirse zu kultivieren. Um diese Zeit waren auch in Jiahu, einer bemerkenswerten Fundstätte zwischen Jangtse und Gelbem Fluss, Reis und Hirse kultiviert worden, möglicherweise auch Schweine domestiziert. In Cishan, Provinz Hebei, ließ ein Feuer um 6000 v. u. Z. 80 Vorratsgruben mit fast einer Viertelmillion Pfund großer Hirsesamen verkohlen und konservierte sie damit. Auf dem Grund einiger Gruben fand man unter der Hirse auch vollständige Skelette von Hunden und Schweinen; sie gehören zu den frühesten Zeugnissen für domestizierte Tiere in China.
Wie im Westen bedeutete die Domestizierung auch hier über Jahrhunderte hinweg unzählige kleine Veränderungen an Feldpflanzen, Tieren sowie an Techniken. Der hohe Grundwasserspiegel von Hemudu im Jangtse-Delta bescherte den Archäologen eine wahre Goldgrube, denn er konservierte große Mengen von Wasserbaureis sowie Werkzeuge aus Holz und Bambus, alle aus der Zeit ab 5000 v. u. Z. Um 4000 v. u. Z. war der Reis endgültig domestiziert und – wie Weizen und Gerste im Westen – vollständig davon abhängig, dass Menschen ihn ernteten. Außerdem hatten die Menschen der Hemudu-Kultur Wasserbüffel domestiziert, deren Schulterblattknochen sie als Spaten nutzten. Wie Archäologen dokumentieren konnten, hat sich im nordchinesischen Wei-Tal eine Jägerkultur ab 5000 v. u. Z. kontinuierlich zu einer Agrikultur entwickelt. Am deutlichsten ließ sich das an Werkzeugen zeigen, die in Gebrauch waren: Spaten und Hacken aus Stein ersetzten die Steinbeile, als die Menschen von der Brandrodung kleiner Waldstücke zu dauerhaft kultivierten Feldern übergingen; die Spaten wurden größer, als die Ackerbauern den Boden tiefer umzugraben begannen. Im Jangtse-Tal gab es deutlich erkennbare, von Dämmen umgebene Reisfelder, die geflutet werden konnten, vermutlich ab 5700 v. u. Z.
Frühe chinesische Siedlungen wie Jiahu (um 7000 v. u. Z.) unterschieden sich kaum von denen im Fruchtbaren Halbmond: Man fand Relikte kleiner, unregelmäßig runder, halb in die Erde gebauter Hütten und zwischen diesen Mahlsteine und Grabstätten. In Jiahu lebten 50 bis 100 Menschen. Eine der Hütten war etwas größer als die anderen, doch die sehr gleichmäßige Verteilung der Funde spricht dafür, dass Eigentum und geschlechtlich bedingte soziale Unterschiede noch schwach ausgebildet waren. Das Kochen und die Vorratshaltung geschahen gemeinschaftlich. Das änderte sich um 5000 v. u. Z., als einige der Siedlungen 150 Bewohner zählten und mit Gräben geschützt wurden. In Jiangzhai, Provinz Shaanxi, der bestdokumentierten Stätte aus dieser Zeit, standen die Hütten um einen unbebauten Bereich, der zwei große Aschehaufen enthielt, vermutlich Relikte gemeinschaftlicher Rituale.
Verglichen mit den Heiligtümern, die im Westen damals bereits seit einigen Jahrtausenden errichtet wurden, wirken die Opferstätten von Jiangzhai – wenn es denn welche waren – ziemlich zahm. Doch zwei bemerkenswerte Funde aus Gräbern bei Jiahu zeigen, dass Religion und Ahnen hier keinen Deut weniger wichtig genommen wurden als im Fruchtbaren Halbmond. Der erste Fund besteht |130|aus über dreißig Flöten, geschnitzt aus Flügelknochen des Mandschurenkranichs, die alle aus Männergräbern stammen, die reicher ausgestattet sind als der Durchschnitt. Auf fünf der Flöten kann heute noch gespielt werden. Die ältesten, entstanden um 7000 v. u. Z., hatten fünf oder sechs Löcher. Es sind also keine besonders feinen Instrumente, doch heutige chinesische Volkslieder lassen sich darauf spielen. Um 6500 v. u. Z. waren dann sieben Löcher üblich, und die Flötenbauer gaben den Instrumenten die gleiche Tonhöhe, woraus man wohl schließen kann, dass Flötenspieler in Gruppen Musik machten. Eines der Gräber, angelegt um 6000 v. u. Z., enthielt eine Flöte mit acht Löchern, auf der sich jede moderne Melodie spielen lässt.
Das alles klingt interessant. Die eigentliche Bedeutung der Flöten aber tritt erst zutage, wenn sie im Zusammenhang mit 24 reich ausgestatteten Männergräbern betrachtet werden, die Schildkrötenpanzer enthalten; in 14 davon waren einfache Zeichen geritzt worden. Aus einem der Gräber, es stammt von etwa 6250 v. u. Z., ist der Kopf des Verstorbenen entfernt (man denkt sofort an Çatalhöyük!) und durch 16 Schildkrötenpanzer ersetzt worden, zwei davon mit Ritzungen. Einige dieser Zeichen ähneln – zumindest sehen das einige Forscher so – verblüffend den Piktogrammen von Chinas frühestem ausgearbeiteten Schriftsystem, das die Könige der Shang-Dynastie 5000 Jahre später verwendet haben.
Auf die Shang-Inschriften werde ich in Kapitel 4 zurückkommen. Hier will ich nur festhalten, dass der zeitliche Abstand zwischen den Zeichen von Jiahu (um 6250 v. u. Z.) und Chinas erstem wirklichen Schriftsystem (um 1250 v. u. Z.) fast ebenso lang ist wie der zwischen den merkwürdigen Symbolen aus Jerf al-Ahmar in Syrien (um 9000 v. u. Z.) und der ersten wirklichen Schrift in Mesopotamien (um 3300 v. u. Z.). Allerdings gibt es in China mehr Hinweise auf Kontinuität. Dutzende von Fundstätten, insbesondere aus der Zeit nach 5000 v. u. Z., enthielten die merkwürdigen Gefäße mit eingeritzten Zeichen. Gleichwohl streiten die Experten erbittert darüber, ob die groben Ritzungen von Jiahu direkte Vorläufer der über 5000 Symbole des Shang-Schriftsystems sind.
Nicht das schwächste Argument für eine solche Verbindung ist der Umstand, dass so viele Shang-Texte auf Schildkrötenpanzer geritzt wurden. Die Könige dieser Zeit nutzten die Panzer für ihre rituellen Weissagungen; erste Spuren solcher Praktiken findet man bereits um 3500 v. u. Z. Und so fragen sich die Ausgräber von Jiahu, ob die Verbindung von Schildkrötenpanzern, Schriftzeichen, Wahrsagerei und sozialer Macht nicht schon vor 6000 v. u. Z. begonnen hat. Wie jeder weiß, der Texte des Konfuzius kennt, gehören Musik und Rituale in China seit dem 1. Jahrtausend v. u. Z. zusammen. Sollten Flöten, Schildkrötenpanzer und Schriftzeichen aus den Gräbern von Jiahu ein Hinweis darauf sein, dass es bereits 5000 Jahre früher Menschen gab, die darauf spezialisiert waren, mit den Ahnen zu sprechen?
Es wäre eine in der Tat erstaunliche Kontinuität, doch gibt es Parallelen dazu. In Kapitel 1 habe ich die merkwürdigen doppelköpfigen Statuen mit den riesigen starren Augen erwähnt, die, aus der Zeit um 6600 v. u. Z. stammend, in Ain Ghazal |131|im Jordan-Tal gefunden wurden. Die Kunsthistorikerin Denise Schmandt-Besserat hat darauf hingewiesen, wie auffallend ähnlich die Beschreibungen von Göttern sind, die sich in Texten finden, die um 2000 v. u. Z. in Mesopotamien entstanden sind. Im Osten wie im Westen könnten einige Elemente der Religion der ersten Ackerbaugesellschaften außerordentlich langlebig gewesen sein.
Schon vor den Entdeckungen in Jiahu hat Kwang-chih Chang von der Harvard University – der Pate der chinesischen Archäologie von den 1960er Jahren bis zu seinem Tod 2001 – behauptet, dass die ersten wirklich mächtigen Menschen in China Schamanen gewesen seien, die es verstanden, andere davon zu überzeugen, sie könnten zu Tieren und Ahnen sprechen, zwischen den Welten hin und her fliegen, und die die Kommunikation mit den Himmeln zu ihrem Monopol machten. Als Chang dies schrieb, in den 1980er Jahren, erlaubten ihm die verfügbaren Funde nur, die Spuren solcher Spezialisten bis 4000 v. u. Z. zurückzuverfolgen. Zu dieser Zeit wandelten sich chinesische Gesellschaften rasch, und aus einigen Siedlungen wurden Städte. Um 3500 v. u. Z. hatten einige Gemeinwesen bereits 2000 oder 3000 Bewohner, so viele wie Çatalhöyük oder Ain Ghazal 3000 Jahre früher; eine Handvoll dieser Gemeinwesen konnte Tausende von Arbeitskräften mobilisieren, die Befestigungsanlagen errichteten, indem sie Lage über Lage Erde feststampften (guter, zum Bau geeigneter Stein ist selten in China). Die eindrucksvollste dieser Mauern fand sich in Xishan, Provinz Henan. Sie war ursprünglich zwischen 3,50 und 4,50 Meter dick und über 1,6 Kilometer lang. Noch heute ist sie an einigen Stellen bis 2,50 Meter hoch. Unter den Fundamenten wurden in Tonkrügen beigesetzte Kinderskelette gefunden, vermutlich während des Baus gebrachte Opfer. Zahlreiche mit Asche gefüllte Gruben in der Siedlung selbst enthalten Erwachsene in Kampfhaltungen, manchmal zusammen mit Tierknochen. Auch das können rituelle Morde gewesen sein wie die von Çayönü in der heutigen Türkei, und es gibt einige Belege dafür, dass solche schauerlichen Rituale in China bis 5000 v. u. Z. zurückreichen.
Sollte Chang Recht und Schamanen ihre Führungsrolle tatsächlich um 3500 v. u. Z. übernommen haben, dann könnten sie in den größeren Häusern gewohnt haben, die über einer Grundfläche von 370 Quadratmetern errichtet wurden und die von dieser Zeit an in einigen Städten auftauchen. (Archäologen nennen sie häufig »Palast«, was vielleicht ein wenig zu grandios klingt.) Die Bauten hatten mit Stein belegte Fußböden, große zentrale Feuerstellen und Aschegruben, die auch Tierknochen (von Opfern?) enthielten. In einem Gebäude befand sich ein Artefakt aus weißem Marmor, das aussieht wie ein Zepter. Der interessanteste dieser »Paläste«, der von Anban, Provinz Shaanxi, stand erhöht in der Mitte der Stadt. Die Säulen ruhten auf steinernen Fundamenten, das Bauwerk war umgeben von Gruben voller Asche, von denen einige rot angemalte Kieferknochen von Schweinen enthielten, andere in Stoff gehüllte Schweineschädel, noch andere kleine Tonfiguren mit großen Nasen, Bärten und seltsam spitzen Hüten (sie erinnern an Halloween-Hexen).
|132|Zweierlei fanden die Archäologen an diesen Statuetten besonders aufregend. Zum einen währte die Tradition ihrer Herstellung Tausende von Jahren, und man hat ein ziemlich ähnliches Exemplar in einem um 1000 v. u. Z. entstandenen Palast gefunden, das das chinesische Schriftzeichen wu auf seinem Hut trägt. Wu bedeutet »religiöser Mittler«. Einige Archäologen schließen daraus, dass alle Figurinen, auch die aus Anban, Schamanen darstellen. Zum anderen wirken viele der Figurinen eindeutig kaukasisch und nicht chinesisch. Ähnliche Exemplare wurden vielerorts entlang der Route von Anban ins zentralasiatische Turkmenistan gefunden, entlang des Wegs, der später zur Seidenstraße werden sollte, die China mit Rom verband. In Sibirien ist der Schamanismus eine bis heute starke Tradition. Gegen Geld rufen ekstatische Seher dort Geister herbei und sagen abenteuerlustigen Touristen die Zukunft voraus. Die Figurinen aus Anban könnten dafür sprechen, dass in chinesische Traditionen religiöser Autorität um 4000 v. u. Z. Schamanen aus dem tiefsten Zentralasien eingegangen sind. Manche Archäologen glauben sogar, dass Schamanen aus dem Fruchtbaren Halbmond, die um 10 000 v. u. Z. gelebt haben, aus der Ferne einigen Einfluss auf den Osten hatten.
Wie andere Relikte zeigen, ist das beileibe nicht ausgeschlossen. Die außergewöhnlichsten davon sind Mumien aus dem Tarim-Becken, die im Westen so gut wie unbekannt waren, bis ihnen Magazine wie Discover, National Geographic, Archaeology und Scientific American Mitte der 1990er Jahre plötzliche Publizität verschafften. Die kaukasischen Züge der Mumien scheinen zweifelsfrei zu bestätigen, dass Menschen aus Zentral- und sogar aus Westasien um 2000 v. u. Z. in die westlichen Randgebiete Chinas gezogen sind. Und – ein merkwürdiges Zusammentreffen, fast zu schön, um wahr zu sein – die im Tarim-Becken bestatteten Menschen hatten nicht nur Bärte und große Nasen wie die Figurinen von Anban, bei einigen fand man auch spitze Kopfbedeckungen (in einem Grab lagen zehn wollene Mützen).
Ein paar überraschende Funde, und schon sind alle in heller Aufregung! Doch selbst wenn man die wilderen Theorien einmal beiseite lässt, sieht es so aus, als sei die Kraft der Religion im frühen China nicht weniger bedeutsam gewesen als im Fruchtbaren Halbmond. Und wenn immer noch Zweifel bleiben, so sind zwei Entdeckungen aus den 1980er Jahren dazu angetan, sie zu zerstreuen. Bei Xishuipo in der Provinz Henan grabende Archäologen waren erstaunt, als sie in einem um 3600 v. u. Z. angelegten Grab einen erwachsenen Mann fanden, neben den Muschelschalen in der Form eines Drachens und eines Tigers gelegt worden waren. Weitere Muster aus Muscheln umgaben das Grab selbst, eines zeigt einen drachenköpfigen Tiger mit einem Hirsch auf dem Rücken und einer Spinne auf dem Kopf; ein anderes einen Mann, der auf einem Drachen reitet. Chang interpretierte den Toten als Schamanen, die ihn umgebenden Muschelmosaiken als Tiergeister, die ihm halfen, sich zwischen Himmel und Erde zu bewegen.
Eine Entdeckung in der heutigen Mandschurei, weit im Nordosten, überraschte |133|die Archäologen noch mehr. Zwischen 3500 und 3000 v. u. Z. entstand bei Niuheliang auf einer Fläche von fünf Quadratkilometern eine ganze Gruppe religiöser Stätten. In deren Zentrum lag, was die Ausgräber den »Tempel der Göttin« nannten, ein seltsamer, 18 Meter langer unterirdischer Gang mit Kammern voller Tonstatuetten: Menschen, Mischwesen aus Schwein und Drachen sowie weitere Tiere. Mindestens sechs der Statuen stellten, lebensgroß und größer, nackte Frauen dar, die mit gekreuzten Beinen sitzen. Die am besten erhaltene Frauenfigur hat rot bemalte Lippen und Augen aus blassblauer Jade – einem seltenen, schwer zu bearbeitenden Stein, der zu dieser Zeit an Stätten überall in China als Luxusgut auftaucht. Weil blaue Augen bei Chinesen selten sind, ist man leicht geneigt, diese Statuen mit den kaukasisch wirkenden Figurinen aus Anban und den Mumien aus dem Tarim-Becken in Verbindung zu bringen.
Trotz der isolierten Lage von Niuheliang liegt um den Tempel verstreut ein halbes Dutzend Ansammlungen von Gräbern. Wälle mit einem Durchmesser von 300 Metern markieren einige Gräber, und zu den Grabbeigaben gehören auch Jadeornamente, eines davon zeigt ein Drachen-Schwein. Mit allem Einfallsreichtum, den der Mangel an Beweisen in uns weckt, haben Archäologen darüber gestritten, ob die dort bestatteten Männer und Frauen Priester oder Häuptlinge waren oder vielleicht auch beides zugleich. Wie dem auch sei, die Idee, eine Minderheit der Toten – meist Männer – mit Jadegaben zu bestatten, setzte sich in ganz China durch, und um 4000 v. u. Z. begann an manchen Grabanlagen die Verehrung der Toten. Wie es aussieht, haben sich die Menschen im Osten ebenso sehr um die Ahnen gekümmert wie die im Fruchtbaren Halbmond, allerdings hat die Sorge um die Ahnen jeweils anderen Ausdruck gefunden: Im Westen hat man die Schädel von den Toten entfernt, im Osten wurden sie in Grabanlagen verehrt. An beiden Enden Eurasiens hat man größte Energie in Zeremonien investiert, die mit Göttern und Ahnen zu tun hatten, und die ersten mit Macht ausgestatteten Individuen waren offenbar jene, die Verbindung mit den unsichtbaren Welten der Ahnen und Geister aufnehmen konnten.
Durch Ackerbau bestimmte Lebensweisen – jenen ziemlich ähnlich, die einige Jahrtausende zuvor im Westen entwickelt wurden (mit allem was dazugehört: schwerer Arbeit, Vorratshaltung, Befestigungsanlagen, Ahnenkulten, Unterordnung der Frauen und Jungen unter die Männer und Alten) – waren um 3500 v. u. Z. offenbar auch im Osten fest etabliert und haben sich von den dortigen Besiedlungskernen her ausgebreitet. Auch die Verbreitung des Ackerbaus scheint sich in beiden Teilen der Welt nach ähnlichen Mustern vollzogen zu haben; zumindest ähneln sich die Expertendebatten über den jeweiligen Weltteil. Einige Archäologen gehen davon aus, dass die Menschen aus den Kerngebieten zwischen Jangtse und Gelbem Fluss durch Ostasien zogen und ihre agrikulturellen Lebensformen mitnahmen; andere denken, dass sich lokale Sammlergruppen niederließen, Pflanzen und Tiere domestizierten, miteinander Tauschhandel trieben und in großen Gebieten zunehmend ähnliche Kulturen entwickelten. Die linguistische |134|Befundlage ist ähnlich kontrovers wie in Europa; genügend genetische Daten, um irgendeine Frage zu entscheiden, gibt es nicht. Mit Bestimmtheit lässt sich allenfalls sagen, dass mandschurische Sammler in großen Siedlungen lebten und um 6000 v. u. Z. Hirse anbauten. Ab 4000 v. u. Z. wird bis weit hinauf im Jangste-Tal Reis angebaut, ab 3000 auf Taiwan und rund um das heutige Hongkong, ab 2000 im heutigen Thailand und in Vietnam. Um diese Zeit verbreitete sich der Reisanbau auch auf der Malaiischen Halbinsel und über das Chinesische Meer hinweg auf den Philippinen und Borneo (Abbildung 2.8).
So wie im Westen erlitt die Ausbreitung des Ackerbaus auch im Osten einige Rückschläge. Wie Phytolithen zeigen, war im heutigen Korea Reis gegen 4400 v. u. Z., Hirse gegen 3600 bekannt; Letztere erreichte Japan um 2600. Doch die prähistorischen Koreaner und Japaner ignorierten diese Neuerungen weitere 2000 Jahre lang. Auch koreanische und japanische Küstengebiete boten offenbar reiche Ressourcen aus dem Meer, die, wie riesige Haufen weggeworfener Muschelschalen zeigen, große Dauersiedlungen ernährten. Diese im Überfluss lebenden Sammler entwickelten verfeinerte Kulturen und verspürten offenbar keinerlei Drang, sich der Bestellung des Bodens zu widmen. Wie die Sammler und Jäger an der Ostsee zwischen 5200 und 4200 v. u. Z. waren auch deren asiatische Kollegen zahlreich und entschlossen, die Kolonisten zu vertreiben, die ihnen das Land streitig machen wollten, doch so zahlreich auch wieder nicht, als dass Hunger sie zum Ackerbau veranlasst hätte.
In Korea wie in Japan war der Übergang zum Ackerbau verbunden mit dem Auftauchen von Waffen aus Metall – aus Bronze in Korea um 1500 v. u. Z., aus Eisen in Japan um 600 v. u. Z. So wie europäische Archäologen darüber streiten, ob es ein Druck oder ein Sog war, der den reichen Sammlergesellschaften um die Ostsee ein Ende machte, so denken einige Asianisten, dass diese Metallwaffen Eindringlingen gehörten, die mit ihren Überfällen auch den Ackerbau verbreiteten, während andere davon ausgehen, dass es innere Wandlungsprozesse waren, die Wildbeutergesellschaften verändert haben, woraufhin plötzlich Metallwaffen interessant wurden.
Um 500 v. u. Z. waren Reisfelder auf Japans südlicher Insel Kyushu verbreitet, doch die Ausbreitung des Ackerbaus erlitt auf der Hauptinsel Honshu einen weiteren Rückschlag. Und bis er im Norden auf Hokkaido, wo die Möglichkeiten des Nahrungsammelns besonders üppig waren, Fuß fassen konnte, dauerte es weitere 1200 Jahre. Zuletzt aber verdrängte der Ackerbau das Jagen und Sammeln in Asien ebenso gründlich wie im Westen.
Wie können wir uns all das erklären? Gewiss waren Osten und Westen unterschiedlich, von den Nahrungsmitteln, die die Menschen zu sich nahmen, bis hin zu den Göttern, die sie verehrten. Niemand könnte Jiahu mit Jericho verwechseln. Aber waren die kulturellen Gegensätze wirklich so stark, dass sich daraus die Vorherrschaft des Westens erklären ließe? Oder waren die unterschiedlichen kulturellen Traditionen nur zwei Wege, das Gleiche zu tun? Tabelle 2.1 fasst die Befunde zusammen. Dabei, so denke ich, fällt dreierlei sofort auf.

Abbildung 2.8: Gehet hin und mehret euch, Version II
Die Ausbreitung des Ackerbaus aus den Tälern von Jangtse und Gelbem Fluss heraus, 6000 bis 1500 v. u. Z.
Erstens: Wenn die vor 10 000 Jahren im Fruchtbaren Halbmond geschaffene Kultur, von der die späteren westlichen Gesellschaften abstammen, tatsächlich |136|ein größeres Potenzial für die gesellschaftliche Entwicklung hatte als die im Osten geschaffene Kultur, sollten wir eigentlich auf dieser Tabelle größere Unterschiede zwischen beiden entdecken können. Das ist aber nicht der Fall. Tatsächlich geschah in Ost und West so ziemlich das Gleiche. Beide Regionen erlebten die Domestizierung von Hunden, die Kultivierung von Pflanzen und die Domestizierung von großen (über 50 Kilogramm schweren) Tieren. In beiden kam es zur schrittweisen Entwicklung der »Voll-Landwirtschaft« (womit ich ertragreiche, arbeitsintensive Systeme mit vollständig domestizierten Pflanzen, mit Reichtum und Geschlechterhierarchie meine), zum Aufstieg großer Siedlungen (mit über 100 Bewohnern) und, nach weiteren 2000 bis 3000 Jahren, von Städten (mit über 1000 Einwohnern). Menschen beider Regionen errichteten ausgeklügelte Bauwerke und Befestigungen, experimentierten mit Vorformen von Schrift, mit in wunderschönen Mustern bemalter Keramik, beide legten üppige Grabstätten an, lebten im Bann von Ahnen und Menschenopfern, beide verbreiteten ihre agrikulturellen Lebensweisen (zunächst langsam, nach 2000 Jahren dann beschleunigt, bis sie auch die reichsten Wildbeutergemeinschaften überwanden).
Zweitens: In Ost und West geschah nicht nur das Gleiche, es geschah auch in mehr oder weniger gleicher Reihenfolge. In Tabelle 2.1 habe ich das mit Linien illustriert, die in beiden Regionen parallele Entwicklungen miteinander verbinden. Die meisten dieser Linien weisen ein in etwa gleiches Gefälle auf, wobei der jeweilige Entwicklungsschritt zunächst im Westen geschieht und sich dann, rund 2000 Jahre später, im Osten wiederholt. Das spricht sehr dafür, dass die Entwicklungen in beiden Regionen einer gemeinsamen kulturellen Logik folgten, dass gleiche Ursachen an beiden Enden Eurasiens gleiche Folgen hatten. Der einzige wirkliche Unterschied ist der, dass der Prozess im Westen 2000 Jahre früher begonnen hat.
Drittens: Gleichwohl ist keiner meiner beiden ersten Punkte vollständig richtig. Es gab Ausnahmen von der Regel. Erste Keramikgefäße entstanden im Osten mindestens 7000 Jahre früher als im Westen; reich ausgestattete Gräber gab es 1000 Jahre früher. Umgekehrt bauten die Leute im Westen monumentale Heiligtümer über 6000 Jahre früher als die im Osten. Wer nun der Meinung ist, diese Unterschiede von Osten und Westen basierten auf unterschiedlichen Wegen kultureller Entwicklung, die wiederum erklären würden, warum der Westen vorherrscht, der müsste darlegen, warum Töpferei, Gräber und Heiligtümer so große Bedeutung gewinnen konnten; andererseits müssten alle, die (wie ich zum Beispiel) davon ausgehen, dergleichen habe keine wirkliche Bedeutung gehabt, ihrerseits erklären, warum es zu diese Abweichungen vom allgemeinen Muster kam.
Darüber, warum Keramik im Osten so früh auftaucht, sind sich die meisten Archäologen einig: Die dort verfügbaren Nahrungsmittel machten das Kochen erforderlich. Die Menschen im Osten brauchten Behältnisse, die sie aufs Feuer setzen konnten, und lernten darum früh, Ton zu brennen. Wenn dem so war, müssten wir vielleicht überlegen, ob nicht Unterschiede in der Nahrungszubereitung Ost und West auf unterschiedliche Entwicklungsschienen gesetzt haben.
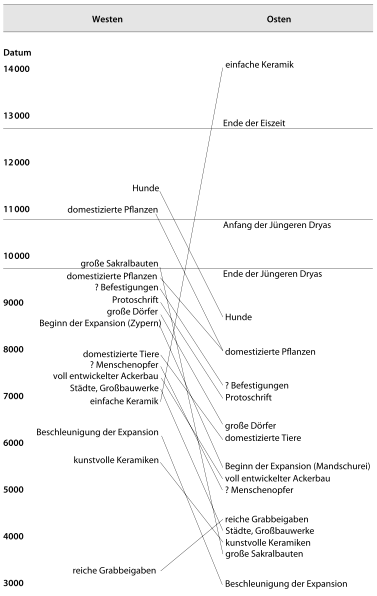
Tabelle 2.1: Ein Vergleich der Anfänge im Westen und im Osten
|138|Vielleicht hat ja die westliche Art des Garens mehr Nährstoffe erschlossen, die Menschen also stärker gemacht. Aber das ist nicht wirklich überzeugend. Anatomische Studien geben ein eher düsteres Bild des Lebens in den landwirtschaftlichen Kerngebieten sowohl des Ostens als auch des Westens. Es war, wie der englische Philosoph Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert schrieb, »ein einsames, kümmerliches, rohes und kurzdauerndes Leben« (wenn auch nicht notwenig brutal). Im Osten wie im Westen waren die ersten Ackerbauern unterernährt, verkümmert, sie schleppten eine Menge Parasiten mit sich herum, hatten schlechte Zähne und starben früh. In beiden Regionen haben Neuerungen in der Landwirtschaft die Ernährung verbessert; und in beiden Regionen entwickelten sich in den Führungsschichten einfallsreichere Küchenpläne. Dass der Osten vom Kochen abhing, war nur einer unter vielen Unterschieden in der Nahrungszubereitung; insgesamt jedoch überwiegen die Ähnlichkeiten in der Ernährung die Unterschiede bei weitem.
Vielleicht aber führten die Unterschiede in der Nahrungszubereitung zu unterschiedlichen Mustern der Nahrungsaufnahme und damit auch zu unterschiedlichen Familienstrukturen, mit langfristigen Folgen. Doch auch das ist nicht sehr wahrscheinlich. Die frühesten Ackerbauern in Ost und West haben ihre Nahrungsmittel offenbar gemeinsam gelagert, zubereitet und wohl auch verzehrt; erst in den darauf folgenden Jahrtausenden haben sie das auf kleinerer Familienebene gemacht. Und auch dabei überwiegen die Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West die Unterschiede. Die frühe Erfindung der Keramik im Osten ist gewiss ein interessanter Unterschied, doch zur Erklärung, warum der Westen die Welt regiert, scheint er nichts Wesentliches beizutragen.
Und was ist mit der frühen Anlage aufwändiger Gräber im Osten? Was mit der noch früheren Anlage aufwändiger Heiligtümer im Westen? Ich vermute, dass diese Entwicklungen einander Spiegelbilder sind. Beide stehen sie, wie wir gesehen haben, in engem Zusammenhang mit dem Ahnenkult, der sich herausbildete und intensiver wurde, als der Ackerbau das, was die Toten hinterließen, zum wichtigsten Faktor des wirtschaftlichen Lebens machte. Aus Gründen, die wir wahrscheinlich niemals verstehen werden, haben die Menschen im Osten und im Westen verschiedene Formen dafür gefunden, den Ahnen Dank abzustatten und mit ihnen in Verbindung zu treten. Einige Gruppen im Westen hatten wohl die Vorstellung, dies ließe sich am besten bewerkstelligen, wenn man die Schädel verstorbener Verwandter herumreichte, Gebäude mit Stierschädeln und Säulen anfüllte und darin Menschen opferte; die im Osten fühlten sich offenbar besser, wenn sie mit ihren Verwandten aus Jade geschnitzte Tierfiguren begruben, die Grabstätten verehrten und schließlich andere Menschen köpften und zu den Toten in die Gräber stießen. Unterschiedliche Einfälle unterschiedlicher Menschen, aber ähnliche Wirkungen.
Zwei Schlüsse, denke ich, lassen sich aus Tabelle 2.1 ziehen. Erstens: Die frühen Entwicklungen in den westlichen und östlichen Kerngebieten waren einander |139|zumeist ziemlich ähnlich. Ich möchte die tatsächlichen Unterschiede nicht herunterspielen, die sich, von der Machart der Steinwerkzeuge bis zu den Pflanzen und Tieren, die die Menschen verzehrten, überall zeigen, doch keiner dieser Unterschiede spricht sonderlich für eine Theorie langfristiger Determinierung, von der zu Anfang die Rede war; keiner spricht dafür, dass irgendetwas auf dem Weg, den die westliche Kultur nach der letzten Eiszeit einschlug, dieser mehr Potenziale verschafft hätte als der östlichen und dass aus diesem Grund der Westen die Welt regiert. Diese These ist offensichtlich falsch.
Wenn sich angesichts der in Tabelle 2.1 dargestellten Fakten überhaupt eine der Theorien langfristiger Determinierung halten lässt, dann nur die simpelste von allen: Der Westen hat in seiner Entwicklung dank geographischer Vorteile einen 2000-jährigen Vorsprung gehabt und diesen lange genug gehalten, um als Erster bei der Industrialisierung anzulangen, und kann darum die Welt beherrschen. Um diese Theorie zu überprüfen, um zu sehen, ob es sich tatsächlich so verhält, müssen wir unseren Ost-West-Vergleich auf jüngere Epochen ausdehnen.
Das klingt ziemlich einfach. Doch die zweite Lehre, die sich aus Tabelle 2.1 ziehen lässt, ist, dass kulturübergreifende Vergleiche ihre Tücken haben. Das Auflisten bedeutsamer Veränderungen in zwei Spalten taugte für den Anfang, denn wir mussten, um die Anomalien der Gegenüberstellung zu deuten, Kochen und Backen, Schädel und Gräber in einen Zusammenhang bringen. Nur so konnten wir herausfinden, was sie innerhalb der prähistorischen Gesellschaften bedeutet haben mögen. Und das stürzt uns in eines der zentralen Problemfelder von Kulturanthropologie oder Ethnologie: das komparative Studium unterschiedlicher Gesellschaften.
Als europäische Missionare und Beamte im 19. Jahrhundert damit begannen, Informationen über die Völker in ihren kolonialen Imperien zu sammeln, wunderten sich Wissenschaftler über diese Berichte und Darstellungen ausländischer Sitten. Kulturanthropologen1* haben diese Aktivitäten katalogisiert, haben Überlegungen angestellt zu ihrer Verbreitung rund um den Globus und auch darüber, was sie uns sagen könnten über die Entwicklung zivilisierteren Verhaltens (womit letztlich natürlich europäisches Verhalten gemeint war). Sie schickten neugierige Studenten in exotische Gegenden, um weitere Beispiele zu sammeln. Einer dieser aufgeweckten jungen Männer war Bronislaw Malinowski, ein Pole, der in London studiert hatte und sich auf den Trobriand-Inseln aufhielt, als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach. Er fand kein Schiff, mit dem er hätte nach Hause fahren können, |140|also tat Malinowski das in seiner Lage einzig Vernünftige. Statt sich verstimmt in sein Zelt zurückzuziehen, suchte er sich eine Freundin. Und so lernte er bis 1918 die Kultur der Trobriander von innen heraus zu verstehen. Er begriff, was den Professoren in ihrer reinen Büchergelehrsamkeit entgehen musste: Ethnologie bedeutet zu verstehen, wie die Sitten einer Kultur zusammenpassen. Vergleichen lassen sich Kulturen nur in ihrer Gesamtfunktion, nicht aber einzelne, aus dem Zusammenhang gerissene Praktiken, denn ein und dasselbe Verhalten kann in unterschiedlichen Kontexten ganz unterschiedliche Bedeutung haben. So kann dich das Tätowieren des Gesichts in Kansas zum Beispiel zum Rebellen machen, in Neuguinea dagegen erweist es dich als Konformisten. Ähnlich kann die gleiche Vorstellung in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlichen Ausdruck finden, so wie das Weitergeben von Schädeln und das Bestatten von Jade im prähistorischen Westen und Osten gleichermaßen Verehrung der Ahnen bedeutet.
Malinowski hätte Tabelle 2.1 missbilligt. Wir können, hätte er gesagt, aus zwei funktionierenden Kulturen keine Wundertüte von Sitten machen und anhand dieser beurteilen, welche der beiden Kulturen besser abschneidet. Und ganz sicher können wir auch keine Bücher schreiben mit Kapiteln wie »Der Westen übernimmt die Führung«. Was eigentlich, so hätte er gefragt, wollen wir mit »führen« sagen? Wie um alles in der Welt könnten wir rechtfertigen, aus dem nahtlosen Gewebe des Lebens einfach spezifische Praktiken herauszulösen und diese gegeneinander abzuwägen? Und selbst wenn wir die Wirklichkeit derart auflösen könnten, woher sollten wir wissen, welche Bruchstücke wir miteinander vergleichen dürfen?
Allesamt triftige Fragen, und wir müssen sie beantworten, wenn wir erklären wollen, warum der Westen die Welt regiert – selbst wenn die Suche nach Antworten Ethnologie und Kulturanthropologie in den letzten 50 Jahren schier zerrissen hat. Mit einiger Beklemmung stürze ich mich nun in diese aufgewühlten Gewässer.