»Die steigende Flut hebt alle Schiffe«, hat John F. Kennedy einmal gesagt.1 Und nie hatte dieser Satz mehr Gültigkeit als in den 300 Jahren zwischen 1500 und 1800, als das Schiff der gesellschaftlichen Entwicklung im Westen wie im Osten unaufhaltsam nach oben getragen wurde (Abbildung 9.1.). Um 1700 stieß es hier wie da an die Obergrenze, die bis dahin bei 43 Punkten gelegen hatte, um 1750 ließ es diese bereits hinter sich.
Kennedys berühmt gewordener Ausspruch stammt aus einer Rede, die er anlässlich der Einweihung eines neuen Staudamms in Herber Springs, Arkansas, gehalten hat. Das Projekt wurde von seinen Gegnern als Wahlkreisgeschenk erster Güte kritisiert: Klar, sagten sie, die steigende Flut hebt alle Schiffe, aber manche hebt sie schneller als andere. Auch das hatte zwischen 1500 und 1800 mehr Gültigkeit als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Im Osten beschleunigte sich die gesellschaftliche Entwicklung um ein Viertel, aber im Westen stieg sie doppelt so schnell an. 1773 (oder irgendwann zwischen 1750 und 1800, wenn man eine vernünftige Fehlertoleranz zugrunde legt) zog der Westen hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Entwicklung am Osten vorbei und beendete damit das 1200 Jahre währende Zeitalter des Ostens.
Historiker streiten erbittert um die Fragen, warum die Flut nach 1500 weltweit so rasant anstieg und warum sich das Schiff des Westens als so besonders auftriebsstark erwies. In diesem Kapitel versuche ich zu zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Fragen gibt und dass, wenn man sie im richtigen, nämlich langfristigen Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung betrachtet, die Antworten darauf gar nicht mehr so sehr im Dunkeln liegen.
Es dauerte eine Weile, bis das Schicksal von Tomé Pires verwunden war. Erst 1557 fingen chinesische Beamte an, die portugiesischen Kaufleute zu tolerieren, die ihre Geschäfte in Macao eröffneten (Abbildung 9.2.), und obwohl die Niederlassungen der Portugiesen an den Küsten Asiens sich 1570 bereits bis ins japanische Nagasaki |420|erstreckten, blieben sie zahlenmäßig doch ein jämmerlich kleines Häufchen. Für die meisten Europäer blieben die Länder des fernen Ostens sagenumwobene Orte, für die meisten Asiaten war Portugal nicht einmal das.
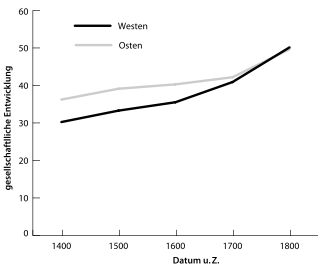
Abbildung 9.1: Manche Schiffe schwimmen besser als andere
Im 18. Jahrhundert trieb die steigende Flut der sozialen Entwicklung den Osten wie den Westen über den Pegel hinaus, der bis dahin die Obergrenze organischer Wirtschaftssysteme gebildet hatte. Aber den Westen trieb sie stärker, weiter und schneller voran. Dem Index zufolge übernahm der Westen 1773 wieder die Führung.
Wenn diese europäischen Abenteurer im 16. Jahrhundert überhaupt einen Einfluss auf das Leben der Menschen im Osten hatten, dann wegen der erstaunlichen Pflanzen aus der Neuen Welt – Mais, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Erdnüsse –, die sie im Gepäck hatten. Sie gediehen da, wo sonst nichts wuchs, hielten auch dem schlechtesten Wetter stand und sättigten die Bauern und ihre Tiere aufs Angenehmste. Im Laufe des 16. Jahrhunderts wurden von Irland bis zum Gelben Fluss Millionen Hektar Land damit bepflanzt.
Vermutlich kamen sie gerade zur rechten Zeit. Das 16. Jahrhundert war kulturell ein goldenes Zeitalter für den Osten wie für den Westen. In den 1590er Jahren (zugegebenermaßen einem besonders guten Jahrzehnt) konnten sich die Bürger Londons Theaterstücke wie Shakespeares König Heinrich der Fünfte, Julius Caesar und Hamlet ansehen oder sie konnten preiswerte religiöse Traktate wie John Foxes blutrünstig bebildertes Buch der Märtyrer lesen, die zu Tausenden aus den neuen Druckerpressen kamen. Auf der anderen Seite Eurasiens konnten die Bewohner Beijings den zwanzigstündigen Päonien-Pavillon von Tang Xianzu, die bis heute |421|meistaufgeführte klassische chinesische Oper, bestaunen oder sich in die Lektüre der Reise nach Westen vertiefen (der Saga in hundert Kapiteln von einem Affen, einem Schwein und einem Shrek-ähnlichen Dämon namens Sha Wujing, die im 7. Jahrhundert einen Mönch auf seiner Suche nach Buddha nach Indien begleiten und ihn unterwegs aus zahllosen Gefahrensituationen retten).

Abbildung 9.2: Eine dicht besiedelte Welt
Der Osten in der Zeit der steigenden Flut, 1500–1700
Aber hinter der glänzenden Fassade lag einiges im Argen. Der Schwarze Tod hatte mindestens ein Drittel der Bevölkerung in den Kerngebieten des Westens und des Ostens dahingerafft, und nach 1350 hemmten immer neue Epidemien ein Jahrhundert lang ein neuerliches Wachstum der Bevölkerung. Zwischen 1450 und 1600 stieg jedoch die Zahl der hungrigen Mäuler hier wie dort auf nahezu das Doppelte an. »Die Bevölkerungszahl ist so hoch wie noch niemals zuvor in |422|der Geschichte«, wusste ein chinesischer Gelehrter 1608 zu berichten.2 Im fernen Frankreich machte man die gleiche Beobachtung. Hier vermehrten sich die Menschen »wie Mäuse in der Scheune«, wie man im Languedoc zu sagen pflegte.
Angst war immer ein Antriebsmotor der gesellschaftlichen Entwicklung. Mehr Kinder bedeuteten kleinere Ackerparzellen oder mehr Erben, die in die Röhre guckten, und sie bedeuteten unweigerlich größere Sorgen. Die Bauern jäteten und düngten ihre Felder häufiger, stauten Bäche, bohrten Brunnen, webten mehr Stoff und versuchten mehr Kleidungsstücke zu verkaufen. Viele ließen sich in Randgebieten nieder und rangen steinigen Hängen und versandeten Böden, die ihre Eltern keines Blickes gewürdigt hätten, das Nötigste für ein noch so karges Leben ab. Andere kehrten den dicht besiedelten Kerngebieten den Rücken und ließen sich in abgelegenen, von jeglicher Zivilisation noch unberührten Grenzregionen nieder. Doch auch wenn sie die Wunderpflanzen aus der Neuen Welt anbauten, schienen die Erträge nie zu reichen.
Das 15. Jahrhundert, in dem es wenig Arbeitskräfte, dafür aber umso mehr fruchtbares Land gegeben hatte, verblasste allmählich zur undeutlichen Erinnerung: glückliche Tage, Fleisch vom Rind und vom Schwein, Krüge voll Bier und Wein. Damals, so bemerkte der Präfekt eines Landkreises in der Nähe von Nanjing im Jahr 1609, sei alles besser gewesen: »Die Menschen waren vollkommen autark: Jede Familie besaß ein Wohnhaus, ein Stück Land für den Ackerbau, einen Hang zum Sammeln von Feuerholz sowie einen Garten für die Gemüsezucht.« Doch nun sei alles anders: »Neun von zehn Menschen sind verarmt, die Habgier kennt keine Grenzen, Menschen fügen ihresgleichen Schaden zu … welch ein Jammer!«3 Und in Deutschland war die Situation Mitte des 16. Jahrhunderts ähnlich drastisch: »In Schwaben hat sich laut Heinrich Müller (1550) die Ernährung des Landvolks drastisch verschlechtert. Anstelle der reichlichen Mahlzeiten von einst, die täglich Fleisch umfassten und an Festtagen wie Kirchweih zur Schlemmerei ausarteten, machen sich überall Teuerung und Mangel bemerkbar. Selbst die Kost der reichsten Bauern, so der Autor, ist fast schlechter als die der Tagelöhner und Knechte von anno dazumal.«4
In dem englischen Märchen Dick Whittington und seine Katze (das wie viele solcher Geschichten seinen Ursprung im 16. Jahrhundert hat) findet ein armer Junge vom Land sein Glück in London, aber im wirklichen Leben kamen viele der hungrigen Millionen, die es auf der Suche nach Arbeit in die Großstädte verschlug, nur vom Regen in die Traufe. Abbildung 9.3 zeigt, wie sich die städtischen Reallöhne (das heißt die Kaufkraft der Verbraucher, angepasst an inflationäre Prozesse) nach 1350 entwickelten. Die grafische Darstellung stützt sich auf die Ergebnisse von Wirtschaftshistorikern, die in jahrelanger detektivischer Arbeit bruchstückhafte alte Aufzeichnungen entziffert haben, niedergeschrieben in einem babylonischen Gewirr von Sprachen und einem noch größeren Durcheinander von Maßeinheiten. Erst seit dem 14. Jahrhundert wurde statistisches Zahlenmaterial in europäischen Archiven so dokumentiert, dass man daraus genauer auf die Einkommensentwicklung |423|schließen kann, für China gilt dies erst von 1700 an. Aber trotz der lückenhaften Dokumentation und der vielen sich überschneidenden Linien ist zumindest für den Westen eine eindeutige Tendenz zu erkennen. In dem Jahrhundert nach der großen Pestepidemie verdoppelten sich die Löhne in etwa in allen Gebieten, aus denen uns Zahlen vorliegen, fielen jedoch, als die Bevölkerung wieder zu wachsen begann, fast wieder auf den Stand zurück, auf dem sie vor dem Schwarzen Tod gewesen waren. Die Florentiner, die in den 1420er Jahren die Steine für Filippo Brunelleschis Kathedrale schleppten und ihre mächtige Kuppel errichteten, ließen sich Fleisch, Käse und Oliven schmecken; die Männer, die 1504 Michelangelos David an seinen Standort wuchteten, mussten sich mit trockenem Brot begnügen. Ein Jahrhundert später konnten sich ihre Urenkel glücklich schätzten, wenn sie auch nur das bekamen.
Mittlerweile hatte der Hunger Eurasien fest im Griff. Eine schlechte Ernte, eine falsche Entscheidung oder einfach nur Pech konnten eine arme Familie zwingen, sich von dem zu ernähren, was sie mühselig ergattern mussten: in China Spreu und Bohnenhülsen, Baumrinde und Wildkräuter, in Europa Kohlstrünke, Wildkräuter und Gras. Kamen mehrere ungünstige Umstände zusammen, konnte dies zur Folge haben, dass Tausende ihre Nahrung auf der Straße zusammenbetteln mussten und dass die Schwächsten verhungerten. Es ist sicher kein Zufall, dass die Protagonisten der ältesten europäischen Volksmärchen (wie beispielsweise Dick Whittington) nicht von goldenen Eiern und gen Himmel wachsenden Zauberbohnen träumten, sondern von echten Eiern und echten Bohnen. Ein voller Magen war alles, was sie sich von den guten Feen wünschten.
Im Westen wie im Osten verhärteten diejenigen, die sich noch leidlich über Wasser halten konnten, ihr Herz gegen Bettler und Vagabunden, die sie in Armenhäuser und Gefängnisse steckten, in unwirtliche Grenzregionen abschoben oder in die Sklaverei verkauften. Das war zwar herzlos, ganz ohne Zweifel, aber die Menschen, denen es nur ein bisschen besser ging, fühlten sich von ihren eigenen Sorgen derart bedrängt, dass sie sich nicht um das Schicksal anderer kümmern konnten. Wenn die Zeiten schlecht sind, schrieb 1545 ein Mann im Jangtse-Delta an einen Freund, »wird den Ärmsten die Steuerschuld erlassen, aber die Wohlhabenden werden so geschröpft, dass sie ebenfalls verarmen«5. Den Kindern ehemals angesehener Familien drohte ein unaufhaltsamer sozialer Abstieg.
Die Söhne der Adeligen suchten sich neue Betätigungsfelder, um in dieser kälter gewordenen Welt um Wohlstand und Macht zu wetteifern, und ihre offene Missachtung der Traditionen empörte die Konservativen im Lande. »Immer häufiger werden ausgefallene Kleider und Hüte getragen«, bemerkte ein chinesischer Beamter indigniert, »und es gibt sogar einige, die Kaufleute werden!«6 Schlimmer noch, ließ sich einer seiner Kollegen vernehmen, selbst ehemals ehrbare Leute
sind verrückt nach Reichtum und Einfluss. … Sie gefallen sich darin, Beschuldigungen zur Anzeige zu bringen, und benutzen ihre Macht, um ihre Argumente mit solchem |424|Nachdruck vorzutragen, dass man nicht mehr zwischen Rechtschaffenheit und Betrug unterscheiden kann. Verschwenderisch und vorzugsweise elegant gekleidet wandern sie in ihren weißen Seidengewändern umher, sodass man kaum noch sagen kann, wer ein Ehrenmann ist und wer ein Schuft.7
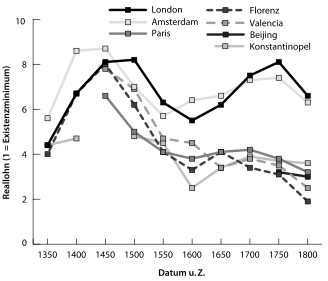
Abbildung 9.3: Arm oder reich
Die Entwicklung der Reallöhne ungelernter Arbeiter in sechs europäischen Städten sowie in Beijing von 1350–1800. Jede Stadt und jedes Gewerbe hat ihre beziehungsweise seine eigene Geschichte, aber wo immer eine Auswertung möglich ist, zeigt sich, dass die Kaufkraft der Arbeiter, nachdem sie sich zwischen 1350 und 1450 verdoppelt hatte, bis 1550 oder 1600 wieder auf den Stand zurückfiel, den sie vor 1350 gehabt hatte. Aus Gründen, die sich im Laufe dieses Kapitels noch erschließen werden, entfernt sich die Kurve der Großstädte im Nordwesten Europas von 1600 an immer weiter von allen anderen. (Für Paris und Valencia liegen Daten erst von 1450, für Beijing von 1750 an vor, und im Zahlenmaterial für Konstantinopel klafft verständlicherweise um 1453, als die Osmanen die Stadt eroberten, eine Lücke.) Daten aus Allen 2006 b.
Große Unruhe herrschte insbesondere unter den Beamten. Die Ränge des Adels blähten sich immer mehr auf, aber die Zahl der Beamtenposten stieg nicht an, und als die dornigen Tore zur Bildung sich als zunehmend undurchlässig erwiesen, fanden die Wohlhabenden Mittel und Wege zu bewirken, dass Reichtum mehr zählte als Gelehrsamkeit. »Arme Studenten, die einen Platz bei den Prüfungen zu ergattern hofften, wurden von den Beamten abgewiesen, als wären sie Flüchtlinge und Hungerleider«, klagte ein Provinzbeamter.8
|425|Es waren harte Zeiten, sogar an der Spitze der Hierarchie, für die Monarchen selbst. Theoretisch waren steigende Bevölkerungszahlen gut für die Regierung – mehr Bürger, denen man Steuern aufbürden, mehr Soldaten, die man zum Dienst verpflichten konnte –, aber in der Praxis lagen die Dinge nicht so einfach. Hungernde Bauern, die keinen Ausweg mehr sahen, konnten aufbegehren, statt brav ihre Steuern zu zahlen, und der aufsässige, untereinander zerstrittene Adel tat es ihnen nicht selten gleich. (Vor allem Beamtenanwärter, die in den Prüfungen durchgefallen waren, entwickelten eine bemerkenswerte Vorliebe dafür, als Rebellen wieder in Erscheinung zu treten).
Das Problem war so alt wie die Regierungsform der Monarchie selbst, und die meisten Könige des 16. Jahrhunderts griffen auf altbewährte Lösungsstrategien zurück: Zentralisierung und Expansion. Japan war in dieser Hinsicht ein Extrembeispiel. Hier war die politische Führung im 15. Jahrhundert vollkommen zusammengebrochen. Dörfer, buddhistische Klöster und sogar einzelne Stadtteile hatten eigene Regierungen ausgerufen und Schlägertrupps angeheuert, die für ihre Sicherheit sorgen oder die Nachbarschaft ausplündern sollten.1* Im 16. Jahrhundert wuchs die Bevölkerung an, es entbrannten erbitterte Kämpfe um die Ressourcen, und aus dem Heer kleinerer Regenten traten einige große Gebieter hervor. Die ersten portugiesischen Gewehre erreichten Japan 1543 (eine Generation früher also als die Portugiesen selbst), und in den 1560er Jahren waren japanische Waffenschmiede in der Lage, hervorragende eigene Musketen herzustellen – gerade rechtzeitig, um den ohnehin schon mächtigen Herren, die es sich leisten konnten, ihre Krieger zu bewaffnen, zu noch mehr Macht zu verhelfen. Im Jahr 1582 machte sich einer der Feldherren, Toyotomi Hideyoshi, faktisch zum Shogun über das gesamte Inselreich.
Hideyoshi rief seine zerstrittenen Landsleute auf, alle Waffen abzuliefern, und versprach ihnen, diese einzuschmelzen und aus dem Metall die größte Buddhastatue der Welt zu gießen. Das, so erklärte er, gereiche »zum Wohle der Menschen nicht nur in diesem, sondern auch im jenseitigen Leben«9. Welche religiösen Motive er auch immer gehabt haben mag – eines lag auf der Hand: Die Entwaffnung der Bevölkerung war ein gewaltiger Schritt hin zur Zentralisierung des Staates, bot sie der Regierung doch eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine Volkszählung durchzuführen, das Land zu vermessen, Steuern festzulegen und Personen zum Kriegsdienst zu verpflichten. Fünf Jahre später sah Hideyoshi die Lösung aller seiner Probleme in der Expansion und beschloss daher, China zu erobern. Abermals fünf Jahre später landeten seine Truppen – etwa eine Viertelmillion Mann stark und mit modernsten Musketen bewaffnet – in Korea, wo sie zunächst alles niederwalzten, was sich ihnen in den Weg stellte.
Das Chinesische Reich war in der Expansionsfrage tief gespalten. Einige Ming-Kaiser bemühten sich wie Hideyoshi in Japan, ihren maroden Haushalt zu sanieren |426|und zu expandieren. Sie führten Volkszählungen durch, versuchten auszutüfteln, wer wofür Steuern zu entrichten hatte, und wandelten komplizierte Arbeits- und Getreideabgabeverpflichtungen in einfache Silberzahlungen um. Die Beamten jedoch lehnten solche Umtriebe mit überwältigender Mehrheit ab. Jahrhundertealte Traditionen, so argumentierten sie, hätten gezeigt, dass der ideale Herrscher still (und kostengünstig) im Zentrum des Geschehens sitze und das Land durch sein moralisches Vorbild regiere. Er führe keine Kriege, und noch weniger schröpfe er den Landadel, die Familien also, denen die meisten Beamten entstammten. Volkszählungen und Steuerregister, diese Lieblingssteckenpferde des Japaners Hideyoshi, könne man getrost vergessen.
Tatendurstigere Kaiser rieben sich in diesem bürokratischen Sumpf auf. Manchmal war das, was bei ihren Bemühungen herauskam, komisch. Als beispielsweise Kaiser Zhengde 1517 darauf beharrte, gegen die Mongolen in den Krieg zu ziehen, scheiterte er am diensthabenden Beamten an der Großen Mauer, der sich weigerte, die Tore zu öffnen, weil ein Kaiser nach Beijing gehöre. Manchmal entbehrten die Dinge aber auch jeglicher Komik. So ließ Zhengde bei anderer Gelegenheit seine leitenden Beamten wegen Aufsässigkeit auspeitschen, was einige von ihnen das Leben kostete.
Die wenigsten Kaiser verfügten über die Tatkraft eines Zhengde, und anstatt gegen Beamte und Landadelige mobil zu machen, ließen sie die Steuerlisten vor sich hin modern. Als ihnen das Geld ausging, zahlten sie keinen Sold mehr an die Truppen (1569 musste der stellvertretende Kriegsminister eingestehen, dass nur noch ein Viertel der in den Soldbüchern registrierten Soldaten auffindbar waren). Schließlich war es billiger, die Mongolen zu bestechen, als mit ihnen Krieg zu führen.
Auch die Zahlungen an die Kriegsflotte wurden eingestellt, obwohl dieser die Aufgabe oblag, den ausufernden Schwarzmarkt zu zerschlagen, der entstanden war, nachdem Hongwu im 14. Jahrhundert den privaten Seehandel verboten hatte. Entlang der Küste tätigten chinesische, japanische und portugiesische Schmuggler in Piratenmanier ihre lukrativen Geschäfte, deckten sich mit den modernsten Gewehren ein und schlugen damit die schlecht ausgerüstete Küstenwache, die ihnen das Handwerk legen sollte, mühelos in die Flucht. Nicht, dass sich die Küstenwache allzu große Mühe gegeben hätte; Schmiergelder von Schmugglern gehörten zu den Haupteinnahmequellen der Soldaten.
Die Szenerie an Chinas Küste ähnelte zunehmend bestimmten US-amerikanischen Krimiserien, in denen skrupellose Verbrecher, lokale Würdenträger und zwielichtige Politiker in einem Filz schmutziger Geschäfte miteinander verbunden sind. Ein rechtschaffener, aber reichlich naiver Gouverneur bekam dies am eigenen Leib zu spüren, als er, das Gesetz befolgend, eine Bande von Schmugglern hinrichten ließ, obwohl einer von ihnen der Onkel eines Richters war. Der Richter ließ sozusagen die Drähte glühen, der Gouverneur wurde seines Amtes enthoben und beging Selbstmord, als der Kaiser einen Haftbefehl für ihn ausstellte.
|427|In den 1550er Jahren verlor die Regierung endgültig die Kontrolle über die Küste. Aus Schmugglern wurden Piratenkönige, die 20 Städte beherrschten und sogar drohten, die kaiserlichen Gräber in Nanjing zu plündern. Am Ende bedurfte es einer ganzen Reihe politisch umsichtiger und unbestechlicher Personen, um ihrem Treiben ein Ende zu setzen. Mit einer 3000 Mann starken Geheimtruppe (nach Qi Jiguang, dem Anführer dieses Fähnleins der Aufrechten, »Qis Heer« genannt) führten die Reformer manchmal mit, manchmal auch ohne Unterstützung der Regierung einen Schattenkrieg, finanziert mit Hilfe von Steuergeldern einer städtischen Oberschicht, die ein Präfekt aus Yangzhou abzweigte und ihnen heimlich zukommen ließ. Qis Heer lieferte den Beweis, dass der Staat immer noch in der Lage war, sich gegen seine Feinde zu behaupten, sofern nur der Wille dazu vorhanden war, und sein Erfolg leitete eine (kurze) Phase der Reformen ein. Nach Nordchina versetzt, revolutionierte Qi die Verteidigungsanlagen der Großen Mauer, indem er Wehrtürme errichten2* und mit gut ausgebildeten Schützen bemannen ließ und diese durch Kampfwagen verstärkte, auf die Geschütze montiert waren – ähnlich den Wagenfestungen, mit denen die Ungarn ein Jahrhundert zuvor dem Ansturm der Osmanen getrotzt hatten.
In den 1570er Jahren reformierte der kaiserliche Großsekretär Zhang Juzheng, den viele für den fähigsten Staatsbeamten in der Geschichte Chinas halten, die Steuergesetzgebung, trieb Steuerschulden ein und modernisierte die Streitkräfte. Er förderte vielversprechende junge Männer wie Qi und wachte persönlich über die Erziehung des kindlichen Kaisers Wanli. Die kaiserlichen Schatzkammern füllten sich wieder und das Kriegsheer erholte sich, doch als Zhang 1582 starb, holte der Beamtenstand zum Vergeltungsschlag aus. Postum wurde Zhang diskreditiert, seine Gefolgsleute verloren ihre Ämter. Der verdienstvolle General Qi starb arm und vereinsamt, verlassen sogar von seiner Frau.
Kaiser Wanli aber verlor nun, da sein wichtigster Ratgeber das Zeitliche gesegnet hatte, zunehmend das Interesse an Staatsangelegenheiten und zog sich 1589 vollständig aus seiner kaiserlichen Verantwortung zurück. Er ergab sich der Völlerei, verschwendete ein Vermögen für Kleidung und wurde so dick, dass er ohne Hilfe nicht mehr aufstehen konnte. Ein Vierteljahrhundert lang gab er keine kaiserlichen Audienzen mehr, sondern ließ seine Minister und ausländische Staatsgäste vor dem leeren Thron ihren Kotau machen. Nichts wurde erledigt, weder wurden neue Beamte eingestellt noch alte befördert. 1612 war die Hälfte aller Staatsämter und -posten unbesetzt, und die Liste anhängiger Gerichtsverfahren reichte Jahre zurück.
So gesehen war es kein Wunder, dass Hideyoshi 1592 mit einem leichten Sieg rechnete. Aber ob es nun an seiner Kriegführung oder an der modernisierten |428|Flotte der Koreaner lag oder auch daran, dass sich das zur Hilfe geeilte chinesische Heer (vor allem die von Qi aufgebaute Artillerie) unerwartet gut schlug, jedenfalls geriet der Vormarsch der Japaner ins Stocken. Manche Historiker sind der Meinung, dass Hideyoshi China trotzdem besiegt hätte, wäre er nicht 1598 gestorben. So aber überlegten sich seine Generäle die Sache mit der Expansion noch einmal, verließen Korea stehenden Fußes und eilten zurück in die Heimat, um sich dem wichtigen Geschäft ihrer Grabenkämpfe untereinander zu widmen, während Wanli und sein Gefolge zum ebenso wichtigen Geschäft des mehr oder weniger Nichtstuns zurückkehrten.
Nach 1600 war man sich in den großen Reichen des östlichen Kerngebiets stillschweigend darin einig, dass die Beamten recht hatten: Zentralisierung und Expansion waren nicht die Lösung ihrer Probleme. Für China war die Nordgrenze zu den mongolischen Steppengebieten nach wie vor eine Herausforderung, in Südostasien bildeten europäische Piraten/Händler immer noch eine Bedrohung, aber Japan drohten – einmalig in der Geschichte der Menschheit – so wenig Gefahren, dass dort keine Schusswaffen mehr verwendet wurden und die Waffenschmiede des Landes wieder dazu übergingen, Schwerter (leider keine Pflugscharen) zu fertigen. Einen solchen Luxus konnte sich im Westen niemand leisten.
In mancher Hinsicht waren sich Osten und Westen im 16. Jahrhundert ziemlich ähnlich. Hier wie da wurde das Ursprungsgebiet der Zivilisation von einem mächtigen Reich beherrscht (das Gebiet des Gelben Flusses und des Jangtse im Osten vom chinesischen Kaiserreich der Ming-Dynastie, der östliche Mittelmeerraum im Westen vom Osmanenreich der Türken), während in den Randgebieten kleinere Staaten einen blühenden Handel trieben (Japan und südostasiatische Staaten im Osten, westeuropäische Staaten im Westen). Aber hier endeten auch schon die Übereinstimmungen. Anders als im zerstrittenen China zweifelte im Osmanischen Reich niemand daran, dass Expansion die Lösung aller Probleme war. Nach der Eroberung durch die Osmanen 1453 war die Einwohnerzahl Konstantinopels auf 50 000 zurückgegangen, stieg aber erneut sprungartig an, als die Stadt wieder zum Zentrum eines mächtigen Reiches wurde. Um 1600 lebten in Konstantinopels 400 000 Menschen, und sie benötigten – wie viele Jahrhunderte zuvor die römische Bevölkerung – die Früchte des gesamten Mittelmeerraums, um satt zu werden. Und wie die römischen Senatoren vor ihnen waren auch die osmanischen Sultane der Überzeugung, all diese Mahlzeiten seien am besten durch Eroberungszüge zu sichern.
Die Sultane verfolgten eine komplexe Strategie, die ihre Basis zum einen im westlichen Kerngebiet und zum anderen in den Steppen hatte. Das war das Geheimnis ihres Erfolgs. Sultan Süleyman I. schätzte die Stärke seiner Armee im |429|Jahr 1527 auf 75 000 Reiter, die meisten von ihnen Bogenschützen aus einer nomadischen Oberschicht, sowie 28 000 Janitscharen, vorwiegend christliche Sklaven, die als Musketiere ausgebildet und durch die Artillerie verstärkt wurden. Um die Reiter bei Laune zu halten, übertrugen ihnen die Sultane erobertes Land als Lehen; und um die Janitscharen zufriedenzustellen, das heißt ihnen pünktlich den vollen Sold auszahlen zu können, führten sie Landvermessungen durch, die selbst Hideyoshi in Staunen versetzt hätten, und lenkten die Geldflüsse aus den entsprechenden Steuereinnahmen bis auf den letzten Silberling.
Das alles erforderte einiges Verwaltungsgeschick, und so kam es, dass eine ständig wachsende Bürokratie die klügsten Köpfe des Reiches für sich beanspruchte, während die Sultane sehr gewieft konkurrierende Interessengruppen gegeneinander ausspielten. Im 15. Jahrhundert begünstigten sie meist die Janitscharen, zentralisierten die Regierung und pflegten eine weltoffene Kultur. Im 16. Jahrhundert neigten sie eher zur Aristokratie und zur Dezentralisierung und stärkten den Islam. Aber wichtiger als all dieses geschickte Lavieren und Protektionieren waren erfolgreiche Beutezüge, die alles am Laufen hielten. Die Osmanen brauchten den Krieg, und im Allgemeinen gingen sie auch als Sieger daraus hervor.
Die schwerste Prüfung erlebten sie an der östlichen Front. Jahrelang hatten sie sich mit immer wieder aufbrandenden Unruhen in Anatolien herumgeschlagen (Abbildung 9.4), wo sie von den kämpferischen schiitischen Rotköpfen1* als sunnitische Despoten geschmäht wurden. Bösartig wurde das Geschwür, als sich Ismail I., der Schah von Persien, 1501 selbst zum direkten Nachfahren des Kalifen und Imams Ali ibn Abi Talib erklärte. Diese schiitische Herausforderung lieferte den Hungrigen, Armen und Entrechteten des Reiches ein Ziel für ihre Wut, die sich so gewalttätig entlud, dass selbst hartgesottene Soldaten mit Entsetzen reagierten: »Sie machten alles nieder – Männer, Frauen und Kinder«, wusste ein Unteroffizier über die Aufständischen zu berichten, »sie bringen sogar Katzen und Hühner um.«10 Der türkische Sultan ließ die Schiiten von seinen Religionsgelehrten zu Häretikern erklären, und die Folge war, dass im gesamten 16. Jahrhundert ein Dschihad den anderen jagte.
Die Osmanen waren aufgrund ihrer überlegenen Feuerwaffen im Vorteil, und obwohl sie Persien nie vollständig unterwerfen konnten, schafften sie es doch, den weiteren Vormarsch der persischen Streitkräfte zu verhindern, wonach sie nach Südwesten abschwenkten, um 1517 mit Ägypten den Hauptgewinn einzuheimsen. So hatten die hungrigen Bürger Konstantinopels zum ersten Mal seit der islamischen Expansion, die gut 900 Jahre zurücklag, freien Zugang zum Nildelta, dem Brotkorb Ägyptens.
Aber wie jede Eroberungsmacht seit den Assyrern mussten auch die Osmanen feststellen, dass jeder gewonnene Krieg einen weiteren nach sich zieht. Um den Getreidehandel zwischen Ägypten und Konstantinopel wieder aufleben zu lassen, brauchten die Türken zum Schutz ihrer Handelsschiffe eine Kriegsflotte, doch ihre Siege über die verwegenen Piraten des Mittelmeers (Muslime wie Christen) trieben die Flotte immer weiter nach Westen. In den 1560er Jahren beherrschte das Osmanische Reich die gesamte nordafrikanische Küste und führte Seekriege gegen westeuropäische Streitkräfte. Überdies drangen die Türken tief ins europäische Binnenland vor, wo sie 1526 Ungarn eroberten und den König und viele seiner Adeligen töteten.
Im Jahr 1529 stand Sultan Süleyman mit seinem Heer vor Wien. Zwar gelang es ihm nicht, die Stadt einzunehmen, aber die Belagerung weckte in der christlichen Welt die Angst, die Osmanen könnten sich bald ganz Europa einverleiben. »Ich schaudere bei dem Gedanken, welchen Ausgang ein größerer Krieg haben würde«, schrieb ein Botschafter in Konstantinopel in einem Brief in die Heimat.
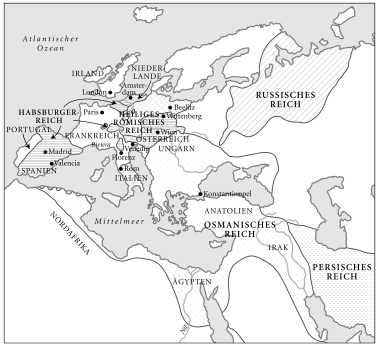
Abbildung 9.4: Die westlichen Reiche Das Habsburger, das Heilige Römische, das Osmanische und das Russische Reich um 1550.
|431|Sie verfügen über die gewaltigen Reichtümer ihres Reiches, Praxis und Erfahrung an den Waffen, ein erprobtes Heer, eine ungebrochene Reihe von Siegen. … Dem haben wir eine leere Staatskasse, Verschwendungssucht, verfallene Sitten und erschöpfte Ressourcen entgegenzusetzen … und, was das Schlimmste von allem ist, der Feind ist an Siege gewöhnt, wir an Niederlagen. Gibt es auch nur den geringsten Zweifel daran, wie ein Krieg ausgehen würde?11
Einige Europäer hegten diesen Zweifel sehr wohl, allen voran Karl V. aus dem Hause Habsburg, einer der superreichen Familien, die seit dem Schwarzen Tod in Mitteleuropa die Macht untereinander aufteilten. Durch geschickt eingefädelte Heiratsverbindungen und zeitlich fast übernatürlich günstig gelegene Todesfälle in der angeheirateten Verwandtschaft schafften es die Habsburger, sich von der Donau bis zum Atlantik auf diverse Königsthrone zu hieven, und 1516 fiel Karl das gesamte Erbe – Österreich, Teile von Deutschland, das heutige Tschechien, Süditalien, Spanien und die Niederlande, also die heutigen Staaten Belgien und Holland – in den Schoß. Mit all diesen Königskronen verfügte er nun über die besten Soldaten, die reichsten Städte und die führenden Bankhäuser Europas, und 1518 wählten ihn die deutschen Kurfürsten auch noch zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Diese Krone, ein eher kurioses Relikt aus den Wirren des europäischen Mittelalters, war ein zweifelhafter Segen, denn das Heilige Römische Reich war, wie Voltaire in den 1750er Jahren bemerkt hat, »in keiner Weise heilig, noch römisch, noch ein Reich«12. Und im Allgemeinen kostete es mehr, die zänkische Schar der Kurfürsten in Zaum zu halten, als es der Thron wert war. Allerdings trat derjenige, der den Kaiserthron bestieg, das Erbe von Karl dem Großen an – keine Kleinigkeit, wenn man im Begriff stand, Europa gegen die Türken zusammenzuscharen.
In den Augen vieler Beobachter gab es für Westeuropa nur zwei Alternativen: Eroberung durch die Muselmanen oder Unterwerfung unter die Habsburger, die Einzigen, die als stark genug angesehen wurden, um die Türken aufzuhalten. Der Großkanzler Karls brachte es 1519 in einem Brief an den Kaiser auf den Punkt: »Sire, da Euch Gott diese ungeheure Gnade verliehen hat, Euch über alle Könige und Fürsten der Christenheit zu erhöhen zu einer Macht, die bisher nur Euer Vorgänger Karl der Große besessen hat, so seid Ihr auf dem Wege zur Weltmonarchie, zur Sammlung der Christenheit unter einem Hirten.«13
Hätte entweder der Botschafter oder der Großkanzler Recht gehabt, so hätte sich in Westeuropa schon bald das gleiche Bild geboten wie in den anderen Kerngebieten der Welt, die von einer großen Landmacht beherrscht wurden. Doch die Vorstellung, »unter einem Hirten« vereinigt zu sein, schreckte die Könige und Fürsten der christlichen Welt so sehr, dass einige von ihnen Präventivkriege gegen Karl führten, um dies zu verhindern. Frankreich verbündete sich gar mit den Türken gegen die Habsburger, und gemeinsam nahmen sie mit ihrer Flotte die französische Riviera unter Beschuss, die zu dieser Zeit zum Herrschaftsgebiet Kaiser Karls gehörte. Karl seinerseits sah sich durch all das natürlich gezwungen, |432|sich noch ernsthafter um die Versammlung der christlichen Schäflein zu bemühen.
Karl und sein Sohn Philipp II. brachten den größten Teil ihrer langen Regentschaft2* damit zu, gegen Christen, nicht gegen Muselmanen zu kämpfen. Anstatt aber eine westeuropäische Landmacht zu schaffen, entzweiten sie Europa mit ihren Kriegen, alte Feindschaften vertieften sich und neue entstanden. Als beispielsweise Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen am Hauptportal der Schlosskirche zu Wittenberg anschlug, war dies überhaupt nichts Besonderes; es war eine zu dieser Zeit gebräuchliche Art, theologische Streitthemen zum Gegenstand öffentlicher Diskussionen zu machen (und Luthers Thesen waren, verglichen mit denen anderer Kirchenkritiker seit dem Schwarzen Tod, ausgesprochen gemäßigt). Doch in der aufgeladenen Atmosphäre der Zeit wurde aus Luthers Reformation eine politische und gesellschaftliche Erschütterung, die seine Zeitgenossen oft mit der Spaltung zwischen Schiiten und Sunniten in der islamischen Welt verglichen.
Luther hatte auf Karls Unterstützung gehofft, doch in den Augen des Kaisers setzte ein vereintes christliches Reich eine ungeteilte Kirche voraus. An Luther gerichtet, ließ er verlauten: »Denn es ist sicher, dass ein einzelner Bruder irrt, wenn er gegen die Meinung der ganzen Christenheit steht, da sonst die Christenheit tausend Jahre oder mehr geirrt haben müsste. Deshalb bin ich entschlossen, meine Königreiche und Herrschaften, Freunde, Leib und Blut, Leben und Seele einzusetzen.«14 Und er handelte danach. Doch in einer Situation, in der ganz Europa für oder gegen die Habsburger in Waffen stand, erwies es sich als verhängnisvoll, die Differenzen innerhalb des Christentums zu leugnen. Millionen Christen sagten sich, sei es aus Überzeugung oder auch nur aus Unsicherheit, von der römisch-katholischen Kirche los. Protestanten und Katholiken brachten sich gegenseitig um, Protestanten brachten andere Protestanten um, und die Auslegungen des Protestantismus wurden immer vielfältiger. Die einen verkündeten die Ankunft eines neuen Heilands, die anderen riefen zur freien Liebe oder zum Kommunismus auf. Viele fanden einen gewaltsamen und grausamen Tod. Und alle machten sie den Habsburgern das Regieren schwerer – und teurer.
Da Menschen, die in ihren Feinden Handlanger des Teufels sehen, selten zu Zugeständnissen bereit sind, wurden aus kleinen Streitigkeiten große Konflikte, die kein Ende fanden und die Kriegsausgaben in schwindelnde Höhen trieben. Als für die Habsburger schließlich das untere Ende der Leiter erreicht war, war dies das Ende überhaupt: Sie konnten es sich einfach nicht leisten, Europa zu vereinigen.
In den Jahren 1555 und 1556 dankte Karl, erschöpft von seinen vielen Kriegen, stufenweise ab und teilte die Länder seines Herrschaftsbereiches auf: Ferdinand I., einer seiner Brüder, erhielt Österreich und später den Kaiserthron des Heiligen |433|Römischen Reiches, seinem Sohn Philipp übertrug er Spanien und die übrigen westeuropäischen Besitztümer. Es war ein kluger Schachzug: War der Habsburger Thron mit der spanischen Regentschaft identisch, konnte Philipp den Verwaltungsapparat straffen und sich auf das Wesentliche konzentrieren: das Geld.
Vierzig Jahre lang schuftete Philipp wie ein Ochse, um die Finanzen der Habsburger zu sanieren. Er war ein merkwürdiger Mensch. Stunden um Stunden verbrachte er in pedantischer Eintönigkeit auf dem düsteren, eigens für ihn errichteten Königssitz El Escorial in der Nähe Madrids, war aber stets zu beschäftigt, um seinen Besitztümern einen Besuch abzustatten. Doch obwohl er seine Untertanen so eifrig zählte und mit Steuern belegte wie Hideyoshi und damit die Steuereinnahmen vervielfachte und trotz entscheidender Siege über Franzosen und Türken kam er dem endgültigen Triumph, der das christliche Westeuropa vereinigen sollte, zu keinem Zeitpunkt auch nur einen Schritt näher. Philipps Untertanen – die sich vermehrten wie Mäuse in der Scheune, zwischen Hunger und Staat gefangen waren und zusehen mussten, wie ihre Steuern draufgingen für Auseinandersetzungen in fernen Ländern mit Menschen, die ihnen vollkommen fremd waren – setzten sich zunehmend zur Wehr.
In den 1560er Jahren schaffte Philipp es gar, dass sich Gott und Mammon gemeinsam gegen ihn verbündeten. Als Protestanten von den Habsburgern verfolgt und mit höheren Steuern belegt, begehrte die normalerweise eher phlegmatisch veranlagte Bürgerschaft der Niederlande auf und blies zum Bilder- und Kirchensturm. Weil er die reichen Niederlande keinesfalls an einen Haufen Calvinisten verlieren wollte, schickte Philipp seine Streitmacht, woraufhin die Niederländer ein eigenes Heer aufstellten. Philipp gewann eine Schlacht nach der anderen, aber den Krieg konnte er nicht gewinnen. Die Niederländer weigerten sich, weitere Steuern an die Habsburger zu zahlen, aber wenn es um ihren Glauben ging, waren sie bereit, mit jeder beliebigen Summe Geldes und unter Einsatz ihres Lebens darum zu kämpfen. In den 1580er Jahren überstiegen die Kriegskosten bereits die Staatseinnahmen des gesamten Reiches, und Philipp musste sich, da er nun weder Sieg noch Niederlage hätte bezahlen können, noch mehr Geld von seinen italienischen Finanziers leihen. Als er an dem Punkt angelangt war, dass er seinen Soldaten keinen Sold mehr bezahlen und seinen Schuldnern keine Rückzahlungen mehr leisten konnte, erklärte er den Staatsbankrott – was er im Laufe seiner Regentschaft noch ein zweites und ein drittes Mal tat. Seine unbezahlten Soldaten gerieten außer Rand und Band und bestritten ihren Lebensunterhalt mit Raubzügen und Plünderungen, womit sie Philipps Kreditwürdigkeit vollends ruinierten. Spanien wurde zwar erst 1639 (zur See) und 1643 (zu Lande) endgültig besiegt, doch als Philipp 1598 starb, war das Reich, dessen Schulden die Jahreseinnahmen um das Fünfzehnfache überstiegen, bereits am Boden zerstört.
Es sollte zwei Jahrhunderte dauern, bis es in Westeuropa wieder nach der Entwicklung einer veritablen Landmacht aussah, aber inzwischen hatten andere Westeuropäer eine industrielle Revolution losgetreten, die im Begriff war, die |434|Welt zu verändern. Hätten die Habsburger oder die Türken Europa im 16. Jahrhundert vereint, so wäre es möglicherweise nicht zur industriellen Revolution gekommen. Vielleicht haben wir mit Karl und Philipp, die Westeuropa nicht einigen konnten, oder mit Süleyman, dem es nicht gelang, Westeuropa zu erobern, die vertrottelten Stümper gefunden, die den Lauf der Geschichte verändert haben.
Das allerdings wäre abermals zu viel der Schuldzuweisung an irgendeine einzelne Person. Der europäische Botschafter, der so besorgt um die Gefahr eines türkischen Eroberungszuges gewesen war, hatte seinen Einlassungen hinzugefügt: »Das einzige Hindernis ist Persien, das den türkischen Eroberern so im Nacken sitzt, dass sie gezwungen sind, Vorsicht walten zu lassen.«15 Die Türken waren schlichtweg nicht in der Lage, Persien, die Schiiten und die Europäer zu besiegen. Ebenso lag es nicht am Verlust irgendeiner entscheidenden Schlacht oder am Fehlen irgendeiner notwendigen Ressource, dass Karl und Philipp nicht in der Lage waren, die christliche Welt zu einen. (Tatsächlich trugen sie bis in die 1580er Jahre fast immer den Sieg davon, und Glück, Begabung und Anerkennung war ihnen im Übermaß beschieden.) Vielmehr lag es daran, dass es ihre strategischen und finanziellen Möglichkeiten überstieg, gleichzeitig gegen Türken, christliche Reformatoren und die anderen Staaten Westeuropas zu kämpfen. Und wenn die Habsburger mit all ihren Privilegien nicht in der Lage waren, Westeuropa zu einen, dann konnte dies niemand. Westeuropa sollte sich auch weiterhin von den Reichen unterscheiden, die sich in einem breiten Streifen von der Türkei bis nach China erstreckten.
So unterschiedlich die Ausprägung der Reiche war, hatte bis dato die gesellschaftliche Entwicklung in beiden Kerngebieten doch beträchtliche Fortschritte gemacht. In den Jahrzehnten nach dem Dahinscheiden von Hideyoshi und Philipp (beide im Jahr 1598) deutete allerdings alles darauf hin, dass das Entwicklungsparadox wieder in Erscheinung trat. Wie so oft in der Geschichte trug das Klima zur Zuspitzung der neuerlichen Krise bei. War es schon seit 1300 kühl gewesen, so wurde es nun noch kälter. Manche Klimaforscher machen dafür einen Vulkanausbruch in Peru im Jahr 1600 verantwortlich, andere eine niedrige Sonnenaktivität. Die meisten sind sich jedoch darin einig, dass in den Jahren zwischen 1645 und 1715 fast überall in der Alten Welt eine außergewöhnliche Kälte herrschte. Von London bis Guangdong beklagten sich Chronisten und Beamte über Schnee und Eis und viel zu kalte Sommer.
Gemeinsam sorgten gewissenlose Städter und gierige Landwirte dafür, dass das 17. Jahrhundert zum Verhängnis für all diejenigen wurde, die sich nicht wehren konnten: Wälder, Sumpfgebiete, Wildtiere, kolonisierte Völker. Manchmal suchten Herrscher, von schlechtem Gewissen geplagt, diese Opfer durch Gesetze zu |435|schützen, die aber vor allem bei den Siedlern wenig Beachtung fanden, die immer weiter über die Grenzen der Kerngebiete hinausdrängten. In China machten sich so genannte Hüttenleute auf Berghängen und in den Wäldern breit und zerstörten mit dem Anbau von Süßkartoffeln und Mais empfindliche Ökosysteme. Sie trieben dort ansässige Volksgruppen wie die Miao an den Rand des Hungertodes, doch als die Miao aufbegehrten, schlug der chinesische Staat den Aufstand mit seinen Truppen nieder. Die Ainu im Norden Japans, die Iren in der ältesten Kolonie der Briten und die indigenen Völker an der Ostküste Nordamerikas – sie alle könnten die gleiche traurige Geschichte erzählen.
Vordringende Menschen, die ihre ebenso vordringenden Pflanzen und Tiere mitbrachten, verdrängten heimische Spezies oder rotteten sie durch intensive Jagd aus, pflügten gewachsene Lebensräume nieder und holzten die Wälder ab. Ein Gelehrter beklagte sich in den 1660er Jahren, dass japanische Berglandschaften zu vier Fünfteln entwaldet seien. Um 1550 waren nur noch zehn Prozent der englischen und schottischen Landfläche bewaldet, und 200 Jahre später waren auch diese Wälder zur Hälfte verschwunden. In Irland nahmen die Waldflächen um 1600 zwar noch zwölf Prozent des Landes ein, doch bis 1700 hatten die Kolonisten fünf Sechstel dieser Bäume abgeholzt.
In den Großstädten zogen die Holzpreise so empfindlich an, dass die Menschen nach Alternativen suchten. In der Umgebung von Edo, dem heutigen Tokio, gingen Salz- und Zuckersieder, Töpfer und schließlich auch Hausbesitzer dazu über, Kohle zu verbrennen, und wo dies möglich war, benutzte man in Europa zunehmend Torf und Steinkohle anstelle von Holzkohle. Wie die Bewohner von Kaifeng 500 Jahre vor ihnen griffen die Londoner begierig auf fossile Brennstoffe als Ersatz für das Holz zurück, das sie sich nicht mehr leisten konnten. Die meisten Familien im englischen Hinterland konnten noch genügend Brennholz auftreiben, aber in London verbrauchte 1550 jeder Bewohner durchschnittlich eine Vierteltonne Kohle im Jahr. 1620 war es schon dreimal so viel, und 1650 lieferte Kohle die Hälfte der in England verbrauchten Heizenergie. »London ist in eine so dichte Wolke von Kohlenrauch eingehüllt«, beklagte sich ein Londoner 1659, »dass, wenn es so etwas wie eine Hölle auf Erden gibt, es dieser Vulkan an einem nebelverhangenen Tag sein muss.«16
Leider lag er mit seiner Einschätzung falsch, denn die Wirklichkeit in anderen Teilen Eurasiens kam der Hölle noch viel näher. Der Klimawandel war nur der erste apokalyptische Reiter, der die Menschen heimsuchte. Zunehmender Druck auf die Ressourcen führte dazu, dass Regierungen und Staaten auseinanderbrachen. Wenn Könige die Ausgaben senkten, brachten sie ihre Beamten und Soldaten gegen sich auf; wenn sie die Steuern erhöhten, machten sie sich ihre Kaufleute und Bauern zu Feinden. Gewalttätige Proteste von Seiten der Armen gehörten seit der Erfindung des Staatswesens zum Alltag, aber jetzt gesellten sich auch verarmte Adelige, bankrotte Kaufleute, um ihren Sold betrogene Soldaten und gescheiterte Beamtenanwärter zu den Aufständischen.
|436|Als die Zeiten schwieriger wurden, versuchten westliche Regenten, möglichen Aufständen den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie mit Nachdruck behaupteten, den Fleisch gewordenen Willen Gottes zu repräsentieren. Die osmanischen Sultane bemühten sich offensiver um ihre Religionsgelehrten, während die Intellektuellen Westeuropas die Idee des Absolutismus verbreiteten. Der König, so behaupteten sie, sei Herrscher von Gottes Gnaden, seine Macht könne weder durch Parlamente noch durch die Kirche oder den Willen des Volkes beschränkt werden. Es galt das Schlagwort Ludwigs XIV., des französischen Sonnenkönigs: »Un roi, une loi, une foi«, ein König, ein Gesetz, ein Glaube. Wer auch nur einen Aspekt dieses Gesamtanspruchs anzweifelte, stellte alles in Frage, was recht und heilig ist.
Aber Scharen wütender Untertanen waren entschlossen, genau das zu tun. Als Osman II., der als Sultan des Osmanischen Reiches zugleich Mohammeds Nachfolger und Gottes Stellvertreter auf Erden war, 1622 versuchte, die Macht der immer kostspieliger werdenden Janitscharen zu beschneiden, schleiften diese, nicht faul, den Herrscher aus seinem Palast, erdrosselten ihn und verstümmelten seinen Leichnam. Murad IV., Osmans Bruder und Nachfolger, versuchte die verfahrene Situation zu retten, indem er sich mit den Strenggläubigen unter den Religionsgelehrten verbündete. Um ihnen zu gefallen, verbot er sogar das Kaffeetrinken und stellte das Rauchen unter Todesstrafe, doch in den 1640er Jahren verlor der Sultan endgültig seinen Machtanspruch. 1648 wurde Sultan Ibrahim der Verrückte von den Janitscharen abgesetzt und gehängt (vielleicht gerade noch rechtzeitig, denn er trug seinen Beinamen vollkommen zu Recht), worauf ein Bürgerkrieg ausbrach, der ein halbes Jahrhundert dauern sollte.
Die 1640er Jahre waren fast überall ein Alptraum der Potentaten. Aufstände gegen die absolutistische Herrschaft lähmten Frankreich, in England führten die Anhänger des Parlaments Krieg gegen den allzu forschen König Karl I. und richteten ihn schließlich hin. Damit war der Geist aus der Flasche gelassen: Wenn es möglich war, einem gottgleichen König den Prozess zu machen und ihn zu enthaupten, dann war alles möglich. Vielleicht zum ersten Mal seit dem alten Athen kamen demokratische Ideen auf. »Der Ärmste in England hat genauso ein Leben zu leben wie der Mächtigste«, erklärte ein Oberst des Parlamentsheeres, in dem die Kommandogewalt erstmals nach Befähigung und nicht nach Abstammung vergeben wurde, »jeder Mensch, der unter einer Regierung leben soll, muss sich zuerst aus freiem Willen dieser Regierung unterstellen.«17
Das war schon starker Tobak im 17. Jahrhundert, aber einige radikale Splittergruppen im englischen Bürgerkrieg gingen noch weiter. Die Leveller (Gleichmacher), eine der Fraktionen im Unterhaus, lehnten gesellschaftliche Unterschiede generell ab. Sie traten ein für die Gleichheit vor dem Gesetz und die Abschaffung der Stände. »Keiner kommt mit einem Sattel auf dem Rücken zur Welt«, lautete ihr Motto, »und keiner mit Stiefeln und Sporen, um auf ihm zu reiten.«18 Und wenn schon Hierarchien nicht naturgegeben waren, dann war es Privateigentum |437|erst recht nicht. Innerhalb eines Jahres nach der Hinrichtung des Königs spaltete sich eine noch radikalere Gruppe ab, die sich True Levellers nannte. Eine andere Splittergruppe, die Ranters, bezeichnete Gott als »den großen Gleichmacher« und predigte die ewige Revolution: »Umsturz, Umsturz, Umsturz … Teilt alles, was da ist, sonst wird die Pest Gottes alles, was ihr habt, verfaulen lassen und vernichten.«19
Die Zeit war einfach reif für den Gleichheitsgedanken der Leveller. So heißt es in einem 1644 verfassten Rapport:
Sie schmiedeten scharfe Schwerter aus ihren Hacken und bezeichneten sich selbst als »gleichmachende Könige«, und sie schafften den Unterschied ab zwischen Herren und Dienern, Würdenträgern und Gemeinen, Reichen und Armen. Die Gleichmacher nahmen sich die besten Kleider ihrer Herren …, und sie befahlen ihren Herren, niederzuknien und ihnen den Wein einzuschenken. Sie schlugen ihnen auf die Wangen und sagten: »Wir Menschen sind alle gleich. Wer gab euch das Recht, uns Diener zu nennen?«20
Allerdings: Diese kompromisslosen Gleichmacher waren gar keine Engländer; sondern machten vielmehr die Ostküste Chinas unsicher. Die Ming-Dynastie war bankrott und aufgrund ihrer inneren Querelen nahezu handlungsunfähig, und als 1628 eine Hungersnot – der dritte der apokalyptischen Reiter – ausbrach, schienen die Kaiser ihr himmlisches Mandat verloren zu haben. Aufständische verfolgten ihre Ziele immer hemmungsloser, selbsternannte lokale Machthaber sorgten ab 1630 für Chaos im Land. 1644 fiel Beijing, und Chongzhen, der letzte Ming-Kaiser, erhängte sich an einem einsamen Pagodenbaum hinter dem Palast. »In meiner Schwäche und Wertlosigkeit habe ich den Himmel beleidigt«, hatte er auf sein Gewand geschrieben. »Voller Scham, vor das Angesicht meiner Vorfahren zu treten, sterbe ich. Ich lege meine Kaiserkrone ab, zerwühle mein Haar vor dem Gesicht und überlasse den Rebellen meinen Leichnam zum Zerreißen. Auf dass sie meinem Volk keinen Schaden zufügen mögen!«21
Doch seine letzten Worte waren vergebens. Da die aufständischen Kriegsherren ihre aufgeblähten Heere genauso wenig bezahlen konnten wie die Könige Europas, die Sultane des Osmanischen Reiches oder Chongzhen selbst, stellten sie es ihren Soldaten frei, sich ihren Sold bei der Zivilbevölkerung zu holen. Soldaten haben geplündert, seit es Kriege gibt, und sind dabei immer schon grausam vorgegangen. Doch im bluttriefenden 17. Jahrhundert loteten wütende, gierige und verängstigte Soldaten in ganz Eurasien offenbar neue Abgründe der Grausamkeit aus. Die Chroniken aus dieser Zeit sind voll von Folterungen, Massenhinrichtungen und systematischen Vergewaltigungen. Als Beijing fiel, wurden die Bürger der Stadt
brutal verprügelt, bis sie auch das letzte Stück Silber herausgerückt hatten, das sie besaßen. Manche wurden mehr als drei- oder viermal mit Finger- oder Gliederpressen gefoltert. Manche denunzierten andere, sodass Tausende von Bürgerfamilien betroffen waren …, bis den Menschen schließlich nichts mehr am Leben lag.22
|438|Sofern überhaupt möglich, waren die Auswüchse der Gewalt, die durch das Versagen der Regenten entfesselt wurde, im Westen noch schlimmer. In Deutschland erreichten die Religionskriege zwischen 1618 und 1648 ihren blutigen Höhepunkt. Aus allen Winkeln der christlichen Welt wurden gewaltige Heere entsandt; Söldner, die nur unregelmäßig oder überhaupt nicht bezahlt wurden, nahmen sich zum Leben, was immer das Land hergab. Die überlieferten Quellen offenbaren unvorstellbare Gräueltaten. Die kleine Stadt Beelitz südwestlich von Berlin, die das Pech hatte, dass die kaiserlichen Truppen 1637 ausgerechnet hier hindurchmarschierten, ist nur eines von zahllosen traurigen Beispielen. Ein Zollbeamter beschrieb die Geschehnisse:
Da haben die reuber und mörder ein Holz genohmmen, den armmen leutten solches im halße gestochen, umbgerühren, waßer eingegoßen, sandt darzu eingeschutten, ja wohl mänschen koth undt die leutte jämmerlich gequelen umb Gelde, wie ein Bürger von Beelitz, David Örtel genandt, wiederfahren, undt balde gestorben.23
Ein anderer Soldatenmob hängte einen Beelitzer Bürger über ein Feuer und ließ ihn dort schmoren, bis er den Männern zeigte, wo er seine Ersparnisse versteckt hatte; nur um von einer anderen Gruppe Söldner, die gehört hatten, dass ihre Kameraden Geld aus ihm herausgeräuchert hatten, wieder zum Feuer zurückgeschleppt zu werden, in das sie sein Gesicht hielten – »so lange, biß er davon stirbet, ja das ihm die Haut wie einer ganß abgeschlachtet abgehet«24.
Lange Zeit hat man solche Gräuelgeschichten für erfunden, mindestens aber übertrieben gehalten, für religiöse Propaganda, zu schrecklich, um wahr zu sein, doch neuere Forschungen widersprechen dieser Annahme. Über zwei, wenn nicht sogar vier Millionen Menschen starben während des Dreißigjährigen Krieges eines gewaltsamen Todes (eine Zahl, die erst in den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts wieder erreicht werden sollte), und etwa zehnmal so viele wurden von Hunger und Krankheiten – dem dritten und vierten apokalyptischen Reiter – dahingerafft, die den Kriegsscharen auf dem Fuß folgten. China wie Mitteleuropa erlebten einen von Menschen verursachten Schwarzen Tod, der die Bevölkerung hier wie da um ein Drittel dezimierte.
Die eigentliche Pest, die in verheerenden neuen Formen wiederkehrte, tat ein Übriges. In seiner 1722 veröffentlichten fiktiven Reportage Die Pest zu London beschrieb Daniel Defoe die Ereignisse, die London während der Pestepidemie 1665 in einen Hexenkessel des Aberglaubens, der Angst und der Leiden verwandelten. Nicht weniger anschaulich sind die Berichte chinesischer Ärzte: »Manchmal haben alle geschwollene Mandeln, dann wieder schwellen jedermann Gesicht und Kopf an. … Manchmal leiden alle an Durchfall und Wechselfieber. Es können auch Krämpfe oder Pusteln oder ein Hautausschlag oder juckende Krätze oder Furunkeln auftreten.«25
Vier der fünf apokalyptischen Reiter suchten die Erde mit Macht heim, und doch erlebte das 17. Jahrhundert, wie Abbildung 9.1 zeigt, keinen Zusammenbruch. |439|Mit der gesellschaftlichen Entwicklung ging es weiter bergauf, sie überstieg 43 Punkte – die Obergrenze, die sie im Römischen Reich und unter der Song-Dynastie erreicht hatte – im Osten 1710, im Westen 1723 (in beiden Fällen plus/minus 25 Jahre, je nach Genauigkeit des Indexes). Um 1800 näherte man sich im Osten wie im Westen einer neuen Obergrenze von 50 Punkten. Warum, so muss man sich fragen, spiegelte die gesellschaftliche Entwicklung nicht die geschichtlichen Ereignisse wider?
Nertschinsk, 22. August 1689. Der kurze sibirische Sommer kann auf eigentümliche Weise schön sein. Alljährlich sprießt, wenn die Frostperiode vorbei ist, das Gras aus dem Boden und überzieht die sanft gewellte Landschaft mit einem grünen Teppich, der gesprenkelt ist mit roten, gelben und blauen Wiesenblumen und Schmetterlingen. In diesem Sommer jedoch bot sich ein anderes Bild: An den Ufern der Schilka (Abbildung 9.5) schoss eine Zeltstadt aus dem Boden, und Hunderte von chinesischen Gesandten setzten sich mit mürrischen Russen zusammen, um eine gemeinsame Grenze auszuhandeln.1* Begleitet wurden die Chinesen von christlichen Missionaren, die den Vertragstext ins Lateinische übersetzen sollten.
Die Russen waren fern ihrer Heimat. Noch bis 1500 war Moskau nur ein Fürstentum von vielen im Wilden Osten Europas gewesen, ständig bedrängt von den plündernden Horden der Mongolen, die aus den Steppengebieten einfielen, und von Ritterheeren, die aus Polen, Deutschland und Litauen vordrangen. Seine gewalttätigen und ungebildeten Fürsten nannten sich Zaren (also Caesaren), was eine direkte Verbindung zum Byzantinischen und sogar zum Römischen Reich suggerieren sollte, schienen sich aber oft nicht im Klaren darüber zu sein, ob sie herrschen wollten wie ein europäischer König oder wie ein mongolischer Khan. Bis in die 1550er Jahre, als Iwan der Schreckliche, ein übler Sadist selbst nach den erbärmlichen Normen russischer Herrscher, die Zarenkrone trug, war Moskau relativ bedeutungslos, aber Iwan machte die verlorene Zeit schnell wett. Ein mit Musketen beladener Tross von Glücksrittern überquerte das Uralgebirge, unterwarf 1598 den mongolischen Khan der Region und machte so Moskau den Weg nach Sibirien frei.
Heute vor allem als eisiger Schauplatz von Solschenizins Szenen aus dem Gulag bekannt, verbanden die Russen Sibirien damals mit dem Traum von unendlichen Reichtümern. Sie waren vom Pelzfieber befallen: Nachdem die Europäer ihre eigenen Marder, Zobel und Hermeline durch die Jagd ausgerottet hatten, würden sie nun teuer für ihre Mäntel bezahlen. Innerhalb von 40 Jahren erreichten russische Pelzjäger, die die Tundra durchstreiften, um diesen lukrativen Markt zu bedienen, die Küste des Pazifischen Ozeans. Sie hatten am Rand der verschneiten Wälder Sibiriens eine Reihe umfriedeter Niederlassungen errichtet, von denen sie auszogen, um ihre Nerzfallen aufzustellen oder bei den noch steinzeitlich lebenden und jagenden Ureinwohnern der Gegend Felle zu ergaunern. Und obwohl diese einsamen Weiten in den Augen eines Süleyman oder eines Hideyoshi kaum als Weltreich gegolten hätten, bewahrten die Steuern aus dem Pelzhandel so manchen Zar vor dem Ruin.
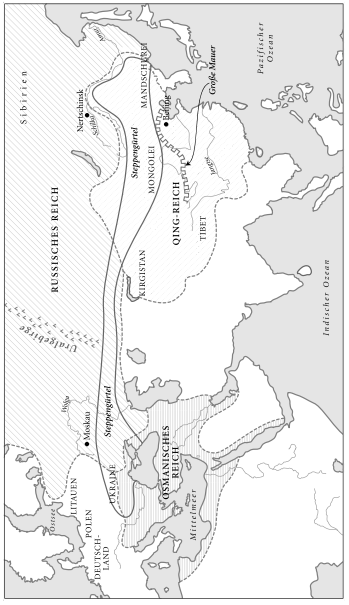
Abbildung 9.5: Am Ende der
Steppen schlagen die Imperien zurück
1750 legen Russland und China den Steppenschnellweg still.
|441|Immer häufiger kam es an den Ufern des Amur zu heftigen Zusammenstößen zwischen russischen Fallenstellern und chinesischen Grenztruppen, doch in den 1680er Jahren einigte man sich darauf, miteinander zu reden. Beide Seiten fürchteten, der Gegner könne, wie so viele fehlgeleitete Regenten in der Vergangenheit, die Mongolen zu seinen Verbündeten machen und so den fünften apokalyptischen Reiter – Einwanderungen der Steppenvölker – auf den Plan bringen. So kam es zu den Verhandlungen in Nertschinsk.
Der Vertrag, der in diesem sibirischen Sommer geschlossen wurde, markierte eine der großen Veränderungen der Weltgeschichte. 2000 Jahre lang war der eurasische Steppengürtel ein Schnellweg zwischen Osten und Westen gewesen, der außerhalb des Machtbereichs der großen Agrarreiche lag. Migranten, Mikroben, Ideen und Erfindungen waren auf diesem Weg von hier nach da gelangt und hatten so Westen und Osten im gleichen Rhythmus von Fortschritt und Zusammenbruch miteinander verbunden. Ganz selten – und wenn, dann nur um einen hohen Preis – hatten sich Eroberer wie Dareios von Persien, der Han-Kaiser Wudi oder der Tang-Kaiser Taizong die Steppengebiete untertan gemacht. Doch im Großen und Ganzen galt die Regel, dass die Agrarreiche zahlten, was die Nomaden forderten, und ansonsten auf das Beste hofften.
Mit den Schusswaffen wurde alles anders. Die Nomadenvölker benutzten regelmäßig Feuerwaffen (das älteste bekannte Gewehr aus dem Jahr 1288 wurde, wie bereits erwähnt, auf Nomadengebiet in der Mandschurei gefunden), und es waren vermutlich Mongolen, die Gewehre aus China in den Westen brachten. Aber die Gewehre wurden immer besser, sie trugen weiter und ließen sich schneller laden – und zudem entwickelten die Reiche eine immer effizientere Verwaltung. Deren Generälen, die es sich leisten konnten, Zehntausende von Infanteristen zu rekrutieren, sie mit Musketen und Kanonen zu bewaffnen und gründlich daran auszubilden, gelang es immer häufiger, die berittenen Truppen der Nomaden zu besiegen. Um 1500 trugen die berittenen Bogenschützen aus den Steppengebieten noch sehr häufig den Sieg über die Fußtruppen der Agrarreiche davon. Um 1600 kam das noch manchmal vor. Um 1700 war es die absolute Ausnahme.
Nun waren es die Russen, die die Führung übernahmen. In den 1550er Jahren verdrängte Iwan der Schreckliche die schwächelnden Mongolenkhanate aus dem |442|Wolgabecken, und in den darauf folgenden 100 Jahren umfriedeten Russen, Türken und Polen die dürren Steppengebiete der Unkraine systematisch mit Gräben, Palisaden und Garnisonen. Mit Musketen bewaffnete Dorfbewohner schränkten anfangs die Ströme der umherziehenden Nomaden ein, bis sie ihnen schließlich vollkommen den Weg abschnitten. Und in Nertschinsk kamen Russen und Chinesen überein, dass fürderhin in den Steppengebieten niemand – kein Flüchtling, kein Händler, kein Fahnenflüchtiger und schon gar kein umherziehender Nomade – einen Schritt ohne ihre Erlaubnis tun dürfe. Für alle galt jetzt das Recht der Agrarreiche.
Das letzte Gefecht Zentralasiens im Jahr 1644 zeigt, wie viel sich verändert hatte. In China beendete die Einnahme Beijings durch Li Zicheng und seine Bauernarmee die Herrschaft der Ming-Dynastie, und als der Bürgerkrieg außer Kontrolle zu geraten drohte, kam ein ehemaliger Ming-General zu dem Schluss, dass es das geringste von vielen möglichen Übeln sei, wenn man die halbnomadischen Mandschuren aufforderte, über die Große Mauer einzudringen und in China wieder für Ordnung zu sorgen. In der Geschichte Chinas war es schon oft vorgekommen, dass ein Herrscher in Bürgerkriegszeiten militärische Unterstützung aus Zentralasien gesucht hatte – fast immer mit fatalen Folgen. Aber die Mandschuren kamen, anders als die Eindringlinge früherer Zeiten, nicht als berittener Nomadentrupp, sondern als wohlorganisierte, von der chinesischen Armee kaum zu unterscheidende Streitmacht mit einer zahlenstarken Infanterie, ausgerüstet mit Musketen und Kanonen, die nach der Bauweise portugiesischer Modelle gefertigt waren.
Die Mandschuren nahmen Beijing fast ungehindert ein, riefen die neue Qing-Dynastie aus und verbrachten die folgenden 40 Jahre damit, ihre Herrschaft zu festigen. Im Gegensatz zu früheren Invasoren aus den Steppengebieten öffneten sie nicht sämtliche Schleusen, um immer mehr Nomaden aus der Kälte nach China einströmen zu lassen, sondern sie bildeten in den langen Jahren der Konsolidierung eine Armee heraus, die in der Lage war, bis weit nach Zentralasien vorzustoßen. 1697 schlugen die Qing-Truppen tief in der Mongolei eine große Nomadenarmee, und 1720 dehnte das Qing-Reich die chinesische Herrschaft erstmals auf das tibetische Bergland aus. 1750 lösten die Qing schließlich das Nomadenproblem ein für alle Mal, indem sie Feuerwaffen, Schießpulver und Munition bis an die Grenze Kirgistans schleppten, wo sie den letzten Widerstand zerschlugen.
Im 17. und 18. Jahrhundert gelang es also den großen Agrarreichen, allen voran Russland und Qing-China, einen der apokalyptischen Reiter für immer unschädlich zu machen. Aus diesem Grund löste der Druck der gesellschaftlichen Entwicklung, die sich vor einer neuen Obergrenze staute, keine Abwanderungswellen aus den Steppen aus, wie es im 2. und im 12. Jahrhundert der Fall gewesen war. Und aus diesem Grund reichte nicht einmal die vereinte Last von Staatsversagen, Hungersnot, Seuchen und Klimawandel aus, um einen Zusammenbruch |443|der Kerngebiete zu bewirken. Der Steppenschnellweg war geschlossen, und damit endete ein ganzes Kapitel in der Geschichte der Alten Welt.
Für die Nomaden war dies eine Katastrophe sondergleichen. Wer die Kriege überlebt hatte, konnte nicht mehr frei umherziehen. Die Bewegungsfreiheit, eine Grundlage der nomadischen Lebensweise, war nun abhängig von den Launen ferner Herrscher, und vom 18. Jahrhundert an verkamen viele dieser einst so stolzen Steppenkrieger zu gekauften Handlangern, zu Schlägern, die bei Bedarf angeheuert wurden, um widerspenstige Bauern zur Vernunft zu bringen.
Für die Agrarreiche war die Abriegelung des Steppengürtels dagegen ein Sieg auf der ganzen Linie. In Zentralasien, von wo aus so lange Zeit Gefahr gedroht hatte, wurden neue Siedlungsgebiete erschlossen. Als es immer seltener zu Überfällen durch Nomaden kam, drängten bis zu zwei Millionen Russen und fünf bis zehn Millionen Chinesen aus den übervölkerten Kerngebieten heraus, um sich als Pioniere am Rande der Steppengebiete niederzulassen. Diejenigen, die stark genug waren, sich durchzuschlagen, zerstückelten das Land für Ackerbau und Viehzucht, für den Abbau von Bodenschätzen und zur Holzgewinnung und bereicherten ihre Heimat mit Rohmaterialien und Steuern. Die Schließung des Steppenschnellweges verhinderte nicht nur den Zusammenbruch, sondern sie leitete eine Blütezeit ein, in der die Decke durchstoßen wurde, die jahrtausendelang die Indexwerte der gesellschaftlichen Entwicklung auf die unteren Vierziger beschränkt hatte.
Während die Russen und Chinesen den Steppengürtel abriegelten, erschlossen die Westeuropäer einen neuen Seeweg, der den Lauf der Geschichte noch dramatischer verändern sollte.
Nachdem die Europäer erstmals den Atlantik überquert und den Indischen Ozean erreicht hatten, waren ihre Seereiche für die Dauer eines Jahrhunderts nichts Besonderes. Die Venezianer hatten schon seit dem 13. Jahrhundert den Handel über den Indischen Ozean angezapft und sich dadurch bereichert; die Portugiesen taten es ihnen nun gleich, nur billiger und schneller, indem sie um die Südspitze Afrikas herumgesegelten, statt sich feilschend ihren Weg durch das Osmanische Reich zu bahnen. In Amerika hatten die Spanier eine vollkommen Neue Welt betreten, aber was sie dort trieben, war nichts anderes als das, was die Russen später in Sibirien tun sollten.
Die Spanier wie die Russen waren Weltmeister im Outsourcen. Iwan der Schreckliche überließ der Familie Stroganow gegen eine Scheibe vom Kuchen das Monopol auf alles, was östlich des Urals zu holen war; die spanischen Könige gestanden praktisch jedem, der darum bat, das Recht zu, alles zu behalten, was sie in Amerika finden konnten, solange die Habsburger nur 20 Prozent davon bekamen. |444|In Sibirien wie in Amerika schwärmten kleine Abenteurergrüppchen aus, errichteten quer über ein unvorstellbar großes unerforschtes Gebiet (Abbildung 9.6) auf eigene Kosten Niederlassungen und schickten einen Brief nach dem anderen in die Heimat, in denen sie mehr Geld und mehr europäische Frauen forderten.

Abbildung 9.6: Die Seereiche 1500–1750
Die Pfeile zeigen die Routen des atlantischen Dreieckshandels mit Sklaven, Zucker, Rum, Nahrungsmitteln und Fertigwaren zwischen Europa, Afrika und Amerika.
Während die Russen vom Pelzfieber getrieben wurden, waren für die Spanier Gold und Silber die Objekte der Begierde. Die Spanier leckten Blut, als Cortés 1521 Tenochtitlán eroberte, und Francisco Pizarro steigerte ihren Rausch, als er 1533 den Inkakönig Atahualpa gefangen nehmen ließ und dessen Untertanen befahl, als Lösegeld einen sieben mal fünf Meter großen und drei Meter hohen Raum |445|mit Schätzen zu füllen. Die Inkas brauchten Wochen, um diesem Befehl nachzukommen. Auf Pizarros Geheiß wurden die gesammelten künstlerischen Errungenschaften der Andenzivilisation zu Barren eingeschmolzen – 6000 Kilogramm Gold und 12 000 Kilogramm Silber – und Atahualpa dann trotzdem erdrosselt.
Mit dieser relativ leichten Art der Bereicherung war es 1535 vorbei, aber der Traum von El Dorado, dem sagenhaften Goldreich, in dem das Edelmetall praktisch auf der Straße lag, sorgte dafür, dass immer mehr Schurken und Halsabschneider in Amerika eintrafen. »Täglich dachten sie an nichts anderes als an das Gold und das Silber und die Schätze der Indios von Peru«, beklagte sich ein Chronist. »Sie benahmen sich wie Verzweifelte, Wahnsinnige, Verrückte, waren völlig außer sich in ihrer Gier nach Gold und Silber.«26
Der Wahnsinn fand 1555 neue Nahrung, als die Silbergewinnung in der Neuen Welt dank verbesserter Bergbautechniken zu einem überaus gewinnträchtigen Geschäft wurde. Die Erträge waren märchenhaft: 50 000 Tonnen Silber wurden zwischen 1540 und 1700 von Amerika nach Europa geschafft, zwei Drittel davon aus Potosí am Cerro Rico, einem Berg im heutigen Bolivien, der praktisch zur Gänze aus Silbererz bestand. Bis 1580 hatten sich die Silbervorräte in Europa verdoppelt und der Anteil der Habsburger daran war um das Zehnfache gestiegen – ungeachtet der Tatsache, dass »jeder in Potosí geprägte Peso zehn Indios das Leben gekostet hat«27, wie ein spanischer Besucher 1638 schrieb. Wie die russischen Zaren sahen die Habsburger die Eroberung der noch unerforschten Randgebiete hauptsächlich als eine Möglichkeit, die Kriege zu finanzieren, mit denen sie eine Landmacht in Europa aufbauen wollten. »Potosí existiert nur, um den hochfliegenden Ambitionen Spaniens zu dienen«, schrieb ein anderer Beobachter. »Es dient dazu, die Türken zu bestrafen, die Mauren zu demütigen, Flandern erzittern zu lassen und England in Angst und Schrecken zu versetzen.«28
Den größten Teil des Silbers aus der Neuen Welt verwendeten die Habsburger, um die immensen Schulden bei ihren italienischen Finanziers zurückzubezahlen, von denen aus es wiederum nach China gelangte, wo die blühende Wirtschaft alles Silber erforderte, dessen man habhaft werden konnte. »Mit all den Silberbarren aus Peru, die nach China gebracht werden, könnte der Kaiser von China einen Palast bauen«, bemerkte ein Kaufmann.29 Doch auch wenn das Habsburger Reich Silber aus- und das Ming-Reich dasselbe einführte, hatten sie ansonsten vieles gemein. Beiden war mehr daran gelegen, sich ein möglichst großes Stück vom Kuchen zu sichern, als daran, den Kuchen selbst zu vergrößern. Beide Reiche beschränkten den Überseehandel auf ein paar Auserwählte, deren staatlich verliehenes Monopol problemlos zu besteuern war.
Theoretisch durfte pro Jahr nur eine große Schiffsladung Silber über den Atlantik nach Spanien gebracht werden, und der Handel mit anderen Gütern war (auch wieder theoretisch) ebenso streng reguliert. Praktisch sah es hier genauso aus wie an den unruhigen Küsten Chinas: Diejenigen, denen die lukrativen Amigo-Geschäfte verwehrt waren, bauten einen riesigen Schwarzmarkt auf. Diese Schwarzhändler |446|konnten wie die Schmuggler in China die offiziellen Händler unterbieten, weil sie ihre Ware raubten, keine Steuern zahlten und im Übrigen jeden niederschossen, der ihnen in die Quere kam.
Die Franzosen, die in den 1520er und 1530er Jahren die Hauptlast der europäischen Kriege zu tragen hatten, stürzten sich als Erste ins Geschäft. Der erste Piratenangriff wurde 1536 vermeldet; in den 1550er Jahren waren solche Überfälle bereits an der Tagesordnung. »Entlang der gesamten Küste Haitis gibt es kein einziges Dorf, das die Franzosen nicht geplündert hätten«30, beklagte sich ein Amtsträger 1555. In den 1560er Jahren fingen auch englische Schmuggler an, Sklaven zollfrei zu verschieben oder, wenn sich die Gelegenheit ergab, Maultierkarawanen zu überfallen und das Silber, das sie mit sich führten, zu stehlen. Sie machten fette Beute, und innerhalb von 20 Jahren hatten sich die verwegensten Männer Westeuropas (sowie eine Handvoll Frauen) zusammengeschart, um es ihnen gleichzutun.
Wie China reagierte auch Spanien schwerfällig und halbherzig. Hier wie da fand man es billiger, das Piratenunwesen zu ignorieren, anstatt es zu bekämpfen. Erst in den 1560er Jahren nahmen beide Mächte ernsthaft den Kampf gegen die Piraten auf, und er sollte noch Jahrzehnte dauern. Im Jahr 1575 gingen chinesische und spanische Schiffe vor den Philippinischen Inseln sogar vereint gegen die Piraten vor.
Als die Chinesen und auch die Osmanen den Krieg gegen die Piraten weitgehend gewonnen hatten, sah sich Spanien jedoch mit der wesentlich schlimmeren Gefahr der Freibeuterei – einer staatlich geförderten Form der Piraterie – konfrontiert. Freibeuter waren Kapitäne, die seitens ihrer Herrscher nicht nur das verbriefte Recht hatten, die spanischen Karavellen zu kapern und auszurauben, sondern zu diesem Zweck sogar mit eigenen Fregatten oder Galeonen ausgestattet wurden. Und ihre Dreistigkeit kannte keine Grenzen. In den 1550er Jahren plünderte und brandschatzte der wüste französische Kaperkapitän »Holzbein« Le Clerc die wichtigsten Städte Kubas, und 1575 nahm der englische Freibeuter John Oxenham Kurs auf die Karibik, warf vor Panama die Anker aus und schleppte zwei seiner Schiffskanonen über die Landenge. Als er auf der pazifischen Seite angelangt war, ließ er Bäume fällen, baute ein neues Schiff, das er mit flüchtigen Sklaven bemannte, und terrorisierte ein paar Wochen lang die wehrlosen Bewohner der peruanischen Küste.
Oxenham endete schließlich in Lima am Strang, aber vier Jahre später trat sein alter Kamerad Francis Drake auf den Plan: mit der noch verwegeneren Idee, die Südspitze Südamerikas zu umsegeln und Peru nach allen Regeln der Kunst auszurauben. Nur eines seiner sechs Schiffe kam um Kap Hoorn herum, aber dieses Schiff war so schwer bewaffnet, dass es den Engländern umgehend die Seehoheit im Pazifischen Ozean sicherte. Drake brachte die größte Ladung Silber und Gold an sich, die je von spanischen Schiffen erbeutet wurde (über 25 Tonnen), und segelte dann, als ihm klar wurde, dass er auf der Route, die er auf der Hinfahrt |447|genommen hatte, nicht würde zurückkehren können, ungerührt mit seiner kostbaren Fracht um die ganze Welt. Piraterie zahlte sich aus: Drakes Geldgeber konnten 4700 Prozent Rendite auf ihre Investition verbuchen, und Königin Elizabeth I. benötigte nur zwei Drittel ihres Gewinnanteils, um die gesamten britischen Auslandsschulden Englands zu begleichen.
Von solchen Erfolgen ermutigt, schickten die Feinde Spaniens ihre eigenen Möchtegern-Konquistadoren in die Neue Welt. Das allerdings ging nicht besonders gut. In der Erwartung, Gold und Gewürze zu finden, gründeten die Franzosen – ein erstaunlicher Sieg der Hoffnung über die Erfahrung – 1541 eine Kolonie in Quebec. Da beides in Quebec ausgesprochen rar war, ging die Kolonie bald zugrunde. Und auch der nächste Versuch der Franzosen war nicht eben von Erfolg gekrönt: In noch getreulicherer Nachahmung der Spanier ließen sich französische Siedler in Florida quasi Tür an Tür mit einer spanischen Festung nieder und wurden prompt massakriert.
Die Engländer waren mit ihren ersten Versuchen nicht wesentlich erfolgreicher. Nachdem er 1579 Peru in Angst und Schrecken versetzt hatte, segelte Francis Drake die amerikanische Westküste hinauf und landete schließlich in Kalifornien (vielleicht in der malerischen Bucht bei San Francisco, die heute den Namen Drake’s Bay trägt). Hier ließ er die Einheimischen, die ihm am Strand über den Weg liefen, wissen, dass ihre Heimat ab sofort Nova Albion – Neuengland – heiße und Königin Elizabeth gehöre; um kurz darauf davonzusegeln und sich nie wieder blicken zu lassen.
Drakes Erzrivale Walter Raleigh gründete 1585 im heutigen North Carolina eine eigene Kolonie, die er Roanoke nannte. Raleigh, der offenbar realistischer war als Drake, brachte immerhin richtige Siedler ins Land, aber sein Plan, Roanoke als Piratennest zu nutzen und von hier aus spanische Schiffe auszuplündern, erwies sich als verhängnisvoller Fehler. Roanoke war zu ungünstig gelegen, und als Drake im darauffolgenden Jahr wieder vorbeikam, ergriffen die ausgehungerten Siedler die Gelegenheit beim Schopf und kehrten mit ihm in die Heimat zurück. Einer von Raleighs Offizieren setzte desungeachtet eine zweite Gruppe von Siedlern in Roanoke ab (eigentlich sollte er sie in ein geeigneteres Gebiet in der Chesapeake-Bucht bringen, hatte aber den Weg nicht gefunden). Keiner weiß, was aus ihnen geworden ist. Als ihr Gouverneur jedenfalls 1590 wieder vorbeischauen wollte, war niemand mehr da, und er fand nur noch das in einen Baum geritzte Wort »Croatan« (wie die Siedler Roanoke nannten) vor.
Die Siedlungsgebiete in der Neuen Welt waren wild, und das Leben war billig hier, aber das Leben der indigenen Amerikaner war noch billiger als das der Kolonisten. Die Spanier machten sich gern über die Unfähigkeit ihrer kaiserlichen Herren in Madrid lustig, und sie pflegten zu sagen: »Wenn der Tod aus Spanien käme, hätten wir alle ein langes Leben.«31 Die nordamerikanischen Ureinwohner fanden das vermutlich nicht sonderlich witzig. Für sie kam der Tod tatsächlich aus Spanien. Isoliert zwischen Atlantik und Pazifik lebend, also von Fremdeinflüssen |448|abgeschirmt, hatten sie keine Abwehrkräfte gegen die Krankheiten der Alten Welt entwickelt, sodass ihre Zahl innerhalb weniger Generationen nach Kolumbus’ Landung auf höchstens ein Viertel dezimiert war. Das war der »kolumbianische Austausch«, von dem in Kapitel 6 die Rede war: Die Europäer bekamen einen neuen Kontinent, die amerikanischen Ureinwohner bekamen die Pocken. Zwar verübten Europäer gelegentlich unvorstellbare Gräueltaten an der einheimischen Bevölkerung, aber häufiger noch wurde diese von einem unsichtbaren Tod ereilt: in Form von Mikroben, die mit der Atemluft oder durch Körperflüssigkeiten übertragen wurden. Überdies eilten den Europäern ihre Krankheiten meist voraus. Siedler übertrugen sie auf Einheimische, die sie dann stafettenartig im Hinterland verbreiteten. Folglich hatten die Weißen, wenn sie selber an Ort und Stelle auftauchten, kaum Schwierigkeiten, die dezimierten Gruppen amerikanischer Ureinwohner aus ihren angestammten Gebieten zu vertreiben.
Wo immer die Bedingungen gut waren, schufen Kolonisten »neu-europäische Gebiete«, wie der Historiker und Geograph Alfred Crosby es genannt hat, also Ableger ihrer alten Heimat – vertraute Tiere, Getreidepflanzen und Gemüse- und Obstsorten inbegriffen. Und selbst da, wo kein Siedler sich niederlassen wollte – wie in New Mexico, wo es den Worten eines spanischen Vizekönigs zufolge nichts gab außer »Nackten, Falschen Korallenschlangen und vier Kieselsteinen«32 –, veränderte der ökologische Imperialismus (auch einer der treffenden Begriffe, die Crosby geprägt hat) das Gesicht der Landschaft. Von Argentinien bis Texas gelangten Rinder, Schweine und Schafe in Freiheit, wo sie verwilderten, riesige Herden bildeten und die Weiten der Prärien und Pampas übernahmen.
Und nicht nur das, die Kolonisten schufen sogar bessere Europas, in denen sie nicht bei widerspenstigen Bauern den Pachtzins eintreiben mussten, sondern die indigene Bevölkerung, die noch am Leben war, in die Knechtschaft zwingen oder – wenn keine amerikanischen Ureinwohner greifbar waren – Sklaven aus Afrika einschleppen lassen konnten. Die ersten wurden 1510 registriert; 1650 lebten in den spanischen Kolonien Amerikas bereits mehr schwarze Sklaven als Europäer. »Selbst wenn du arm bist, geht es dir hier besser als in Spanien«, schrieb ein Siedler in einem Brief in die Heimat, »weil du hier immer das Sagen hast, nicht selbst arbeiten musst und immer auf einem Pferd sitzt.«33
Indem sie bessere Europas schufen, veränderten die Siedler wieder einmal grundlegend die Bedeutung der geographischen Bedingungen. Im 16. Jahrhundert, als europäische Imperialherrscher mit konservativem Weltbild die Neue Welt vor allem als Finanzierungsquelle für ihre Eroberungskriege gesehen hatten, war der Atlantische Ozean einfach nur ein lästiges Ärgernis zwischen Amerika und der Alten Welt gewesen. Im 17. Jahrhundert schien die geographische Trennung dagegen eher ein Vorteil zu sein. Die ökologischen Unterschiede zwischen der Neuen und der Alten Welt ermöglichten es den Kolonisten, Gebrauchsgüter zu produzieren, die es in Europa entweder nicht gab oder die in Amerika leichter herzustellen waren, und sie dann in die alte Heimat zu exportieren. Der Atlantik |449|stellte nun kein Hindernis mehr dar, sondern begann sich zu einer Handelsroute zu entwickeln, die Welten miteinander verband.
1608 kamen zum zweiten Mal französische Siedler nach Quebec, diesmal allerdings nicht als Schatzjäger, sondern als Pelzhändler. Ihr Geschäft blühte. In Jamestown waren englische Siedler dem Hungertod nah, bis sie 1612 entdeckten, dass Tabakpflanzen in Virginia prächtig gedeihen. Die Qualität des Tabaks war nicht so exquisit wie das, was die Spanier auf den karibischen Inseln ernteten, aber er war billig, und schon bald konnten die Produzenten ein Vermögen damit verdienen. 1613 ließen sich niederländische Pelzhändler auf Manhattan nieder und kauften dann den Algonkin die ganze Insel für schlappe 60 Gulden ab. Die Auswanderer, die in den 1620er Jahren aus religiösen Gründen England verlassen und sich in Massachusetts angesiedelt hatten, sprangen auf den Zug auf und schickten Holz für den Schiffsbau in die alte Heimat. In den 1650er Jahren lieferten die nordamerikanischen Siedler Rinder und getrockneten Fisch in die Karibik, wo Zucker – das weiße Gold – einen wahren Rausch ausgelöst hatte. Siedler und Sklaven wurden erst vereinzelt, dann in Scharen westwärts über den Atlantik geschwemmt, während exotische Waren plus Steuern Richtung Osten zurückschwappten.
Bis zu einem gewissen Grad hatten alle Pioniere, die in neue Siedlungsgebiete vorgedrungen waren, etwas Ähnliches getan. Griechen hatten aus den westlichen Mittelmeerregionen Weizen eingeführt, Chinesen hatten Reis aus dem Jangtse-Delta über den Kaiserkanal verschifft, und die Kolonisten, die sich am Rande der Steppen niedergelassen hatten, lieferten nun Holz, Pelze und Erze nach Moskau und Beijing. Doch dank der schieren Vielzahl ökologischer Nischen jenseits des Atlantiks und dank der Größe dieses Meeres waren die Westeuropäer in der Lage, etwas vollkommen Neues zu entwickeln: eine unabhängige interkontinentale Ökonomie, die durch ein Dreieckssystem überlappender Handelsnetze zusammengehalten wurde.
Anstatt einfach nur Waren von A nach B zu transportieren, schafften Kaufleute westeuropäische Gebrauchsgüter (Textilwaren, Gewehre usw.) nach Westafrika und tauschten sie dort mit Gewinn gegen Sklaven, die sie dann in die Karibik brachten und dort, auch wieder mit Gewinn, gegen Zucker eintauschten. Schließlich kehrten sie mit dem Zucker nach Europa zurück, wo sie das weiße Gold mit noch größerem Gewinn verkauften, bevor sie ein neues Kontingent an Fertigwaren erwarben und wieder Richtung Afrika in See stachen. Europäer wiederum, die sich in Nordamerika niedergelassen hatten, konnten Rum nach Afrika verschiffen und Sklaven in die Karibik holen, wo sie im Tausch gegen ihre menschliche Ware Melasse bekamen, die in Nordamerika für die Produktion von weiterem Rum gebraucht wurde. Andere brachten Nahrungsmittel in die Karibik (wo die mit Zuckerrohr bepflanzten Bodenflächen zu kostbar waren, um darauf Essbares für die Sklaven anzubauen), kauften dort Zucker ein, den sie nach Westeuropa lieferten, und kehrten dann mit Fertigwaren nach Nordamerika zurück.
|450|Auch die Vorteile der Rückständigkeit machten sich bemerkbar. Spanien, die große westeuropäische Imperialmacht des 16. Jahrhunderts, war die ausgeprägteste absolutistische Monarchie und betrachtete entsprechend ihre Kaufleute als Geldautomaten, die auf Befehl Bares ausspuckten, wenn sie bedroht wurden, und ihre Kolonien als lohnende Beute, die restlos ausgeplündert werden konnte. Wäre es den Habsburgern gelungen, ihre Gegner in eine vereinigte Landmacht zu zwingen, so hätte sich diese transatlantische Ökonomie sicher noch bis weit ins 17. Jahrhundert fortgesetzt. So aber gaben Kaufleute vom relativ rückständigen nördlichen Rand Europas, wo die Könige weniger mächtig waren, eine neue Richtung vor.
Tonangebend waren hier vor allem die Niederländer. Im 14. Jahrhundert waren die Niederlande ein wasserdurchtränkter, in mehrere Stadtstaaten zergliederter Randstreifen. Theoretisch gehörten die Niederlande zum Herrschaftsgebiet der Habsburger, praktisch befanden diese fernen, viel beschäftigten Herren das unbedeutende Gebiet im äußersten Nordwesten ihres Reiches jedoch keiner Mühe wert und überließen die Regierungsgeschäfte demzufolge den örtlichen Honoratioren. Um zu überleben, mussten die niederländischen Städte erfinderisch sein. In Ermangelung von Brennholz heizten die Niederländer mit Torf; in Ermangelung ausreichender Ackerflächen zur Deckung ihres Nahrungsbedarfs fischten sie in der Nordsee und tauschten ihren Fang im Ostseeraum gegen Getreide ein; und da es keine Könige und keine Adeligen gab, die ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten, sorgten die wohlhabenden Bürger der Niederlande dafür, dass in ihren Städten das Geschäftsleben blühte. Solides Geld und eine noch solidere Politik zogen immer mehr Geld an, bis aus den ehemals rückständigen Niederlanden im 16. Jahrhundert plötzlich Europas führendes Finanzzentrum geworden war. Nunmehr in der Lage, sich Geld zu niedrigen Zinsen zu leihen, waren die Niederländer bestens gerüstet, den endlosen Zermürbungskrieg zu finanzieren, der die Macht der Spanier allmählich brechen sollte.
England entwickelte sich unaufhaltsam in die gleiche Richtung wie die Niederlande. Vor der großen Pestepidemie um die Mitte des 14. Jahrhunderts war England ein echtes Königreich, doch durch den Aufschwung des Wollhandels gewannen die Kaufleute so viel Einfluss wie nirgendwo sonst außerhalb der Niederlande. Im 17. Jahrhundert übernahmen sie die Führung, lehnten sich gegen ihren relativ schwachen König Karl I. auf und machten ihn am Ende einen Kopf kürzer. Anschließend drängten sie die Regierung zum Bau einer großen, modernen Handelsflotte. Als ein unblutiger Umsturz im Jahr 1688 mit Wilhelm von Oranien einen niederländischen Prinzen auf den englischen Thron brachte, gehörten die Kaufleute zu den Hauptnutznießern.
Nach 1600 verlor Spanien allmählich seine Vormachtstellung, englische und niederländische Kaufleute drängten offensiv in den transatlantischen Handel. Wie Abbildung 9.3 zeigt, waren die Löhne am englisch-niederländischen Nordrand Europas schon 1350 geringfügig höher als in den reichen, aber übervölkerten |451|Städten Italiens. Nach 1600 klaffte die Schere jedoch immer weiter auseinander. Überall in Europa sanken die Löhne aufgrund der rasch wachsenden Bevölkerung auf das Niveau der Zeit vor dem Schwarzen Tod, nur im Nordwesten waren sie fast wieder so hoch wie im goldenen Zeitalter des 15. Jahrhunderts.
Dieser Wohlstand kam nicht daher, dass man die Reichtümer des amerikanischen Kontinents einfach ausgebeutet und nach Europa gebracht hätte, wie es die Spanier getan hatten. In der Debatte darum, welchen Anteil Kolonisierung und Handel am neuen Wohlstand hatten, liegen selbst die höchsten Schätzungen bei weniger als 15 Prozent, die niedrigsten gehen von fünf Prozent aus. Die atlantische Wirtschaft veränderte die Art, wie die Menschen arbeiteten – darin lag ihre revolutionäre Kraft.
Ich habe in diesem Buch Angst, Faulheit und Habgier mehrfach als die Triebkräfte der Geschichte genannt. Angst siegt im Allgemeinen über Faulheit, und als nach 1450 überall in Eurasien die Bevölkerungszahlen stiegen, begannen die Menschen zu handeln – aus Angst, ihre gesellschaftliche Stellung zu verlieren, nicht genug zu essen zu bekommen oder gar zu verhungern. Doch nach 1600, als der atlantische Handel mit seiner ökologischen Vielfalt, dem billigen Güterverkehr und den offenen Märkten den kleinen Leuten eine neue Welt des Konsums zugänglich machte, siegte auch die Habgier über die Faulheit. Im 18. Jahrhundert konnte sich ein Mensch, der ein bisschen Geld übrig hatte, nicht nur einen Laib Brot zusätzlich kaufen; er konnte sich vielmehr importierte Waren wie Tee, Kaffee, Tabak und Zucker leisten oder heimische Luxusartikel wie Tonpfeifen, Hüte oder auch Galanteriewaren. Zugleich brachte diese atlantische Wirtschaft, der die Fülle an Waren zu verdanken war, auch die Leute hervor, die in der Lage waren, einen solchen Menschen mit dem benötigten Geld zu versorgen. Denn weil die Händler vom Hut bis zur Wolldecke alles kauften und nach Amerika und Afrika verschifften, was sie ergattern konnten, mussten die Fabrikanten Leute einstellen und entlohnen, die diese Güter herstellten. Manche Bauern ließen ihre Familien spinnen und weben, andere verdingten sich in Werkstätten. Manche gaben die Landwirtschaft ganz auf, andere stellten fest, dass es sich lohnte, immer mehr Land für eine intensivere Bewirtschaftung einzuzäunen, zu bewässern und zu düngen und immer mehr Vieh zu halten, um die Nachfrage nach Nahrungsmitteln für die hungrigen Arbeiter zu decken.
Natürlich waren die Verhältnisse nicht überall gleich, aber im ganzen Nordwesten Europas verkauften die Menschen zunehmend ihre Arbeitskraft und arbeiteten immer länger. Und indem sie dies taten, konnten sie immer mehr Zucker, Tee und Baumwolltücher kaufen – was zur Folge hatte, dass immer mehr Sklaven über den Atlantik geschleppt, immer größere Flächen für Plantagen gerodet und immer mehr Fabriken und Werkstätten eröffnet wurden. Die Verkäufe stiegen und mit ihnen die Produktionsmengen. Folglich fielen die Preise, was wiederum dafür sorgte, dass noch mehr Europäer Zugang zu dieser Welt der Konsumgüter fanden.
|452|Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich rund um die nordatlantischen Küsten die erste Konsumkultur herausgebildet, was das Leben von Millionen veränderte. Männer, die es nie gewagt hätten, einen Fuß in ein Café zu setzen, wenn sie nicht wenigstens Lederschuhe und eine Taschenuhr vorweisen konnten – geschweige denn, ihrer Frau zu sagen, dass sie sich keinen Zucker für den Tee leisten konnten, wenn Gäste erwartet wurden –, waren weniger anfällig dafür, Dutzende von Feiertagen zu begehen oder nach alter Sitte montags blau zu machen, um den Kater vom Sonntag auszuschlafen. Angesichts der vielen Dinge, die es zu kaufen gab, war Zeit Geld. »Ein einziger Zeiger der Uhr genügte«, wie Thomas Hardy in einem seiner Romane beklagt hat, nicht mehr, »um den Tag einzuteilen«.34
Tatsächlich waren Uhren mit zwei Zeigern die geringste der Anforderungen, die dieses neue Zeitalter mit sich brachte. Die Menschen im Westen interessierten sich für Sämaschinen, Dreieckspflüge, Dampfkessel und Uhren, die nicht nur zwei Zeiger hatten, sondern auch noch auf der anderen Seite der Erdkugel die Zeit präzise anzeigten, sodass Schiffskapitäne mit ihrer Hilfe die Längengrade berechnen konnten. 2000 Jahre lang hatten die Stimmen der Alten genügt, um die brennenden Fragen des Lebens zu beantworten. Doch nun dämmerte den Menschen allmählich die Erkenntnis, dass ihnen die Weisheiten des klassischen Altertums die Dinge, die sie wissen mussten, nicht vermitteln konnten.
Der Titel, den Francis Bacon seinem 1620 erschienenen Buch gegeben hat, Novum Organum ( »Neue Methode«), sagt alles. Als Organon bezeichnete er die sechs Schriften, in denen Aristoteles sich über die Kunst der Logik ausgelassen hatte. Sein Ziel war es, etwas Neues an ihre Stelle zu setzen – »jedoch so, dass dabei die Ehre und der Ruhm der Alten nicht geschmälert … werde«. Er übernehme dabei bloß »die Rolle des Wegweisers«, um von den richtigen Grundlagen aus eine allgemeine Erneuerung der Wissenschaften und Künste sowie aller menschlichen Lehren zu beginnen. Diejenigen, die sich auf fremde Autoritäten stützten, »müssen die eingewurzelten verkehrten Vorstellungszweifel ohne Umstände zeitgemäß ändern: Dann erst mögen sie – wofern es ihnen beliebt –, also vorbereitet, ihr Urteil fällen.«35
Was aber sollte diese richtigen Grundlagen liefern? Ganz einfach: Beobachtung, unvoreingenommenes wissenschaftliches Forschen. Die Philosophen sollten aufhören, ihre Nase in Bücher zu stecken, und sich stattdessen alle Dinge ansehen, die ihnen unter die Augen kämen: Sterne und Insekten, Kanonen und Schiffsruder, Äpfel, die vom Baum fielen, und wackelnde Kronleuchter. Und sie sollten sich mit Hufschmieden, Uhrmachern und Mechanikern unterhalten – Leuten eben, die wussten, wie die Dinge funktionieren.
Wenn sie dies täten, so Bacon (und der Beifall von Galileo, Descartes und Heerscharen weniger bekannter Philosophen war ihm gewiss), könnten sie gar |453|nicht umhin, als zu dem einen Schluss zu kommen: dass nämlich die Natur kein lebendiger, atmender Organismus mit Wünschen und Zielen sei, wie die Alten behauptet hatten, sondern ein mechanisches Gebilde – fast wie ein Uhrwerk. Gott war der Uhrmacher, der das Getriebe der bewegten Natur in Gang gesetzt und sich dann zurückgezogen hatte. Und wenn das so war, mussten die Menschen in der Lage sein, die Funktionsweise der Natur ebenso leicht zu entschlüsseln wie irgendeinen anderen Mechanismus. Schließlich, so dachte sich René Descartes, ist es »der aus diesen und jenen Rädern zusammengesetzten Uhr ebenso natürlich, die Stunden anzuzeigen, als dem aus diesem oder jenem Samen aufgewachsenen Baum es ist, diese Früchte zu tragen«36.
Dieses mechanische Modell der Natur trug, gepaart mit ein paar blitzgescheiten Experimenten und logischen Schlussfolgerungen, außerordentlich reiche Früchte. Mit einem Schlag wurden Geheimnisse offenbart, die seit Anbeginn der Zeit im Dunkeln gelegen hatten. Luft, so zeigte sich, ist keine Leere, sondern eine stoffliche Substanz, das Herz pumpt Blut durch den Körper wie ein Blasebalg, und das Erstaunlichste: Die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums.
All diese Entdeckungen, die den Alten und auch der Heiligen Schrift widersprachen, lösten Stürme der Entrüstung aus. Galileo Galilei wurde für seine Himmelsbeobachtungen damit belohnt, dass man ihn vor ein Inquisitionsgericht zerrte und zwang, die Wahrheit seiner Erkenntnisse gegen besseres Wissen zu widerrufen. Doch alle kirchlichen Schikanen führten nur dazu, dass sich das neue Denken noch schneller vom mediterranen Kerngebiet nach Nordwesteuropa verbreitete, wo die gesellschaftliche Entwicklung die größten Fortschritte machte, die Probleme der alten Weltsicht am deutlichsten erkannt wurden und die Angst davor, sich mit der Obrigkeit anzulegen, am geringsten war.
In Nordeuropa begann man die Renaissance auf den Kopf zu stellen, indem man dem klassischen Altertum den Rücken kehrte, anstatt Antworten darin zu suchen, und in den 1690er Jahren, als die gesellschaftliche Entwicklung nur noch um Haaresbreite unter dem Höchststand lag, den sie im Römischen Reich erreicht hatte, debattierten gelehrte Herren in Paris über die Frage, ob die Moderne im Begriff sei, das Altertum zu überholen. Die Antwort lag mittlerweile für jeden, der Augen hatte, um zu sehen, klar auf der Hand. 1687 war Isaac Newtons Werk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica erschienen, für das er eigens die Technik der Infinitesimalrechnung entwickelt hatte, um sein mechanisches Himmelsmodell mathematisch darstellen zu können.1* Sie war selbst für gebildete Leser mindestens ebenso unverständlich, wie es Einsteins allgemeine Relativitätstheorie 230 Jahre später sein sollte, aber ungeachtet |454|dessen stimmten alle darin überein, dass sie den Beginn eines neuen Zeitalters einläutete.
Als man Englands Dichterfürsten Alexander Pope bat, der Geistesgröße Newton ein Denkmal zu setzen, dichtete er:
In Dunkel barg Natur ihr Angesicht,
Gott sprach: »Es werde Newton!« Und es ward Licht.37
In Wirklichkeit vollzog sich der Übergang von der Nacht zum Tag nicht ganz so plötzlich. Newton veröffentlichte seine Principia fünf Jahre, nachdem man in England die letzte Hexe aufgehängt hatte, und fünf Jahre vor Beginn der Hexenprozesse von Salem in Massachusetts. Und wie sich 1936 herausstellte, als Newtons persönliche Papiere in einer Auktion versteigert wurden, konnte sich der Naturphilosoph ebenso für die Alchimie begeistern wie für die Schwerkraft; auch war er bis zu seinem Tod überzeugt, dass es ihm eines Tages gelingen würde, Blei in Gold zu verwandeln. Aber schließlich war er beileibe nicht der einzige Wissenschaftler des 17. Jahrhunderts, der ein paar heutzutage eindeutig schrullig wirkende Überzeugungen vertrat. Allmählich entzauberten die Westeuropäer jedoch die Welt und vertrieben ihre Geister und Dämonen mit Hilfe der Mathematik. Zahlen wurden zum Maß der Wirklichkeit.
Was für die Natur galt, ließe sich ja vielleicht auch auf die Gesellschaft anwenden. Bis zu einem gewissen Grad nahmen Regierungsvertreter und die Finanzleute solche Überlegungen wohlwollend auf. Wenn man den Staat als Maschine betrachte, könnten Statistiker seine Haushaltseinnahmen berechnen und Minister sein kompliziertes Räderwerk justieren. Aber die neue Denkweise wurde auch mit Sorge aufgenommen. Die Naturwissenschaften hatten die Lehren der Alten als unbegründet abgetan und ihre eigene Richtung eingeschlagen. Würden die Gesellschaftswissenschaften genauso mit den Königen und der Kirche verfahren?
Wenn es, wie von Wissenschaftlern behauptet, tatsächlich keine besseren Methoden gab, um Gottes Willen zu begreifen, als Beobachtung und Vernunft, dann konnte man daraus logisch folgern, dass diese auch so gut wie keine anderen als Instrumente der Staatsführung geeignet waren. Ebenso vernünftig war John Locke zufolge die Annahme, Gott habe dem Menschen gewisse natürliche Rechte verliehen: »Er hat von Natur … die Macht, sein Eigentum – nämlich sein Leben und seine Habe – gegen das Unrecht und die Angriffe anderer Menschen zu schützen.« Daraus folgte für den Philosophen: »Das große und hauptsächliche Ziel also, zu dem sich Menschen in Staatswesen zusammenschließen, ist die Erhaltung ihres Eigentums.« Deshalb sind die Menschen »von Natur alle frei, gleich und unabhängig, und niemand kann aus diesem Zustand verstoßen und ohne seine Einwilligung der politischen Gewalt eines anderen unterworfen werden«38.
Solche Gedanken hätten schon dann für beträchtliche Unruhe gesorgt, wären sie nur in lateinischer Sprache in der Abgeschiedenheit altehrwürdiger, efeuumrankter Universitäten vorgebracht worden. Aber das war nicht der Fall. Wohlhabende |455|Damen der Gesellschaft richteten in Paris und später auch in anderen Großstädten Europas Salons ein, in denen die Gelehrten und die Mächtigen der Welt auf Tuchfühlung gingen und die Gedanken der Aufklärung die Runde machten. Debattierclubs wurden eröffnet und Vordenker der Aufklärung eingeladen, die neuen Ideen in Vorträgen zu erläutern und durch Experimente zu veranschaulichen. Billigere Drucktechniken, bessere Vertriebsmöglichkeiten und zunehmende Alphabetisierung schufen die Voraussetzungen dafür, dass neue Zeitschriften mit einer Mischung aus Berichterstattung, Gesellschaftskritik und Leserbriefen von zigtausend Menschen gelesen werden konnten. 300 Jahre vor Starbucks entdeckten geschäftstüchtige Kaffeehausbetreiber, dass die Kunden den ganzen Tag herumsaßen, lasen, diskutierten und Kaffee bestellten, wenn kostenlose Zeitungen und bequeme Stühle für sie bereitgehalten wurden. Etwas vollkommen Neues begann sich herauszukristallisieren: eine öffentliche Meinung.
Deren Protagonisten pflegten zu sagen, die Aufklärung breite sich in Europa aus und werfe ihr Licht in all die düsteren Winkel, über die Jahrhunderte des Aberglaubens ihre Schatten geworfen hätten. Aber was war die Aufklärung? Immanuel Kant drückte es ganz klar und einfach aus: »Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!«39
Die Gefahr für die herrschenden Monarchen war offensichtlich, doch anstatt sie zu bekämpfen, zeigten sich die meisten von ihnen kompromissbereit. Sie zogen es vor, sich als aufgeklärte Herrscher zu inszenieren, die zum Wohle der Allgemeinheit mit Vernunft regierten. »Die Philosophen sollen die Lehrer der Fürsten sein«, schrieb Preußens Friedrich II. 1740, »ihr folgerichtiges Denken ist die Schule für ein folgerichtiges fürstliches Handeln.«40
In Wirklichkeit fanden es die Fürsten eher lästig, wenn sich ihre Untertanen des Verstandes bedienten. In Großbritannien2* mussten sich die Könige schlichtweg damit abfinden, in Spanien konnte das aufklärerische Denken unterdrückt werden, aber Frankreich war einerseits so avantgardistisch (immerhin eine französische Wortprägung), dass es dort von Aufklärern nur so wimmelte, und andererseits so absolutistisch, dass deren Bücher von Zeit zu Zeit verboten und sie selbst ins Gefängnis gesteckt wurden.
Von allen Büchern und geistreichen Sprüchen, die Paris in den 1750er Jahren in Aufregung versetzten, reichte nichts in seiner Wirkung an das streitbarste und zugleich ehrgeizigste Werk der Aufklärung, Enzyklopädie oder alphabetisch geordnetes Lexikon der Wissenschaften, Künste und Gewerbe heran. Denis Diderot, Jean-Baptiste d’Alembert und die Verfasser der etwa 60 000 Artikel dieses Riesenwerks beanspruchten nichts weniger, als das gesamte Wissen der Zeit verfügbar zu machen, damit sich alles menschliche Handeln am Maßstab der Vernunft messen lassen könne. Zuhauf verkündeten Perücken tragende Rebellen, dass Sklaverei, |456|Kolonialismus sowie die Benachteiligung von Frauen und Juden vor dem Gesetz wider die Natur und die Vernunft seien. Und aus dem schweizerischen Exil zog der klügste Kopf von allen, Voltaire, gar mit dem Schlachtruf »Rottet sie aus, die Niedertracht!« gegen die Privilegien der Kirche und der Krone zu Felde.
Voltaire wusste genau, wo sich die Europäer nach Vorbildern aufgeklärter Herrschaftsmodelle umsehen mussten: in China. Dort gebe es einen weisen Despoten, der sich in den Regierungsgeschäften von einer rationalen Beamtenschaft beraten ließe, sinnlose Kriege meide und keine religiöse Verfolgung dulde. Es gebe dort außerdem den Konfuzianismus, der im Gegensatz zum Christentum ein Glaube der Vernunft ohne Aberglauben und alberne Legenden sei.
Voltaire hatte nicht ganz Unrecht, denn in China war der Absolutismus in Intellektuellenkreisen 100 Jahre vor seiner europäischen Geburt in Frage gestellt worden. Der Buchdruck hatte den Schriften des Neuen Denkens eine noch breitere Leserschaft beschert als in Westeuropa, und private Lehranstalten erlebten eine neue Blüte. Die berühmteste dieser Institutionen, die Donglin-Akademie, wandte sich noch eindeutiger gegen »die Niedertracht« als Voltaire. In den 1630er Jahren appellierte deren Leiter, Chen Zilong, an die Eigenverantwortung seiner Studenten, indem er sie aufrief, sich bei der Suche nach Antworten auf ihr eigenes Urteilsvermögen zu verlassen statt auf die alten Schriften, was zur Folge hatte, dass etliche Donglin-Studenten ins Gefängnis geworfen, gefoltert und hingerichtet wurden, weil sie es gewagt hatten, die Ming-Regierung zu kritisieren.
Als die Mandschuren 1644 nach diversen Eroberungskriegen an die Macht kamen und die Qing-Dynastie begründeten, verschärfte sich die Kritik der Intellektuellen nur. Hunderte von Gelehrten verweigerten ihnen die Gefolgschaft. Einer von ihnen war Gu Yanwu, ein untergeordneter Beamter, der die Prüfungen für die höchsten Ränge nie abgelegt hatte. Gu entzog sich dem Einfluss der Herrschenden, indem er sich in den fernen Randgebieten des Reiches niederließ. Hier kehrte er dem kleinkarierten metaphysischen Geplänkel den Rücken, das das akademische Leben des Ostens seit dem 12. Jahrhundert beherrscht hatte, und versuchte stattdessen wie Francis Bacon in England, sich die Welt begreiflich zu machen, indem er genau beobachtete, was wirkliche Menschen wirklich tun.
Fast 40 Jahre lang reiste Gu durch die Lande und füllte unzählige Notizbücher mit der Beschreibung von Tätigkeiten in der Landwirtschaft, im Bergbau und im Bankwesen. Das machte ihn berühmt. Andere Denker eigneten sich seine Methode an, allen voran Ärzte, die noch erschüttert darüber waren, wie vollkommen hilflos sie den großen Epidemien der 1640er Jahre gegenübergestanden hatten. Sie fingen an, Krankengeschichten zu sammeln und die überkommenen Theorien anhand realer Krankheitsverläufe zu überprüfen. In den 1690er Jahren war endlich sogar der Kaiser überzeugt, dass es von Vorteil sei, ein Problem zu lösen, »indem man ihm auf den Grund geht und mit einfachen Leuten darüber spricht«41.
Die Gelehrten des 18. Jahrhunderts nannten diesen Ansatz kaozheng, »beweisführende Forschung«. Er stellte Fakten über Annahmen, gab streng methodische |457|Vorgehensweisen für so unterschiedliche Wissenschaftsgebiete wie Mathematik, Astronomie, Geographie, Linguistik und Geschichtsforschung vor und entwickelte einheitliche Regeln zur Auswertung von Beweisen. Kaozheng entsprach der wissenschaftlichen Revolution in Westeuropa in jeder Hinsicht – bis auf einen Punkt: Kaozheng-Gelehrte entwickelten kein mechanisches Modell der Natur.
Wie ihre westlichen Kollegen waren die Intellektuellen im Osten oft frustriert über die Lehren, die sie aus der Zeit übernommen hatten, als die gesellschaftliche Entwicklung zuletzt die Obergrenze von 43 Punkten auf dem Index erreicht hatte (in China während der Song-Dynastie im 11. und 12. Jahrhundert). Anstatt aber deren Grundprämisse eines durch den Geist (qi) begründeten Universums zurückzuweisen und an deren Stelle das Bild einer Welt zu setzen, die wie das Räderwerk einer Maschine funktioniert, besannen sich die meisten Denker des Ostens auf die noch älteren und ehrwürdigeren Schriften der Han-Dynastie zurück. Selbst Gu Yanwu fand an den alten Schriften ebenso viel Gefallen wie am Studium des Bergbaus und der Landwirtschaft, und nicht wenige Ärzte benutzten die Krankengeschichten, die sie gesammelt hatten, nicht nur, um Menschen zu heilen, sondern auch und genauso gern, um die medizinischen Lehrtexte der Han-Zeit zu veranschaulichen. Anstatt die Renaissance auf den Kopf zu stellen, entschied man sich in China für eine zweite Renaissance. Es gab viele hervorragende Gelehrte, aber aufgrund dieser Entscheidung wurde aus keinem von ihnen ein Galilei oder ein Newton.
Und in dieser Hinsicht irrte Voltaire. Er stellte China just in dem Moment als leuchtendes Beispiel hin, als es aufhörte, ein solches zu sein. Etliche der Pariser Salonlöwen sahen klarer. Sie entwarfen ein vollkommen gegensätzliches Bild Chinas. Auch ohne einen Index, an dem sie hätten ablesen können, dass der Osten angesichts der gesellschaftliche Entwicklung im Westen nach und nach seine führende Rolle eingebüßt hatte, kamen diese Leute zu dem Schluss, dass China keineswegs der Idealvorstellung eines aufgeklärten Staates entsprach. Für sie war es vielmehr der Gegenpol zu allem, was europäisch war. In Europa hatte man Tatgendrang, rationales Denken und Kreativität von den alten Griechen gelernt und war nun im Begriff, die eigenen Lehrer zu überflügeln; China dagegen war das Land, in dem die Zeit stillstand.
Damit war die Langfristtheorie der westlichen Überlegenheit geboren. Einige Europäer wie etwa Montesquieu machten als eigentliche Ursache für diese Überlegenheit die Gunst des kühlen und erfrischenden Klimas aus. Für andere waren die Chinesen nicht nur unterwürfig, sondern eine vollkommen andere Menschenart. Carl von Linné, der Begründer der modernen Taxonomie, unterschied vier Menschenrassen: die weißhäutigen Europäer, die gelbhäutigen Asiaten, die rothäutigen Amerikaner und die schwarzhäutigen Afrikaner. Und in den 1770er Jahren kam der Philosoph David Hume zu der Erkenntnis, nur Weiße seien überhaupt fähig, eine echte Zivilisation zu entwickeln. Kant seinerseits fragte sich, ob gelbhäutige Menschen überhaupt als richtige Rasse gelten könnten. Vielleicht, |458|so sinnierte er, waren sie lediglich das Produkt einer Kreuzung von Indern und Mongolen.
Der Mut, sich ihres Verstandes zu bedienen, stand offensichtlich nur weißhäutigen Europäern zu.
1937 bestiegen drei junge Nachwuchswissenschaftler in Nanjing, der damaligen Hauptstadt Chinas, ein Schiff Richtung England. Es wäre ihnen zu jeder Zeit schwer gefallen, die chaotische Betriebsamkeit ihrer Heimatstadt (die wegen ihres feuchtheißen Klimas als einer der »vier Glutöfen« Chinas bekannt ist) gegen die stillen Wandelgänge, den unaufhörlichen Nieselregen und die schneidenden Winde in Cambridge einzutauschen; aber in diesem Sommer waren die Umstände besonders ungünstig. Die drei jungen Leute wussten nicht, ob sie ihre Familie und ihre Freunde je wiedersehen würden. Japanische Truppen waren auf dem Weg nach Nanjing. Ein paar Monate später sollten sie 300 000 Bürger von Nanjing so grausam niedermetzeln, dass selbst ein Nazioffizier, der Zeuge des Massakers wurde, entsetzt war.
Und die drei Flüchtlinge konnten auch nicht erwarten, dass man sie bei ihrer Ankunft freudig willkommen heißen würde. Heute wimmelt es an den wissenschaftlichen Fakultäten der Universität Cambridge von chinesischen Studenten, aber 1937 hatte das Vermächtnis von Hume und Kant noch nicht viel von seiner Wirkung verloren. Die Drei erregten beträchtliches Aufsehen, und vor allem Joseph Needham, ein aufgehender Stern am Institut für Biochemie, war regelrecht elektrisiert. Die Studentin Lu Gwei-djen, die zu der Gruppe der drei jungen Wissenschaftler aus Nanjing gehörte, berichtete später: »Je besser er uns kennen lernte, desto mehr stellte er fest, wie sehr wir ihm, was wissenschaftliches Auffassungsvermögen und intellektuellen Scharfblick betraf, ähnelten, und das veranlasste ihn dazu, sich zu fragen, warum die moderne Wissenschaft ihre Ursprünge nur in der westlichen Welt gehabt hatte.«42
Needham hatte zu dieser Zeit weder Sprachkenntnisse noch war er Historiker, aber er war einer der klügsten und eigensinnigsten Köpfe, die Cambridge zu bieten hatte, und das wollte schon etwas heißen. Lu wurde seine Geliebte und brachte ihm die chinesische Sprache und Geschichte näher. Und Needham verliebte sich so hoffnungslos in Lus Heimatland, dass er 1942 den sicheren Hafen seiner Universität verließ und im Auftrag der Royal Society einen Posten in Chongqing annahm, um die chinesischen Universitäten während des verheerenden Krieges gegen Japan zu unterstützen. Die BBC bat ihn förmlich, seine Eindrücke aufzuzeichnen, doch Needham tat viel mehr als das. Er kritzelte auf den Rand des BBC-Briefes eine Frage, die sein Leben verändern sollte: »Sci[ence] in general in China – why not develop?«43
|459|Diese Frage – warum es nämlich nach so vielen Jahrhunderten der wissenschaftlichen Überlegenheit der Chinesen die Westeuropäer waren, die im 17. Jahrhunderten die moderne Wissenschaft begründet hatten – ist heute allgemein als »Needham-Frage« bekannt. Und Needham schlug sich immer noch damit herum, als ich ihn 40 Jahre später in Cambridge kennen lernte (wo meine Frau Anthropologie studierte, Lu Gwei-djen – immer noch Needhams Geliebte, erst später seine zweite Gattin – ein Forschungsstipendium innehatte und wir die obere Etage in Lus Haus bewohnten). Er hat die Frage nie beantwortet, aber dass wir heute wesentlich besser als in den 1930er Jahren verstehen können, was sich abspielte, verdanken wir zum großen Teil der Akribie, mit der er über Jahrzehnte hinweg die wissenschaftlichen Errungenschaften Chinas katalogisierte.
Wie wir in Kapitel 7 gesehen haben, hatte China im 11. Jahrhundert, als die gesellschaftliche Entwicklung einen Höchststand erreichte, besonders rasante Fortschritte in Wissenschaft und Technik gemacht, die jedoch mit dem wirtschaftlichen und sozialen Niedergang endeten. Es stellt sich nun die Frage, warum chinesische Intellektuelle, als die gesellschaftliche Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert eine neuerliche Blüte erlebte, nicht wie ihre europäischen Kollegen daran gingen, mechanische Modelle der Natur zu entwerfen und deren Geheimnisse zu enträtseln.
Und wieder lautet die Antwort, dass Intellektuelle die Fragen stellen, die ihnen die gesellschaftliche Entwicklung aufzwingt: Jede geschichtliche Periode bekommt das Denken, das sie braucht. Westeuropa brauchte aufgrund der neu erschlossenen transatlantischen Siedlungsgebiete präzise Normen, um Einheiten von Raum, Zeit und Geld zu bemessen. In einer Zeit, in der Uhren mit zwei Zeigern zum Standard geworden waren, hätten die Europäer schon ziemlich begriffsstutzig sein müssen, wenn sie sich nicht gefragt hätten, ob die Natur selbst nicht auch ein Mechanismus sei. Und die Regierenden in Europa hätten noch begriffsstutziger sein müssen, wenn sie im wissenschaftlichen Denken nicht so viele Vorteile erkannt hätten, dass sie ihren exzentrischen und unberechenbaren Intellektuellen ein wenig Spielraum ließen. Wie die erste und die zweite Achsenzeit sowie die Renaissance waren Aufklärung und wissenschaftliche Revolution nicht Ursachen, sondern Folgen der fortschreitenden gesellschaftlichen Entwicklung.
Natürlich hatte der Osten seine eigenen neuen Siedlungsgebiete im Steppengürtel, aber dieses Neuland war für ihn weniger exotisch als die transatlantischen Territorien für Europa, und insofern war die Notwendigkeit eines neuen Denkansatzes weniger zwingend. Zwar stellten chinesische Natur- und Gesellschaftsphilosophen zum Teil die gleichen Fragen wie ihre westeuropäischen Kollegen, aber es erschien ihnen nicht so unbedingt erforderlich wie diesen, ein vollkommen neues Denkmodell im Sinne einer mechanischen Auffassung des Universums zu entwickeln. Zudem waren für die neuen Qing-Herrscher mit |460|einer zu großen Freiheit des Denkens wesentlich mehr Gefahren als Vorteile verbunden.
So tat der Hof der Qing alles in seiner Macht Stehende, um die Gelehrten aus ihren privaten Akademien und ihren Forschungsreisen nach fremden Gefilden in den Staatsdienst zurückzuholen. Die Qing richteten Sonderprüfungen ein, zahlten großzügige Gehälter und umwarben die intellektuelle Elite. Der junge Kaiser Kangxi präsentierte sich geflissentlich als Konfuzianer und scharte zum gemeinsamen Studium der klassischen Texte eine Gruppe von Gelehrten um sich. Um zu zeigen, dass es ihm ernst war mit der konfuzianischen Moral, erließ er 1670 ein »heiliges Edikt«. Darüber hinaus finanzierte er umfangreiche Enzyklopädien (die Vollständige Sammlung der Abbildungen und Schriften von den Anfängen bis zur Gegenwart, die kurz nach seinem Tod erschien, umfasste 800 000 Seiten1*), die allerdings anders als die Enzyklopädien, die zur gleichen Zeit in Frankreich veröffentlicht wurden, an kein Tabu rührten, sondern lediglich die alten Texte getreu wiedergaben und einer Gruppe regierungstreuer Gelehrter die Pfründe sicherten.
Die Rechnung ging in jeder Hinsicht auf, und während Intellektuelle in den Staatsdienst zurückdrängten, wurde kaozheng selbst zum Karrieresprungbrett. Die Prüfungskandidaten mussten Ergebnisse beweisführender Forschung nachweisen, die aber nur liefern konnte, wer Zugang zu guten Bibliotheken hatte. Das hatte zur Folge, dass niemand außer einer ganz kleinen Elite gute Prüfungsergebnisse erzielen konnte. Die Verlockung eines einträglichen Postens im Staatsdienst leistete dem konventionellen Denken gewaltigen Vorschub.
Auf die wichtige Frage, ob chinesische Intellektuelle, wäre ihnen mehr Zeit geblieben, ihre eigene wissenschaftliche Revolution bewirkt hätten, gehe ich im nächsten Kapitel ein. Aber wie die Dinge lagen, ließen ihnen die Westeuropäer diese Zeit nicht. Seit den 1570er Jahren waren Jesuiten von Macao aus als Missionare auf chinesisches Gebiet vorgedrungen, und obwohl sie gekommen waren, um Seelen zu retten, und nicht, um Wissenschaft zu verkaufen, wussten sie doch, dass kleine Geschenke die Freundschaft erhalten. Uhren aus dem Westen waren ebenso ein Renner wie Brillen. Kong Shangren, einer der bedeutendsten chinesischen Schriftsteller, dessen Augenlicht mit der Zeit immer schwächer geworden war, dichtete voller Begeisterung:
Von jenseits der westlichen Ozeane wird über Macao
Durchsichtiges Glas ins Land gebracht.
Zu Linsen so groß wie Münzen geschliffen,
Umfassen sie den Blick in einem doppelten Rahmen.
Ich setze sie auf – und plötzlich wird alles klar.
Ich kann bis in die Einzelheiten der Dinge sehen!
Und Kleingedrucktes im schwachen Licht am Fenster lesen
Wie in meiner Jugend.44
|461|Das größte Geschenk, das die Jesuiten mitbrachten, war jedoch die Astronomie. Den Missionaren war bewusst, dass der Kalender in China eine wichtige Rolle spielte. Wurde das Fest der Wintersonnenwende am falschen Tag gefeiert, konnte dies den Kosmos ebenso aus den Angeln heben wie in der christlichen Welt eine irrtümliche Verschiebung des Osterfestes. Die Regierenden in China nahmen diese Gefahr so ernst, dass sie sogar bereit waren, Ausländer im Amt für Astronomie einzustellen, wenn die Fremden – meist Araber und Perser – sich erwiesenermaßen besser mit den Sternen auskannten als einheimische Gelehrte.
Die Jesuiten sahen darin ganz richtig eine Möglichkeit, sich die Tür zum chinesischen Kaiserhof zu öffnen. Sie hatten in den 1580er Jahren ihren erklecklichen Teil zur Einführung des Gregorianischen Kalenders beigetragen, und obwohl ihr astronomisches System verglichen mit dem Wissensstand in Nordwesteuropa veraltet war (sie hielten beharrlich an der geozentrischen Sicht der Welt fest), war es doch besser als alles, was man in China finden konnte.
Anfangs lief alles wie geschmiert. Anfang des 17. Jahrhunderts traten dann ein paar höhere Beamte, beeindruckt von den mathematischen Kenntnissen der Jesuiten, heimlich zum Christentum über. Sie priesen die westlichen Wissenschaften als den ihrigen überlegen und übersetzten europäische Lehrbücher ins Chinesische. Die Konservativeren unter den chinesischen Gelehrten reagierten empört auf dieses unpatriotische Treiben, sodass sich der wichtigste Anhänger der Jesuiten genötigt sah, gemäßigtere Töne anzuschlagen: »Wir werden Stoff und Wesen des westlichen Wissens miteinander verschmelzen und in die Form des [traditionellen chinesischen] Systems der Großen Übereinstimmung gießen«45, versicherte er seinen Landsleuten und ließ gar die Vermutung folgen, die Wissenschaft des Westens habe ihren Ursprung möglicherweise in der chinesischen Weisheit früherer Tage.
Als die Mandschuren 1644 die Macht in Beijing übernahmen, schlugen die Jesuiten vor, einen öffentlichen Wettstreit im Voraussagen der nächsten Sonnenfinsternis zu veranstalten, den sie auch prompt gewannen. Sie standen so hoch im Ansehen wie noch nie, und im Jahr 1656 sah es ein paar berauschende Monate lang sogar so aus, als würde der Kaiser zum Christentum übertreten. Der Sieg schien ihnen schon sicher, als dem jugendlichen Herrscher klar wurde, dass Christen keine Konkubinen haben dürfen. So wurde er stattdessen Buddhist. Die Konservativen sahen die Stunde der Rache gekommen und bezichtigten den ranghöchsten Jesuiten der Spionage.
Im Jahr 1664 wurde ein neuerlicher Wettstreit am Fernrohr angeordnet, bei dem ein Jesuit, das Amt für Astronomie und ein muslimischer Astronom den genauen Zeitpunkt einer abermals bevorstehenden Sonnenfinsternis voraussagen sollten. Viertel nach zwei, sagte das Amt, halb drei, sagte der Muslim, punkt drei Uhr, sagte der Jesuit. Mit Hilfe von Linsen wurde das Bild der Sonne in einen verdunkelten Raum projiziert. Viertel nach zwei verging ohne Sonnenfinsternis. |462|Halb drei: Nichts tat sich. Aber fast auf den Schlag genau um drei Uhr schob sich ein Schatten vor die glühende Scheibe.
Nicht gut genug, beschieden die Richter und verboten das Christentum.
So weit, so gut, sollte man meinen – wäre da nicht die ärgerliche Tatsache gewesen, dass der chinesische Kalender immer noch falsch war. Also veranstaltete Kaiser Kangxi, kaum dass er 1668 den Thron bestiegen hatte, noch einmal einen Wettstreit. Wieder gewannen die Jesuiten.
Überzeugt von deren überlegenem Wissen stürzte sich Kangxi ins Studium ihrer Lehren, saß stundenlang bei den Priestern und ließ sich von ihnen in Arithmetik, Geometrie und Mechanik unterrichten. Er fing sogar an, Cembalo zu spielen. »Ich begriff auch, dass die westliche Mathematik ihren Nutzen hatte«, schrieb der Kaiser. »Auf Inspektionsreise bediente ich mich später der westlichen Verfahren, um meinen Beamten zu zeigen, wie sie bei der Planung ihrer Flussregulierungsarbeiten genauere Berechnungen anstellen konnten.« Er erkannte an, »dass die ›neuen Rechenmethoden‹ … grundlegende Fehler unmöglich« machten und »die Grundregeln der westlichen Kalenderwissenschaft … fehlerfrei« waren, aber jeden weiteren Überlegenheitsanspruch der Jesuiten in Bezug auf ihren Gott und ihre Wissenschaft wies er zurück. »Denn wenn sich auch manche westlichen Methoden von unseren unterscheiden und vielleicht sogar eine Verbesserung bedeuten, so bieten sie doch wenig Neues. Die Grundregeln der Mathematik leiten sich allesamt vom Buch der Wandlungen her, und die westlichen Methoden sind chinesischen Ursprungs. … Letzten Endes ist keiner der Europäer in der chinesischen Literatur wirklich bewandert.«46
In Sorge, die Jesuiten könnten sich eifriger für die Astronomie einsetzen als für die christliche Religion, entsandte der Papst 1704 einen Emissär nach Beijing, der ein Auge auf die Ordensbrüder haben sollte. Kangxi schob daraufhin die Missionare auf das Abstellgleis, indem er nach dem Vorbild der Pariser Akademie der Wissenschaften Lehrstätten einrichtete, in denen chinesische Gelehrte, frei vom Einfluss der Jesuiten, Astronomie und Mathematik studieren konnten. Die jesuitische Mathematik, in der nur wenig Algebra und noch weniger Infinitesimalrechnung vorkamen, war bereits um Jahrzehnte hinter dem zurück, was in Nordeuropa gelehrt wurde. Als Kangxi aber auch noch diese Verbindung zur westlichen Wissenschaft kappte, vertiefte sich die akademische Kluft zwischen Osten und Westen zu einem Abgrund.
Es wäre sicher verlockend, in Kangxi (siehe Abbildung 9.7) die Antwort auf Needhams Frage zu sehen, ihn also für den vertrottelten Stümper zu halten, der die chinesische Wissenschaft ins 18. Jahrhundert hätte führen können, sich aber entschied, dies nicht zu tun. Doch von allen Männern (und der einen Frau), die auf dem Himmlischen Thron gesessen haben, ist Kangxi wohl derjenige, der ein solches Etikett am wenigsten verdiente. Er war ein echter Gelehrter, ein starker Regent und ein tatkräftiger Mann (der unter anderem 56 Kinder zeugte). Kangxi sah Westeuropa in einem größeren Zusammenhang. 2000 Jahre lang hatten chinesische Kaiser die taktische Überlegenheit nomadischer Kriegführung hinnehmen |463|müssen und es im Allgemeinen für weniger gefährlich gehalten, die Reitertruppen zu bestechen, als gegen sie zu kämpfen. Kangxi war der Erste, der erkannte, dass sich das zu ändern begann, und er führte selbst die Feldzüge an, in deren Folge der Steppenschnellweg in den 1690er Jahren abgeschnitten wurde. Mit den Westeuropäern hatte Kangxi seit den 1660er Jahren die Verbindung gepflegt, doch nun erschien es ihm als weniger gefährlich, sie einfach links liegen zu lassen. Ein paar südostasiatische Regenten waren schon im 16. Jahrhundert zu der gleichen Einschätzung gekommen, und die Japaner waren ihnen 1613 darin gefolgt. Ein gewalttätiger Aufstand im Jahr 1637, an dem viele Christen beteiligt waren, bestätigte die Klugheit der Entscheidung, die Verbindungen zum Westen abzubrechen. In diesem Licht betrachtet, sieht Kangxis Verhalten keineswegs nach Stümperei aus.
Auf jeden Fall indes muss eine weitere Frage gestellt werden. Hätte Kangxi, selbst wenn ihm bewusst gewesen wäre, wie sich die westliche Wissenschaft entwickelte, und wenn er sie in China gefördert hätte, den Vorsprung der gesellschaftlichen Entwicklung im Osten im 18. Jahrhundert halten können?
Die Antwort lautet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit: nein. Es war die Verschiebung der westlichen Grenzen über den Atlantik hinaus, die dafür sorgte, dass in Europa lauthals und hektisch nach Antworten auf neue Fragen gerufen wurde. Die Erweiterung des chinesischen Einflussbereichs auf die Steppengebiete stellte keine auch nur annähernd vergleichbare Herausforderung dar. Die gut bezahlten Gelehrten in Kangxis wissenschaftlichen Instituten sahen keine Notwendigkeit, sich mit der Entwicklung der Infinitesimalrechnung aufzuhalten oder herauszufinden, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Für sie war es viel nutzbringender, die Mathematik – wie die Medizin – als einen Zweig der klassischen Lehren zu behandeln.
Beide, der Osten wie der Westen, bekamen das Denken, das sie brauchten.
Als Kangxi 1722 starb, hatte die gesellschaftliche Entwicklung einen höheren Stand erreicht als je zuvor. Zweimal im Laufe der Geschichte lag sie bei 43 Punkten – das erste Mal im Römischen Reich um 100 u. Z. und etwa 1000 Jahre später während der Song-Dynastie in China –, nur um in Katastrophen zu münden, die den Wert wieder nach unten drückten. Doch 1722 war der Steppenschnellweg abgeschnitten. Einer der apokalyptischen Reiter war tot, und die gesellschaftliche Entwicklung brach nicht ein, als sie an die Obergrenze stieß. Vielmehr stieg sie im Osten dank der territorialen Erweiterungen am Rande der Steppen weiter an, während der Westen, nunmehr vor Zuwanderungen durch Russland und China geschützt, seine Grenzen über den Atlantik ausdehnen konnte. Der Westen entwickelte sich noch schneller als der Osten und zog um 1773 an diesem vorbei. Auf beiden Seiten Eurasiens hatte ein neues Zeitalter begonnen.

Abbildung 9.7: Der große Stümper?
Kangxi, Kaiser von China, um 1700 porträtiert von dem italienischen Maler Giovanni Gherardi.
Aber kann davon wirklich die Rede sein? Wäre ein Römer oder ein Chinese der Song-Zeit ins 18. Jahrhundert nach London oder Beijing versetzt worden, so hätte er sicher vieles bestaunt. Gewehre beispielsweise. Oder Amerika. Oder Tabak, Kaffee und Schokolade. Und was die Mode betraf – gepuderte Perücken? Mandschu-Zöpfe? Geschnürte Mieder? Abgebundene Füße? O tempora, o mores! ( »O Zeiten! O Sitten!«), wie Cicero zu sagen pflegte.
Noch mehr, viel mehr, wäre ihm allerdings vertraut vorgekommen. Die großen, mit Kanonen und Gewehren bewaffneten Armeen der modernen Welt waren sicher stärker als die Streitkräfte früherer Zeiten, und es konnten mehr Menschen lesen als je zuvor, aber weder der Westen noch der Osten hatten eine Millionenstadt vorzuweisen, wie es das alte Rom oder das mittelalterliche Kaifeng gewesen waren.1* Vor allem aber hätte der Besucher bemerkt, dass die Art |465|und Weise, wie die Menschen die Entwicklung – gleichviel, dass deren Stand so hoch war wie noch nie – vorantrieben, sich nicht wesentlich von den Bemühungen unterschied, die er zu seiner Zeit selbst an den Tag gelegt hatte. Die Bauern verwendeten mehr Dünger, legten mehr Bewässerungsgräben an, wechselten die Fruchtfolge in kürzerem Turnus und ließen weniger Felder brachliegen. Handwerker verbrannten mehr Holz, um Metall zu gießen, und gingen zu Kohle über, als das Holz knapp wurde. Es wurden mehr und größere Tiere gezüchtet, die Lasten trugen und bessere Wagen über glattere Straßen zogen. Wind und Wasser wurden nutzbar gemacht, um Erze zu zerkleinern und Getreide zu mahlen, für die Schifffahrt wurden Flüsse begradigt und künstliche Kanäle angelegt. Gut, unser Besucher aus Rom oder aus Song-China hätte vermutlich eingeräumt, dass im 18. Jahrhundert vieles größer und besser war als im 1. oder 11. Jahrhundert, zugleich aber wohl doch verneint, dass sich die Dinge grundlegend anders verhielten.
Und da lag der Hund begraben. Die Eroberung der Steppen und der Ozeane hatte die Obergrenze von etwa 43 Punkten, die die Römer und Song-Chinesen erreicht hatten, nicht durchstoßen: Sie hatte sie lediglich ein wenig nach oben gedrückt, und um 1750 gab es bereits beunruhigende Zeichen dafür, dass sich die Entwicklung erneut dagegen anstemmen musste. Die Entwicklungskurven der Reallöhne in Abbildung 9.3 veranschaulichen dies. Um 1750 sank der Lebensstandard allenthalben, sogar im dynamischen Nordwesten Europas. Die Zeiten drohten abermals schwerer zu werden.
Was war da zu tun? Die Bürokraten in Beijing, die Salonzirkel in Paris und alle einigermaßen selbstbewussten Intellektuellen irgendwo zwischendrin warteten mit den unterschiedlichsten Theorien auf. Die einen waren der Meinung, aller Wohlstand werde von den Bauern produziert. Folglich drängten sie die Regierenden, denjenigen, die Sümpfe trockenlegten und Berghänge terrassierten, Steuererleichterungen zu gewähren. Andere behaupteten, aller Wohlstand verdanke sich dem Handel. Also verwendeten die Regierenden (oft genug dieselben) noch mehr Mittel darauf, ihre Nachbarn an den Bettelstab zu bringen, indem sie deren Handelsgeschäfte übernahmen.
Die Maßnahmen waren vielfältig, doch kristallisierte sich prinzipiell heraus, dass die Regierenden im Westen (die sich schon seit dem 15. Jahrhundert so erbittert bekämpften) Krieg für die Lösung ihrer Probleme hielten. Hingegen waren die Regierenden im Osten (die sich im Allgemeinen kriegerisch zurückgehalten hatten) vom Gegenteil überzeugt. Japan belegte dies am eindeutigsten. Nachdem sich das Land 1598 aus Korea zurückgezogen hatte, kamen die Regierenden zu dem Schluss, dass mit Eroberungen nichts zu gewinnen war, und in den 1630er Jahren stellten sie überdies fest, dass sie beim Überseehandel nur wertvolle Güter wie Silber und Kupfer einbüßten. Chinesische und niederländische Kaufleute (die Niederländer waren 1640 die einzigen Ausländer, die überhaupt nach Japan einreisen durften) lebten in winzigen Ghettos in Nagasaki, und die einzigen Frauen, |466|die Zutritt zu ihren Quartieren hatten, waren japanische Prostituierte. Kein Wunder also, dass der Handel mit dem Ausland vor sich hin kümmerte.
Durch seine Insellage vor feindlichen Angriffen geschützt, ging es Japan bis etwa 1720 prächtig. Die Bevölkerungszahl verdoppelte sich, und Edo entwickelte sich zur größten Stadt der Welt. Reis, Fisch und Soja verdrängten billigere Nahrungsmittel vom Speiseplan der Japaner. Und es herrschte Frieden: Nachdem die Bauern 1587 ihre Waffen bei den Truppen Toyotomi Hideyoshis abgeliefert hatten, legten sie sich nie wieder neue Schwerter und erst recht keine Gewehre zu. Und selbst die stolzen Samuraikrieger willigten ein, ihre Streitigkeiten nur noch durch Schwertkämpfe auszutragen, worüber die Amerikaner, die sich in den 1850er Jahren den Weg nach Japan erstritten, nicht schlecht staunten. Ein Admiral gab zu Protokoll:
Diesen Menschen war der Gebrauch von Feuerwaffen anscheinend so gut wie unbekannt. Einer meiner Offiziere schnappte das japanische Wort für Gewehr auf, mit dem ein sehr gebildeter Mann den Umstehenden seine Beschlagenheit unter Beweis stellte. Ein Amerikaner, der von kleinauf an den Anblick von Kindern mit Spielzeugpistolen gewöhnt ist, kann nicht umhin, in der Unkenntnis von Waffen etwas Absonderliches zu sehen, das von ursprünglicher Unschuld und arkadischer Einfalt zeugt. Wir waren nicht gewillt, hier als Störenfriede aufzutreten.47
Nach 1720 trübte sich das Bild jedoch zunehmend ein. Japan platzte aus allen Nähten. Ohne einen entscheidenden technischen Durchbruch war es unmöglich, aus dem überbevölkerten Land noch mehr Nahrungsmittel, Treibstoff, Bekleidung und Wohnstätten herauszuholen, und ohne Außenhandel konnten diese Dinge auch nicht importiert werden. Die Bauern Japans legten einen erstaunlichen Erfindungsreichtum an den Tag. Die Regierenden erkannten, welchen Schaden die Gier nach Brennmaterial ihren Wäldern zugefügt hatten, und begannen, sie zu schützen. Die japanische Kulturelite entwickelte einen strengen ästhetischen Minimalismus, um die Ressourcen des Landes möglichst zu schonen. Doch die Lebensmittelpreise stiegen, Hunger breitete sich aus, und unzufriedene Massen trugen ihren Protest auf die Straße. Arkadien sah anders aus.
Japan konnte diesen drastischen Weg nur beschreiten, weil China, das einzige Land, das eine ernst zu nehmende Gefahr für seine Sicherheit darstellte, sich in die gleiche Richtung bewegte. In China konnte die Bevölkerung zwar aufgrund der ausgedehnten, offenen Grenzen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts getrost weiter wachsen, doch auch die Qing-Regierung schottete das Land zunehmend gegen die Gefahren aus der Welt jenseits der Ozeane ab. 1760 wurden ausländische Handelsniederlassungen auf Guangzhou beschränkt, und als Lord Macartney im Auftrag der Britischen Ostindiengesellschaft 1793 nach China reiste, um sich über die Schikanen zu beklagen, verwies ihn Kaiser Qianlong herrisch in die Schranken. »Raffinierte Gegenstände«, so schrieb er, »haben wir nie geschätzt, und wir bedürfen in keiner Weise der Erzeugnisse Englands. Weitere Beziehungen stehen |467|nicht im Einklang mit den Gesetzen des Himmlischen Reiches … und wären für Ihr Land nicht von Vorteil.«48
Im Westen teilten nur wenige Regierende Qianlongs Glauben an die Abkapselung. Die Welt, in der sie lebten, wurde nicht von einem einzigen großen Kaiserreich beherrscht, sondern sie war geprägt von permanenten territorialen Streitereien und Machtverschiebungen. Die westlichen Herrscher gaben sich der Überzeugung hin, dass die Reichtümer der Welt zwar endlich seien, sie sich aber gegebenenfalls ein größeres Stück vom Kuchen schnappen könnten. Jeder Gulden, jeder Franc und jedes Pfund, das sie für Kriege ausgäben, würde sich eines Tages auszahlen – und solange auch nur noch ein Monarch dieser Ansicht war, mussten alle anderen ebenfalls für den Kampf gerüstet sein. In Westeuropa hörte das Wettrüsten nie auf.
Die europäischen Händler des Todes verbesserten die Werkzeuge ihres Gewerbes ständig (bessere Bajonette, vorgefertigte Schießpulverpatronen, schnellere Abzugsmechanismen), aber den eigentlichen Durchbruch brachte die systematische Organisation der Gewalt. Zucht und Ordnung – in Form von Uniformen, festgelegten Dienstgraden und Erschießungskommandos nun auch für Offiziere, die taten, was sie wollten (die einfachen Soldaten waren schon immer brutal bestraft worden, wenn sie Befehlen nicht Folge leisteten) – wirkten Wunder, und eine praktische Ausbildung, die das ganze Jahr über andauerte, erzeugte Kampfmaschinen, die in der Lage waren, komplexe Manöver auszuführen und dabei gleichmäßige Salven aus ihren Waffen abzufeuern.
Solche disziplinierten Kriegshunde lieferten mehr Tote für ihr Geld ab. Die Niederländer waren die Ersten, die der billigen, aber üblen Tradition ein Ende machten, Kriege an Privatunternehmer zu übertragen. Solche Warlords hatten mörderische Haufen angeheuert, ihre Söldner aber nur selten oder gar nie bezahlt und es ihnen stattdessen überlassen, sich ihren Sold bei der Zivilbevölkerung selbst zu holen. Die anderen westeuropäischen Länder taten es den Niederländern nach und nach gleich. Krieg war nach wie vor die Hölle, aber jetzt war es immerhin eine geregeltere Hölle.
Das Gleiche galt auf See, wo sich der Vorhang über die Zeit der Totenkopfflaggen und der vergrabenen Schätze senkte. England wollte nichts mehr von seiner Francis-Drake-Vergangenheit wissen und führte nun Krieg gegen die Piraterie. Als der berüchtigte Captain Morgan 1671 den Friedensvertrag zwischen England und Spanien missachtet und ein paar spanische Kolonien in der Karibik überfallen hatte, war er dafür mit Unterstützung seiner einflussreichen Hintermänner in den Adelsstand erhoben und zum Gouverneur von Jamaika ernannt worden. Der nicht weniger berüchtigte Captain Kidd hingegen wurde 30 Jahre später, nur weil er ein britisches Schiff überfallen hatte, nach London geschleppt, wo er erfahren musste, dass seine einflussreichen Hintermänner (einschließlich des Königs) ihm nicht helfen konnten oder wollten. So gab er seinen letzten Schilling für eine Buddel Rum aus und randalierte, bevor man |468|ihm die Schlinge um den Hals legte: »Ich bin der Unschuldigste von allen!«49 – woraufhin das Seil riss. Das hätte ihm früher vielleicht einmal das Leben gerettet, aber diese Zeiten waren vorbei. Ein zweites Seil vollendete das Werk. Als die Marine 1718 den Oberpiraten Edward Teach, genannt Blackbeard, in einen Hinterhalt lockte, machte niemand auch nur den Versuch, ihm zu helfen. Blackbeard zeigte sich zählebiger als Kidd: Fünf Gewehrkugeln und 25 Schwerthiebe streckten ihn schließlich nieder. Im selben Jahr wurden im Karibischen Meer 25 Piratenüberfälle gezählt, 1726 waren es nur noch sechs. Die Zeit der gesetzlosen Abenteurer war vorbei.
Das alles kostete Geld, und die Fortschritte in der organisierten Kriegführung setzten noch größere Fortschritte im Finanzwesen voraus. Eigentlich konnte es sich kein Land leisten, ein Heer von Land- und Marinesoldaten das ganze Jahr über zu ernähren, zu bezahlen und auszurüsten. Auch für dieses Problem fanden die Niederländer eine Lösung: Kredite. Man braucht Geld, um Geld zu bekommen, und da die Niederlande über so stabile Einkünfte aus dem Handel und so solide Banken zur Regelung des Geldflusses verfügten, konnten die regierenden Krämer in kürzerer Zeit höhere Kredite zu niedrigen Zinsen und bei längerfristiger Abzahlung aufnehmen als ihre verschwenderischeren Konkurrenten.
Wieder war es England, das dem Beispiel der Niederlande folgte. Um 1700 hatten beide Länder eine Staatsbank, die die öffentlichen Schulden regulierte, indem sie langfristige Anleihen verkaufte, während die Regierung die Bedenken der Käufer ausräumte, indem sie aus Steuereinnahmen Zinsen auf die Anleihen zahlte. Die Folgen waren überwältigend. Daniel Defoe (der Verfasser von Robinson Crusoe, diesem epischen Roman über die neuen ozeanischen Verkehrswege) schrieb über das englische Kreditwesen:
Kredit macht Kriege, und er macht Frieden; er stellt Armeen auf, rüstet Kriegsflotten aus, schlägt Schlachten, belagert Städte; kurz gesagt wird er mit größerem Recht als die Triebfeder des Krieges bezeichnet als das Geld selbst. … Kredit lässt Soldaten ohne Bezahlung kämpfen und Truppen ohne Proviant marschieren … und spült bei Bedarf beliebig viele Millionen in die Kassen des Fiskus und der Banken.50
Unbegrenzte Kredite hatten endlose Kriege zur Folge. Großbritannien musste 20 Jahre lang Krieg führen, um den Niederländern das größte Stück ihres Handelskuchens abzujagen, aber dieser Sieg ebnete nur den Weg für noch heftigere Kämpfe. Frankreich schien entschlossen, die Landmacht zu werden, von der die Habsburger vergeblich geträumt hatten, und britische Politiker äußerten sich besorgt, dass die Franzosen auf See angreifen könnten, wenn sie zu Lande nichts mehr zu fürchten hätten. Der britische Premierminister William Pitt (der Ältere) schlug als Lösung des Problems vor, »Amerika mit Hilfe von Deutschland zu erobern«51 und kontinentale Allianzen zu finanzieren, damit die französischen Truppen in Europa beschäftigt seien, während die Briten ihr Kolonialreich nach allen Seiten vergrößern könnten.
|469|Die britisch-französischen Kriege zogen sich von 1689, als der erste Versuch Frankreichs, in England einzufallen, scheiterte, bis 1815, als Napoleon in der Schlacht von Waterloo eine endgültige Niederlage erlitt. Bei diesen gewaltigen Schlachten ging es um nichts anderes als um die Vorherrschaft im Kerngebiet Europas. Auch in den Wäldern Kanadas und Ohios, auf den Plantagen der Karibik und in den Dschungeln Westafrikas und Bengalens trugen Europäer und (mehr noch) ihre einheimischen Verbündeten Dutzende kleiner, aber heftiger Scharmützel aus, die zusammen genommen den Krieg des Westens zur ersten weltumspannenden kriegerischen Auseinandersetzung machten. Es gab kühne Taten und niederträchtigen Verrat genug, um so manches Buch damit zu füllen, aber die eigentliche Geschichte wurde in Pfund, Schilling und Pence geschrieben. Die Briten rüsteten ihre Kriegsflotte und Truppen mit Krediten immer neu auf, während die Franzosen ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen konnten. »Unsere Glocken sind ganz dünnwandig geworden vom vielen Siegesgeläut«52, frohlockte der britische Schriftsteller Horace Walpole 1759, und 1763 war Frankreich finanziell so ausgelaugt, dass dem Land keine andere Wahl blieb, als seine Überseekolonien fast vollständig abzutreten (Abbildung 9.8).
Doch der Krieg des Westens war noch nicht einmal zur Hälfte ausgefochten. Selbst in Großbritannien machten sich die finanziellen Belastungen bemerkbar, und als die wenig durchdachten Pläne, den amerikanischen Kolonisten einen Teil der Last aufzubürden, 1776 zu einer Revolte führten, waren die Franzosen mit Geld und Schiffen zur Stelle, um den Rebellen den Rücken zu stärken. Nicht einmal mit ihren Krediten waren die Briten in der Lage, zugleich wild entschlossene Rebellen auf der anderen Seite des Atlantiks und eine andere Großmacht auf dem eigenen Kontinent in Schach zu halten.
Geld konnte jedoch der Niederlage ihren Stachel nehmen. Eigentlich hätte der Verlust Amerikas an Revolutionäre, die ihren Anspruch auf Glück und Unabhängigkeit in einer Sprache feierten, in der sich die Gedanken der französischen Aufklärung spiegelten, der atlantischen Wirtschaft Großbritanniens den Todesstoß versetzen und Frankreich zur herrschenden Macht in Europa machen müssen. Doch auch diesmal retteten Kredite die Situation. Großbritannien konnte seine Schulden abbezahlen, ließ die Seewege auch weiterhin von seiner Flotte überwachen und fuhr fort, Güter auszuführen, die in Amerika nach wie vor gebraucht wurden. 1789 hatte der transatlantische Handel Großbritanniens wieder den Umfang erreicht, den er vor dem Unabhängigkeitskrieg gehabt hatte.
Für Frankreich hingegen war das Jahr 1789 eine Katastrophe. Ludwig XVI. hatte durch sein Eingreifen zugunsten der Kolonisten Schulden angehäuft, die er nicht zurückzahlen konnte. Er sah sich darum gezwungen, dem Adel, der Kirche und den Wohlhabenden höhere Steuern abzuverlangen, was die Bürger dazu veranlasste, die Aufklärung gegen ihn selbst ins Feld zu führen. Die Nationalversammlung verabschiedete die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte (in die zwei Jahre später auch die Frauen einbezogen wurden), und die großbürgerlichen
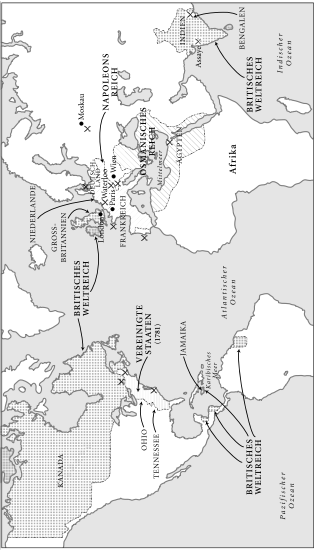
Abbildung 9.8: Die ganze Welt
ist eine Bühne
Der Krieg des Westens, den England und seine Verbündeten von 1689
bis 1815 gegen Frankreich führten, auf der globalen Bühne. Die
gekreuzten Schwerter zeigen die Schauplätze wichtiger Schlachten
an, das Britische Kolonialreich in den Grenzen von 1815 ist durch
gepunktete Flächen gekennzeichnet.
|471|Fraktionen des Dritten Standes fanden sich wider Willen als Drahtzieher einer unüberschaubaren Spirale der Gewalt und des Bürgerkrieges wieder, aus der sie sich zugleich nach Kräften herauszuhalten suchten. »Setzt den Terror auf die Tagesordnung«53, forderten die Radikalen und richteten anschließend den König, seine Familie und Tausende ihrer revolutionären Weggefährten hin.
Aber wieder entwickelten sich die Dinge anders, als vernünftigerweise zu erwarten gewesen wäre. Großbritannien konnte seine Kolonial- und Handelsmacht nicht zur Vorherrschaft in Europa ummünzen. Zudem war die Periode der Kabinettskriege vorbei. Die Französische Revolution machte den Weg frei für die Levée en masse, eine neue Form der Massenmobilisierung, und ein paar Jahre lang sah es während der Koalitionskriege so aus, als würde es Napoleon, dem genialen Feldherrn, endlich gelingen, Frankreich zur führenden Landmacht Europas zu machen. 1805 mobilisierte Napoleon – mittlerweile selbstgekrönter Kaiser der Franzosen – seine Grande Armée zum vierten Mal seit 1789 zum Ansturm auf Großbritannien. »Lasst uns sechs Stunden lang Herren über den Kanal sein«, feuerte er seine Soldaten an, »dann sind wir die Herren der Welt!«54
Ihm waren die sechs Stunden nicht vergönnt, und obwohl er mit seiner Handelsblockade die schlimmsten Alpträume aller britischen Kaufleute wahr werden ließ, konnte er die wirtschaftliche Macht Großbritanniens nicht brechen. 1812 regierte Napoleon über ein Viertel der europäischen Bevölkerung und hatten seine Truppen Moskau eingenommen. Aber zwei Jahre später war er entmachtet und russische Truppen (die auf der Soldliste der Briten standen) hatten Paris besetzt. Und wieder ein Jahr später wurden auf dem Wiener Kongress Beschlüsse gefasst, die dem Krieg des Westens für die nächsten 99 Jahre den Wind aus den Segeln nehmen sollten.
Machten all diese Kriege letztendlich überhaupt einen Unterschied? In gewisser Weise: ja. 1683, am Vorabend der britisch-französischen Kriege, war Wien wieder einmal von türkischen Truppen belagert worden, doch als sich die Mächtigen 1815 dort zum Kongress versammelten, hatte Europa durch den Krieg des Westens den Rest der Welt in punkto Waffentechnik, Truppenführung und Wirtschaftskraft so weit hinter sich gelassen, dass die Türken von weiteren Eroberungsversuchen absahen. Schon 1803 gelang es den Briten, mit knapp 5000 Soldaten (die Hälfte davon vor Ort rekrutiert und an europäischen Musketen ausgebildet) eine zehnmal so große Streitmacht des indischen Marathenreiches zu zerschlagen.
In anderer Hinsicht auch wieder nicht. Ungeachtet aller Kriege und Feuergefechte sanken die Reallöhne nach 1750 unaufhörlich. Von 1770 an bot eine neue Gelehrtenzunft, die sich Nationalökonomen nannten, alles auf, was Naturwissenschaften und Aufklärung zu bieten hatten, um dieses Problem zu lösen. Die Erkenntnisse, die sie durch ihre Forschung gewannen, verhießen nichts Gutes. Es gebe nun einmal eherne Gesetze, die das Handeln der Menschheit bestimmten. Und eines dieser Gesetze laufe darauf hinaus, dass die Menschen jeden Anstieg der Produktivität und der Einkommen unweigerlich zum Anlass nehmen |472|würden, mehr Kinder in die Welt zu setzen. Diese Kinder würden den gesamten Wohlstandsüberschuss aufzehren und, schlimmer noch, als Erwachsene später eigene Arbeitsplätze beanspruchen, woraufhin die Löhne aufgrund der Konkurrenzsituation wieder so weit sinken würden, dass man davon nicht leben und nicht sterben könne.
Aus diesem Teufelskreis schien es keinen Ausweg zu geben. Hätten die Nationalökonomen den Index der gesellschaftlichen Entwicklung gekannt, so hätten sie vermutlich darauf hingewiesen, dass sich die Obergrenze zwar ein Stück nach oben verschoben habe, aber so starr wie eh und je geblieben sei. Sie hätten vielleicht mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass der Westen 1773 den gleichen Entwicklungsstand erreicht hatte wie der Osten, hätten dies aber als relativ unwichtig abgetan, weil aufgrund der ehernen Gesetze keiner von beiden eine wesentlich höhere Punktzahl erzielen würde. Die Nationalökonomie hatte den wissenschaftlichen Beweis erbracht, dass sich eigentlich auf Dauer nichts ändern konnte.
Und dann änderten sich die Dinge doch.