»Wenn ein Mensch Londons überdrüssig ist«, heißt es bei Samuel Johnson, »ist er des Lebens überdrüssig; denn in London gibt es alles, was das Leben bieten kann.«1 Das war 1777, und jeder Gedankenblitz, jede glänzende neue Erfindung belebte Johnsons Heimatstadt zusätzlich. London hatte Kathedralen und Paläste, Parks und Flüsse, herrschaftliche Viertel und Slums. Und, vor allem, man konnte einkaufen – Dinge nämlich, die sich frühere Generationen auch in ihren wildesten Fantasien nicht hätten träumen lassen. Direkt vor den neuen Arkaden der Oxford Street konnten die feinen Damen und Herren aus ihren Kutschen steigen, konnten dort nach Neuheiten stöbern, nach einem Schirm etwa, einer Erfindung der 1760er Jahre, die den Engländern rasch unverzichtbar wurde, vielleicht auch nach einer Handtasche oder nach Zahnpasta, auch das Novitäten dieser Jahre. Es waren aber nicht nur die Reichen, die sich dieser neuen Kultur des Konsums hingaben. Auch Geschäftsleute verbrachten, zum Entsetzen der Konservativen, Stunden in den Kaffeehäusern, die Armen nannten ihren Tee »unverzichtbar«2, und Landfrauen legten sich Klaviere zu.
Damals entwickelten die Engländer die Vorstellung, dass sie anders seien als andere Völker. Der schottische Gelehrte Adam Smith hatte sie 1776, in seinem Wohlstand der Nationen, ein Volk von Krämern genannt, und er glaubte, ihnen damit ein Kompliment zu machen. Weil sich jeder von ihnen derart um seinen eigenen Wohlstand sorgte, würden, so Smith, alle reicher. Und er erinnerte an den Gegensatz zwischen Großbritannien und China. Dieses »zählte lange zu den reichsten Ländern der Erde, überaus fruchtbar, der Boden bestens kultiviert, die Menschen sehr fleißig und zahlreich«, habe aber den Wohlstand erlangt, den zu erreichen »Gesetze und Einrichtungen des Landes« erlaubten. Nun steckten die Chinesen fest. Ihr Wohlstand, so Smith, werde durch die »Konkurrenz der Arbeiter und die Interessen der Unternehmer … bald auf das niedrigste Niveau [herabgedrückt], das sich mit unseren Vorstellungen über Humanität noch eben vereinbaren lässt«. In China übertreffe die Armut der niederen Stände noch »bei weitem die der bettelhaftesten Völker Europas. … Auch für Aas, beispielsweise den Kadaver eines Hundes oder einer Katze, halb verwest und stinkend, sind sie genauso dankbar wie die Menschen anderer Länder für das zuträglichste Essen.«3 |48|Johnson und Smith hatten ja nicht Unrecht. Kaum war die industrielle Revolution in den 1770er Jahren in Gang gekommen, schon lagen die durchschnittlichen Einkommen in England höher und waren gleichmäßiger verteilt als in China. Ein Faktum, auf das sich Theorien stützen, die zeigen wollen, dass die westliche Vorherrschaft über lange Perioden determiniert ist. Die Führungsrolle des Westens sei, so ihr Argument, die Voraussetzung der industriellen Revolution gewesen und nicht deren Folge, und darum müssten wir, wenn wir jene Rolle erklären wollten, historisch weit, möglicherweise sehr weit zurückblicken.
Klingt einleuchtend, oder? Der Historiker Kenneth Pomeranz, dessen Buch The Great Divergence ich in der Einleitung bereits erwähnt habe, besteht darauf, dass Adam Smith und alle Lobredner des Westens, die ihm gefolgt seien, die falschen Dinge miteinander verglichen. China sei so groß und vielfältig wie der gesamte Kontinent Europa. Insofern sei es kein Wunder, dass England die meisten Punkte mache, wenn wir diese zu Smiths Zeiten entwickeltste Region Europas isoliert betrachteten und als solche dann mit dem durchschnittlichen Entwicklungsstand in ganz China verglichen. Aus dem gleichen Grund würde, wenn wir eine Gegenprobe anstellten und die Mündungsregion des Jangtse (um 1770 die in China weitest entwickelte Region) mit dem durchschnittlichen Entwicklungsstand Europas verglichen, dieses Delta besser dastehen als England. Dabei hätten beide Regionen, so Pomeranz, im 18. Jahrhundert mehr miteinander gemein gehabt (nämlich beginnende Industrialisierung, aufstrebende Märkte, komplexe Teilung der Arbeit) als England mit unterentwickelten Teilen Europas oder das Jangtse-Delta mit unterentwickelten Regionen Chinas. All das führt Pomeranz zu dem Schluss, dass Theoretiker, die von einer langfristigen Determiniertheit der westlichen Vorherrschaft ausgingen, schlampig dächten und das Pferd vom Schwanz her aufzäumten. Wenn England und das Jangtse-Delta im 18. Jahrhundert tatsächlich so viel gemeinsam hatten, dann müsse man die Erklärung der westlichen Vorherrschaft irgendwann nach diesem Datum suchen und nicht davor.
Eines ist klar: Wenn wir wissen wollen, warum der Westen die Welt regiert, müssen wir vor allem herausfinden, wer und was »der Westen« ist. Und schon geraten die Dinge durcheinander. Die meisten von uns haben ein Bauchgefühl für das, was »den Westen« eigentlich ausmacht. Manche setzen ihn gleich mit Demokratie und Freiheit, andere mit dem Christentum, wieder andere mit säkularem Rationalismus. Der Historiker Norman Davies stieß auf nicht weniger als zwölf verschiedene Definitionen des Westens. Allen gemeinsam sei, was Davies deren »elastische Geographie« nennt. Jede dieser Definitionen gebe dem Westen eine unterschiedliche Gestalt, und eben das schaffe die von Pomeranz monierte Verwirrung. Der Westen, so Davies, »kann von seinen Verfechtern auf so gut wie jede Art definiert werden, die ihnen geeignet scheint« – mit der Folge, dass das, was sie als »westliche Zivilisation« betrachten, nichts anderes sein könne als »ein Amalgam intellektueller Konstrukte, das darauf angelegt ist, das Beweisinteresse des jeweiligen Autors zu stärken«.4
|49|Sollte Davies recht haben, dann würden Autoren, die der Frage nach der westlichen Vorherrschaft nachgehen, nichts anderes tun, als einige zufällige Werte herauszupicken, die den »Westen« definieren, und anschließend zu behaupten, bestimmte Länder verkörperten diese Werte. Diese Länder würden dann mit einer Gruppe ebenso zufällig herausgegriffener »nicht-westlicher« Länder verglichen. Auf diesem Weg kann man in der Tat zu jedem Schluss gelangen, der den eigenen Absichten dienlich ist. Das Ganze gilt auch umgekehrt. Jeder, der so gewonnene Schlussfolgerungen ablehnt, könnte seinerseits andere Werte herausgreifen, die seiner Meinung nach »Westlichkeit« definieren, könnte eine andere Gruppe von Ländern benennen, die diesen Wert verkörperten, ebenso eine andere Vergleichsgruppe, und schon würde er zu einer anderen, aber nicht weniger interessegeleiteten Schlussfolgerung gelangen.
Kein großer Gewinn also. Darum möchte ich einen anderen Weg einschlagen. Anstatt vom Ende des historischen Prozesses auszugehen und von Annahmen darüber, was zu den Werten des Westens gezählt werden muss, und erst dann in der Zeit zurückzublicken und nach den Wurzeln dieser Werte zu suchen, möchte ich tatsächlich mit dem Anfang des historischen Prozesses einsetzen, mich dann in der Zeit voranbewegen, bis wir jenen Punkt erreichen, an dem wir in unterschiedlichen Teilen der Welt je unterschiedliche Formen des Lebens entstehen sehen. Den geographisch westlichsten Teil dieser unterschiedlichen Regionen werde ich den »Westen« nennen, den östlichsten den »Osten«, beide also als das behandeln, was sie sind, nämlich als geographische Bezeichnungen und nicht als Werturteile.
Zu erklären, wir müssten am Anfang beginnen, ist eine Sache; eine ganz andere ist es, diesen Anfang zu finden. Wie wir sehen werden, gibt es in der fernen Vergangenheit einige Punkte, an denen Wissenschaftler versucht haben, Osten und Westen in Begriffen der Biologie zu definieren. Damit haben sie verworfen, was ich in der Einleitung dieses Buchs behauptet habe, nämlich dass Menschen (in großen Gruppen betrachtet) einander ziemlich ähnlich sind, und haben stattdessen die Menschen in einem Teil der Welt als allen anderen genetisch überlegen betrachtet. Es gibt in der Tat historische Punkte, an denen man allzu leicht zu der Behauptung gelangt, eine Region sei seit unvordenklichen Zeiten allen anderen kulturell überlegen gewesen. Wir müssen solche Vorstellungen sehr genau betrachten, denn wenn wir bereits am Anfang einen Schritt in die falsche Richtung tun, werden wir die Gestalt der Vergangenheit insgesamt falsch erfassen und damit auch die Gestalt der Zukunft.
Jede Kultur macht sich ihre eigene Geschichte davon, wie alles anfing, doch in den letzten Jahren haben uns Astrophysiker einige neue, wissenschaftliche Versionen geliefert. Die meisten Experten denken heute, Zeit und Raum hätten vor über 13 |50|Milliarden Jahren begonnen, sie streiten allerdings darüber, wie das geschehen sein soll. Die vorherrschende »Inflationstheorie« des Universums geht davon aus, dass dieses sich – zu Beginn nur ein Punkt von unendlicher Dichte und unendlich kleiner Ausdehnung – mit Überlichtgeschwindigkeit ausgedehnt habe. Die rivalisierende »Zyklustheorie« des Universums dagegen behauptet, dieses expandiere, seit ein zuvor bestehendes Universum kollabiert sei. Beide Schulen sind sich darin einig, dass unser Universum sich noch immer ausdehnt, wobei die Inflationisten davon ausgehen, dass es sich weiterhin ausdehnen wird, dass die Sterne irgendwann erlöschen werden und sich zuletzt unendliche Finsternis und Kälte verbreiten werden; die Zykliker dagegen behaupten, auch unser Universum werde in sich zusammenstürzen, erneut explodieren, und damit werde ein neues Universum beginnen.
Es ist schwer, diese Theorien zu verstehen, wenn man nicht Jahre der Ausbildung in höherer Mathematik absolviert hat. Zum Glück jedoch zwingt uns unsere Frage auch nicht, derart früh einzusetzen. Wie sollte es Osten oder Westen geben, solange es überhaupt noch keine Richtungen gab und auch die Naturgesetze nicht, wie wir sie kennen? Was sollte Ost und West bedeuten, wenn es unsere Sonne noch nicht gab und unser Planet noch keine Gestalt angenommen hatte? Dies geschah vor 4,5 Milliarden Jahren. Wir könnten vielleicht von Osten und Westen sprechen, sobald die Erdkruste sich gebildet hatte, zumindest aber sobald die Kontinente in etwa ihre heutige Lage eingenommen hatten, womit wir uns bereits im Zeitraum der letzten Jahrmillionen bewegen. Doch auch diese Überlegungen treffen den Punkt nicht. Im Sinn der Frage unseres Buchs können Ost und West erst dann irgendetwas bedeuten, wenn wir eine weitere Zutat in unseren Mix aufnehmen: menschliche Wesen.
Paläoanthropologen, die die Frühmenschen erforschen, streiten noch lieber als Historiker. Ihr Forschungsgebiet ist jung und entwickelt sich rapide, und immer wieder stellen neue Entdeckungen etablierte Wahrheiten auf den Kopf. Würde man zwei Paläoanthropologen in einen Raum sperren, würden sie diesen wahrscheinlich mit drei Theorien zur menschlichen Evolution verlassen, und kaum wäre die Tür hinter ihnen ins Schloss gefallen, wären auch diese bereits wieder überholt.
Die Grenze zwischen Menschen und Vormenschen kann nur unscharf sein. Manche Paläoanthropologen denken, dass wir, sobald wir vorgeschichtliche Affenarten entdecken, die aufrecht gehen konnten, auch von Menschen sprechen sollten. Nach fossilen Hüft- und Zehenknochen geurteilt, haben einige ostafrikanische Affen damit vor sechs oder sieben Millionen Jahren begonnen. Die meisten Experten allerdings sind der Meinung, mit einer solchen Definition liege die Latte zu niedrig. Die zum biologischen Standard gewordene Klassifikation bestimmt die Gattung Homo (lateinisch für »Mensch«) durch zwei miteinander verbundenen Kriterien: zum einen durch den Zuwachs des Gehirnvolumens von 400 bis 500 auf rund 630 Kubikzentimeter (unser Gehirn hat etwa das doppelte Volumen), zum anderen durch Belege dafür, dass aufrecht gehende Affen Steine gegeneinander geschlagen haben, um einfachste Werkzeuge herzustellen. Beide Prozesse begannen unter zweibeinigen ostafrikanischen Affen vor etwa 2,5 Millionen Jahren. Louis und Mary Leakey, die berühmten Ausgräber in der Olduvai-Schlucht in Tansania (Abbildung 1.1), nannten diese Kreaturen, die ein ziemlich großes Gehirn hatten und zudem Werkzeuge benutzten, Homo habilis, lateinisch für »geschickter Mensch«.
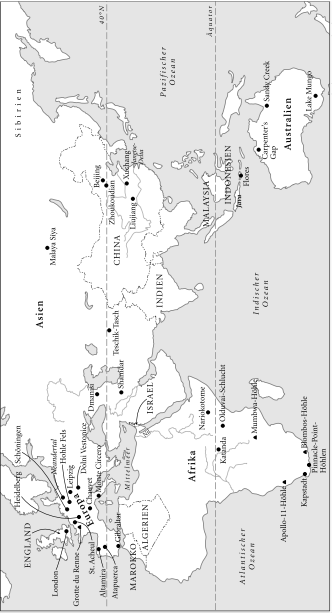
Abbildung 1.1: Bevor »Osten« und »Westen« viel bedeuteten
Stätten in der Alten Welt, die in diesem Kapitel erwähnt werden.
|52|Als Homo habilis über die Erde spazierte, hatten Ost und West noch keine große Bedeutung. Erstens, weil diese Geschöpfe ausschließlich in den Wäldern Ostafrikas lebten und sich noch keine regionalen Variationen entwickelt hatten; zweitens, weil die Formulierung »über die Erde spazierte« wohl eher ein Euphemismus ist. Die geschickten Menschen hatten Zehen und Gelenke wie wir, und sie sind mit Gewissheit aufrecht gelaufen, doch ihre langen Arme legen nahe, dass sie noch ziemlich viel Zeit in den Bäumen verbrachten. Es waren wohl besondere Affen, aber auch nicht mehr. Die Spuren, die ihre Steinwerkzeuge an Tierknochen hinterließen, zeigen, dass Homo habilis sich sowohl von Fleisch als auch von Pflanzen ernährte, allem Anschein nach aber lebte er auch ziemlich weit unten in der Nahrungskette. Einige Paläoanthropologen vertreten die Theorie, Menschen seien ihrer Art nach Jäger; ihrer Meinung nach war Homo habilis geschickt und mutig genug, um mit nichts anderem bewaffnet als mit Stöcken und kantig geschlagenen Steinbrocken Wild zu töten. Andere wiederum betrachten Homo habilis (wohl überzeugender) als Resteverwerter, der den wahren Raubtieren (Löwen etwa) folgte und von dem lebte, was diese übrig ließen. Man hat Spuren, die Homo habilis mit seinen Werkzeugen auf Tierknochen hinterlassen hat, mikroskopisch untersucht und herausgefunden, dass sie zumindest vor denen der Hyänenzähne dorthin kamen.
25 000 Generationen lang tollten Gruppen des Homo habilis in dieser kleinen Ecke der Welt herum und schwangen sich durch die Bäume, schlugen sich Steinwerkzeuge zurecht, lausten einander und zeugten Nachwuchs. Dann, irgendwann vor rund 1,8 Millionen Jahren, verschwanden sie. Und zwar, soweit wir das beurteilen können, ziemlich plötzlich; allerdings gehört die genaue Datierung von Funden zu den Schwierigkeiten und Problemen beim Studium der menschlichen Evolution. In vielen Fällen sind wir davon abhängig, dass in den Gesteinsschichten, die fossile Knochen oder Werkzeuge enthalten, auch instabile radioaktive Isotopen zu finden sind, deren Zerfallszeiten bekannt sind, sodass man die Funde datieren kann, indem man das Verhältnis zwischen diesen Isotopen bestimmt. Diese Datierungen können jedoch Fehler enthalten, die sich im Bereich von einigen zehntausend Jahren bewegen. Darum kann, wenn wir sagen, die Welt des Homo habilis sei plötzlich zu Ende gewesen, dieses »plötzlich« ebenso gut einige wenige wie einige 1000 Generationen umfassen.
Als Charles Darwin in den 1840er und 1850er Jahren über den Vorgang der natürlichen Selektion nachdachte, nahm er an, diese vollziehe sich durch allmähliche Akkumulation kleiner Veränderungen. In den 1970er Jahren jedoch machte |53|der Biologe Stephen Jay Gould geltend, dass die Evolution kein Ergebnis kleiner Schritte über einen langen Zeitraum hinweg sei, sondern dass irgendwelche Ereignisse eine Kaskade schneller Veränderungen auslöse. Evolutionsbiologen heute sind uneins darüber, welches das tauglichere Modell ist, ob schrittweise Veränderungen (Evolution durch Kriechen, wie deren Kritiker höhnen) oder Goulds »unterbrochenes Gleichgewicht«5 (Evolution durch Sprünge). Zur Erklärung des Verschwindens von Homo habilis scheint Goulds Denkmodell aber geeigneter. Vor etwa 1,8 Millionen Jahren wurde das Klima in Ostafrika trockener, und offene Savannen entstanden dort, wo früher die Wälder gewesen waren, in denen die »geschickten Menschen« gelebt haben; und genau an diesem Punkt traten neue Arten von Affenmenschen1* an seine Stelle.
Ich möchte diesem neuen Affenmenschen hier noch keinen Namen geben, sondern für den Augenblick nur festhalten, dass sie größere Gehirne (im Durchschnitt etwa 800 Kubikzentimeter Volumen) hatten als Homo habilis. Es fehlten ihnen auch die langen, schimpansenartigen Arme, was vermutlich bedeutet, dass sie die meiste Zeit auf dem Boden zubrachten. Außerdem waren sie größer. Ein rund 1,5 Millionen Jahre altes Skelett, das bei Nariokotome in Kenia gefunden wurde, bekannt als Turkana-(oder Nariokotome-)Boy, gehörte zu einem etwa 1,50 Meter großen Kind, das, wäre es ausgewachsen, etwa 1,80 Meter groß geworden wäre. Seine Knochen waren nicht nur länger, sondern auch weniger robust als die von Homo habilis, woraus zu schließen ist, dass dieser Junge und seine Zeitgenossen sich mehr auf ihre geistigen Fähigkeiten und ihre Werkzeuge verlassen haben als auf rohe Kraft.
Die meisten von uns denken, geschickt und gescheit zu sein, sei selbstverständlich von Vorteil. Wenn dem so wäre, warum hat Homo habilis, wo er doch schon das Potenzial gehabt hätte, sich in diese Richtung zu entwickeln, eine halbe Million Jahre herumgewerkelt, bevor er sich »plötzlich« in ein größeres Geschöpf mit größerem Gehirn verwandelt hat? Die wahrscheinlichste Erklärung liegt wohl in dem Faktum, dass es nichts umsonst gibt. Und es ist aufwändig, ein großes Gehirn am Leben zu erhalten. Unser Gehirn macht etwa zwei Prozent unseres Körpergewichts aus, verbraucht aber bis zu 20 Prozent der Energie, die wir insgesamt konsumieren. Große Gehirne bringen noch weitere Probleme mit sich: Der Schädel muss wachsen, damit er es aufnehmen kann – und er wurde so groß, dass die heutigen Frauen Schwierigkeiten haben, Babys durch den Geburtskanal zu pressen. Sie umgehen das Problem, indem sie ihre Kinder unreif zur Welt bringen. Würden unsere Babys solange im Mutterleib bleiben, bis sie sich – wie der Nachwuchs anderer Säugetiere – selbst erhalten könnten, wäre ihr Kopf zu groß, um aus dem Leib herauszukommen.
|54|Dennoch müssen riskante Geburten, jahrelange Aufzucht und große Gehirne, die ein Fünftel der von uns aufgenommenen Nahrung verbrennen, durchaus das Richtige für uns gewesen sein – richtiger jedenfalls, als die gleiche Energie dazu zu nutzen, um Klauen auszubilden, mehr Muskeln oder große Zähne. Intelligenz ist ein größeres Plus als jede dieser Alternativen. Fraglicher dagegen scheint, warum eine genetische Mutation, die vor einigen Millionen Jahren zu einem größeren Gehirn führte, den Affenmenschen damals schon so viele Vorteile brachte, dass sich der größere Energieaufwand gelohnt hat. Das muss aber der Fall gewesen sein. Denn wären höhere Intelligenz und größeres Geschick nicht zumindest so nützlich gewesen, dass der zur Erhaltung der grauen Zellen höhere Energieaufwand ausgeglichen werden konnte, dann wären die gescheiten Affen weniger erfolgreich gewesen als ihre dumpferen Verwandten und ihre smarten Gene rasch wieder aus der Population verschwunden.
Vielleicht war an allem ja das Wetter schuld. Als der Regen ausblieb und die Bäume, in denen die Affenmenschen gelebt hatten, zu verkümmern begannen, könnten die gescheiteren und möglicherweise auch geselligeren Mutanten einen Vorsprung vor ihren affenartigeren Verwandten errungen haben. Anstatt sich aus dem offen liegenden Grasland zurückzuziehen, fanden die klügeren Affen Wege, genau dort zu überleben. Und während eines Wimpernschlags (auf der Zeitachse der Evolution) verbreitete eine Handvoll Mutanten ihre Gene im gesamten Pool und verdrängten Homo habilis, der langsamer dachte, kleiner war und den Wald liebte.
Ob ihre Lebensräume übervölkert waren, ob es Zank gab zwischen den Gruppen, ob sie einfach neugierig waren – in jedem Fall haben die neuen Affenmenschen als Erste ihrer Art Ostafrika verlassen. Überall wurden ihre Knochen gefunden: von der Südspitze des Kontinents bis zu den Pazifikküsten Asiens. Dennoch sollten wir uns keine großen Wanderungswellen vorstellen, nichts in der Art des Westward ho der Wildwestfilme. Die Affenmenschen werden wohl kaum gewusst haben, was sie tun; zudem erforderte die Überwindung so großer Entfernungen noch größere Zeitspannen. Von der Olduvai-Schlucht nach Kapstadt in Südafrika ist es ein weiter Weg – über 2500 Kilometer –, doch um diese Strecke in 100 000 Jahren zu überwinden (allem Anschein nach dauerte es tatsächlich so lange), mussten die Affenmenschen wohl nichts anderes tun, als den Raum ihrer Nahrungssuche jedes Jahr um durchschnittlich 35 Meter in eine Richtung zu erweitern. Hätten sie sich mit der gleichen Geschwindigkeit nach Norden treiben lassen, hätten sie auch die Schwelle zu Asien erreicht; und tatsächlich wurde 2002 bei Grabungen in der Nähe von Dmanissi in der heutigen Republik Georgien ein 1,7 Millionen Jahre alter Schädel gefunden, der Eigenschaften des Homo habilis |55|und der neueren Affenmenschen vereinte. Steinwerkzeuge aus China und fossile Knochen aus Java (das damals noch mit dem asiatischen Festland verbunden war) könnten etwa ebenso alt sein, und dies würde bedeuten, dass die Affenmenschen, nachdem sie Afrika verlassen hatten, ihre Wandergeschwindigkeit erhöht hätten, auf durchschnittlich fabelhafte 140 Meter im Jahr.1*
Die Erwartung wäre nicht unrealistisch, dass sich, nachdem die Affenmenschen Ostafrika verlassen hatten und sich durch die warmen subtropischen Breiten bis nach China verbreiteten, westliche und östliche Formen des Lebens unterscheiden ließen. Für die Zeit vor 1,6 Millionen Jahren verzeichnen archäologische Inventare tatsächlich östliche und westliche Muster. Gleichwohl ist zu fragen, ob diese Unterschiede bedeutsam genug sind, um dahinter unterschiedliche Lebensweisen vermuten zu dürfen.
Bekannt sind diese Unterschiede seit den 1940er Jahren, als Hallam Movius, ein Archäologe aus Harvard, feststellte, dass die Knochen der neuen, klügeren Affenmenschen häufig in Verbindung mit Steinwerkzeugen gefunden wurden, die mit einer neuen Abschlagtechnik hergestellt worden waren. Die signifikantesten dieser Werkzeuge haben die Archäologen zur Leitform der Altsteinzeitperiode des Acheuléen erklärt, die ihren Namen Saint-Acheul verdankt, einem Vorort von Amiens, wo man diese Werkzeuge zum ersten Mal in großer Zahl fand. Es handelt sich um Faustkeile (englisch handaxes): »Keile«, weil die Steingeräte zwar wie Axtköpfe geformt waren, ganz offensichtlich aber nicht nur zum Spalten, sondern auch zum Schneiden, Stoßen und Hämmern verwendet wurden; »Faust« erinnert daran, dass sie in der Hand geführt und nicht an Stielen befestigt wurden. Diese Werkzeuge als Artefakte zu bezeichnen, mag übertrieben erscheinen, doch mit ihrer einfachen Symmetrie sind sie sehr viel schöner als die rohen Klingen und Hackwerkzeuge von Homo habilis. Wie Movius feststellte, wurden die Faustkeile des Acheuléen zwar an Fundorten in Afrika, Europa und Südwestasien gefunden, in Südostasien dagegen an keiner Stelle. Dort fand man gröber gefertigte Werkzeuge, die denen des Prä-Acheuléen ähneln, die in Afrika ausgegraben worden sind und dem Homo hablis zugeschrieben werden.
Sollte die so genannte Movius-Linie (Abbildung 1.2) tatsächlich den Beginn der Trennung von östlichen und westlichen Lebensweisen markieren, könnte dies für eine in der Zeit erstaunlich weit zurückreichende Determinierung sprechen – für eine Theorie, der zufolge sich, kaum dass die Affenmenschen über die Grenzen Afrikas hinaus vorgedrungen waren, auch zwei Kulturkreise herausgebildet haben: die westlichen, technisch fortgeschritteneren Faustkeil-Kulturen des Acheuléen in Afrika und Südwestasien und die östlichen, technisch weniger entwickelten Abschlag- und Chopper-Kulturen in Ostasien. Dann wäre es kein Wunder, dass heute der Westen die Welt regiert, hat er doch, wie man aus der |56|Movius-Linie schließen könnte, die Führung bereits seit 1,5 Millionen Jahren inne.

Abbildung 1.2: Der Anfang von Osten und Westen? Die Karte zeigt die Movius-Linie, die für rund eine Million Jahre die Faustkeil-Kulturen des Westens von den Abschlag- und Chopper-Kulturen des Ostens trennte.
Die Movius-Line festzulegen ist allerdings leichter, als sie zu erklären. Die frühesten in Afrika gefundenen Faustkeile des Acheuléen sind rund 1,6 Millionen Jahre alt, doch schon 100 000 Jahre zuvor gab es ja bereits Affenmenschen im georgischen Dmanissi. Der Befund ist eindeutig: Die ersten Affenmenschen haben Afrika verlassen, bevor der Faustkeil des Acheuléen zu ihrem normalen Werkzeugkasten gehörte. Es waren diese Gruppen, die Techniken des Prä-Acheuléen quer durch Asien getragen haben, während die westliche, afrikanische Region sich daran machte, die Werkzeuge des Acheuléen zu entwickeln.
Ein kurzer Blick auf Abbildung 1.2 zeigt jedoch, dass die Movius-Linie gar nicht Afrika von Asien trennt, sie verläuft vielmehr durch Nordindien. Das ist ein wesentliches Detail. Die ersten Auswanderer verließen Afrika, bevor der Acheuléen-Faustkeil entwickelt war, also muss es einander folgende Wellen der Auswanderung aus Afrika gegeben haben, deren spätere den Faustkeil nach Südwestasien und Indien gebracht haben. Darum müssen wir eine neue Frage stellen: |57|Warum haben diese späteren Wellen von Affenmenschen die Werkzeugindustrie des Acheuléen nicht noch weiter nach Osten getragen?
Die wahrscheinlichste Antwort ist, dass die Movius-Linie eben nicht die Grenze zwischen einem technisch avancierten Westen und einem weniger fortgeschrittenen Osten markiert, sondern nur die westlichen Regionen, in denen die Art Steine, die man für Faustkeile braucht, leicht zu finden sind, von solchen östlichen Gebieten trennt, in denen diese Steine selten sind und in denen sich brauchbare Alternativen boten – Bambus etwa, der zwar widerstandsfähig ist, sich aber doch nicht so lange erhält, dass wir aus Bambus gefertigte Werkzeuge ausgraben könnten. Nach dieser Interpretation müssen Faustkeilnutzer, nachdem sie über die Movius-Linie hinweg gelangt waren, die Werkzeuge des Acheuléen nach und nach aufgegeben haben, weil sie unbrauchbar gewordene nicht ersetzen konnten. Allerdings stellten sie weiterhin Chopper und Abschläge her, denn dazu lassen sich Geröllsteine (pebbles) aller Art verwenden; möglicherweise nutzten sie zunehmend auch Bambus für Aufgaben, die zuvor mit Faustkeilen verrichtet wurden.
Einige Archäologen glauben, Funde aus dem Bose-Becken in Südchina stützten derartige Überlegungen. Vor rund 800 000 Jahren ging hier ein riesiger Meteor nieder: ein Unglück epischen Ausmaßes. In heftigen Feuerstürmen verbrannten zehntausende Hektar Wald. Vor dem Einschlag haben im Bose-Becken lebende Affenmenschen Chopper, Abschläge und (vermutlich) Bambus genutzt – so wie andere Gruppen in Ostasien auch. Doch als sie nach den Bränden zurückkehrten, begannen sie, Faustkeile in der Art des Acheuléen zu fertigen – möglicherweise, so die Theorie, weil die Feuersbrünste den Bambus restlos vernichtet und zugleich verwertbares Gestein freigelegt hatten. Nach einigen Jahrhunderten, nachdem sich die Vegetation wieder erholt hatte, gaben die Bewohner dort die Faustkeilproduktion auf und kehrten zum Bambus zurück.
Sollten diese Überlegungen zutreffen, waren die Affenmenschen Ostasiens bestens in der Lage, Faustkeile herzustellen, wenn die Umstände dies begünstigten. Meist aber machten sie sich diese Mühe nicht, weil es Möglichkeiten gab, mit geringerem Aufwand an Werkzeuge zu kommen. Faustkeile aus Stein und Werkzeuge aus Bambus waren unterschiedliche Geräte, mit denen sich aber das Gleiche tun ließ. Kurz: Alle Gruppen der Affenmenschen lebten auf mehr oder weniger gleiche Weise, ob sie sich nun in Marokko oder in Malaysia befanden.
Das erscheint durchaus plausibel, doch wir bewegen uns im Gebiet der prähistorischen Archäologie, und da lassen sich Dinge immer auf mehrere Weisen betrachten, auch die Movius-Linie. Bislang habe ich es vermieden, den Affenmenschen, die Acheuléen-Faustkeile benutzt haben, Namen zu geben. Von diesem Punkt an jedoch macht es einen Unterschied, mit welchen Namen wir sie belegen.
Seit den 1960er Jahren heißt die neue Spezies, die sich in Afrika vor rund 1,8 Millionen Jahren entwickelt hat, bei den meisten Paläoanthropologen Homo erectus ( »aufrechter Mensch«). Sie vermuten, dass diese Geschöpfe durch die subtropischen |58|Breiten an die Küste des Stillen Ozeans wanderten. In den 1980er Jahren jedoch lenkten einige Experten ihre Aufmerksamkeit auf kleine Unterschiede zwischen den Schädeln des Homo erectus, die in Afrika, und solchen, die in Ostasien gefunden wurden. Weil sie davon ausgingen, es tatsächlich mit zwei verschiedenen Arten von Affenmenschen zu tun zu haben, prägten sie einen neuen Namen, nämlich Homo ergaster ( »arbeitender Mensch«), für diejenigen, die sich in Afrika vor 1,8 Millionen Jahren entwickelt und dann bis nach China verbreitet haben. Erst als Homo ergaster Ostasien erreicht habe, so argumentierten sie, hat sich Homo erectus aus dieser Art entwickelt. Homo erectus wäre demzufolge eine rein asiatische Spezies, zu unterscheiden von Homo ergaster, der Afrika, Südwestasien und Indien besiedelte.
Sollte diese Theorie zutreffen, würde die Movius-Linie nicht nur den trivialen Unterschied von Werkzeugtypen markieren, sondern eine genetische Wasserscheide, die die frühen Affenmenschen in zwei Linien teilte. Damit hätten wir so etwas wie die Mutter aller Theorien langfristiger Determination: Osten und Westen sind unterschiedlich, weil im Osten und im Westen – und zwar seit über einer Million Jahren – zwei unterschiedliche Arten von Menschen leben.
Die Fachdebatte über die Klassifikation prähistorischer Skelette hat alarmierende Implikationen. Nur zu gern stürzen sich Rassisten auf solche Details, denn damit lassen sich Vorurteile, Gewalttätigkeiten und sogar Genozide rechtfertigen. Vielleicht denken Sie, man solle nicht zuviel Zeit auf die Auseinandersetzung mit dieser Art von Theorien verwenden, das fördere nur Intoleranz und Selbstgerechtigkeit; vielleicht wäre es besser, sie einfach zu ignorieren. Das, denke ich, wäre ein Fehler. Es reicht nicht, rassistische Theorien zu ächten. Wenn wir sie wirklich zurückweisen und ihnen die Theorie entgegensetzen wollen, dass Menschen (in großen Gruppen betrachtet) mehr oder weniger gleich sind, dann müssen wir zeigen, dass rassistische Theorien falsch sind, und sie widerlegen. Dass heute die meisten von uns solche Theorien nicht mögen, reicht nicht aus.
Grundsätzlich wissen wir nicht, ob es vor rund 1,5 Millionen Jahren nur eine Art von Affenmenschen auf der Erde gegeben hat – was bedeuten würde, dass sie sich (wiederum in großen Gruppen betrachtet) von Afrika bis Indonesien weitgehend glichen – oder ob Homo ergaster westlich der Movius-Linie und Homo erectus östlich davon gelebt haben: als jeweils eigene, klar unterschiedene Arten. Nur weitere Forschungen können diese Frage klären. Wir wissen allerdings, und zwar ohne jeden Zweifel, dass sich innerhalb der letzten Million Jahre im Osten und im Westen tatsächlich unterschiedliche Arten von Affenmenschen entwickelt haben.
Vermutlich haben die geographischen Bedingungen eine Menge damit zu tun. Die Affenmenschen, die vor rund 1,7 Millionen Jahren auf ihren Wanderungen |59|Afrika verließen, waren sehr gut an subtropische Klimata angepasst, als sie aber weiter nordwärts zogen, hinein nach Europa und Asien, mussten sie längere und härtere Winter überstehen. Wie ihre afrikanischen Vorfahren lebten sie unter freiem Himmel, und das wurde, als sie sich der Linie von etwa 40° nördlicher Breite näherten (eine Linie vom Norden Portugals bis nach Beijing, vgl. Abbildung 1.1), zunehmend unpraktikabel. Soweit wir wissen, lag das Bauen von Hütten und das Anfertigen von Bekleidung jenseits ihrer mentalen Fähigkeiten, auf eine Lösung jedoch werden sie gekommen sein: Sie suchten Schutz in Höhlen. So wurden die Höhlenmenschen geboren, von denen man uns in unserer Kindheit erzählte.
Das Leben in Höhlen war keine reine Wohltat für die Affenmenschen, denn sie mussten sich diesen Lebensraum mit Bären und löwengroßen Hyänen teilen, die mit ihren Zähnen Knochen zermalmen konnten. Für Archäologen jedoch erweist sich diese neue Lebensform als Gottesgeschenk, denn in Höhlen erhalten sich prähistorische Ablagerungen gut. Und das wiederum versetzt uns in die Lage zu verfolgen, wie die Evolution der Affenmenschen einen in den östlichen und westlichen Teilen der Alten Welt jeweils eigenen Verlauf zu nehmen begann. Auslöser waren unterschiedliche Formen der Anpassung an das kältere Klima.
Die für das Verständnis der östlichen Affenmenschen bedeutendste Fundstelle liegt bei Zhoukoudian nahe Beijing, genau auf dem 40. Breitengrad, und war mit Unterbrechungen von 670 000 bis 410 000 v. u. Z. besiedelt. Die Geschichte ihrer Ausgrabung hat durchaus epische Züge, und sie liefert die Vorlage für Amy Tans Roman Die Tuschezeichnung. Während europäische, amerikanische und chinesische Archäologen zwischen 1921 und 1937 die Höhlen in den Bergen bei Zhoukoudian ausgruben, geriet die Grabungsstätte in die Frontlinie des unerbittlich geführten Bürgerkriegs zwischen Nationalisten, Kommunisten und einheimischen Warlords. Die Grabenden arbeiteten häufig im Lärm der Geschütze und Gewehre, und wenn sie ihre Funde ins 40 Kilometer entfernte Beijing bringen wollten, mussten sie Banditen und deren Straßensperren umgehen. Mit dem Einmarsch der Japaner in China kam das Projekt endgültig zum Erliegen. Zhoukoudian wurde zur Basis kommunistischer Widerstandskämpfer, und japanische Soldaten folterten und ermordeten drei Mitglieder des Grabungsteams.
Es sollte noch schlimmer kommen. Im November 1941, als ein Krieg zwischen Japan und den Vereinigten Staaten immer wahrscheinlicher wurde, entschloss man sich, die Funde nach New York in Sicherheit zu bringen. Techniker packten sie in zwei große Kisten, die ein Wagen der amerikanischen Botschaft aus Beijing abholen sollte. Bis heute weiß man nicht, ob der Wagen jemals ankam oder wohin er, wenn er denn kam, die Kisten brachte. Einer Geschichte zufolge fingen japanische Soldaten die US-Marines, die die Funde sichern sollten, just in dem Augenblick ab, als die ersten Bomben auf Pearl Harbor fielen, nahmen sie gefangen und kümmerten sich nicht weiter um die unschätzbare Fracht. Ein Leben zählte nicht |60|viel in diesen dunklen Tagen, warum also sollte man sich besondere Gedanken um ein paar Kisten voller Steine und Knochen machen?
Doch nicht alles ging verloren. Das Team von Zhoukoudian hatte seine Funde gewissenhaft veröffentlicht und bereits Gipsabgüsse der Knochen nach New York gesandt – ein frühes Beispiel dafür, wie klug es ist, seine Daten zu sichern. Diese Abgüsse ließen erkennen, dass sich der Peking-Mensch1* (so nannten die Ausgräber die Affenmenschen von Zhoukoudian) vor 600 000 Jahren von großen, hoch aufgeschossenen Afrikanern wie dem Turkana-Boy unterschied: Er war von gedrungener Gestalt und darum der Kälte besser angepasst. Peking-Menschen waren ungefähr 1,65 cm groß und weniger behaart als moderne Affen. Wir bekämen gleichwohl einen Schrecken, würden wir einem dieser Gesellen plötzlich im Stadtzentrum begegnen. Peking-Menschen hatten kurze breite Gesichter mit niedriger flacher Stirn, schweren Augenwülsten und Brauen und einem mächtigen Unterkiefer mit stark fliehendem Kinn.
Eine Unterhaltung mit einem Peking-Menschen käme kaum zustande. Soweit wir wissen, waren die Basalganglien des Homo erectus kaum entwickelt (die Teile des Gehirns, die es dem modernen Menschen ermöglichen, mit einer kleinen Zahl von Mundbewegungen eine unendliche Zahl distinkter Laute zu erzeugen). Das außergewöhnlich vollständig erhaltene Skelett des Turkana-Boys weist einen Nervenkanal auf (der das Rückenmark enthält), dessen Durchmesser um ein Viertel kleiner ist als beim modernen Menschen. Daraus wäre zu schließen, dass er seine Atmung nicht so genau kontrollieren konnte, dass er hätte sprechen können wie wir.
Das mag so sein. Andere Funde jedoch legen – indirekt – nahe, dass die Affenmenschen der östlichen Alten Welt auf irgendeine Weise doch miteinander kommunizieren konnten. 1994 gruben Archäologen auf Flores, einer kleinen Insel vor Java, Artefakte aus, die 800 000 Jahre alte Steinwerkzeuge zu sein schienen. Zu dieser Zeit war Flores definitiv schon eine Insel, von Java durch zwölf Seemeilen offenen Meeres getrennt. Dann aber hat sich Homo erectus mit seinesgleichen zumindest so gut verständigen können, dass sie Boote herstellen, über den Horizont hinaus aufs offene Meer segeln und Flores besiedeln konnten. Das sagten die einen; andere Archäologen jedoch fanden die Vorstellung eines Boote bauenden Homo erectus völlig abwegig. Ihrer Meinung nach könnten die gefundenen »Werkzeuge« ebenso gut durch natürliche Vorgänge, also zufällig, in werkzeugähnliche Formen gespaltene Steine sein.
Der Streit hätte, wie so viele Debatten der Archäologie, leicht in einer Sackgasse enden können, wären im Jahr 2003 auf Flores nicht weitere erstaunliche Funde gelungen. Mit Hilfe eines tief reichenden Echolots wurden acht Skelette aufgespürt, die alle auf 16 000 v. u. Z. datiert wurden. Sie waren nicht größer als 1,20 Meter, |61|aber alle ausgewachsen. Damals war gerade die erste von Peter Jacksons Verfilmungen von Herr der Ringe in die Kinos gekommen, und sofort nannten Journalisten diese kleinen Leute »Hobbits«, nach J. R. R. Tolkiens behaarten Halblingen. Werden Tierpopulationen auf Inseln isoliert, auf denen sie keine Fressfeinde haben, entwickeln sie sehr häufig Zwergformen; wahrscheinlich kamen auch die »Hobbits« auf diese Weise zu ihrer Zwergengestalt. Damit dies aber bis 16 000 v. u. Z. hatte geschehen können, müssen Affenmenschen Flores viele 1000 Generationen zuvor besiedelt haben – vielleicht sogar seit jenen 800 000 Jahren, von denen die 1994 gefundenen Steinwerkzeuge zeugen. Auch das würde bedeuten, dass Homo erectus über gewisse Fähigkeiten der Kommunikation verfügte.
Wir müssen also davon ausgehen, dass sich die Affenmenschen von Zhoukoudian untereinander viel besser verständlich machen konnten als Schimpansen oder Gorillas; die Ablagerungen in der Höhle zeigen zudem, dass sie auch nach Belieben Feuer machen konnten. Zumindest in einem Fall haben Peking-Menschen den Kopf eines Wildpferdes geröstet. Schnitte am Schädelknochen zeigen, dass es ihnen auf Zunge und Gehirn ankam, die beide reich sind an Fett. Möglicherweise waren sie auch scharf auf das Gehirn ihrer Artgenossen, jedenfalls haben Archäologen in den 1930er Jahren aus der Art von Knochenbrüchen auf Kannibalismus und sogar auf Formen der Kopfjägerei geschlossen. Eine in den 1980er Jahren durchgeführte Studie an den Gipsabgüssen ergab, dass die meisten Spuren an den Schädelknochen von Zähnen der riesigen prähistorischen Hyänen stammten und nicht von anderen Peking-Menschen; ein Schädel allerdings – von dem 1966 ein zusätzliches Fragment ausgegraben wurde – zeigt eindeutig Verletzungen durch Steinwerkzeuge.
Könnte man, statt irgendwo in der Stadtmitte auf einen Peking-Menschen zu treffen, mit einer Zeitmaschine zurückreisen in das Zhoukoudian vor einer halben Million Jahre, würde man dort eine verwirrende und beunruhigende Erfahrung machen. Man würde Höhlenmenschen sehen, die miteinander kommunizieren, und sei es durch Grunzen und Gestikulieren, aber man könnte mit ihnen nicht sprechen. Auch indem man Bilder malte, würde man sie nicht erreichen; wir haben keinerlei verlässliche Hinweise darauf, ob Kunst für Homo erectus von größerer Bedeutung war als für Schimpansen. Der Peking-Mensch, der sich im Osten der Alten Welt entwickelte, ist sehr verschieden von uns.
Doch haben sich Peking-Menschen auch von den Affenmenschen unterschieden, die sich im Westen der Alten Welt entwickelten? Die ältesten Funde aus Europa – sie wurden 1994 in einer Kette von Höhlen bei Atapuerca in Spanien entdeckt – sind etwa 800 000 Jahre alt (stammen also ungefähr aus der Zeit, in der Homo erectus seine Boote bestiegen und Flores besiedelt haben könnte). In mancher |62|Hinsicht waren die Funde aus Atapuerca denen in Zhoukoudian ähnlich: Viele Knochen sind kreuz und quer von Steinwerkzeugspuren überzogen, wie sie ähnlich auch ein Metzger hinterlassen würde.
Die Hinweise auf Kannibalismus eroberten die Schlagzeilen, die Paläoanthropologen aber fanden die Frage aufregender, was die Funde in Atapuerca von denen aus Zhoukoudian unterschied. Die Schädel aus Atapuerca hatten einen größeren Hohlraum für das Gehirn, dazu ziemlich modern geformte Nasenbeine und Wangenknochen. Die Paläoanthropologen schlossen daraus, dass eine neue Art entstanden war, die sie Homo antecessor ( »Urmensch«) nannten.
Homo antecessor half zu verstehen, was es mit einer Folge von Funden auf sich hatte, die seit 1907 gemacht worden waren, als Arbeiter in einer Sandgrube in Deutschland einen merkwürdigen Unterkieferknochen gefunden hatten. Diese Art, nach der nahe gelegenen Universitätsstadt Homo heidelbergensis oder Heidelbergmensch genannt, sah Homo erectus sehr ähnlich, hatte allerdings einen Schädel, der mit hohen runden Schädelknochen und einem Gehirnvolumen von rund 1000 Kubikzentimetern – also deutlich größer als die durchschnittlich 800 Kubikzentimeter des Homo erectus – dem unseren schon ähnlich war. Wie es aussieht, hat sich das Tempo der evolutionären Veränderungen überall in der Alten Welt beschleunigt, nachdem der Affenmensch den kalten Norden erreicht hatte und mit völlig anderen klimatischen Verhältnissen konfrontiert war, unter denen zufällige genetische Mutationen gute Chancen hatten, sich durchzusetzen.1*
Dafür jedenfalls haben wir einige unstrittige Fakten. Vor 600 000 Jahren, als Homo heidelbergensis die Bühne betrat und der Peking-Mensch in Zhoukoudian Herr im Hause war, gab es im Osten und im Westen der Alten Welt tatsächlich zwei definitiv unterschiedene Arten: Homo erectus mit einem kleineren Gehirn im Osten und im Westen, mit größerem Gehirn ausgestattet, Homo antecessor und Homo heidelbergensis.
Wobei, was das Gehirn anbelangt, Größe nicht alles ist. Anatole France hat den Nobelpreis für Literatur des Jahres 1921 mit einem Gehirn gewonnen, das nicht größer war als das des Homo heidelbergensis. Doch war dieser, wie es scheint, ein ganzes Stück geschickter und klüger als ältere Affenmenschen oder als sein Zeitgenosse Peking-Mensch. Bevor der Heidelbergmensch auftauchte, hatten sich die Steinwerkzeuge über eine Million Jahre kaum verändert, um 500 000 v. u. Z. jedoch fertigte Homo heidelbergensis dünnere und darum leichtere Exemplare, ihm gelangen feinere Abschläge, weil er weiche Hämmer (vermutlich aus Holz) verwendete und nicht mehr nur Steine aufeinander schlug. Dem könnte eine bessere |63|Koordination von Hand und Auge zugrunde gelegen haben. Die Gruppen des Homo heidelbergensis stellten sehr viel spezialisiertere Werkzeuge her, und vor allem begannen sie, besonders geformte Kernsteine herzustellen, präparierte Rohlinge, aus denen dann nach Bedarf und Belieben diverse Werkzeuge geschlagen wurden. Das kann nichts anderes heißen, als dass diese Art sehr viel besser als Homo erectus darüber nachdenken konnte, was sie von der Welt wollten und wie es sich erreichen ließ. Schon die Tatsache, dass der Heidelbergmensch bei Heidelberg hat überleben können, weit nördlich des 40. Breitengrads, deutet darauf hin, dass er viel geschickter war als ältere Affenmenschen.
Die Bewohner Zhoukoudians haben sich zwischen 670 000 und 410 000 Jahren v. u. Z. wenig verändert, die westlichen Affenmenschen dagegen setzten in dieser Periode ihre Evolution fort. Wenn man einige 100 Meter in die dunklen Höhlen beim spanischen Atapuerca hineinkriecht, meist auf dem Bauch, manchmal auch mit Hilfe von Seilen, gelangt man an ein fast 13 Meter tiefes Loch, das Sima de los Huesos oder Grube der Knochen genannt wird. Zu Recht, denn dort fand man die dichteste Konzentration von Relikten der Affenmenschen, die je entdeckt wurde. Über 4000 Fragmente wurden seit den 1990er Jahren geborgen, die aus der Periode zwischen 600 000 und 564 000 Jahren v. u. Z. stammen. Die meisten Knochen gehören Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Was sie so tief unter der Erde getan haben, wird wohl ein Rätsel bleiben, doch Sima de los Huesos enthielt, wie auch ältere Ablagerungen in Atapuerca, Relikte erstaunlich unterschiedlicher Affenmenschen. Die spanischen Ausgräber klassifizierten die meisten als Homo heidelbergensis, viele ausländische Forscher halten sie eher für eine andere Spezies: für Neandertaler.
Diese berühmtesten aller Höhlenmenschen wurden 1856 in einem Steinbruch im Neandertal bei Düsseldorf entdeckt. Dort fanden Arbeiter eine Schädelkappe und 15 weitere Knochen, die sie einem Lehrer präsentierten (Grabungen in den 1990er Jahren förderten weitere 62 Fragmente zutage). Der wiederum zeigte die Funde einem Anatomen, der sie, mit erstaunlichem Understatement, als »prägermanisch« einstufte.
Die Funde von Atapuerca legen nahe, dass sich die Neandertaler im Zeitraum von einer Viertelmillion Jahren verbreiteten. Wahrscheinlich waren es weder Klimaveränderungen noch die Expansion in neue Lebensräume, die für Bedingungen gesorgt haben, unter denen einige wenige Mutanten entstehen und den Heidelbergmenschen schließlich verdrängen konnten, als vielmehr reine Zufallsabweichungen im genetischen Bestand der Population (genetic drift), aufgrund derer sich viele unterschiedliche Arten von Affenmenschen nebeneinander entwickelt haben. Die »klassischen« Neandertaler erschienen vor 200 000 Jahren und verbreiteten sich in den folgenden 100 000 Jahren über den größten Teil Europas bis hin nach Sibirien; China oder Indonesien allerdings haben sie, soweit wir wissen, nicht erreicht.
Wie sehr nun unterschieden sich Neandertaler von Peking-Menschen? Sie waren in der Regel etwa gleich groß wie die östlichen Affenmenschen, sahen |64|aber mit ihrer fliehenden Stirn und dem schwach ausgeprägten Kinn womöglich noch primitiver aus. Sie hatten große Schneidezähne, häufig abgenutzt, weil sie als Werkzeug eingesetzt wurden. Eine hervortretende Gebisspartie und Nase prägten das Gesicht, wobei die große Nase als Anpassung an die Kälte im eiszeitlichen Europa interpretiert wird. Neandertaler waren schwerer gebaut als Peking-Menschen, hatten breitere Hüften und Schultern. Sie waren so stark wie Ringer, hatten die Ausdauer von Marathonläufern und waren wohl auch wilde Kämpfer.
Obwohl ihre Knochen schwerer waren als die der meisten Affenmenschen, zogen sich Neandertaler häufig Verletzungen zu. Die Muster ihrer Knochenbrüche entsprechen, um einen modernen Vergleich zu geben, denen professioneller Rodeoreiter. Weil es vor 100 000 Jahren, zu Zeiten der Neandertaler, jedoch keine bockenden Wildpferde gab, von denen sie hätten stürzen können (moderne Pferde entwickelten sich nicht vor 4000 v. u. Z.), gehen Paläoanthropologen davon aus, dass sie sich ihre Verletzungen in Kämpfen zuzogen – in Kämpfen mit Artgenossen wie mit wilden Tieren. Neandertaler waren wilde Jäger; Analysen von Stickstoffisotopen in ihren Knochen haben ergeben, dass sie sich vor allem von Fleisch ernährten und einen erstaunlich hohen Anteil ihres Proteinbedarfs aus fleischlicher Nahrung bezogen. Archäologen hatten lange den Verdacht, dass die Neandertaler einen Teil ihres Bedarfs durch den Verzehr von Artgenossen deckten, so wie auch die Peking-Menschen. Funde, die in den 1990er Jahren in Frankreich gemacht wurden, bestätigten das inzwischen zweifelsfrei. An dieser Fundstätte entdeckte man Knochen von einem halben Dutzend Neandertalern vermischt mit Knochen von fünf Rothirschen. Affenmenschen und Rotwild waren auf die gleiche Weise behandelt worden: zunächst mit Steinwerkzeugen zerteilt, dann das Fleisch von den Knochen geschabt und schließlich die Schädel und die langen Röhrenknochen zerschmettert, um an Gehirn und Knochenmark zu gelangen.
Nach den Details, die ich bislang aufgeführt habe, haben sich Neandertaler nicht sehr von Peking-Menschen unterschieden, doch ist dem noch einiges hinzuzufügen. Zum einen hatten Neandertaler ein großes Gehirn – größer selbst als unseres, im Durchschnitt 1520 gegenüber unseren durchschnittlich 1350 Kubikzentimetern. Sie hatten auch einen breiteren Neuralkanal als der Turkana-Boy, und die damit dickeren Nervenstränge des Rückenmarks verliehen ihnen größere manuelle Geschicklichkeit. Ihre Steinwerkzeuge waren besser gearbeitet und vielfältiger als die des Peking-Menschen, sie verfügten über spezialisierte Schaber, Klingen und Spitzen. Spuren von Teer an einer solchen Spitze, die im Hals eines Wildesels gefunden wurde, deuten darauf hin, dass es sich um eine Speerspitze gehandelt hat, die an einem Holzspieß befestigt war. Gebrauchsspuren an manchen Werkzeugen lassen erkennen, dass Neandertaler sie vor allem zur Holzbearbeitung verwendet haben. Holz zerfällt in der Regel, in der Unterwasserfundstelle nahe dem niedersächsischen Schöningen aber wurden neben Knochenhaufen von |65|Wildpferden auch vier wunderschön geschnitzte, zwei Meter lange Speere geborgen. Die Speere waren als Stoß- und nicht als Wurfwaffen austariert; die Neandertaler waren wohl geschickt, doch möglicherweise nicht koordiniert genug, um Wurfgeschosse einsetzen zu können.
Die Notwendigkeit, sich bedrohlichen Tieren bis auf kurze Distanzen zu nähern, mag der Grund sein für die an Rodeoreiter erinnernden Verletzungen der Neandertaler. Es gibt aber auch Funde, so wie die aus der Shanidar-Höhle im Norden des Irak, die auf ganz andere Eigenschaften verweisen. Eines der Skelette gehörte einem Mann, der trotz seiner deformierten Beine und obwohl er einen Unterarm und das linke Auge verloren hatte, noch Jahre überlebt hat – nach diesem Fund hat Jean Auel den verkrüppelten spirituellen Führer einer Gruppe Neandertaler auf der Krim geschildert, eine Figur ihres Bestsellers Ayla und der Clan des Bären. Ein anderer Mann aus Shanidar litt an einer arthritischen Versteifung des rechten Knöchels, doch auch er hat sich offenbar so lange durchgeschlagen, bis ihn eine Stichwunde tötete. Dass sie über größere Gehirne verfügten, hat es den Schwachen und Verkrüppelten zweifellos erleichtert, für sich zu sorgen; Neandertaler konnten mit Gewissheit Feuer anzünden und wahrscheinlich auch aus Tierhäuten Kleidung fertigen. Und dennoch ist schwer vorstellbar, dass die beiden Männer aus Shanidar ohne die Hilfe gesunder Gefährten oder Familienmitglieder zurechtgekommen sind. Selbst die nüchternsten Wissenschaftler gehen davon aus, dass Neandertaler – anders als ältere Arten der Gattung Homo und anders auch als ihre Zeitgenossen in Zhoukoudian – etwas zeigen, das wir nur als »Menschlichkeit« bezeichnen können.
Einige Paläoanthropologen sind sogar der Auffassung, dass es das große Gehirn und der weite Neuralkanal den Neandertalern erlaubten, in etwa so zu sprechen, wie wir das tun. Wie moderne Menschen verfügten sie bereits über das bewegliche Zungenbein, an dem der Kehlkopf aufgehängt ist und das die Funktionen des Sprechens, Schluckens und Atmens erleichtert. Andere Wissenschaftler widersprechen dem: Das Neandertalergehirn sei zwar groß, aber auch länger und flacher gewesen als unseres, darum wohl auch die Sprachzentren weniger ausgeprägt. Man müsse, selbst wenn dies nur von drei erhaltenen Schädeln bestätigt werde, davon ausgehen, dass der Kehlkopf bei Neandertalern sehr weit oben im Hals gesessen habe, sodass sie trotz ihres Zungenbeins wohl nur ein begrenztes Spektrum an Tönen erzeugen, vielleicht einzelne Silben hervorbringen (wir könnten hier von einem »ich Tarzan, du Jane«-Modell sprechen), möglicherweise auch wichtige Gedanken äußern konnten – etwa: »Komm her«, »lass uns jagen gehen«, »lass uns Werkzeuge/Essen/Sex machen«. Dazu aber werden sie Gesten und Töne miteinander kombiniert haben (so wie der Clan des Höhlenbären im bereits erwähnten Roman, der den Neandertalern eine entwickelte Zeichensprache zuschreibt).
Im Jahr 2001 sah es so aus, als könne die Genetik Licht in diese Angelegenheit bringen. Wissenschaftler fanden heraus, dass in einer britischen Familie, deren |66|Mitglieder über drei Generationen hinweg an einer Sprachstörung gelitten hatten, die verbale Entwicklungsdyspraxie genannt wird, auch eine Mutation des Gens FOXP2 vorkam. Dieses Gen kodiert ein Protein, das die Hirnaktivitäten beim Reden und Sprechen beeinflusst. Allerdings bedeutet das nicht, dass FOXP2 das Sprachgen ist: Das Sprechen ist ein unendlich komplexer Prozess, an dem zahllose Gene beteiligt sind, von deren Zusammenwirken wir noch keine Ahnung haben. FOXP2 fiel den Wissenschaftlern auf, weil manchmal nur ein Glied in einer Kette fehlerhaft sein muss, um das ganze System zusammenbrechen zu lassen. (Eine Maus zerbeißt ein Zwei-Cent-Kabel, und schon springt mein 20 000-Dollar-Auto nicht an.) So können sich Funktionsstörungen von FOXP2 und die komplizierten Sprachnetzwerke des Gehirns verhaken. Wie auch immer, einige Archäologen vermuten, dass zufällige Mutationen, die FOXP2 und verwandte Gene hervorbrachten, den modernen Menschen sprachliche Fähigkeiten verschafft haben, die früheren Arten, die Neandertaler einbegriffen, fehlten.
Dann aber wurde die Sache interessant. Wie heute jeder weiß, ist die DNA – Desoxyribonukleinsäure – der Grundbaustein des Lebens, und es ist Genetikern im Jahr 2000 gelungen, das menschliche Genom zu sequenzieren. Weniger bekannt ist, dass Wissenschaftler in Leipzig bereits 1997 aus dem Armknochen jenes Neandertalerskeletts, das 1856 bei Düsseldorf gefunden wurde, die uralte DNA extrahieren konnten – eine außerordentliche Leistung, denn DNA-Ketten beginnen bereits kurz nach dem Tod zu zerbrechen, weshalb in derart altem Material nur kleinste Fragmente überdauern. Das Leipziger Team hatte gewiss nicht im Sinn, Höhlenmenschen zu klonen und einen Neandertal-Park2* zu eröffnen, doch zwischen 2007 und 2009 wurde auch das Genom des Neandertalers sequenziert, und das wiederum führte zu einer bemerkenswerten Erkenntnis: Schon die Neandertaler hatten (was zuvor bezweifelt wurde) das Gen FOXP2.
Möglicherweise also waren die Neandertaler nicht weniger mitteilungsfreudig als wir. Es könnte aber auch sein, dass FOXP2 gar nicht der Schlüssel zu Sprachfähigkeit und -verständnis ist. Eines Tages werden wir das wohl wissen, derzeit aber können wir nur die materiellen Spuren untersuchen, die die Neandertaler hinterließen. Sie lebten in größeren Gruppen als frühere Formen von Affenmenschen, sie jagten effektiver, besetzten Territorien für längere Perioden, und sie kümmerten sich umeinander, wie dies früheren Affenmenschen nicht möglich war.
|67|Sie haben auch einige ihrer Toten ganz sorgfältig begraben, haben über ihren Toten vielleicht sogar Rituale vollzogen – die frühesten Hinweise auf die menschlichste aller Fähigkeiten, auf ein spirituelles Leben –, wenn wir die Funde denn richtig interpretieren. In Shanidar zum Beispiel sind einige Körper definitiv bestattet worden, und die Erde in einem der Gräber enthielt Pollen in hoher Konzentration, was bedeuten könnte, dass einige Neandertalergruppen den Körper eines geliebten Toten auf Frühlingsblumen betteten. Weniger romantisch ist der Hinweis anderer Archäologen: Die Grabstätte sei durchzogen von Rattengängen, und Ratten schleppten häufig Blumen in ihre Verstecke.
In einem anderen Fall, am Monte Circeo bei Rom, haben Bauarbeiter 1939 ein Grab entdeckt, das 50 000 Jahre v. u. Z. von einem Felssturz verschüttet worden war. Sie erzählten den Archäologen, dass ein Neandertalerschädel mitten in einem Kreis von Steinen auf dem Boden gelegen habe, doch hatten sie den Schädel zuvor bereits bewegt, was viele Wissenschaftler an ihrem Bericht zweifeln ließ.
Zuletzt ist da noch Teschik-Tasch in Usbekistan. Dort fand Hallam Movius (berühmt wegen der nach ihm benannten Linie) das Skelett eines Jungen, um das, wie er berichtet hat, fünf oder sechs Paar Wildziegenhörner gelegt worden waren. Allerdings hat Movius weder Lageskizzen noch Fotografien präsentiert, um Skeptiker davon zu überzeugen, dass die Hörner ein bedeutungsvolles Muster bildeten.
Wir brauchen eindeutigere Beweise, bevor wir diese Frage ad acta legen können. Ich selbst gehe davon aus, dass es keinen Rauch ohne Feuer gibt und die Neandertaler insofern bestimmt eine gewisse Form spirituellen Lebens kannten. Möglicherweise gab es unter ihnen Medizinfrauen und Schamanen wie Iza und Creb aus Clan des Bären. Wie dem auch sein mag: Könnte die Zeitmaschine, von der ich bereits sprach, einen von uns nach Shanidar und auch nach Zhoukoudian expedieren, wir würden wirkliche Unterschiede im Verhalten zwischen den Peking-Menschen im Osten und den Neandertalern im Westen beobachten können. Und nur mit einiger Mühe könnten wir uns vor dem Gedanken hüten, dass der Westen damals entwickelter war als der Osten. Dies könnte bereits 1,6 Millionen Jahre früher so gewesen sein, als sich die Movius-Linie herausbildete, 100 000 Jahre später war es unzweifelhaft so. Wieder hebt das Gespenst der rassistischen Theorie langfristiger Determiniertheit sein Haupt: Beherrscht der Westen die Welt, weil die heutigen Europäer als Erben von den genetisch überlegenen Neandertalern abstammen, die Asiaten dagegen vom primitiveren Homo erectus?
Nein, natürlich nicht. Historiker lieben es, auf einfache Fragen lange verwickelte Antworten zu geben, in diesem Fall aber liegen die Dinge klar auf der Hand. Die Europäer stammen nicht von den überlegenen Neandertalern ab, so wenig wie die |68|Asiaten vom minderwertigen Homo erectus. Vor rund 70 000 Jahren1* begann eine neue Spezies der Gattung Homo – nämlich wir – aus Afrika herauszuwandern und alle anderen Formen zu verdrängen.2*Unsere Art, Homo sapiens ( »der weise Mensch«), machte reinen Tisch: Wir heutigen Menschen sind alle Afrikaner. Die Evolution hat sich natürlich fortgesetzt, und lokale Variationen in Hautfarbe, Gesichtskontur, Größe, Laktosetoleranz und 1000 anderen Dingen haben sich in den 2000 Generationen herausgebildet, seitdem wir uns über den gesamten Globus verteilt haben. Bei Licht besehen sind alle diese Unterschiede trivial. Wo immer man hingeht, was immer man tut: Die Menschen (in großen Gruppen betrachtet) sind doch überall weitgehend gleich.
Die Evolution unserer Spezies und deren Eroberung des Planeten sind der Grund für die biologische Einheit der Menschheit und bilden insofern auch den Ausgangspunkt aller Erklärungen, warum der Westen die Welt regiert. Diese biologische Einheitlichkeit schließt alle rassistischen bzw. auf Rassenbegriffen basierenden Theorien aus. Doch so bedeutsam diese Prozesse auch sein mögen, vieles von den Ursprüngen der modernen Menschen bleibt im Dunkel. In den 1980er Jahren haben Archäologen herausgefunden, dass die ersten Skelette, die den unseren mehr oder weniger gleichen, rund 150 000 Jahre alt sind – geborgen an ost- und südafrikanischen Fundstellen. Die neue Spezies hatte flachere Gesichter als frühere Affenmenschen; Gesichter, deren untere Partien nicht mehr so weit über die Stirn hervorsprangen. Sie nutzten ihre Zähne seltener als Werkzeuge, hatten längere und muskulösere Gliedmaßen, weitere Neuralkanäle, und ihr Kehlkopf saß an einer zum Sprechen geeigneteren Stelle. Die Schädelhöhlung für ihr Gehirn war etwas kleiner als bei den Neandertalern, dennoch war das Schädeldach höher und gewölbter und ließ so Raum für größere Sprech- und Sprachzentren sowie für mehr übereinander liegende Neuronenschichten, die darum enorm viele Operationen parallel ausführen konnten.
An den Skeletten lässt sich ablesen, dass schon der früheste Homo sapiens sich in dem Gang fortbewegen konnte, in dem auch wir gehen. Merkwürdigerweise aber behauptete die Archäologie, Homo sapiens habe sich über 100 000 Jahre geweigert, auch so zu sprechen wie wir. Werkzeuge und Handlungsweisen von Homo sapiens scheinen denen älterer Affenmenschen weitgehend ähnlich zu sein, |69|und der frühe Homo sapiens kannte – wiederum wie ältere Affenmenschen und ganz anders als wir – offenbar jeweils nur eine Art, Dinge zu erledigen. Egal wo in Afrika die Archäologen gruben, stets förderten sie die gleichen, nicht sonderlich aufregenden Funde zutage. Es sei denn, sie gruben an Stätten, an denen Homo sapiens vor weniger als 50 000 Jahren gelebt hat. An solch jüngeren Stätten nämlich begann Homo sapiens allerhand interessante Dinge zu tun, und das auf viele verschiedene Weisen. Werkzeuge in nicht weniger als sechs eindeutig unterscheidbaren Stilen haben Archäologen registriert, die zwischen 50 000 und 25 000 v. u. Z. im Nil-Tal in Gebrauch waren. In den Zeiten davor war von Südafrika bis an die Mittelmeerküsten ein einziger Stil vorherrschend.
Die Menschen hatten Stile entwickelt. An der Art, in der Steinwerkzeuge zurechtgeschlagen wurden, lässt sich eine Gruppe signifikant von ihren Nachbarn unterscheiden; und wenn die Abschläge auf eine dritte Weise entstanden waren, dann kann sich darin eine neue Generation in ihrem Unterschied zu ihren Vorfahren zeigen. Der Wandel vollzog sich lange Zeit unendlich langsam – zumindest nach Maßstäben, die wir gewohnt sind. Uns erscheint ja schon ein Handy wie ein Fossil, mit dem wir keine Fotos aufnehmen können, das uns nicht unseren Standort auf einer Karte zeigt und uns keine E-Mails lesen lässt. Von nun an jedoch und verglichen mit den riesigen Zeiträumen zuvor vollzog sich der Wandel geradezu kometenhaft.
Wie uns jeder Teenager bestätigen wird, der mit grün gefärbten Haaren oder mit einem neuen Piercing im Elternhaus auftaucht, gibt es keinen besseren Weg, sich selbst darzustellen, als sich zu schmücken. Doch allem Anschein nach hat das bis vor 50 000 Jahren niemand so gesehen. Und plötzlich taten es alle. Fundstätte um Fundstätte, die jünger ist als 50 000 Jahre v. u. Z., lieferte den Archäologen mit Ornamenten verzierte Knochen, Tierzähne und Elfenbein – und das zeigt ja nur die Tätigkeiten, die in haltbaren Materialien Niederschlag fanden und deshalb von uns ausgegraben werden können. Wahrscheinlich sind so gut wie alle anderen Formen persönlichen Schmucks, die auch wir kennen – Haartracht, Schminke, Tätowierungen, Kleidung –, etwa um die gleiche Zeit aufgetaucht. Eine genetische Studie kam zu dem ziemlich kribbligen Ergebnis, dass sich vor etwa 50 000 Jahren auch Körperläuse, die von unserem Blut leben, entwickelt haben – als kleiner Bonus für die ersten Fashionistas.
»Welch ein Meisterwerk ist der Mensch!«, keucht Hamlet, als seine Freunde Rosenkranz und Güldenstern kommen, ihn auszuspähen. »Wie edel durch Vernunft! Wie unbegrenzt an Fähigkeiten! In Gestalt und Bewegung wie bedeutend und wunderwürdig! Im Handeln wie ähnlich einem Engel! Im Begreifen wie ähnlich einem Gott!«7 Und wie unähnlich doch einem Affenmenschen. Menschen um 50 000 v. u. Z. dachten und handelten auf einer ganz anderen Ebene als ihre Vorfahren. Dazwischen muss etwas ganz Außerordentliches stattgefunden haben – etwas so Tiefgreifendes, Magisches, dass es normalerweise eher nüchterne Wissenschaftler in den 1990er Jahren zu rhetorischen Höhenflügen animiert hat. |70|Manche sprachen von einem »Großen Sprung nach vorn«3*, andere von der Morgendämmerung der menschlichen Kultur, ja sogar vom Big Bang, dem Urknall des menschlichen Bewusstseins.
So dramatisch sie sein mögen, alle diese Theorien vom Großen Sprung behalten stets etwas Unbefriedigendes. Denn wir dürfen uns nicht nur eine, sondern müssen uns zwei Transformationen vorstellen, deren erste (vor etwa 150 000 Jahren) zum Körperbau des modernen Menschen führte, aber nicht zu einem anderen Gebaren, während die zweite (vor etwa 50 000 Jahren) die Handlungsweisen des modernen Menschen hervorbrachte, unseren Köperbau jedoch unverändert ließ. Die von den meisten anerkannte Erklärung läuft darauf hinaus, dass die zweite Transformation – der Große Sprung – mit rein neurologischen Veränderungen begonnen habe, in deren Verlauf das Gehirn neu geschaltet wurde. Das habe es den Menschen ermöglicht, auf moderne Art zu sprechen, und das wiederum habe zur Revolution des Verhaltens geführt. Ein Rätsel jedoch blieb, worin diese Neuschaltung eigentlich bestanden haben soll (und warum sich nicht gleichzeitig auch an der Schädelform etwas geändert hat).
Wenn überhaupt irgendwo, dann hat die Evolutionswissenschaft genau hier Raum gelassen für eine übernatürliche Intervention, für irgendeine höhere Macht, die mit ihrem Atem einen Funken Göttlichkeit in den dumpfen Lehm der Affenmenschen gepustet hat. Als ich (erheblich) jünger war, hat mir die Episode besonders gefallen, mit der Arthur C. Clarke seinen Roman 2001 beginnen lässt, der parallel zum Drehbuch für Stanley Kubricks unvergesslichen, wenn auch schwer nachvollziehbaren Film 2001: Odyssee im Weltraum entstand. (Beider Ausgangspunkt war Clarkes Kurzgeschichte Der Wachposten.) Mysteriöse kristalline Monolithen gelangen aus weit entfernten Räumen des Alls auf die Erde, gerade rechtzeitig, um die Affenmenschen unseres Planeten vor der Vernichtung durch Hunger zu bewahren. Nacht um Nacht, während ein Monolith ihm Visionen sendet und ihn lehrt, Steine zu werfen, fühlt Mond-Schauer, Alphamännchen in einer Gruppe von Affenmenschen, »die ersten Regungen einer neuen, starken Empfindung. … Sein primitives Hirn musste gründlich und bis in die kleinsten Teile umgeformt werden.« Ihren Abschluss findet die Mission des Monolithen damit, dass sich Mond-Schauer einen ausgeblichenen Knochen schnappt und damit einem Ferkel den Schädel einschlägt. Clarkes Vision vom Big Bang des menschlichen Bewusstseins hat, deprimierend genug, von Anfang an mit Zerstören und Töten zu tun und kulminiert im Mord, den Mond-Schauer an Einohr verübt, dem Alphamann einer rivalisierenden Gruppe. Als Nächstes findet sich der Leser ins Zeitalter der Weltraumfahrt versetzt.8
|71|Clarke verlegt die große Stunde von 2001 in die Zeit vor drei Millionen Jahren, denkt dabei vermutlich an die Erfindung des Werkzeugs durch Homo habilis. Mir schien jedoch immer schon, dass der Punkt, an dem ein guter Monolith wirklich etwas hätte vollbringen können, das Erscheinen des modernen Menschen gewesen wäre. Als ich mit meinem Archäologiestudium begonnen habe, wurde mir beigebracht, Dinge wie die zuletzt geäußerten nicht zu sagen. Doch ich wurde das Gefühl nicht los, dass professionelle Erklärungen weit weniger zwingend sind als die von Clarke.
Das große Problem, mit dem sich Archäologen in jenen fernen Tagen meines Studienbeginns herumschlagen mussten, lässt sich eigentlich ganz einfach formulieren: Man hatte damals noch nicht sehr viele Stätten ausgegraben, die Relikte aus der Zeit zwischen 200 000 und 50 000 Jahren v. u. Z. enthielten. Das geschah erst während der 1990er Jahre, und mit den neuen Funden wurde klar, dass wir überhaupt keine Monolithen brauchen. Der Große Sprung nach vorn löste sich damals auf in eine Folge von Trippelschritten, die sich auf Zehntausende von Jahren verteilen.
Wir kennen eine Reihe von Fundstätten, die älter sind als 50 000 Jahre, in denen aber dennoch Hinweise auf erstaunlich modern wirkende Handlungsweisen entdeckt wurden. So zum Beispiel die Pinnacle-Point-Höhlen an der südafrikanischen Küste, deren (2007 genauer untersuchten) Funde unter anderem belegen, dass die frühen Menschen bereits vor gut 70 000 Jahren das Feuer benutzten, um Steinwerkzeuge zu bearbeiten. Schon vor rund 160 000 Jahren war Homo sapiens in diese Küstenregion gezogen – allein das ist eine interessante Tatsache, denn frühere Affenmenschen haben die Meeresufernähe gemieden, wahrscheinlich weil sie sich nicht vorstellen konnten, dort viel Nahrung zu finden. Homo sapiens jedoch zog nicht nur gezielt in Küstengebiete – eine eindeutig moderne Präferenz –, sondern verstand es auch, sobald er dort siedelte, Schalentiere zu sammeln, zu öffnen und zuzubereiten. Die Gruppen beherrschten die Abschlagtechnik so gut, dass sie kleine leichte Spitzen herstellen konnten, die sich perfekt für Wurfspeere und Pfeile eigneten – etwas, was weder Peking-Menschen noch Neandertaler jemals taten.
Andere Beispiele aus afrikanischen Fundstätten: Vor rund 100 000 Jahren umlegten die Bewohner der Mumbwa-Höhlen in Sambia ihre Feuerstelle mit Steinplatten und schufen sich so eine gemütliche Nische. Leicht lässt sich vorstellen, wie sie dort im Kreis saßen und Geschichten erzählten. An afrikanischen Küsten, von der Südspitze bis Marokko und Algerien im Norden (und selbst über Afrika hinaus, in Israel), an Dutzenden von Siedlungsstätten hockten sich die Gruppen geduldig hin, schnitten und schliffen aus den Schalen von Straußeneiern Perlen, einige mit einem Durchmesser von etwa sechs Millimetern. Vor 90 000 Jahren waren die Leute von Katanda (in der heutigen Demokratischen Republik Kongo) zu Fischern geworden, die ihre Harpunen aus Knochen schnitzten. Die interessanteste Fundstätte ist die Blombos-Höhle an der Küste der südafrikanischen Kap-Provinz, wo die Ausgräber |72|nicht nur Muschelperlen fanden, sondern auch mehrere fingerlange und auf den ersten Blick unscheinbare Ockersteine. Dieses Eisenerz kann zu vielen Zwecken verwendet werden, man kann Dinge damit verkleben, Segel wasserabweisend machen und anderes mehr; in neuerer Zeit allerdings war dieser Stoff vor allem bekannt, weil sich mit ihm gut zeichnen lässt. Auf Baumrinde, an Höhlenwänden und auf menschlicher Haut hinterlässt Ocker kräftige rote Linien. In Pinnacle Point etwa fanden sich 75 Ockerstücke, und ab 100 000 v. u. Z. taucht er an den meisten Fundstellen in Afrika auf, woraus zu schließen wäre, dass die frühen Menschen gerne zeichneten. Was den Ockerstab aus der Blombos-Höhle jedoch so besonders interessant macht, ist, dass jemand vor 77 000 Jahren geometrische Muster darauf geritzt und ihn damit zum ersten Artefakt gemacht hat, bei dem unbestreitbar von Kunst zu reden ist. Zugleich ist dieser mit Ritzzeichnungen versehene Stein ein Objekt, das hergestellt wurde, um weitere Kunstwerke zu produzieren.
An allen diesen Siedlungsstätten finden wir Spuren von einer oder zwei modernen Handlungsweisen, niemals aber die gesamte Palette, die für die Zeit nach 50 000 v. u. Z. bekannt ist. Auch gibt es nicht viele Hinweise darauf, dass die modern erscheinenden Tätigkeiten sich schrittweise herausgebildet und dann durchgesetzt hätten. Langsam jedoch tasten sich die Archäologen vor zu einer Erklärung für die Trippelschritte hin zur vollständig modernen Menschheit, wobei sie den Antrieb vor allem im Klimawandel sehen.
Schon in den 1830er Jahren wurde den Geologen klar, dass die kilometerlangen, linienartig geschwungenen Gesteinsschuttablagerungen, die in Teilen Europas und Nordamerikas zu finden sind, von Eisschilden geformt worden sein müssen, die dieses Geröll vor sich her schoben (und nicht, wie man bis dahin dachte, von Wassermassen der biblischen Sintflut). Die Vorstellung einer »Eiszeit« war damit geboren, auch wenn es weitere fünfzig Jahre dauerte, bis Wissenschaftler begriffen hatten, warum es zu solchen extrem kalten Perioden kommt.
Die Umlaufbahn der Erde um die Sonne bildet keinen vollkommenen Kreis, weil die Schwerkraft anderer Planeten auch auf unseren Globus einwirkt. Im Verlauf von 100 000 Jahren wandelt sich die Form dieser Umlaufbahn von nahezu rund (wie derzeit) bis leicht elliptisch – und wieder zurück. Zudem steht die Rotationsachse der Erde nicht stabil, sondern taumelt in einem 22 000-Jahre-Rhythmus um die Senkrechte; ebenso schwankt die Neigung der Erdachse zur Umlaufbahn ( »Erdschiefe«), und zwar in einem 41 000-Jahres-Rhythmus. Diese drei Zyklen überlagern einander, und die Wissenschaft nennt das Ergebnis Milanković-Zyklen, nach dem serbischen Astrophysiker, der sie berechnet hat. Es sind also zeitvariante Muster, in denen sich die Intensität der Sonneneinstrahlung auf die Erde (die so genannte Solarkonstante) verändert. Durch die Überlagerung ergibt sich ein Rhythmus von ungefähr 100 000 Jahren, in dem die Sonneneinstrahlung schwankt: zwischen leicht überdurchschnittlicher, über das Jahr leicht ungleich verteilter und leicht unterdurchschnittlicher, etwas gleichmäßiger verteilter Energieeinstrahlung.
|73|Das alles hätte noch keine wesentlichen Folgen, würden die Milanković-Zyklen nicht in Wechselwirkung mit zwei geologischen Trends stehen. So hat erstens die Kontinentaldrift in den letzten 50 Millionen Jahren den größeren Teil der Landmassen in die Nordhalbkugel verschoben, was wiederum die Wirkung der jahreszeitlichen Unterschiede in der Sonneneinstrahlung vergrößert. Zweitens hat in derselben Periode die vulkanische Aktivität abgenommen. Es gibt – zumindest bislang noch – weniger Kohlendioxid in der Atmosphäre als zur Zeit der Dinosaurier, und darum hat sich der Planet über lange Perioden und bis vor kurzem kontinuierlich abgekühlt.
Während des größten Teils der Erdgeschichte waren die Winter kalt genug, um es über den Polen schneien und den Schnee gefrieren zu lassen; normalerweise aber ließ die Sonne dieses Eis im Sommer schmelzen. Vor 14 Millionen Jahren jedoch kühlte die Erde (aus Gründen, die noch nicht hinreichend geklärt sind) so weit ab, dass die Sonne das Eis am Südpol mit seiner großen Landmasse nicht mehr völlig abschmolz. Am Nordpol wiederum, wo es keine derartige Landmasse gibt, schmilzt das Eis zwar leichter, doch waren die Temperaturen vor 2,75 Millionen Jahren so weit gesunken, dass sich das Eis auch dort das ganze Jahr hindurch hielt. Das hatte enorme Konsequenzen. Jedes Mal, wenn die Erde, den Milanković-Zyklen entsprechend, zwar gleichmäßiger verteilte, aber geringere Sonneneinstrahlung erhielt, dehnte sich die Eiskappe am Nordpol weiter nach Europa, Asien und Nordamerika aus, band dabei mehr Wasser, ließ die Erde also trockener werden und den Meeresspiegel sinken. Gleichzeitig stieg die Menge der ins All zurückgestrahlten Sonnenenergie, wodurch die Durchschnittstemperaturen weiter sanken. Die Erde kreiselte sich in eine Eiszeit hinein, die so lange dauerte, bis sich der Planet wieder in eine wärmere Position hineintrudelte, neigte und drehte, und das Eis sich zurückzog.
Je nach Zählweise gab es zwischen vierzig und fünfzig Eiszeiten, und die beiden, die in die Periode zwischen 190 000 und 90 000 v. u. Z. fielen – die für die menschliche Evolution kritischen Jahrtausende –, waren besonders rau und heftig. Der Malawisee in Ostafrika etwa enthielt um 135 000 v. u. Z. nur den zwanzigsten Teil des Wassers, das er heute speichert. Die rauer werdende Umwelt muss die Regeln des Überlebens verändert haben, und das könnte erklären, warum sich Mutationen, die für ein größeres Gehirn sorgten, durchzusetzen begannen. Das könnte auch der Grund dafür sein, warum wir so wenige Siedlungsstätten aus dieser Zeit gefunden haben, weil die meisten Hominini damals vermutlich ausgestorben sind. Einige Archäologen und Genetiker gehen davon aus, dass um 100 000 v. u. Z. nur noch etwa 20 000 Vertreter unserer Gattung überlebt haben dürften.
Sollte diese neue Theorie zutreffen, dann hätte diese Populationskrise mehrere Dinge auf einmal bewirkt. Einerseits hätten sich mit schrumpfendem Genpool Mutationen leichter durchsetzen können; andererseits aber wären die kleiner gewordenen Homo-sapiens-Gruppen im Zweifelsfall auch leichter ausgestorben |74|und hätten jede vorteilhafte Mutation mit in den Tod genommen. Wenn es – was die geringe Zahl bekannter Siedlungsstätten aus dieser Zeit nahelegt – weniger Gruppen gegeben hat, dann müssen sich diese Gruppen auch seltener begegnet sein und damit weniger Gelegenheit gehabt haben, ihre Gene und ihr Wissen zu vereinen. Wir sollten also davon ausgehen, dass kleine Gruppen von Hominini 100 000 Jahre lang unter unfreundlichen und unsicheren Umweltbedingungen in Afrika ihr Leben fristeten. Sie begegneten einander kaum, kreuzten sich nur gelegentlich, tauschten nur selten Dinge und Nachrichten aus. In diesen isolierten Populationsinseln kam es häufig zu Mutationen, einige davon brachten Menschen hervor, wie wir welche sind, andere nicht. Einige Gruppen entwickelten Harpunen mit Widerhaken, andere fertigten Perlen, die meisten taten nichts dergleichen; und alle lebten sie unter dem Schreckgespenst der Auslöschung.
Dunkle Tage also für Homo sapiens. Dann aber, vor rund 70 000 Jahren, wendete sich das Blatt. Es wurde wärmer in Ost- und Südafrika und feuchter, damit das Jagen und Sammeln leichter, und mit ihren Nahrungsquellen vermehrten sich die frühen Menschen. Der moderne Homo sapiens hatte sich bereits seit gut 100 000 Jahren entwickelt, mit viel Versuch und Irrtum, mit Untergang und Auslöschung. Doch als sich das Klima besserte, konnten die Populationen mit den vorteilhaftesten Mutationen durchstarten. Sie pflanzten sich schneller fort als die mit kleinerem Gehirn ausgestatteten Hominiden. Es gab keine Monolithen, keinen Großen Sprung nach vorn, nur eine Menge Geschlechtsverkehr und Nachwuchs.
Innerhalb weniger Jahrtausende erreichten die frühen Menschen einen Kipppunkt, der ebenso sehr demographisch wie biologisch bestimmt war. Statt immer wieder auszusterben, wurden die Gruppen moderner Menschen groß und zahlreich genug, um in regelmäßigen Kontakt zu kommen, um Gene, Wissen und Können zu vereinigen. Nun vollzog sich der Wandel kumulativ, und die Handlungsweisen des Homo sapiens unterschieden sich rasch von denen anderer Affenmenschen. Und als es dazu kam, waren die Tage biologischer Unterschiede zwischen Osten und Westen gezählt.
Klimawandel ist selten ein einfacher Vorgang, und während die Ursprungsgebiete des Homo sapiens in Ost- und Südafrika vor 70 000 Jahren immer feuchter wurden, trocknete Nordafrika immer mehr aus. Unsere Vorfahren, die sich in ihren Siedlungsräumen rasch vermehrten, breiteten sich nicht in diese Richtung aus, stattdessen wanderten kleine Gruppen aus dem Gebiet des heutigen Somalia über eine Landbrücke in den Süden der Arabischen Halbinsel und von dort weiter in den heutigen Iran (Abbildung 1.3) – zumindest müssen wir annehmen, dass sie dies taten. Auch wenn es nur wenig archäologische Erkundungen in Südasien |75|gibt, müssen wir wohl davon ausgehen, dass sich Gruppen moderner Menschen in diese Richtung wandten, denn um 60 000 v. u. Z. hatten sie bereits das heutige Indonesien erreicht, hatten Boote gebaut, mit diesen 50 Seemeilen offener Gewässer überwunden und waren schließlich am Lake Mungo in Südostaustralien angelangt. Diese Siedler bewegten sich fünfmal schneller als die Gruppen des Homo erectus/ergaster außerhalb Afrikas. Waren die früheren Affenmenschen im Jahresdurchschnitt etwa 35 Meter vorangekommen, legten die anatomisch modernen Menschen um die zwei Kilometer zurück.
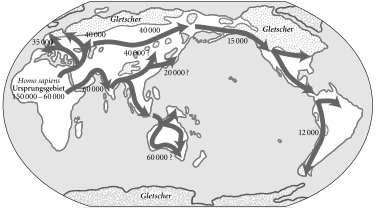
Abbildung 1.3: Die wiederhergestellte Einheit der Menschheit Die Verbreitung der modernen Menschen von Afrika aus, zwischen etwa 60 000 und 14 000 v. u. Z. Die Zahlen geben an, vor wie vielen Jahren anatomisch moderne Menschen in den verschiedenen Weltteilen auftauchten. Die Küstenlinien entsprechen denen der späten Eiszeit, etwa um 20 000 v. u. Z.
Zwischen 50 000 und 40 000 v. u. Z. zog eine zweite Welle von Wanderern vermutlich durch das heutige Ägypten nach Südwest- und Zentralasien, erreichte von dort aus Europa. Geschickt genug, um sich feine Klingen und Knochennadeln zu fertigen, schneiderten und nähten sich diese modernen Menschen passende Kleidung, bauten sich Unterkünfte aus Mammutstoßzähnen und Häuten und verwandelten so selbst die frostigen Weiten Sibiriens in einen Lebensraum. Um 15 000 v. u. Z. überquerten Menschen die Landbrücke zwischen Sibirien und dem heutigen Alaska und/oder segelten in kurzen Sprüngen an beider Küsten entlang. Um 12 000 v. u. Z. haben sie Koprolith (wissenschaftssprachlich für versteinerten Kot) in Höhlen im heutigen Oregon und Seegras in den Bergen des heutigen Chile hinterlassen. (Einige Archäologen glauben, dass Menschen auch den Atlantik überquert haben, und zwar entlang der Eisplatten, die damals Europa und Amerika verbanden; bislang allerdings bleibt das Spekulation.)
|76|Die Situation in Ostasien ist weniger klar. Ein vollständig moderner Menschenschädel wurde im chinesischen Liujiang gefunden; er könnte 68 000 Jahre alt sein, allerdings ist diese Datierung umstritten. Die ältesten nicht umstrittenen Relikte sind deutlich jünger, etwa 40 000 Jahre alt. Mit weiteren Grabungen wird man klären müssen, wann moderne Menschen das heutige China erreicht haben, ob bereits sehr früh oder erst relativ spät.1* Gesichert ist immerhin, dass sie vor 20 000 Jahren im heutigen Japan ankamen.
Wohin immer die neuen Menschen wanderten, sie haben dort, wie es aussieht, für Verwüstung gesorgt. Auf den Kontinenten, auf die frühere Affenmenschen niemals den Fuß gesetzt hatten, wimmelte es, als Homo sapiens dort anlangte, von riesigen Tieren. Die ersten Menschen, die Neuguinea und Australien erreichten, fanden dort 200 Kilogramm schwere flugunfähige Vögel und Reptilien vor, die eine Tonne wogen. Um 35 000 v. u. Z. waren sie ausgestorben. Die Funde am Lake Mungo und an einigen anderen Stätten zeigen, dass Menschen um 60 000 v. u. Z. dort angekommen waren. Menschen und Megafauna koexistierten also rund 25 000 Jahre lang. Einige Archäologen allerdings bestreiten diese Daten, ihrer Meinung nach müsste man die Ankunft der ersten Menschen dort auf 40 000 v. u. Z. vordatieren. Hätten sie Recht, wären die Großtiere nach Ankunft der Menschen verdächtig schnell verschwunden. Als vor 15 000 Jahren Menschen auf dem amerikanischen Doppelkontinent auftauchten, stießen sie dort auf Kamele, Elefanten und Riesenfaultiere; 4000 Jahre später waren diese Arten ausgelöscht. Die Koinzidenz zwischen der Ankunft von Homo sapiens und dem Verschwinden dieser riesigen Tiere ist frappant.
Direkte Beweise allerdings, dass Menschen diese Tiere bis zum Aussterben gejagt und aus ihrem Lebensraum vertrieben haben, gibt es nicht – dafür aber eine Menge anderer Erklärungen für ihr Verschwinden (Klimaänderungen etwa oder Meteoriteneinschläge). Die Tatsache, dass auch die Affenmenschen verschwanden, als Homo sapiens ihre Lebensräume erreichte, ist kaum noch strittig. Anatomisch moderne Menschen waren um 35 000 v. u. Z. in Europa eingedrungen, und nach nur 10 000 Jahren waren die Neandertaler, von einigen gebirgigen Randzonen abgesehen, überall verschwunden. Die letzten uns bekannten Relikte von Neandertalern wurden in Gibraltar gefunden, in einem Grabungshorizont, der 25 000 Jahre alt ist. 150 000 Jahre hatten sie Europa dominiert, und nun waren sie schlicht verschwunden.
Die Frage, wie moderne Menschen die Affenmenschen verdrängt haben, ist von grundlegender Bedeutung, um entscheiden zu können, ob die Vorherrschaft des Westens überhaupt rassisch begründet werden kann. Aber wir wissen nicht, ob unsere Vorfahren die geistig weniger begabten Arten aktiv vernichtet oder sie im Wettbewerb um Ressourcen einfach nur überholt und verdrängt haben. An |77|den meisten Fundstätten lösen die Hinterlassenschaften der modernen Menschen die der Neandertaler einfach ab. Das spricht für einen plötzlichen Wandel. Eine bedeutende Ausnahme bildet die Grotte du Renne (Rentierhöhle) bei Arcy-sur-Cure im französischen Burgund. Die Spuren einer Nutzung durch Neandertaler wechseln sich in den 33 000 bis 35 000 Jahre alten Schichten mit solchen ab, die moderne Menschen hinterließen. Zu den Relikten aus Neandertalerschichten gehören auch Steinfundamente für Hütten, Knochenwerkzeuge und Halsschmuck aus Tierzähnen. Die Ausgräber dieser Höhle gehen davon aus, dass die Neandertaler von den modernen Menschen gelernt haben und dass sich so etwas wie eine Dämmerung des Neandertalerbewusstseins ankündigte. Diverse Ockerfunde in Siedlungsstätten der Neandertaler in Frankreich (in einer der Höhlen über 20 Pfund) scheinen das zu bestätigen.
Wir können uns die muskelbepackten, langsam denkenden Neandertaler vorstellen, wie sie die wendigeren, gesprächigen Neuankömmlinge beobachteten, deren bemalte Körper, den Bau von Hütten bewunderten und sich anschließend mit ungeschickten Händen mühten, es diesen nachzutun, vielleicht sogar versuchten, frisch gejagtes Fleisch gegen Schmuck zu tauschen. Jean Auel hat sich in ihrem Roman Ayla und der Clan des Bären vorgestellt, wie die modernen Menschen die Neandertaler, »die Flachköpfe«, verjagt haben, während diese wiederum alles daran setzten, den »Anderen« aus dem Weg zu gehen – ausgenommen Ayla, das fünfjährige Menschenmädchen, das der Bärenclan der Neandertaler adoptiert hat. Natürlich ist das Fiktion, aber darum nicht weniger plausibel als alle anderen Vermutungen auch – es sei denn, wir folgten den unromantischen Archäologen, die da sagen, schlampige Grabungen seien die einfachste Erklärung dafür, dass in der Grotte du Renne Neandertalerschichten und solche moderner Menschen einander ablösten; sie sehen keinen Beweis dafür, dass die »Flachköpfe« von den »Anderen« gelernt hätten.
Entscheidend ist der Sex. Wenn sich die anatomisch modernen Menschen im Westen der Alten Welt an die Stelle der Neandertaler, im Osten an die des Homo erectus gesetzt haben, ohne sich mit diesen zu mischen, dann können die auf Rassebegriffen basierenden Theorien, die die aktuelle Vorherrschaft des Westens auf bereits in der Vorgeschichte bestehende biologische Differenzen zurückführen, nur falsch sein. Was aber geschah tatsächlich?
Zu Hochzeiten des so genannten wissenschaftlichen Rassismus in den 1930er Jahren behaupteten einige Anthropologen, dass anatomisch moderne Menschen aus China primitiver seien als solche aus Europa. Ihre Begründung: Die Schädel der Ostmenschen wiesen Ähnlichkeiten mit denen des Peking-Menschen auf (kleine Wülste auf dem Schädeldach, vergleichsweise flache obere Partien des Gesichts, schaufelförmige Schneidezähne). Dieselben Anthropologen betonten auch, dass die Schädel der Ureinwohner Australiens Ähnlichkeiten mit dem eine Million Jahre alten indonesischen Homo erectus zeigten (Knochenwülste am Hinterkopf, an denen die Nackenmuskulatur ansetzte, vorspringende Augenbrauen, |78|fliehende Stirn, große Zähne). Darum, so die Schlussfolgerung dieser (westlichen) Anthropologen, müssten die modernen Menschen des Ostens von diesen primitiveren Affenmenschen abstammen, die im Westen dagegen von den fortgeschritteneren Neandertalern; und das wiederum könnte erklären, warum der Westen die Welt regiere.
Derart simpel argumentiert heute niemand mehr. Doch wenn wir der Frage nach der westlichen Vorherrschaft ernsthaft nachgehen wollen, müssen wir die Möglichkeit berücksichtigen, dass Homo sapiens sich mit vormodernen Menschen gekreuzt hat und Populationen im Osten biologisch weniger entwickelt gewesen sein könnten als die im Westen. Wir werden kaum Beilager ausgraben können, die uns bewiesen, dass Homo sapiens im Westen seine Gene mit denen des Neandertalers beziehungsweise im Osten mit denen des Peking-Menschen vermischt hat. Zum Glück ist das aber auch nicht erforderlich, denn wenn es zu solchen amourösen Treffen tatsächlich gekommen ist, dann müssten die Folgen noch in unseren Körpern festzustellen sein.
Denn alle Vorfahren, die wir je hatten, haben uns Bestandteile ihrer DNA vererbt, sodass Genetiker, zumindest theoretisch, die DNA aller lebenden Menschen vergleichen und einen Stammbaum zeichnen könnten, der zurückführt bis zum jüngsten gemeinsamen Vorfahren aller Menschen. Dass jedoch die Hälfte unserer DNA von der väterlichen, die andere von der mütterlichen Linie herrührt, erschwert die praktische Entwirrung der Erbinformationen enorm.
Aber pfiffige Genetiker haben einen Weg gefunden, dieses Problem zu umgehen, indem sie sich die DNA der Mitochondrien – eines vom Zellkern unabhängigen Organells – vorgenommen haben. Denn diese mitochondriale DNA (mtDNA) wird nicht, wie die nukleare DNA der Chromosomen, geschlechtlich reproduziert, sondern ausschließlich von Frauen weitergegeben (Männer erben die mtDNA ihrer Mutter, geben sie aber nicht weiter). Vor Urzeiten hatten wir alle die gleiche mtDNA, und darum muss jede Differenz zwischen der mtDNA in meinem Körper zur mtDNA im Körper eines anderen die Folge zufälliger Mutationen sein und nicht die sexueller Vermischung.
1987 hat ein von der Genetikerin Rebecca Cann geleitetes Forschungsteam eine Studie zur mtDNA lebender Menschen aus allen Weltteilen veröffentlicht. Sie identifizierten in ihren Daten rund 150 Typen und stellten fest, dass sie, mit welchen statistischen Tricks sie ihr Datenmaterial auch aufbereiteten, stets zu drei Schlüsselergebnissen kamen. Erstens: Es gibt nirgends eine größere genetische Diversität der mtDNA als in Afrika. Zweitens: Die Diversität in der übrigen Welt ist eine Teilmenge der Diversität in Afrika. Und drittens: Die tiefsten – und darum ältesten – Abstammungslinien der mtDNA kommen alle aus Afrika. Das lässt nur einen Schluss zu: Die letzte weibliche Ahnin, die allen Menschen auf der Welt gemeinsam ist, muss in Afrika gelebt haben – die afrikanische Eva, wie sie sofort genannt wurde. Sie war, wie Cann und ihre Kollegen festhielten, »die eine glückliche Mutter«9. Indem sie standardisierte Schätzungen der Mutationsrate |79|zugrunde legten, errechneten sie, dass Eva vor 200 000 Jahren gelebt haben muss.
Während der gesamten 1990er Jahre stritten Paläoanthropologen über die Schlussfolgerungen des Teams um Cann. Einige stellten ihre Methode in Frage (es gibt Tausende von Möglichkeiten, die statistischen Zahlen zu gruppieren, die aber, theoretisch zumindest, alle gleich gültig sind), andere die Ausgangsdaten (die meisten »Afrikaner« der Studie waren Afroamerikaner), doch auch mit revidierten Zahlen und Proben kam man immer wieder zu fast den gleichen Ergebnissen. Das einzig neue Resultat war, dass man die Lebenszeit Evas präzisierte: auf 175 000 ±50 000 Jahre v. u. Z. Um die Sache zu entscheiden, Ende der 1990er Jahre dann, bekam die afrikanische Eva Gesellschaft, weil Genetiker mit verbesserten Techniken in der Lage waren, die nukleare DNA auf dem Y-Chromosom zu untersuchen. Wie die mtDNA wird auch sie asexuell reproduziert, allerdings ausschließlich auf der männlichen Linie. Wie eingehende Forschungen ergaben, offenbart auch die nukleare DNA des Y-Chromosom die größte Diversität und die tiefsten Abstammungslinien in Afrika und verweist so auf einen afrikanischen Adam, der irgendwann im Zeitraum von 90 000 bis 60 000 Jahren v. u. Z. gelebt hat – die Quelle für nichtafrikanische Varianten liegt erst etwa bei 50 000 Jahren.2* Die genetischen Daten scheinen absolut schlüssig zu sein: Alle heute lebenden Menschen stammen von Afrikanern ab, keine und keiner trägt genetische Spuren des Neandertalers oder des Peking-Menschen in sich.
Einige Paläoanthropologen allerdings sind noch immer nicht überzeugt und behaupten, dass die Genetik weniger zähle als die Ähnlichkeiten im Knochenbau, die sie zwischen dem westlichen Homo sapiens und den Neandertalern beziehungsweise zwischen dem östlichen Homo sapiens und dem Homo erectus sehen. Sie verwerfen die Out-of-Africa-Theorie zugunsten einer Theorie »multiregionaler« Entwicklung. Die ursprünglichen kleinen Schritte, das räumen sie ein, könnten durchaus in Afrika geschehen sein, doch die anschließenden Wanderungen der Populationen zwischen Afrika, Europa und Asien hätten für einen derart raschen Genfluss gesorgt, dass sich günstige Mutationen an einem Ort innerhalb weniger 1000 Jahre überallhin hätten verbreiten können. Aus diesem Grund hätten sich leicht unterschiedene Formen des anatomisch modernen Menschen (Homo sapiens) in verschiedenen Teilen der Welt parallel entwickelt. Dies |80|erkläre beides: die genetischen Beweise ebenso wie die aus dem Knochenbau abgeleiteten. Und demzufolge seien Ost- und Westmenschen biologisch tatsächlich unterschieden.
Wie so viele Theorien ist auch die des Multiregionalismus zweischneidig, und so beharren einige chinesische Wissenschaftler darauf, dass China etwas Besonderes sei, denn – so konnte man in der China Daily lesen – »die modernen Chinesen stammen nicht aus Afrika, sondern von dort, wo sich das heutige China befindet«.10 Seit Ende der 1990er Jahre jedoch sprechen immer mehr Beweise gegen derartige Vorstellungen. Für Europa konnte gezeigt werden, dass die mtDNA der Neandertaler sich von der unseren vollständig unterscheidet, was wohl ausschließt, dass Neandertaler und Homo sapiens gemeinsame Nachkommen gehabt haben. Selbst die winzige Möglichkeit, dass sich Neandertaler und Homo sapiens gekreuzt haben, dass dann aber genetisches Material von Neandertalern durch zufällige Auslöschung aus unserem Genpool verschwunden ist, dürfte eher unwahrscheinlich sein: Die mtDNA, die Genetiker 2003 aus in Europa gefundenen, 24 000 Jahre alten Skeletten extrahiert haben, zeigt eine Menge Gemeinsamkeiten mit unserer, jedoch überhaupt keine mit der mtDNA von Neandertalern.
Die Zahl der Untersuchungen fossiler DNA aus Ostasien ist geringer, doch die wenigen Studien, die unternommen wurden, sprechen dafür, dass auch hier keine Vermischung stattgefunden hat. Die Autoren einer Untersuchung von Y-Chromosomen stellen sogar fest: »Die Daten stützen nicht einmal einen minimalen Beitrag von dort lebenden Hominiden zur Abstammung des anatomisch modernen Menschen in Ostasien.«11 Die genetischen Daten scheinen eindeutig zu sein. Homo sapiens hat sich in Afrika entwickelt und sich nicht mit Affenmenschen gekreuzt – möglicherweise konnte er das nicht einmal.
Die Diskussion zieht sich hin, noch 2007 wurde triumphierend behauptet, die Formen kürzlich in Zhoukoudian ausgegrabener Zähne und eines Schädelfragments aus Xuchang zeigten, dass sich in China aus dem Homo erectus anatomisch moderne Menschen entwickelt hätten. Aber noch während diese Funde publiziert wurden, trieben andere Wissenschaftler den, wie es scheint, letzten Nagel in den Sarg der Multiregionaltheorie. Ihre ausgeklügelte, mehrfache Regressionsanalyse der Maße von über 6000 Schädeln zeigen, dass die Variationen von Schädeltypen, bei angemessener Berücksichtigung des Klimas, dem entsprechen, was die DNA-Analysen ergeben haben. Wir alle sind Afrikaner. Unsere Verbreitung aus Afrika heraus in den letzten 60 000 Jahren hat alle genetischen Unterschiede von der Tafel gewischt, die sich in der halben Million Jahre zuvor herausgebildet hatten.
Damit entbehren rassistische Theorien, die die Vorherrschaft des Westens in der Biologie begründet sehen wollen, jeder faktischen Grundlage. Vielmehr gilt: Menschen sind, in großen Gruppen betrachtet, alle gleich, wo immer man sie findet. Wir alle haben von unseren afrikanischen Vorfahren den gleichen unruhigen, erfinderischen Geist geerbt. Biologie als solche kann nicht erklären, warum der Westen die Welt beherrscht.
Wenn die Rassentheorien falsch liegen, wo beginnen die Unterschiede zwischen Ost und West dann? Über 100 Jahre lang dachten viele Europäer, die Antwort liege auf der Hand: Sie brauchten keine Biologie, um an ihre kulturelle Überlegenheit und auch daran zu glauben, dass diese bestehe, seit es so etwas wie den modernen Menschen gibt. Den Beweis, der sie so sicher machte, glaubten sie seit 1879 zu haben. Charles Darwins Über die Entstehung der Arten, zwei Jahrzehnte zuvor erschienen, machte aus der Fossilienjagd ein respektables Hobby für adlige Landbesitzer, und wie so viele seiner Standesgenossen widmete sich auch Don Marcelino Sanz de Sautuola auf seinen nordspanischen Ländereien der Suche nach Höhlenmenschen. Eines Tages besuchte er, seine Tochter im Schlepptau, die Höhle von Altamira. Archäologie ist nicht das spannendste Spiel für Achtjährige, sodass die kleine Maria umhersprang, während der Vater die Augen fest auf den Boden heftete. Und plötzlich, so erzählte sie Jahre später in einem Interview, habe sie Gestalten und Figuren am Höhlendach gesehen. »Schau Papa, gemalte Stiere!«, habe sie gerufen.
Alle Archäologen träumen von einem solchen Augenblick, in dem man nicht glauben kann, was man sieht, in dem die Zeit stillsteht und angesichts einer atemberaubenden Entdeckung alles andere versinkt. Nur wenigen ist das vergönnt, und möglicherweise hat kein Archäologe je etwas Vergleichbares erlebt. Sautuola sah Bisons, Rotwild, Schicht um Schicht, vielfarbige Tiere, sechs Meter der Höhlendecke nahmen sie ein, manche zusammengerollt, manche im Sprung, andere fröhlich hüpfend (Abbildung 1.4). Jedes einzelne wundervoll und bewegend dargestellt. Picasso, der den Fundort Jahre später besichtigte, rief überwältigt: »Keiner von uns kann so malen. Nach Altamira ist alles andere Dekadenz!«
Sautuolas erste Reaktion sei spontanes Gelächter gewesen, rasch aber habe ihn die Begeisterung gepackt, so Maria später: »Er war so erregt, dass er gar nicht sprechen konnte.«12 Nach und nach überzeugte er sich davon, dass die Zeichnungen tatsächlich alt waren (nach jüngsten Untersuchungen sind einige davon über 25 000 Jahre alt). Damals aber, 1879, wusste das niemand. Als Sautuola den Fund auf dem Internationalen Kongress für Anthropologie und Vorgeschichtliche Archäologie vorstellte, lachte ihn die versammelte Fachwelt aus. Höhlenmenschen, das wusste schließlich jeder, konnten keine solchen Kunstwerke produzieren. Sautuola, da waren sich die Experten einig, konnte nur ein Lügner sein oder ein Narr. Sautuola nahm das persönlich, als Angriff auf seine Ehre; acht Jahre später starb er als gebrochener Mann.
Erst 1902 hat Sautuolas Hauptkritiker, der französische Prähistoriker Émile Cartailhac, Altamira besucht und anschließend öffentlich Abbitte geleistet. Und seither sind einige 100 Höhlen mit prähistorischen Malereien gefunden worden, vor ein paar Jahren erst, 1994, die Chauvet-Höhle im französischen Departement Ardèche, eine der spektakulärsten von allen. Sie ist so gut erhalten, dass man den |82|Eindruck hat, die Maler hätten die Höhle gerade mal für einen Happen Rentierfleisch verlassen und kämen jeden Augenblick zurück. Eine der Darstellungen in der Chauvet-Höhle ist 30 000 Jahre alt und damit eine der ältesten Hinterlassenschaften der anatomisch modernen Menschen in Europa.

Abbildung 1.4: »Nach Altamira ist alles andere Dekadenz …« Ein Ausschnitt aus der Decke der Stiere, 1879 von der achtjährigen Maria Sanz de Sautuola entdeckt. Die wissenschaftliche Anerkennung dieses Fundes hat ihr Vater nicht mehr erlebt.
Nirgendwo sonst auf der Welt wurde bislang etwas gefunden, das diesen Höhlenmalereien gleichkäme. Die Wanderung des modernen Menschen aus Afrika heraus hat alle von der Movius-Linie geschaffenen Unterscheidungen hinfällig gemacht, auch alle biologischen Unterschiede zwischen den älteren hominiden Spezies. Sollten wir also den Anfang einer besonderen (und überlegenen) westlichen Tradition in eine einzigartig kreative Kultur verlegen, die das nördliche Spanien und den Südwesten Frankreichs vor 30 000 Jahren mit prähistorischen Picassos füllte?
Die Antwort darauf findet man, vielleicht etwas erstaunlich, in den frostigen Weiten der Antarktis. Jedes Jahr fällt dort Schnee, bedeckt die Schichten der vorangegangenen Jahre und presst sie mit der Zeit zu dünnen Eisschichten zusammen. Diese bilden so etwas wie die Aufzeichnung des Wetters in vorgeschichtlicher Zeit. Klimaforscher können die einzelnen Schichten voneinander isolieren, ihre jeweilige Stärke messen und sagen, wie viel Schnee jeweils fiel; sie können das Verhältnis zwischen den Sauerstoffisotopen ermitteln und daraus auf die Temperaturen schließen; und sie können die Menge von Kohlenstoff und Methan miteinander |83|vergleichen, was Aufschluss gibt über Treibhauseffekte. Das Gewinnen der Eisbohrkerne in der Antarktis ist eine der härtesten Aufgaben der Wissenschaft. 2004 ist es einem europäischen Team gelungen, einen Hohlkernbohrer 3,2 Kilometer tief zu treiben und damit erstaunliche 740 000 Jahre in die Vergangenheit vorzudringen.
Was mit diesen Bohrungen zutage kam, ist eindeutig: Die Welt der Künstler von Altamira war kalt. Nachdem die modernen Menschen Afrika verlassen hatten, begannen die Temperaturen erneut zu fallen; und vor rund 20 000 Jahren – als mehr Künstler Ocker und Holzkohle auf Höhlenwänden verstrichen als jemals zuvor und danach – erreichte die letzte Eiszeit ihren frostigen Höhepunkt. Die Durchschnittstemperaturen lagen um zehn Grad Celsius unter denen unserer Tage, und das macht einen Riesenunterschied. Kilometerdicke Gletscher bedeckten Nordasien, Europa und Amerika, banden so viel Wasser, dass der Meeresspiegel über 90 Meter tiefer lag als heute. Über die Gletscher fegte der Wind, Staubstürme tobten über trockenen Steppen, kalt im Winter, ausgedörrt im Sommer. Selbst in den weniger abschreckenden Gegenden, bei 40 Grad nördlicher Breite, waren die Sommer kurz, es regnete nur selten, ein geringer Kohlendioxidanteil in der Luft bremste das Wachstum der Pflanzen und hielt die Populationen von Tieren (und Menschen) klein. Es war wie in den schlimmsten Tagen, bevor anatomisch moderne Menschen Afrika verließen.
Das Leben war dort, wo heute die Tropen sind, einfacher als in Sibirien, doch wo immer Archäologen sich umsehen, finden sie Hinweise darauf, dass sich die Gruppen den Bedingungen der Eiszeit in ziemlich ähnlicher Weise angepasst hatten. Die Gruppen waren klein; ein Dutzend Individuen waren schon eine große Horde; in milderen Regionen mochten etwa doppelt so viele zusammenleben. Sie lernten, wann die unterschiedlichen Pflanzen reif wurden und wo sie zu finden waren; wann und wo die Tiere den Jahreszeiten folgend umherzogen und wo sie ihnen auflauern konnten. Beiden folgten sie bei ihren Zügen durch die Landschaft. Wer diese Dinge nicht lernte, musste verhungern.
Derart kleine Gruppen hatten heftig um ihre Reproduktion zu kämpfen. Wie Jäger und Sammler in abgelegenen Regionen unserer Tage müssen auch diese Gruppen von Zeit zu Zeit zusammengekommen sein, um Heiratspartner und Güter auszutauschen, Geschichten zu erzählen und vielleicht auch mit ihren Göttern, Geistern und Ahnen zu kommunizieren. Solche Treffen werden aufregende Höhepunkte im Jahresverlauf gewesen sein. Natürlich können wir darüber nur spekulieren, doch viele Archäologen gehen davon aus, dass solche Feste den Hintergrund der spektakulären Höhlenmalereien in Westeuropa bilden: Alle kamen, herausgeputzt mit Perlen, den besten Tierhäuten und geschminkten Gesichtern; alle schmückten nach Kräften ihre heiligen Versammlungsorte, um sie ganz besonders herzurichten.
Doch liegt die Frage nahe, warum wir – wenn denn das Leben überall gleich hart war, in Afrika, in Asien und in Europa – die begeisternden Höhlenmalereien |84|nur in Westeuropa gefunden haben. Die traditionelle Antwort, dass die Europäer eben kulturell kreativer gewesen seien als die Menschen anderswo, erscheint nicht unbedingt als abwegig. Aber kehren wir die Frage doch einfach mal um. Die Geschichte der europäischen Kunst ist kein durchgehender Katalog von Meisterwerken, der von der Chauvet-Höhle bis zu Chagall reicht. Mit den Höhlenmalereien war es nach 11 500 v. u. Z. vorbei, und es sollten Jahrtausende vergehen, bevor wir von etwas auch nur annähernd Vergleichbarem sprechen können. Die Wurzeln der westlichen Vorherrschaft in einer Tradition von 30 000 Jahren europäischer Kreativität zu suchen, kann nur falsch sein, wenn diese Tradition für Jahrtausende unterbrochen war. Vielleicht sollten wir eher danach fragen, warum die Zeit der Höhlenmalerei endete, denn dann werden wir darauf stoßen, dass die erstaunlichen Funde aus dem vorgeschichtlichen Europa ebensoviel mit geographischen und klimatischen Bedingungen zu tun haben wie mit irgendeiner Besonderheit westlicher Kultur.
Während fast der gesamten Eiszeit waren Nordspanien und Südwestfrankreich ausgezeichnete Jagdgründe, weil sie regelmäßig von Rentierherden auf ihren Wanderungen zwischen Sommer- und Winterweiden durchquert wurden. Als jedoch die Temperaturen wieder zu steigen begannen, vor etwa 15 000 Jahren (mehr dazu in Kapitel 2), zogen die Rentiere im Winter nicht mehr so weit nach Süden, und die Jäger folgten ihnen in den Norden.
Es kann kein Zufall sein, dass die westeuropäische Höhlenmalerei genau um diese Zeit zum Erliegen kam. Immer weniger Künstler krochen mit ihren Tranlampen und Ockerstiften unter die Erde. Irgendwann um 13 500 v. u. Z. war der allerletzte Künstler fortgezogen. Er oder sie werden sich darüber keine Gedanken gemacht haben, doch mit diesem Tag endete eine uralte Tradition. In den Höhlen herrschte wieder Dunkelheit, und für einige Jahrtausende unterbrachen nur Fledermäuse und das Tropfen des Wassers ihre Grabesstille.
Warum aber zog die wunderbare Höhlenmalerei ab 11 500 v. u. Z., als die Jäger den abwandernden Rentieren folgten, nicht kontinuierlich mit nach Norden? Vermutlich aus dem einfachen Grund, weil in Nordeuropa keine passenden Höhlen für die Malerei zu finden waren. In Nordspanien und Südwestfrankreich gibt es eine enorme Zahl tiefer Kalksteinhöhlen; weiter nördlich deutlich weniger. Wenn die Jagdgründe der vorgeschichtlichen Völker keine tiefen Höhlen umfassten, dann blieben auch die Anstrengungen, ihre Versammlungsorte zu schmücken, nicht erhalten, und wir können sie nicht finden. Ohne Höhlen blieb den Menschen nichts anderes übrig, als sich auf ebener Erde zu versammeln. Und Spuren künstlerischer Betätigung, die 20 000 Jahre lang dem Wind, der Sonne und dem Regen ausgesetzt sind, können kaum je überdauern.
»Kaum je« ist allerdings nicht dasselbe wie »Fehlanzeige«, und so werden wir manchmal doch fündig. In der Apollo-11-Höhle in Namibia lösten sich Steinplatten mit Zeichnungen von Rhinozeros und Zebra von den Wänden, fielen zu Boden und blieben unter Ablagerungen erhalten, die zwischen 26 000 und 19 000 |85|Jahre als sind. Einige Funde in Australien sind noch älter. In Sandy Creek etwa können die mineralischen Ablagerungen, die sich über Teilen von Ritzzeichnungen an einer Höhlenwand bildeten, auf die Zeit vor 25 000 Jahren datiert werden, Fragmente von Farbpigmenten sind sogar zwischen 26 000 und 30 000 Jahre alt. Und in Carpenters Gap, einem Überhang, fanden sich abgefallene Steinplatten von einer bemalten Wand in den Überbleibseln einer 40 000 Jahre alten Siedlung, womit diese Malerei noch älter ist als die in der Chauvet-Höhle.
Keines der afrikanischen oder australischen Beispiele reicht ästhetisch an die besten Arbeiten aus Spanien oder Frankreich heran, und es gibt zudem etliche tiefe Höhlen außerhalb Westeuropas, die überhaupt keine Malereien aufweisen (zum Beispiel Zhoukoudian, das vor 20 000 Jahren wieder besiedelt wurde). Es wäre töricht zu behaupten, alle Menschen hätten sich der Höhlenkunst mit der gleichen Anstrengung gewidmet, von der Erwartung, alle künstlerischen Traditionen müssten gleich erfolgreich sein, ganz zu schweigen. Doch bedenkt man, dass die Bedingungen für die Erhaltung der Malerei in Europa besonders günstig waren, dass zudem Archäologen hier länger und intensiver gesucht haben als anderswo, dann kann man daraus, dass auf anderen Kontinenten überhaupt etwas erhalten blieb, zumindest schließen, dass anatomisch moderne Menschen überall den Drang verspürten, sich künstlerisch mitzuteilen. Wo die Voraussetzungen für Höhlenmalerei nicht so gut waren wie in Westeuropa, haben die Menschen ihre Energie in andere Ausdrucksformen gesteckt.
Abbildung 1.5 zeigt sehr schön, dass es gleichzeitig mit der in Westeuropa massiert auftretenden Höhlenkunst weiter im Osten vermehrt zu Nachbildungen von Menschen und Tieren in Stein, Ton und Knochen kam. Würde es die Ökonomie von Buchpublikationen erlauben, ich könnte Bilder von Dutzenden ganz außerordentlicher Figurinen zeigen, die zwischen Deutschland und Sibirien an vielen Stätten gefunden wurden. So aber muss ich mich auf den jüngsten dieser Funde beschränken, der 2008 im Hohle Fels, einer Karsthöhle der Schwäbischen Alb (Abbildung 1.6), geborgen wurde – eine 59,7 Millimeter hohe Statuette einer weiblichen Gestalt ohne Kopf, aber mit gewaltigen Brüsten, die vor 35 000 Jahren aus Mammutelfenbein geschnitzt wurde. Etwa um die gleiche Zeit haben sich Jäger aus Malaya Síya in der Nähe des Baikalsees in Sibirien – an gewiss einem der unwirtlichsten Orte der Erde – Zeit genommen, Bilder von Tieren auf Knochen zu ritzen. Und um 25 000 v. u. Z. schließlich haben sich in Dolní Věstonice, in der heutigen Tschechischen Republik, bis zu 120 Individuen zählende Gruppen in ihren Hütten aus Mammutknochen und Tierhäuten versammelt und dort aus Ton Tausende von Tierfigürchen und auch großbrüstige Frauengestalten geschaffen. In Ostasien bleiben die Verzeichnisse von Kunstwerken schmal. Der älteste Fund jedoch – die kleine Nachbildung eines Vogels, vor vielleicht 15 000 Jahren aus einer Geweihsprosse geschnitzt und 2009 in Xuchang entdeckt – ist so kunstvoll gearbeitet, dass wir sicher sein können, bei zukünftigen Grabungen auch in China eine blühende Tradition eiszeitlicher Kunst zu entdecken.

Abbildung 1.5: Die Anfänge westlicher Kultur? Die leeren Kreise zeigen Höhlenmalereien, die 12 000 Jahre und älter sind, die gefüllten Kreise Funde beweglicher Kunstwerke von gleichem Alter.
Eiszeitliche Menschen außerhalb Europas, denen die Bedingungen fehlten, die Altamira und Chauvet so unverwechselbar gemacht haben, fanden offensichtlich andere Ventile für ihre Kreativität. Es gibt ziemlich wenig Hinweise darauf, dass die Affenmenschen zuvor überhaupt einen kreativen Drang verspürt haben, Homo sapiens allerdings scheint die Kreativität einprogrammiert zu sein. Vor etwa 50 000 Jahren hatten die Menschen die mentalen Fähigkeiten, in der Welt nach Bedeutungen zu suchen, und auch die Geschicklichkeit erlangt, diese Bedeutungen in dinglichen Artefakten zum Ausdruck zu bringen, sicher auch in Dichtung, Musik und Tanz – was wir natürlich nie werden belegen können. Auch hier gilt, dass Menschen (in großen Gruppen betrachtet) weitgehend gleich zu sein scheinen, wo immer wir auf ihre Spuren stoßen. Bei all ihrer Pracht: Die Malerei von Altamira macht den Westen nicht zu etwas anderem als den Rest der Welt.
Technische, geistige und biologische Unterschiede, die, nachdem der erste Affenmensch Afrika verlassen hatte, über anderthalb Millionen Jahre akkumuliert wurden, teilten die Alte Welt in einen Westen mit Homo neanderthaliensis/Homo sapiens und einen Osten mit Homo erectus. Vor ungefähr 100 000 Jahren war der Westen charakterisiert durch relativ fortgeschrittene Techniken und sogar durch |87|modern anmutende Handlungsweisen, wie etliche Hinweise nahelegen, während der Osten zunehmend zurückgeblieben wirkt. Als dann jedoch, vor 70 000 Jahren, anatomisch moderne Menschen aus Afrika herauswanderten, spülten sie alle diese Unterschiede hinweg. Als die letzte Eiszeit vor 20 000 Jahren ihren Höhepunkt erreichte, waren »Osten« und »Westen« lediglich Himmelsrichtungen, in denen die Sonne auf- beziehungsweise unterging. Menschen, die mehr miteinander verband als trennte, lebten in kleinen Gruppen verstreut zwischen England und Sibirien – und erreichten (ziemlich) schnell auch den amerikanischen Kontinent. Jede dieser Gruppen suchte Nahrung und ging auf die Jagd, durchstreifte riesige Gebiete, folgte dem Rhythmus, in dem die Pflanzen reif wurden und die Tiere hin- und herzogen. Jede Gruppe wird ihr Territorium genau gekannt, wird über jeden Felsen und jeden auffälligen Baum Geschichten erzählt haben; jede wird ihre eigenen Artefakte, eigene Kunstfertigkeiten und Traditionen, ihre Werkzeuge und Waffen, ihre Geister und Dämonen gehabt haben. Und jede wird auch gewusst haben, dass ihre Götter sie liebten, schließlich waren sie trotz aller Widrigkeiten noch immer am Leben.

Abbildung 1.6: Schaffensdrang Die kopflose 59,7 mm hohe und 33,3 g schwere »Venus vom Hohle Fels« aus Mammutelfenbein. Mit einem Alter von mindestens 31 000, höchstens 35 000 Jahren ist sie die weltweit älteste gesicherte Darstellung eines Menschen.
Die Menschen waren so weit gekommen, wie es ihnen in einer derart kalten, regenarmen Welt möglich war. Doch dann schwankte die Erde unter ihren Füßen.