Der Abbildung 7.1 zufolge müsste das Jahr 541 eines der berühmtesten Daten der Geschichte sein. In diesem Jahr nämlich (oder, um dem Index eine gewisse Fehlermarge einzuräumen, irgendwann um die Mitte des 6. Jahrhunderts) übertraf der Osten mit seiner gesellschaftlichen Entwicklung zum ersten Mal den Westen: das Ende eines 14 000 Jahre alten Musters. Mit einem Schlag wurden alle einfachen Theorien langfristiger Determination der westlichen Vorherrschaft widerlegt. Um 700 lagen die Indexpunkte des Ostens bereits um ein Drittel höher als die des Westens, um 1100 war der Abstand um fast 40 Prozent größer als während der 2500 Jahre zuvor (als der Westen noch die Nase vorn hatte).
Warum konnte der Osten im 6. Jahrhundert am Westen vorbeiziehen? Warum erreichte seine gesellschaftliche Entwicklung für das nächste halbe Jahrtausend einen derart hohen Stand, warum fiel der Westen kontinuierlich zurück? Das sind zentrale Fragen, wenn man wissen will, warum der Westen heute die Welt regiert, und wenn wir in diesem Kapitel eine Antwort versuchen, werden wir vielen Helden und Schurken, Genies und Pfuschern begegnen. Hinter diesen Dramen allerdings werden wir dieselbe simple Tatsache entdecken, die während des gesamten Geschichtsverlaufs verantwortlich war für die Unterschiede zwischen Ost und West: die Geographie.
Schon vor 100 u. Z. begann der Indexwert gesellschaftlicher Entwicklung im Osten zu fallen, und bis 400 nahm die Talfahrt kein Ende. Als er seinen tiefsten Stand erreicht hatte, war dies zugleich der niedrigste seit 500 Jahren. Staaten waren zusammengebrochen, Städte niedergebrannt worden, Völkerwanderungen – aus Zentralasien nach Nordchina, von Nord- nach Südchina – hatten das gesamte Kerngebiet erschüttert. Doch eben diesen Wanderungen verdankte der Osten seine Wiederbelebung.
In den Kapiteln 4 bis 6 haben wir verfolgt, wie die zunehmende gesellschaftliche Entwicklung die geographischen Bedingungen veränderte, wie sich Vorteile der |326|Rückständigkeit nutzen ließen, wie neue Verkehrswege durch Meere und Steppen erschlossen wurden. Doch wir haben seit dem 3. Jahrhundert auch verfolgt, dass solche Einflüsse ebenso gut umgekehrt verlaufen konnten: Auch bei rückläufiger gesellschaftlicher Entwicklung konnten die geographischen Bedingungen eine neue Bedeutung erlangen. Indem römische und chinesische Städte zu schrumpfen begannen, das Bildungsniveau sank, die Armeen an Kampfkraft verloren und der Lebensstandard fiel, schrumpften die Kerngebiete auch geographisch. Dieser Prozess verlief in West und Ost unterschiedlich, und zum Teil erklärt sich schon daraus, warum die gesellschaftliche Entwicklung in China so schnell wieder aufwärts zeigte, während sie im Westen bis ins 8. Jahrhundert ständig sank.
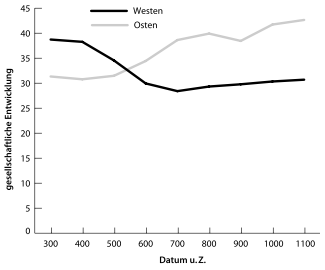
Abbildung 7.1: Die große Umkehrung
Der Osten kann seinen Niedergang stoppen und zum ersten Mal in der Geschichte den Westen überholen.
Wie wir in Kapitel 6 ebenfalls verfolgt haben, zerfiel das alte Zentrum des östlichen Kerngebiets, das Tal des Gelben Flusses, nach 300 u. Z. in die Streitenden Reiche, und Millionen Menschen flohen aus dem Norden in den Süden. Mit diesem Exodus wurde das Land südlich des Jangtse, das während der Han-Dynastie ein unterentwickeltes Randgebiet gewesen war, zum neuen Grenzgebiet. Die Flüchtlinge kamen in eine fremde feucht-heiße Gegend, in der ihre Hauptnahrungsmittel Weizen und Hirse schlecht gediehen, Reis dagegen gut. Das Land war dünn besiedelt, oft von Völkerschaften, deren Sitten und Sprachen völlig andere waren als die der nordchinesischen Einwanderer. In den gewaltsamen Auseinandersetzungen, zu denen es bei kolonialen Landnahmen unausweichlich kommt, konnten sich die Einwanderer aufgrund ihrer größeren Kopfstärke und ihrer strafferen Organisation durchsetzen und die autochthone Bevölkerung zurückdrängen.

Abbildung 7.2: Der Osten erholt sich, 400–700
Abbildung 7.2a zeigt die Staaten Westliches und Östliches Wei und die südchinesische Liang-Dynastie im Jahr 541. Alle drei wurden 589 von der Sui-Dynastie vereinigt. Abbildung 7.2b zeigt die größte Ausdehnung des Tang-Reiches um 700.
|328|Zwischen 280 und 464 verfünffachte sich die Zahl der erfassten Steuerzahler südlich des Jangtse, und mit den Wanderungen kamen nicht nur mehr Menschen in den Süden, sondern mit ihnen auch neue Techniken. Das landwirtschaftliche Handbuch Die wesentlichen Methoden der einfachen Leute, ein Kompendium aus dem 6. Jahrhundert, verzeichnet für die 530er Jahre nicht weniger als 37 Reissorten, und das Auspflanzen der in besonderen Beeten sechs Wochen lang vorgezogenen Setzlinge in die überfluteten Reisfelder war zur üblichen Praxis geworden – eine Knochenarbeit, die aber hohe Erträge brachte. In den Wesentlichen Methoden wird erklärt, dass es möglich ist, Felder durch Düngung Jahr für Jahr zu bearbeiten – sie mussten also nicht mehr brachliegen. Auch ist hier zu lesen, wie Wassermühlen – besonders solche in buddhistischen Klöstern, die oft an schnell fließenden Gebirgsbächen errichtet wurden und die über das Kapital für große Investitionen verfügten – das Mahlen von Korn und Reis, aber auch das Auspressen ölhaltiger Samen rentabler machen. Damit ergaben sich neue Möglichkeiten für die Landwirtschaft – denen ähnlich, über die die Römer verfügten, als sie im 1. Jahrhundert u. Z. Westeuropa eroberten. Schrittweise, im Verlauf von Jahrhunderten, münzte der Süden seine landwirtschaftliche Rückständigkeit in einen Vorsprung um.
Nicht nur die Herstellung, auch der Transport von Lebensmitteln wurde kostengünstiger. Chinas Flüsse konnten die Möglichkeiten, die das Mittelmeer dem Römischen Reich als Wasserstraße bot, nicht ersetzen, Schritt für Schritt jedoch sorgte menschlicher Erfindungsgeist für einen Ausgleich. Statistiken wie die für römische Schiffswracks haben Unterwasserarchäologen aus dem Osten bislang noch nicht vorgelegt; aus schriftlichen Dokumenten aber lässt sich schließen, dass die Schiffe nun größer und schneller wurden. Auf dem Jangtse kamen etwa ab 490 muskelbetriebene Schaufelradschiffe in Gebrauch. Von Chengdu bis Jiankang ernährte Reis die wachsenden Städte; städtische Märkte boten Anreize, Produkte anzubauen, die für den Verkauf bestimmt waren, zum Beispiel Tee (der in erhaltenen Dokumenten um 270 zum ersten Mal erwähnt wird und bis 500 zum weit verbreiteten Luxusgut wurde). Ob Großgrundbesitzer, Kaufleute oder Klöster, sie alle wurden reich – durch Pachteinnahmen, die Schifffahrt und den Mühlenbetrieb im Tal des Jangtse.
Nur die Einnahmen des Kaiserhofs in Jiankang stagnierten. In dieser Hinsicht glich die Lage in China weniger der des Römischen Reiches als der Assyriens im 8. Jahrhundert v. u. Z., als zwar Statthalter und Grundbesitzer von Bevölkerungswachstum und zunehmendem Warenverkehr profitierten, nicht aber der Staat – bis Tiglath-Pileser kam und neue Verhältnisse schuf. Einen Herrscher dieses Kalibers hatte Südchina nicht, nur Kaiser, denen es hin und wieder gelang, den Adel |329|zu zügeln und zu versuchen, den Norden zurückzuerobern. Allerdings endeten solche Unternehmungen stets in Bürgerkriegen. In den knappen 300 Jahren zwischen 317 und 589 waren es nacheinander fünf Dynastien, die die Herrscher in Jiankang stellten (so eine der Zählweisen).
Die Wesentlichen Methoden lassen vermuten, dass die fortgeschrittene Landwirtschaft im Norden bis in die 530er Jahre überlebte. Fernhandel und Münzprägung aber waren schon lange zuvor zurückgegangen, weil berittene Räuberbanden das Land plünderten. Zunächst führte das zu einem politischen Chaos, das die Verhältnisse im Süden noch übertraf, allmählich aber stellten neue Herrscher die Ordnung wieder her, vor allem die Xianbei, die aus den Rändern der mandschurischen Steppe einwanderten. Wie die Parther, die sechs Jahrhunderte zuvor den Iran überrannt hatten, verbanden sich auch bei den Xianbei, einer kampfstarken Reiterelite, die von Bauern Schutzgelder erhob, nomadische mit bäuerlichen Traditionen.
Auf den Trümmern Nordchinas errichteten sie in den 380er Jahren einen eigenen Staat: das Nördliche Wei.1* Statt die Chinesen auszurauben, arrangierten sie sich mit ihnen; zumindest zum Teil behielten sie auch die bezahlten Beamten und das Steuersystem der alten High-End-Staaten bei. Dadurch gewann das Nördliche Wei einen gewissen Vorsprung gegenüber den aufrührerischen Sippen, die in den anderen nordchinesischen Staaten regierten, und der wurde schließlich so groß, dass die Xianbei 439 die ganze Region vereinigen konnten.
Die Abkommen, die das Nördliche Wei mit den letzten Vertretern der alten chinesischen Aristokratie traf, waren allerdings brüchig. Die meisten Xianbei-Krieger zogen lieber mit ihren Herden umher, als sich mit hochnäsigen Literaten abzugeben; und als die Reiter dann sesshaft wurden, behagte ihnen auch der Kontakt mit den chinesischen Bauern nicht, und sie zogen sich lieber in ihre eigenen Burgen zurück. Ihre politische Organisation lief auf einen Low-End-Staat hinaus. Mehr brauchte es auch nicht, solange sie nur nördliche Räuberstaaten bekämpften. Doch als Reiterhorden der Xianbei 450 Jiankang erreichten, machten sie die Erfahrung, dass sie zwar Schlachten gewinnen und stehlen konnten, was nicht niet- und nagelfest war, für wirkliche Städte aber keine Gefahr darstellten. Dazu fehlten ihnen die Mittel, die sich nur ein wohlorganisierter High-End-Staat leisten konnte: Schiffe, Belagerungsmaschinen und Nachschubketten.
Ohne High-End-Armee konnten die Herrscher des Nördlichen Wei Südchina nicht plündern. Und weil sich Raubzüge in Nordchina, das sie ja zu ihrem Reich gemacht hatten, von selbst verboten, fehlten ihnen bald die Mittel, um die Loyalität ihrer Anhänger zu kaufen – in der Regel eine tödliche Schwäche für Low-End-Staaten. So sah Kaiser Xiaowen in den 480er Jahren bloß noch einen Ausweg: Er |330|musste seinen Staat besser organisieren. Und das tat er rigoros, verstaatlichte den Grundbesitz, übertrug die Anbauflächen nur an diejenigen zur Pacht, die sich als Steuerzahler und für den Staatsdienst registrieren ließen, und setzte, um die Xianbei dazu zu bringen, wie Untertanen eines High-End-Staates zu denken und zu handeln, einen Frontalangriff auf deren Traditionen in Gang. Xiaowen verordnete also eine neue Kleiderordnung, ersetzte die Familiennamen der Xianbei durch chinesische, zwang alle Höflinge unter 30 Jahren, chinesisch zu sprechen, und siedelte einige hunderttausend Menschen in einer neuen Stadt an der geheiligten Stätte von Luoyang an.
Die Xianbei gaben jedoch ihre angestammten Sitten und Gebräuche nur zum Teil auf, andere weigerten sich, ihr Herrschaftsgebaren dem chinesischer Adliger anzupassen. Kulturkämpfe brachen aus und eskalierten zu Bürgerkriegen. Im Jahr 534 schließlich zerfiel das Nördliche Wei in einen östlichen (sich modernisierenden) und einen westlichen (traditionalistischen) Staat. Die Traditionalisten, die am nomadischen Lebensstil festhalten wollten, konnten Reiterhorden aus der Steppe für ihre Sache einnehmen, und bald sah es so aus, als seien sie militärisch stark genug, um die von Xiaowen eingeleitete Revolution zu stoppen. Doch erneut erwies sich die Verzweiflung als Mutter der Erneuerung. Xiaowen hatte versucht, die Krieger der Xianbei in chinesische Herren zu verwandeln, seine Nachfolger versuchten es mit dem Gegenteil: Sie gewährten chinesischen Soldaten Steuervergünstigungen, machten Angehörige der chinesischen Oberschicht zu Kommandeuren und gestatteten chinesischen Kriegern, Namen der Xianbei anzunehmen. Bauern und Intelligenz lernten zu kämpfen, und 577 überwältigten sie die Opposition. Es war ein langer verfahrener Prozess, zuletzt aber triumphierte Xiaowens Vision.
Das Resultat war ein stark polarisiertes China. Im Norden saß ein High-End-Staat (in dem sich die Sui-Dynastie mit einem Militärputsch 581 die Macht sicherte) mit einer gewaltigen Armee auf einer in die Brüche gegangenen Wirtschaft; im Süden dagegen versuchte ein in die Brüche gegangener Staat mit schwachen Institutionen mehr oder weniger vergeblich, vom wirtschaftlichen Aufschwung zu profitieren.
Das klingt, als könne es nur in eine Sackgasse führen, tatsächlich aber zündete diese Situation einen Neustart gesellschaftlicher Entwicklung. Im Jahr 589 ließ Wendi, der erste Kaiser der Sui, eine Flotte bauen, vereinnahmte das Jangtse-Tal und warf eine riesige Armee (vielleicht eine halbe Million Soldaten) gegen Jiankang. Aufgrund des enormen militärischen Ungleichgewichts fiel die Stadt innerhalb einiger Wochen. Als den Adligen Südchinas klar wurde, dass Wendi vorhatte, ihnen Steuern abzunehmen, organisierten sie einen Volksaufstand – sie sollen den Sui-Gouverneuren die Bäuche aufgeschlitzt, sie sogar verspeist haben –, noch im selben Jahr aber erlitten sie eine Niederlage. Ohne zermürbend lange Kriege hatte Wendi Südchina erobert. Und der Osten konnte wieder aufblühen.
Indem sie daran ging, wieder ein einziges großes Reich zu schaffen, bewirkte die Sui-Dynastie zweierlei. Erstens konnte der erstarkte Staat in Nordchina vom neuen wirtschaftlichen Grenzgebiet im Süden zehren, und zweitens konnte der wirtschaftliche Aufschwung im Süden ganz China erfassen.
Dahinter stand nicht unbedingt ein absichtsvoller Plan. Als die Sui-Kaiser das größte Bauwerk ihres Zeitalters errichten ließen, den rund 2400 Kilometer langen und 40 Meter breiten Kaiserkanal, der den Jangtse mit Nordchina verband, ging es ihnen vor allem um einen raschen Verbindungsweg für ihre Truppentransporte. Im Verlauf nur einer Generation jedoch wurde der Kanal zu Chinas wirtschaftlicher Hauptschlagader, auf der Reis aus dem Süden in den Norden verschifft wurde. »Als sie das Taihang-Gebirge durchschnitten«, klagten Gelehrte aus dem 7. Jahrhundert, »fügten die Sui den Menschen unerträgliches Leid zu.« Sie mussten aber zugleich einräumen, dass der Kanal auch »unendliche Vorteile« gebracht habe: »Sein Nutzen für die Menschen ist wahrlich ungeheuer!«1
Der Kaiserkanal fungierte wie ein von Menschen gemachtes Mittelmeer. Er veränderte die geographischen Bedingungen des Ostens, indem China endlich eine Wasserstraße des Kalibers hatte, wie sie auch dem alten Rom zugute gekommen war. Nun konnte die sich stark vermehrende Bevölkerung in den Städten des Nordens mit billigem Reis aus dem Süden versorgt werden. »Hunderte von Häusern, Tausende von Häusern – wie ein großes Schachbrett«, schrieb der Dichter Bai Juyi über Chang’an, das noch einmal zu Chinas Hauptstadt wurde. Die Stadt nahm eine Fläche von 80 Quadratkilometern ein, »wie ein großes Feld, das mit Reihen von Kohlköpfen bepflanzt ist«2. Eine Million Einwohner drängten sich auf Boulevards, die von Bäumen gesäumt und bis fünfmal breiter waren als New Yorks Fifth Avenue. Und Chang’an war kein Einzelfall. Luoyang war wahrscheinlich halb so groß, ein Dutzend anderer Städte zählte über 100 000 Einwohner.
Chinas Erholung hatte jedoch etwas von einem Drahtseilakt, denn die Verschmelzung der Staatsmacht des Nordens mit den Grenzgebieten des Südens, wo der begehrte Reis angebaut wurde, war eine durchaus zweischneidige Angelegenheit. Einerseits organisierte und überwachte eine aufblühende Verwaltung die städtischen Märkte, die den Bauern und Kaufleuten gute Verdienstmöglichkeiten boten, was wiederum die gesellschaftliche Entwicklung vorantrieb. Andererseits stand diese Verwaltung mit ihrer exzessiven Bürokratie der Entwicklung im Weg, weil sie dem Handel mit kleinlichen Verordnungen und Vorschriften Fesseln anlegte. Die Beamten setzten die Preise, Termine für Käufe und Verkäufe, sogar den Lebensstil der Kaufleute fest (zum Beispiel durften sie nicht reiten, das sei für Händler zu würdevoll).
Immer wieder stellten die Beamten politische über wirtschaftliche Erwägungen. Statt den Kauf und Verkauf von Land zu fördern, hielten sie fest an Xiaowens Reformen, denen zufolge aller Boden Staatsbesitz war und Bauern nur Pächter |332|sein konnten. Damit waren die Bauern gezwungen, sich in den Steuerlisten registrieren zu lassen. Für die Bürokratie fiel jede Menge Papierkram1* an. Aus Dokumenten, die unter den besonders trockenen Bedingungen von Dunhuang am Rande der Wüste Gobi erhalten blieben, geht hervor, dass sich die Verwalter des 8. Jahrhunderts ziemlich penibel an die Regularien hielten.
Die Beamtenschaft, die Berge von Unterlagen zu bewältigen hatte, schwoll stetig an und durchlief ihrerseits eine Revolution. Seit den Zeiten der Han gab es die Aufnahmeprüfungen, die aus der Verwaltung ein Reservat für Chinas beste und klügste Köpfe machen sollten. In der Praxis aber gelang es den Adelsfamilien immer wieder, die Besetzung eines hohen Amtes zum Vorrecht der Geburt zu machen. Erst jetzt, im 7. Jahrhundert, wurden die Ergebnisse der Aufnahmeprüfungen zum tatsächlich einzigen Erfolgskriterium. Wenn wir davon ausgehen, dass das Schreiben von Gedichten und das Zitieren aus der klassischen Literatur tatsächlich administrative Talente erkennen lassen, kann man von China wohl mit Fug und Recht sagen, es habe den rationalsten Auswahlmodus für den öffentlichen Dienst entwickelt, den die Geschichte kennt.2*
Als sich der Zugriff der alten Aristokratie auf die hohen Staatsämter langsam lockerte, wurde ein Posten in der Verwaltung zum sichersten Weg, zu Reichtum und Einfluss zu gelangen, und die Konkurrenz um Ämter verschärfte sich. In manchen Jahren bestand weniger als einer unter hundert Kandidaten die Prüfungen, und jede Menge Geschichten, tragische wie komische, berichten von Männern, die jahrzehntelang immer wieder neu zur Prüfung antraten. Ehrgeizige Familien stellten Tutoren ein, so wie manche es noch heute tun, um ihre Kinder durch die Aufnahmenprüfungen zu bringen, mit denen Elite-Universitäten ihre Bewerber aussieben; und mit dem möglicherweise bereits um 581 erfundenen Holztafeldruck konnte man Tausende von Büchern mit Übungsfragen unter die Leute bringen. Manche Kandidaten trugen »Betrügerhemden« mit vorbildlichen, auf den Futterstoff geschriebenen Aufsätzen. Weil die literarische Gestaltung großen Einfluss auf die Noten hatte, beeilten sich alle jungen Männer, Dichter zu werden, und da nun so viele gute Köpfe Verse produzierten, wurde dies zum goldenen Zeitalter der chinesischen Literatur.
Die Prüfungen bewirkten eine beispiellose soziale Mobilität innerhalb der gebildeten Elite – eine neue Offenheit, die auch die Geschlechterbeziehungen umfasste. Manche Historiker sprechen in diesem Zusammenhang sogar von einem neuen »Protofeminismus«, aber man sollte diesen Trend doch besser nicht überschätzen. |333|Der Rat, den die Großväterlichen Unterweisungen für die Familie – eines der am weitesten verbreiteten Bücher des 8. Jahrhunderts – für die Frauen bereithielt, hätte auch tausend Jahre früher niemanden aufgeregt:
Eine Braut dient ihrem Mann,
wie sie ihrem Vater gedient hat.
Ihre Stimme soll nicht zu hören sein,
noch ihr Körper oder Schatten zu sehen.
Mit dem Vater und den älteren Brüdern ihres Gatten
spricht sie nicht.3
Auf der anderen Seite verschafften neue Mitgiftvorschriften und die (im Vergleich zu konfuzianischen Auffassungen) liberalen Einstellungen der Buddhisten zu weiblichen Fähigkeiten vermögenden Frauen einen gewissen Spielraum, um sich über Großvaters Anweisungen hinwegzusetzen. So etwa Wu Zetian, die nach einer Zeit als buddhistische Nonne (im Alter von 13 Jahren) einen anderen Dienst aufnahm, nämlich als Konkubine im Harem des Kaisers, bis sie durch Heirat zur Nebenfrau von dessen Sohn wurde. Sie konnte ihren nicht sehr hellen, leichtlebigen Mann mühelos in die Tasche stecken und regierte »hinter dem Bambusvorhang«, wie eine Redeweise lautete. Als ihr Mann 683 passenderweise starb, soll sie den legitimen Thronerben vergiftet haben, später auch zwei ihrer eigenen Söhne (einen nach sechs Wochen, den anderen nach sechs Jahren). 690 zog sie den Bambusvorhang auf und wurde mit dem Regentennamen Wu Zhao zur ersten Frau, die jemals offiziell auf dem chinesischen Thron saß.
In mancher Hinsicht war Wu Zhao Protofeministin. Sie beauftragte eine Gruppe von Gelehrten mit einer Sammlung von Lebensläufen berühmter Frauen und stieß Konservative vor den Kopf, indem sie eine Prozession von Frauen zum Berg Tai anführte und dort Chinas heiligstes Ritual, das Opfer an den Himmel, zelebrierte. Aber ihre Schwesterlichkeit hatte auch Grenzen. Während Wu sich noch an die Spitze vorarbeitete, wurde ihr die Hauptfrau ihres Mannes bedrohlich, darum erstickte sie (so zumindest wird behauptet) ihren eigenen Säugling, schob diesen Mord ihrer Rivalin die Schuhe und bestrafte sie, indem sie ihr Arme und Beine abschneiden und den verstümmelten Körper in ein Fass Wein stecken ließ.
Nicht weniger widersprüchlich als Wus Protofeminismus war ihr Buddhismus. Bei aller Frömmigkeit instrumentalisierte sie die Religion doch schamlos für politische Zwecke. So »entdeckte« ihr Liebhaber – ein Mönch – 685 Schriftrollen, in denen der Aufstieg einer Frau zur universalen Herrscherin vorausgesagt wurde: Wu zierte sich ein bißchen, nahm dann aber den Titel Maitreya (Zukünftige Buddha) an. Und der Legende zufolge ist das Gesicht der schönen Maitreya-Buddha-Statue in Longmen, Provinz Guangdong, Wus Zügen nachempfunden (Abbildung 7.3).
Nicht weniger kompliziert war Wus Verhältnis zur Beamtenschaft. Sie hielt daran fest, die Aufnahmeprüfungen über familiäre Beziehungen zu setzen, doch |334|die konfuzianischen Herren Gelehrten, die eben davon profitierten, hassten ihre Herrscherin leidenschaftlich – ein Gefühl, das auf Gegenseitigkeit beruhte. Wu drangsalierte die Gelehrten mit diversen Säuberungsaktionen; die wiederum rächten sich, indem sie ihre Herrscherin in der offiziellen Geschichtsschreibung zum Inbegriff all dessen machten, was schief geht, wenn eine Frau an der Spitze steht.

Abbildung 7.3: Das Gesicht der Wu Zhao?
Zumindest der Legende nach ist das Gesicht dieser monumentalen Statue der Zukünftigen Buddha, um 700 in Longmen erschaffen, dem der einzigen Frau nachgebildet, die China jemals im eigenen Namen regiert hat.
Ganz verschweigen jedoch konnten die Historiker den Glanz ihrer Regierung nicht. Immerhin gebot sie über eine Armee von einer Million Männern, hatte Macht und Mittel, sie tief in die Steppe vorstoßen zu lassen. Ähnlich wie bei den Römern und anders als bei den Han hob ihre Armee Soldaten vor allem im Innern des Reiches aus, ihre Offiziere entstammten der Oberschicht. Mit ausgetüftelten Vorsichtsmaßnahmen sicherte sie sich die Loyalität ihrer Befehlshaber, und so konnte die Armee Gegner im Innern durchaus einschüchtern. Ein Offizier, der ohne Genehmigung auch nur zehn Mann in Marsch setzte, musste mit einem |335|Jahr Haft rechnen, und wer auf eigene Faust ein Regiment mobilisierte, lief Gefahr, erdrosselt zu werden. Gestützt auf diese Armee dehnte das Chinesische Reich seine Herrschaft nach Nordosten, nach Südosten und bis hinein nach Zentralasien weiter aus als je zuvor; sogar in Nordindien intervenierte es 648.
Unter Wus Regierung reichte Chinas »sanfte« Macht sogar noch weiter. Vom 2. bis zum 5. Jahrhundert war Indien ein kulturelles Gravitationszentrum gewesen, das China in den Schatten stellte. Seine Missionare und Kaufleute verbreiteten den Buddhismus in alle Himmelsrichtungen, und umgekehrt übernahmen die Eliten sich neu formierender Staaten in Südostasien Kleidung, Schriften und die Religion Indiens. Vom 7. Jahrhundert an aber machte sich Chinas Einfluss zunehmend bemerkbar. In Südostasien entwickelte sich eine besondere indochinesische Kultur, chinesische Schulen des Buddhismus wirkten auf das buddhistische Denken in Indien zurück, und die herrschenden Schichten in den Staaten, die in Korea und Japan entstanden, lernten den Buddhismus ausschließlich über China kennen. Sie übernahmen chinesische Kleidung, Stadtplanung, Gesetze und Schriftzeichen und stützten ihre Macht mit der Behauptung, von den chinesischen Herrschern nicht nur anerkannt zu werden, sondern von ihnen abzustammen.
Die Anziehungskraft der chinesischen Kultur beruhte zum Teil auf ihrer Offenheit für fremde Ideen und der Fähigkeit, diese zu integrieren und daraus neue Funken zu schlagen. Viele der mächtigsten Männer in Wus Welt konnten ihre Vorfahren bis zu den Steppennomaden zurückverfolgen, die nach China eingefallen waren, und sie pflegten ihre Bindungen an den Steppenschnellweg, der Ost und West miteinander verband. Tänzer und Lautenspieler aus Zentralasien waren der letzte Schrei in Chang’an; modebewusste Frauen trugen persische Kleidung mit eng geschnürten Miedern, Plisseeröcken und meterlangen Schleiern; und wahre Trendsetter protzten mit ostafrikanischen »Teufelssklaven« als Türstehern. »Wenn sie nicht sterben«, bemerkte ein Eigentümer solcher Sklaven kalt, »kann man sie behalten, und irgendwann beginnen sie, die menschliche Sprache zu verstehen, obwohl sie diese selbst nicht sprechen können.«4
Der Nachwuchs in Chinas mächtigen Familien brach sich die Knochen beim Polo, dem bei Nomaden so beliebten Spiel; jedermann lernte, nach zentralasiatischer Sitte auf Stühlen statt auf Matten zu sitzen, und elegante Damen vertrieben sich die Zeit in Heiligtümern exotischer Religionen wie dem Zoroastrismus oder dem Christentum – Kaufleute aus Zentralasien, Persien, Indien oder Arabien, die scharenweise in chinesischen Städten auftauchten, hatten diese fremden Glaubensrichtungen nach Osten mitgebracht. Wie eine 2007 durchgeführte DNA-Studie ergeben hat, war ein gewisser Yu Hong, der 592 im nordchinesischen Taiyuan beigesetzt wurde, Europäer (unklar bleibt allerdings, ob er die ganze Strecke vom westlichen bis zum östlichen Ende der Steppe selbst zurückgelegt hat oder ob seine Vorfahren sie langsam, Strecke für Strecke, überwunden haben).
Wus Welt war das Produkt von Chinas Vereinigung im Jahr 589, die im Süden einen mächtigen Staat entstehen ließ und ihm riesige Räume wirtschaftlicher |336|Entwicklung eröffnete. Das erklärt, warum die gesellschaftliche Entwicklung im Osten sich so rasch beschleunigte; ist aber nur die halbe Erklärung dafür, warum sich die Entwicklungslinien von Ost und West um 541 kreuzten. Um das zu verstehen, müssen wir auch die Gründe kennen, aus denen die gesellschaftliche Entwicklung im Westen weiterhin fiel.
Auf den ersten Blick schien eine Erholung des Westens im 6. Jahrhundert mindestens so wahrscheinlich zu sein wie die im Osten. In beiden Kerngebieten war ein altes Riesenreich zusammengebrochen und ein kleineres Reich übrig geblieben, das die legitime Herrschaft über die ganze Region beanspruchte. Daneben gab es eine Menge »barbarischer« Reiche, die diesen Anspruch ignorierten (Abbildung 7.4). Nach den Katastrophen des 5. Jahrhunderts hatte Byzanz seine Grenzen gesichert und erfreute sich relativer Ruhe. So standen die Zeichen gut, als 527 ein neuer Kaiser namens Justinian den Thron bestieg.
Historiker bezeichnen Justinian I. oft als den letzten Römer. Er regierte mit ungeheurer Energie, brachte die Verwaltung auf Vordermann, hob die Steuern an und baute Konstantinopel um (der Bau der wundervollen Kirche Hagia Sophia fällt in seine Regierungszeit). Er arbeitete wie ein Teufel, und manche Kritiker behaupteten, er sei auch ein Teufel gewesen – so etwas wie ein Vampir aus Hollywood, der weder aß noch trank, noch schlief, zugleich aber gewaltigen sexuellen Appetit hatte.
Die eigentlich treibende Kraft hinter Justinian muss, so man dem Klatsch trauen kann, dessen Frau Theodora I. gewesen sein (Abbildung 7.5), die eine noch schlechtere Presse bekam als Wu Zhao. Sie war, bevor Justinian sie heiratete, Schauspielerin gewesen (im Altertum oft ein Euphemismus für Prostituierte). Ihr sexueller Appetit soll den ihres Mannes noch übertroffen haben. Gerüchten zufolge schlief sie bei einem nächtlichen Gelage mit allen Gästen, nahm sich, als diese erschöpft gewesen seien, auch noch ihre 30 Bediensteten vor und beklagte dabei, dass Gott ihr nur drei Körperöffnungen gegeben habe. Ob wir das nun glauben wollen oder nicht: Kaiserin jedenfalls war sie mit Leib und Seele. 532 etwa, als Adlige aus Protest gegen Justinians Steuerpolitik randalierende Stadionbesucher gegen ihn aufwiegeln wollten, war es Theodora, die den Kaiser von der Flucht abhielt.5 Justinian riss sich zusammen, setzte die Armee ein und schaute nicht zurück.
Im nächsten Jahr entsandte Justinian seinen Feldherrn Belisar, um Nordafrika den Vandalen zu entreißen. 65 Jahre zuvor hatten Brandschiffe die Hoffnungen der Byzantiner, Karthago wieder in ihre Gewalt zu bringen, in Rauch aufgehen lassen, diesmal erwischte es die Vandalen. Belisar befreite Nordafrika und setzte anschließend nach Sizilien über, wo als Nächstes die Armeen der Goten untergingen. Das Weihnachtsfest 536 konnte Justinians Feldherr in Rom feiern. So lief |337|eigentlich alles wie am Schnürchen. Doch als Justinian 565 starb, war die Rückeroberung zum Stillstand gekommen, das Reich bankrott und die gesellschaftliche Entwicklung des Westens hinter die des Ostens zurückgefallen. Was war schief gegangen?

Abbildung 7.4: Die Letzten ihrer Art?
Zunächst versuchte der oströmische Kaiser Justinian I. von 533–565, dann der persische Großkönig Chosrau II. von 602–627, das westliche Kerngebiet wieder zu vereinigen. Der byzantinische Kaiser Herakleios setzte sich von 624–628 gegen Persien zur Wehr.
Belisars Sekretär Prokopios, von dem eine Historia arcana (Geheimgeschichte) genannte Schmähschrift stammt, schob die Schuld den Frauen zu, lieferte also eine verschwurbelte Verschwörungstheorie, die die konfuzianischen Beamten der Kaiserin Wu Zhao nicht besser hätten schreiben können. Belisars Frau Antonina, so Prokopios, sei Kaiserin Theodoras beste Freundin und ihre Partnerin bei deren hemmungslosem sexuellen Treiben gewesen. Um Justinian von dem nur allzu wahren Klatsch über Antonina (und sie selbst) abzulenken, habe Theodora deren Mann Belisar bei Justinian angeschwärzt. Überzeugt, dieser plane einen Anschlag, rief ihn Justinian zurück – mit der Folge, dass die ohne ihren Feldherrn kopflose byzantinische Armee geschlagen wurde. Justinian habe daraufhin Belisar flugs zu seinem Heer zurückbeordert, damit dieser rette, was zu retten war; sei dann aber erneut seinem Verfolgungswahn erlegen. Und dieses dumme Spiel habe sich noch einige Male wiederholt.

Abbildung 7.5: Schlechter (oder besser, je nach Blickwinkel) als Wu Zhao?
Kaiserin Theodora, nach einem 547 in Ravenna entstandenen Mosaik.
Über den Wahrheitsgehalt von Prokopios’ geheimer Geschichte wollen wir nicht weiter rechten; es wäre auch unergiebig. Die entscheidende Erklärung für das Scheitern der Wiedereroberung liegt eher darin, dass bei allen Ähnlichkeiten des östlichen und westlichen Kerngebiets im 6. Jahrhundert die Unterschiede zwischen beiden überwogen. Strategisch gesehen war Justinians Position der von Wendi, dem ersten Sui-Kaiser, geradezu entgegengesetzt. 577, als dieser sich anschickte, China zu vereinigen, bildeten die nördlichen »barbarischen« Reiche eine einzige Einheit, die Wendi dazu nutzten konnte, den materiell reichen, militärisch aber schwachen Süden zu überwältigen. Justinian dagegen versuchte, eine Vielzahl meist armer, aber starker »barbarischer« Staaten aus dem reichen Byzantinischen Reich heraus zu erobern. Das, was Wendi 589 gelungen war, nämlich das Kerngebiet in einem einzigen Feldzug wieder zu vereinigen, konnte Justinian nur misslingen.
Denn der byzantinische Kaiser musste auch die Perser in Schranken halten. Ein Jahrhundert lang hatten die Hunnenkriege, Steuerkonflikte und religiöse Aufstände Persiens militärische Möglichkeiten begrenzt. Nun aber, wo es so aussah, |339|als könnte das Römische Reich wieder auferstehen, war Persien in einer besseren Position. 540 durchbrach eine persische Armee die schwachen byzantinischen Verteidigungslinien und plünderte Syrien, weshalb Justinian nun an zwei Fronten zu kämpfen hatte. (Dass es so weit kommen konnte, lag gewiss nicht an Antoninas Intrigen, eher schon daran, dass Belisar aus Italien zurückgerufen wurde.)
Und damit nicht genug. 541 traf aus Ägypten die unerfreuliche Kunde von einer neuen Krankheit ein. Die Kranken fühlten sich fiebrig, Leisten und Achselhöhlen schwollen an. Innerhalb eines Tages verfärbten sich die Schwellungen schwarz, und die Opfer fielen ins Koma oder Delirium. Nach ein, zwei weiteren Tagen starben die meisten von ihnen unter entsetzlichen Schmerzen. Es war die Beulenpest. Ein Jahr später erreichte sie Konstantinopel, wo sie wahrscheinlich 100 000 Menschen hinraffte. Die Todesgefahr war nach Ansicht des Bischofs Johann von Ephesus so groß, dass »niemand aus dem Haus gehen soll, ohne einen Anhänger mit seinem Namen darauf um den Hals zu tragen«6.
Der Bazillus der Beulenpest entwickelte sich vermutlich lange vor 541 im Gebiet der großen afrikanischen Seen und wurde im äthiopischen Hochland bei Flöhen heimisch, deren Wirtstiere Hausratten waren. Kaufleute dürften bei ihren Fahrten übers Rote Meer mit der Zeit immer mehr äthiopische Ratten nach Ägypten eingeschleppt haben. Doch sind Flöhe, die den Bazillus tragen, nur bei Temperaturen zwischen 17° und 30° Celsius wirklich aktiv, sodass die ägyptische Hitze eine epidemiologische Schranke bildete – zumindest bis in die späten 530er Jahre.
Was dann geschah, ist umstritten. Wie Baumringe zeigen, herrschte mehrere Jahre lang eine ungewöhnliche Kälte. Sowohl byzantinische als auch angelsächsische Himmelsbeobachter verzeichneten zudem einen großen Kometen. Manche Historiker neigen zu der Auffassung, dass dessen Schweif einen Staubschleier bildete, der mit den daraufhin sinkenden Temperaturen die Seuche auf die Menschen losließ. Andere halten Vulkanasche für die Ursache des Temperatursturzes. Eine dritte Fraktion glaubt weder das eine noch das andere.
Bedenkt man all das, werden es weder Kometen noch falsche Strategien allein und auch nicht die lockere Moral am Hof gewesen sein, welche die gesellschaftliche Entwicklung des Westens im 6. Jahrhundert zurückfallen ließen. Der fundamentale Unterschied zwischen Ost und West, der darüber entschied, wie die Erschütterungen durch Kriege und Seuchen die Entwicklung beeinflussten, war geographischer Natur und hatte mit den genannten Störungen nichts zu tun. Die Wirtschaft unter Justinian lief wie geschmiert: Ägyptische und syrische Bauern waren produktiver denn je, Kaufleute brachten noch immer Getreide und Olivenöl nach Konstantinopel. Mit dem Aufschwung aber, der von den Reisfeldern im chinesischen Süden ausging, war keine der westlichen Entwicklungen vergleichbar. Als Wendi den Süden eroberte, befehligte er mindestens 200 000 Soldaten, Justinian dagegen konnte 551 – auf dem Höhepunkt seines Krieges in Italien – nicht mehr als 20 000 aufbieten. Wendi brachte mit seinen siegreichen Feldzügen den großen Reichtum Südchinas in seine Gewalt, Justinian hingegen |340|gewann bloß ärmere, häufig von Kriegen verwüstete Länder hinzu. Ein wiedervereinigtes Römisches Imperium hätte das Mittelmeer im Verlauf mehrerer Generationen vielleicht in ein riesiges Netz bedeutender Handelsstraßen zurückverwandelt, hätte neue wirtschaftliche Grenzen erschlossen und den Trend gesellschaftlicher Entwicklung umgekehrt, doch ein solcher Überschuss an Zeit stand Justinian nicht zur Verfügung.
Es war die Geographie, die Justinians heroisch-großspurige Wiedereroberung zum Scheitern verurteilte, bevor sie recht begonnen hatte; und so, wie er es anstellte, machte er dieses Scheitern nur noch schlimmer. Seine Soldaten verwandelten Italien in Brachland, die Händler und Kaufleute, die die Truppen mit Lebensmitteln versorgten, verteilten Ratten, Flöhe und den Tod rund ums Mittelmeer.1* Nach 546 ebbte die Seuche ab, doch der Bazillus hatte sich eingenistet, und bis etwa 750 verging kein Jahr, ohne dass irgendwo eine Epidemie ausbrach. Die Bevölkerung schrumpfte um ein Drittel. Wie 400 Jahre zuvor, als der Alte-Welt-Austausch Seuchen auslöste, gab es auch diesmal Gruppen, die vom Massensterben profitierten: Weil es immer weniger Arbeitskräfte gab, stiegen die Löhne – zum Vorteil der Überlebenden. Damit brachen härtere Zeiten für die Reichen an. (In einer bemerkenswert unchristlichen Bemerkung klagte Bischof Johannes von Ephesos, all diese Toten hätten die Kosten für den Wäschedienst in die schwindelnde Höhe getrieben.) Justinian reagierte mit einem Dekret, in dem die Löhne auf das Niveau der Zeit vor der Seuche festgeschrieben wurden. Helfen konnte das nicht. Denn das Land lag brach, die Städte schrumpften, das Steueraufkommen sank, die Institutionen brachen zusammen. Bald erging es jedermann schlechter.
Innerhalb von zwei weiteren Generationen brach Byzanz zusammen. Bereits im 5. Jahrhundert waren Britannien und große Teile Galliens aus dem westlichen Kerngebiet ausgeschieden. Das vom Krieg zerrissene Italien und Teile Spaniens folgten im 6. Jahrhundert. Schließlich erreichte die Zusammenbruchswelle, die langsam von Nordwesten nach Südosten rollte, auch das byzantinische Kernland. Die Bevölkerung Konstantinopels sank um drei Viertel, Landwirtschaft, Handel und Einkommen brachen ein, und das Ende schien nahe. Nur einer träumte um 600 noch davon, das westliche Kerngebiet wiederherzustellen: König Chosrau II. von Persien.
Schließlich war Rom tatsächlich nicht das einzige westliche Reich, das hätte wiedererstehen können. Hatte nicht Persien, als Rom um 500 v. u. Z. noch klein und unbedeutend war, den größten Teil des westlichen Kerngebiets vereinigt? Jetzt, da Byzanz in die Knie gegangen war, schien seine Zeit wieder gekommen. 609 durchbrach Chosrau die zerfallenden Grenzbefestigungen, und die byzantinische |341|Armee schmolz dahin. 614 eroberte er Jerusalem und mit ihm die heiligsten Reliquien der Christenheit: Bruchstücke des Wahren Kreuzes, an dem Jesus gekreuzigt worden war, die Heilige Lanze, die seine Seite durchstochen, und den Heiligen Schwamm, der ihn erfrischt hatte. In weiteren fünf Jahren konnte Chosrau Ägypten seinem Reich einverleiben, 626 dann – 99 Jahre, nachdem Justinian den Thron bestiegen hatte – sahen die persischen Armeen über den Bosporus hinweg Konstantinopel vor sich. Und die Awaren, Nomaden aus der westlichen Steppe, die Chosrau zu Verbündeten gemacht hatte, waren durch den Balkan gefegt und standen hinterrücks zum Angriff bereit.
Doch Chosraus Träume platzten noch schneller als die Justinians. Er wurde 628 weggeputscht und bald darauf ermordet. Prompt ging sein Reich in die Brüche. Ohne sich von den Armeen unter den Stadtmauern Konstantinopels beeindrucken zu lassen, hatte sich der byzantinische Kaiser Herakleios Gold und Silber von der Kirche »geliehen«, war zum Kaukasus gefahren und hatte dort unter den Turkvölkern2* der Steppe eine eigene nomadische Reiterei angeworben. Reiter, so sein Kalkül, waren kriegsentscheidend, und da Byzanz kaum noch welche hatte, wollte er welche mieten. Seine Turk-Reiterei schlug die Perser zurück, die sich ihr entgegenstellten, und verwüstete Mesopotamien.
Mehr brauchte es nicht, um die Welle des Zusammenbruchs auch über Persien rollen zu lassen. Die herrschende Klasse brach auseinander, Chosraus eigener Sohn ließ den König hinter Schloss und Riegel verhungern, gab die Länder und Reliquien zurück, die Chosrau erobert hatte, und trat sogar zum Christentum über. Persien versank in Bürgerkriegswirren, acht Könige saßen in nur fünf Jahren auf dem Thron, Herakleios dagegen wurde als der Größte von allen gefeiert. »Maßlose Freude und unbeschreibliches Glück haben die ganze Welt ergriffen«, heißt es in der Eloge eines Zeitgenossen.7 »Lasst uns alle mit vereinter Stimme die Lobpreisungen der Engel singen«, schrieb ein anderer: »Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden.«8
Das rasant wechselnde Kriegsglück im Jahrhundert nach 533 war nur ein Zeichen für die Todeskämpfe, in denen die alten Reiche des Westens sich wanden. Da es, anders als in China, keine neuen, wirtschaftlich starken Grenzgebiete gab, konnte Chosrau die gesellschaftliche Entwicklung im Westen ebenso wenig drehen wie Justinian. Je hartnäckiger es beide versuchten, desto schlimmer wurde die Lage. Mit einem Jahrhundert voller Gewalt, Seuchen und des wirtschaftlichen Niedergangs unterhöhlten der letzte Römer und der letzte Perser das westliche Kerngebiet. Um 630, nur zehn Jahre nach dem Einzug Herakleios’ in Jerusalem, mit dem dieser das Wahre Kreuz an seinen rechtmäßigen Ort zurückbrachte, hatten ihre Triumphe und Tragödien keinerlei Bedeutung mehr.
Ohne es zu wissen, folgten beide, Justinian wie Chosrau, alten Mustern. Mit den Kriegen, die sie führten, um das jeweilige Kerngebiet komplett unter ihre Herrschaft zu bringen, schwächten sie es und zogen erneut fremde Völkerschaften von den Randregionen ins Innere. Chosrau brachte Awaren nach Konstantinopel, Herakleios führte Turkvölker nach Mesopotamien; beide Reiche warben arabische Stämme zum Schutz ihrer Wüstengrenzen an, denn das war billiger, als eigene Garnisonen zu unterhalten. Dasselbe Denken, das Roms Grenzgebiete germanisiert und die Chinas xiongnuisiert hatte, arabisierte jetzt die gemeinsame Grenze von Byzanz und Persien. Beide Reiche bekamen es im 6. Jahrhundert immer mehr mit Arabern zu tun, beide bauten arabische Klientelstaaten auf; Persien verleibte das südliche Arabergebiet sogar seinem Reich ein. Und zum Ausgleich drangen äthiopische Verbündete von Byzanz in den Jemen vor. So wurden arabische Territorien ins Kerngebiet hineingezogen, Araber schufen in der Wüste eigene Reiche, indem sie an den Handelsstraßen Oasenstädte bauten und zum Christentum übertraten.
Die großen Kriege zwischen Persien und Byzanz erschütterten die arabische Peripherie, und als beide Reiche auseinanderfielen, balgten sich arabische Kriegsherren um die Ruinen. Im westlichen Arabien kämpften in den 620er Jahren Mekka und Medina (Abbildung 7.6) um die Kontrolle der Handelsstraßen, ihre Kriegerbanden schwärmten in die Wüste aus, um Verbündete zu finden und die Karawanen der Gegner zu überfallen. In diesem Spiel hatten die alten Reichsgrenzen kaum noch Bedeutung, und als Medina im Jahr 630 Mekka unterwarf, machten seine Räuberbanden bereits Palästina unsicher. Dort stießen Araber, die loyal zu Medina standen, mit arabischen Parteigängern Mekkas zusammen; weitere arabische Stämme wurden von Konstantinopel bezahlt und kämpften gegen die beiden anderen Gruppen.
Solche Geschehnisse wären etwa den Aramäerstämmen bekannt vorgekommen, die nach 1200 v. u. Z., als das Ägyptische und das Babylonische Reich zusammenbrachen, im Wüstenrandgebiet ihr Unwesen trieben. Eben das wiederholte sich in den Grenzgebieten immer dann, wenn Staaten sie nicht länger schützen konnten. Eines allerdings wäre den Aramäern neu gewesen, nämlich Medinas Führer, ein gewisser Mohammed ibn Abdullah.
Um 610, als Persien seinen folgenreichen Krieg gegen Byzanz begann, hatte dieser Mohammed eine Vision. Ihm war der Erzengel Gabriel erschienen und hatte befohlen: »Rezitiere!« Mohammed, verständlicherweise verwirrt, erwiderte, er habe nichts vorzutragen, noch zweimal aber erging Gabriels Aufforderung. Und siehe, plötzlich drangen Worte aus Mohammeds Mund:
Trag vor im Namen deines Herrn, der erschuf,
Erschuf den Menschen aus einem Blutklumpen!
Trag vor, denn dein Herr ist im Guten unübertrefflich,
Der durch das Schreibrohr nahebrachte,
Den Menschen lehrte, was er nicht wusste!9
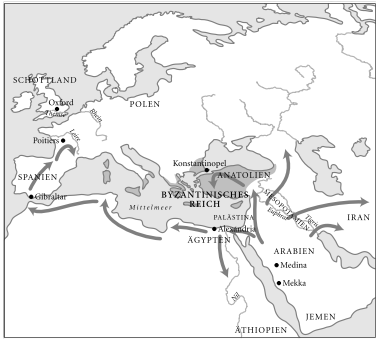
Abbildung 7.6: Dschihad
Zwischen 632 und 732 vereinigten die Araber fast das gesamte westliche Kerngebiet. Die Pfeile zeigen die Hauptlinien des arabischen Vorstoßes.
Mohammed fürchtete, er sei verrückt geworden oder Dämonen hätten von ihm Besitz ergriffen, doch seine Frau beschwichtigte ihn. In den folgenden 22 Jahren meldete sich Gabriel immer wieder und ließ Mohammeds widerstrebende Lippen unter Fieberanfällen und Schweißausbrüchen Gottes Worte sprechen. Und was für Worte das waren: Augenblicklich, so die Überlieferung, verwandele ihre Schönheit die Menschen, die sie vernehmen. »Mein Herz wurde weich, und ich weinte«, sagte Umar, einer der bedeutendsten Bekehrten, »der Islam zog in mich ein.«10
Der Islam – »die Unterwerfung unter Gottes Willen« – ist in vieler Hinsicht eine typische Religion der zweiten Welle der Achsenzeit. Ihr Gründer entstammte dem Rand der Elite (war ein unbedeutendes Mitglied eines gerade zu Reichtum gelangten Kaufmannsclans) und dem Rand eines Reiches. Er hinterließ keine schriftlichen Aufzeichnungen (der Koran, das heißt: »Lesungen«, wurde erst nach seinem Tod zusammengestellt); er glaubte, Gott sei unbegreiflich, knüpfte an das |344|ältere achsenzeitliche Denken an, predigte Gerechtigkeit, Gleichheit vor Gott und Mitleid mit den Schwachen. All das teilte er mit früheren Denkern der Achsenzeit. Doch verkörperte er auch etwas völlig Neues: Er war ein Achsenkrieger.
Im Unterschied zu Buddhismus, Konfuzianismus oder Christentum entstand der Islam am Rand zusammenbrechender Reiche und gewann Gestalt in einer Zeit beständiger kriegerischer Auseinandersetzungen. Dabei war der Islam keine Religion der Gewalt (im Koran geht es erheblich weniger blutig zu als in der hebräischen Bibel), aber die Muslime konnten sich aus den Kriegen nicht heraushalten. »Und kämpfet für Allahs Sache gegen jene, die euch bekämpfen, doch überschreitet das Maß nicht, denn Allah liebt nicht die Maßlosen«, lehrte Mohammed – oder, wie der amerikanische Muslim Malcolm X im 20. Jahrhundert predigte: »Sei friedlich, sei höflich, gehorche dem Gesetz, begegne jedermann mit Respekt, doch legt jemand Hand an dich, schicke ihn auf den Friedhof.«11 Zwang hatte bei der Verbreitung der Religion nichts zu suchen, aber Muslime – »die sich Gott ergeben« – waren verpflichtet, ihren Glauben zu verteidigen, wann immer er bedroht war. Das allerdings wird häufig vorgekommen sein, denn während sie das Wort verbreiteten, drangen sie plündernd in die kollabierenden Reiche ein.
So zogen die umherziehenden arabischen Stämme ganz eigene Vorteile aus ihrer Rückständigkeit: In einer Welt, in der beides rar war, gab ihnen die Verbindung von Erlösung und Kämpfertum organisatorischen Halt und ein festes Ziel.
Wie viele andere Völker, die in peripheren Gebieten lebten und einen Platz im Zentrum suchten, behaupteten auch die Araber, dieser Platz stehe ihnen wegen ihrer Abstammung zu, nämlich als Nachfahren von Abrahams Sohn Ismael. Mit eigenen Händen hätten Vater und Sohn die Kaaba errichtet, Mekkas bedeutendstes Heiligtum. Abrahams ursprüngliche Religion sei der Islam gewesen, das Judentum habe sich davon abgespalten. Tatsächlich präsentiert der Koran den Islam als Erweiterung des Judentums: »Wer verschmäht den Glauben Abrahams denn einer, der sich selbst zum Toren macht? Denn ihn haben wir bereits im Diesseits auserwählt, und im Jenseits gehört er gewiss zu den Rechtschaffenen.« Alle Propheten, von Abraham bis Jesus, werden anerkannt (allerdings gilt Jesus weder den Juden noch Mohammed als der Messias), und Mohammed ist der letzte Prophet, der, die Botschaft des Herrn besiegelnd, das Versprechen von Judentum und Christentum erfüllt: »Und streitet mit den Leuten der Schrift, auf die schönste Weise nur … Und sagt: ›Wir glauben an das, was zu uns herabgesandt und was zu euch herabgesandt. Und unser Gott und euer Gott ist Einer. Und Ihm sind wir ergeben.‹«12 Es musste also nicht notwendig zu Konflikten zwischen den Buchreligionen kommen: Tatsächlich brauchte der Westen den Islam.
Mohammed schickte Briefe an Chosrau und Herakleios, in denen er diese Dinge erklärte, erhielt aber keine Antwort. Das machte weiter nichts, denn die Araber waren ohnehin bereits nach Palästina und Mesopotamien unterwegs. Sie kamen als Kriegerbanden, nicht als Armeen, selten mit mehr als 5000 und vermutlich nie stärker als 15 000 Mann; sie kämpften auch nicht in regelrechten Schlachten, |345|sondern schlugen zu und zogen sich rasch zurück. Doch auch die Streitkräfte, die ihnen Widerstand leisteten, waren kaum zahlreicher. Bankrott und zersplittert, wie sie in den 630er Jahren waren, fehlte den Reichen die Kraft, sich der verwirrenden neuen Bedrohung zu stellen.
Für die meisten Menschen in Südwestasien dürfte es ohne große Bedeutung gewesen sein, wenn arabische Stammesfürsten byzantinische oder persische Beamte ablösten. Jahrhunderte lang hatten beide Reiche viele ihrer christlichen Untertanen wegen doktrinärer Nebensächlichkeiten verfolgt. Im Byzantinischen Reich beispielsweise galt seit 451 die offizielle Lehre, dass Jesus zwei Naturen habe, eine menschliche und eine göttliche, beide in einem Körper vereint. Ägyptische Gelehrte hielten dem entgegen, Jesus habe in Wirklichkeit nur eine, nämlich eine rein göttliche Natur. In den 630er Jahren hatten so viele Menschen im Streit um die Zwei-Naturen-Lehre ihr Leben verloren, dass viele syrische und ägyptische Anhänger der Lehre von der einen Natur1* die Muslime willkommen hießen. Besser, man hatte Ungläubige als Herren, denen diese Frage gleichgültig war, als Glaubensgenossen, die ihretwegen heiligen Terror veranstalteten.
Es waren kaum 4000 Muslime, die 639 in Ägypten einfielen, dennoch ergab sich Alexandria kampflos. Das mächtige Persische Reich, noch immer erschüttert von zehn Jahren Bürgerkrieg, fiel wie ein Kartenhaus in sich zusammen; die Byzantiner zogen sich nach Anatolien zurück und gaben damit drei Viertel der Basis ihrer Steuereinkünfte auf. Innerhalb der nächsten 50 Jahre zerfielen die High-End-Institutionen des Oströmischen Reiches. Es überstand diese Zeit nur, weil ziemlich rasch Low-End-Lösungen gefunden wurden, indem etwa lokale Würdenträger Armeen aufstellten, deren Soldaten nicht bezahlt wurden, sondern für ihren Unterhalt durch eigenen Landbau aufkommen mussten. Um 700 lebten kaum 50 000 Menschen in Konstantinopel, sie pflügten die Vorstädte um und bauten dort Gemüse an; es gab keine Einfuhren mehr, und statt mit Münzen zu bezahlen, wurde direkt getauscht.
In nur einem Jahrhundert vereinnahmten die Araber die reichsten Teile des westlichen Kerngebiets. 674 schlugen ihre Heerscharen unter den Stadtmauern Konstantinopels ihr Lager auf; 40 Jahre später standen sie am Ufer des Indus (im heutigen Pakistan) und setzten nach Spanien über, 732 erreichte eine Reiterhorde Poitiers in Zentralfrankreich. Danach ließen die Wanderungen von der Wüste in die Zentren der Reiche allmählich nach. Ein Jahrtausend später schrieb Gibbon:
Die Bahn des Sieges war nun über tausend Meilen vom Felsen von Gibraltar bis an die Ufer der Loire verlängert worden; die Wiederholung dieses Raumes hätte die Saracenen an die Grenzen von Polen oder des schottischen Hochlandes gebracht. Der Rhein ist nicht ungangbarer als der Nil oder Euphrat, und die arabische Flotte hätte ohne Seekampf in die Mündung der Themse einlaufen können. Vielleicht würde die Auslegung |346|des Koran in den Schulen von Oxford gelehrt, und auf ihren Kanzeln einem beschnittenen Volke die Heiligkeit und Wahrheit der Offenbarungen Mohameds bewiesen.13
»Vor einem solchen Unheil blieb das Christenthum bewahrt«, setzte Gibbon hinzu, nicht ohne Sarkasmus. Der gängigen Meinung nach – und das war im England des 18. Jahrhunderts nicht anders als im 7. Jahrhundert in Konstantinopel – galt das Christentum als das für den Westen charakteristische Glaubens- und Wertsystem und der Islam als dessen Gegensatz. Es wird wohl immer so gewesen sein, dass die Machthaber in den Kerngebieten all jene als Barbaren hinstellen, die von den Rändern her ins Zentrum drängen. Doch Gibbon verstand sehr wohl, dass die Araber Teil jener Veränderungsprozesse waren, die mit dem Triumph des Christentums begonnen hatten und die das westliche Kerngebiet mit der zweiten Welle der Achsenzeit durchlief. Ohne weiteres können wir die Araber in eine weiter zurückreichende Tradition stellen, die auf die Amoriter in Mesopotamien um 2200 v. u. Z. zurückgeht. Wir können sie sehen, wie sie selbst sich sahen, nämlich als Menschen, die durch Konflikte im Kerngebiet in dieses hineingezogen worden waren und jetzt ihren vermeintlich rechtmäßigen Platz an dessen Spitze einforderten. Sie kamen nicht, um den Westen zu begraben, sondern um ihn zu vervollkommnen; sie wollten Justinian und Chosrau keinen Strich durch deren Ambitionen machen, sondern diese erfüllen.
Wie Gibbons Kritikern aus dem 18. Jahrhundert kommt es auch vielen Politexperten unseres Jahrhunderts gelegen, die islamische Kultur als nicht-westlich, als Gegensatz zur »westlichen« Kultur hinzustellen (womit sie in der Regel Nordwesteuropa und dessen Kolonien in Übersee meinen). An den historischen Realitäten geht das vorbei. Um 700 war die islamische Welt mehr oder weniger das westliche Kerngebiet, die Christenheit dagegen ein peripheres Phänomen an dessen nördlichem Rand. Die Araber hatten einen ungefähr so großen Teil des westlichen Kerngebiets zu einem Staat zusammengefasst wie zuvor Rom.
Die Araber brauchten für ihre Eroberungen im Westen länger als Wendi im Osten für die seinen, doch waren die arabischen Armeen vergleichsweise klein und der Widerstand der Bevölkerung meist begrenzt, sodass sie die Länder, die sie eroberten, selten verwüsteten. Darum konnte die gesellschaftliche Entwicklung im 8. Jahrhundert ihren Sinkflug beenden. Nun hätte sich das mehr oder weniger vereinte westliche Kerngebiet, so wie das östliche im 6. Jahrhundert, wieder fangen und sich die Lücke zwischen Ost und West verringern können.
Dazu aber kam es nicht, wie Abbildung 7.1 deutlich zeigt. Obwohl beide Kerne um 700 im Wesentlichen wiedervereinigt waren und zwischen dem 8. und 10. Jahrhundert |347|vergleichbare politische Höhen und Tiefen durchlebten, verlief die gesellschaftliche Entwicklung im Osten schneller als im Westen.
Beide wiedervereinten Kerne waren politisch schwach. Ihre Herrscher mussten eine Lektion noch einmal lernen, die den Han und den Römern wohlbekannt gewesen war, dass Reiche nämlich mit Tricks und Kompromissen regiert werden. Doch weder die chinesische Sui-Dynastie noch die Araber waren darin wirklich gut. Wie die Han mussten sich auch die Sui Sorgen machen wegen der Nomaden (jetzt eher Turkvölker1* als Xiongnu), doch mit seinem Wachstum zog der östliche Kern auch das Interesse sich neu formierender Staaten auf sich. Als die Goguryo im heutigen Korea in Geheimverhandlungen mit den Turkvölkern traten, um mit ihnen zusammen China zu plündern, wurde dem Sui-Kaiser klar, dass er handeln musste. 612 entsandte er eine riesige Streitmacht gegen Goguryo, aber dank schlechten Wetters, noch schlechterer Logistik und einer grauenhaften Führung wurde diese aufgerieben. 613 führte er eine zweite, 614 eine dritte Armee ins Feld. Als er sich anschickte, noch eine vierte Armee auszuheben, rissen Rebellionen gegen die damit verbundenen Belastungen sein Reich auseinander.
Eine Zeitlang sah es so aus, als brächen die apokalyptischen Reiter erneut los. Kriegsherren teilten China auf, Häuptlinge der Turknomaden spielten sie gegeneinander aus, plünderten, wie es ihnen gefiel, Hunger und Krankheiten breiteten sich aus. Eine Epidemie kam aus der Steppe, eine andere, vermutlich die Beulenpest, übers Meer. Aber so wie Stümperei genügt hatte, die Krise auszulösen, so hätten weise Potentaten sie auch beenden können. Einer der Warlords, der Herzog von Tang, redete den Turkhäuptlingen zu, ihn gegen die anderen chinesischen Kriegsherren zu unterstützen, und bis jene Stammesführer ihren Fehler erkannten, hatte er sich zum Herrscher einer neuen Tang-Dynastie ausgerufen. 630 nutzte sein Sohn interne Konflikte unter den Turkstämmen aus, um die chinesische Herrschaft so weit wie nie zuvor in die Steppe hinein auszudehnen (Abbildung 7.2b). Die staatliche Kontrolle war wiederhergestellt, Hungersnöte, Bevölkerungsbewegungen und Seuchen ebbten ab. Die Woge gesellschaftlicher Entwicklung, die Wus Welt erzeugt hatte, schwoll nun wirklich an.
Eine feste Hand war nötig, nötiger als zu Zeiten der Han, um das Zentrum zusammenzuhalten, doch wie die Menschen nun einmal sind, ist eine solche Hand nicht immer verfügbar. Tatsächlich war es das menschlichste aller Gefühle, die Liebe, die das Reich der Tang zunichte machte. Dem großen Dichter Bai Juyi zufolge verliebte sich Kaiser Xuanzong 740 in Yang Guifei, die Frau seines Sohnes und eine der Vier Schönheiten des alten Chinas, und machte sie zu seiner Konkubine. Die Geschichte klingt verdächtig nach der von König You, der Schlangenfrau Bao Si und ihrer Liebe, an der 1500 Jahre zuvor die westliche Zhou-Dynastie zugrunde gegangen sein soll. Wie dem auch sei, der Überlieferung zufolge war |348|Xuanzong bereit, alles zu tun, um Yang Guifei zu gefallen. Eine seiner glänzenden Einfälle bestand darin, ihre Günstlinge mit Ehren zu überhäufen, darunter auch einen turkstämmigen Feldherrn namens An Lushan, der auf chinesischer Seite kämpfte. Xuanzong schlug allen Rat, jegliche Vorsicht in Fragen militärischer Macht in den Wind und übertrug ihm immer weitere Befehlsgewalt über seine riesigen Armeen.
Es kam, wie es kommen musste. 755 fiel An Lushan undurchsichtigen Palastintrigen zum Opfer, verlor die Gunst seiner Herrin und des Kaisers. Was blieb dem Mann also anderes übrig, als die ihm anvertrauten Armeen gegen Chang’an in Marsch zu setzen. Xuanzong und Yang flohen, die Soldaten jedoch, die sie zu ihrem Schutz eskortierten, machten Yang für den Bürgerkrieg verantwortlich und forderten ihren Tod. Xuanzong – der die Geliebte nicht den Soldaten überlassen wollte und schluchzend und voller Verzweiflung, aber vergeblich nach einem Ausweg suchte – befahl seinem Haupteunuchen schließlich doch, die Geliebte zu erdrosseln. Bai Juyi schrieb:
Wie Blüten fielen Haarnadeln zu Boden, niemand hob sie auf.
Der Kaiser konnte sie nicht retten, nur verhüllen sein Gesicht.
Und als er den Blick wieder hob, war der Ort von Blut und Tränen
Verdeckt von gelbem Staub, von kaltem Wind dorthin geweht.
Der Legende zufolge beauftragte Xuanzong einen Seher damit, Yangs Geist auf einer verzauberten Insel ausfindig zu machen. In Bais Gedicht spricht sie zum Kaiser:
Unsere Seelen gehören zusammen
irgendwo, irgendwann, auf der Erde oder im Himmel,
werden wir uns wiedersehen.14
Inzwischen hatte Xuanzongs Sohn die Rebellion niedergeschlagen., musste dafür allerdings anderen Militärgouverneuren so weitgehende Befugnisse einräumen wie die, derer sich zuvor An Lushan erfreut hatte. Und weil er sich außerdem des Beistandes der Turknomaden versicherte, waren weitere Katastrophen vorprogrammiert. Die Grenzen wurden durchlässig, Steuereinnahmen schrumpften, und mehrere Generationen lang stolperte das Reich zwischen Ansätzen zur Wiederherstellung der Ordnung und neuen Erhebungen, zwischen Invasionen und Rebellionen hin und her. Erst 907 machte ein Kriegsherr dem Elend der Tang-Dynastie ein Ende, indem er den halbwüchsigen Kaiser umbrachte. Was folgte, war die Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Reiche. Für die nächsten 50 Jahre blieb Nordchina ein großes Reich, in dem wechselnde Fraktionen von Eunuchen und Militärs die Macht ausübten, während sich acht bis zehn kleinere Staaten in den Süden teilten.
Am Schicksal Xuanzongs zeigte sich Chinas grundlegendes politisches Problem: Starke Kaiser konnten sich sehr wohl über andere Interessen und staatliche Institutionen hinwegsetzen, aber nur dann, wenn sie zugleich geschickt und maßvoll |349|vorgingen, handelten sie sich wenige Probleme ein. Doch eine solche Begabung hing vom Zufall ab, die zu bewältigenden Aufgaben waren vielfältig, und so musste es früher oder später zu einer Katastrophe kommen.
Umgekehrt lagen die Dinge im westlichen Kerngebiet. Hier war die Führung schwach. Das riesige arabische Reich hatte keinen Kaiser. Mohammed war ein Prophet, kein Potentat. Die Menschen folgten ihm, weil sie glaubten, er wisse, was Gott wolle. Nach seinem Tod im Jahr 632 gab es keinen Grund, einem anderen zu folgen, und fast hätte sich Mohammeds arabisches Bündnis aufgelöst. Um das zu verhindern, machten seine engsten Gefolgsleute einen aus ihrer Mitte zum khalifa, was in nützlicher Zweideutigkeit sowohl »Stellvertreter« (Gottes) als auch »Nachfolger« (Mohammeds) bedeutet. Seinen Anspruch auf die Führungsmacht konnte ein Kalif jedoch allein durch seine Nähe zum Propheten begründen.
Wenn man bedenkt, wie uneins die arabischen Stammesfürsten und Clanchefs waren (von denen einige Persien und Byzanz ausrauben, andere die Reiche in Parzellen aufteilen und sich als Grundbesitzer niederlassen, wieder andere neue Propheten salben wollten), haben sich die ersten Kalifen wacker geschlagen. Sie brachten die Araber dazu, das Byzantinische und das Persische Reich so wenig wie möglich in Unordnung zu bringen: Die Bauern sollten auf ihren Feldern, die Grundbesitzer auf ihren Gütern und die Beamten in ihren Kontoren bleiben. Die einzige große Veränderung, die sie vornahmen, war, die Reichssteuern in ihre Schatullen umzuleiten, sodass sie vor allem Angehörige der eigenen Stämme für ihre Dienste als berufsmäßige Gotteskrieger bezahlen konnten. Diese lebten in rein arabischen Garnisonsstädten, die in den eroberten Ländern an strategisch wichtigen Punkten errichtet wurden.
Die Unsicherheit darüber, was ihr Amt bedeutete, konnten die Kalifen nicht auflösen. Waren sie Könige, die zentral die Staatsfinanzen verwalteten und Verordnungen erließen, oder religiöse Führer, die den unabhängigen Scheichs in den eroberten Provinzen geistlichen Rat erteilten? Sollten sie die vorislamischen Stammeseliten repräsentieren? Oder waren sie, als die ersten Getreuen Mohammeds, Auserwählte? Sollten sie eine egalitäre Gemeinschaft von Gläubigen anführen? Kein Kalif konnte es allen Muslimen fortwährend recht machen. Und 656, als bereits der dritte Kalif einem Mordanschlag zum Opfer gefallen war, wuchsen sich die Schwierigkeiten zur akuten Krise aus. Nur wenige von Mohammeds ursprünglichen Getreuen lebten noch, und die Wahl fiel auf Ali ibn Abi Talib, Mohammeds viel jüngeren Vetter (und Schwiegersohn).
Ali wollte den ursprünglichen Geist des Islam, so wie er ihn sah, wiederherstellen, aber seine Strategie, für die Armen einzutreten, die Steuereinnahmen in den Händen der Soldaten zu lassen und die Beute erfolgreicher Plünderungen gleichmäßiger aufzuteilen, brachte zuvor privilegierte Gruppen gegen ihn auf. Bürgerkrieg drohte, aber die Muslime scheuten (zu dieser Zeit) davor zurück, sich gegenseitig umzubringen. Statt die ganze arabische Welt in einen Krieg zu stürzen, entschlossen sich Alis enttäuschte Anhänger 661, ihn zu ermorden. Das |350|Kalifat ging nun auf Muawiya ibn Abu Sufyan über, den syrischen Statthalter. Er machte Damaskus zur Hauptstadt und mühte sich ohne allzu großen Erfolg, ein gewöhnliches Reich mit zentraler Steuerverwaltung und Beamten zu schaffen.
In China hatte Xuanzongs Liebe eine politische Katastrophe ausgelöst; im Westen war es die Bruderliebe – genauer: deren Fehlen –, die das Unglück heraufbeschwor. Eine neue Kalifendynastie verlegte die Hauptstadt 750 nach Bagdad und bemühte sich um effizientere Zentralisierung, aber 809 brachen Führungsstreitigkeiten zwischen Brüdern aus, die den Kalifen al-Ma’mun selbst nach arabischen Maßstäben außerordentlich schwächten. Er traf den kühnen Entschluss, dem Problem auf den Grund zu gehen: Gott. Im Unterschied zu Christen oder Buddhisten hatten die Muslime keine institutionalisierte kirchliche Hierarchie. Die Kalifen übten zwar große weltliche Macht aus, beanspruchten aber nicht, mehr als andere über Gottes wahren Willen zu wissen. Al-Ma’mun entschloss sich, das zu ändern, womit er eine alte Wunde des Islam wieder aufriss.
Im Jahr 680, kaum zwanzig Jahre nach dem Mord an Mohammeds Vetter/Schwiegersohn Ali, hatte dessen Sohn Hussein das Banner der Revolte gegen die Kalifen ergriffen. Als Hussein unterlag und getötet wurde, rührten nur wenige Muslime einen Finger für ihn. Dafür aber bildete sich im folgenden Jahrhundert eine Fraktion (shi’a) heraus, die die Macht der Kalifen für illegitim hielt, weil sie ihre Stellung allein dem Mord an Ali verdankten. Den Schiiten zufolge waren Hussein, Ali und Mohammed tatsächlich göttlich legitimiert, daher könnten auch nur Imame, nämlich Abkömmlinge dieser Linie, die Gläubigen anleiten. Die Mehrheit der Muslime (die Sunniten hießen, weil sie der sunna, den alten Bräuchen, folgten) fand diese Geschichte lächerlich, doch die Schiiten arbeiteten ihre Theologie weiter aus. Im 9. Jahrhundert glaubten manche Schiiten, dass die Linie der Imame zu einem mahdi führe, zu einem Messias, der das Reich Gottes auf Erden begründen werde.
Al-Ma’mun kam nun die glänzende Idee, den amtierenden Imam (Husseins Ur-Ur-Urenkel) als Erben zu adoptieren und damit die Schiiten wieder einzugemeinden und auf sich selbst zu verpflichten. Ein schlauer, wenn auch manipulativer Trick. Doch er lief ins Leere, weil der Imam im Laufe des Jahres starb und dessen Sohn wiederum keinen Sinn für al-Ma’muns Winkelzüge hatte. Der aber ließ sich nicht entmutigen und enthüllte Plan B. Einige religiöse, von der griechischen Philosophie beeinflusste Gelehrte, die sich in Bagdad ihren Studien hingaben, waren bereit zu erklären, dass der Koran Menschenwerk und nicht (wie die meisten Muslime glaubten) Gottes unmittelbare Offenbarung sei. Als lediglich von Gott inspiriertes Buch unterstehe der Koran – wie auch die Kleriker, die ihn interpretierten – der Autorität des Kalifen, Gottes irdischem Stellvertreter. Daraufhin rief Al-Ma’mun eine irakische Inquisition2* ins Leben, die anders denkende Gelehrte |351|einschüchtern und ihm ihre Zustimmung sichern sollte. Doch einige Kleriker widerstanden und blieben prinzipienfest: Der Koran sei Gottes Wort und stehe über allem anderen – auch über al-Ma’mun. Die Auseinandersetzung währte bis 848, dann mussten die Kalifen eingestehen, dass sie verloren hatten.
Mit seinen Plänen A und B schwächte al-Ma’mun die Autorität des Kalifats, mit Plan C aber erledigte er sie endgültig. Da ihm noch immer religiöse Autorität fehlte, entschloss er sich, zu gröberen Mitteln zu greifen. Nun wollte er sich militärische Macht kaufen, nämlich turkische Reiter als Sklavenarmee anheuern. Doch al-Ma’mun und seine Erben mussten die gleiche Erfahrung machen wie andere Herrscher zuvor: Auf Dauer waren Nomaden nicht zu kontrollieren. Um 860 waren die Kalifen praktisch zu Geiseln ihrer eigenen Sklavenarmee geworden. Ohne militärische Macht und ohne religiösen Rückhalt konnten sie keine Steuern mehr eintreiben, mussten vielmehr einzelne Provinzen an Emire abtreten, an Militärgouverneure, die nun ihrerseits an Steuern einsackten, was sie konnten. 945 schließlich eroberte ein Emir Bagdad, und das Kalifat zerfiel in ein Dutzend unabhängiger Emirate.3*
Zu diesem Zeitpunkt waren östliches und westliches Kerngebiet in jeweils zehn und mehr Staaten zersplittert. Doch trotz aller Gleichartigkeit, mit der sich die Zusammenbrüche in beiden Gebieten vollzogen, schritt die gesellschaftliche Entwicklung im Osten schneller voran als im Westen. Wieder scheint sich zu bestätigen, dass nicht Kaiser und Intellektuelle die Geschichte machten, sondern Millionen fauler, gieriger und verängstigter Menschen auf der Suche nach leichteren, einträglicheren und sichereren Lebensbedingungen. Trotz oft grausamer Disziplinierungsversuche von Seiten der Herrschenden schlugen sich die einfachen Menschen durch und machten das Beste aus den Umständen, unter denen sie lebten. Weil aber die geographischen Realitäten in Ost und West sehr unterschiedlich waren, hatten die politischen Krisen jeweils auch andere Konsequenzen.
Motor der gesellschaftlichen Entwicklung im Osten war die Binnenwanderung, die seit dem 5. Jahrhundert eine neue Grenze jenseits des Jangtse zur Folge hatte. Die Wiederherstellung eines vereinigten Reiches im 6. Jahrhundert beschleunigte die Entwicklung, im 8. Jahrhundert war der Aufwärtstrend so stark, dass ihm sogar die Folgen von Xuanzongs Liebesleben nichts anhaben konnten. Gewiss hatte das politische Chaos negative Konsequenzen. So lag das plötzliche scharfe Absinken der Punktzahl um das Jahr 900 (Abbildung 7.1) vor allem daran, dass verschiedene, sich gegenseitig bekämpfende Armeen die Millionenstadt Chang’an vernichteten. Aber die meisten Kämpfe fanden abseits lebenswichtiger Reisfelder, Kanäle und Städte statt. Sie fegten vor allem kleine Regierungsbeamte hinweg, |352|die den Handel bis dahin behindert hatten, was die gesellschaftliche Entwicklung womöglich noch beschleunigte. Außerstande, das Staatsland in diesen unruhigen Zeiten zu überwachen, beschafften sich die Staatsbeamten Geld durch Monopole und Besteuerung des Handels und hatten insofern kein Interesse mehr daran, den Kaufleuten vorzuschreiben, wie sie ihre Geschäfte zu führen hatten. So kam es zu einer Art Machttransfer von den politischen Zentren Nordchinas zu den Kaufleuten des Südens, und diese, die nun selbst entscheiden mussten, was zu tun war, entwickelten noch ganz andere Ideen, um den Handelsverkehr voranzutreiben.
Ein großer Teil des nordchinesischen Fernhandels war staatlich gelenkt, abgesprochen zwischen Kaiserhof und den Herrschern in Korea und Japan. 775, mit dem Zusammenbruch der Tang-Dynastie, gingen diese Verbindungen allerdings verloren – was auch positive Folgen hatte. Abgeschnitten von den chinesischen Vorbildern, entwickelte sich die Kultur der japanischen Elite höchst eigenständig. So traten zum Beispiel mehrere Frauen mit literarischen Meisterwerken hervor, etwa mit Die Geschichte vom Prinzen Genji oder mit dem Kopfkissenbuch. Insgesamt allerdings waren die Folgen negativ. Im 9. Jahrhundert verlangsamte sich die wirtschaftliche Entwicklung in Nordchina, Korea und Japan, womit auch die politischen Systeme zusammenbrachen.
Die unabhängigen Kaufleute in Südchina dagegen verstanden es, ihre Freiheit von staatlicher Regulierung zu nutzen. Seit den 1990er Jahren werden in der Javasee Schiffswracks aus dem 10. Jahrhundert geborgen, die nicht nur chinesische Luxuswaren an Bord hatten, sondern auch Keramik und Glas aus Südasien und der muslimischen Welt – Zeichen für die Expansion der Märkte in dieser Region. Als lokale Eliten begannen, den aufblühenden Handel zu besteuern, entstanden in Südostasien die ersten starken Staaten, auf Sumatra etwa oder bei den Khmer in Kambodscha.
Die im westlichen Eurasien so ganz andere Geographie, in der es nichts der Reisgrenze im Osten Entsprechendes gab, führte dazu, dass der politische Zusammenbruch dort auch andere Folgen hatte. Die arabischen Eroberungszüge im 7. Jahrhundert fegten die alte Grenze zwischen römischer und persischer Welt hinweg (Abbildung 7.7), was dem muslimischen Kern einen ungeahnten Aufschwung verschaffte. Die Kalifen ließen die im Irak und in Ägypten bereits vorhandenen Bewässerungssysteme ausbauen, Reisende brachten landwirtschaftliche Produkte und Techniken vom Indus bis zum Atlantik. So verbreiteten sich Reis, Zucker und Baumwolle im muslimischen Mittelmeerraum, und mit Hilfe des Fruchtwechsels erzielten die Bauern zwei oder drei Ernten. Die Muslime, die Sizilien kolonisierten, erfanden klassisch westliche Speisen wie Pasta und Speiseeis.
Doch den Vorteilen, die sich aus der Überwindung der alten Grenze zwischen Rom und Persien ergaben, standen zunehmend Nachteile gegenüber, die sich den neuen Grenzen zwischen Islam und Christentum im Mittelmeerraum verdankten. Als der südliche und östliche Mittelmeerraum immer muslimischer (um 750 waren vielleicht zehn Prozent der arabischen Untertanen Muslime, um 950 dann |353|90 Prozent) und Arabisch dort zur Lingua franca wurde, verringerten sich die Kontakte zur Christenheit. Und ab 800, nachdem das Kalifat gescheitert war, errichteten die Emire zusätzliche Barrieren innerhalb der islamischen Welt selbst. Einige Regionen im muslimischen Kerngebiet, wie Spanien, Ägypten und Iran, waren groß genug, um wirtschaftlich allein durch die Nachfrage aus dem Inland über die Runden zu kommen, andere Regionen dagegen verfielen. Und während die Kriege des 9. Jahrhunderts die wirtschaftlichen Kernregionen Chinas weitgehend aussparten, wurde das empfindliche Bewässerungsnetz im Irak von rivalisierenden Turkarmeen und durch einen Aufstand afrikanischer Plantagensklaven verwüstet, der sich über 14 Jahre hinzog – angeführt von einem Mann, der mal behauptete, Dichter, dann wieder Prophet oder Nachkomme Alis zu sein.

Abbildung 7.7: Die Bruchlinie verschiebt sich
Die dick gestrichelte Linie stellt die Grenze dar, die Rom von 100 v. u. Z. bis 650 u. Z. wirtschaftlich, politisch und kulturell von Persien trennte. Die durchgezogene Linie zeigt die Hauptgrenze zwischen Islam und Christentum ab 650 u. Z. Links oben sieht man das Frankenreich um 800, in seiner Blütezeit also; unten die muslimische Welt und ihre politischen Grenzen um 945.
|354|Im Osten steuerten, als Nordchina in die Krise geriet, auch Korea und Japan auf einen politischen Zusammenbruch zu. In ähnlicher Weise zerfiel, als sich der muslimische Kern herausbildete, die christliche Peripherie in immer mehr Fragmente. Die Byzantiner schlachteten sich zu Tausenden ab, trennten sich wegen doktrinärer Differenzen (vor allem über die Frage, ob Gott Bilder von Jesus, Maria und den Heiligen gutheiße) von der römischen Kirche; und die germanischen Königreiche schufen sich, weitgehend abgeschnitten vom Mittelmeer, eine eigene Welt.
Manche Gebiete in diesen fernen Grenzländern des Westens konnten darauf hoffen, zu einem eigenen Kern zu werden. Seit dem 6. Jahrhundert hatten sich die Franken zu einer Regionalmacht entwickelt. An der Nordsee entstanden zugleich kleine Handelsstädte, die die unersättliche Nachfrage fränkischer Adliger nach Luxusgütern befriedigten. Ihr Staat blieb gering organisiert, mit nur rudimentär entwickeltem Steuerwesen und Verwaltung. Könige, denen es gelang, ihre händelsüchtigen Feudalherren erfolgreich zu mobilisieren, konnten lockere Reiche zusammenbringen, die große Teile Westeuropas umfassten, jedoch rasch verfielen, sobald schwächere Herrscher auf den Thron kamen. Und wenn ein Monarch mehrere Söhne hinterließ, teilte er das Reich gewöhnlich unter ihnen auf – was oft zu Kriegen um die Wiedervereinigung des Erbes führte.
Ab Mitte des 8. Jahrhunderts begann eine besonders gute Zeit für die Franken. In den 750er Jahren ersuchte sie der Papst um Schutz vor den Langobarden und anderen Raufbolden in der Umgebung Roms, und der Frankenkönig Karl I. brachte am Weihnachtsmorgen des Jahres 800 Papst Leo III. dazu, ihn in Sankt Peter zum Kaiser zu krönen, zum »durchlauchten Augustus« und zum Beschützer des Papstes und des christlichen Glaubens.
Karl, der später mit dem Zusatz »der Große«4* geehrt wurde, versuchte von Anfang an, ein Reich aufzubauen, das des von ihm angestrebten Kaisertitels würdig sein sollte. Seine Heere trugen das Christentum mit Feuer und Schwert nach Osteuropa, trieben im Westen die Muslime zurück nach Spanien. Gleichzeitig ließ er durch seine gebildeten Beamten wenigstens einige Steuergelder eintreiben, holte Gelehrte nach Aachen ( »das kommende Rom«, wie einer seiner Hofdichter jubelte15), schuf eine stabile Währung und kümmerte sich um die Wiederbelebung des Handels. Man ist versucht, Karl den Großen mit Xiaowen zu vergleichen, der drei Jahrhunderte zuvor das Nördliche Wei an Chinas rauer Grenze in Richtung High-End ausgebaut und damit einen Prozess in Gang gesetzt hatte, der zur Wiedervereinigung des östlichen Kerngebiets führte. Karls Kaiserkrönung in Rom lässt in der Tat Ambitionen erkennen, die denen Xiaowens ähnlich sind. Auch dass Karl Botschafter nach Bagdad entsandte, um die Freundschaft des Kalifen zu suchen, spricht dafür. Dieser sei so beeindruckt gewesen, heißt es in fränkischen Chroniken, dass er Karl einen Elefanten zukommen ließ.
|355|In arabischen Quellen allerdings ist weder etwas von Franken noch von Elefanten zu lesen. Karl war eben doch kein Xiaowen und zählte in den Ratsversammlungen des Kalifen nicht viel. Auch sah die byzantinische Kaiserin Irene5* in Karls Anspruch auf die römische Kaiserwürde keinen Grund, zu seinen Gunsten abzudanken. Wirklichen High-End-Status erlangte das Frankenreich nie. Karl mochte gewaltige Ambitionen haben; realistische Möglichkeiten, das westliche Kerngebiet wiederzuvereinigen oder auch nur dessen christliche Randzonen zu einem einzigen Staat zu machen, hatte er nicht.
Etwas aber gelang Karl dem Großen wider Willen und unglücklicherweise doch: Er trieb die gesellschaftliche Entwicklung so weit voran, dass er Räuberhorden aus den noch wilderen Gebieten jenseits der christlichen Peripherie in sein Reich lockte. Als er 814 starb, schoben sich die Langschiffe der skandinavischen Wikinger die Flüsse hinauf bis ins Zentrum des Reiches. Im Süden fielen Magyaren auf zähen kleinen Steppenponys raubend in Deutschland ein. Und noch weiter im Süden waren sarazenische Piraten aus Nordafrika drauf und dran, Rom zu plündern. Der Königshof in Aachen war schlecht gerüstet, um angemessen zu reagieren. Wenn die Wikinger ihre Schiffe mal wieder am Ufer festmachten und Dörfer niederbrannten, dann kamen die fränkischen Truppen schlicht zu spät – sofern überhaupt. So also stellten sich die Landbewohner zunehmend unter den Schutz ihrer lokalen Fürsten, die Städter hielten sich an ihre Bischöfe und Bürgermeister. Als die drei Enkel Karls des Großen im Jahre 843 das Reich unter sich aufteilten, hatten die Könige für die meisten ihrer Untertanen kaum noch Bedeutung.
Als genügten diese Spannungen nicht, geriet Eurasien nach 900 unter neuen Druck – und zwar buchstäblich: Die Umlaufbahn der Erde verschob sich weiter, und über den Landmassen nahm der atmosphärische Druck zu, sodass sich sowohl die Westwinde, die vom Atlantik her wehten, als auch die Monsunwinde über dem Indischen Ozean abschwächten. Die Durchschnittstemperaturen in Eurasien stiegen zwischen 900 und 1300 um 2 bis 3° Celsius, die Regenfälle verringerten sich um zehn Prozent.
Wie immer zwang der Klimawandel die Menschen, ihre Lebensgewohnheiten zu ändern, wobei ihnen allerdings die Wahl der Mittel offen blieb. Im nasskalten Nordeuropa war dieses so genannte Mittelalterliche Wärmeoptimum grundsätzlich willkommen, zwischen 1000 und 1300 verdoppelte sich die Bevölkerung. Im wärmeren und trockeneren islamischen Kerngebiet kam es weitgehend ungelegen. |356|Dort verringerte sich die Bevölkerung um rund zehn Prozent; nur einige Gebiete, vor allem in Nordafrika, gediehen prächtig. 908 löste sich Ifriqiya1* (Abbildung 7.8) aus dem Machtbereich der Kalifen in Bagdad. Radikale Schiiten2* konstruierten eine Abstammungslinie offiziell unfehlbarer Kalif-Imame, die sie auf Mohammeds Tochter Fatima zurückführten, weshalb sie Fatimiden genannt wurden. Sie eroberten 969 Ägypten, wo sie mit Kairo eine große neue Stadt errichteten und in Bewässerungsanlagen investierten. Um 1000 hatte Ägypten die höchste gesellschaftliche Entwicklungsrate im Westen, und ägyptische Kaufleute fuhren kreuz und quer über das Mittelmeer.
Wir wüssten wenig über diese Kaufleute und ihren Handel, hätte sich die jüdische Gemeinde von Kairo 1890 nicht entschlossen, ihre 900 Jahre alte Synagoge umzubauen. Dort gab es, wie in anderen Synagogen auch, einen Lagerraum, in dem die Gläubigen Dokumente deponieren konnten, die sie aus Furcht, dass diese vielleicht den Namen Gottes enthielten, nicht vernichten wollten. Normalerweise wurden diese Lagerräume in periodischen Abständen ausgeräumt, dieser jedoch hatte sich über Jahrhunderte mit Makulatur gefüllt. Als der Umbau begann, tauchten auf Kairos Antiquitätenmärkten alte Dokumente auf, und im Frühjahr 1896 brachte ein englisches Schwesternpaar ein Bündel davon mit nach Cambridge. Zwei Texte daraus zeigten sie Solomon Schechter, einem Professor für Talmudistik. Den traf alsbald schier der Schlag: Einer der Texte war ein hebräisches Fragment des biblischen Buches Ecclesiasticus (Jesus Sirach), das bis dahin nur aus griechischen Übersetzungen bekannt war. Noch im Dezember machte sich der gelehrte Doktor auf nach Kairo und brachte 140 000 Dokumente mit nach Hause.
Unter diesen befanden sich einige hundert Briefe an Kairoer Handelshäuser, die zwischen 1025 und 1250 aus so fernen Ländern wie Spanien und Indien eingegangen waren. Die ideologischen Spaltungen, die sich nach den arabischen Eroberungen gebildet hatten, bedeuteten den Korrespondenten offenbar wenig, ihnen ging es mehr ums Wetter, um ihre Familien und die eigene Wohlstandsmehrung als um Religion oder Politik. Das dürfte typisch gewesen sein für alle Kaufleute aus dem Mittelmeerraum. Der Handel in Ifriqiya und Sizilien, wo das muslimische Palermo durch seine wirtschaftlichen Beziehungen zum christlichen Norditalien zur aufstrebenden Stadt wurde, ist zwar weniger gut dokumentiert, scheint aber ebenso international und gewinnbringend gewesen zu sein.
Sogar Monte Polizzo, das abgelegene sizilianische Dorf, in dem ich in den letzten Jahren an Ausgrabungen beteiligt gewesen bin, kommt hier ins Bild. Wie in Kapitel 5 bereits angedeutet, kam ich dort hin, um die Auswirkungen der phönizischen und griechischen Kolonisation im 7. und 6. Jahrhundert v. u. Z. zu studieren. Als wir 2000 mit den Grabungen begannen, fanden wir jedoch ein zweites Dorf über den alten Häusern: gegründet um 1000 u. Z., vermutlich von muslimischen Einwanderern aus Ifriqiya, niedergebrannt um 1125. Als unser Botaniker aus diesen Ruinen geborgene, verkohlte Samen durchsiebte, entdeckte er – zur allgemeinen Überraschung –, dass offensichtlich ein Gebäude als Lagerraum gedient hatte und gefüllt war mit sorgfältig gedroschenem Weizen ohne größere Grasbeimengung.3*

Abbildung 7.8: Die aus der Kälte kamen Die Wanderungen von Seldschuken (durchgezogene Pfeile) und Wikingern bzw. Normannen (gestrichelte Pfeile) in das westliche Kerngebiet, 11. Jahrhundert.
Ganz anders die Samen, die wir aus dem 6. Jahrhundert v. u. Z. fanden: Sie waren stets stark mit Gras und Spreu vermischt. Daraus ließ sich nur sehr grobes Brot herstellen, wenig erstaunlich für ein einfaches Bauerndorf, dessen Bewohner für den eigenen Bedarf anbauten und denen Spelzen im Mund wenig ausgemacht |358|haben. Das so gründliche Trennen der Spreu vom Weizen im 12. Jahrhundert hingegen spricht für kommerzielle Bauern, die reines Korn für mäkelige Städter produzierten.
Die Wirtschaft des Mittelmeerraums muss einen gehörigen Aufschwung erlebt haben, wenn sogar das kleine Monte Polizzo an internationale Handelsnetze angeschlossen war. So gut ging es dem ältesten Teil des muslimischen Kerngebiets in Südwestasien nicht. Schlimm genug, dass seit den 860er Jahren die türkischen Militärsklaven, die irakische Kalifen für ihre Armeen gekauft hatten, geputscht und ihre Führer sich zu Sultanen erhoben hatten. Und es sollte noch schlimmer kommen. Seit dem 7. Jahrhundert hatten muslimische Kaufleute und Missionare den Turkstämmen in der Steppe Mohammeds frohe Botschaft gepredigt, und im Jahr 960 trat der Karluk-Clan im heutigen Usbekistan – angeblich 200 000 Familien – geschlossen zum Islam über. Für den Glauben ein Triumph, ein Albtraum jedoch für die Politiker, denn die Karluken gründeten ihr eigenes Reich, das der Karachaniden. Zugleich begaben sich die Seldschuken – ein weiterer Turkstamm, der ebenfalls den muslimischen Glauben angenommen hatte – auf die Wanderschaft, durchquerten plündernd den Iran, eroberten 1055 Bagdad und vertrieben bis 1079 sowohl die Byzantiner aus fast ganz Anatolien als auch die Fatimiden aus Syrien.
Das muslimische Südwestasien entwickelte sich rasch anders als die blühende islamische Mittelmeerregion, denn das von den Seldschuken geschaffene Großreich erwies sich als noch weniger effektiv als das Kalifat. Als der gewalttätige Seldschuken-Sultan Malik Schah I. 1092 starb, folgten seine Söhne der Tradition der Steppe, teilten das Reich in neun Teile und bekämpften einander gegenseitig. Die wichtigste Waffe in ihren Kriegen war die Reiterei, daher verliehen die Seldschukenherrscher große Güter an die Kriegsherren, die berittene Gefolgsleute stellen konnten. Wie zu erwarten, kümmerten sich diese Nomadenhäuptlinge wenig um Verwaltung und Handel, prägten auch keine Münzen mehr. So schrumpften Handel und Städte, Kanäle verschlammten, Dörfer an den Grenzen wurden aufgegeben. Unter den neuen, trocken-heißen Klimaverhältnissen hatten die Bauern ohnehin gegen die Versteppung ihrer kostbaren Äcker kämpfen müssen. Nun machte ihnen die Politik der Seldschuken ihre Arbeit noch schwerer. Viele Eroberer, die lieber Nomaden blieben als einen städtischen Lebensstil anzunehmen, begrüßten den Niedergang der Landwirtschaft, und im Laufe des 12. Jahrhunderts ließen auch immer mehr Araber ihre Äcker im Stich und schlossen sich den Turkstämmen und ihren Herden an.
Aufgeschreckt durch die zunehmende Verbreitung radikal schiitischer Theorien und von den seldschukische Herren nach Kräften unterstützt gründeten Gelehrte im östlichen Iran Schulen, die eine schlüssige sunnitische Lehre entwickeln sollten. Ihre Denkmale der Gelehrsamkeit – wie zum Beispiel Abu Hamid al-Ghazalis Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften mit den Mitteln der griechischen Logik oder sein Versuch, islamische Rechtswissenschaft, sufistische |359|Mystik und Mohammeds Offenbarung miteinander zu vereinbaren – sind bis heute Grundlagen des sunnitischen Denkens. Diese Neubelebung war so erfolgreich, dass einige Schiiten ihr Heil nur noch darin sahen, die Führer der Sunniten zu ermorden. Sie zogen sich ins iranische Hochland zurück und gründeten eine Geheimgesellschaft, die unter dem Namen Assassinen bekannt wurde (der Legende nach wurden sie so genannt, weil sie Haschisch rauchten, um sich mental auf ihre Mordaktionen vorzubereiten). Mit dem Dolch im Gewande war das Erstarken der Sunniten nicht aufzuhalten, ebensowenig jedoch konnte eine revitalisierte Glaubensrichtung den Staat der Seldschuken zusammenhalten. So brachen die seldschukischen Gebiete, denen eine politische Organisation nach Art der Fatimidenreiche Nordafrikas fehlte, unter dem Druck der mittelalterlichen Warmzeit zusammen.
Das Elend der einen entsprach dem Wohlergehen der anderen. In Nord- und Westeuropa ermöglichte das wärmere Klima längere Anbauphasen und höhere Erträge, sodass die Bearbeitung zuvor wenig ergiebiger Böden sich nun durchaus lohnte. Die Bauern nahmen riesige, vordem bewaldete Landstriche unter den Pflug; fast die Hälfte aller Bäume in Westeuropa wurde in diesem Zeitraum gefällt.
Wie stets seit der Verbreitung des Ackerbaus aus dem Fruchtbaren Halbmond heraus wirkten in Zeiten der Expansion zwei Prozesse zusammen, die halfen, fortgeschrittene landwirtschaftliche Methoden von West- nach Osteuropa zu verbreiten. Der erste war die Kolonisierung, die häufig von der Kirche getragen wurde – der Institution, die in den Grenzgebieten in der Regel als einzige gut organisiert war. »Gib diesen Mönchen ein unberührtes Moor oder einen wilden Wald«, schrieb der normannische Dichter und Diplomat Gerald von Wales (Giraldus Cambrensis), »dann lasse ein paar Jahre vergehen, und du wirst nicht nur wundervolle Kirchen finden, sondern um sie herum auch Siedlungen.«16 Die Ausdehnung des Kulturraums galt als gottesfürchtiges Werk; und so heißt es in einer Anwerbungskampagne von 1108: »Die Heiden sind die schlimmsten Menschen, aber ihr Land ist das beste, sie haben Weizen, Honig und Mehl. … Hier könnt ihr eure Seele retten [indem die Heiden gezwungen wurden, das Christentum anzunehmen] und zugleich auch gutes Siedlungsland erwerben.«17
Manchmal flohen die Heiden, manchmal unterwarfen sie sich, kamen dann aber kaum besser weg als Sklaven. Doch wie die Wildbeuter, denen einige tausend Jahre zuvor die ersten Bauern, oder wie die Sizilianer, denen auf einmal griechische Kolonisten entgegentraten, organisierten sich bisweilen auch die Heiden und behaupteten sich auf ihrem Grund und Boden. Als fränkische und andere germanische Bauern nach Osten zogen, dort Bäume fällten und Weideland umpflügten, übernahmen Dorfleute in Böhmen, Polen, Ungarn und selbst im fernen Russland ihre Techniken und nutzten das wärmere Klima, um ihr eigenes Land intensiver zu bearbeiten. Ihre frisch christianisierten Häuptlinge überredeten sie zu der oder zwangen sie in die neue Rolle steuernzahlender Untertanen. Im Namen ihrer |360|Herren bekämpften die alteingesessenen Dörfler sodann die Kolonisten – und sich auch untereinander.
Anders als im Osten entwickelten sich in Europa keine großen Handelsströme zwischen dem neuen, Ackerbau treibenden Grenzgebiet und den alten städtischen Zentren. Ohne ein Äquivalent zu Chinas Kaiserkanal gab es keine Möglichkeit, etwa polnisches Getreide preiswert in große Städte wie Palermo oder Kairo zu verschiffen. Die westeuropäischen Städte lagen zwar näher an den Grenzregionen, sie wuchsen auch, aber es waren doch zu wenige und sie waren zu klein, um auskömmliche Märkte abzugeben. Stattdessen stützten sich diese Städte auf eine Intensivierung der lokalen Produktion und auch die Erschließung neuer Energiequellen.
So verbreiteten sich Wassermühlen, die im muslimischen Kerngebiet schon gang und gäbe waren, nun auch an der christlichen Peripherie. Zwischen dem 10. und dem 13. Jahrhundert verfünffachte sich beispielsweise die Zahl der Mühlen im Robec-Tal in der Normandie, und das Domesday Book, das Reichsgrundbuch Wilhelm des Eroberers von 1086, weist für England 5624 Mühlen aus. Die Bauern besannen sich nun auch auf die Vorteile von Pferden. Die waren zwar teurer in der Anschaffung, fraßen auch mehr als Ochsen, konnten dafür aber den Pflug schneller und ausdauernder ziehen. Nach 1000 verschoben sich die Relationen allmählich zugunsten der Pferde, als die Europäer – aus Gründen, auf die ich in Kapitel 8 zurückkommen werde – von den Muslimen Hufeisen aus Metall übernahmen sowie andere Schirrungen verwendeten. Die Hufeisen verliehen den Pferden einen sichereren Tritt, und die neuen Kummetgeschirre schnürten ihnen, wenn sie vor dem Pflug gingen, nicht mehr die Luft ab, was ihre Zugkraft vervierfachte. 1086 war auf den Ländereien englischer Barone nur eines von 20 Zugtieren ein Pferd, 1300 belief sich das Verhältnis auf eins zu fünf. Mit dieser zusätzlichen Pferdekraft (und dem zusätzlichen Dünger) konnten die Bauern das Brachland weiter reduzieren und mehr aus ihren Anbauflächen herausholen.
Die Bauernhöfe in Europa blieben weniger produktiv als die in Ägypten oder China, doch auch sie erwirtschafteten zunehmend Überschüsse, die sie in den Städten verkauften. Diese wachsenden Städte übernahmen neue Funktionen. Viele Nordwesteuropäer waren Leibeigene, rechtlich gezwungen, das Land ihrer Herren zu bearbeiten, die sie umgekehrt vor Räubern (und anderen Herren) beschützten. Zumindest theoretisch waren die Grundherren Vasallen der Könige, die im Gegenzug für die Lehen, die sie erhielten, in des Königs gepanzerter Reiterei kämpften. Die Könige wiederum verdankten ihre Position der Kirche, die im Namen Gottes sprach. Doch alle, Grundherren, Könige und Kirche, wollten vom Reichtum profitieren, der sich nun in den Städten anhäufte, und die Städter konnten sich häufig die Befreiung von feudalen Pflichten aushandeln, indem sie den Feudalherren einen Teil ihres Reichtums überließen.
Wie so gut wie alle Low-End-Herrscher seit den Zeiten der Assyrer und der Zhou betrieben auch die Könige Europas einträgliche Schutzgeschäfte, wobei ihre |361|Geschäftsbasis noch verfahrener war als die ihrer Vorläufer. Ob Stadtbürger, Adlige, Könige oder Kleriker – sie alle mischten sich ständig in die Angelegenheiten der jeweils anderen ein, und da es keine funktionierende Zentralmacht gab, waren Konflikte unausweichlich.
1075 zum Beispiel beanspruchte Papst Gregor VII. das Recht für sich, die Bischöfe im Heiligen Römischen Reich nördlich und südlich der Alpen zu ernennen. Offiziell ging es ihm um die Moral der Kirchenführer, doch waren die Bischöfe in Deutschland auch Herren über große Territorien. So winkte für Gregor der angenehme Nebeneffekt, auch größere Anteile an den deutschen Ressourcen kontrollieren zu können. König Heinrich IV. reklamierte auf dem Reichstag von Worms seine Rechte als Verteidiger des Glaubens und forderte im Verein mit den deutschen Reichsfürsten und Erzbischöfen Papst Gregor auf, sein Amt niederzulegen. In dem Wormser Schreiben heißt es: »Heinrich, nicht durch Anmaßung, sondern durch Gottes gerechte Anordnung König, an Hildebrand [der Geburtsname des Papstes], nicht mehr den Papst, sondern den falschen Mönch. … Ich, Heinrich, durch die Gnade Gottes König, sage dir zusammen mit allen meinen Bischöfen: Steige herab, steige herab!«18
Gregor dachte jedoch gar nicht daran, sondern belegte seinerseits den König mit dem Bann. Nun hatte jeder deutsche Feudalherr das Recht, seinen Herrscher zu ignorieren. Nach einem Jahr musste Heinrich zur Rettung seines Throns eine Demütigung über sich ergehen lassen: Drei Tage lang kniete er vor der Burg Canossa im Apennin barfuß im Schnee und bat den Papst um Vergebung. Der löste den Bann, doch der Frieden zwischen weltlicher und geistlicher Macht währte nicht lange. Schon ein paar Monate später unterstützte Gregor einen Gegenkönig, und als er Heinrich 1080 erneut für abgesetzt erklärte, stellte der einen Gegenpapst auf und zog gegen Rom. In diesem Drama gab es keinen Sieger. Papst Gregor verlor jeden Rückhalt, nachdem seine eigenen Söldner Rom geplündert hatten, weil er sie nicht bezahlt hatte. Heinrich, mittlerweile zum Kaiser gekrönt, beendete sein Leben auf der Flucht vor dem eigenen Sohn, und der theologische Streit um die Einsetzung der Bischöfe wurde ebensowenig gelöst wie der dahinter liegende Konflikt um das Verhältnis von weltlicher und kirchlicher Macht.
Das Europa des 11. Jahrhunderts war voller solch verwickelter Konflikte, doch nach nahmen die Institutionen an Stärke zu und klärten sich Verantwortungsbereiche. Den Königen gelang es immer besser, ihre Untertanen zu organisieren, zu mobilisieren und zu besteuern. Ein Historiker hat diesen Prozess einmal die Herausbildung einer »persecuting society« (Verfolgergesellschaft) genannt19: den verstärkten Anspruch weltlicher Obrigkeiten, einen an den christlichen Normen orientierten Lebenswandel durchzusetzen. Königliche Beamte brachten die Menschen dazu, sich als Teil einer Nation zu sehen (der englischen, französischen und so weiter), und zwar durch Abgrenzung von allem, was sie nicht waren – weder Parias wie die Juden noch Homosexuelle, Leprakranke oder Häretiker. Alle diese »Anderen« wurden zum ersten Mal systematisch jeglichen Schutzes beraubt, verfolgt |362|und terrorisiert. Ein überaus unerfreulicher Prozess, in dessen Verlauf sich zunehmend effizientere Staaten entwickelten.
Andere Historiker sprechen weniger bitter von der »Zeit der Kathedralen«20, in der überall in Europa Ehrfurcht gebietende Bauten entstanden. Zwischen 1180 und 1270 wurden allein in Frankreich 80 Kathedralen, 500 Abteien und Zehntausende von Pfarrkirchen gebaut. Dafür mussten über 25 Millionen Kubikmeter Stein gebrochen und transportiert werden, mehr als für Ägyptens Große Pyramide.
Die Wissenschaft im europäischen Westen war zusammen mit dem Römischen Reich untergegangen und konnte sich auch im Frankenreich Karls des Großen nur teilweise wieder erholen. Ab 1000 jedoch sammelten sich um die neuen Kathedralen herum Gelehrte, es wurden Schulen gegründet, die mit denen der unabhängigen Muftis in der islamischen Welt vergleichbar waren. Christen, die im muslimischen Spanien studierten, brachten Übersetzungen der aristotelischen Schriften zur Logik mit, die arabische Hofgelehrte jahrhundertelang aufbewahrt hatten. Dies stärkte das intellektuelle Leben auch in der Christenwelt, Theologen dort dachten nun auf ähnlich komplexe Weise über Gott nach, wie dies al-Ma’muns Philosophen im Bagdad des 9. Jahrhunderts getan hatten. Müßig zu erwähnen, dass es innerhalb der gebildeten Elite natürlich auch zu neuen Konflikten kam.
Nirgends besser als am Schicksal des Petrus Abaelardus (Pierre Abaillard), eines klugen, von der neuen Bildung erfüllten jungen Mannes, der um 1100 in Paris auftauchte, lassen sich diese Konflikte verfolgen. Er zog von einer Schule zur anderen und demütigte in mehreren Disputationen seine pedantischen Lehrer, deren Gedankengebäude er mit seinem Primat der Vernunft und seiner aristotelischen Logik zum Einsturz brachte. Ungewöhnlich selbstgewiss, wie er war, gründete er eine eigene Schule. Als er eine seiner Schülerinnen, die noch sehr junge Heloïse, verführte und schwängerte, rächte sich deren entehrte Familie furchtbar, indem sie ihn überfallen und entmannen ließ: »Eines Nachts, als ich in einem abgeschiedenen Zimmer meiner Unterkunft ruhig schlief, bestachen sie einen meiner Diener mit Geld und rächten sich an mir durch eine besonders grausame und schmachvolle Strafe, von der die Welt mit größtem Erstaunen hörte: Sie schnitten mir die Körperteile ab, mit denen ich begangen hatte, was sie beklagten.«21
Heloïse und Abaelard zogen sich schamerfüllt jeder in ein Kloster zurück und führten 20 Jahre lang eine Korrespondenz. In diesem erzwungenen Ruhestand schrieb Abaelard Sic et Non. Theologia Christiana ( »Ja und Nein«), eine Art Handbuch zum Gebrauch der Logik für die Lösung von Widersprüchen in der christlichen Lehre. Sein Name stand für die Gefahren, die mit der neuen Wissenschaft verbunden waren, gleichwohl zwang er christliche Theologen und Philosophen mit seinem Denken, die Autorität der Heiligen Schrift mit dem aristotelischen Rationalismus in Einklang zu bringen. Erst um 1270, als Thomas von Aquin eine |363|perfekte Lösung für diese Aufgabe fand, war die christliche Bildung genau so entwickelt und anspruchsvoll wie die der sunnitischen Renaissance.
In diesen Jahrhunderten wurden allerdings nicht nur Ideen und Institutionen aus dem muslimischen Kerngebiet in die christlichen Randgebiete importiert. Europäische Kaufleute machten sich auch selbst in die islamische Welt auf. Die Venezianer, Genuesen und Pisaner konkurrierten mit ihren Kollegen aus Kairo und Palermo um den lukrativen Mittelmeerhandel – kaufend und verkaufend, stehlend und miteinander streitend. Auswanderer aus dem zunehmend übervölkerten Nordwesten halfen den spanischen Christen, die Muslime zurückzudrängen, und im gesamten Mittelmeerraum entfachten die Normannen einen Sturm von Plünderungen und Eroberungen.
Die Normannen waren Abkömmlinge der heidnischen Wikinger aus Skandinavien, die sich im 9. Jahrhundert in fernen nordwestlichen Randgebieten erfolgreich als Räuber betätigt hatten und im 10. ihre Raubzüge in größerem Stil durchführten. Als die mittelalterliche Warmzeit den Nordatlantik befahrbar machte, segelten sie auf ihren Langschiffen nach Island, Grönland und sogar nach Vinland (Nordamerika). Sie siedelten sich in Irland und England an, und in Nordfrankreich, in der heutigen Normandie, wurde ihr Häuptling Rollo, nachdem er sich 912 hatte taufen lassen, zum regelrechten Herzog ernannt.
Um Einzelheiten des christlichen Glaubens kümmerten sich die Normannen nicht sonderlich. So opferten sie 931 zum Beispiel, aus Anlass von Rollos Bestattung, hundert Gefangene. Aber wegen ihres kriegerischen Ungestüms waren sie selbst im fernen Konstantinopel als Söldner beliebt. 1016 wurden sie von beiden Parteien der endlosen Kriege um Süditalien angeheuert, und 1061 schickten sich ihre Kriegerhorden an, einen eigenen Staat zu gründen: Sie drangen in Sizilien ein und rotteten die muslimische Bevölkerung fast vollständig aus. Wer heute Sizilien besucht, wird kaum ein islamisches Bauwerk finden, dabei galt die Insel in den zwei Jahrhunderten der islamischen Herrschaft als Wunder des Mittelmeers.
Die Normannen hegten keine besondere Feindseligkeit gegen den Islam, Christen behandelten sie nicht weniger rücksichtslos. Ein italienischer Schriftsteller nannte sie »eine wilde, barbarische, schreckliche Rasse mit unmenschlichen Zügen«22. Noch entsetzter zeigte sich Anna Komnene, eine byzantinische Prinzessin und Geschichtsschreiberin: »Doch wenn es gilt zu kämpfen und wenn es zur Schlacht kommt, dann sind sie unbesiegbar in ihrer eifernden Wut, und zwar nicht nur der gemeine Soldat, sondern auch ihre Anführer, und wenn sie sich dann mitten in die feindlichen Schlachtreihen stürzen, kann nichts sie aufhalten.«23
Byzanz lernte die Normannen auf die harte Tour kennen. Das Reich hatte sich im 9. und 10. Jahrhundert, als die Muslime begannen, sich gegenseitig zu bekämpfen, wieder etwas erholt. 975 kam eine byzantinische Armee sogar bis auf Sichtweite an Jerusalem heran. Es gelang ihr zwar nicht, die Heilige Stadt einzunehmen, doch konnte sie Jesu Sandalen und das Haar Johannes des Täufers befreien. |364|Dann aber, im folgenden Jahrhundert, machten sich die Byzantiner auf gefährliche Weise abhängig von normannischen Söldnern, deren notorische Unzuverlässigkeit 1071 zu einer katastrophalen Niederlage gegen die Türken beitrug. Als 20 Jahre später Konstantinopel von türkischen Truppen belagert wurde, wandte sich der byzantinische Kaiser hilfesuchend an den Papst in Rom. Der aber hatte anderes im Sinn. Er war darauf erpicht, gegen die Könige Europas seine eigene Position zu stärken, berief 1095 eine Synode ein und verkündete dort seine Vorstellung, mit einer militärischen Expedition – einem Kreuzzug – die Türken aus Jerusalem zu vertreiben.
Damit löste er eine unbeschreibliche Begeisterung aus, heftiger als ihm oder den Byzantinern lieb sein konnte. Zehntausende einfache Leute zogen nach Osten, plünderten Mitteleuropa und massakrierten Juden. Nur wenige erreichten Anatolien, wo die Türken sie niedermachten. Niemand schaffte es bis ins Heilige Land, es sei denn als Sklave.
Mehr Erfolg hatten die drei französischen und normannischen Ritterheere, von Genueser Kaufleuten unterstützt, als sie sich 1099 Jerusalem näherten. Der Zeitpunkt war günstig: Die Seldschuken, völlig in Beschlag genommen von ihren internen Fehden, leisteten kaum Widerstand, und mit einigen tollkühnen Aktionen gelang es den Kreuzfahrern, eine Bresche in Jerusalems Stadtmauer zu schlagen. Zwölf Stunden lang plünderten und mordeten sie auf eine Weise, die selbst die Normannen unter ihnen schockierte, verbrannten Juden bei lebendigem Leib und hackten Muslime in Stücke (immerhin befleißigten sich die Christen, nach Aussage einer Jüdin, wenigstens nicht der türkischen Praxis, ihre Opfer zuerst zu vergewaltigen). Als die Sonne schließlich sank, wateten die Eroberer durch knöcheltiefe Blutlachen zur Grabeskirche, um Gott zu danken.
So spektakulär diese Episode auch sein mochte, eine ernsthafte Bedrohung des islamischen Kerngebiets war sie nicht. Das christliche Königreich Jerusalem erlitt immer neue Niederlagen, bis die Muslime die Stadt 1187 zurückeroberten. Es folgten weitere Kreuzzüge, die meisten scheiterten auf grässliche Weise. Weil sich die Kreuzfahrer keine Schiffe leisten konnten, endete der vierte Zug 1204 damit, dass sich die militanten Christen zu Söldnern venezianischer Geldgeber machen ließen und nicht Jerusalem, sondern Konstantinopel plünderten und besetzten. Weder die Kreuzzugsbewegung noch das Byzantinische Reich erholten sich von dieser Schande.
Unter dem Druck der mittelalterlichen Warmzeit änderte der Westen seine Gestalt. Die muslimischen Länder blieben Kerngebiet; doch die gesellschaftliche Entwicklung in Südwestasien stagnierte, und so verlagerte sich das islamische Gravitationszentrum hin zum Mittelmeer. Und selbst im Mittelmeerraum gab es Gewinner und Verlierer. Ägypten wurde zum muslimischen Kronjuwel; Byzanz, Roms letzter Überrest, ging endgültig seinem Untergang entgegen; und die unzivilisierten, rückständigen Randgebiete im Nordwesten dehnten sich schneller aus als alle anderen.
Die Verhältnisse im östlichen Kerngebiet konnten unterschiedlicher kaum sein. 907 hatte sich das Tang-Reich aufgelöst, schon 960 jedoch wurde China erneut vereinigt. Taizu, der erste Kaiser der neuen Song-Dynastie, war ein hartgesottener Soldat, registrierte aber sehr wohl, dass das Anwachsen wirtschaftlicher und kultureller Bindungen zwischen den chinesischen Regionen in den letzten Jahrhunderten viel dazu beigetragen hatte, dass sich die Eliten China als ein Reich vorstellten und wünschten. Dass kam ihm zupass. Im Unterschied zu früheren Einigungsbestrebungen fügten sich die meisten Staaten nun, ohne dass es zu Kriegen kam, und akzeptierten die Herrschaft der Song.
Taizu erkannte auch, dass es militärische Befehlshaber gewesen waren, die die meisten früheren Dynastien zu Fall gebracht hatten, also entledigte er sich ihrer. Er lud die Feldherren, die ihm auf den Thron verholfen hatten, zu einem Fest und »löste die Macht der Militärs mit einem Becher Wein auf«24, wie es in der offiziellen Geschichtsschreibung heißt. Er brachte einen Trinkspruch auf die Heerführer aus, gratulierte ihnen zur Erreichung des Ruhestands (womit er die Herren überraschte) und entließ sie. Erstaunlicherweise kam Taizu mit diesem unblutigen Coup durch; und von nun an führte er die Armee, wenn nötig, selbst.
Der Wechsel von einer militärischen zu einer zivilen Regierung war ein kluger Schachzug, denn er kam dem weit verbreiteten Wunsch nach Frieden und Einheit sehr entgegen. Der einzige Haken war, dass China noch immer Feinde hatte, besonders zwei halbnomadische Völker, die Kitan und die Tanguten, die jenseits der Nordgrenze Reiche gebildet hatten (Abbildung 7.9). Spannungen mit ihnen ließen sich nicht mit einem Glas Wein lösen, und nachdem die Song eine Armee verloren hatten und beinahe auch ihren Kaiser, besannen sie sich der alten Politik, den Frieden mit Geschenken zu erkaufen.
Bis zu einem gewissen Grad funktionierte diese Methode. Weder die Kitan noch die Tanguten überrannten den östlichen Kern, wie es die Seldschuken im Westen getan hatten. Die Kehrseite allerdings war, dass sich, wie frühere Dynastien auch, die Song mit den Geschenken und Garnisonen, für die sie aufkommen mussten, bald ruinierten, wobei sich der Frieden auch so nicht wirklich sichern ließ. In den 1040er Jahren mussten die Song eine Armee von einer Million Mann unterhalten und jeden Monat einige tausend Rüstungen und Millionen von Pfeilspitzen kaufen – nicht unbedingt das, was Taizu gewollt hatte.
Manche Feldherren hofften, China könne durch Wunderwaffen davor bewahrt werden, in das alte Unentschieden mit den Steppenvölkern zu schlittern. Um 850 hatten daoistische Alchimisten (ausgerechnet bei der Suche nach Elixieren für ein ewiges Leben) eine Rohform des Schießpulvers entdeckt. Auf Malereien aus der Zeit um 950 sind Menschen zu sehen, die sich aus Bambusrohren gegenseitig mit brennendem Pulver bespritzen. Und in einem Militärhandbuch von 1044 wird eine »Feuerdroge« beschrieben, die in Papier oder Bambus eingewickelt war und |366|mit einem Katapult geschleudert wurde. Aber dieses Schießpulver sah gefährlicher aus, als es war, es machte zwar die Pferde scheu, verletzte aber in der Regel niemanden – noch nicht.

Abbildung 7.9: Das antimilitaristische Reich
Die Teilung Chinas zwischen den Staaten der Song, der Kitan und der Tanguten, um 1000. Chinas Hauptkohlenreviere sind mit Punkten markiert.
Da also doch keine technischen Durchbrüche absehbar waren, brauchte die Armee der Song einfach mehr Geld. Hilfe kam von unerwarteter Seite: zum einen von den chinesischen Gelehrten, zum anderen von der prosperierenden Wirtschaft.
Nachdem der turkstämmige Feldherr An Lushan mit seiner Revolte 755 den Untergang der Tang-Dynastie eingeleitet und das Land ins Chaos gestürzt hatte, fror bei vielen Gelehrten der Enthusiasmus für alles Fremde ein. Diese Begeisterung habe China doch nichts weiter gebracht als Unordnung. Die 500 Jahre, die seit dem Fall der Han vergangen waren, erschienen vielen enttäuschten Mitgliedern der Oberschicht nur als barbarisches Zwischenspiel, das die chinesischen Traditionen korrumpiert habe. Der übelste dieser zersetzenden Importe aus dem Ausland sei, so hieß es nun, der Buddhismus.
819 ließ der hohe Beamte, gelehrte Dichter und entschiedene Konfuzianer Han Yu dem Kaiser eine »Denkschrift zu den Knochen des Buddha« zukommen. |367|Ihn erfüllte die Massenhysterie mit Abscheu, die alle 30 Jahre ausbrach, wenn ein angeblicher Fingerknochen Buddhas als Reliquie in feierlicher Prozession in den Kaiserpalast überführt wurde. Daran sehe man doch, dass der Buddhismus nichts weiter sei als ein Kult barbarischer Völker. Damals, in den Zeiten, als der Buddhismus China verführt habe, seien die Beamten nicht imstande gewesen, die »Erfordernisse von Vergangenheit und Gegenwart« völlig zu verstehen und das Land vor verderblichen Einflüssen zu bewahren. Inzwischen aber sei die Wissenschaft viel weiter fortgeschritten. Die Gelehrten müssten nur lernen, so zu denken, zu malen und vor allem so zu schreiben wie die Alten. Dann könnten sie sich die alten Tugenden wieder aneignen und das Land retten. »Das Prosaschreiben muss zum Mittel für den Weg werden«, so Hans dringender Rat. Er selbst tat alles dafür, den schnörkellosen Schreibstil der Han-Dynastie wiederzubeleben.25
Der Schlag gegen den Buddhismus führte zu Protesten – nicht zuletzt der Kaiser reagierte überaus ungehalten und schickte Han in die Verbannung –, war aber auch nicht unwillkommen. Die buddhistischen Klöster hatten enorme Reichtümer angehäuft, und als Kaiser Wuzong in den 840er Jahren hart gegen den Buddhismus durchgriff – indem er den Mönchen ihr geistliches Amt entzog, Klöster schloss und ihre Schätze konfiszierte –, werden ihn dazu eher finanzielle Nöte als das Wettern der Gelehrten bewogen haben. Die offizielle Verfolgung verhalf den Ansichten, die Han Yu vertreten hatte, zu einiger Anerkennung. Zwar blieben Millionen Chinesen Buddhisten, aber noch mehr Tang-Untertanen verfielen in Zweifel über diese importierte Religion. Sie konnten der Möglichkeit, dass die Antworten auf Buddhas große Fragen – Was ist das wirkliche Ich? Wie passe ich ins Universum? – in ihren konfuzianischen Klassikern verborgen lagen und nur herausgeholt werden mussten, immer mehr abgewinnen.
Eine »neokonfuzianische« Bewegung ergriff die Oberschicht, und in Chinas Stunde der Not, als die Kitan und Tanguten ins Land drängten, taten es die besten Köpfe des Reiches Konfuzius nach und stellten sich dem Herrscher als Berater zur Verfügung. Vergiss Wiedergeburt und Unsterblichkeit, sagten sie, das Hier und Jetzt ist alles, und Erfüllung kommt durch Handeln in der Welt. »Der wahre Gelehrte«, heißt es bei einem von ihnen, »sollte der Erste sein, der sich um die Probleme der Welt sorgt, und der Letzte, der ihre Freuden genießt.«26
Die Neokonfuzianer machten aus den klassischen Studien ein Programm zur Perfektionierung der Gesellschaft. Männer mit den zum Verständnis der alten Kultur notwendigen philologischen und künstlerischen Fähigkeiten sollten die althergebrachten Tugenden nutzen, um die moderne Welt zu retten. Dutzende von Gelehrten boten dem Kaiser ihre Dienste an. Der bemerkenswerteste war Wang Anshi, ein bekannter Dichter, Philosoph und Kanzler. Seine vielen Feinde trieben ihn am Ende ins Exil und Unglück, doch seine radikale »Neue Politik« – eine Elfte-Jahrhundert-Version von New Deal und Reaganomics in einem – verschaffte dem Staatshaushalt etwas Erleichterung. Wang ersann ein neues, gerechteteres Steuersystem, indem er für die Kleinbauern die Steuerquote senkte, aber |368|die Steuerpflicht erweiterte, sodass sich die Einnahmen insgesamt erhöhten. Er finanzierte große öffentliche Arbeiten und regte das Wachstum mit »Grünen-Schössling-Krediten« an, die er an Bauern und kleine Kaufleute ausgeben ließ. Und er glich den Haushalt aus, indem er die teuren Berufssoldaten durch billigere Milizen ersetzte. Den konservativen Beamten ging das gegen den Strich; erhoben sie Einwände, wurden sie entlassen. Wang machte Wirtschaft, Geographie und Recht zu Gegenständen der Beamtenprüfungen und hob die Gehälter derjenigen an, die sie bestanden.
Bedeutsam, wie die Errungenschaften der Neokonfuzianer auch waren, erscheinen sie doch geradezu als belanglos, wenn man sie mit einer zweiten Entwicklung vergleicht, die sich gleichzeitig abspielte – eine wirtschaftliche Explosion, die es mit der des alten Rom aufnehmen konnte. Die mittelalterliche Warmzeit erwies sich für fast ganz China als Segen. Seesedimente, die Chemie der Stalagmiten und schriftliche Dokumente lassen vermuten, dass es im halbtrockenen Norden mehr regnete, was den Bauern dort sehr gelegen kam, während der feuchte Süden weniger Niederschläge zu verzeichnen hatte, auch das zur Freude der Bauern dieser Region. Bis 1100 wuchs die chinesische Bevölkerung auf etwa 100 Millionen Menschen.
Um 1100 waren alle 37 Reissorten, die in den Wesentlichen Methoden der einfachen Leute aus dem 6. Jahrhundert erwähnt wurden, durch ertragreichere Sorten ersetzt worden, und die Bauern erzielten mit ihren bewässerten und gedüngten Feldern regelmäßig drei Ernten, indem sie im Wechsel Reis und Weizen anbauten. Ein wachsendes Netz von Straßen – in den Städten häufig mit Steinen und selbst auf dem Land manchmal mit Ziegeln gepflastert – erleichterte es, die Ernten zu den Häfen zu bringen; auch der Transport zu Wasser erlebte weitere Verbesserungen. Chinesische Schiffsbauer übernahmen die besten Eigenschaften persischer, arabischer und südostasiatischer Wasserfahrzeuge und bauten große hochseetüchtige Dschunken mit Schotten, mit vier, manchmal sogar sechs Masten und bis zu tausend Mann starken Besatzungen. Die Frachtkosten verminderten sich drastisch, und die Kaufleute stellten sich organisatorisch auf Großhandel um. In einem Text aus dem 12. Jahrhundert heißt es:
Die Flüsse und Seen sind miteinander verbunden, sodass man mit ihrer Hilfe überallhin gelangen kann. Verlässt ein Schiff seinen Heimathafen, hindert es nichts daran, auf eine Reise von 10 000 Li [knapp 5000 Kilometer] zu gehen. Jedes Jahr nutzen die einfachen Leute alles Getreide, das sie nicht für die Saat und ihre Nahrung brauchen, zu Handelszwecken. Großkaufleute tragen zusammen, was die kleineren Haushalte haben. Kleine Boote sind angewiesen auf größere Schiffe und arbeiten mit ihnen zusammen, sie fahren hin und her und verkaufen Getreide mit solidem Gewinn.27
Fast so wichtig wie die Dschunken waren Transportmakler, Mittelsmänner, die Frachten kauften und lagerten, Darlehen vergaben und die Schiffe schnell wieder zurückschickten. All das verlangte Münzgeld, und als die Wirtschaft wuchs, hatte |369|die Regierung Mühe, genug Bronzemünzen zu prägen. Heroische Anstrengungen, neue Kupfervorkommen zu finden (und weniger heroische, indem die Münzen durch Zusatz von Blei in ihrem Wert gemindert wurden), führten dazu, dass die Produktion von 300 Millionen Münzen im Jahr 983 auf 1,83 Milliarden im Jahr 1007 hochschnellte, und noch immer übertraf die Nachfrage den Nachschub.
Gier und Faulheit sorgten auch hier für die rettende Lösung. Als der Teehandel im 9. Jahrhundert einen gewaltigen Aufschwung erlebte und die staatliche Überwachung des Handels nachließ, gründeten Händler aus Sichuan Büros in Chang’an, wo sie die Münzen, die sie für ihren Tee bekamen, gegen »fliegendes Geld« – Kreditbriefe aus Papier – eintauschen konnten. Nach Sichuan zurückgekehrt, konnten die Händler diese Kreditbriefe im Hauptbüro der Gesellschaft in Bargeld zurücktauschen. Nimmt man an, eine Tasche voll fliegenden Geldes sei 40 Taschen voller Bronzemünzen wert gewesen, dann leuchten die Vorteile auf Anhieb ein. Alsbald gebrauchten die Kaufleute Kreditbriefe wie richtiges Geld. Damit war das Kreditgeld erfunden – Gutscheine, deren Wert auf Vertrauen beruhte und nicht auf ihrem Metallgehalt. 1024 ging der Staat den logisch nächsten Schritt und druckte Banknoten aus Papier. Binnen kurzem waren mehr Werte in Banknoten in Umlauf als in Münzen.
Als Papiergeld und Kreditwesen auch jenseits der Städte Fuß fassten und den Handel erleichterten, bauten immer mehr Bauern auf ihrem Land an, was am besten gedieh, verkauften es gegen Bargeld und kauften, was sie selbst nicht so ohne weiteres herstellen konnten. Ein buddhistischer Mönch beschrieb einen kleinen Markt in einem entlegenen Dorf:
Die Morgensonne steht noch nicht über dem See,
Für den Moment erscheinen Brombeerhecken wie Tore aus Kiefernholz.
Uralte Bäume tauchen die steilen Klippen in düsteres Licht.
Die traurigen Rufe der Affen treiben hinunter.
Der Pfad macht eine Biegung, es öffnet sich ein Tal,
In der Ferne kaum sichtbar ein Dorf.
Den Weg entlang ziehen, rufend und lachend,
Landarbeiter, schneller mal die einen, dann wieder die anderen,
Ein paar Stunden ihr Geschick auf dem Markt zu messen.
Buden und Läden sind zahllos wie Wolken.
Sie bringen Leinen und Maulbeerpapier,
Oder treiben Junghennen und Ferkel vor sich her.
Bürsten und Kehrschaufeln, so oder so gestapelt –
Zu viele Haushaltssachen, um alle zu nennen.
Ein älterer Mann kontrolliert den geschäftigen Handel,
Alle beachten sie seine kleinsten Anweisungen.
Höchst sorgfältig vergleicht er
Jeden einzelnen Maßstab
Und dreht ihn langsam in seiner Hand.28
|370|Städtische Märkte waren natürlich ungleich großartiger, zum Teil bezogen sie ihre Waren von Lieferanten eines halben Kontinents. Südostasiatische Kaufleute verbanden den Hafen von Quanzhou mit indonesischen Gewürzinseln und den Reichtümern des Indischen Ozeans, die Einfuhren gelangten von dort in alle Städte des Reiches. Um sie zu bezahlen, stellten Familienbetriebe Seide, Porzellan, Lackarbeiten und Papier her, und die erfolgreichsten der kleinen Betriebe wuchsen zu Fabriken. Selbst Dorfleute konnten kaufen, was früher Luxus war, zum Beispiel Bücher. Relativ billig, mit Holztafeln gedruckt, verließen sie in den 1040er Jahren in Millionen Exemplaren die Druckereien. Die Zahl der Lese- und Schreibkundigen entsprach gewiss der im römischen Italien tausend Jahre zuvor.
Zu den bedeutendsten Veränderungen jedoch kam es in der Textilproduktion und der Kohleförderung – genau jenen Branchen, die den Anstoß gaben für die industrielle Revolution im England des 18. Jahrhunderts. Die Weber des 11. Jahrhunderts erfanden eine von Pedalen angetriebene Haspelmaschine für Seide. 1313 berichtete der Gelehrte Wang Zhen in einem Traktat über die Landwirtschaft von einer großen Vorrichtung zum Spinnen von Hanf, die, mit Tier- und Wasserkraft betrieben, »mehrfach billiger« sei »als die Frauen, die sie ersetzte«; in Gebrauch waren diese Maschinen »in allen Teilen Nordchinas …, wo Hanf verarbeitet wird«.
Der Wirtschaftshistoriker Mark Elvin hat französische Pläne für eine Flachsspinnmaschine aus dem 18. Jahrhundert mit Wangs Modell aus dem 14. Jahrhundert verglichen und war völlig verblüfft über die Ähnlichkeit beider. Unausweichlich dränge sich der Verdacht auf, »der französische Entwurf sei letztlich chinesischen Ursprungs«. Wohl sei Wangs Maschine nicht so leistungsfähig gewesen wie die französische, »aber wenn der Fortschritt, den sie repräsentierte, ein bisschen weitergetrieben worden wäre, hätte China auf dem Gebiet der Textilproduktion 400 Jahre vor dem Westen eine wirkliche industrielle Revolution erlebt«29.
Statistiken über die Textilproduktion und -preise in der Song-Ära sind nicht überliefert, wir können diese Mutmaßung also nicht ohne weiteres überprüfen. Allerdings haben wir Informationen über eine andere, nämlich die Eisenindustrie. Einschlägigen Steuererklärungen lässt sich entnehmen, dass sich die Herstellung von Eisen zwischen 800 und 1078 auf ungefähr 125 000 Tonnen versechsfachte – fast die Menge, die in ganz Europa um 1700 produziert wurde.
Die Eisenwerke gruppierten sich um ihren Hauptmarkt, die Millionenstadt Kaifeng, Provinz Henan, wo (unter anderem) die zahllosen Waffen gegossen wurden, die die Armee brauchte. Kaifeng, wegen seiner Lage am Gelben Fluss inzwischen zur Hauptstadt gekürt, war vor allem ein Produktionsstandort. Die Stadt hatte keine Geschichte, keine von Bäumen gesäumten Boulevards, nicht die zierlichen Paläste früherer Hauptstädte, inspirierte auch keine große Dichtung. Im 11. Jahrhundert aber wuchs sie zu einer übervölkerten, chaotischen und pulsierenden Metropole heran. In ihren lärmenden Schenken wurde bis zum frühen Morgen Wein serviert, 50 Theater zogen jeweils Tausende von Zuschauern an, |371|und selbst entlang der einen großen Prozessionsstraße öffneten immer mehr Läden. Vor den Stadtmauern brannten die Schmelzöfen Tag und Nacht, dunkle Fabriken spuckten Feuer und Rauch, schluckten Bäumen zu Zehntausenden, um Erz zu Eisen zu schmelzen – so viele Bäume, dass Eisenfabrikanten ganze Berge aufkauften, abholzen ließen und den Preis für Holzkohle in die Höhe trieben. Gewöhnliche Hausbesitzer konnten da nicht mehr mithalten. 1013 brachen Brennstoffaufstände aus, bei denen frierende Bewohner Kaifengs zu Hunderten niedergetrampelt wurden.
Kaifeng geriet offensichtlich in einen ökologischen Engpass. Es gab in Nordchina einfach nicht genug Wald, um Millionen Menschen mit Nahrung und Wärme zu versorgen und zugleich Gießereien zu unterhalten, die tausende Tonnen Eisen ausstießen. Da blieben nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Menschen und/oder die Industrien würden abwandern – oder es würden sich ganz neue Brennstoffquellen finden.
Homo sapiens hat immer von Pflanzen und Tieren gelebt, denen er Nahrung, Kleidung, Brennstoff und Unterkunft abgewinnen konnte, und mit der Zeit ist er zu einem immer effizienteren Parasiten geworden. So verbrauchten die Untertanen des Han- und des Römischen Reiches in den ersten Jahrhunderten u. Z. sieben- oder achtmal so viel Energie pro Person wie ihre Vorfahren in der Eiszeit, 14 000 Jahre zuvor.1* Han und Römer hatten zudem gelernt, Mühlen mit Wasserkraft und Schiffe mit Wind anzutreiben, was einen großen Schritt über die energetische Nutzung von Pflanzen und Tieren hinausging. Aber die frierenden Menschen in Kaifeng, die 1013 auf die Barrikaden gingen, lebten noch immer vor allem von anderen Organismen, nahmen in der Großen Kette der Energie einen kaum höheren Platz ein als die Jäger und Sammler der Steinzeit.
Innerhalb weniger Jahrzehnte änderte sich das, und ohne es zu wissen oder zu wollen, wurden Kaifengs Eisenfabrikanten zu Revolutionären. Als die gefräßigen Schmieden miteinander sowie mit Häusern und Herdstellen um Brennmaterial konkurrierten, stießen die Industriellen die Tür zwischen der alten organischen Ökonomie und der neuen Welt fossiler Brennstoffe auf. Kaifeng lag in der Nähe von zwei der größten Kohlenreviere Chinas (Abbildung 7.9), die über den Gelben Fluss leicht zu erreichen waren. Es brauchte also keinen großen Erfindungsgeist – nur Gier und Verzweiflung, Versuch und Irrtum –, um herauszufinden, wie man Stein- anstelle von Holzkohle nutzen konnte, um Eisenerz zu schmelzen.
Ein um 1080 verfasstes Gedicht vermittelt einen Eindruck von den damaligen Veränderungen. Die erste Strophe beschreibt eine Frau, die so verzweifelt auf der Suche nach Brennstoff ist, dass sie ihren Körper gegen Feuerholz verkauft, die zweite |372|eine Kohlengrube, die Rettung verspricht, die dritte einen großen Schmelzofen und die vierte die Erleichterung, dass die Leute jetzt genug zu essen haben. Nun lassen sich große Eisenschwerter schmieden, ohne dass dafür die Wälder draufgehen.
Hast du sie nicht gesehen
Letzten Winter, als Regen und Schnee die Reisenden aufhielten
Und der Wind an den Knochen der Stadtbewohner zerrte?
Ein halbes Bündel nasses Feuerholz, ihr Bettzeug bis zum Morgen erduldend2*, Im Zwielicht klopfte sie ans Tor, ihr Gewerbe mochte niemand.
Wer hätte gedacht, dass in diesen Bergen ein Schatz versteckt liegt,
Zuhauf, wie schwarze Juwelen, zehntausend Wagenladungen Kohle.
Gnade und Gunst im Überfluss, von denen niemand wusste.
Der üble Hauch der Öfen – zhenzhen3*– verzieht sich.
Ist ein Anfang erst gemacht, wird er unermesslich ohne Grenzen.4*
Zehntausend Männer mühen sich, tausend haben die Aufsicht.
Wird Erz in den brodelnden Fluss geworfen, wird er noch heller,
Reich fließende Jade und Gold, seine kraftvolle Stärke.
Jetzt, in den Südlichen Bergen, atmen Kastanienwälder auf,
Kein Zwang in den Nördlichen Bergen, das harte Erz zu hämmern.
Gießen werden sie dein Schwert, hundertfach verfeinert,
Um den dicken Fisch von Banditen in Stücke zu hauen.30
Kohle und Eisen hoben gemeinsam ab. Eine gut dokumentierte Gießerei beschäftigte 3000 Arbeiter, die pro Jahr 35 000 Tonnen Erz und 42 000 Tonnen Kohle in die Öfen schaufeln mussten, um 14 000 Tonnen Roheisen zu gewinnen. Um 1050 wurde so viel Kohle gefördert, dass auch private Haushalte sie nutzen konnten, und als die Regierung 1098 ihre Armenfürsorge überdachte, war Kohle der einzige Brennstoff, den die Beamten für erwähnenswert hielten. Zwanzig neue Kohlemärkte wurden zwischen 1102 und 1106 in Kaifeng eröffnet.
Um diese Zeit hatte die gesellschaftliche Entwicklung im Osten einen dem alten Rom tausend Jahre zuvor entsprechenden Höhepunkt erreicht. Der in muslimisches Kerngebiet und christliche Peripherie zersplitterte Westen war nun weit abgeschlagen. Erst im 18. Jahrhundert, als in England die industrielle Revolution einsetzte, sollte er dieses Niveau gesellschaftlicher Entwicklung wieder erreichen. Alles deutet darauf hin, dass sich innerhalb von Kaifengs rußgeschwärzten Mauern eine chinesische industrielle Revolution zusammenbraute, die den Osten mit seinem gewaltigen Entwicklungsvorsprung würde die Welt regieren lassen. Die Geschichte schien den Weg zu nehmen, der Albert nach Bejing und nicht Looty nach Balmoral geführt hätte.