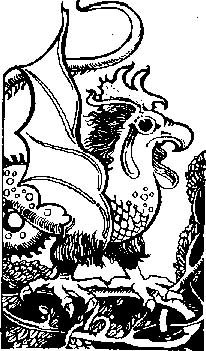
9 Der Verwandler
Bink wurde in eine Grube geworfen. Ein Heuhaufen dämpfte seinen Aufprall, und ein hölzernes Dach, das auf vier hohen Pfählen ruhte, schützte ihn vor der Sonne. Ansonsten war sein Gefängnis kahl und leer. Die Wände bestanden aus etwas Steinartigem, das zu hart war, als daß man mit bloßen Händen hätte hineingraben können; sie waren auch zu steil, um daran emporzuklettern. Der Boden bestand aus gestampfter Erde.
Er schritt die Grube ab. Die Wand war ringsherum undurchdringlich und zu hoch zum Erklimmen. Wenn er emporsprang, dann konnte er den oberen Rand beinahe berühren, doch ein Metallgitter versperrte den Ausgang nach oben. Wenn er sich anstrengte, dann könnte er vielleicht einen der Stäbe ergreifen, doch dann würde er nur in der Luft hängen. Es mochte vielleicht eine ganz gute Körperübung sein, aber zur Flucht konnte sie ihm nicht verhelfen. Also war der Käfig wirklich geschlossen und dicht.
Kaum war er zu diesem Schluß gekommen, als Soldaten an das Gitter traten und der Rost auf ihn herab rieselte. Sie stellten sich in den Schatten des Dachs, während einer von ihnen sich
niederkauerte, um die kleine Öffnung im Gitter aufzuschließen und zu öffnen. Dann warfen sie noch jemanden zu ihm hinab.
Es war Fanchon.
Bink sprang vor und fing sie in seinen Armen auf, bevor sie auf dem Stroh aufprallte, und pufferte dadurch ihren Sturz. Zusammen fielen sie ins Heu. Über ihnen wurde die Tür im Gitter wieder zugeschlagen, und das Schloß rastete ein.
»Na, daß dich meine Schönheit nicht gerade so betört hat, weiß ich eigentlich«, bemerkte sie, als sie voneinander losließen.
»Ich hatte Angst, Sie könnten sich ein Bein brechen«, erwiderte Bink. »Als ich hier hinuntergeworfen wurde, da wäre das auch fast passiert.«
Sie blickte zu ihren knorpeligen Knien hinab. »Könnte dem Aussehen meiner Beine auch nicht weiter schaden.«
Das war nicht verkehrt. Noch nie hatte Bink ein häßlicheres Mädchen gesehen.
Aber was tat sie hier? Warum warf der Böse Magier seinen Lockvogel zusammen mit seinem Gefangenen in die Grube? So konnte man den Gefangenen doch nicht zum Reden bringen! Er hatte Bink vielmehr erzählen müssen, daß Fanchon geredet hätte, um ihn aufzufordern, ihre Information zu bestätigen. Selbst wenn sie wirklich eine Gefangene sein sollte, dann hätte man sie getrennt voneinander einsperren müssen. Dann könnten die Wächter jedem der beiden erzählen, der andere habe ausgepackt.
Wenn sie wenigstens schön gewesen wäre, dann hätten sie ja vielleicht darauf hoffen können, daß sie ihn mit weiblichen Waffen zum Reden bringen würde, aber zu dieser Hoffnung bestand ja nun wirklich nicht die geringste Veranlassung. Das alles ergab keinen Sinn.
»Warum haben Sie ihm nicht von dem Schildstein erzählt?« fragte Bink, ohne sich über die Art seiner eigenen Ironie völlig im klaren zu sein. Wenn sie nur spielte, dann konnte sie nichts verraten haben – aber dann hätte man sie auch nicht hier
hinunterwerfen dürfen. Wenn sie echt war, dann mußte sie Xanth treu sein. Aber warum hatte sie dann gesagt, daß sie den Standort des Schildsteins verraten wolle?
»Ich habe es ihm gesagt«, erwiderte sie.
Sie hatte es ihm gesagt? Jetzt hoffte Bink inständig, daß sie nicht echt war.
»Ja«, antwortete sie und sah ihm geradewegs dabei in die Augen. »Ich habe ihm gesagt, daß er sich unter dem Thron im Königspalast im Norddorf befindet.«
Bink versuchte, diese Aussage richtig einzuschätzen. Es war der falsche Ort – aber wußte sie das auch? Oder versuchte sie nur, ihn zu einer Reaktion zu überlisten, zu einer Preisgabe der begehrten Information, während die Wächter ihrem Gespräch lauschten? Oder war sie wirklich eine Verbannte, die den Standort kannte und gelogen hatte? Das würde Trents Reaktion erklären. Denn wenn Trents Katapult eine Elixierbombe auf den Palast von Xanth warf, dann würde er nicht nur den Schild verfehlen, sondern den König aufschrecken – oder zumindest die wacheren Minister, die keine Narren waren –, so daß sie merkten, mit welcher Bedrohung sie es zu tun hatten. Wenn die Magie dort in der unmittelbaren Umgebung gedämpft oder neutralisiert wurde, dann würden sie schon wissen, was gespielt wurde.
Hatte Trent etwa seine Bombe bereits geschleudert und nun alle Hoffnung, nach Xanth einzufallen, verloren? Sobald man dort wußte, welche Gefahr drohte, würde man den Schildstein an einen anderen geheimen Ort schaffen, so daß keine Informationen, die Trent von Exilanten erhielt, wirklich zuverlässig sein konnten. Nein, wenn das passiert wäre, dann würde Trent Fanchon in eine Kröte verwandeln und auf ihr herumtrampeln. Und er würde sich auch nicht länger mit Bink abgeben. Man würde ihn töten oder freilassen, aber nicht weiterhin gefangenhalten. Also war nichts derart Drastisches geschehen. Außerdem war dafür noch gar nicht genügend Zeit verstrichen.
»Ich sehe, daß du mir nicht traust«, bemerkte Fanchon.
Eine zutreffende Beobachtung. »Das kann ich mir nicht leisten«, gab er zu. »Ich will nicht, daß Xanth etwas zustößt.«
»Warum sollte es dir etwas ausmachen, wo sie dich doch rausgeworfen haben?«
»Ich kannte die Regel. Ich hatte einen fairen Prozeß.«
»Einen fairen Prozeß!« rief sie wütend. »Der König hat ja nicht mal Humfreys Nachricht gelesen oder das Wasser vom Quell des Lebens probiert!«
Bink schwieg. Woher konnte sie das erfahren haben?
»Ach, hör doch auf!« sagte sie. »Ich bin nur wenige Stunden nach deinem Prozeß durch dein Dorf gekommen. Alle haben darüber geredet. Wie der Magier Humfrey deine Magie bestätigt hat, der König aber…«
»Schon gut, schon gut«, erwiderte Bink. Sie kam also offenbar wirklich aus Xanth, aber er wußte trotzdem nicht, inwieweit er ihr trauen konnte. Und doch mußte sie ja dann den Standort des Schilds kennen und hatte ihn nicht verraten. Es sei denn, daß sie ihn verraten hatte und Trent ihr nicht glaubte. Dann würde er wohl nun darauf warten, daß Bink mit ihm zusammenarbeitete. Aber sie hatte den falschen Ort angegeben. Das war sinnlos. Bink könnte ihre Aussage anfechten, ohne den richtigen Ort zu erwähnen. Es gab Tausende von möglichen Standorten. Also meinte sie es wohl ernst: Sie hatte versucht, Trent hinters Licht zu führen, und war gescheitert.
Die Waagschale in Binks Geist senkte sich nun zur anderen Seite. Jetzt glaubte er, daß sie wirklich aus Xanth war und ihr Land nicht verraten hatte. Darauf deutete das bisher vorhandene Beweismaterial hin. Wie raffiniert konnte Trent wohl vorgehen? Vielleicht besaß er ja eine mundanische Maschine, die irgendwie Nachrichten hinter dem Schild abfangen konnte. Oder er hatte, was wahrscheinlicher war, einen magischen Spiegel innerhalb der Randzone vor dem Schild aufgestellt, um auf diese Weise Nachrichten in Erfahrung zu bringen. Nein – in diesem Fall hätte er direkt vom Standort des Schildsteins erfahren.
Bink schwindelte. Er wußte nicht, was er glauben sollte. Aber den Standort würde er auf keinen Fall preisgeben.
»Ich bin nicht ins Exil verbannt worden, falls du das gedacht haben solltest«, sagte Fanchon. »Man verbannt die Leute doch nicht, weil sie häßlich sind. Ich bin freiwillig gegangen.«
»Freiwillig? Aber warum denn?«
»Na, ich hatte zwei Gründe.«
»Was für Gründe?«
Sie blickte ihn an. »Ich fürchte, du würdest keinen von beiden glauben.«
»Versuch’s doch mal.«
»Zunächst: Der Magier Humfrey hat mir gesagt, daß das die
einfachste Lösung für mein Problem wäre.«
»Was für ein Problem?« Gutgelaunt war Bink nicht gerade.
Sie blickte ihn noch einmal direkt an. Es war schon fast ein Starren. »Soll ich es Wort für Wort erklären?«
Bink merkte, wie er errötete. Ihr Problem bestand offensichtlich in ihrem Aussehen. Fanchon war eine junge Frau, aber sie war nicht schlicht oder farblos, sie war häßlich, der lebende Beweis dafür, daß Jugend und Gesundheit nicht unbedingt dasselbe waren wie Schönheit. Keine Kleidung, keine Schminke würde daran wirklich etwas ändern können, das konnte nur die Magie. Weshalb ihre Ausreise aus Xanth unsinnig war. War ihr Verstand ebenso verformt wie ihr Körper?
Er mußte das Thema wechseln und konzentrierte sich auf einen Teil dieses Gedankengangs. »Aber in Mundania gibt es doch keine
Magie.«
»Eben.«
Wieder rebellierte sein Sinn für Logik. Mit Fanchon zu reden war genauso schwierig, wie sie unbefangen anzusehen. »Du meinst, daß die Magie dich zu… zu dem macht, was du bist?« Wie taktvoll er doch vorging!
Doch sie verhöhnte ihn nicht. »Ja, mehr oder weniger.«
»Warum hat Humfrey dir nicht… den üblichen Lohn abverlangt?«
»Er konnte meinen Anblick nicht ertragen.«
Das wurde ja immer schlimmer! »Ah… und was war dein zweiter
Grund, Xanth zu verlassen?«
»Das sage ich dir nicht jetzt.«
Das ergab Sinn. Sie hatte gesagt, daß er ihr ihre Gründe nicht abnehmen würde, und den ersten hatte er geglaubt. Also wollte sie ihm den anderen nicht sagen. Typisch weibliche Logik!
»Na, sieht so aus, als wären wir zusammen Gefangene«, sagte Bink und blickte sich wieder in der Grube um. Alles sah noch genauso trostlos aus wie vorher. »Meinst du, daß man uns was zu essen geben wird?«
»Bestimmt«, meinte Fanchon. »Trent wird vorbeikommen und uns etwas Wasser und Brot vor die Nase baumeln und fragen, wer von uns ihm die Information geben will. Der bekommt dann etwas zu essen. Mit der Zeit wird es immer schwieriger, es ihm abzuschlagen.«
»Du begreifst aber schauderhaft schnell!«
»Ich bin ja auch schauderhaft schlau«, meinte sie. »Man kann mit Fug und Recht behaupten, daß ich genauso klug bin wie häßlich.«
In der Tat. »Bist du auch schlau genug, dir etwas auszudenken, wie wir hier herauskommen?«
»Nein, ich glaube nicht, daß eine Flucht möglich ist«, sagte sie und nickte entschieden.
»Oh«, sagte Bink etwas verwirrt. Ihre Worte sagten nein, ihre Geste aber ja. War sie verrückt? Nein, sie wußte nur, daß die Wächter ihnen zuhörten, auch wenn sie nicht zu sehen waren. Also übermittelte sie ihnen eine Botschaft, während sie Bink eine andere mitteilte. Was bedeutete, daß sie bereits einen Fluchtplan parat hatte.
Es war jetzt Nachmittag. Ein Sonnenstrahl ergoß sich durch das Gitter am Dachrand vorbei in die Grube. Das war auch ganz gut so, dachte Bink. Wenn die Sonne hier niemals eindränge, dann würde es unerträglich feucht und muffig werden.
Trent trat an das Gitter. »Ich nehme an, daß Sie sich inzwischen miteinander bekannt gemacht haben?« fragte er freundlich. »Haben Sie schon Hunger?«
»Jetzt kommt’s«, murmelte Fanchon.
»Ich muß mich für den Zustand Ihres Quartiers entschuldigen«, sagte Trent und kauerte sich mit vollkommener Eleganz nieder. Es war, als empfinge er sie in einem ordentlichen Büro. »Wenn Sie mir beide Ihr Wort geben, daß Sie das Gelände nicht verlassen oder sich sonst irgendwie in unsere Vorhaben und unseren Betrieb einmischen, dann lasse ich Ihnen ein bequemes Zelt richten.«
»Das ist Subversion«, sagte Fanchon zu Bink. »Wenn du erst einmal ein paar Gefallen angenommen hast, dann bist du auch verpflichtet. Tu’s nicht.«
Sie hatte wirklich erstaunlich recht. »Da wird nichts draus«, sagte Bink.
»Sehen Sie«, fuhr Trent gelassen fort, »wenn Sie in einem Zelt wären und versuchen sollten zu entkommen, dann müßten meine Wächter Pfeile in Sie hineinschießen, und das möchte ich nicht. Für Sie wäre das recht unangenehm, und mich würde es meiner Informanten berauben. Also ist es unvermeidlich, daß Sie auf die eine oder andere Weise gefangengehalten werden. Entweder durch das Ehrenwort oder durch die Fessel, wenn ich es einmal so ausdrücken darf. Der einzige Vorteil dieser Grube besteht darin, sicher zu sein.«
»Sie könnten uns jederzeit gehenlassen«, erwiderte Bink. »Denn Ihre Information bekommen Sie sowieso nicht.«
Wenn diese Bemerkung den Bösen Magier ärgerte, dann ließ er es sich jedenfalls nicht anmerken. »Hier sind etwas Wein und
Kuchen«, sagte Trent und ließ ein Paket an einer Kordel zu ihnen hinab. Weder Bink noch Fanchon griffen danach, obwohl Bink plötzlich sehr hungrig und durstig war. Der würzige Geruch drang verführerisch durch die Grube. Es waren offenbar gute, frische Lebensmittel in dem Paket.
»Bitte nehmen Sie es«, sagte Trent. »Ich versichere Ihnen, daß nichts davon vergiftet oder mit Drogen versetzt ist. Ich möchte, daß Sie beide bei bester Gesundheit bleiben.«
»Damit Sie uns in Kröten verwandeln können?« fragte Bink laut. Was hatte er schon noch zu verlieren?
»Nein, leider haben Sie diesen Bluff durchschaut. Kröten sprechen nicht sonderlich verständlich, und es ist wichtig für mich, daß Sie das tun.«
Konnte es sein, daß der Böse Magier während seines langen Aufenthalts in Mundania sein Talent eingebüßt hatte? Bink fühlte sich schon wohler in seiner Haut.
Das Paket berührte das Heu. Fanchon zuckte mit den Schultern, kauerte sich nieder und öffnete es. Tatsächlich – Wein und Kuchen. »Vielleicht ist es besser, wenn einer von uns zuerst ißt«, meinte sie. »Wenn dann die nächsten paar Stunden nichts passiert, dann ißt der andere auch.«
»Ladies first«, sagte Bink. Wenn das Essen vergiftet und sie eine Spionin war, dann würde sie es nicht anrühren.
»Danke.« Sie teilte den Kuchen. »Such dir ein Stück aus«, sagte sie.
»Du ißt dieses da«, sagte Bink und zeigte darauf.
»Sehr schön«, sagte Trent über ihnen. »Sie trauen sich weder gegenseitig noch mir. Also sind Sie dabei, Regeln zu entwickeln, die Ihre jeweiligen Interessen schützen sollen. Aber das ist wirklich nicht notwendig. Wenn ich einen von Ihnen vergiften wollte, dann würde ich ihm das Gift einfach auf den Kopf träufeln.«
Fanchon biß ein Stück von dem Kuchen ab. »Schmeckt sehr gut«, sagte sie. Sie entkorkte den Wein und nahm einen Schluck. »Der auch.«
Doch Bink blieb mißtrauisch. Er würde warten.
»Ich habe über Sie nachgedacht«, sagte Trent. »Fanchon, ich will offen mit Ihnen reden. Ich kann Sie in jedes andere Lebewesen verwandeln, auch in einen anderen Menschen.« Er blinzelte sie von oben an. »Wie würde es Ihnen gefallen, schön zu sein?«
Oh! Wenn Fanchon keine Spionin war, dann war das ein verlockendes Angebot. Wenn aus häßlich schön werden könnte…
»Hauen Sie ab!« erwiderte Fanchon. »Sonst werfe ich noch mit einem Schlammkloß nach Ihnen.« Doch dann überlegte sie sich etwas. »Wenn Sie uns wirklich hier unten lassen wollen, dann sorgen Sie wenigstens für sanitäre Anlagen. Ein Eimer und ein Vorhang. Wenn ich einen hübschen Hintern hätte, dann würde es mir nichts ausmachen, nicht ungestört zu sein, aber so, wie die Dinge stehen, ziehe ich es vor, sittsam zu bleiben.«
»Gut formuliert«, sagte Trent. Er machte eine Handbewegung, und die Wächter ließen die geforderten Gegenstände durch die Öffnung in die Grube hinunter. Fanchon stellte den Eimer in eine Ecke, entfernte Nadeln aus ihrem drahtigen Haar und befestigte den Stoff an zwei Wänden, so daß eine dreieckige Kammer entstand. Bink begriff nicht, weshalb ein Mädchen ihres Aussehens solch einen Aufwand um ihr Schamgefühl betrieb. Es würde doch keiner ihr nacktes Fleisch anstarren, egal, wie gerundet es sein mochte. Es sei denn, daß sie außerordentlich empfindlich war und mit ihren lockeren Bemerkungen darüber hinwegtäuschen wollte. In dem Fall ergab das dann doch Sinn. Ein hübsches Mädchen würde sich schockiert geben, wenn man ihren nackten Oberkörper sah, doch insgeheim würde sie sich freuen, wenn die Reaktion schmeichelhaft war. Fanchon war nicht so eingebildet.
Sie tat ihm leid und er sich selbst auch. Seine Haft wäre sicherlich angenehmer, wenn seine Gefährtin optisch etwas ansprechender wäre. Doch auf der anderen Seite war er auch ganz
dankbar für ein wenig Privatsphäre. Es wäre sonst peinlich, seinen natürlichen Bedürfnissen nachzugeben. Jetzt war er also im Kreis gegangen, und sie hatte das Problem bereits formuliert, bevor er überhaupt angefangen hatte, darüber nachzudenken. Sie dachte wirklich sehr flink.
»Er meint es ernst damit, dich schön zu machen«, sagte Bink. »Er kann…«
»Es würde nicht funktionieren.«
»Doch! Trents Talent…«
»Ich kenne sein Talent. Aber das würde mein Problem nur verschlimmern, selbst wenn ich dazu bereit wäre, Xanth zu verraten.«
Das war aber merkwürdig. Sie wollte gar nicht schön werden? Warum war sie dann so empfindlich, wenn es um ihr Aussehen ging? Oder war das wieder nur eine List, mit der er dazu bewegt werden sollte, den Standort des Schildsteins preiszugeben? Das bezweifelte er. Sie kam offensichtlich aus Xanth, denn kein Außenstehender hatte alles über seine Erfahrung mit dem Quell des Lebens und dem senilen König erraten können.
Die Zeit verstrich, und es wurde Abend. Fanchon ging es immer noch gut, und Bink aß und trank seinen Anteil.
Als es dämmerte, fing es an zu regnen. Das Wasser tropfte durch das Gitter. Zwar bot das Dach einen gewissen Schutz, aber es tropfte immer noch genügend Wasser auf sie herab, um sie gründlich zu durchnässen. Doch Fanchon lächelte. »Gut«, flüsterte sie. »Die Nornen meinen es heute nacht gut mit uns.«
Gut? Bink zitterte in seinen nassen Kleidern und musterte sie erstaunt. Sie kratzte mit ihren Fingerspitzen im aufgeweichten Boden der Grube. Bink schritt zu ihr hinüber, um zu sehen, was sie dort tat, doch sie winkte ab. »Sorg dafür, daß die Wächter nichts bemerken«, flüsterte sie.
Die Gefahr war gering. Die Wachen interessierten sich nicht für sie. Sie hatten sich untergestellt und waren nicht in Sicht. Selbst wenn sie sich in der Nähe aufgehalten hätten, war es inzwischen doch zu dunkel geworden, um etwas zu erkennen.
Was tat sie da nur Wichtiges? Sie kratzte Schlamm vom Boden und vermengte ihn mit dem Heu, ohne dabei auf den Regen zu achten. Bink begriff das nicht. War das vielleicht ihre Art, sich zu entspannen?
»Hast du in Xanth irgendwelche Mädchen gekannt?« fragte Fanchon. Der Regen ließ langsam nach, doch die Dunkelheit bot ihr ausreichenden Schutz bei ihrem heimlichen Tun, so daß weder Bink noch die Wachen wissen konnten, was hier vor sich ging.
Bink hätte das Thema lieber vermieden. »Ich verstehe nicht, wieso…«
Sie schritt zu ihm hinüber. »Ich mache Ziegel, du Idiot!« flüsterte sie eindringlich. »Rede weiter – und achte dabei auf Lichter. Wenn du irgend jemanden kommen siehst, so sag das Wort ›Chamäleon‹. Dann verstecke ich schnell alles.«
Sie glitt zurück in ihre Ecke.
Chamäleon. Das Wort hatte etwas an sich – jetzt fiel es ihm ein! Die Chamäleonechse, die er kurz vor seiner Reise zum Guten Magier gesehen hatte – sein Zukunftsomen. Das Chamäleon war ganz plötzlich gestorben. Hieß das etwa, daß auch seine Zeit gekommen war?
»Rede!« befahl Fanchon. »Du mußt die Geräusche, die ich mache, übertönen!« Dann, im Plauderton: »Hast du da Mädchen gekannt?«
»Oh… ein paar«, sagte Bink. Ziegel? Wofür?
»Waren sie hübsch?« Ihre Hände waren im Dunkeln nicht zu sehen, aber er hörte das leise Klatschen des Schlamms und das Rascheln des Strohs. Wahrscheinlich benutzte sie das Heu, um die Schlammziegel zu formen und ihnen Halt zu verleihen. Aber das
war doch verrückt. Wollte sie vielleicht ein abgetrenntes Klo mauern?
»Oder waren sie nicht so hübsch?« drängte sie.
»Och. Hübsch, ja«, erwiderte er. Es sah so aus, als würde sich dieses Thema nicht vermeiden lassen. Wenn die Wächter lauschen sollten, dann würden sie ihre Aufmerksamkeit, wenn er über hübsche Mädchen sprach, eher auf ihn richten als auf das Klatschen ihres Schlamms. Na gut, wenn es das war, was sie wollte… »Meine Verlobte, Sabrina, war schön – ist schön –, und die Magierin Iris schien schön zu sein, aber ich habe auch andere getroffen, die es nicht waren. Wenn sie erst einmal alt werden oder heiraten…«
Der Regen hatte gänzlich aufgehört. Bink sah ein Licht, das sich der Grube näherte. »Chamäleon«, murmelte er und verspannte sich innerlich. Omen waren immer genau – wenn man sie nur richtig verstand.
»Frauen müssen nicht erst häßlich werden, wenn sie heiraten«, sagte Fanchon. Die Geräusche aus ihrer Ecke klangen nun anders.
Sie war dabei, alles zu verstecken. »Manche fangen schon vorher damit an.«
Die war aber wirklich mit ihrem eigenen Zustand beschäftigt! Wieder fragte er sich, weshalb sie dann Trents Angebot, schön zu werden, ausgeschlagen hatte. »Als ich auf dem Weg zum Magier Humfrey war, da habe ich eine Zentaurin kennengelernt«, sagte Bink und hatte Schwierigkeiten, sich angesichts ihrer merkwürdigen Situation selbst auf ein solch ausgefallenes Thema zu konzentrieren. In einer Grube mit einem häßlichen Mädchen gefangen zu sein, das unbedingt Ziegel herstellen wollte! »Sie war schön, auf eine statueske Weise. Natürlich war sie im Grunde ein Pferd…« Schlechte Wortwahl. »Ich meine, hinten war sie… Na ja, jedenfalls bin ich auf ihrem Rücken geritten…« Während er das nahende Licht beäugte, fragte er sich, was wohl die Wächter denken würden, wenn sie ihn so hören sollten. Nicht, daß ihn das auch nur einen Funken interessierte… Das Licht war
hauptsächlich zu sehen, weil es sich im Metall der Gitterstäbe widerspiegelte. »Weißt du, sie war zur Hälfte ein Pferd. Sie hat mich durch das Zentaurenland gebracht.«
Das Licht erlosch. Es mußte ein Wächter auf einer Routinepatrouille gewesen sein. »Falscher Alarm«, flüsterte er. Dann, wieder im Plauderton: »Aber auf der Reise zum Magier habe ich ein wirklich sehr hübsches Mädchen kennengelernt. Sie war… sie hieß…« Er machte eine Konzentrationspause. »Wynne. Aber sie war entsetzlich dumm. Ich hoffe, der Spaltendrache hat sie nicht erwischt.«
»Ihr wart in der Spalte?«
»Eine Weile. Bis mich der Drache verjagt hat. Ich mußte außen herumgehen. Ich bin erstaunt, daß du davon weißt. Ich habe geglaubt, daß es da einen Vergessenszauber gibt, denn sie war nicht auf meiner Karte eingezeichnet, und ich hatte auch nie davon gehört, bis ich dort war. Obwohl, wieso ich mich dann jetzt daran erinnere…«
»Ich habe in der Nähe der Spalte gewohnt«, sagte sie.
»Du hast dort gewohnt? Wann ist sie denn entstanden? Was ist ihr Geheimnis?«
»Sie war schon immer da. Es gibt da einen Vergessenszauber. Ich glaube, der Magier Humfrey hat ihn dort eingesetzt. Aber wenn man starke Assoziationen dazu hat, dann kann man sich doch daran erinnern. Jedenfalls eine Weile lang. Auch Magie hat ja ihre Grenzen.«
»Vielleicht ist es das. Ich werde mein Erlebnis mit dem Drachen und dem Schatten nie vergessen.«
Fanchon war wieder dabei, Ziegel zu machen. »Und weitere Mädchen?«
Bink hatte den Eindruck, daß sie sich mehr als nur oberflächlich dafür interessierte. Lag das daran, daß sie die Menschen aus dem Spaltengebiet kannte? »Laß mal überlegen. Da war noch eins. Ein ganz normales Mädchen, Dee hieß sie. Sie hat sich mit dem
Soldaten gestritten, mit dem ich zusammen war, Crombie. Er war ein Frauenhasser, jedenfalls gab er das vor, und da ist sie einfach weggegangen. Eigentlich schade, ich mochte sie ganz gern.«
»Ach ja? Ich dachte, du ziehst hübsche Mädchen vor?«
»Hör mal, jetzt sei mal nicht so verdammt empfindlich!« sagte er barsch. »Du hast schließlich das Thema aufgebracht. Ich mochte Dee mehr als… ach, ist ja auch egal. Ich hätte mich lieber über Fluchtpläne unterhalten.«
»Tut mir leid«, sagte sie. »Ich… ich wußte von deiner Reise um die Spalte. Wynne und Dee sind… Freundinnen von mir. Also war ich natürlich interessiert.«
»Freundinnen von dir? Alle beide?« Langsam begannen die Mosaiksteinchen zusammen ein Muster zu ergeben. »Was hast du für ein Verhältnis zur Magierin Iris?«
Fanchon lachte. »Gar keins. Meinst du, ich würde so aussehen, wenn ich die Magierin wäre?«
»Ja«, sagte Bink. »Wenn du es mit Schönheit versucht hättest und es nicht geklappt hätte und wenn du immer noch machthungrig wärst und glaubtest, du könntest es irgendwie mit Hilfe eines unschuldigen, nichtsahnenden Reisenden schaffen – das würde dann auch erklären, wieso Trent dich nicht mit seinem Angebot locken konnte, dich schön zu machen. Das würde deine Tarnung nur auffliegen lassen. Vor allem, weil du ja sowieso so schön sein könntest, wie du wolltest. Also wäre es möglich, daß du mir in einer Verkleidung gefolgt bist, die keiner durchschaut. Und natürlich würdest du nicht gerade einem anderen Magier dabei helfen, in Xanth die Macht zu übernehmen…«
»Also würde ich dann hierher nach Mundania gehen«, schloß sie. »Wo es keine Magie gibt und folglich auch keine Illusionen.«
Jetzt steckte er wieder in der Klemme. Hm, wirklich? »Vielleicht siehst du ja wirklich so aus. Vielleicht habe ich die richtige Iris dort auf ihrer Insel nie gesehen.«
»Und wie würde ich dann wohl wieder nach Xanth zurückkehren?«
Darauf wußte Bink keine Antwort. Er versuchte es mit einer Vorwärtsverteidigung. »Na, und weshalb bist du denn hergekommen? Daß es hier nicht magisch ist, hat dein Problem offensichtlich nicht gelöst.«
»Na ja, es braucht Zeit…«
»Bis die Magie verfliegt?«
»Ganz genau. Als die Drachen noch über Mundania fliegen konnten, das war vor der Errichtung des Schilds, da dauerte es mehrere Tage oder sogar Wochen, bis sie verblaßten. Vielleicht sogar noch länger. Der Magier Humfrey sagt, daß es viele Beschreibungen und Abbildungen von Drachen in mundanischen Texten gäbe. Die Mundanier sehen keine Drachen mehr, also halten sie die alten Texte für Phantastereien, aber das beweist immerhin, daß es eine Weile dauert, bis sich die Magie in einem Tier oder einem Menschen auflöst.«
»Folglich könnte eine Magierin ihre Illusion doch einige Tage aufrechterhalten«, sagte Bink.
Sie seufzte. »Vielleicht. Aber ich bin nicht Iris, obwohl ich bestimmt nichts dagegen hätte, sie zu sein. Ich hatte ganz andere, triftige Gründe, Xanth zu verlassen.«
»Ja, ich erinnere mich. Der eine war, daß du deine Magie, was immer das für eine sein mag, verlieren wolltest, und den anderen Grund wolltest du mir nicht nennen.«
»Ich schätze, du hast ein Recht darauf, ihn zu erfahren. Du würdest ihn so oder so erfahren. Ich habe von Wynne und Dee gehört, was du für ein Mensch bist, und…«
»Also ist Wynne dem Drachen entkommen?«
»Ja, dank deiner Hilfe. Sie…«
Ein Licht näherte sich. »Chamäleon«, sagte Bink.
Fanchon beeilte sich, ihre Ziegel zu verbergen. Diesmal erschien das Licht über der Grube.
»Ich hoffe doch, daß Sie dort unten nicht ertrunken sind?« fragte Trents Stimme.
»Wir wären schon fortgeschwommen«, erwiderte Bink. »Hören Sie, Magier, je unbequemer Sie es uns hier machen, um so weniger werden wir Ihnen helfen wollen.«
»Das ist mir durchaus bewußt, Bink. Ich würde Ihnen ja auch viel lieber ein bequemes Zelt zur Verfügung stellen…«
»Nein.«
»Bink, ich verstehe einfach nicht, wie Sie einer Regierung treu sein können, die Sie derartig schäbig behandelt hat!«
»Was wissen Sie denn davon?«
»Natürlich haben meine Spione Ihre Gespräche überwacht. Aber ich hätte es mir ja eigentlich auch denken können, wie alt und stur der Sturmkönig inzwischen sein muß. Die Magie manifestiert sich in vielerlei Formen, und wenn man die Definitionen zu eng faßt…«
»Na, hier macht das jedenfalls keinen Unterschied mehr.«
Der Magier beharrte jedoch auf seinem Standpunkt, und seine Argumente klangen wesentlich logischer als Binks unvernünftige Reaktion. »Es mag ja sein, daß Sie kein magisches Talent besitzen, Bink, obwohl ich kaum glaube, daß Humfrey sich bei so etwas irren würde. Aber Sie besitzen andere Qualitäten, die sehr für Sie sprechen, und Sie würden einen ausgezeichneten Bürger abgeben.«
»Er hat recht, weißt du«, sagte Fanchon. »Du hättest wirklich eine bessere Behandlung verdient gehabt.«
»Auf wessen Seite stehst du eigentlich?« fragte Bink.
Sie seufzte im Dunkeln. Es klang sehr menschlich, und es fiel ihm wesentlich leichter, das auf diese Weise zu empfinden, wenn er sie nicht dabei anblicken mußte. »Ich bin auf deiner Seite Bink. Ich bewundere deine Loyalität, aber ich bin schon der Meinung, daß du das alles nicht verdient hast.«
»Warum hast du ihm denn nicht gesagt, wo sich der Schildstein befindet – wenn du es wirklich weißt?«
»Weil Xanth, trotz aller seiner Mängel, immer noch ein ganz netter Ort ist und bleibt. Der senile König wird schon nicht ewig leben, und wenn er stirbt, dann werden sie den Magier Humfrey einsetzen müssen, und der wird alles besser machen, auch wenn er sich jetzt darüber beschwert, daß es ihm die Zeit stehlen würde. Vielleicht wird ja gerade ein neuer oder junger Magier geboren, der danach die Macht übernimmt. Irgendwie wird es schon klappen, das hat es bisher immer getan. Das letzte, was Xanth gebrauchen kann, das ist, von einem grausamen Bösen Magier übernommen zu werden, der seine Gegner in Steckrüben verwandelt.«
Trent gluckste über ihren Köpfen. »Meine Liebe, Sie besitzen einen scharfen Verstand und eine spitze Zunge. Eigentlich ziehe ich es vor, meine Gegner in Bäume zu verwandeln, die sind dauerhafter als Steckrüben. Ich nehme nicht an, daß Sie, und sei es nur der Argumentation halber, zugeben würden, daß ich wohl ein besserer Herrscher wäre als der jetzige König?«
»Da liegt er nicht ganz falsch«, sagte Bink mit zynischem Lächeln.
»Auf wessen Seite stehst du eigentlich?« fragte Fanchon und äffte Binks Tonfall nach…
Doch es war Trent, der lachte. »Sie beide gefallen mir«, sagte er. »Wirklich. Sie sind aufgeweckt und treu. Wenn Sie die Treue nur mir schenken würden, dann wäre ich zu erheblichen Zugeständnissen bereit. Zum Beispiel könnte ich Ihnen ein Vetorecht einräumen bei allem, was ich verwandeln will. Auf diese Weise könnten Sie die Steckrüben auswählen.«
»Damit wir auch noch für Ihre Verbrechen mitverantwortlich sind«, entgegnete Fanchon. »Diese Art von Macht würde uns schon sehr bald korrumpieren. Zum Schluß wären wir auch nicht mehr anders als Sie.«
»Nur wenn Ihr Grundcharakter meinem nicht überlegen ist«, meinte Trent. »Und wenn das der Fall wäre, dann wären Sie sowieso nicht verschieden von mir. Sie sind einfach nur noch nie
in meiner Situation gewesen. Es wäre besser, wenn Sie das endlich einsehen würden, anstatt unreflektierte Heuchler zu bleiben.«
Bink zögerte. Er war durchnäßt und fror, und der Gedanke, die Nacht in dieser Grube verbringen zu müssen, behagte ihm nicht sonderlich. Hatte Trent eigentlich vor zwanzig Jahren immer Wort gehalten? Nein, das hatte er nicht. Er hatte sein Wort gebrochen, wann immer seine Machtgier dies erfordert hatte. Deshalb war er ja unter anderem auch gescheitert. Niemand konnte es sich leisten, ihm zu vertrauen, nicht einmal seine Freunde.
Die Versprechen des Magiers waren wertlos. Seine Logik bestand aus einem Netz schlauer Spitzfindigkeiten, die seinen Gefangenen nur die Information entlocken sollten, wo sich der Schildstein befand. Wenn er sie nicht mehr benötigte, dann würden Bink und Fanchon die ersten sein, die verwandelt wurden. Bink antwortete nicht, und auch Fanchon schwieg. Einen Augenblick später ging Trent wieder fort.
»Und so haben wir der Versuchung Nummer zwei widerstanden«, bemerkte Fanchon. »Aber er ist ein schlauer und skrupelloser Mann. Es wird immer schwieriger werden.«
Bink fürchtete, daß sie recht damit haben konnte.
Am nächsten Morgen buk das schräg einfallende Sonnenlicht die groben Ziegel. Sie waren zwar noch alles andere als hart, aber es war immerhin ein Anfang. Fanchon legte sie in die Abtrennung, damit man sie von oben nicht erkennen konnte. Wenn alles klappte, dann wollte sie sie am Nachmittag noch einmal in die Sonne legen.
Trent kam mit weiteren Lebensmitteln vorbei: frisches Obst und Milch. »Es mißfällt mir zwar, die Auseinandersetzung auf einem solchen Niveau zu führen«, sagte er, »aber meine Geduld neigt sich dem Ende zu. Man kann jederzeit den Schildstein routinemäßig an einen anderen Ort bringen, dann wird Ihre Information nutzlos sein. Wenn mir einer von Ihnen nicht noch heute die Stelle verrät, dann werde ich Sie beide morgen verwandeln. Sie, Bink, werden dann ein Drachenhahn und Sie, Fanchon, will ich in einen Basilisken verwandeln. Sie werden dann beide im selben Käfig untergebracht.«
Bink und Fanchon blickten sich gegenseitig voller Verzweiflung an. Drachenhahn und Basilisk – zwei Namen für die gleiche Sache: ein geflügeltes Reptil, das aus den dotterlosen Eiern von Hähnen von Kröten auf warmen Misthaufen ausgebrütet wurde. Sein Atem war so scharf, daß er die Pflanzen welken ließ und Steine zerschmettern konnte, und wer ihn anblickte, der fiel tot um. Der Basilisk – der kleine König unter den Reptilien.
Das Chamäleon seines Omens hatte sich in das Abbild eines Basilisken verwandelt – kurz vor seinem Tod. Jetzt war er an dieses Chamäleon von einem Menschen erinnert worden, der von diesem Omen nichts hatte wissen können, und er schwebte in der Gefahr, in ein solches verwandelt zu werden… Der Tod war nur noch eine Frage der Zeit, dessen war er sich jetzt gewiß.
»Das ist nur ein Bluff«, sagte Fanchon schließlich. »Das kann er nicht wirklich, er will uns nur Angst einjagen.«
»Mit Erfolg«, brummte Bink.
»Vielleicht wäre eine kleine Vorführung ganz angebracht«, sagte Trent. »Ich verlange von niemandem, daß er mir meine magischen Fähigkeiten blindlings abnimmt, wo ich sie doch mühelos unter Beweis stellen kann. Da ich sowieso regelmäßig üben muß, um mein volles Talent nach dem langen Exil in Mundania wiederzuerlangen, kommt mir eine solche Vorführung durchaus gelegen.« Er schnippte mit den Fingern. »Lassen Sie die Gefangenen ihre Mahlzeit beenden«, befahl er dem Wächter, der herbeigeeilt war. »Dann bringen Sie sie aus der Zelle.« Er verschwand.
Jetzt war Fanchon aus einem anderen Grund betrübt. »Vielleicht blufft er ja nur, aber wenn sie hier herunterkommen, dann werden sie die Ziegel entdecken, dann sind wir sowieso erledigt.«
»Nicht, wenn wir sofort kommen, ohne ihnen Schwierigkeiten zu machen«, meinte Bink. »Sie werden nicht herunterkommen, wenn es sich vermeiden läßt.«
»Wollen wir’s hoffen«, sagte sie.
Als die Wachen kamen, kletterten Bink und Fanchon sofort die Strickleiter empor, die man ihnen hinunterließ. »Wir werden den Bluff des Magiers entlarven!« sagte Bink. Die Soldaten reagierten nicht auf seine Bemerkung. Zusammen marschierten sie über den Isthmus gen Osten, auf Xanth zu.
Als sie in Sichtweite des Schilds waren, erblickten sie Trent, der neben einem Drahtkäfig stand. Um ihn herum standen Soldaten mit gespannten Bogen und angelegten Pfeilen. Sie trugen geschwärzte Brillen, und alles sah sehr grimmig aus.
»Ich warne Sie«, sagte Trent, als sie bei ihm ankamen, »Blicken Sie einander nicht in die Augen nach der Verwandlung. Ich kann keine Toten mehr lebendig machen.«
Wenn dies wieder nur eine Taktik war, um ihnen Angst einzuflößen, dann hatte der Magier jedenfalls Erfolg damit. Fanchon mochte vielleicht noch zweifeln, doch Bink glaubte seinen Worten. Er erinnerte sich an Justin Baum, das Erbe, das Trents Zorn vor zwanzig Jahren zurückgelassen hatte. Er sah das Omen wieder vor sich. Erst ein Basilisk werden, dann sterben…
Trent fing Binks bekümmerten Blick auf. »Wollen Sie mir irgend etwas sagen?« fragte er in beiläufigem Ton.
»Ja. Wie haben sie Sie eigentlich ins Exil schaffen können, ohne in Kröten, Steckrüben oder noch Schlimmeres verwandelt zu werden?«
Trent runzelte die Stirn. »Das habe ich eigentlich nicht gemeint, Bink. Aber im Interesse der allgemeinen Harmonie und Verständigung will ich Ihre Frage beantworten. Einer meiner Gefolgsleute, dem ich vertraut habe, wurde bestochen, um einen
Schlafzauber über mich zu verhängen. Während ich schlief, hat man mich dann durch den Schild getragen.«
»Und woher wollen Sie wissen, daß das nicht noch einmal vorkommt? Sie können nicht die ganze Zeit wachbleiben.«
»Ich habe lange über dieses Problem nachgedacht, während der ersten Jahre meines Exils. Ich bin zu dem Schluß gekommen, daß ich selbst daran schuld gewesen bin. Ich habe mich anderen gegenüber treulos verhalten, also haben andere mich auch verraten. Ich war keineswegs völlig ehrlos, ich habe mein Wort nur gebrochen, wenn es wirklich notwendig zu sein schien, aber…«
»Das ist dasselbe wie zu lügen«, warf Bink ein.
»Das habe ich damals nicht so gesehen. Aber ich nehme an, daß mein diesbezüglicher Ruf in der Zwischenzeit nicht besonders gut geworden ist. Es ist das Vorrecht des Siegers, den Verlierer der völligen Korrumpiertheit zu beschuldigen, um seinen Sieg zu rechtfertigen. Trotzdem: mein Ehrenwort war kein unumstößliches Gesetz, und mit der Zeit sah ich ein, daß es diese grundlegende Charakterschwäche war, die meinen Sturz verschuldet hat. Die einzige Möglichkeit, eine Wiederholung zu vermeiden, bestand darin, mein Vorgehen zu ändern. Und deswegen betrüge ich nicht mehr – nie mehr. Und mich betrügt auch keiner mehr.«
Das war eine offene, vernünftige Antwort. Der Böse Magier war in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil von dem, als was er gemeinhin dargestellt wurde. Anstatt häßlich, schwächlich und kleinkariert zu sein – eine solche Beschreibung hätte besser auf Humfrey gepaßt –, sah er gut aus, war kräftig und weltgewandt. Und doch war er ein Bösewicht, und Bink war zu gewitzt, um sich von seinen wohlklingenden Worten betören zu lassen.
»Fanchon, treten Sie vor!« befahl Trent.
Fanchon trat ihm mit zynischem Gesichtsausdruck entgegen. Trent machte keinerlei Gesten, und er murmelte auch keine Formeln. Er blickte sie lediglich konzentriert an.
Sie verschwand.
Ein Soldat kam mit einem Schmetterlingsnetz angerannt und warf es über irgend etwas am Boden. Dann hob er es wieder auf: Darin zappelte ein unheilvolles, echsenähnliches Wesen mit Flügeln.
Es war tatsächlich ein Basilisk! Bink wandte hastig die Augen ab, um nicht von dem tödlichen Blick des Ungeheuers getroffen zu werden.
Der Soldat warf das Wesen in den Käfig, und ein zweiter Soldat mit geschwärzter Schutzbrille deckte ihn ab. Die anderen Soldaten entspannten sich sichtlich. Der Basilisk krabbelte im Käfig umher und versuchte zu fliehen, doch das war hoffnungslos. Er starrte den Draht wütend an, doch sein Blick wirkte nicht auf Metall. Ein dritter Soldat warf ein Tuch über den Käfig und versperrte damit dem kleinen Ungeheuer die Sicht. Jetzt entspannte auch Bink sich. Das Ganze war offensichtlich sorgfältig geplant und geübt worden.
Die Soldaten hatten genau gewußt, was sie zu tun hatten.
»Bink, treten Sie vor!« sagte Trent im gleichen Ton wie zuvor.
Bink war entsetzt. Doch ein Teil seines Verstandes bäumte sich auf: Es ist immer noch ein Bluff! Sie steckt mit ihnen unter einer Decke. Sie haben alles so eingerichtet, daß ich glauben muß, sie sei verwandelt worden. Alle ihre Einwände waren nur dazu gedacht, mich in Sicherheit zu wiegen, diesen Augenblick vorzubereiten.
Aber das glaubte er nur halb. Das Omen verlieh dem Ganzeneine ganz besondere, unheimliche Überzeugungskraft. Wie auf den Schwingen eines Mottenhabichts schwebte der Tod über ihm und kam immer näher…
Und doch durfte er seine Heimat nicht verraten. Mit weichen Knien trat er vor.
Trent blickte ihn an – da machte die Welt einen Satz. Verwirrt und verängstigt krabbelte Bink auf einen nahe stehenden Busch zu, um in Sicherheit zu gelangen. Die grünen Blätter verwelkten, als er sich ihnen näherte. Dann fiel das Netz über ihn, und er wäre fast gefangengenommen worden. Er entsann sich seiner Flucht vor dem Spaltendrachen und schlug im letzten Augenblick einen Haken, wich zurück – und das Netz verfehlte ihn knapp. Er starrte den Soldaten an, dem in seiner Verwirrung die Brille heruntergerutscht war. Ihre Blicke trafen sich – und der Mann stürzte getroffen hintüber zu Boden.
Das Schmetterlingsnetz flog hoch, doch da sprang ein weiterer Soldat vor und ergriff es. Wieder wollte Bink auf den Busch krabbeln, doch diesmal erwischte ihn das Netz. Er wurde emporgerissen, seine Flügel flatterten hilflos umher, sein peitschender Schwanz verfing sich im Netz, genau wie seine Klauen, und sein Maul schnappte ins Leere.
Dann warf man ihn in den Käfig. Das Netz wurde mehrere Male geschüttelt, um den Schwanz freizubekommen, und er fiel mit ausgebreiteten Flügeln auf den Rücken. Er stieß einen Schmerzenskrächzer aus.
Als er sich wieder aufgerappelt hatte, wurde es um ihn herum dunkel. Er befand sich im Käfig, und man hatte ihn gerade abgedeckt, damit niemand von seinem Blick getroffen würde. Jetzt war er ein Drachenhahn.
Das war aber eine Vorführung! Er hatte nicht nur zugesehen, wie Fanchon verwandelt wurde, es war ihm sogar selbst widerfahren, und er hatte einen Soldaten einfach dadurch getötet, daß er ihn anblickte. Wenn es unter Trents Trupp noch Skeptiker gegeben haben sollte, so gab es jetzt mit Sicherheit keine mehr.
Er erblickte den gebogenen Stachelschwanz eines Wesens seiner Art. Es war ein Weibchen. Doch sie hatte ihm den Rücken zugekehrt. Sein Hühnerechsencharakter setzte sich durch. Er wünschte keine Gesellschaft.
Wütend hackte er auf sie ein und biß sie, während er seine Klauen in sie verkrallte. Sofort drehte sie sich um. Der muskulöse Schwanz bildete einen guten Bewegungshebel. Einen Augenblick lang blickten sie sich gegenseitig an.
Sie war schrecklich, furchteinflößend, widerlich, scheußlich und abstoßend. Noch nie hatte er etwas so Ekelhaftes gesehen. Und doch war sie weiblichen Geschlechts und hatte deswegen auch etwas fundamental Anziehendes. Das Paradoxon des Abgestoßen-und des Angezogenseins überwältigte ihn schließlich, und er verlor das Bewußtsein.
Als er aufwachte, hatte er Kopfschmerzen. Er lag auf dem Heu in der Grube. Es war später Nachmittag.
»Sieht so aus, als würde der Blick eines Basilisken stark überschätzt«, meinte Fanchon. »Wir sind beide nicht gestorben.«
Es war also wirklich passiert. »Nicht ganz«, stimmte Bink ihr zu. »Aber ich fühle mich doch ein bißchen tot.« Während er sprach, wurde ihm etwas klar, was er zuvor nie erkannt hatte: Der Basilisk war ein magisches Wesen, das auch selbst Magie ausüben konnte. Er war eine intelligente Hühnerechse gewesen, die einen Feind magisch niedergestreckt hatte. Wie stand es denn jetzt um seine Theorie der Magie?
»Na ja, du hast dich jedenfalls wacker geschlagen«, sagte Fanchon gerade. »Den Soldaten haben sie schon begraben. Im Lager herrscht eine Totenstille.«
Totenstille – war das die Bedeutung des Omens gewesen? Er war nicht selbst gestorben, aber er hatte getötet, ohne es zu wollen, auf eine Weise, die seiner ganzen Natur fremd gewesen war. War das Omen damit in Erfüllung gegangen?
Bink setzte sich auf, als ihm auch noch etwas anderes klar wurde. »Trents Talent ist also echt. Wir sind verwandelt worden. Wir sind tatsächlich verwandelt worden!«
»Es ist echt. Wir sind wirklich verwandelt worden«, stimmte sie ihm mißmutig zu. »Ich gebe zu, daß ich Zweifel hatte, aber jetzt bin ich überzeugt.«
»Er muß uns zurückverwandelt haben, als wir ohnmächtig waren.«
»Ja, es war nur eine Vorführung.«
»Aber eine wirkungsvolle.«
»Das kann man wohl sagen.« Sie erschauerte. »Bink… ich… ich weiß nicht, ob ich das noch einmal aushalte. Es war ja nicht nur die Verwandlung, es war auch…«
»Ich weiß. Du hast wirklich einen verdammt häßlichen Basilisken abgegeben.«
»Ich würde ein verdammt häßliches Irgendwas abgeben, egal, was es wäre. Aber diese pure Bösartigkeit, diese Dummheit und Schrecklichkeit… das ist wirklich übel! Den Rest meines Lebens so zuzubringen…«
»Ich kann es dir nicht verdenken«, erwiderte Bink. Doch noch immer nagte irgend etwas in seinem Hirn. Das Erlebnis war so überwältigend gewesen, daß er noch eine ganze Weile brauchen würde, um es voll zu durchdenken.
»Ich hätte niemals gedacht, daß jemand mich dazu zwingen könnte, gegen mein Gewissen zu handeln. Aber das hier… das hier…« Sie legte das Gesicht in die Hände. Bink nickte schweigend. Dann wechselte er das Thema. »Hast du bemerkt, daß diese beiden Wesen männlich und weiblich waren?«
»Natürlich«, sagte sie und beherrschte sich wieder, weil sie sich auf etwas Neues konzentrieren konnte. »Wir sind doch auch männlich und weiblich. Der Magier kann unsere Gestalt verändern, aber nicht unser Geschlecht.«
»Aber Basilisken sollten neutral sein. Sie werden aus Hahneiern ausgebrütet… Es gibt keine Basiliskeneltern, nur Hähne.«
Sie nickte nachdenklich, als sie merkte, worauf er hinauswollte. »Du hast recht. Wenn es Männchen und Weibchen gäbe, dann müßten sie sich paaren und fortpflanzen. Was aber dann per definitionem bedeutet, daß es keine Basilisken sind. Das ist ein Paradox.«
»An dieser Definition kann irgend etwas nicht stimmen«, meinte Bink. »Entweder ist da, was den Ursprung dieser Ungeheuer
angeht, eine Menge Aberglaube mit im Spiel, oder wir waren keine echten Basilisken.«
»Wir waren echt«, sagte sie und machte erneut eine Grimasse. »Davon bin ich jetzt überzeugt. Zum erstenmal in meinem Leben bin ich froh über meine menschliche Gestalt.« Was für sie ein bemerkenswertes Geständnis war!
»Das bedeutet aber, daß Trents Magie vollkommen wirklich ist«, sagte Bink. »Er verwandelt nicht nur die Gestalt, er macht Dinge zu anderen Dingen, wenn du verstehst, was ich meine.« Dann wurde ihm klar, was ihn so beschäftigt hatte. »Aber wenn die Magie außerhalb von Xanth nachläßt, außerhalb von dem schmalen Randgebiet vor dem Schild, dann müßten wir uns…«
»Müßten wir nur nach Mundania!« rief sie. »Mit der Zeit würden wir dann unsere ursprüngliche Gestalt wiedererlangen. Also wäre es nicht von Dauer.«
»Also ist seine Fähigkeit, andere zu verwandeln, doch nur ein Bluff, auch wenn sie wirklich ist«, fuhr er fort. »Er müßte uns hier im Käfig behalten, sonst würden wir ihm entfliehen und uns seiner Macht entziehen. Er muß nach Xanth, sonst besitzt er wirklich kaum Macht. Nicht mehr Macht, als er jetzt schon als General dieser Armee besitzt – die Macht, zu töten.«
»Alles, was er jetzt bekommen kann, ist nur ein verführerischer Vorgeschmack auf die Macht«, sagte sie. »Ja, daß er wirklich nach Xanth will, darauf kann man wetten!«
»Aber in der Zwischenzeit sind wir immer noch in seiner Gewalt.«
Sie holte die Ziegel hervor und legte sie in das schwächer werdende Sonnenlicht. »Was wirst du tun?« fragte sie.
»Wenn er mich freiläßt, dann werde ich weiter nach Mundania reisen. Da wollte ich ja sowieso hin, bevor ich überfallen wurde. Eins hat Trent mir jedenfalls gezeigt: Man kann da draußen überleben. Aber ich werde meine Route sorgfältig notieren, denn es sieht ja so aus, als wäre Xanth nur sehr schwer wiederzufinden.«
»Ich meinte wegen des Schildsteins.«
»Nichts.«
»Du wirst ihm nichts verraten?«
»Nein, natürlich nicht«, sagte er. »Jetzt, da wir wissen, daß seine Magie uns nicht wirklich schaden kann, jedenfalls nicht mehr als seinen Soldaten, hat sie für mich einen Teil ihres Schreckens verloren. Nicht, als ob das noch wichtig wäre. Ich könnte es dir wirklich nicht verdenken, wenn du es ihm verraten würdest.«
Sie blickte ihn an. Ihr Gesicht war immer noch häßlich, aber es hatte einen besonderen Ausdruck, den er nicht zu erklären vermochte. »Weißt du, du bist wirklich ein bemerkenswerter Mann, Bink.«
»Nein, ich bin nichts Besonderes. Ich habe keine Magie.«
»Du hast Magie. Du weißt nur nicht, welche.«
»Das ist dasselbe.«
»Du weißt ja, ich bin dir hierher gefolgt.«
Jetzt wurde ihm klar, was sie meinte. Sie hatte in Xanth von ihm gehört, von dem Reisenden ohne Zauber. Sie hatte gewußt, daß das in Mundania keine Rolle spielen würde. Welch eine Verbindung – der Mann ohne Magie und die Frau ohne Schönheit. Sie hatten ähnliche Mängel aufzuweisen. Vielleicht würde er sich mit der Zeit an ihr Aussehen gewöhnen, ihre anderen Eigenschaften waren ja durchaus schätzenswert. Bis auf eine.
»Ich verstehe dich«, sagte er. »Aber wenn du mit dem Bösen Magier gemeinsame Sache machst, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Sogar dann nicht, wenn er dich schön machen sollte. Nicht, daß das sonderlich wichtig wäre – du kannst deine Belohnung ja in Xanth entgegennehmen, sofern er diesmal sein Wort halten sollte.«
»Du machst mir wieder Mut«, sagte sie. »Dann versuchen wir mal zu fliehen.«
»Wie denn?«
»Mit den Ziegeln, du Dämlack! Sie sind inzwischen hart geworden. Sobald es dunkel geworden ist, schichten wir sie auf, und…«
»Das Gitter versperrt uns den Ausgang, die Tür ist noch immer verschlossen. Wenn wir eine Treppe haben, macht das keinen Unterschied. Wenn das Problem nur darin bestünde, nach oben zu kommen…«
»Es gibt doch einen Unterschied«, murmelte sie. »Wir stapeln sie auf, stellen uns darauf und drücken das Gitter nach oben. Es ist nicht verankert, das habe ich überprüft, als man uns hergebracht hat. Es ruht nur wegen der Schwerkraft auf dem Grubenrand. Es ist schwer, aber du bist stark…«
Bink blickte hoffnungsfroh auf. »Du könntest es abstützen, nachdem ich es hochgedrückt habe. Stück für Stück, bis…«
»Nicht so laut!« flüsterte sie eindringlich. »Vielleicht belauscht man uns immer noch.« Aber sie nickte. »Du hast es schon begriffen. Es ist nichts Sicheres, aber einen Versuch ist es wert. Und wir werden den Lagerplatz des Elixiers überfallen müssen, damit er es nicht einsetzen kann, wenn noch jemand herauskommen sollte und ihm sagt, wo sich der Schildstein befindet. Ich habe schon alles durchdacht.«
Bink lächelte. Er fing an, sie zu mögen.