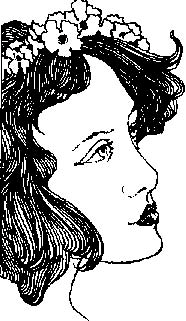
13 Die Erklärung
Chamäleon hatte ihre ›normale‹ Phase, in der Bink sie zuvor als Dee kennengelernt hatte, inzwischen durchschritten und trat nun in ihre Schönheitsphase ein. Sie sah nicht genauso aus wie Wynne, ihr Haar war heller, und ihre Gesichtszüge waren leicht verändert. Offenbar wiederholte sich ihr eigenes Aussehen niemals ganz genau, sondern veränderte sich von Zyklus zu Zyklus. Doch immer bewegte sie sich von einem Extrem zum anderen. Leider ließ ihre Intelligenz nun auch nach, so daß sie keine große Hilfe mehr bei dem Versuch war, aus dem Schloß zu fliehen. Sie interessierte sich vielmehr dafür, sich mit Bink anzufreunden, und das war eine Ablenkung, die er sich, wie er meinte, im Augenblick nicht leisten konnte.
Erstens bestand seine oberste Priorität darin, von hier wegzukommen, und zweitens war er sich nicht sicher, ob er sich auf längere Zeit an ein derart wechselhaftes Wesen binden sollte. Wenn sie doch nur gleichzeitig schön und aufgeweckt wäre – aber nein, das wäre auch nichts. Nun begriff er, warum Trents Angebot, sie schön zu machen, sie nicht gereizt hatte. Das hätte nur ihre Phasen verschoben. Wenn sie schön und klug wäre, dann wäre sie
einen Monat später häßlich und dumm, und das war auch nicht gerade eine Verbesserung der Lage. Sie mußte von dem ganzen Fluch befreit werden. Und selbst wenn sie auf der Höhe ihrer Schönheit und Intelligenz stehenblieb, würde er ihr doch nicht unbegrenzt trauen, denn von solch einem Typ Frau war er schon einmal verraten worden. Sabrina – er unterdrückte die Erinnerung. Und selbst ein normales Mädchen konnte mit der Zeit ziemlich langweilig werden, wenn es nur eine durchschnittliche Intelligenz oder Magie besaß…
Nun, da sie sich nicht aktiv dagegen wehrten, war Schloß Roogna eigentlich ein ganz angenehmer Aufenthaltsort. Es tat sein Bestes, um diesen Eindruck zu erwecken. Die Schloßgärten standen voller üppiger Obstbäume, sie bescherten ihnen Getreide, Gemüse und Kleinwild. Trent übte sich im Bogenschießen, indem er auf Hasenjagd ging und die Tiere von den hohen Zinnen herab jagte. Er benutzte einen der prächtigen Bogen aus der Waffenkammer des Schlosses. Einige der Wesen waren falsche Hasen, die Bilder ihrer selbst in einigem Abstand von ihren wirklichen Körpern projizieren, aber Trent schien diese Herausforderung zu genießen, auch wenn er dadurch zahlreiche Pfeile vergeudete. Einmal erwischte er einen Stinker, dessen magischer Geruch schon dafür sorgte, daß sie den Kadaver hastig äußerst tief vergruben. Dann erlegte er einen Schrumpfer, der beim Sterben immer kleiner wurde, bis er so groß war wie eine Maus und zu nichts mehr zu gebrauchen war. Die Magie warimmer für kleinere Überraschungen gut. Aber manche davon waren auch gutartig.
Sie mußten sich selbst um die Küche kümmern, sonst wären die Zombies eingedrungen, um sie zu bekochen. Das wollten sie lieber nicht, also übernahm Chamäleon dort das Kommando. Von einigen weiblichen Gespenstern, die sehr eigen waren, was die Schloßküche anging, unterstützt, kochte sie durchaus beachtenswerte Mahlzeiten. Das Spülen war kein Problem, denn es gab sogar einen ewigen magischen Springbrunnen mit aseptischen Eigenschaften. Man mußte die Teller nur einmal kurz darunterhalten, und schon glänzten sie wieder. Es war auch eine recht beeindruckende Erfahrung, in dem Wasser zu baden, denn es schäumte stark.
Die Innenwände des Schlosses waren genauso stabil wie das Dach. Offenbar waren hier Wasserdichtigkeitszauber vorhanden. Jeder von ihnen besaß ein luxuriöses Schlafzimmer mit kostbaren Wandvorhängen, weichen Teppichen, die sich bewegten, bebenden Daunenkissen und Nachttöpfen aus massivem Silber. Sie lebten wie die Fürsten. Bink stellte fest, daß die bestickte Tapete gegenüber seinem Bett in Wirklichkeit ein magisches Bild war: die winzigen Figuren darauf bewegten sich und spielten ihre Miniaturdramen. Da gab es winzige Ritter, die Drachen töteten, und winzige Damen, die an ihren Näharbeiten saßen, während sich diese Ritter und Damen im Inneren ihres Schlosses umarmten. Zuerst schloß Bink vor diesem Anblick die Augen, doch schon bald überwog seine natürliche Neugier, und er sah sich alles genau an. Und er wünschte sich, daß auch er – aber nein, das wäre nicht recht, obwohl er wußte, daß Chamäleon dazu bereit gewesen wäre.
Die Gespenster erwiesen sich als unproblematisch, und sie freundeten sich sogar mit ihnen an. Bink lernte sie alle kennen. Einer der Geister war der Torhüter, der nach ihnen gesehen hatte, als das Fallgitter hinter ihnen heruntergefallen war, dann gab es ein Zimmermädchen und auch eine Küchenhilfe. Alles in allem waren es sechs, die alle auf unpassende Weise umgekommen und deshalb nicht ordnungsgemäß unter Beachtung aller Zeremonien bestattet worden waren. Eigentlich waren es Schatten, aber ohne eigenen Willen. Nur der König von Xanth konnte sie freisprechen, und das Schloß durften sie nicht verlassen. Also waren sie dazu verdammt, auf ewige Zeiten hier im Dienst zu stehen, anstatt ihren eigentlichen Pflichten nachkommen zu können. Es waren alles im Grunde recht nette Leute, die keinerlei Macht über das Schloß selbst besaßen und nur einen Teil seiner Verzauberung darstellten. Sie halfen ihnen, wann immer sie konnten, und legten einen geradezu bemitleidenswerten Eifer an den Tag, ihnen zu gefallen.
Sie teilten Chamäleon mit, wo sie neue Nahrungsmittel finden konnte, und erzählten Bink ihre Lebensgeschichte aus der guten alten Zeit. Zuerst waren sie erschrocken gewesen, als lebende Wesen hier eingedrungen waren, denn sie hatten jahrhundertelang in ihrer Abgeschiedenheit allein gelebt, doch sie begriffen, daß dies auf Befehl des Schlosses geschah, und nun hatten sie sich daran gewöhnt.
Trent verbrachte die meiste Zeit in der Bibliothek, als wollte er ihr ganzes Wissen in sich aufnehmen. Zuerst hielt auch Chamäleon sich dort eine Weile auf, doch als ihre Intelligenz nachließ, widmete sie sich anderen Dingen. Sie suchte fieberhaft nach einem Zauber, der sie normal machen würde, doch als sie in der Bibliothek keinen solchen fand, irrte sie im Schloß und seinen Ländereien umher. Solange sie allein war, manifestierte sich nichts Bedrohliches, keine Ratten, kein fleischfressender Efeu, keine Zombies. Sie selbst war keine Gefangene, nur die Männer. Sie suchte nach Quellen der Magie und probierte alles Eßbare, sehr zur Beunruhigung von Bink, der sehr gut wußte, wie giftig viele magische Dinge sein konnten. Doch sie schien ein verzaubertes Leben zu führen – verzaubert von Schloß Roogna.
Durch Zufall machte sie eine Entdeckung: eine kleine rote Frucht, die in großen Mengen an einem der Bäume wuchs. Chamäleon wollte in eine der Früchte hineinbeißen, doch die Rinde war zu hart, also nahm sie sie in die Küche mit, um sie mit einem Beil zu zerteilen. Es waren keine Geister da, denn die erschienen jetzt meistens nur noch, wenn sie etwas zu tun hatten. Deshalb konnte auch niemand Chamäleon warnen. Sie war unvorsichtig und ließ eine der Früchte auf den Boden fallen.
Bink hörte die Explosion und kam in die Küche gerannt. Chamäleon, die jetzt schon recht hübsch war, kauerte in einer Ecke. »Was ist passiert?« fragte Bink und blickte sich nach feindseliger Magie um.
»Oh, Bink!« rief sie und drehte sich erleichtert zu ihm um. Ihr selbstgeschneidertes Kleid war durcheinander, und oben sah er ihre wohlgeformten Brüste, während unten ihre festen runden Schenkel hervorschauten. Es war wirklich schwierig, sich zu beherrschen, denn sie hatte auch noch vieles von Dee an sich, das, was er an ihr gemocht hatte, bevor er begriffen hatte, was mit ihr los war. Er hätte sie jetzt ergreifen und mit ihr Liebe machen können, und sie hätte es ihm weder in ihrer dummen noch in ihrer klugen Phase übelgenommen.
Aber er war kein Gelegenheitsliebhaber, und zu dieser Zeit und in dieser Situation mochte er sich nicht derart festlegen. Er schob sie sanft beiseite, was ihn mehr Selbstüberwindung kostete, als er sich anmerken ließ. »Was ist passiert?« fragte er erneut.
»Es… es hat geknallt«, stammelte sie.
Er mußte sich selbst daran erinnern, daß ihre nachlassende Intelligenz ein weiterer Teil des Fluchs war. Jetzt war es schon leichter, ihrem üppigen Körper zu widerstehen. Ein Körper ohne
Geist reizte ihn nicht.
»Was hat geknallt?«
»Die Kirsche.«
»Die Kirsche?« Es war das erste, was er über die neue Frucht
gehört hatte.
Doch nach langem, geduldigen Fragen erfuhr er endlich die ganze Geschichte.
»Das sind Kirschbomben!« rief er. »Wenn du eine davon gegessen hättest…«
Sie war noch nicht so dumm, das nicht zu begreifen. »Oh, mein Mund!«
»Oh, dein Kopf! Diese Dinger sind ziemlich stark. Hat Milly dich denn nicht davor gewarnt?« Milly war das Zimmermädchengespenst.
»Sie war beschäftigt.«
Womit konnte ein Gespenst sich wohl beschäftigen? Na ja, das war jetzt nicht die Zeit, darüber nachzudenken. »In Zukunft solltest du nichts essen, bevor ein Geist dir sagt, daß es harmlos ist.«
Chamäleon nickte gehorsam.
Bink hob eine der Kirschen auf und musterte sie. Es war ein einfacher kleiner roter Ball, der nur an einer Stelle eine Einbuchtung hatte, wo der Stengel abgebrochen war. »Der alte Magier Roogna hat diese Bomben wahrscheinlich im Krieg eingesetzt. Er hatte zwar etwas gegen Krieg, soweit ich weiß, aber die Verteidigung hat er trotzdem niemals vernachlässigt. Junge, Junge! Wenn sich ein Mann mit einer Schleuder auf den Zinnen postiert, dann könnte er mit den Dingern eine ganze Armee zusammenbomben. Wer weiß, was es noch für Bäume in dieser Waffensammlung gibt. Wenn du nicht damit aufhörst, mit seltsamen Früchten herumzuexperimentieren…«
»Ich könnte das Schloß in die Luft jagen«, sagte sie und blickte den sich verteilenden Rauchschwaden nach. Der Boden war versengt, und einem der Tische fehlte ein Bein.
»Das Schloß in die Luft jagen…« wiederholte Bink, dem plötzlich ein Gedanke kam. »Chamäleon, warum holst du nicht noch ein paar Kirschbomben? Ich würde gerne mal mit ihnen experimentieren. Aber sei sehr vorsichtig. Du darfst nirgendwo anstoßen und auch keine fallen lassen.«
»Klar«, sagte sie mit dem gleichen Eifer, wie er ihn schon von den Gespenstern her kannte. »Ganz vorsichtig.«
»Und iß keine davon!« Das war mehr als nur ein Witz.
Bink suchte Stoff und Bindfaden zusammen und machte daraus verschieden große Beutel. Bald besaß er Beutelbomben unterschiedlicher Sprengkraft, die er an strategischen Punkten im Schloß verteilte. Einen Beutel behielt er selbst.
»Ich glaube, jetzt können wir Schloß Roogna verlassen«, sagte er. »Aber erst muß ich mit Trent reden. Du stellst dich hier an die Küchentür. Wenn du irgendwelche Zombies sehen solltest, dann bewirf sie mit Kirschen.« Er war überzeugt davon, daß kein Zombie genügend Koordinationsfähigkeit besaß, die Bomben aufzufangen und zurückzuwerfen. Verfaulendes Fleisch und wurmstichige Augen verliehen nun einmal keine sichere Zielhand. Folglich waren sie auch verwundbar. »Und wenn du Trent und nicht mich siehst, wie er hier herunterkommt, dann wirf eine Kirsche in diesen Haufen. Und zwar schnell, bevor er bis auf sechs Fuß an dich herangekommen ist.« Er zeigte auf eine große Bombe, die er an einer Stützsäule befestigt hatte. »Hast du verstanden?«
Das hatte sie nicht, aber er schärfte ihr alles so lange ein, bis sie es begriffen hatte. Sie sollte Kirschen auf alles werfen, was sich bewegte – außer auf Bink selbst.
Jetzt war er bereit.
Mit klopfendem Herzen machte er sich auf den Weg in die Bibliothek, um mit dem Bösen Magier zu reden.
Ein Gespenst versperrte ihm den Weg. Es war Milly, die Kammerzofe, die ihr weißes Laken so gerichtet hatte, daß es einem Zimmermädchenkleid ähnelte. Ihre schwarzen Augenlöcher wirkten irgendwie beinahe menschlich. In der jahrhundertelangen Isolation waren die Gespenster ziemlich verwahrlost, doch nun, da sie Gesellschaft hatten, nahmen sie ihre richtige Gestalt wieder an. In einer Woche würden sie wahrscheinlich die Gestalt von richtigen Leuten wiedererlangt haben und auch deren Gesichtsfarbe, obwohl sie dann immer noch Geister waren. Bink nahm an, daß Milly sich wohl als recht hübsches Mädchen entpuppen würde, und er fragte sich, wie sie wohl gestorben sein mochte. Hatte sie vielleicht ein Verhältnis mit einem Gast im Schloß gehabt und war von einer eifersüchtigen Ehefrau dabei erwischt und erdolcht worden?
»Was ist los, Milly?« fragte er und blieb stehen. Er hatte das Schloß zwar vermint, doch gegen seine unglücklichen Bewohner hatte er nichts. Er hoffte, daß sein Bluff Erfolg haben würde, damit er nicht das Heim dieser Gespenster vernichten mußte, die für die grandiosen Streiche des Schlosses ja nun wirklich nichts konnten.
»Der König… Privatkonferenz«, sagte sie. Ihre Stimme klang immer noch etwas atemlos, da ein Wesen mit so wenig stofflicher Substanz (sie besaß ja kaum Ektoplasma) Schwierigkeiten beim Artikulieren hatte. Aber er verstand sie trotzdem.
»Eine Konferenz? Es sind doch nur wir hier«, warf er ein. »Oder willst du damit sagen, daß er auf dem Topf sitzt?«
Milly errötete, so gut ihr das eben möglich war. »Nein!«
»Na ja, tut mir leid, aber dann muß ich ihn eben stören«, sagte Bink. »Siehst du, ich erkenne ihn nicht als König an, und ich möchte das Schloß bald verlassen.«
»Oh.« Sie legte eine neblige Hand mit einer sehr weiblichen, Unheil andeutenden Gebärde vor ihr Gesicht. »Aber sieh!«
»Na gut.« Bink folgte ihr in die kleine Kapelle, die an die Bibliothek grenzte. Es war eigentlich ein Nebenzimmer des Hauptschlafraums, ohne Zugang zur Bibliothek. Doch es stellte sich heraus, daß es darin ein kleines Fenster zur Bibliothek gab. Da die Kapelle nicht erleuchtet und somit dunkler war als der Nebenraum, konnte man hindurchschauen, ohne selbst gesehen zu werden.
Trent war nicht allein. Vor ihm stand eine Frau in mittleren Jahren, die noch immer sehr gut aussah, obwohl ihre Schönheit bereits nachgelassen hatte. Sie trug die Haare in einem strengen Knoten, aber um Augen und Mund herum hatte sie Lachfalten. Und neben ihr stand ein Junge von etwa zehn Jahren, der der Frau stark glich und wohl ihr Sohn war.
Keiner der beiden sagte etwas, doch ihr Atem und ihre leisen Bewegungen verrieten, daß sie lebten und stofflich waren, also keine Gespenster. Wie waren sie nur hierhergekommen? Und was wollten sie hier? Warum hatten weder Bink noch Chamäleon ihre Ankunft bemerkt? Es war so gut wie unmöglich, sich dem Schloß unbemerkt zu nähern. Und das Fallgatter versperrte noch immer den Haupteingang. Bink war ja am Kücheneingang gewesen und hatte Bomben gebastelt.
Aber da sie nun einmal hier waren – warum redeten sie dann nicht? Warum redete Trent nicht? Sie blickten einander in gespenstischer Stille an. All das ergab keinerlei Sinn.
Bink beäugte das seltsame, schweigende Paar. Sie erinnerten ihn dunkel an die Witwe und den Sohn des Schattens Donald, denen er von der Silbereiche berichtet hatte, damit sie nicht länger inArmut zu leben brauchten. Die Ähnlichkeit war keine rein körperliche, denn diese Leute hier sahen besser aus und hatten offensichtlich niemals Armut ertragen müssen; vielmehr hatten sie eine Aura stillen Verlustes an sich. Hatte die Frau wohl auch ihren Mann verloren? Und war sie zu Trent gekommen, damit er ihr irgendwie half? Wenn dies der Fall sein sollte, dann hatten sie sich aber den falschen Magier ausgesucht.
Bink zog sich zurück. Es war ihm unangenehm, zu schnüffeln. Selbst Böse Magier hatten ein Anrecht auf ein Privatleben. Er schritt hinaus in den Gang und kehrte zur Treppe zurück. Milly, die ihre Warnung ausgesprochen hatte, war verschwunden. Offensichtlich kostete es die Gespenster einige Anstrengung, sich zu manifestieren und verständlich zu sprechen, so daß sie sich in ihrer freien Zeit wohl in irgendeinem Vakuum davon erholen mußten.
Er ging wieder auf die Bibliothek zu. Diesmal trat er laut und heftig auf, damit sein Kommen zu hören war. Trent würde ihn seinen Besuchern vorstellen müssen.
Doch als Bink die Tür öffnete, war nur der Magier im Raum. Er saß an einem Tisch und las wieder in einem Buch. Als Bink eintrat, blickte er hoch. »Wollen Sie sich ein gutes Buch holen, Bink?« fragte er.
Bink verlor die Fassung. »Diese Leute! Was ist mit ihnen geschehen?«
Trent runzelte die Stirn. »Was für Leute, Bink?«
»Ich habe sie gesehen. Eine Frau und ein Junge, genau hier…« Bink zögerte. »Hören Sie, ich wollte wirklich nicht herumschnüffeln, aber als Milly mir sagte, daß Sie in einer Konferenz wären, da habe ich von der Kapelle aus ins Zimmer geschaut.«
Trent nickte. »Dann haben Sie sie also gesehen. Ich hatte nicht vor, Sie mit meinen privaten Problemen zu belasten.«
»Wer waren sie? Wie sind sie hierhergekommen? Was haben Sie mit ihnen gemacht?«
»Das waren meine Frau und mein Sohn«, sagte Trent ernst. »Sie sind tot.«
Bink fiel wieder die Geschichte ein, die der Matrose über die Familie des Bösen Magiers in Mundania erzählt hatte, die dort an einer Krankheit gestorben waren. »Aber sie waren doch hier drinnen, ich habe sie selbst gesehen.«
»Und was man sieht, das glaubt man auch.« Trent seufzte. »Bink, es waren zwei Küchenschaben, die ich in die Gestalt meiner Lieben verwandelt habe. Es waren die einzigen Menschen, die ich jemals geliebt habe oder jemals lieben werde. Ich vermisse sie, ich brauche sie… und sei es nur, indem ich ab und an ihre Gestalten ansehe. Als ich sie verloren habe, da hat mich nichts mehr in Mundania gehalten.« Er betupfte sein Gesicht mit einem bestickten Taschentuch aus dem Schloß, und Bink war erstaunt zu sehen, daß in den Augen des Bösen Magiers Tränen standen. Doch Trent beherrschte sich. »Aber das ist ja auch eigentlich nicht Ihre Angelegenheit, und ich ziehe es vor, nicht darüber zu reden. Was führt Sie zu mir, Bink?«
Ach ja. Er hatte etwas vorgehabt, und nun mußte er es auch durchführen. Irgendwie war ihm zwar der Wind aus den Segeln genommen worden, aber er sagte: »Chamäleon und ich werden Schloß Roogna verlassen.«
Trents makellose Stirn legte sich in Falten. »Schon wieder?«
»Diesmal wirklich«, sagte Bink gereizt. »Die Zombies werden uns nicht wieder aufhalten.«
»Und Sie halten es für nötig, mir darüber Mitteilung zu machen? Ich dachte eigentlich, daß wir uns über diesen Punkt verständigt hätten, und ich bin sicher, daß ich Ihre Abwesenheit zu gegebener Zeit schon bemerken würde. Wenn Sie befürchtet haben sollten, daß ich mich dagegenstellen würde, dann wäre es doch wohl vorteilhafter für Sie gewesen, ohne mein Wissen fortzugehen.«
Bink lächelte nicht. »Nein. Ich bin der Auffassung, daß ich durch unser Abkommen dazu verpflichtet bin, Sie darüber in Kenntnis zu setzen.«
Trent machte eine kleine, wedelnde Handbewegung. »Also gut. Ich kann nicht behaupten, daß ich froh bin, Sie gehen zu sehen. Ich habe Ihre Qualitäten schätzengelernt, wie sie sich etwa in Ihrer Sorgfalt äußern, mich über Ihr Weggehen zu informieren. Und Chamäleon ist ein feines Mädchen von gleicher Ehrbarkeit, und sie wird von Tag zu Tag hübscher. Es wäre mir viel lieber, Sie beide auf meiner Seite zu wissen, aber da dies wohl nicht sein soll, wünsche ich Ihnen, daß Sie anderswo Ihr Glück machen.«
Bink wurde immer verlegener. »Das hier ist nicht gerade ein höflicher Abschied. Tut mir leid.« Er wünschte sich jetzt, daß er Trents Frau und Sohn nicht gesehen hätte oder daß er wenigstens nicht erfahren hätte, wer sie waren. Es waren offensichtlich gute Menschen gewesen, die ihr Schicksal nicht verdient hatten, und Bink hatte wirkliches Mitgefühl für den trauernden Magier. »Das Schloß wird uns nicht freiwillig gehen lassen. Also müssen wir es dazu zwingen. Deshalb haben wir Bomben gelegt und…«
»Bomben!« rief Trent. »Das sind doch mundanische Erfindungen. In Xanth gibt es keine Bomben, und es wird auch niemals welche geben. Jedenfalls nicht, solange ich König bin.«
»Es sieht so aus, als hätte es auch früher schon Bomben gegeben«, erwiderte Bink beharrlich. »Draußen im Hinterhof steht ein Kirschbombenbaum. Jede dieser Kirschen explodiert mit großer Sprengkraft, wenn sie auf irgend etwas aufprallt.«
»Kirschbomben?« wiederholte Trent. »Soso. Was haben Sie denn mit den Kirschen getan?«
»Wir haben sie dazu benutzt, das Schloß zu verminen. Wenn Roogna versuchen sollte, uns aufzuhalten, dann werden wir es vernichten. Es wäre also besser, wenn es uns… in Frieden ziehen ließe. Ich mußte es Ihnen sagen, damit Sie die Bomben nach unserer Abreise entschärfen können.«
»Warum erzählen Sie mir das? Stellen Sie sich denn nicht gegen meine Pläne und gegen die von Schloß Roogna? Wenn Magier und Schloß vernichtet würden, dann wären Sie doch der strahlende Sieger.«
»Strahlend? Nein. Das ist nicht die Art von Sieg, die ich mir wünsche«, erwiderte Bink. »Ich… hören Sie, Sie könnten so viel Gutes für Xanth tun, wenn Sie doch nur…« Aber Bink wußte, daß es zwecklos war. Es lag einfach nicht in der Natur eines Bösen Magiers, sich dem Guten zu widmen. »Hier ist eine Skizze mit einer Liste, wo sich die Bomben befinden«, sagte er und legte ein Papier auf den Tisch. »Sie brauchen die Beutel und Pakete einfach nur vorsichtig aufzuheben und ins Freie zu tragen.«
Trent schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, daß Ihnen damit die Flucht gelingen wird, Bink. Das Schloß ist nicht in sich selbst intelligent. Es reagiert nur auf bestimmte Reize. Es würde Chamäleon vielleicht ziehen lassen, aber Sie nicht. Seiner Meinung nach sind Sie ein Magier, folglich müssen Sie auch hierbleiben. Mag sein, daß Sie schlauer waren als Schloß Roogna, aber es wird den ganzen Umfang Ihres Plans nicht begreifen. Also werden die Zombies Sie genauso aufhalten wie zuvor.«
»Dann müssen wir es bombardieren.«
»Ganz genau. Sie werden die Kirschen zur Explosion bringen müssen und uns alle gemeinsam vernichten.«
»Nein, wir verlassen erst das Schloß und werfen eine Kirsche darauf. Wenn es sich nicht bluffen läßt…«
»Man kann es nicht bluffen. Es ist kein denkendes Wesen, es reagiert nur. Sie werden gezwungen sein, es zu vernichten – und Sie wissen doch, daß ich das nicht zulassen darf. Ich brauche Roogna!«
Jetzt wurde es schwierig, doch Bink war vorbereitet. »Chamäleon wird die Bomben zünden, wenn Sie mich verwandeln sollten«, sagte er und spürte, wie es ihm kalt den Rücken herunterlief. Diese Art von Machtspiel gefiel ihm gar nicht, aber er hatte ja gewußt, daß es einmal soweit kommen würde. »Wenn Sie sich in irgendeiner Weise einmischen sollten…«
»Oh, ich würde das Abkommen schon nicht verletzen. Aber…«
»Sie können das Abkommen gar nicht verletzen. Entweder kehre ich allein zu Chamäleon zurück, oder sie wirft eine Kirsche in eine Bombe hinein. Sie ist zu dumm, um irgend etwas anderes zu tun, als Anweisungen zu befolgen.«
»Hören Sie mir zu, Bink! Mein Ehrenwort ist es, was mich daran hindert, das Abkommen zu verletzen, nicht Ihre taktischen Vorbereitungen. Ich könnte Sie in einen Floh und dann eine Schabe in Ihre Gestalt verwandeln und sie zu Chamäleon hinunterschicken. Wenn sie die Kirsche erst einmal weggelegt hat, dann…«
Binks Gesichtsausdruck verriet seine Betroffenheit. Der Böse Magier konnte seinen Plan tatsächlich zunichte machen. Chamäleon, die Dumme, würde alles erst merken, wenn es zu spät war. Ihre mangelnde Intelligenz war seine Stärke, aber auch seine Schwäche zugleich.
»Ich werde es nicht tun«, sagte Trent. »Ich erzähle Ihnen lediglich von dieser Möglichkeit, um Ihnen zu beweisen, daß auch ich so etwas wie einen Ehrenkodex besitze. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Ich bin der Ansicht, daß Sie diesen Grundsatz einen Augenblick außer acht gelassen haben, und wenn Sie mir einmal zuhören, dann werden Sie Ihren Fehler bestimmt erkennen
und rückgängig machen. Ich darf es nicht zulassen, daß Sie dieses herrliche und historisch so wertvolle Gebäude vernichten, um keinen Preis!«
Bink fühlte sich bereits schuldig. Wollte der andere ihm eine Sache ausreden, von der er doch wußte, daß sie richtig war?
»Es ist Ihnen doch sicherlich klar«, fuhr der Magier eindringlich fort, »daß sich das ganze Gebiet vor Rache auflehnen würde, wenn Sie Ihren Plan durchführten. Sie wären dann zwar vielleicht nicht mehr im Schloß, aber Sie wären immer noch in der Umgebung von Roogna, und Sie würden eines entsetzlichen Todes sterben. Und Chamäleon auch.«
Chamäleon auch – das tat weh. Dieses schöne Mädchen, von einem Gewirrbaum aufgefressen, von Zombies zerrissen… »Dieses Risiko muß ich eingehen«, entgegnete Bink grimmig, obwohl er einsah, daß der Magier recht hatte. So wie man sie in dieses Schloß getrieben hatte – niemals würde man sie gehen lassen. »Vielleicht könnten Sie ja das Schloß davon überzeugen, daß es uns gehen lassen soll, anstatt eine solche Kettenreaktion auszulösen.«
»Sie sind vielleicht ein sturer Kopf!«
»Stimmt.«
»Hören Sie mir wenigstens zu, bis ich fertig bin. Wenn ich Sie nicht überzeugen kann, dann muß eben geschehen, was geschehen muß, sosehr ich das verhindern möchte.«
»Machen Sie’s kurz.« Bink war von seiner eigenen Frechheit erstaunt, aber er wußte nun einmal, was er zu tun hatte. Wenn Trent sich ihm auf sechs Fuß nähern sollte, dann würde er fliehen, um nicht verwandelt zu werden. Vielleicht konnte er dem Magier ja entkommen. Doch so oder so durfte er keine Zeit verschwenden, denn er mußte befürchten, daß Chamäleon des Wartens müde werden und irgendeine Dummheit anstellen würde.
»Ich möchte wirklich nicht, daß Sie oder Chamäleon sterbenmüssen, und an meinem eigenen Überleben bin ich natürlich auch interessiert«, sagte Trent. »Auch wenn ich jetzt niemanden mehr liebe, so sind Sie beide mir doch nähergekommen als sonst ein Mensch. Es ist beinahe so, als habe das Schicksal es so gewollt, daß verwandte Seelen aus der gewöhnlichen Gesellschaft Xanths ausgeschlossen werden müßten. Wir…«
»Verwandte Seelen!« rief Bink empört.
»Es tut mir leid, wenn ich unzulässige Vergleiche gezogen haben sollte. Wir haben in einer recht kurzen Zeit ziemlich viel durchgemacht, und es ist wohl nur gerecht, wenn ich feststelle, daß wir einander gelegentlich auch das Leben gerettet haben. Vielleicht bin ich ja nur nach Xanth zurückgekommen, um mich mit Ihresgleichen zusammenzutun.«
»Vielleicht«, sagte Bink steif und unterdrückte die gemischten Gefühle, die in ihm aufstiegen. »Aber das rechtfertigt noch lange nicht, daß Sie Xanth erobern und wahrscheinlich ganze Familien dabei ausrotten werden.«
Trent wirkte schmerzlich berührt, aber er beherrschte sich. »Das behaupte ich ja auch gar nicht, Bink. Die Tragödie meiner Familie in Mundania war nur der Auslöser, nicht der Grund für meine Rückkehr. Mich hielt in Mundania nichts mehr, also habe ich meine Aufmerksamkeit natürlich wieder auf mein Heimatland Xanth gerichtet. Ich hoffe, ihm Gutes anzutun, indem ich es für die Realitäten der Gegenwart öffne, bevor es zu spät ist. Ich will Xanth nichts Böses tun. Selbst wenn es zu einigen Todesopfern kommen sollte, dann wäre dieser Preis für die Rettung Xanths doch nicht zu hoch.«
»Sie glauben wirklich, daß Xanth nicht überleben wird, wenn Sie es nicht retten?« Bink versuchte, abfällig zu klingen, aber es gelang ihm nicht so recht. Wenn er doch nur ebenso redegewandt wäre wie der Böse Magier!
»Ja, das tue ich wirklich. In Xanth ist eine neue Kolonisationswelle überfällig, und eine solche Welle würde ihm genauso dienen, wie es die anderen getan haben.«
»Die Wellen haben zu Mord und Vergewaltigung und Zerstörung geführt! Sie sind der Fluch Xanths gewesen!«
Trent schüttelte den Kopf. »Bei manchen war das der Fall, ja. Aber andere waren äußerst segenreich, wie etwa die vierte Welle, aus der dieses Schloß noch stammt. Es war weniger die Tatsacheder Wellen, als ihre mangelhafte Lenkung, die dem Land Ärger beschert hat. Alles in allem waren sie seinem Fortschritt dienlich, waren sie lebenswichtig. Aber ich erwarte ja gar nicht, daß Sie mir das glauben. Im Augenblick möchte ich Sie nur davon überzeugen, daß Sie dieses Schloß und sich selbst verschonen sollten. Ich versuche nicht, Sie von meiner Sache zu überzeugen.«
Irgend etwas an diesem Gespräch beunruhigte Bink zutiefst. Der Böse Magier wirkte viel zu reif, zu weise, zu engagiert. Trent irrte sich, er mußte sich irren, und doch redete er so überzeugend, daß Bink Schwierigkeiten hatte, diesen Irrtum aufzudecken. »Versuchen Sie doch, mich zu überzeugen«, sagte er.
»Ich bin froh, daß Sie das sagen, Bink. Ich möchte gerne, daß Sie meine logische Begründung für mein Tun kennen. Vielleicht können Sie mir ja auch mit konstruktiver Kritik dienen.«
Das klang nach einer raffinierten intellektuellen List. Bink versuchte, es als Sarkasmus zu werten, aber er war sich sicher, daß das nicht der Fall war. Er fürchtete zwar, daß der Magier intelligenter war als er, aber er wußte auch, daß er recht hatte. »Vielleicht kann ich das ja«, sagte er vorsichtig. Er hatte ein Gefühl, als wage er sich in eine Wildnis hinaus und als wähle er nur die sichersten Pfade, ohne jedoch der Falle in der Mitte entgehen zu können. Schloß Roogna – auf der körperlichen und auf der intellektuellen Ebene. Roogna hatte achthundert Jahre einer Stimme entbehrt, doch nun hatte es eine gefunden. Bink konnte gegen diese Stimme genausowenig anfechten wie gegen das scharfe Schwert des Magiers – aber er mußte es versuchen.
»Meine Begründung ist zweiteilig, ein Teil bezieht sich auf Mundania, ein anderer auf Xanth. Sehen Sie, trotz mancher ethischer und moralischer Rückschläge hat Mundania in den
letzten paar Jahrhunderten bemerkenswerte Fortschritte gemacht, dank einer Reihe von Leuten, die Entdeckungen gemacht und Informationen verbreitet haben. In mancher Hinsicht ist es ein viel zivilisierteres Gebiet als Xanth. Leider ist auch die Kampfkraft der Mundanier gewachsen. Das müssen Sie mir einfach glauben, denn ich kann es Ihnen jetzt nicht beweisen. Mundania besitzt Waffen, die mit Leichtigkeit alles Leben in Xanth auslöschen können, trotz des Schilds!«
»Das ist eine Lüge!« rief Bink. »Nichts kann den Schild durchdringen!«
»Außer uns dreien, vielleicht«, murmelte Trent. »Aber der Schild schützt vornehmlich vor Lebewesen. Sie könnten den Schild durchdringen, Ihr Körper würde ganz leicht hindurchgelangen, aber Sie wären tot, wenn Sie auf der anderen Seite ankämen.«
»Das ist dasselbe.«
»Das ist gar nicht dasselbe, Bink! Sehen Sie, es gibt dort große Kanonen, die Projektile verschießen, die von Anfang tot sind, zum Beispiel mächtige Bomben, wie Ihre Kirschbomben, nur noch viel schlimmer, die man so einstellen kann, daß sie bei Berührung explodieren. Wenn die Mundanier es darauf angelegt hätten, so könnten sie Xanth damit bepflastern. Dabei würde selbst der Schildstein vernichtet werden. Das Volk von Xanth kann es sich einfach nicht mehr erlauben, die Mundanier zu ignorieren. Es gibt viele von ihnen, wir können nicht auf alle Zeiten unentdeckt bleiben. Sie können uns auslöschen und werden es eines Tages auch tun. Es sei denn, daß wir jetzt Beziehungen mit ihnen
anknüpfen.«
Bink schüttelte ungläubig und verständnislos den Kopf.
Trent fuhr jedoch ohne jede Bissigkeit fort. »Was nun Xanth angeht, da sieht es ganz anders aus. Es stellt für Mundania keine Bedrohung dar, weil die Magie dort nicht wirkt. Aber es stellt selbst eine schleichende und doch gewaltige Bedrohung für das Leben dar, wie wir es in Xanth kennen.«
»Xanth stellt eine Bedrohung für Xanth dar? Das ist ja der reine Unsinn!«
Jetzt lächelte Trent ein wenig herablassend. »Ich sehe schon, daß Sie wohl einige Schwierigkeiten mit der Logik der neuesten mundanischen Wissenschaft hätten.« Doch bevor Bink nachhaken konnte, wurde er wieder ernst. »Nein, ich bin nicht unfair zu Ihnen. Diese innere Bedrohung Xanths ist etwas, das ich selbst erst in den letzten Tagen in dieser Bibliothek erfahren habe, und es ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Schon dieser Aspekt allein rechtfertigt die Notwendigkeit, dieses Schloß zu erhalten, denn seine Sammlung alter Überlieferungen ist lebenswichtig für die Gesellschaft Xanths.«
Bink zweifelte immer noch. »Wir haben achthundert Jahre ohne diese Bibliothek gelebt, wir können es auch jetzt tun.«
»Ah, aber was für ein Leben!« Trent schüttelte den Kopf, als fehlten ihm die Worte. Er erhob sich und ging an ein Regal, das hinter ihm stand, wo er ein Buch hervorholte und es vorsichtig durchblätterte. Schließlich legte er es geöffnet vor Bink auf den Tisch. »Was ist das für ein Bild?«
»Ein Drache«, sagte Bink prompt.
Trent blätterte um.
»Und das hier?«
»Eine Manticora.« Was sollte das? Die Bilder waren ja ganz hübsch, auch wenn sie sich nicht genau mit dem Aussehen der heutigen Wesen deckten. Die Proportionen und Einzelheiten wiesen feine Unterschiede auf.
»Und das?« Es war eine Darstellung eines menschköpfigen Vierbeiners mit
Hufen, einem Pferdeschweif und katzenartigen Vorderbeinen.
»Eine Lamia.«
»Und das?«
»Ein Zentaur. Hören Sie, wir können den ganzen Tag Bilder
bestaunen, aber…«
»Was haben diese Wesen gemeinsam?« fragte Trent.
»Sie besitzen menschliche Köpfe oder Vorderteile, bis auf den Drachen, obwohl der hier im Buch eine beinahe menschliche kurze Schnauze hat. Manche davon besitzen auch menschliche Intelligenz. Aber…«
»Genau! Und jetzt denken Sie doch mal über die Konsequenzen nach. Wenn man einen Drachen durch die verschiedenen ähnlichen Arten zurückverfolgt, dann wird er immer menschenähnlicher. Fällt Ihnen dazu irgend etwas ein?«
»Nur, daß manche Wesen eben menschenähnlicher sind als andere. Aber das ist noch keine Bedrohung für Xanth. Außerdem sind die meisten dieser Abbildungen veraltet. Heute stehen diese Wesen etwas anders aus.«
»Haben die Zentauren Sie in der Evolutionstheorie unterrichtet?«
»Oh, sicher. Daß die Wesen von heute sich von primitiveren Formen entwickelt haben, daß nur die stärksten überlebten. Wenn man weit genug zurückgeht, dann findet man einen gemeinsamen Vorfahren.«
»Genau. Aber in Mundania haben sich Wesen wie die Lamia, die Manticora und der Drache nie entwickelt.«
»Natürlich nicht. Es sind magische Wesen. Sie entwickeln sich durch magische Auswahl. Nur in Xanth können…«
»Und doch stammen die Wesen Xanths offenbar von mundanischen Vorfahren ab. Sie weisen derart zahlreiche Verwandtschaften auf…«
»Also gut!« sagte Bink ungeduldig. »Sie stammen von Mundaniern ab. Was hat das mit Ihrer Eroberung von Xanth zu tun?«
»Der konventionellen Zentaurengeschichtsschreibung zufolge lebt der Mensch erst seit tausend Jahren in Xanth«, sagte Trent. »In diesem Zeitraum hat es zehn Haupteinwanderungswellen aus Mundania gegeben.«
»Zwölf«, sagte Bink.
»Das hängt von der Zählweise ab. Jedenfalls ist das neunhundert Jahre lang geschehen, bis der Schild diese Einwanderung gestoppt hat. Und doch gibt es eine Reihe von teilmenschlichen Formen, die vor dem angeblichen Eintreffen des Menschen liegen. Sagt Ihnen das etwas?«
Bink machte sich immer mehr Sorgen, daß Chamäleon irgendwelchen Unsinn anstellen würde oder daß das Schloß die Kirschbomben irgendwie neutralisieren würde. Er war nicht völlig davon überzeugt, daß Schloß Roogna nicht eigenständig denken konnte. Versuchte der Böse Magier, Zeit zu gewinnen? »Ich gewähre Ihnen noch eine Minute, um Ihre Position darzustellen. Dann gehen wir, so oder so.«
»Wie können sich teilmenschliche Formen entwickeln, ohne menschliche Vorfahren gehabt zu haben? Konvergente Evolution führt nicht zu diesem unnatürlichen Monstermischmasch, den wir hierzulande finden. Sie bringt Wesen hervor, die sich ihrer jeweiligen Umwelt angepaßt haben, und menschliche Züge passen nicht in viele Umwelten. Es muß also Menschen in Xanth gegeben haben, vor vielen Tausenden von Jahren.«
»Schön«, stimmte Bink ihm zu. »Noch dreißig Sekunden.«
»Diese Menschen müssen sich mit Tieren gepaart haben, so daß die zusammengesetzten Formen entstanden sind, die wir heute kennen – die Zentauren, die Manticoras, die Meermenschen, die Harpyien und so weiter. Und dann haben sich diese Mischformen miteinander vermengt, so daß neue Mischformen entstanden sind, die sich wieder miteinander vermengt haben, und so sind dann eben Wesen entstanden wie die Schimäre…«
Bink wandte sich ab, um zu gehen. »Ich glaube, die Minute ist um«, sagte er. Dann blieb er wie angewurzelt stehen. »Sie haben was!«
»Die Arten haben sich mit anderen Arten gekreuzt, um Hybriden hervorzubringen. Menschenköpfige Tiere, Menschen mit Tierköpfen…«
»Unmöglich! Menschen können sich nur mit Menschen paaren. Es wäre unnatürlich…«
»Xanth ist ein unnatürliches Land, Bink. Die Magie macht viele merkwürdige Dinge möglich.«
Bink mußte einsehen, daß die Logik hier dem Gefühl einiges voraus hatte. »Aber selbst wenn es so gewesen sein sollte,« sagte er gepreßt, »dann ist das noch immer keine Entschuldigung dafür, daß Sie Xanth erobern wollen. Was geschehen ist, ist geschehen. Ein Regierungswechsel wird nicht…«
»Ich meine, daß meine Machtergreifung vor diesem Hintergrund gerechtfertigt ist, Bink. Denn die beschlagnahmte Evolution und die Mutationen, die durch Magie und Artenvermischung bewirkt werden, verändern Xanth. Wenn wir von der mundanischen Welt abgeschnitten bleiben, dann wird es eines Tages keine Menschen mehr hier geben, sondern nur noch Kreuzungen. Nur der ständige Zustrom reinen menschlichen Erbguts hat im letzten Jahrtausend den Menschen hier überleben lassen, und allzu viele Menschen gibt es hier gar nicht mehr. Unsere Bevölkerung wird kleiner. Nicht wegen Hungersnöten, Seuchen oder Krieg, sondern wegen der Kreuzungen. Wenn ein Mann sich mit einer Harpyie paart, dann bringen sie eben kein Menschenkind hervor.«
»Nein!« rief Bink entsetzt. »Das würde niemand… niemand würde mit einer dreckigen Harpyie ein Kind zeugen.«
»Mit einer dreckigen vielleicht nicht. Aber wie steht es denn mit einer sauberen, hübschen Harpyie?« fragte Trent mit gehobener Augenbraue. »Sie sind nicht alle so, müssen Sie wissen. Wir sehen immer nur die Ausgestoßenen, nicht die knackigen jungen…«
»Nein!«
»Angenommen, er hat von einem Liebesquell getrunken, aus Versehen… und wenn als nächstes eine Harpyie aus der Quelle trinkt, was dann?«
»Nein. Er…« Aber Bink wußte es besser. Er erinnerte sich an sein Erlebnis an dem Liebesquell am Rande der Spalte. Da war auch eine Harpyie gewesen. Er erschauerte.
»Sind Sie niemals von einer anziehenden Meerjungfrau oder einer Zentaurendame angezogen worden?« beharrte Trent.
»Nein!« Aber vor seinem inneren Auge erblickte er wieder die festen, schönen Brüste von Meerjungfrauen. Und er mußte an Cherie denken – hatte er sie wirklich nur aus Versehen berührt? Die Ehrlichkeit zwang ihn dazu, seine Behauptung zu korrigieren. »Na ja, vielleicht.«
»Und es hat sicherlich andere gegeben, die weniger Skrupel hatten als Sie«, fuhr Trent fort. »Unter gewissen Umständen hätte es doch dazu kommen können, nicht wahr? Nur so zur Abwechslung, vielleicht? Lungern die Jungen in Ihrem Dorf etwa nicht mehr am Rande des Zentaurengebiets herum, wie zu meiner Zeit?«
Ja, Jungen wie Zink und Jama und Potipher, Schläger und Taugenichtse, die das ganze Zentaurenlager in Aufruhr versetzt hatten. Auch daran mußte Bink denken. Das war ihm vorher noch nie in dieser Tragweite bewußt geworden. Natürlich waren sie losgezogen, um die barbusigen Stuten zu sehen. Und wenn sie eine davon vielleicht allein erwischten…
Bink merkte, daß er errötete. »Worauf wollen Sie hinaus?« fragte er und versuchte dabei, seine Verlegenheit zu überspielen.
»Nur darauf: Xanth muß Beziehungen – Entschuldigung, das war ein unglückliches Wort, muß Kontakt mit Mundania aufgenommen haben, und zwar schon lange vor der Zeit, über die uns die Aufzeichnungen berichten. Vor den Wellen. Denn nur in Mundania ist die menschliche Rasse in ihrer reinen Form vorhanden. Sobald ein Mensch seinen Fuß nach Xanth setzt, verändert er sich bereits. Er entwickelt magische Fähigkeiten, und seine Kinder entwickeln noch mehr, bis einige davon echte Vollblutmagier werden. Und wenn sie hierbleiben, dann werden sie unweigerlich zu magischen Wesen. Oder ihre Nachkommen.
Entweder indem sie die natürlichen Grenzen zwischen den Arten durchbrechen, oder indem sie sich zu Kobolden, Elfen, Riesen, Trollen entwickeln – haben Sie sich Humfrey einmal genau angesehen?«
»Er ist ein Gnom«, antwortete Bink, ohne nachzudenken. Dann: »O nein!«
»Er ist ein Mensch, und zwar ein guter, aber ist schon weit auf dem Weg zu etwas anderem fortgeschritten. Jetzt steht er auf dem Höhepunkt seiner Macht, aber seine Kinder, sofern er jemals welche bekommen sollte, könnten echte Gnome werden.
Ich vermute, daß er das auch weiß und aus diesem Grund nicht heiraten möchte. Und nehmen Sie einmal Chamäleon: Sie besitzt keine direkte Magie, weil sie selbst magisch geworden ist. Und so wird es schließlich der ganzen menschlichen Bevölkerung von Xanth einmal ergehen – sofern nicht ständig frisches Blut aus Mundania eingebracht wird. Der Schild muß abgeschafft werden! Man muß es den magischen Wesen von Xanth gestatten, sich frei nach draußen zu bewegen, um dort nach und nach wieder zu ihren ursprünglichen Arten zurückzukehren, sich zurückzuentwickeln. Es müssen neue Triebe hereinkommen.«
»Aber…« Bink merkte, wie er mit den Schrecken rang, die dieses Konzept für ihn barg. »Wenn es… wenn es schon immer einen Austausch gegeben hat, was ist dann aus den Menschen geworden, die vor Jahrtausenden hereingekommen sind?«
»Vermutlich gab es eine Zeitlang irgendein Hindernis, das diesen Austausch blockierte. Es könnte sein, daß Xanth etwa tausend Jahre lang eine echte Insel gewesen ist, auf der die Ursiedler gefangen waren, so daß sie sich völlig mit den dort vorhandenen Arten vermengten. Auf diese Weise entstanden dann vielleicht die Zentauren und andere Abarten. Unter dem Schild geschieht dies gerade aufs neue. Die Menschen müssen…«
»Genug!« sagte Bink, der bis auf die Grundfesten erschüttert und schockiert war. »Mehr kann ich nicht mitanhören.«
»Werden Sie die Kirschbomben entschärfen?«
Wie ein Blitzstrahl kehrte die Vernunft zurück. »Nein! Ich werde Chamäleon holen und gehen – und zwar jetzt.«
»Aber Sie müssen doch begreifen…«
»Nein.« Wieder schien der Böse Magier recht zu haben. Wenn Bink ihm noch länger zuhörte, dann war es um ihn geschehen – und um Xanth. »Was Sie da vorschlagen, ist eine Perversion. Es kann einfach nicht wahr sein. Ich kann es nicht glauben.«
Trent seufzte, und offenbar tat es ihm wirklich leid. »Na ja, einen Versuch war es ja wert, obwohl ich schon befürchtet habe, daß Sie ablehnen würden. Ich darf immer noch nicht zulassen, daß Sie dieses Schloß vernichten…«
Bink spannte seine Muskeln an, um aus dem Wirkungsbereich des Magiers zu springen. Sechs Fuß…
Trent schüttelte den Kopf. »Kein Grund zur Flucht, Bink. Ich werde das Abkommen nicht brechen. Das hätte ich schon tun können, als ich Ihnen die Bilder gezeigt habe, aber mein Ehrenwort ist mir heilig. Also muß ich einen Kompromiß eingehen. Wenn Sie sich mir nicht anschließen wollen, dann muß ich mich wohl Ihnen anschließen.«
»Was?« Bink traute seinen Ohren nicht.
»Verschonen Sie Schloß Roogna. Entschärfen Sie die Bomben.
Ich werde Sie sicher aus dieser Gegend führen.«
Das klang viel zu einfach. »Ehrenwort?«
»Ehrenwort«, erwiderte Trent feierlich.
»Sie können das Schloß dazu bringen, uns gehen zu lassen?«
»Ja. Das ist noch etwas, was ich aus diesen Archiven gelernt habe. Ich muß nur die richtigen Worte sagen, dann wird es unsere Abreise sogar begünstigen.«
»Ihr Ehrenwort«, sagte Bink mißtrauisch. Bisher hatte Trent es nicht gebrochen – aber welche Garantie gab es andererseits schon dafür? »Keine Tricks, kein plötzlicher Gesinnungswandel?«
»Mein Ehrenwort, Bink.«
Was sollte er tun? Wenn der Magier das Abkommen verletzen wollte, dann könnte er ihn auf der Stelle in eine Kaulquappe verwandeln, sich dann an Chamäleon heranschleichen und sie verwandeln. Und – Bink neigte dazu, ihm zu glauben. »Also gut.«
»Gehen Sie und entschärfen Sie die Bomben. Ich werde mich um Roogna kümmern.«
Bink ging fort. Chamäleon begrüßte ihn mit einem kleinen Freudenschrei, und diesmal war er durchaus bereit, sich von ihr umarmen zu lassen. »Trent hat sich damit einverstanden erklärt, uns hier rauszubringen«, sagte er zu ihr.
»Ach Bink, ich bin so froh!« rief sie und gab ihm einen Kuß. Er mußte ihre Hand ergreifen, um sicherzugehen, daß sie die restlichen Kirschbomben nicht fallen ließ.
Sie wurde stündlich schöner. Ihre Persönlichkeit veränderte sich nicht sonderlich, nur daß sie durch ihre schwindende Intelligenz weniger komplex und mißtrauisch wurde. Er mochte diese Persönlichkeit – und nun mußte er sich eingestehen, daß er ihre Schönheit auch mochte. Sie gehörte zu Xanth, sie war magisch, sie versuchte nicht, ihn zu manipulieren – sie war sein Typ von Mädchen.
Aber er wußte, daß ihre Dummheit ihn abstoßen würde, so wie es ihre Häßlichkeit während ihrer anderen Phase tun würde. Er konnte weder mit einer schönen Idiotin noch mit einem häßlichen Genie zusammenleben. Körperlich anziehend war sie nur jetzt, da er sich an ihre Intelligenz noch gut erinnern und er ihre Schönheit berühren und sehen konnte. Es wäre Narrheit gewesen, etwas anderes zu glauben.
Er wich zurück. »Wir müssen die Bomben entfernen. Vorsichtig«, sagte er.
Aber was war mit den Gefühlsbomben in seinem Inneren?