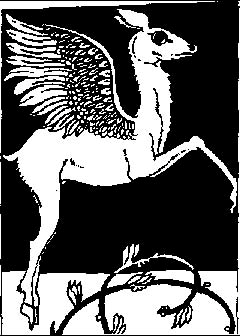
15 Das Duell
Sie kamen auf einen bewaldeten Grat, und mit einemmal war die Wildnis zu Ende. Vor ihnen erstreckten sich die blauen Felder einer Blue-Jeans-Plantage: Zivilisation.
Trent und Chamäleon stiegen ab. Bink war die ganze Nacht unermüdlich dahingeeilt und hatte geschlafen, während seine riesigen Beine von alleine gearbeitet hatten. Sie waren nicht mehr behelligt worden, denn auch die wildesten Tiere der Wildnis waren vorsichtig genug, um sich nicht mit ihnen anzulegen. Jetzt war es später Vormittag, und es war ein schöner, heller Tag. Er fühlte sich wohl.
Plötzlich war er wieder ein Mensch – und fühlte sich immer noch gut. »Ich schätze, jetzt werden wir uns wohl trennen«, sagte er.
»Tut mir wirklich leid, daß wir uns nicht besser einigen konnten«, sagte Trent und streckte ihm die Hand entgegen. »Aber ich bin sicher, daß unsere Trennung auch solche Differenzen vergessen machen wird. Es war mir eine Freude, Sie beide kennengelernt zu haben.«
Bink schüttelte die Hand und fühlte sich merkwürdig niedergedrückt. »Ich schätze, per Definition und Talent sind Sie wirklich der Böse Magier – aber Sie haben geholfen, Xanth vor den Zapplern zu retten, und persönlich haben Sie sich als Freund erwiesen. Ich teile zwar nicht Ihre Ziele, aber…« Er zuckte mit den Schultern. »Leben Sie wohl, Magier.«
»Gleichfalls«, sagte Chamäleon und schenkte Trent ein Lächeln, das ihren Mangel an Intelligenz mehr als wettmachte.
»Na, wenn das aber nicht gemütlich ist!« sagte eine Stimme.
Sie drehten sich abwehrbereit herum – doch es war nichts zu sehen. Nichts als die reifenden Jeans auf ihren grünen Sträuchern und der abweisende Dschungelrand.
Da bildete sich plötzlich ein Rauchwirbel und nahm immer schneller Gestalt an.
»Ein Flaschengeist«, meinte Chamäleon.
Doch jetzt erkannte Bink die Gestalt. »Nein, viel schlimmer«, sagte er. »Das ist die Zauberin Iris, die Meisterin der Illusion.«
»Danke für deine elegante Vorstellung, Bink«, sagte die nun stofflich wirkende Frau. Sie stand inmitten der Jeans und trug ein verführerisches Kleid mit weitem Ausschnitt, aber Bink reizte ihr Aussehen nicht mehr. Auch wenn sie magisch war, so hatte Chamäleon doch eine natürliche Anziehungskraft, die die Magierin nicht nachahmen konnte.
»Das ist also Iris«, sagte Trent. »Ich habe von ihr gehört, bevor ich Xanth verlassen habe, schließlich gehören wir ja derselben Generation an, aber wir sind uns noch nie begegnet. Ihr Talent hat sie wirklich gut im Griff.«
»Es war nur so, daß ich keine allzu große Lust darauf verspürte, verwandelt zu werden«, meinte Iris und blickte ihn schelmisch an. »Sie haben ja einen ganzen Schwanz von Kröten und Käfern und Bäumen und solchen Dingen hinter sich gelassen. Ich dachte, man hätte Sie ins Exil geschickt.«
»Die Zeiten ändern sich, Iris. Haben Sie uns in der Wildnis nicht beobachtet?«
»Nein, das habe ich nicht. Dieser Dschungel ist ein ziemlicher trostloser Ort mit einer ganzen Anzahl Zauber gegen Illusionen, und ich wußte ja auch nicht, daß Sie wieder in Xanth sind. Ich glaube, daß niemand das bereits weiß, nicht einmal Humfrey. Die riesige Sphinx hat meine Aufmerksamkeit erregt, aber ich war mir nicht sicher, daß Sie etwas damit zu tun hatten, bis ich selbst sehen konnte, wie Sie Bink verwandelt haben. Ich wußte, daß man ihn vor kurzem ins Exil geschickt hatte, folglich mußte hier irgend etwas faul sein. Wie sind Sie denn durch den Schild gekommen?«
»Die Zeiten ändern sich«, wiederholte Trent rätselhaft.
»Ja, das tun sie«, erwiderte sie pikiert. Sie blickte sie nacheinander an. Bink hatte gar nicht gewußt, daß sie ihre Illusionen derart gelungen so weit projizieren und daß sie auf diese Entfernungen sehen konnte. Die Macht der Magier und Zauberinnen reichte eben bis in die seltsamsten Gebiete hinein. »Kommen wir jetzt zum Geschäftlichen?«
»Zum Geschäftlichen?« fragte Bink erstaunt.
»Seien Sie doch nicht so naiv«, brummte Trent. »Das Aas meint Erpressung.«
Jetzt stand also starke Magie gegen starke Magie. Vielleicht würden sie sich ja gegenseitig ausschalten, dann wäre Xanth doch noch gerettet. Damit hatte Bink nicht gerechnet.
Iris sah ihn an. »Bist du sicher, daß du nicht doch auf mein früheres Angebot zurückkommen willst, Bink?« fragte sie. »Ich könnte es so einrichten, daß man deine Verbannung rückgängig macht. Du könntest immer noch König werden. Die Zeit ist reif dafür. Und wenn du wirklich unschuldig aussehende Frauen bevorzugen solltest…«
Plötzlich stand eine zweite Chamäleon vor ihm, so schön wie die echte. »Alles, was du willst, Bink – und auch noch voller Intelligenz.«
Dieser Seitenhieb ärgerte ihn. »Geh und spring doch in die Spalte!« sagte Bink.
Die Gestalt verwandelte sich in eine schöne Zauberin, und Iris wandte sich an Chamäleon. »Ich kenne dich nicht, meine Liebe, aber es wäre doch wirklich schade, wenn du zum Drachenfutter würdest.«
»Ein Drache!« schrie Chamäleon verängstigt.
»Das ist nun einmal die herkömmliche Strafe dafür, daß man gegen das Exilierungsgesetz verstößt. Wenn ich die Behörden verständige und sie ihre Magiesucher auf euch drei ansetzen,
dann…«
»Laß sie in Frieden!« sagte Bink im scharfem Ton.
Iris beachtete ihn nicht. »Tja, wenn du deinen Freund doch nur dazu bewegen könntest, mitzuarbeiten«, sagte sie zu Chamäleon, »dann könntest du diesem schrecklichen Schicksal entgehen. Diese Drachen knabbern wirklich schrecklich gern an hübschen Gliedmaßen herum. Und du könntest auch die ganze Zeit schön sein.« Iris hatte zwar behauptet, Chamäleon nicht zu kennen, aber offensichtlich hatte sie sich einiges zusammengereimt. »Ich kann dich in deiner anderen Phase genauso schön erscheinen lassen, wie du es jetzt bist.«
»Wirklich?« fragte Chamäleon aufgeregt.
»Die Listen der Zauberin sind wirkungsvoll«, sagte Trent leise zu Bink.
»In ihr steckt keine Wahrheit«, murmelte Bink als Antwort. »Es ist nur eine Illusion.«
»Eine Frau ist das, was sie zu sein scheint«, sagte Iris zu Chamäleon. »Wenn sie dem Auge und dem Tastsinn gefällt, dann gefällt sie in allem. Das ist doch alles, was Männern wichtig ist.«
»Hör nicht auf sie«, sagte Bink. »Die Zauberin will dich nur benutzen.«
»Falsch!« sagte Iris. »Ich will dich benutzen, Bink. Ich habe nichts gegen deine Freundin, solange du mit mir zusammenarbeitest. Ich bin nicht eifersüchtig. Alles, was ich will, ist Macht.«
»Nein!« rief Bink.
»Nein«, echote Chamäleon unsicher.
»Und jetzt zu Ihnen, Magier Trent«, sagte Iris. »Ich habe Sie ja nicht lange beobachtet, aber Sie scheinen ein Mann zu sein, der sich an sein gegebenes Wort hält, jedenfalls so lange, wie es Ihnen nützlich erscheint. Ich könnte eine ganz gute Königin für Sie abgeben – oder ich könnte die Palastwachen losschicken, um Sie innerhalb von fünf Minuten zu töten.«
»Ich würde die Wachen verwandeln«, sagte Trent.
»Auf Bogenschußweite? Na ja, vielleicht«, meinte sie zweifelnd. »Aber ich glaube kaum, daß Sie danach noch König bleiben würden. Das ganze Land Xanth würde Sie jagen, um Sie zu töten. Sie könnten eine große Zahl verwandeln – aber wann würden Sie dann noch Schlaf finden?«
Das saß! Man hatte den Bösen Magier schon einmal gefangengenommen, während er schlief. Wenn man ihn entlarvte, bevor er sich mit ihm ergebenen Truppen schützen konnte, dann würde er nicht überleben können.
Doch warum sollte Bink sich deswegen schon sorgen? Wenn die Zauberin den Bösen Magier verriet, dann war Xanth gerettet – ohne daß Bink etwas dazugetan hätte. Seine Weste wäre rein, er würde weder sein Land noch seinen Gefährten verraten haben. Er brauchte sich einfach nur aus der Sache herauszuhalten.
»Nun, ich könnte Tiere oder Menschen in mein Ebenbild verwandeln«, meinte Trent. »Da würden die guten Patrioten wohl ziemliche Schwierigkeiten haben, zu wissen, wen sie umbringen müßten.«
»Das würde nicht funktionieren«, erwiderte Iris. »Ein Magiesucher läßt sich von keiner Illusion zum Narren halten, sobald das Zielobjekt erst einmal geortet worden ist.«
Trent überlegte. »Ja, unter solchen Umständen wäre es für mich schon ziemlich schwierig, zu überleben. Wenn ich das alles durchdenke, muß ich Ihr Angebot wohl annehmen, Zauberin. Natürlich müßte man ein paar Einzelheiten klären, aber…«
»Das können Sie nicht tun!« rief Bink schockiert.
Trent blickte ihn mit milder Verwunderung an. »Mir erscheint es nur vernünftig, Bink. Ich will König werden, Iris möchte Königin sein. So können wir uns die Macht teilen, es bleibt genügend für jeden übrig. Vielleicht müßten wir unsere Interessensphären abgrenzen. Es wäre eine reine Zweckheirat, aber auf eine andere
Verbindung lege ich im Augenblick ohnehin keinen Wert.«
»Na denn!« sagte Iris und lächelte siegesbewußt.
»Na gar nichts!« schrie Bink und merkte, daß er bereits gegen seinen Vorsatz verstieß, sich nicht einzumischen. »Sie sind beide Verräter an Xanth, ich werde das nicht zulassen!«
»Das wird er nicht zulassen!« lachte Iris höhnisch. »Wer, zum Teufel, glaubst du eigentlich, daß du bist, du zauberloses Gehopse?«
Jetzt, da sie anscheinend eine andere Möglichkeit gefunden hatte, zum Ziel zu gelangen, gab sie ihre wahre Einstellung ihm gegenüber preis.
»Unterschätzen Sie ihn nicht«, sagte Trent zu ihr. »Bink ist auf seine Weise ebenfalls ein Magier.«
Bink spürte, wie ihn ein heißes Gefühl von Dankbarkeit durchflutete. Er kämpfte es nieder, weil er wußte, daß er sich nicht von Beleidigungen oder Schmeicheleien von dem ablenken lassen durfte, was er für richtig erkannt hatte. Der Böse Magier konnte mit Worten ein ebenso gefährliches Netz der Illusionen spinnen wie die Zauberin mit ihrer Magie. »Ich bin kein Magier, ich bin lediglich Xanth treu. Und dem rechtmäßigen König.«
»Diesem senilen Wareinmal, der dich verbannt hat?« fragte Iris. »Der kann ja nicht einmal mehr eine Windhose hervorzaubern. Er ist krank und wird sowieso bald sterben. Deshalb müssen wir auch jetzt handeln. Der Thron muß an einen Magier gehen.«
»An einen guten Magier!« konterte Bink. »Nicht an einen bösen Verwandler oder an eine machtgierige Schlampe von einer Täuschungsmeisterin.«
»Du wagst es, mich so zu nennen?« keifte Iris und hörte sich plötzlich fast so an wie eine Harpyie. Sie war so erregt, daß ihr Bild sich in Rauch aufzulösen begann. »Trent, verwandeln Sie ihn in einen Stinkkäfer und zertreten Sie ihn.«
Trent schüttelte den Kopf und unterdrückte dabei ein Lächeln. Es war offensichtlich, daß er der Zauberin gegenüber keinerlei zarte Gefühle hegte und Binks Beleidigung auch aus der Sicht eines Mannes verstehen konnte. Iris hatte ihnen ja gerade unter Beweis gestellt, daß sie dazu bereit war, ihren von der Illusion verschönten Körper um der Macht willen zu verkaufen. »Wir haben ein Waffenstillstandsabkommen.«
»Ein Abkommen? Unsinn!« Ihr Rauch verwandelte sich nun in eine Feuersäule, um ihren gerechten Zorn besser darzustellen. »Sie brauchen ihn nicht mehr. Befreien Sie sich doch von ihm!«
Doch Trent blieb eisern. »Wenn ich ihm gegenüber mein Wort brechen sollte, Iris, wie könnten Sie mir dann trauen?«
Das ernüchterte sie – und beeindruckte Bink. Es gab einen sehr subtilen, aber äußerst wichtigen Unterschied zwischen diesen beiden Magiern. Trent war ein Mann – im besten Sinne des Wortes.
Iris wirkte nicht sonderlich erfreut. »Ich dachte, daß Ihr Abkommen nur so lange Gültigkeit hat, bis Sie die Wildnis verlassen haben?«
»Die Wildnis wird nicht nur vom Dschungel bestimmt«, murmelte Trent.
»Was?« fragte sie.
»Dieses Abkommen wäre wertlos, wenn ich seinen Geist so plötzlich verfälschen würde«, erwiderte Trent. »Bink und
Chamäleon und ich werden uns trennen, und wenn wir Glück haben, sehen wir einander niemals wieder.«
Der Mann war mehr als nur fair, und Bink wußte, daß er sich in die Situation hätte fügen und gehen sollen, und zwar auf der Stelle. Doch seine Sturheit drängte ihn in die Katastrophe. »Nein«, sagte er. »Ich kann nicht einfach weggehen, während Sie beide einen Plan schmieden, um Xanth zu erobern.«
»Hören Sie, Bink«, sagte Trent. »Ich habe Sie nie über meine Ziele im Zweifel gelassen. Wir haben immer gewußt, daß wir nicht dasselbe bezwecken. Unser Abkommen bezog sich lediglich auf unsere gegenseitigen Beziehungen während einer Zeit gemeinsamer Bedrohtheit, nicht aber auf unsere Langzeitpläne. Es gibt Versprechen, die ich einzulösen habe, gegenüber meiner mundanischen Armee, gegenüber Schloß Roogna und nun gegenüber der Zauberin Iris. Es tut mir leid, daß Sie das nicht billigen, denn an Ihrer Billigung liegt mir sehr viel. Aber die Eroberung Xanths war schon immer mein Ziel. Und jetzt, bitte, verlassen Sie mich so würdevoll, wie es Ihnen möglich erscheint,denn ich hege tiefen Respekt für Ihre Überzeugung, auch wenn ich der Ansicht bin, daß die Gesamtsituation Sie irren läßt.«
Wieder spürte Bink, wie gefährlich verlockend Trents goldene Zunge sein konnte. Er entdeckte keinen logischen Fehler in seiner Argumentation. Er hatte nicht die geringste Chance, den Magier mit magischen Mitteln zu überwältigen, und was die Intelligenz anging, so war der ihm wohl auch haushoch überlegen. Doch moralisch mußte er einfach im Recht sein! »Sie respektieren gar nichts, wenn Sie keinen Respekt vor den Traditionen und Gesetzen Xanths haben.«
»Das ist eine vielsagende Antwort, Bink. Ich respektiere diese sehr wohl, aber es sieht so aus, als sei das System verfahren. Es muß also berichtigt werden, ehe wir von der Katastrophe überwältigt werden.«
»Sie reden von einer Katastrophe, die von Mundania ausgehen soll. Ich fürchte mich vor der Katastrophe der Pervertierung unserer eigenen Kultur. Ich muß Ihnen Widerstand leisten, soweit es in meiner Macht steht.«
Trent war verblüfft. »Ich glaube nicht, daß Sie mir Widerstand leisten können, Bink. Wie stark Ihre Magie auch sein mag, sie hat sich noch nie manifestiert. Sobald Sie sich gegen mich stellen, bin ich dazu gezwungen, Sie zu verwandeln. Das möchte ich eigentlich nicht tun.«
»Dazu müßten Sie auf sechs Fuß Reichweite an mich herankommen«, erwiderte Bink. »Ich könnte Sie mit einem Stein von weitem treffen.«
»Sehen Sie?« sagte Iris. »Er ist bereits in Reichweite, Trent. Zerschmettern Sie ihn doch!«
Doch der Magier zögerte noch immer. »Sie wollen sich wirklich gegen mich stellen, Bink? Mich körperlich bekämpfen?«
»Das will ich nicht, ich muß es.«
Trent seufzte. »Dann besteht die ehrenhafteste Lösung darin, daß wir das Abkommen mit einem förmlichen Duell beenden. Ich schlage vor, daß wir uns über den Ort und die Bedingungen des Kampfes einigen. Wünschen Sie einen Sekundanten?«
Bink verstand diesen Begriff nicht. Er bebte innerlich und versuchte, sein Zittern zu unterdrücken. Er hatte Angst, und er wußte, daß er sich wie ein Narr verhielt, und doch konnte er nicht nachgeben.
»Ich meine eine andere Person, die Sie unterstützt, indem sie darauf achtet, daß die Bedingungen eingehalten werden. Vielleicht Chamäleon?«
»Ich gehöre zu Bink!« sagte Chamäleon sofort. Sie verstand die Situation zwar nur zum Teil, aber an ihrer Loyalität bestand kein Zweifel.
»Nun ja, vielleicht kennt man hier keine Sekundanten«, sagte Trent. »Ich schlage vor, daß wir ein Gebiet am Rand der Wildnis wählen, etwa eine Meile in den Wald hinein und eine Meile lang.
Ungefähr eine Quadratmeile oder so viel, wie ein Mann in fünfzehn Minuten durchqueren kann. Und es soll bis Anbruch der Dunkelheit dauern. Keiner von uns darf dieses Gebiet bis dahin verlassen, und wenn sich die Angelegenheit bis dann nicht erledigt haben sollte, dann beenden wir den Kampf und scheiden in Frieden voneinander. Ist das fair genug?«
Der Böse Magier klang so vernünftig, daß es Bink gleich in die Unvernunft trieb. »Bis in den Tod!« sagte er – und bereute es sofort. Er wußte, daß der Magier ihn nicht töten würde, wenn er nicht dazu gezwungen war. Er würde ihn in einen Baum oder in irgendein anderes harmloses Lebewesen verwandeln. Erst hatte es nur Justin Baum gegeben, nun hätte es auch Bink Baum geben können. Vielleicht hätten sich die Leute in seinem Schatten ausgeruht und Picknick gemacht oder sich geliebt. Aber nun ging es um Leben und Tod.
Er hatte eine Vision von einem gefällten, stürzenden Baum.
»Bis zum Tod«, sagte Trent traurig. »Oder bis einer aufgibt.« Aufdiese Weise fing er Binks Übertreibung elegant ab, ohne seinen Stolz zu verletzen. Er ließ es so erscheinen, als wolle er für sich selbst noch ein Schlupfloch offenhalten und nicht für Bink. Wie konnte ein Mann, der derart im Unrecht war, nur immer so rechtschaffen erscheinen?
»Also gut«, sagte Bink. »Sie gehen nach Süden und ich nach Norden in den Wald. In fünf Minuten bleiben wir stehen, drehen uns um und fangen an.«
»Einverstanden«, sagte der Magier. Er streckte Bink die Hand entgegen, und Bink nahm sie.
»Du solltest aus der Duellzone verschwinden«, sagte Bink zu Chamäleon.
»Nein! Ich bleibe bei dir!« sagte sie. Sie mochte zwar dumm sein, aber untreu war sie nicht. Bink konnte es ihr genausowenig verübeln wie Trent, daß er nach Macht strebte. Und doch mußte er sie davon abhalten.
»Das wäre unfair«, sagte er. »Zwei gegen einen. Du mußt fortgehen!«
Doch sie blieb eisern. »Ich bin zu dumm, um alleine fortzugehen!« Autsch! Wie wahr!
»Lassen Sie sie doch mit Ihnen gehen«, sagte Trent. »Es macht ja doch keinen Unterschied.«
Das klang logisch.
Bink und Chamäleon gingen los, in nordwestlicher Richtung auf den Dschungel zu. Trent ging in Richtung Südwesten davon. Kurz darauf hatten sie den Magier aus den Augen verloren. »Wir müssen einen Schlachtplan machen«, sagte Bink. »Trent war zwar bisher ein vollkommener Gentleman, aber jetzt ist der Pakt aufgekündigt worden, und er wird seine Macht gegen uns einsetzen. Wir müssen ihn erwischen, bevor er uns erwischt.«
»Ja.«
»Wir müssen Steine und Stöcke sammeln und vielleicht eine
Fallgrube ausheben.«
»Ja.«
»Wir müssen ihn daran hindern, nahe genug an uns
heranzukommen, um uns zu verwandeln.«
»Ja.«
»Sag nicht immer ja!« schnaubte er unwirsch. »Das hier ist eine ernste Angelegenheit. Unser Leben steht auf dem Spiel!«
»Entschuldigung. Ich weiß ja, daß ich im Augenblick schrecklich dumm bin.«
Sofort tat es Bink leid. Natürlich war sie jetzt dumm, das war ja auch ihr Fluch. Und es konnte durchaus sein, daß er die Sache überzeichnete. Es war ja möglich, daß Trent der Angelegenheit dadurch aus dem Weg ging, daß er einfach verschwand, ohne sich zu stellen. Auf diese Weise hätte Bink sein Möglichstes getan, hätte
einen moralischen Sieg davongetragen – und nichts geändert. Dann wäre Bink der Dumme.
Er drehte sich zu Chamäleon um, um sich zu entschuldigen, und merkte, daß sie jetzt betörend schön war, ganz so wie Wynne, als er sie kennengelernt hatte. War das wirklich erst einen Monat her? Aber jetzt war sie keine Fremde mehr für ihn. »Du bist schon in Ordnung, so wie du bist, Chamäleon.«
»Aber ich kann dir nicht beim Planen helfen, ich kann überhaupt nichts tun. Du magst keine dummen Leute.«
»Ich mag schöne Mädchen«, erwiderte er. »Und ich mag auch kluge Mädchen. Aber wenn beides zusammenkommt, dann werde ich immer mißtrauisch. Ich würde mich ja für ein ganz gewöhnliches, durchschnittliches Mädchen entscheiden, aber die würde nach einer Weile ziemlich langweilig werden. Manchmal möchte ich mich eben mit jemandem unterhalten, der intelligent ist, manchmal möchte ich…« Er brach seinen Satz ab. Sie besaß im Augenblick den Verstand eines Kindes; es war einfach nicht gerecht, ihr jetzt solche Gedankenakrobatik zuzumuten.
»Was?« fragte sie und blickte ihn an. In ihrer letzten schönen Phase waren ihre Augen fast schwarz gewesen, nun waren sie dunkelgrün. Aber sie hatten jede beliebige Farbe haben können ohne daß sie deswegen weniger schön gewesen wäre.
Bink wußte, daß es um seine Chancen, diesen Tag zu überleben, schlecht bestellt war, und um Xanths Rettung stand es noch schlechter. Er hatte Angst, aber er war sich des Lebens auch noch viel bewußter als sonst. Und er hatte ein Gespür für Treue. Und für Schönheit. Warum sollte er vor seinem Bewußtsein verbergen, was sich in seinem Unterbewußtsein schon seit so langer Zeit entwickelt hatte?
»… Liebe machen«, beendete er seinen Satz.
»Das kann ich«, sagte sie, und ihre Augen glänzten, als sie begriff, was er meinte. Bink wollte lieber nicht darüber nachdenken, wie weit ihr Verständnis gehen mochte.
Er küßte sie, und es war wunderbar. »Aber Bink«, sagte sie atemlos. »Ich werde nicht schön bleiben.« »Das ist es ja gerade«, sagte er. »Ich mag Abwechslung. Ich hätte
Schwierigkeiten, damit klarzukommen, immer mit einem dummen Mädchen zusammenzusein, aber du bist ja nicht die ganze Zeit dumm. Häßlichkeit ist auch nichts für dauernd, aber du bist ja auch nicht immer häßlich. Du bist… Vielfalt. Und das ist es, was ich in einer längeren Beziehung suche und was kein anderes Mädchen bieten kann.«
»Ich brauche einen Zauber…« sagte sie.
»Nein! Du brauchst überhaupt keinen Zauber, Chamäleon. Du bist schon in Ordnung, so wie du bist. Ich liebe dich.«
»Oh, Bink!« sagte sie.
Da vergaßen sie das Duell.
Doch die Wirklichkeit drängte sich ihnen nur zu bald wieder auf. »Da seid ihr ja!« sagte Iris und erschien vor ihrer provisorischen Laube. »Tztz! Was habt ihr denn da gemacht?«
Chamäleon richtete hastig ihr Kleid. »Etwas, was du nicht verstehen würdest«, sagte sie mit typisch weiblicher Intuition.
»Nein? Macht auch nichts. Sex ist unwichtig.« Die Zauberin formte die Hände vor ihrem Mund zu einem Trichter und rief: »Trent! Sie sind hier drüben!«
Bink stürzte auf sie zu – und rannte durch ihr Abbild hindurch. Er stürzte auf den Waldboden. »Dummer Junge«, meinte Iris. »Mich kannst du nicht anfassen.«
Nun hörten sie, wie der Böse Magier durch den Wald auf sie zukam. Bink suchte verzweifelt nach irgend etwas, was er als Waffe benutzen könnte, doch er erblickte nur dicke Baumstämme. Damit diese Baume nicht mit scharfen Steinen angeritzt wurden, hatten sie alle Steine magisch eliminiert. An anderen Orten hätten sich gewiß Waffen finden lassen, nicht aber in dieser Wildnis, in der alles auf Selbstschutz bedacht war, besonders hier am Rand, wo die Farmen andauernd neues Land brauchten und rodeten.
»Ich habe dich vernichtet!« rief Chamäleon. »Ich wußte doch, daß ich nicht…«
… hätte Liebe machen sollen? In gewisser Weise hatte sie recht. Sie hatten wertvolle Zeit damit vergeudet, sich zu lieben, anstatt zu kämpfen. Andererseits war dies vielleicht die letzte Möglichkeit dafür gewesen. »Das war die Sache wert«, sagte Bink. »Wir müssen eben davonlaufen.«
Sie setzten sich in Bewegung, doch da erschien das Bild der Zauberin vor ihnen. »Hierher, Trent!« schrie sie erneut. »Schneiden Sie ihnen den Weg ab, bevor sie entkommen!«
Bink begriff, daß sie nirgendwohin konnten, solange sie von Iris verfolgt wurden. Sie konnten sich nirgends verstecken, konntenkeinerlei Überraschungsangriff vorbereiten, Trent würde sie immer wieder aufspüren.
Da fiel sein Auge auf den hypnotischen Kürbis, den Chamäleon mit sich trug. Wenn er Trent dazu bringen konnte, in einem unbedachten Augenblick in den Kürbis hineinzublicken…
Da sahen sie auch schon den Magier. Bink nahm Chamäleon sanft den Kürbis aus der Hand. »Sieh zu, daß du ihn ablenkst, damit ich Zeit bekomme, ihm diesen Kürbis ins Gesicht zu schieben«, sagte er. Er versteckte den Kürbis hinter seinem Rücken. Iris wußte wahrscheinlich nicht, was es damit auf sich hatte. Wenn Trent erst einmal ausgeschaltet war, dann war auch sie machtlos.
»Iris!« rief der Magier laut. »Das soll ein fairer Zweikampf sein. Wenn Sie sich noch einmal einmischen sollten, dann werde ich unsere Abmachung aufkündigen!«
Die Zauberin wollte wütend antworten, besann sich jedoch eines Besseren und verschwand.
Trent blieb etwa ein Dutzend Schritte vor Bink stehen. »Es tut mir leid, daß es dazu gekommen ist. Sollen wir von vorne anfangen?« fragte er mit ernster Stimme.
»Das wäre wohl das beste«, erwiderte Bink. Dieser Mann war sich seiner selbst so verdammt sicher, daß er es sich erlauben konnte, einen deutlichen Vorteil preiszugeben. Vielleicht wollte er ja auch ein reines Gewissen bei der Angelegenheit bewahren, soweit er eins haben sollte. Doch auf diese Weise hatte Trent sich vor einer möglichen Katastrophe bewahrt. Bink bezweifelte, daß er den Kürbis noch ein zweites Mal würde einsetzen können.
Sie gingen wieder auseinander. Bink und Chamäleon flohen in den tiefen Wald – und liefen beinahe einem Gewirrbaum in die bebenden Fangarme.
»Wenn wir ihn nur dazu bringen könnten, dort hineinzulaufen«, sagte Bink, aber er merkte, daß er es gar nicht wirklich meinte. Er hatte sich in einen Zweikampf hineinmanövriert, den er überhaupt nicht gewinnen wollte. Aber er konnte es sich ebensowenig leisten, zu verlieren. Er war genauso dumm wie Chamäleon – nur ein bißchen komplizierter.
Sie entdeckten einen Schlingenschlaufenbusch. Die Schlaufen hatten einen Durchmesser von bis zu achtzehn Zoll, doch wenn ein achtloses Tier seinen Kopf oder etwa ein Bein hindurchsteckte, dann zogen sie sich bis zu einem Viertel ihrer Größe zusammen. Ihre Fibern waren so zäh, daß man sie nur mit einem Messer durchschneiden oder die Fessel mit einem Gegenzauber lösen konnte. Selbst wenn man sie von dem Busch abtrennte, behielten die Schlaufen noch einige Tage ihre Wirksamkeit, bis sie schließlich steif wurden.
Chamäleon wich erschreckt zurück, doch Bink blieb nachdenklich stehen. »Es ist möglich, solche Schlaufen abzubrechen und mitzunehmen«, sagte er. »Im Norddorf haben wir sie dazu verwendet, um Pakete fester zu verschnüren. Der Trick besteht darin, daß man sie nur von außen berührt. Wir können einige davon Trent in den Weg legen oder sie nach ihm werfen. Ich bezweifle, daß er sie wird verwandeln können, nachdem sie von der lebenden Pflanze abgelöst worden sind. Kannst du gut werfen?«
»Ja.«
Er schritt auf den Busch zu und entdeckte sofort eine neue Gefahr. »Schau mal dort, ein Nest von Ameisenlöwen!« rief er. »Wenn wir sie auf ihn ansetzen könnten…«
Chamäleon blickte die zwölf Zoll großen löwenköpfigen Ameisen an und erschauerte. »Müssen wir das?«
»Ich wünschte, wir müßten es nicht«, erwiderte Bink. »Sie würden ihn nicht wirklich auffressen, er würde sie schon vorher verwandeln. Aber sie könnten ihn so beschäftigt halten, daß wir ihn überwältigen könnten. Wenn wir ihn nicht irgendwo aufhalten,
dann erobert er sehr wahrscheinlich Xanth.«
»Wäre das schlimm?«
Das war wieder eine ihrer dummen Fragen, aber sie machte ihm trotzdem zu schaffen. Wäre der Böse Magier wirklich so viel schlimmer als der jetzige König? Er verdrängte die Frage. »Das steht uns nicht an, zu entscheiden. Der Ältestenrat wird den nächsten König wählen. Wenn die Krone erst einmal durch Verschwörungen oder Eroberungen jedem zur Verfügung steht, dann sind wir wieder in den alten Zeiten der Wellen. Da wird niemand mehr in Sicherheit leben können. Es muß per Gesetz entschieden werden, wer die Krone Xanths erhält.«
»Ja«, meinte sie. Bink war selbst davon überrascht, wie treffend er die Situation geschildert hatte, aber das überstieg natürlich ihre Aufnahmefähigkeit.
Trotzdem war ihm nicht wohl bei dem Gedanken, Trent vor die Ameisenlöwen zu werfen, also suchte er weiter. Tief in seinem Inneren suchte er ebenfalls nach einer Antwort auf die Frage nach der moralischen Rechtfertigung der gegenwärtigen Regierung. Angenommen, Trent hatte recht mit seiner Behauptung, daß es für Xanth lebensnotwendig sei, sich für eine Immigration zu öffnen? Den Lehren der Zentauren zufolge war die menschliche Bevölkerung in den letzten hundert Jahren immer kleiner geworden; wo waren all diese Leute nur abgeblieben? Entstanden etwa in diesem Augenblick wieder neue teilmenschliche Ungeheuer durch magisch ermöglichte Kreuzungen? Schon der bloße Gedanke war wie eine Schlingenschlaufe um den Hals. Wenn man ihn zu Ende dachte – scheußlich! Und doch sah alles ganz danach aus. Wenn er König wäre, dann würde Trent das ändern. War dasÜbel der Wellen wirklich schlimmer als diese Alternative? Bink kam zu keiner endgültigen Entscheidung.
Schließlich gelangten sie an einen großen Fluß. Als er noch in seiner Sphinxgestalt gewesen war, hatte Bink ihn überquert, ohne sonderlich auf ihn zu achten, doch nun stellte er ein tödliches Hindernis dar. Kleine Wellenringe wiesen auf Raubtiere hin, und über dem Wasser schwebten gespenstische Nebelschwaden. Bink schleuderte einen Schlammklumpen ins Wasser, und sofort wurde er von einer riesigen krebsartigen Schere gepackt. Den Rest des Ungeheuers sah er nicht, so daß er nicht wußte, ob es sich dabei um eine Meerkrabbe, um einen gigantischen Panzerkrebs oder einfach nur um eine körperlose Schere handeln mochte. Aber schwimmengehen wollte er hier lieber nicht.
Am Ufer lagen zahlreiche runde Steine. Der Fluß hatte von Steinen nicht so viel zu befürchten wie die Bäume. Trotzdem war es ratsam, vorsichtig zu sein. Bink stocherte mit seinem Stock auf ihnen herum, um sich davon zu überzeugen, daß es keine magischen Trugbilder waren. Zum Glück waren es keine. Er stocherte auch versuchsweise mit seinem Stock in eine hübsche Wasserlilie hinein, und die Pflanze verschlang sofort drei Zoll von seiner Stockspitze. Seine Vorsicht war also durchaus gerechtfertigt.
»Also gut«, sagte er, nachdem sie einen Vorrat an Steinen eingesammelt hatten. »Wir werden versuchen, ihn aus dem Hinterhalt zu überfallen. Wir legen die Schlingschlaufen auf seinen wahrscheinlichen Fluchtweg und decken sie mit Blättern zu. Dann kannst du ihn mit Schlingen bewerfen, während ich die Steine nach ihm schleudere. Er wird den Steinen und Schlingen ausweichen und sich erst einmal zurückziehen. Dabei muß er aber auf uns beide achten, folglich könnte er in eine der Schlingen treten. Sie wird seinen Fuß umklammern, und während er versucht, sie abzubekommen, ist er angreifbar. Vielleicht erwischen wir ihn dann. Wir holen uns etwas Stoff von einem Deckenbaum, den wir ihm über den Kopf werfen, damit er uns nicht sehen und verwandeln kann, oder wir halten ihm den Hypnokürbis vors Gesicht. Dann wird er aufgeben müssen.«
»Ja«, sagte sie.
Sie machten alles bereit. Die getarnten Schlingen erstreckten sich von einem hungrigen Gewirrbaum bis zu dem Nest der Ameisenlöwen, und sie selbst versteckten sich hinter einem unsichtbaren Busch, den sie zufällig entdeckt hatten. Auf andere Weise konnte man diese harmlosen, mitunter allerdings ziemlich lästigen Gewächse auch gar nicht ausfindig machen. Wenn man sich dahinter versteckte, dann war man ebenfalls unsichtbar, solange der Busch sich zwischen ihnen und dem Betrachter befand. Sie setzten sich und warteten.
Doch Trent überraschte sie. Während sie die Falle eingerichtet hatten, hatte er einen Bogen geschlagen, indem er sich an den Geräuschen orientiert hatte, die sie verursachten. Jetzt kam er aus Norden auf sie zu. Wie die meisten Mädchen mußte Chamäleon oft austreten, besonders dann, wenn sie sehr aufgeregt war. Sie verschwand hinter einem harmlosen Falschbanyanbaum und stieß plötzlich einen Schreckensschrei aus. Kurz darauf stürzte ein junges Flügelreh aus dem Unterholz.
Der Kampf hatte begonnen! Bink lief mit einem Stein in der einen und einem Stock in der anderen Hand auf den Baum zu. Er hoffte, daß er den Magier umstoßen konnte, bevor er seinen Zauber verhängt hatte. Doch Trent war nicht zu sehen.
Hatte er vielleicht die falschen Schlüsse gezogen? Hatte Chamäleon nur ein Reh aus seinem Versteck aufgescheucht…
»Jetzt!« rief der Böse Magier von oben zu ihm herab. Er saß im Baum. Als Bink emporblickte, gestikulierte Trent, aber es war keine Zauberbewegung, er wollte nur in Reichweite kommen, um Bink verwandeln zu können. Bink sprang zurück – zu spät. Er spürte das Kitzeln der Verwandlung.
Er stürzte zu Boden, rollte sich ab, erhob sich wieder – und stellte fest, daß er immer noch seine menschliche Gestalt besaß. Der Zauber hatte versagt! Wahrscheinlich war er doch noch gerade rechtzeitig aus Trents Wirkungsbereich gesprungen, so daß nur ein Arm und nicht sein Kopf dem Magier bis auf sechs Fuß nahe gekommen war.
Er blickte sich wieder zu dem Baum um und war sprachlos. Der Böse Magier saß eingekeilt in den dornigen Ästen eines bonbongestreiften Rosenstrauches. »Was ist passiert?« fragte Bink und vergaß einen Augenblick lang die Gefahr, in der er immer noch schwebte.
»Da ist mir ein Ast in den Weg gekommen«, sagte Trent und schüttelte den Kopf, wie um ihn klarzubekommen. Er mußte ziemlich hart aufgeprallt sein. »Der Zauber hat den Ast an Ihrer Stelle verwandelt.«
Bink hätte fast gelacht, aber jetzt fiel ihm seine eigene Lage wieder ein. Der Magier hatte also versucht, ihn in einen Rosenstrauch zu verwandeln! Er hob seinen Stein und sagte entschuldigend: »Tut mir leid«, dann schleuderte er ihn auf den Kopf des Magiers.
Doch der Stein prallte von dem harten Panzer einer rosa Schildkröte ab. Trent hatte den Strauch in ein gepanzertes Tier verwandelt und hielt sich nun dahinter versteckt.
Bink handelte, ohne nachzudenken. Er hob seinen Stock wie eine Lanze, rannte um die Schildkröte herum und stieß damit nach dem Magier. Doch wieder wich der Mann ihm aus, und Bink spürte erneut das Kitzeln des Verwandeltwerdens.
Aber sein Anlaufschub brachte ihn sofort wieder außer Reichweite seines Gegners, und er zog sich hastig hinter den unsichtbaren Busch zurück. Er staunte selbst über seine wunderbare Rettung. Er war noch immer ein Mensch, der Zauberer hatte statt dessen die Schildkröte in eine Werhornisse verwandelt. Das Insekt summte gereizt, entschied sich dann aber doch lieber für die Flucht.
Jetzt war Trent ihm auf den Fersen. Der Busch verwandelte sich in eine Schlange mit Frauenkopf, die mit einem wütenden Schrei davonschlängelte, und Bink stand wieder im Freien. Er wollte davonstürzen, doch da erwischte ihn die Magie ein drittes Mal.
Neben ihm erschien eine gelbe Kröte. »Was ist das denn?« fragte Trent ungläubig. »Ich habe aus Versehen eine Mücke erwischt. Mein Zauber hat Sie bereits dreimal verfehlt. So schlecht ziele ich doch nun auch wieder nicht!«
Bink lief auf seinen Stock zu. Trent konzentrierte sich wieder auf ihn, und Bink merkte, daß er weder die Waffe erreichen noch sich in Sicherheit bringen konnte. Er war am Ende, trotz aller taktischen Manöver.
Doch da griff das Flügelreh den Magier von der Seite an und drohte, ihn umzuwerfen. Trent hörte es kommen, wirbelte herum, konzentrierte sich darauf und verwandelte es zuerst in einen ausnehmend schönen Flügeldrachen. »Da habe ich keinerlei Probleme«, brummte Trent. »Sie sieht immer gut aus, egal in was ich sie verwandele, aber auf jeden Fall wirken meine Zauber da reibungslos.«
Der kleine Flügeldrache griff ihn zischend an, und plötzlich wurde daraus wieder ein Flügelreh. »Husch!« sagte Trent und klatschte in die Hände. Erschreckt sprang das Reh davon. Es war nicht besonders intelligent.
In der Zwischenzeit hatte Bink diese Ablenkung dazu ausgenutzt, sich zurückzuziehen. Doch er war auf seine eigene sorgfältig errichtete Falle zugelaufen und wußte nun selbst nicht mehr so genau, wo die versteckten Schlingen lagen. Wenn er versuchte, diese Linie zu überqueren, dann setzte er sich der Gefahr aus, entweder in seine eigene Falle zu laufen oder Trents
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken – sofern der Magier nicht ohnehin schon wußte, wo er war.
Trent kam auf ihn zu. Bink war in die Enge getrieben worden, ein Opfer seiner eigenen List. Unbeweglich stand er da. Er wußte, daß der Magier ihn sofort entdecken würde, wenn er auch nur die leiseste Bewegung machte. Er verwünschte sich selbst wegen seiner Unentschlossenheit, aber er wußte einfach nicht mehr, was er tun sollte. Er war ganz augenscheinlich nicht zum Duellanten geboren. Von Anfang an war er überrumpelt und in die Enge getrieben worden. Er hätte den Bösen Magier in Frieden lassen sollen, und doch hätte er niemals tatenlos zusehen können, wie Xanth ohne jede Gegenwehr erobert wurde. Das hier war eben eine Gegenwehr.
»Diesmal gibt es aber keine Fehler mehr«, sagte Trent und trat unerschrocken auf Bink zu. »Ich weiß, daß ich Sie verwandeln kann, denn ich habe es ja schon mehrmals ohne jede Schwierigkeit getan. Ich muß wohl ein bißchen zu hastig vorgegangen sein.« Er blieb in magischer Reichweite stehen, und Bink wagte nicht mehr, nun noch davonzulaufen. Trent konzentrierte sich –, und wieder durchflutete die magische Energie Bink mit einem kräftigen Prickeln.
Plötzlich erschien ein Schwarm Trichtervögel um Bink herum und stob mit höhnischem Kreischen auf starren Schwingen davon.
»Sogar die Mikroben, die Sie umgeben!« rief Trent. »Mein Zauber ist voll an Ihnen abgeprallt! Schon wieder! Jetzt weiß ich aber, daß hier irgend etwas nicht stimmt.«
»Vielleicht wollen Sie mich ja einfach nur nicht töten«, meinte Bink.
»Ich habe nicht versucht, Sie zu töten. Ich wollte Sie nur in irgend etwas Harmloses verwandeln, damit Sie mir nie wieder in die Quere kommen. Ich töte nie ohne guten Grund.« Der Magier dachte nach. »Wirklich sehr seltsam! Ich glaube nicht, daß mein Talent daneben trifft. Irgend etwas stellt sich ihm entgegen. Es muß einen Gegenzauber geben, der es zunichte macht. Sie haben
ja auch ein reichlich verzaubertes Leben geführt, bisher… Ich habe immer gedacht, daß es ein bloßer Zufall ist, aber jetzt…«
Trent überlegte, dann schnippte er mit den Fingern.
»Ihr Talent! Ihr magisches Talent! Das ist es! Sie können durch Magie keinen Schaden erleiden!«
»Aber ich bin schon oft verletzt worden«, wandte Bink ein.
»Aber nicht durch Magie, darauf möchte ich wetten. Ihr Talent weist alle magischen Bedrohungen einfach ab.«
»Aber ich bin schon das Opfer vieler Zauber geworden. Sie haben mich doch auch verwandelt…«
»Nur, um Ihnen zu helfen – oder um Sie zu warnen. Sie mögen meinen Motiven ja nie getraut haben, aber Ihre Magie wußte um die Wahrheit. Ich habe vorher niemals versucht, Ihnen Schaden zuzufügen, deshalb durften meine Zauber auch wirken. Jetzt stehen wir im Zweikampf, und ich versuche Sie zu Ihren Ungunsten zu verwandeln, deshalb werden meine Zauber abgewiesen. In dieser Hinsicht ist Ihre Magie stärker als meine – wie es ja auch alle bisherigen Zeichen angedeutet haben.«
Bink staunte. »Aber… aber dann habe ich ja gewonnen. Sie können mir nichts anhaben.«
»Nicht unbedingt, Bink. Meine Magie hat die Ihre dazu gezwungen, sich zu offenbaren, damit ist sie auch angreifbar geworden.« Der Böse Magier zog sein glitzerndes Schwert. »Ich besitze noch andere Talente außer der Magie. Verteidigen Sie sich – körperlich!« Bink schlug seinen Stock hoch, als der Magier einen Ausfall machte. Er parierte die Klinge gerade noch rechtzeitig. Er war verwundbar – körperlich. Plötzlich lösten sich alle Rätsel seiner Vergangenheit. Noch nie hatte die Magie ihm wirklich Schaden zugefügt. Sie hatte ihn gedemütigt, ja, besonders während seiner Kindheit. Aber körperlich hatte sie ihm nie etwas anhaben können. Wenn er mit einem anderen Jungen um die Wette gelaufen war und der Junge durch Bäume und Hindernisse
hindurchgelaufen war, um zu gewinnen, da hatte Bink nicht körperlich, sondern allenfalls seelisch darunter gelitten. Und als er – auf nicht magische Weise – seinen eigenen Finger abgehackt hatte, da hatte nichts ihm geholfen. Die Magie hatte das zwar kuriert, aber keine Magie hätte ihm die Wunde zufügen können. Und so hatte ihn die Magie manches Mal in Bedrängnis gebracht, ohne daß er wirklichen Schaden erlitten hätte. Selbst vor Potiphers Giftgas war er gerade noch rechtzeitig gerettet worden. Er hatte im wahrsten Sinne des Wortes ein verzaubertes Leben geführt.
»Ihre Magie hat wirklich faszinierende Aspekte«, sagte Trent gesprächig, während er eine neue Blöße zu entdecken versuchte. »Wenn jeder davon wüßte, dann wäre es offensichtlich nur ein sehr schwacher Schutz. Folglich sorgt sie dafür, daß sie nicht leicht entdeckt wird, auf tausenderlei subtile Weise. Ihre Rettungen sahen deshalb oft zufällig aus oder wie seltene Glückstreffer.« Ja, so wie damals, als er dem Spaltendrachen entkommen war! Er hatte sogar von Gegenmagie profitieren können, etwa, als er Donald den Schatten in sich aufgenommen hatte und dadurch unversehrt aus der Spalte hatte fliegen können.
»Ihr Stolz wurde nie gerettet, immer nur Ihr Körper«, fuhr Trent fort. Offensichtlich ließ er sich Zeit bei seinem Vorgehen, um erst alle Einzelheiten zu klären, für alle Fälle. Er war eben ein gründlicher Mann. »Vielleicht haben Sie einige Unannehmlichkeiten erleben müssen, so wie bei unserer Rückkehr nach Xanth. Die sollten dann die Tatsache verschleiern, daß Ihnen nichts wirklich Schlimmes widerfahren war. Anstatt sich selbst preiszugeben, hat Ihr Talent es zugelassen, daß Sie verbannt wurden – denn schließlich war das ja auch im Grunde eine juristische oder gesellschaftliche Sache, nichts wirklich Magisches. Und doch hat Ihnen der Schild nichts anhaben können…«
Er hatte das Prickeln des Schilds gespürt. Jetzt begriff er, daß er die geballte Kraft des Schilds überstanden hatte. Er hätte jederzeit hindurchgehen können. Aber hätte er davon gewußt, so hätte er es vielleicht auch getan – und damit sein Talent preisgegeben. Also hatte es sich versteckt, vor ihm selbst.
Doch nun war es enthüllt worden. Aber da stimmte etwas nicht. »Sie sind doch auch nicht von dem Schild verletzt worden!« rief Bink und führte einen harten Hieb mit seinem Stock.
»Ich habe Sie angefaßt, während wir eindrangen«, sagte Trent. »Chamäleon auch. Sie waren bewußtlos, aber Ihr Talent hat trotzdem funktioniert. Wenn wir beide gestorben wären und Sie überlebt hätten, dann hätte es sich preisgegeben. Vielleicht umgibt Sie ja auch ein kleines Kraftfeld, mit dessen Hilfe Sie alle schützen können, die Sie berühren. Oder das Talent besaß Voraussicht und wußte, daß Sie sonst allein dem Krakentang ausgeliefert gewesen wären, ohne eine eigene Fluchtmöglichkeit. Sie brauchten mich und meine Fähigkeit der Verwandlung, um den magischen Gefahren zu entgehen, deshalb wurde ich auch verschont. Und Chamäleon auch, weil Sie ohne sie nicht mit mir zusammengearbeitet hätten. Also haben wir alle überlebt, um IhrÜberleben zu ermöglichen, und wir haben nie den wahren Grund dafür geahnt. So hat uns Ihre Magie auch während unserer Wanderschaft durch die Wildnis beschützt. Ich dachte, daß ich Sie brauchen würde, um in der Wildnis geschützt zu sein, aber in Wirklichkeit verhielt es sich andersherum. Mein Talent wurde zu einem bloßen Aspekt des Ihren. Als Sie von den Zapplern bedroht wurden und von dem unsichtbaren Riesen, da haben Sie sich meiner Fähigkeit der Verwandlung bedient, um diese Bedrohung abzuwehren. Und immer, ohne zu verraten…«
Trent schüttelte den Kopf und wehrte Binks unbeholfene Hiebe mühelos ab. »Plötzlich ist alles viel weniger erstaunlich. Und je mehr man darüber nachdenkt, um so beeindruckender ist Ihr Talent auch. Sie sind ein Magier, der nicht nur kompliziertere Talente besitzt, sondern auch noch alle ihre Verästelungen beherrscht. Magier sind ja nicht einfach nur kraftvoller als andere Leute, unsere Zauber unterscheiden sich auch qualitativ von denen anderer Menschen, nicht quantitativ. Und das auf eine Weise, wie gewöhnliche Bürger es oft nicht merken und begreifen. Sie stehen auf gleicher Stufe wie Humfrey, Iris und – ich. Ich wüßte wirklich zu gern, wie weit Ihre Macht eigentlich reicht.«
»Ich auch«, erwiderte Bink keuchend. Er war völlig außer Atem, während die Anstrengung dem Magier nicht das geringste auszumachen schien. Das war wirklich frustrierend.
»Aber leider kann ich wohl nicht König werden, solange sich ein Talent wie das Ihrige gegen mich stellt. Es tut mir aufrichtig leid, Ihr Leben opfern zu müssen, und ich möchte, daß Sie wissen, daß ich das nicht von Anfang an vorgehabt habe. Ich hätte es vorgezogen, Sie ganz harmlos zu verwandeln. Aber das Schwert ist nun einmal weniger raffiniert als die Magie. Es kann nur verletzen oder töten.«
Bink erinnerte sich plötzlich an Herman den Zentauren, dessen Kopf vom Körper getrennt worden war. Wenn Trent sich endlich dazu entschloß, den Todesstoß zu führen…
Trent machte einen flinken Ausfall, und Bink sprang beiseite. Die Spitze der Klinge ritzte seine Hand, und Bink ließ mit einem Schmerzensschrei seinen Stock fallen. Offenbar konnten ihm mundanische Mittel durchaus Schaden zufügen. Trent hatte auf die Hand gezielt, um sich seiner Sache völlig sicher zu sein.
Diese Erkenntnis löste die geistige Lähmung, die ihn zu einer Unterschätzung seiner eigenen Verteidigungsmöglichkeiten geführt hatte. Er war zwar verwundbar, aber in einem Kampf von Mann zu Mann hatte er durchaus eine Chance. Die schreckliche Macht des Bösen Magiers hatte ihn ständig eingeschüchtert, doch nun war Trent auch nur ein Mann für ihn. Man konnte ihn auch überraschen.
Als Trent sich gerade anschickte, den Todesstoß zu führen, bewegte Bink sich mit geradezu hellsichtiger Sicherheit. Er duckte sich, packte den Arm des anderen mit seiner blutigen Hand, drehte sich um, knickte in den Knien ein und ruckte vor. Es war der Wurf, den der Soldat Crombie ihn gelehrt hatte, um einen bewaffneten Angreifer auszuschalten.
Doch der Magier war auf der Hut gewesen. Als Bink versuchte, ihn über seine Schulter zu werfen, tänzelte er um ihn herum und hielt sich auf den Beinen, riß seinen Schwertarm frei und zielte erneut. »Sehr hübsches Manöver, Bink. Leider kennt man in Mundania so etwas auch.«
Trent stieß mit tödlicher Präzision vor, und Bink, der das Gleichgewicht zu verlieren drohte, konnte nicht mehr ausweichen und sah, wie die Klinge auf sein Gesicht zufuhr. Jetzt war er endgültig erledigt!
Da schoß das Flügelreh zwischen sie, die Klinge bohrte sich in seinen Körper und trat an der anderen Seite wieder hervor, nur um Haaresbreite von Binks Nasenspitze entfernt.
»Dummes Vieh!« schrie Trent und zog die blutige Klinge wieder heraus. »Der war nicht für dich gedacht’.«
Das Reh stürzte blutüberströmt zu Boden. Sein Bauch war durchbohrt. »Ich werde dich in eine Qualle verwandeln!« schrie der Böse Magier zornig. »Dann wirst du auf dem Land verdampfen!«
»Sie stirbt sowieso gerade«, erwiderte Bink und verspürte einen stechenden Schmerz der Verzweiflung in seinem eigenen Magen. Solche Wunden waren nicht sofort tödlich, aber sie taten entsetzlich weh, und im Endeffekt lief es auf dasselbe hinaus. Chamäleon würde langsam und qualvoll sterben.
Das Omen! Nun war es also endlich in Erfüllung gegangen! Das Chamäleon war plötzlich gestorben. Oder würde bald –
Bink stürzte sich mit einem nie zuvor gekannten Haß- und Rachegefühl auf seinen Gegner. Mit bloßen Händen wollte er ihn…
Trent wich ihm tänzelnd aus und verpaßte Bink einen Handkantenschlag an die linke Halshälfte. Bink stolperte und fiel wie im Tran zu Boden. Blinde Wut war kein Ersatz für kühles Kalkül und Erfahrung. Er sah, wie Trent auf ihn zutrat, das Schwert mit beiden Händen packte und es emporzog, um ihm den letzten Hieb zu verabreichen.
Bink schloß die Augen. Er hatte alles getan, was er tun konnte, und er hatte verloren. »Aber töten Sie sie bitte auch – und zwar sauber!« bettelte er. »Lassen Sie sie nicht leiden!«
Er wartete resigniert auf sein Ende. Doch der Hieb blieb aus. Bink öffnete die Augen – und sah, wie Trent sein fürchterliches Schwert wieder in seinen Gürtel steckte.
»Ich kann nicht«, sagte der Magier nüchtern.
Die Zauberin Iris erschien. »Was ist los?« fragte sie. »Sind Sie etwa zur Memme geworden? Erledigen Sie die beiden, dann haben wir es hinter uns. Ein Königreich wartet auf Sie!«
»Auf diese Weise will ich es nicht bekommen«, sagte Trent. »Früher hätte ich es getan, aber in den letzten zwanzig Jahren habe ich mich geändert, und in den vergangenen beiden Wochen auch. Ich habe einiges über die wahre Geschichte Xanths erfahren, und den frühen Tod kenne ich selbst nur zu gut aus eigener Anschauung. Mein Ehrgefühl hat sich ja spät entwickelt, aber es wird immer stärker. Er läßt nicht zu, daß ich einen Mann töte, der mir einmal das Leben gerettet hat und der einem Monarchen bis zum Tod die Treue hält, der ihn ins Exil verbannt hat.« Er blickte auf das sterbende Reh hinab. »Und ich würde niemals freiwillig ein Mädchen töten, das mangels eigener Klugheit sein Leben für diesen Mann aufopfert. Das ist wahre Liebe von der Art, wie ich sie auch einmal gekannt habe. Meine habe ich nicht retten können, aber die eines anderen würde ich niemals vernichten. Diesen Preis ist der Thron einfach nicht wert.«
»Idiot!« keifte Iris. »Du wirfst ja dein eigenes Leben damit weg!«
»Ja, das tue ich wohl«, sagte Trent. »Aber das Risiko bin ich von Anfang an eingegangen, und so soll es auch sein. Besser, ehrenvoll zu sterben, als in Schande zu leben, auch wenn ein Thron dabei in Aussicht stehen mag. Vielleicht habe ich eigentlich weniger die Macht als die Selbstvervollkommnung gesucht.« Er kniete neben dem Reh nieder, berührte es, und es wurde wieder zu Chamäleon. Aus ihrer schrecklichen Unterleibswunde strömte das Blut. »Ich kann sie nicht mehr retten«, sagte er traurig. »Genausowenig wie ich meine Frau und mein Kind habe retten können. Ich bin kein Arzt. Jedes Wesen, in das ich sie verwandeln könnte, würde genausosehr leiden. Sie braucht Hilfe – magische Hilfe.«
Der Magier blickte hoch. »Iris, Sie können uns helfen. Projizieren Sie Ihr Bild ins Schloß des Guten Magiers Humfrey. Sagen Sie ihm, was hier vorgefallen ist, und bitten Sie ihn um Heilwasser. Ich glaube, daß die Behörden von Xanth diesem unschuldigen Mädchen helfen und diesen jungen Mann verschonen werden, die sie so ungerecht ins Exil verbannt haben.«
»Ich werde nichts dergleichen tun!« schrillte die Zauberin. »Werd wieder vernünftig, Mann! Du kannst ein Königreich gewinnen!«
Trent wandte sich an Bink. »Die Zauberin hat sich nicht durch Erfahrung so geändert wie ich. Sie wird uns nicht helfen. Die Machtgier hat sie für alles andere blind gemacht, so wie sie mich auch fast blind gemacht hätte. Sie werden Hilfe holen müssen.«
»Ja«, sagte Bink. Er konnte es nicht mitansehen, wie das Blut aus Chamäleons Wunde floß.
»Ich werde ihre Wunde so gut verbinden, wie ich kann«, sagte Trent. »Ich glaube, daß sie noch etwa eine Stunde überleben wird. Bis dahin müssen Sie zurück sein!«
»Ja…« erwiderte Bink. Wenn sie sterben sollte…
Plötzlich war Bink ein Vogel, ein buntgefiederter Phönix mit Feuerschwingen. Man würde ihn mit Sicherheit bemerken, denn ein solcher Vogel war nur alle fünfhundert Jahre zu sehen. Er breitete seine Flügel aus und flog empor. Er kreiste immer höher, bis er weit entfernt die Türme des Humfreyschen Schlosses erblickte.