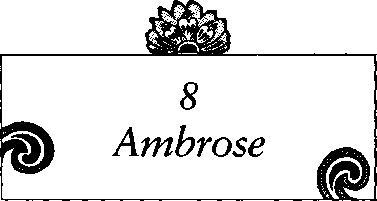Die Offizierin vom Frauen-Marinehilfskorps schob ihre Papiere zurecht und schraubte ihren Füllfederhalter auf. »Nun, Stern, wir müssen jetzt entscheiden, in welche Abteilung wir Sie stecken wollen.«
Penelope saß vor dem Schreibtisch und sah sie an. Die Offizierin hatte zwei blaue Streifen auf dem Ärmel und sehr kurz geschnittenes Haar. Ihr Kragen und ihre Krawatte saßen so fest, daß es aussah, als könne sie jederzeit ersticken, sie trug eine Herrenarmbanduhr, und neben den Papieren lagen ihr ledernes Zigarettenetui und ein massives goldenes Feuerzeug. Penelope erkannte eine weitere Miss Pawson und empfand eine gewisse Sympathie. »Haben Sie irgendwelche Qualifikationen?«
»Nein. Ich glaube nicht.«
»Steno? Schreibmaschine?«
»Nein.«
»Universitätsabschluß?«
»Nein.«
»Sie müssen ›Ma’am‹ zu mir sagen.«
»Ja, Ma’am.«
Die Offizierin räusperte sich und merkte, daß die neue Rekrutin des Frauenhilfskorps sie mit ihrem offenen Gesichtsausdruck und dem zutraulichen Blick ihrer dunkelbraunen Augen aus der Fassung brachte. Sie trug Uniform, aber die Uniform sah an ihr nicht so aus, wie sie aussehen sollte. Sie war zu groß, und ihre Beine waren zu lang, und ihre weichen und dunklen, zu einem losen Knoten gesteckten Haare waren eine Katastrophe. Der Knoten sah aus, als könne er jederzeit aufgehen und eine üppige Haarflut freigeben. Nicht militärisch.
»Ich nehme an, Sie haben eine Schule besucht?« Sie hätte sich nicht gewundert, wenn die Rekrutin Stern zu Hause unterrichtet worden wäre, von einer Gouvernante. Sie sah so aus. Ein bißchen Französisch und Aquarellieren und nicht viel mehr. Aber die Rekrutin Stern sagte: »Ja.«
»Pensionat?«
»Nein. Tagesschulen. Wenn wir in London waren, habe ich die Privatschule von Miss Pritchet besucht, und in Porthkerris die Mädchenoberschule. Porthkerris ist in Cornwall«, fügte sie freundlich hinzu.
Die Offizierin hätte sich gern eine Zigarette angezündet. »Ist dies das erste Mal, daß Sie von zu Haus fort sind?«
»Ja.«
»Sie müssen ›Ma’am‹ zu mir sagen.«
»Ja, Ma’am.«
Die Offizierin seufzte. Rekrutin Stern würde einer von diesen Problemfällen sein. Kultiviert, halbgebildet, vollkommen nutzlos. »Können Sie kochen?« fragte sie ohne große Hoffnung. »Nicht sehr gut.«
Es gab keine Alternative. »In dem Fall fürchte ich, daß wir Sie zu einem Steward machen müssen.«
Rekrutin Stern lächelte liebenswürdig und schien sich zu freuen, daß sie endlich zu einer Entscheidung gekommen waren. »Sehr gut.«
Die Offizierin schrieb einige Notizen auf das Formular und schraubte die Kappe des Füllfederhalters wieder auf. Penelope wartete, was als nächstes geschehen würde. »Ich denke, das wäre es.« Penelope stand auf, aber die Offizierin war noch nicht fertig. »Stern. Ihr Haar. Sie müssen etwas damit machen.«
»Was?« fragte Penelope.
»Wissen Sie, es darf nicht den Kragen berühren. Das ist Marinevorschrift. Warum lassen Sie es nicht kurz schneiden?«
»Ich möchte nicht, daß es kurz geschnitten wird.«
»Hm. dann versuchen Sie einfach, einen richtigen straffen Knoten zu machen. Geben Sie sich ein bißchen Mühe.«
»Oh. Ja, das werde ich tun.«
»Sie können abtreten.«
»Auf Wiedersehen.« Sie ging, doch als die Tür schon halb hinter ihr zu war, wurde sie wieder geöffnet. »Ma’am.« Sie wurde für die Königliche Marine-Artillerieschule HMS Excellent auf der Wal-Insel gezogen. Sie war Steward, doch sie wurde, vielleicht weil sie »anständig sprach«, zu einem Offizierssteward gemacht, das heißt, sie arbeitete in der Offiziersmesse: Sie deckte Tische, servierte Drinks, holte Leute ans Telefon, polierte Bestecke und bediente bei den Mahlzeiten. Und kurz bevor es dunkel wurde, mußte sie bei den Kabinen die Runde machen und für Verdunkelung sorgen. Sie klopfte immer an, und wenn jemand drin war, sagte sie: »Bitte um Erlaubnis, das Schiff zu verdunkeln, Sir.« Sie war in Wahrheit ein Stubenmädchen bei der Royal Navy und wurde auch entsprechend bezahlt, fünfzehn Shilling die Woche. Alle vierzehn Tage war Zahltag, und sie mußte zusammen mit den anderen antreten und warten, bis die Reihe an ihr war, vor dem verkniffen dreinblickenden Zahlmeister - der so aussah, als ob er Frauen haßte, und es wahrscheinlich auch tat - zu salutieren, ihren Namen zu sagen und einen braunen Umschlag mit ihrem mageren Sold entgegenzunehmen.
Um Erlaubnis zur Schiffsverdunkelung zu bitten, war nur einer der Ausdrücke aus der vollkommen neuen Sprache, die sie lernen mußte, und sie hatte eine Woche in einem Ausbildungslager verbracht, um das zu tun. Ein Schlafzimmer war eine Kabine; der Fußboden war das Deck; wenn sie zur Arbeit ging, ging sie an Bord; acht Glasen oder eine Wache waren vier Stunden, und jemanden über die Rahe fieren war jemanden betrunken machen, aber als Frau konnte man das schlecht und hatte deshalb auch keine Gelegenheit, diesen schönen Seemannsausdruck zu gebrauchen. Die Wal-Insel war tatsächlich eine Insel, und um dorthin zu kommen, mußte man eine Brücke überqueren, was einigermaßen aufregend war und einem das Gefühl gab, man ginge an Bord eines Schiffs, obgleich man es gar nicht tat. Vor sehr langer Zeit war sie nichts weiter als eine Schlammbank im Hafen von Portsmouth gewesen, aber nun beherbergte sie die große und wichtige Marineschule und hatte einen Paradeplatz und eine Exerzierhalle, eine Kirche und Anleger und gewaltige Geschützbatterien, wo die Männer übten. Die Büros und Unterkünfte waren in einer Reihe von Häusern und Gebäuden aus rotem Backstein. Die Mannschaftsquartiere waren klein und ärmlich, wie Gemeindewohnungen, aber die Offiziersmesse war groß und luxuriös, ein Landhaus mit einem Fußballplatz als Park.
Es herrschte unaufhörlicher Lärm. Signalhörner wurden geblasen, und Pfiffe ertönten, und Tagesbefehle wurden aus dem knackenden und rauschenden Lautsprecher gebrüllt. Die Männer, die ausgebildet wurden, liefen immerzu in Zweierreihen herum, und ihre Stiefel knallten rhythmisch auf den Asphalt. Auf dem Paradeplatz schrien sich rotgesichtige Unteroffiziere die Kehle aus dem Hals, während Abteilungen verängstigter junger Seeleute ihr bestes taten, um die Schwierigkeiten des geschlossenen Exerzierens zu meistern. Jeden Morgen fand die Flaggenzeremonie statt, und die Königliche Marinekapelle schmetterte »Braganza« und »Hearts of Oak«. Wenn man draußen erwischt wurde, während die Fahne am Mast hochgezogen wurde, mußte man sich zum Achterdeck drehen und Habachtstellung einnehmen und so lange salutieren, bis alles vorbei war.
Die Angehörigen des Frauen-Marinehilfskorps waren in einem requirierten Hotel am nördlichen Stadtrand untergebracht. Penelope teilte dort mit fünf anderen Mädchen eine Kabine, in der sechs Kojen paarweise übereinander angebracht waren. Eines der Mädchen roch abscheulich, was kein Wunder war, da es sich so gut wie nie wusch. Das Quartier war drei Kilometer von der Wal-Insel entfernt, und da die Navy nicht für Beförderung sorgte und keine Busse fuhren, rief Penelope in Porthkerris an und bat Sophie, ihr das Fahrrad zu schicken, mit dem sie immer zur Schule gefahren war. Sophie versprach es. Sie würde es selbst zum Zug bringen, und Penelope sollte es vom Hauptbahnhof von Portsmouth abholen.
»Wie geht es dir denn, Liebling?«
»Ganz gut.« Es war schrecklich, Sophies Stimme zu hören und nicht bei ihr zu sein. »Wie geht es dir? Was macht Papa?«
»Miss Pawson hat ihm beigebracht, wie man mit einer Handspritze umgeht.«
»Und Doris und die Jungen?«
»Ronald ist in die Fußballmannschaft gekommen. Und wir glauben, daß Clark die Masern hat. Und im Garten blühen die ersten Schneeglöckchen.«
»Schon?« Sie hätte sie so gern gesehen. Sie wäre so gern dort gewesen. Es war schrecklich, an alle ihre Lieben in Cam Cottage zu denken und nicht bei ihnen zu sein. An ihr geliebtes Zimmer zu denken, das ihr ganz allein gehörte, an die Vorhänge, die sich in der Brise bauschten, und den Lichtkegel des Leuchtturms, der über die Wand strich.
»Bist du auch glücklich, Liebling?«
Doch ehe Penelope antworten konnte, kam ein Piep-piep-piep aus dem Hörer, und die Leitung war tot. Sie hängte auf und war froh, daß man sie unterbrochen hatte, ehe sie antworten konnte, denn sie war nicht glücklich. Sie fühlte sich einsam, sie hatte Heimweh, sie langweilte sich. Sie paßte nicht in diese merkwürdige neue Welt und fürchtete, daß sie nie hineinpassen würde. Sie hätte Krankenschwester werden sollen oder Landarbeiterin für den Kriegseinsatz oder Arbeiterin in einer Munitionsfabrik - irgend etwas, nur nicht den impulsiven und spektakulären Entschluß fassen, dem sie diese nicht endenwollende Misere verdankte.
Der nächste Tag war ein Donnerstag. Inzwischen war Februar, und es war noch sehr kalt, aber die Sonne hatte den ganzen Tag geschienen, und um fünf Uhr hatte Penelope endlich dienstfrei, verließ den Komplex, salutierte vor dem wachhabenden Offizier und schritt über die schmale Brücke. Es war Hochwasser, und Portsdown Hill wirkte in der einsetzenden Dämmerung paradiesisch ländlich. Wenn ihr Fahrrad da war, würde sie vielleicht Ausflüge machen können und irgendwo ein bißchen Gras finden, auf das sie sich setzen konnte. Aber nun hatte sie nur die langen, leeren Abendstunden vor sich, und sie überlegte, ob sie die Ausgabe riskieren und ins Kino gehen könnte.
Hinter ihr näherte sich ein Auto, das in die Stadt fuhr. Sie ging weiter. Es wurde langsamer und hielt neben ihr. Es war ein schnittiger kleiner MG mit zurückgeklapptem Verdeck. »Wohin wollen Sie?«
Zuerst konnte sie es kaum glauben, daß sie angesprochen wurde. Es war das erste Mal, daß sie hier jemand ansprach, natürlich abgesehen davon, daß die Männer sich in der Messe an sie wandten, um ihr zu sagen, daß sie Erbsen und Karotten haben wollten, oder um einen Pink Gin zu bestellen. Aber da sonst niemand in der Nähe war, mußte sie gemeint sein. Penelope erkannte den Fahrer. Es war der großgewachsene, dunkelhaarige und blauäugige Oberleutnant zur See, der Keeling hieß. Sie wußte, daß er einen Artillerielehrgang machte, weil er in der Messe Gamaschen, weiße Flanellhosen und ein weißes Halstuch trug, also die vorgeschriebene Uniform für Offiziere, die an einem Lehrgang teilnahmen. Aber jetzt trug er gewöhnliche Uniform und wirkte unbeschwert und ausgesprochen gutgelaunt, wie jemand, der sich einen lustigen Abend machen will.
Sie sagte: »Zum Quartier des Frauen-Marinehilfskorps.« Er beugte sich zur Seite und öffnete die Beifahrertür. »Steigen Sie ein, und ich bring Sie hin.«
»Ist es denn Ihre Richtung?«
»Nicht ganz, aber das macht nichts.«
Sie stieg ein und machte die Tür zu. Der kleine Wagen sauste so schnell los, daß sie ihren Hut festhalten mußte. »Ich habe Sie doch schon mal gesehen, nicht wahr? Sie arbeiten in der Messe?«
»Ja.«
»Macht es Spaß?«
»Es geht.«
»Warum haben Sie die Arbeit dann genommen?«
»Ich konnte nichts anderes.«
»Ist dies Ihr erster Einsatz?«
»Ja. Ich habe mich erst vor einem Monat verpflichtet.«
»Wie gefällt es Ihnen bei der Navy?« Da er so eifrig und begeistert wirkte, mochte sie ihm nicht sagen, daß sie die Navy haßte. »Ganz gut. Ich gewöhne mich langsam daran.«
»Ein bißchen wie im Internat?«
»Ich war nicht im Internat, und ich kann es deshalb nicht beurteilen.«
»Wie heißen Sie?«
»Penelope Stern.«
»Ich bin Ambrose Keeling.«
Für viel mehr reichte die Zeit nicht. Fünf Minuten später fuhren sie durch das Tor des Marinehilfskorps-Quartiers, und vor dem Eingang bremste er so scharf, daß der Kies laut knirschte und die diensthabende Unteroffizierin mit einem mißbilligenden Stirnrunzeln aus ihrem Fenster sah.
Er stellte den Motor ab, und Penelope sagte: »Vielen Dank« und langte zum Türgriff. »Was haben Sie heute abend vor?«
»Eigentlich nichts.«
»Ich auch nicht. Warum trinken wir nicht zusammen ein Glas im Offiziersclub?«
»Was. jetzt gleich?«
»Ja. Jetzt gleich.« Die blauen Augen funkelten belustigt. »Klingt das so gefährlich?«
»Nein. kein bißchen. Es ist nur, weil.« Gemeine in Uniform durften keinen Offiziersclub betreten. »Ich müßte mich umziehen und. Zivil anziehen.« Das war noch etwas, was sie im Ausbildungslager gelernt hatte - normale Kleidung hieß »Zivil«. Sie war einigermaßen stolz, daß sie alle diese Regeln und Vorschriften behalten hatte.
»Das macht nichts. Ich warte hier.«
Sie stieg aus und ging ins Haus, während er im Auto sitzenblieb und sich eine Zigarette anzündete, um die Zeit zu vertreiben. Sie eilte zwei Stufen auf einmal nehmend die Treppe hinauf, weil sie schreckliche Angst davor hatte, daß er, wenn sie zu lange brauchte, die Geduld verlieren und allein wegfahren und nie wieder ein Wort mit ihr reden würde. In ihrer Kabine angekommen, zog sie hastig die Uniform aus und warf sie auf ihre Koje, wusch sich Gesicht und Hände, zog die Nadeln aus ihrem Haar und schüttelte es glatt. Während sie es bürstete, genoß sie die vertraute schwere Fülle auf ihren Schultern. Es war, als ob sie wieder frei wäre, wieder sie selbst, und sie spürte, wie ihr Selbstvertrauen langsam zurückkehrte. Sie machte den Gemeinschaftsschrank auf und nahm das Kleid heraus, das Sophie ihr zu Weihnachten geschenkt hatte, und die räudige Bisamjacke, die sie gerettet und für sich behalten hatte, als Tante Ethel sie auf eine Trödelauktion hatte geben wollen. Sie fand ein Paar Strümpfe ohne Laufmaschen und nahm ihre besten Schuhe. Sie brauchte keine Handtasche, weil sie kein Geld hatte und sich nie schminkte. Sie rannte wieder hinunter, trug sich in das Anwesenheitsbuch ein und ging hinaus.
Es war nun fast dunkel, aber er saß immer noch in seinem kleinen Auto und rauchte immer noch an derselben Zigarette. »Tut mir leid, daß ich so lange gebraucht habe.« Außer Atem stieg sie wieder ein.
»Lange?« Er lachte, drückte die Zigarette aus und warf die Kippe fort. »Ich hab noch nie ein Mädchen gekannt, das so schnell war. Ich hatte mich darauf gefaßt gemacht, mindestens eine halbe Stunde zu warten.«
Die Tatsache, daß er bereit gewesen war, so lange auf sie zu warten, war überraschend und schmeichelhaft. Sie lächelte ihn an. Sie hatte vergessen, sich Parfüm hinter die Ohren zu tupfen, und hoffte, er würde nicht merken, daß Tante Ethels alte Pelzjacke nach Mottenkugeln roch.
»Ich habe zum erstenmal Zivil an, seit ich mich verpflichtet habe.«
Er ließ den Motor an. »Was für ein Gefühl ist es?« fragte er. »Es ist himmlisch.«
Sie fuhren zum Offiziersclub in Southsea, er führte sie nach oben, und sie setzten sich an die Bar, und er fragte sie, was sie trinken wolle. Sie wußte nicht recht, was sie nehmen sollte, und so bestellte er zwei Gin mit Orangensaft, und sie sagte ihm nicht, daß sie noch nie in ihrem Leben einen Tropfen Gin getrunken hatte.
Als die Drinks kamen, unterhielten sie sich, die Atmosphäre war ganz locker, und sie erzählte ihm, daß sie in Porthkerris lebe und daß ihr Vater dorthin gezogen sei, weil er Maler sei, aber nun male er nicht mehr. Sie erzählte ihm auch, daß ihre Mutter Französin sei.
»Das erklärt es«, sagte er. »Erklärt was?«
»Ich weiß nicht genau. Irgend etwas an Ihnen. Sie sind mir sofort aufgefallen. Dunkle Augen. Dunkles Haar. Sie sehen nicht so aus wie die anderen Mädchen vom Hilfskorps.«
»Ich bin mindestens drei Meter größer als sie.«
»Das ist es nicht, obgleich ich große Frauen mag. Eine Art.« Er zuckte mit den Schultern und führ auf französisch fort. »Ein gewisses je ne sais quoi. Haben Sie in Frankreich gelebt?«
»Nur kurz. Wir hatten einen Winter lang eine Wohnung in Paris. Aber wir sind öfter hingefahren.«
»Sprechen Sie Französisch?«
»Natürlich.«
»Haben Sie Geschwister?«
»Nein.«
»Ich auch nicht.« Er erzählte von sich. Er war einundzwanzig. Sein Vater, der das Familienunternehmen, offenbar einen Verlag, geführt hatte, war gestorben, als er zehn gewesen war. Nach dem Internat hätte er in den Verlag eintreten können, aber er wollte sein Leben nicht am Schreibtisch verbringen. Außerdem stand offensichtlich Krieg bevor, und so war er zur Royal Navy gegangen. Seine Mutter, die nicht wieder geheiratet hatte, wohnte in einer Wohnung am Wilbraham Place in Knightsbridge, aber sie war bei Kriegsausbruch aufs Land gezogen und wohnte nun in einem kleinen Hotel in einem entlegenen Winkel von Devon. »Es ist besser, wenn sie nicht in London ist. Sie ist nicht sehr stark, und wenn die Bombenangriffe losgehen, könnte sie niemandem helfen und würde nur anderen Leuten zur Last fallen.«
»Wie lange sind Sie schon auf der Wal-Insel?«
»Einen Monat. Ich hoffe, ich bin in zwei Wochen fertig. Es hängt von der Prüfung ab. Artillerie ist mein letzter Lehrgang. Navigation, Torpedos und Funk hab ich Gott sei Dank schon hinter mir.«
»Wohin gehen Sie dann?«
»Noch eine Woche zur Divisionsakademie und dann auf See.« Sie tranken ihr Glas aus, und er bestellte noch eine Runde. Dann gingen sie in den Speiseraum und aßen zu Abend. Nach dem Essen fuhren sie ein bißchen in Southsea herum, und da sie spätestens um halb zehn wieder im Quartier sein mußte, brachte er sie dann zurück.
Sie sagte: »Ich danke Ihnen vielmals«, aber die höfliche Floskel konnte nicht im entferntesten die Dankbarkeit ausdrücken, die sie dafür empfand, daß er mit ihr ausgegangen war und - mehr noch - gerade in dem Moment gekommen war, in dem sie einen Menschen gebraucht hatte, und daß sie nun einen Freund hatte und sich nicht mehr einsam fühlen würde. Er fragte: »Haben Sie Sonnabend frei?«
»Ja.«
»Ich habe Karten für ein Konzert. Möchten Sie mitkommen?«
»Oh.« Sie spürte, daß sie unwillkürlich über das ganze Gesicht zu strahlen begann. »Ja, sehr gern.«
»Ich hole Sie ab. Gegen sieben. Oh, Penelope. Lassen Sie sich einen Ausgehschein bis halb elf geben.«
Das Konzert war in Southsea. Anne Zeigler und Webster Booth sangen Schlager wie Only a Rose und If You Were the Only Girl in the World.
Nie werd ich ihn vergessen,
Den Hügel im Mondschein,
Wo ich dich besessen.
Ambrose hielt ihre Hand. Als er sie diesmal zurückbrachte, hielt er ein kleines Stück vor dem Hilfskorps-Quartier entfernt in einer stillen Seitenstraße, nahm sie trotz Mottenpelz und allem in die Arme und küßte sie. Es war das erste Mal, daß sie von einem Mann geküßt wurde, und sie mußte sich daran gewöhnen, aber nach einer Weile fand sie es kein bißchen unangenehm. Seine Nähe, seine männliche Ausstrahlung und der frische Geruch seiner Haut lösten vielmehr eine körperliche Reaktion in ihr aus, die sie noch nie erlebt hatte. Eine Unruhe tief in ihr. Einen Schmerz, der nicht weh tat. »Penelope, Liebes, du bist das tollste Mädchen, das es gibt.« Doch über seine Schulter hinweg konnte sie die Uhr am Armaturenbrett erkennen, und sie sah, daß es fünf vor halb elf war. Sie gab sich innerlich einen Ruck und rutschte ein Stück zur Seite, löste sich aus seiner Umarmung und strich sich mit einer instinktiven Handbewegung ihr in Unordnung geratenes Haar glatt. Sie sagte: »Ich muß gehen. Ich darf nicht zu spät kommen.« Er seufzte und ließ sie widerstrebend los. »Verdammte Uhr. Verdammte Zeit.«
»Tut mir leid.«
»Ist nicht deine Schuld. Wir müssen uns einfach was anderes einfallen lassen.«
»Was anderes?«
»Ich habe Sonnabend und Sonntag frei. Wie ist es? Könntest du Urlaub bekommen?«
»Nächstes Wochenende?«
»Ja.«
»Ich könnte es versuchen.«
»Wir könnten nach London fahren. Eine Show sehen. Die Nacht über bleiben.«
»Oh, das wäre wunderbar. Ich habe bis jetzt noch keinen Urlaub gehabt. Ich bin sicher, daß es klappt.«
»Das einzig Blöde ist.« Er machte ein besorgtes Gesicht. »Meine Mutter hat ihre Wohnung an einen Kerl von der Army vermietet, da können wir also nicht hin. Ich könnte ja in meinen Club gehen, aber.«
Es war herrlich, daß sie in der Lage war, seine Probleme zu lösen. »Wir können zu mir.«
»Zu dir?«
Penelope fing an zu lachen. »Nicht nach Porthkerris, du Narr. Wir haben doch ein Haus in London.«
»Ein Haus in London?«
»Ja. In der Oakley Street. Es ist ganz einfach. Ich habe einen Schlüssel und kann jederzeit hin.«
Es war ganz einfach. »Aber es ist doch nicht dein Haus?« Sie lachte immer noch. »Natürlich nicht. Es gehört Papa.«
»Aber werden sie auch nichts dagegen haben? Ich meine, deine Eltern. «
»Dagegen haben? Warum sollten sie denn was dagegen haben?« Er dachte daran, ihr den Grund zu sagen, beschloß dann aber, es nicht zu tun. Eine französische Mutter und ein Maler als Vater. Künstler. Bohemiens. Er hatte noch nie eine Bohemienne gekannt, aber er wurde sich bewußt, daß nun eine neben ihm saß. »Nur so«, beteuerte er hastig. Er konnte sein Glück kaum fassen. »Aber du siehst so überrascht aus.«
»Vielleicht war ich es«, gab er zu, und dann lächelte er so charmant er konnte. »Aber ich sollte vielleicht aufhören, überrascht über dich zu sein. Vielleicht sollte ich mir einfach vornehmen, mich nicht mehr von dir überraschen zu lassen, egal, was du tust.«
»Ist das gut?«
»Es kann nicht schlecht sein.«
Dann brachte er sie zurück zum Quartier, sie küßten sich zum Abschied, und sie stieg aus und ging ins Haus und war so verwirrt und glücklich, daß sie vergaß, sich in das Buch einzutragen, und von der Wachhabenden, die sehr schlechte Laune hatte, weil der Vollmatrose, dem sie schöne Augen machte, mit einem anderen Mädchen ins Kino gegangen war, zurückgerufen werden mußte. Sie bekam Urlaub, und Ambrose erzählte, was er vorhatte. Einer seiner Freunde. ein Oberleutnant bei der Freiwilligenreserve der Royal Navy mit beneidenswerten Beziehungen zur Theaterwelt. hatte es geschafft, ihm zwei Karten für The Dancing Years im Drury Lane Theatre zu besorgen. Er organisierte etwas Benzin und lieh sich von einem anderen hilfsbereiten Kumpel fünf Pfund. Am Samstagmittag fuhr er am Tor des Frauenhilfskorps-Quartiers vor und bremste so rasant, daß kleine Kieselsteine in alle Richtungen flogen. Eine Gemeine kam gerade vorbei, und er sagte ihr, sie sei ein Schatz, und ob sie bitte die Gemeine Stern suchen und ihr ausrichten würde, Oberleutnant zur See Keeling sei da und warte auf sie. Sie bekam einen glasigen Blick, als sie das schnittige kleine Auto und den attraktiven jungen Offizier sah, aber er war glasige Blicke gewohnt und nahm ihren offensichtlichen Neid und ihre nicht minder offensichtliche Bewunderung als einen Tribut hin, der ihm zustand. »Mich nicht mehr von dir überraschen lassen, egal, was du tust«, hatte er Penelope spitzbübisch erklärt, doch als sie endlich erschien, war es schwer, nicht ein bißchen überrascht zu sein, denn sie hatte ihre Uniform an, trug ihre alte Pelzjacke und eine Umhängetasche über der Schulter, und das war alles.
»Wo ist dein Gepäck?« fragte er, als sie eingestiegen war und den Pelz zwischen ihren Füßen auf dem Boden verstaute. »Hier.« Sie hielt die Umhängetasche hoch.
»Das ist dein ganzes Gepäck? Aber wir sind das Wochenende über fort. Wir gehen ins Theater. Du hast doch nicht vor, die ganze Zeit diese unmögliche Uniform zu tragen, oder?«
»Nein, natürlich nicht. Ich fahre doch nach Haus. Dort sind genug Sachen zum Anziehen, ich werde schon etwas Passendes finden.« Ambrose dachte an seine Mutter, die gern für jede Gelegenheit eine Garderobe kaufte und dann zwei Stunden brauchte, um sich zu entscheiden, was sie anziehen wollte. »Was ist mit einer Zahnbürste?«
»Meine Zahnbürste und meine Haarbürste sind hier in der Tasche. Das ist alles, was ich brauche. Wir fahren doch nach London, oder nicht?«
Es war ein schöner sonniger Tag, wie geschaffen dafür, alles hinter sich zu lassen, den Dienst zu vergessen und mit jemandem, den man sehr gern hatte, ins Wochenende zu fahren. Ambrose nahm die Straße über Portsdown, und als sie oben waren, schaute Penelope auf Portsmouth zurück und sagte der Stadt freudig Lebewohl. Sie fuhren durch Purbrook und durch das Hügelland an der Küste nach Petersfield, und in Petersfield merkten sie, daß sie Hunger hatten, hielten vor einem Pub und gingen hinein. Ambrose bestellte Bier, und eine freundliche Frau machte ihnen Sandwiches mit Büchsenfleisch, das sie mit einem gelben Blumenkohlröschen aus einem Mixed-Pickles-Glas garnierte.
Dann kamen sie durch Haslemere und Farnham und Guildford und fuhren über Hammersmith auf der King’s Road nach London hinein und bogen in die Oakley Street, bei deren Anblick Penelopes Herz höher schlug, mit der Albert-Brücke am anderen Ende und den Möwen und dem salzigen, ein klein wenig fauligen Geruch der Themse und den tutenden Sirenen der Schlepper. »Da, das Haus dort ist es.«
Er parkte den MG, stellte den Motor ab und lehnte sich zurück, um die Fassade des großen, ehrwürdigen alten Reihenhauses staunend zu betrachten. »Das ist es?«
»Ja. Ich weiß, die Geländer müßten dringend neu lackiert werden, aber wir haben noch keine Zeit dazu gehabt. Und es ist natürlich viel zu groß für uns, aber wir wohnen nicht allein darin. Komm, ich zeige dir alles.«
Sie nahm ihre Umhängetasche und ihre Pelzjacke und half ihm dabei, das Verdeck zu schließen, falls es regnen würde. Als sie damit fertig waren, nahm er seine Reisetasche und wartete nicht ohne eine gewisse Vorfreude darauf, daß Penelope ihn die eindrucksvolle, von Säulen flankierte Eingangstreppe hinaufführen, ihren Schlüssel nehmen und ins Haus lassen würde, und er war ein bißchen enttäuscht, als sie statt dessen ein Stück weiterging, eine schmiedeeiserne Pforte öffnete und die Stufen zum Souterraineingang hinunterlief. Er folgte ihr, machte die Pforte hinter sich zu und sah, daß es ganz und gar nicht aussah wie ein schäbiger Dienstboteneingang. Die Wände waren weiß getüncht, und neben der Tür stand eine knallrote Mülltonne, und rings um den kleinen Vorplatz waren große und kleine Blumentöpfe aus Ton verteilt, die im Sommer zweifellos eine blühende Pracht von Geranien, Geißblatt und Pelargonien enthalten würden.
Die Tür war genauso rot wie die Mülltonne. Er wartete, während sie aufschloß, öffnete und folgte ihr langsam und vorsichtig ins Haus und befand sich in einer hellen und geräumigen Küche, wie er sie noch nie gesehen hatte. Seine Mutter war nur in die Küche gegangen, um Lily, der Köchin und Haushälterin, zu sagen, wie viele Personen am nächsten Tag zum Lunch kommen würden. Da sie sich nie längere Zeit in der Küche aufhalten und ganz gewiß nicht dort arbeiten mußte, war ihr die Einrichtung gleichgültig, und Ambrose hatte sie als einen unerfreulichen, alles andere als einladenden, flaschengrün gestrichenen Raum in Erinnerung. Wenn Lily nicht gerade Kohlen schleppte, Mahlzeiten zubereitete, Möbel abwischte oder bei Tisch auftrug, hielt sie sich in einem winzigen Zimmer auf, das von der Küche abging und mit einer eisernen Bettstelle und einer gelblackierten Kommode möbliert war. Sie mußte ihre Kleidungsstücke an einen Haken an der Tür hängen, und wenn sie baden wollte, mußte sie es nachmittags tun, wenn sonst niemand das Badezimmer benutzte, ehe sie ihr gutes schwarzes Arbeitskleid anzog und eine weiße Musselinschürze umband. Bei Ausbruch des Krieges hatte Lily das Leben ihrer Arbeitgeberin in seinen Grundfesten erschüttert, indem sie kündigte und in einer Munitionsfabrik anfing. Mrs. Keeling hatte keinen Ersatz für sie finden können, und Lilys Verrat war einer der Gründe, weshalb sie klein beigegeben und sich ins fernste Devon zurückgezogen hatte, um dort zu warten, bis wieder Friede war.
Aber diese Küche hier. Er stellte die Reisetasche hin und blickte sich um. Sah den langen blankgescheuerten Holztisch, die Kollektion von Stühlen, das Küchenbüfett mit den vielen bemalten Keramiktellern, Krügen und Schüsseln. An einem Balken über dem Herd hingen, säuberlich nach der Größe geordnet, Töpfe und Kasserollen aus Kupfer neben Kräuterbüscheln und Trockenblumensträußen. Er sah einen Korbsessel, einen blitzenden weißen Kühlschrank, und unter dem Fenster war ein großes weiß emailliertes Spülbecken, so daß jeder, der Geschirr spülen mußte, die Füße der Leute betrachten konnte, die auf dem Bürgersteig vorbeigingen. Der Fußboden hatte einen Plattenbelag und war übersät mit Binsenmatten und Binsenvorlegern, und es roch nach Knoblauch und Kräutern wie in einer épicérie in einem Dorf in Frankreich. Er traute seinen Augen nicht. »Das ist eure Küche?«
»Es ist unser Zimmer für alles. Wir wohnen hier unten.« Erst jetzt sah er, daß der Raum die ganze Länge des Hauses einnahm, denn am anderen Ende führten Fenstertüren in einen Garten, der aus lauter Grün zu bestehen schien. Er wurde jedoch von einem breiten Rundbogen mit einem schweren, hübsch gemusterten - Ambrose wußte nicht, daß der Entwurf von William Morris war -Vorhang unterteilt. »Ursprünglich«, fuhr Penelope fort, während sie ihre Jacke und die Umhängetasche auf den Tisch legte, »waren hier unten natürlich lauter Vorratsräume und Speisekammern, aber Papa hat alle Zwischenwände einreißen lassen und ein Gartenzimmer daraus gemacht, wie er es nennt. Wir benutzen den hinteren Teil als Wohnzimmer. Komm und sieh es dir an.« Er nahm den Hut ab und folgte ihr.
Als er den Rundbogen passiert hatte, sah er den Kamin mit der Einfassung aus farbigen italienischen Kacheln, das Klavier, das alte Grammophon. Große, vielbenutzte Ledersofas und Ledersessel mit losen Bezügen aus verblichenem Kretonne in verschiedenen Mustern, über die breite Seidenschals drapiert waren, schöne Tapisseriekissen. Die Wände waren weißgetüncht und wurden zum größten Teil von Bücherregalen und Fotos bedeckt - von all dem, was sich in vielen Jahren angesammelt hatte, nahm er an. Die restlichen Flächen nahmen Bilder ein, die üppige Gärten und sonnige Terrassen darstellten und in intensiven Farbtönen gehalten waren, bei deren Anblick er die Wärme der südlichen Länder zu spüren glaubte, in denen sie gemalt worden waren. »Sind die Bilder von deinem Vater?«
»Nein. Wir haben nur noch drei Bilder von ihm, und sie sind alle in Cornwall. Er hat Arthritis in den Händen und kann nicht mehr malen. Diese Bilder sind alle von seinem Freund, Charles Rainier. Sie haben vor dem letzten Krieg zusammen in Paris gearbeitet und sind noch heute befreundet. Die Rainiers haben ein herrliches Haus in Südfrankreich. Wir sind früher oft bei ihnen gewesen. in den Ferien, mit dem Auto. da.« Sie nahm ein gerahmtes Foto von einem Regal und hielt es ihm hin. »Das sind wir, irgendwo unterwegs, als wir gerade Rast machen.«
Er sah eines der üblichen Familienbilder, fünf Personen, die in die Kamera blickten und sich bemühten, ein strahlendes Gesicht zu machen: Penelope hatte Zöpfe und trug ein Sommerkleid. Außerdem ihre Eltern und, wie er annahm, irgendeine Verwandte. Was seine Aufmerksamkeit jedoch fesselte, war das Auto, neben dem sie sich aufgebaut hatten.
»Das ist doch ein Viereinhalbliter-Bentley?« Er konnte nicht verhindern, daß seine Stimme bewundernd klang.
»Ja. Papa liebt ihn über alles. Genau wie Mr. Toad in den Leutchen um Meister Dachs. Wenn er damit fährt, nimmt er seinen schwarzen Hut ab und setzt eine Lederkappe auf, und er weigert sich, das Verdeck zu schließen, und wenn es regnet, werden wir alle klitschnaß.«
»Habt ihr ihn noch?«
»Ja, natürlich. Er würde sich nie davon trennen.« Sie stellte das Foto wieder aufs Regal, und sein Blick wurde wieder von Charles Rainiers faszinierenden Bildern angezogen. Er konnte sich nichts Schickeres vorstellen, als in den sorglosen Jahren vor dem Krieg mit einem Viereinhalbliter-Bentley nach Südfrankreich zu fahren, in eine Welt voll Sonnenschein, wo die Luft nach Kiefernharz duftete, wo man unter freiem Himmel speisen und im blauen Mittelmeer baden konnte. Er dachte an trunkene Abende in einer Weinlaube. An eine lange Siesta bei geschlossenen Fensterläden, damit es nicht ganz so heiß war, mit Liebe am Nachmittag und Küssen so süß wie Weintrauben. »Ambrose.«
Jäh aus seinem Tagtraum gerissen, wandte er sich ihr zu. Sie lächelte vollkommen unbefangen, zog ihre Uniformjacke aus und warf sie auf einen Sessel, und da er immer noch in seinen Phantasien gefangen war, malte er sich aus, wie er ihr auch den Rest ausziehen würde, um sie hier und jetzt, auf einem dieser breiten und einladenden Sofas, zu lieben.
Er trat einen Schritt auf sie zu, aber es war bereits zu spät, denn sie hatte sich umgedreht, war zu den Fenstertüren gegangen und kämpfte nun mit einem Riegel. Der Zauber war gebrochen. Kalte Luft strömte herein, und er seufzte und folgte ihr gehorsam in den kalten Londoner Tag hinaus, um sich den Garten zeigen zu lassen. »Du mußt kommen und dir alles ansehen... Er ist sehr groß, weil die Leute, die nebenan gewohnt haben, Papa vor Jahren ein Stück von ihrem Garten verkauft haben. Es tut mir leid für die Leute, die jetzt dort wohnen, sie haben nur einen deprimierenden kleinen Hinterhof behalten. Und die Mauer am Ende ist sehr alt, vermutlich aus der Tudorzeit. Ich glaube, er hat früher zu einer königlichen Obstwiese oder zu einem Lustgarten gehört.«
Es war in der Tat ein sehr großer Garten, mit Rasen und Rabatten und Blumenbeeten und einer altersschwachen Pergola. »Was ist das für ein Schuppen?« fragte er.
»Es ist kein Schuppen. Es ist das Londoner Atelier meines Vaters. Ich kann es dir aber nicht zeigen, weil ich keinen Schlüssel dafür habe. Es ist sowieso voll von Staffeleien, Leinwänden, Farben und Gartenmöbeln und Feldbetten. Er kann einfach nichts fortwerfen. Jedesmal, wenn wir nach London kommen, sagt er, er wolle das Atelier ausräumen, aber er tut es nie. Ich nehme an, es ist deshalb, weil all die Dinge seine Vergangenheit verkörpern. Oder aus Faulheit.« Sie fröstelte. »Kalt, nicht? Gehen wir zurück, und ich zeige dir den Rest.«
Er folgte ihr wortlos, und sein höflich interessierter Ausdruck verriet nichts davon, daß sein Verstand fieberhaft arbeitete und mit der Präzision einer Maschine Möglichkeiten und Chancen ausrechnete. Obgleich dieses alte Londoner Haus dringend renoviert werden mußte und recht unkonventionell aufgeteilt war, beeindruckte es ihn mit seiner Großzügigkeit und stilvollen Schönheit, und er kam zu dem Schluß, daß es der perfekt ausgestatteten Wohnung seiner Mutter mit Abstand vorzuziehen sei.
Außerdem war er damit beschäftigt, sich ein Mosaik aus den verschiedenen kleinen Informationen zusammenzusetzen, die ihm Penelope ganz nebenbei, als wären sie vollkommen unwichtig, gegeben hatte. Bemerkungen über ihre Familie und deren fabelhaft unkonventionellen bohèmehaften Lebensstil. Seiner war im Vergleich dazu alltäglich und furchtbar langweilig. Sein Leben ebenfalls. In London geboren und groß geworden, jedes Jahr in den Sommerferien nach Torquay oder Frinton gefahren, Internat und dann die Royal Navy. Die bis jetzt nichts weiter gewesen war als eine Fortsetzung der Schule, mit ein bißchen Drill und Exerzieren gewürzt. Er war noch nicht mal auf See gewesen und würde erst dann fahren, wenn er alle Lehrgänge absolviert und alle Prüfungen bestanden hatte.
Aber Penelope war wirklich kosmopolitisch. Sie hatte in Paris gelebt, und ihre Familie besaß außer diesem Haus in London auch noch ein Haus in Cornwall. Er versuchte, sich dieses Haus vorzustellen. Er hatte kürzlich Daphne du Mauriers Roman Rebecca gelesen und stellte sich einen Besitz wie Manderley vor, vielleicht eine Villa im elisabethanischen Stil mit einer zwei Kilometer langen, von Hortensienbüschen gesäumten Zufahrt. Und ihr Vater war ein berühmter Maler, und ihre Mutter war Französin, und sie schien es ganz selbstverständlich zu finden, im Sommer mit einem Viereinhalbliter-Bentley nach Südfrankreich zu fahren und dort bei Freunden zu wohnen. Der Viereinhalbliter-Bentley erregte seinen Neid mehr als alles andere. Er hatte immer von solch einem Auto geträumt, denn es war ein Symbol für Wohlstand und Männlichkeit, nach dem sich die Leute auf der Straße umdrehen würden - und es hatte genau die richtige Portion Exzentrik, nicht zuviel und nicht zuwenig.
Während sich diese Gedanken in seinem Kopf drehten und er sich überlegte, wie er noch mehr herausfinden könne, betrat er hinter ihr wieder das Haus und folgte ihr durch das Souterrain zu einer schmalen dunklen Treppe. Sie gingen hinauf und standen in der geräumigen und eleganten Eingangsdiele, mit einem wunderschönen Fächerfenster über der Eingangstür und einer breiten Treppe mit niedrigen Stufen, die sich in einem schönen Bogen nach oben schwang. Er staunte über die unerwartete Pracht und blickte sich um.
»Ich fürchte, es ist ein bißchen heruntergekommen«, sagte sie, wie um sich zu entschuldigen. Ambrose fand es kein bißchen heruntergekommen. »Und wo dieser schreckliche helle Fleck auf der Tapete ist, haben Die Muschelsucher gehangen. Es ist Papas Lieblingsbild, und er wollte nicht, daß es bei einem Bombenangriff beschädigt würde, und deshalb haben Sophie und ich es in eine Kiste packen und nach Cornwall bringen lassen. Ich finde, das Haus ist ohne das Bild nicht mehr so wie früher.«
Ambrose ging zur Treppe, weil er es nicht abwarten konnte, mehr zu sehen, aber sie sagte: »Wir gehen besser nicht nach oben.« Dann öffnete sie eine Tür. »Das ist das Schlafzimmer meiner Eltern. Ich glaube, es war ursprünglich das Eßzimmer. Es geht zum Garten. Morgens ist es hier wunderschön, weil die Sonne voll hereinfallt. Und das hier, zur Straße, ist mein Zimmer. Und hier ist das Bad. Und hier ist die Besenkammer, wo meine Mutter den Staubsauger abstellt. Das ist alles.«
Die Besichtigung war beendet. Ambrose kehrte zum Fuß der Treppe zurück, blieb dort stehen und schaute nach oben. »Wer wohnt dort?«
»Eine Menge Leute. Die Hardcastles und die Cliffords und ganz oben, in den Mansardenzimmern, die Friedmanns.«
»Untermieter«, sagte Ambrose. Das Wort blieb ihm fast in der Kehle stecken, denn es war ein Wort, das seine Mutter immer nur im Ton größten Abscheus ausgesprochen hatte. »Ja, so nennt man es wohl. Es ist sehr schön. Es sind immer Freunde im Haus, man kann sie praktisch jederzeit sehen. Oh, das erinnert mich an etwas, ich muß nach oben und Elizabeth Clifford Bescheid sagen, daß wir hier sind. Ich hab versucht, sie anzurufen, aber es war besetzt, und ich hab vergessen, es noch mal zu probieren.«
»Wirst du ihr sagen, daß ich auch hier bin?«
»Natürlich. Möchtest du sie kennenlernen? Sie ist sehr nett.«
»Nein. Lieber nicht.«
»Warum gehst du dann nicht wieder in die Küche und stellst Wasser auf, damit wir eine Tasse Tee trinken können. Ich werde sehen, ob ich Elizabeth überreden kann, uns ein bißchen Kuchen oder Gebäck zu geben, und wenn wir Tee getrunken haben, gehen wir und kaufen Eier und Brot und was wir sonst noch brauchen. Sonst haben wir morgen nichts zum Frühstück.«
Ihre Stimme klang wie die eines aufgeregten kleinen Mädchens, das zum erstenmal für alles verantwortlich ist. »In Ordnung.«
»Ich bin gleich zurück.«
Sie lief mit ihren langen Beinen die Treppe hinauf, und Ambrose stand in der Diele und sah ihr nach. Er biß sich auf die Lippe. Er, der gewöhnlich so selbstsicher war, empfand eine sonderbare Befangenheit und hatte den nagenden Verdacht, daß er, indem er hierher, in Penelopes Elternhaus, gekommen war, irgendwie die Kontrolle über die Situation verloren hatte. Es beunruhigte ihn, weil er es noch nie erlebt hatte, und er ahnte dunkel, ihre außergewöhnliche Mischung aus Naivität und Weltklugheit könne die gleiche Wirkung auf ihn haben wie ein sehr starker trockener Martini und ihm seine Widerstandskraft und Energie rauben.
Der große Herd in der Küche brannte nicht, aber es gab einen Elektrokessel, und er ließ ihn mit Wasser vollaufen und schaltete ihn an. Der winterliche Himmel hatte sich grau gefärbt, und der große halbdunkle Raum war kalt, aber im Kamin in der Wohnecke waren Fidibusse aus Zeitungspapier und Späne, er zündete sie mit seinem Feuerzeug an und sah zu, wie sie aufflammten, um dann einige Scheite und ein paar Kohlen aus einem Kupfereimer aufzulegen. Als Penelope im Laufschritt zurückkam, prasselte das Feuer, und das Wasser im Kessel summte.
»Oh, das ist gut, du hast den Kamin angemacht. Dann ist es gleich viel gemütlicher. Es gab keinen Kuchen, aber ich hab mir etwas Brot und Margarine geliehen. Aber irgendwas fehlt noch.« Sie stand stirnrunzelnd da und überlegte, und dann fiel ihr ein, was es war. »Ja, die Uhr. Sie ist natürlich stehengeblieben. Wenn du sie bitte aufziehen würdest, Ambrose? Sie tickt so herrlich beruhigend.« Es war eine altmodische Wanduhr, die sehr hoch hing. Er schob einen Stuhl darunter und stieg hinauf, klappte den Glasdeckel auf, drehte die Zeiger auf die richtige Stunde und Minute und zog das Werk mit einem großen Messingschlüssel auf. Penelope öffnete derweil Schubladen und Schranktüren und holte Tassen, Messer, Teelöffel und eine Teekanne heraus.
»War deine Freundin da?« Er horchte kurz, ob die Uhr tickte, und stieg dann vom Stuhl.
»Nein, sie ist in der Stadt, aber ich bin nach oben gegangen und habe mit Lalla Friedmann gesprochen. Ich bin froh, daß ich es getan habe, denn ich habe mir ein bißchen Sorgen um sie gemacht. Weißt du, sie sind Flüchtlinge, Juden, ein junges Ehepaar aus München, und sie haben furchtbare Dinge durchgemacht. Als ich Willi zuletzt sah, dachte ich, er wäre kurz vor einem Nervenzusammenbruch.« Sie überlegte, ob sie Ambrose erzählen sollte, daß es Willi gewesen war, der sie zu ihrem Entschluß bewogen hatte, sich beim Frauen-Marinehilfskorps zu verpflichten, hielt es aber für besser, es nicht zu tun. Sie war nicht sicher, daß er es verstehen würde. »Sie hat gesagt, daß es ihm schon viel besser geht, er hat eine neue Stelle gefunden, und sie ist in anderen Umständen. Sie ist sehr nett. Sie unterrichtet Musik, sie muß sehr begabt sein. Macht es dir etwas aus, den Tee ohne Milch zu trinken?«
Nach dem Tee gingen sie die King’s Road hoch, kauften in einem Lebensmittelgeschäft einige Sachen ein und kehrten dann in die Oakley Street zurück. Es war fast dunkel, so daß sie alle Verdunkelungsvorhänge zuzogen, und dann bezog sie die Betten, und er saß auf einem Stuhl und schaute zu.
»Du kannst in meinem Zimmer schlafen, und ich schlafe im Bett meiner Eltern. Möchtest du baden, ehe du dich umziehst? Im Boiler ist immer genug heißes Wasser. Oder möchtest du vielleicht etwas trinken?«
Ambrose bejahte beides, so daß sie wieder in die Küche hinuntergingen, wo Penelope eine Flasche Gordon’s, eine Flasche Dewar’s und eine Flasche ohne Etikett, deren Inhalt nach Mandeln roch, aus der Anrichte holte. »Wem gehört das alles?« fragte er. »Papa.«
»Hat er nichts dagegen, daß ich davon trinke?« Sie starrte ihn überrascht an. »Aber dafür ist es doch da. Um Freunde zu bewirten.«
Dies war wieder etwas Neues. Seine Mutter teilte den Sherry in winzigen Gläsern zu, und wenn er Gin wollte, mußte er selbst welchen kaufen. Er sagte jedoch nichts, sondern schenkte sich einen doppelten Scotch ein und ging, in einer Hand das Glas und in der anderen seine Reisetasche, wieder nach oben in das ihm zugewiesene Zimmer. Es war sonderbar, sich in dieser fremden, weiblichen Umgebung auszuziehen, und während er es tat, lief er hin und her wie eine Katze, die sich mit einem neuen Heim vertraut machen will, und betrachtete die Bilder, setzte sich probeweise auf das Bett, las die Titel der Bücher auf dem Regal. Er hatte Georgette Heyer und Ethel M. Dell erwartet, fand statt dessen aber Virginia Woolf und Rebecca West. Nicht nur Bohemienne, sondern auch eine Intellektuelle. Er kam sich auf einmal vor wie ein Lebemann. Er zog seinen Noel-Coward-Morgenmantel an, nahm ein Badetuch, seine Waschtasche und das Glas und trat auf die Diele. In dem kleinen Badezimmer ließ er Wasser einlaufen, während er sich rasierte, und legte sich dann in die Wanne, die viel zu kurz für seine langen Beine war, aber das Wasser war angenehm heiß. Wieder im Schlafzimmer, zog er sich an, verschönerte seine Uniform durch ein gestärktes Hemd und eine schwarze Seidenkrawatte von Gieves und schlüpfte in seine besten halbhohen Stiefel, nachdem er sie vorher rasch mit einem Taschentuch auf Hochglanz poliert hatte. Er bürstete sich das Haar, drehte den Kopf nach links und rechts, um sein Profil zu bewundern, nahm dann befriedigt das inzwischen leere Glas und ging wieder ins Souterrain hinunter.
Penelope war verschwunden - vermutlich suchte sie in den Schränken ihrer Mutter etwas, das sie anziehen konnte. Er hoffte, sie würde ihn nicht blamieren. Im Schein der Flammen wirkte das Wohnzimmer ganz romantisch. Er schenkte sich noch einen Scotch ein und untersuchte die aufgestapelten Schallplatten. Es war meist klassische Musik, doch zwischen Beethoven und Mahler fand er eine Platte mit Liedern von Cole Porter. Er legte sie auf den Plattenteller und zog das uralte Grammophon auf.
You’re the top,
You’re the Coliseum,
You’re the top,
You’re the Louvre Museum.
Mit halb geschlossenen Augen, ein imaginäres Mädchen in den Armen haltend, fing er an zu tanzen. Vielleicht könnten sie nach dem Theater und einem kleinen Essen in einem intimen Restaurant in einen Nachtclub gehen. Ins Embassy oder ins Bag of Nails. Wenn sein Geld ausginge, könnten sie mit einem Scheck bezahlen. Mit ein bißchen Glück würde er nicht platzen. »Ambrose.«
Er hatte sie nicht gehört. Ein bißchen verlegen, bei seiner kleinen Pantomime ertappt worden zu sein, blieb er stehen und drehte sich um. Sie kam durch den langen Raum auf ihn zu und wartete ein wenig befangen auf eine anerkennende Bemerkung, aber dieses eine Mal war er um Worte verlegen, denn in dem warmen Licht der Lampe und der Flammen im Kamin sah sie wunderschön aus. Das Kleid, für das sie sich schließlich entschieden hatte, mochte vor fünf Jahren einmal modern gewesen sein. Es war aus cremefarbenem, mit karmesinroten und scharlachroten Blüten bedrucktem Chiffon, und der Rock fiel glatt über ihre schlanken Hüften und bildete dann fließende Falten. Das Mieder hatte winzige Knöpfe bis zu dem kleinen runden Ausschnitt, und darüber war ein capeartiges Oberteil aus mehreren Chiffonlagen, das all ihren Bewegungen folgte und sich bei den rascheren Schritten, die sie nun machte, wie Schmetterlingsflügel zu öffnen schien. Sie hatte das Haar hochgesteckt, so daß ihr langer Hals, ihre anmutige Nackenpartie und ein Paar Ohrringe mit silbergefaßten Korallen wunderbar zur Geltung kamen. Sie hatte sich die Lippen korallenrot geschminkt und roch betörend. Er sagte: »Du duftest wunderbar.«
»Chanel Nummer fünf. Es war noch ein kleiner Rest in der Flasche. Ich fürchtete schon, der Geruch sei verflogen.«
»Er ist nicht verflogen.«
»Nein. Wie sehe ich aus? Wird es so gehen? Ich habe fünf oder sechs Kleider anprobiert, und dies schien mir am besten zu stehen. Es ist schrecklich alt und etwas zu kurz, weil ich größer bin als Sophie, aber.«
Ambrose stellt sein Glas ab und streckte die Hand aus. »Komm her.«
Sie tat es und legte ihre Hand in seine. Er zog sie an sich und küßte sie sehr zärtlich und behutsam, weil er nichts tun wollte, was ihre elegante Frisur oder ihr dezentes Make-up ruinieren könnte. Der Lippenstift schmeckte süß.
Er trat einen Schritt zurück und lächelte in ihre leuchtenden dunklen Augen hinunter.
»Ich wünschte fast, wir brauchten nicht auszugehen«, sagte er. »Wir werden ja zurückkommen«, erwiderte sie, und sein Herz begann vor Vorfreude schneller zu klopfen.
The Dancing Years war eine sehr romantische Show, sentimental und ziemlich unglaubwürdig. Viele der Mädchen auf der Bühne trugen Dirndlkleider und viele Männer Lederhosen, es gab schmalzige Lieder, und die Darsteller verliebten sich ineinander, entsagten ihrer Liebe tapfer und sahen sich beim Abschied schmachtend in die Augen, und jede zweite Melodie war ein Walzer. Als es vorbei war, traten sie auf die stockdunkle Straße hinaus, fuhren den Piccadilly hoch und gingen bei Quaglino’s essen. Eine Band spielte, und auf der winzigen Tanzfläche drehten sich Paare, die Männer alle in Uniform und viele der Mädchen auch.
Bumm.
Warum macht mein Herz bumm Und immerfort Bumm-bumm.
Zwischen den Gängen tanzten Ambrose und Penelope ebenfalls, aber man konnte es kaum als Tanzen bezeichnen, denn inzwischen herrschte ein solches Gedränge, daß sie praktisch nur dastehen, sich hin und her wiegen und von einem Fuß auf den anderen treten konnten. Das war jedoch nicht weiter schlimm, denn sie hielten einander in den Armen, und ihre Wangen berührten sich, und dann und wann küßte Ambrose sie aufs Ohr oder flüsterte ihr etwas sehr Gewagtes zu.
Als sie in die Oakley Street einbogen, war es fast zwei Uhr. Sich an den Händen haltend und ein Lachen unterdrückend, tasteten sie nach dem Türöffner und gingen vorsichtig die steile Steintreppe hinunter.
»Wer hat schon Angst vor Bomben?« sagte Ambrose. »Man kann sich ebensogut das Genick brechen, wenn man während der Verdunkelung herumstolpert.«
Penelope löste sich von ihm, fand den Schlüssel und das Schlüsselloch und bekam nach einigen erfolglosen Versuchen endlich die Tür auf. Er trat an ihr vorbei in das warme, samtene Dunkel. Er hörte, wie sie hinter sich die Tür abschloß, und dann, als sie es gefahrlos tun konnte, das Licht anknipste.
Alles war still. Die Bewohner der Stockwerke über ihnen schliefen friedlich. Nur das Ticken der Uhr oder das gelegentliche Motorengeräusch eines vorbeifahrenden Autos unterbrach die Stille. Das Feuer im Kamin war niedergebrannt, doch Penelope ging in das andere Ende des Raums, schürte die Glut und knipste eine Lampe an, und das warm beleuchtete Wohnzimmer glich einer Bühne, vor der sich unvermittelt der Vorhang gehoben hatte. Erster Akt, erste Szene.
Jetzt fehlten nur noch die Schauspieler.
Er ging nicht gleich zu ihr. Er fühlte sich angenehm beschwipst, aber er hatte den Punkt erreicht, an dem er noch ein Glas brauchte. Er trat zur Whiskyflasche, schenkte sich ein wenig ein und füllte das Glas mit Soda aus einem Siphon auf. Dann löschte er die Küchenlampe und ging zu der knisternden Glut und dem breiten kissenbedeckten Sofa und dem Mädchen, das er den ganzen Abend lang begehrt hatte.
Sie kniete auf dem Kaminvorleger, um sich an den letzten kleinen Flammen zu wärmen. Sie hatte die Schuhe ausgezogen. Als er näher trat, wandte sie den Kopf und lächelte. Es war spät, und sie hätte müde sein können, aber ihre Augen schimmerten, und ihr Gesicht glühte.
Sie sagte: »Warum hat ein Feuer diese gesellige Wirkung? Es ist, als wäre noch jemand im Zimmer.«
»Ich bin froh, daß es nicht so ist. Ich meine, daß niemand anders da ist.«
Sie war vollkommen entspannt und glücklich. »Es war ein schöner Abend. Ich habe mich selten so amüsiert.«
»Er ist noch nicht zu Ende.«
Er setzte sich in einen niedrigen, breiten Sessel. Er sagte: » Mit deinem Haar stimmt etwas nicht.«
»Wieso?«
»Zu perfekt für die Liebe.«
Sie lachte, griff nach oben und fing an, die Nadeln aus dem hoch sitzenden Knoten zu ziehen. Wortlos beobachtete er die klassische weibliche Geste, die erhobenen Arme, das dünne Cape, das sich wie ein Schal aus feinster Seide um ihren langen Hals schmiegte.
Die letzte Nadel war entfernt, und sie schüttelte den Kopf, so daß die lange dunkle Haarflut über ihre Schultern auf den Rücken fiel.
Sie sagte: »Jetzt bin ich wieder ich selbst.«
Die alte Wanduhr in der Küche schlug zweimal, und die Schläge klangen melodisch wider und verhallten. Sie sagte: »Zwei Uhr morgens.«
»Eine gute Zeit. Die richtige Zeit.«
Sie lachte wieder, als brauchte er nur den Mund aufzutun und irgend etwas zu sagen, um ihr Freude zu bereiten. Das glimmende Feuer verbreitete eine wohltuende intensive Wärme. Er stellte sein Glas hin und legte den Uniformrock ab, löste den Knoten der Krawatte, zog sie herunter und knöpfte den hinderlichen gestärkten Kragen seines Hemds auf. Dann stand er auf, beugte sich über sie und zog sie hoch. Er küßte sie und vergrub das Gesicht in der dichten, duftenden Haarfülle, und seine Hände fühlten durch den dünnen Chiffon ihren schlanken jungen Körper, ihre zarten Rippen, das stete Pochen ihres Herzens. Er hob sie hoch - für ein so großgewachsenes Mädchen war sie überraschend leicht -, machte ein paar Schritte und legte sie auf das Sofa, und die magische Haarflut breitete sich rings um ihr Gesicht über das fadenscheinige Kissen. Sie lachte immer noch. Nun hämmerte sein Herz schmerzhaft, und alle Fibern seines Körpers brannten vor Verlangen nach ihr. Er hatte sich während der kurzen Beziehung zu ihr dann und wann unwillkürlich gefragt, ob sie noch Jungfrau sei, aber nun fragte er sich nicht, denn es spielte auf einmal keine Rolle mehr. Er setzte sich neben sie und knöpfte langsam und behutsam die winzigen Knöpfe ihres Mieders auf. Sie versuchte nicht, ihn daran zu hindern, und als er sie von neuem küßte, auf den Mund, den Hals, die runden und milchweißen Brüste, reagierte sie mit einer uneingeschränkten süßen Hingabe.
»Du bist so schön.« Als er es gesagt hatte, wurde ihm zu seiner eigenen Überraschung bewußt, daß die Worte impulsiv gekommen waren, aus seinem Herzen. »Du bist auch schön«, sagte Penelope, legte ihre starken jungen Arme um seinen Hals und zog ihn nach unten. Ihr Mund war offen, bereit für ihn, und er wußte, daß alles an ihr auf ihn wartete.
Die ersterbenden Flammen wärmten sie und beleuchteten ihre Liebe. Tief in seinem Unbewußten regten sich Erinnerungen an ein nächtliches Kinderzimmer, zugezogene Vorhänge - lange Zeit vergessene Bilder der frühesten Kindheit. Doch es war nichts, das ihn beunruhigte, nichts, das ihn störte. Geborgenheit. Und ein Gefühl des Schwebens, eine selige Erregung. Irgendwo am Rande dieser Seligkeit aber auch eine leise Stimme der Vernunft.
»Liebling.«
»Ja.« Ein Flüstern. »Ja.«
»Ist es gut?«
»Gut? O ja. Sehr.«
»Ich liebe dich.«
»Oh.« Nicht mehr als ein Hauch. »Ambrose.«
Mitte April bekam Penelope zu ihrer Überraschung - denn sie war in solchen Dingen hoffnungslos unpraktisch - vom Hauptquartier des Hilfskorps die Mitteilung, daß ihr einwöchiger Urlaub fällig war. Sie meldete sich gehorsam zusammen mit einer Reihe anderer Mädchen im Büro der diensttuenden Unteroffizierin und wartete, und als sie an der Reihe war, bat sie um eine Rückfahrkarte nach Porthkerris.
»Das ist doch in Cornwall, nicht wahr, Stern?«
»Ja.«
»Leben Sie dort?«
»Ja.«
»Sie Glückliche.« Sie stellte die Rückfahrkarte aus, Penelope dankte ihr und verließ das Büro, ihren Fahrtausweis in die Freiheit fest umklammernd.
Die Eisenbahnfahrt nahm kein Ende. Portsmouth - Bath. Bath - Bristol. Bristol - Exeter. In Exeter mußte sie eine Stunde auf den Bummelzug nach Cornwall warten. Es machte ihr nichts aus. Sie stieg in den schmutzigen Waggon, fand einen Fensterplatz und starrte durch die schmierige Scheibe nach draußen. Dawlish, und zum erstenmal erhaschte sie einen Blick auf das Meer; es war nur der Kanal, aber das war besser als nichts. Plymouth und die Saltash- Brücke und unzählige Schiffe, anscheinend die halbe Royal Navy, im Sund vor Anker. Und dann Cornwall und die kleinen Bahnhöfe mit den feierlich und romantisch klingenden Namen. Hinter Redruth ließ sie das Fenster an dem Lederriemen herunter und beugte sich hinaus, denn sie wollte den ersten Zipfel des Atlantiks, die Dünen und die weiße Linie der Brandung auf keinen Fall verpassen. Dann rollte der Zug über den Hayle-Viadukt, und sie sah die Mündung, die jetzt, bei Hochwasser, viel breiter war als sonst. Sie hob ihren Koffer vom Gepäcknetz und ging durch den schmalen Gang zur Tür, als der Zug durch die letzte Kurve ratterte und dann im Bahnhof hielt.
Es war halb neun Uhr abends. Sie stieß die massive Tür auf und trat erleichtert, den schweren Koffer hinter sich her wuchtend, auf den Bahnsteig hinaus. Sie hatte die Uniformmütze rasch in die Jackentasche gesteckt. Die Luft war warm und mild und frisch, und die tief stehende Sonne warf lange Strahlen über die Steinplatten, und aus dem blendenden Schein traten Papa und Sophie und eilten ihr entgegen.
Es war unfaßlich schön, wieder zu Hause zu sein. Als erstes rannte sie nach oben, riß sich die Uniform vom Leib und zog normale Sachen an, einen alten Baumwollrock, ein Aertex-Hemd aus ihrer Schulzeit, eine gestopfte Strickjacke. Nichts hatte sich geändert; das Zimmer war genauso, wie sie es verlassen hatte, nur aufgeräumter und blitzsauber. Als sie mit bloßen Beinen wieder nach unten gelaufen war, ging sie nacheinander durch alle Zimmer, um ganz sicher zu sein, daß auch hier noch alles so war wie früher. Es war noch genauso. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Charles Rainiers Porträt von Sophie, das früher den Ehrenplatz über dem Kamin im Wohnzimmer eingenommen hatte, war an einem weniger auffälligen Platz gelandet, und nun hingen Die Muschelsucher, die nach einigen unvermeidlichen Verzögerungen endlich aus London eingetroffen waren, über dem Kamin. Das Bild war zu groß für das Zimmer, und das Licht wurde der Intensität seiner Farben nicht gerecht, aber es sah trotzdem wunderbar aus.
Und die Potters hatten sich zum Besseren geändert. Doris hatte ihre üppigen Rundungen verloren und war richtig schlank geworden, und sie hatte aufgehört, sich das Haar zu färben, und ließ es gerade auswachsen, so daß sie nun, zur Hälfte wasserstoffblond und zur anderen Hälfte stumpfbraun, wie ein geschecktes Pony aussah. Ronald und Clark waren größer geworden, hatten eine gesunde Farbe bekommen und waren nicht mehr so mager wie damals. Ihre Haare waren nun länger, und ihr Cockney-Akzent hatte deutliche komische Obertöne. Und die Zahl der Enten und Hühner hatte sich verdoppelt, und eine alte Henne hatte ihre Eier unbemerkt in einer defekten alten Schubkarre gelegt, die in einem Brombeerdickicht versteckt war, und dort ausgebrütet.
Penelope wollte nur eines, alles erfahren und nachvollziehen, was sich seit dem unendlich fern wirkenden Tag, an dem sie in den Zug gestiegen und nach Portsmouth gefahren war, in Cam Cottage und Porthkerris zugetragen hatte. Sophie enttäuschte sie nicht. Colonel Trubshot leitete den Zivilluftschutz und ging allen auf die Nerven. Das Sands Hotel war requiriert worden und beherbergte jetzt Soldaten. Die alte Mrs. Treganton, die ungekrönte Herrscherin des Ortes, eine ehrfurchtgebietende Dame mit großen baumelnden Ohrringen, hatte eines Tages eine Schürze umgebunden und die Leitung der Truppenkantine übernommen. Der Strand war mit Stacheldraht abgesperrt worden, und sie bauten längs der ganzen Küste Maschinengewehrnester aus Beton. Miss Preedy gab keinen Tanzunterricht mehr, sondern unterrichtete nun Leibesertüchtigung an einer Mädchenschule, die aus Kent evakuiert worden war, und Miss Pawson war während der Verdunkelung über ihre Handspritze samt Eimer gestolpert und hatte sich das Bein gebrochen. Als sie schließlich nichts mehr zu erzählen hatten, hofften sie verständlicherweise, daß ihre Tochter berichtete, wie es ihr in der Zwischenzeit ergangen war, und alles über ihr neues Leben - das sie sich beim besten Willen nicht vorstellen konnten - erzählte. Aber Penelope wollte nicht erzählen. Sie wollte nicht darüber sprechen. Sie wollte nicht an die Wal-Insel und an Portsmouth denken. Sie wollte nicht einmal an Ambrose denken. Früher oder später würde sie es natürlich müssen. Aber nicht jetzt. Nicht heute abend. Sie hatte eine ganze Woche Zeit. Es konnte warten.
Vom Hügel aus sah man das Land ringsum, das in der Sonne des warmen Frühlingsnachmittags vor sich hin zu dösen schien. Das sonnengetupfte Wasser der großen Bucht im Norden glitzerte blau. Trevose Head verschwamm im Dunst, ein sicheres Zeichen dafür, daß das schöne Wetter anhalten würde. Im Süden lag der Bogen der anderen Bucht mit dem Berg und der Burg, und dazwischen erstreckte sich Weideland, smaragdgrüne, von schmalen heckengesäumten Wegen unterbrochene Wiesen, wo Rinder und Schafe zwischen den herausragenden Granitbuckeln grasten. Eine leichte Brise wehte einen Duft von Thymian heran, und die einzigen Geräusche waren das gelegentliche Bellen eines Hundes und das ferne, gedämpfte Rattern eines Traktors.
Sie und Sophie waren die acht Kilometer von Cam Cottage gelaufen. Sie nahmen die schmalen Wege, die zum Hochmoor hinaufführten, wo die grasigen Böschungen mit wilden Primeln gesprenkelt waren und Schöllkraut in dichten gelben Ständen an den Wasserrinnen wuchs. Zuletzt waren sie über den Zaun geklettert und den sumpfigen Pfad hinaufgegangen, der sich zwischen Brombeerdickichten und hohem Adlerfarn hindurch zur Spitze des Hügels wand, zu den flechtenüberzogenen, steil aufragenden Felsblöcken, wo einst, vor Tausenden von Jahren, die kleinwüchsigen Männer gestanden hatten, die dieses Land bewohnten, um zu beobachten, wie die Segelschiffe der Phönizier, die ihre orientalischen Schätze gegen das begehrte Zinn eintauschen wollten, in der Bucht vor Anker gingen.
Nun waren sie müde von dem langen Marsch und ruhten sich aus. Sophie lag auf einem weichen Moospolster, stützte sich auf einen Ellbogen und hielt sich zum Schutz gegen die grelle Sonne die Hand über die Augen. Penelope saß, das Kinn umfassend, neben ihr. Weit oben am Himmel glitt ein Flugzeug wie ein winziges silbriges Spielzeug über ihnen hinweg. Sie blickten beide hoch und sahen zu, wie es durch das Blau zog. Sophie sagte: »Ich mag Flugzeuge nicht. Sie erinnern mich an den Krieg.«
»Mußt du immer an ihn denken?«
»Manchmal zwinge ich mich dazu, ihn zu vergessen. Ich tue einfach so, als gäbe es ihn nicht. An einem Tag wie heute fällt das nicht schwer.«
Penelope streckte die Hand aus und zupfte an einem Grasbüschel.
»Bis jetzt ist noch nicht viel passiert, nicht wahr?«
»Nein.«
»Glaubst du, es wird noch kommen?«
»Bestimmt.«
»Machst du dir darüber Sorgen?«
»Ich mache mir Sorgen um deinen Vater. Er hat Angst. Er hat es schon einmal durchgemacht.«
»Du doch auch.«
»Nicht so wie er. Nicht im entferntesten.«
Penelope warf die Grashalme fort und griff nach einem anderen Büschel. »Sophie.«
»Ja?«
»Ich bekomme ein Kind.«
Das Geräusch des Flugzeugs erstarb, wurde von der unendlichen Weite des strahlend klaren Himmels verschluckt. Sophie bewegte sich, setzte sich auf. Penelope wandte den Kopf, begegnete dem Blick ihrer Mutter und sah auf dem jugendlichen, sonnengebräunten Gesicht einen Ausdruck, den sie nur als grenzenlose Erleichterung deuten konnte.
»Ist es das, was du uns nicht erzählen wolltest?«
»Ihr habt es gespürt?«
»Natürlich haben wir es gespürt. Du warst so wortkarg, so in dich selbst zurückgezogen. Es mußte etwas passiert sein. Warum hast du es nicht gleich gesagt?«
»Es hat nichts damit zu tun, daß ich mich schäme oder Angst habe. Ich wollte nur den richtigen Augenblick abwarten. Ich wollte Zeit haben, um darüber zu sprechen.«
»Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Ich habe gespürt, daß du unglücklich warst und das, was du getan hast, bedauert hast. Oder daß du irgendwelche Schwierigkeiten hast.«
Penelope wußte nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. »Habe ich die nicht?«
»Natürlich nicht!«
»Weißt du, du setzt mich immer wieder in Erstaunen.« Sophie überhörte es. Sie packte das Problem bei den Hörnern. »Du bist ganz sicher, daß du schwanger bist?«
»Ja.«
»Bist du bei einem Arzt gewesen?«
»Das brauche ich nicht. Und der einzige Arzt, zu dem ich in Portsmouth gehen könnte, ist der Marinestabsarzt, und zu dem will ich nicht.«
»Wann ist es soweit?«
»Im November.«
»Und wer ist der Vater?«
»Er ist Oberleutnant zur See. Er war auf der Wal-Insel stationiert. Er hat einen Artillerie-Lehrgang gemacht. Er heißt Ambrose Keeling.«
»Wo ist er jetzt?«
»Oh. Er ist immer noch da. Er hat die Prüfung nicht geschafft und muß den ganzen Lehrgang wiederholen. Sie nennen es einen Schwanz machen.«
»Wie alt ist er?«
»Einundzwanzig.«
»Weiß er, daß du schwanger bist?«
»Nein. Ich wollte es zuerst dir und Papa sagen.«
»Wirst du es ihm jetzt sagen?«
»Natürlich. Wenn ich zurückkomme.«
»Wie wird er reagieren?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Es klingt nicht so, als ob du ihn gut kennst.«
»Ich kenne ihn gut genug.« Weit unter ihnen, im Tal, ging ein Mann mit seinem Hund über den Hof, öffnete das Tor und schritt zu dem Hang, auf dem seine Kühe weideten. Penelope ließ sich zurücksinken, stützte sich auf einen Ellbogen und beobachtete ihn. Er hatte ein rotes Hemd an, und der Hund tollte um ihn herum. »Weißt du, es stimmt, ich war unglücklich«, fuhr Penelope fort. »Ich glaube, in der ersten Zeit auf der Wal-Insel war ich so unglücklich wie noch nie in meinem ganzen Leben. Wie ein Fisch, den man. den man aus seinem Element genommen hat. Und ich hatte Heimweh und fühlte mich einsam. Als ich mich für das Hilfskorps verpflichtete, dachte ich, ich greife zum Schwert und fange an zu kämpfen wie alle anderen, aber dann tat ich nichts anderes, als Essen zu servieren und Verdunkelungsvorhänge zuzuziehen, und ich lebte mit Frauen und Mädchen zusammen, mit denen ich nichts gemeinsam hatte. Und ich konnte nichts dagegen unternehmen. Ich mußte weitermachen. Wenn ich gegangen wäre, wäre ich mir wie eine Fahnenflüchtige vorgekommen. Dann lernte ich Ambrose kennen, und da wurde alles besser.«
»Ich habe nicht gewußt, daß es so schlimm war.«
»Ich habe es auch nicht geschrieben. Was hätte es genützt?«
»Wirst du das Hilfskorps verlassen müssen, wenn du ein Kind bekommst?«
»Ja, sie werden mich entlassen. Wahrscheinlich unehrenhaft.«
»Wird es dir etwas ausmachen?«
»Ausmachen? Ich kann es kaum erwarten, daß sie mich wegschicken.«
»Penelope. du bist doch nicht absichtlich schwanger geworden?«
»Großer Gott, nein. So verzweifelt war ich nun doch nicht. Nein. Es passierte einfach. Eins von den Dingen, die man nicht ändern kann.«
»Du weißt doch. du weißt doch sicher, daß. daß man Vorsichtsmaßnahmen treffen kann.«
»Natürlich, aber ich dachte, das macht der Mann.«
»O Liebling, ich hatte keine Ahnung, daß du so naiv bist. Ich war eine sehr schlechte Mutter.«
»Ich habe dich nie als meine Mutter gesehen. Für mich warst du wie eine Schwester.«
»Na ja, dann war ich eben eine schlechte Schwester.« Sie seufzte. »Was machen wir jetzt?«
»Wir gehen zurück und sagen es Papa, nehme ich an. Und dann fahre ich zurück nach Portsmouth und sage es Ambrose.«
»Wirst du ihn heiraten?«
»Ja, wenn er mich fragt.«
Sophie dachte darüber nach. Dann sagte sie: »Ich weiß, du mußt diesen jungen Mann sehr mögen, sonst würdest du nicht sein Kind in dir tragen. Ich kenne dich gut genug, um das zu wissen. Aber du brauchst ihn wegen des Kindes nicht unbedingt zu heiraten. Es muß noch etwas anderes geben.«
»Du hast Papa doch auch geheiratet, als ich unterwegs war.«
»Ja, aber ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn immer geliebt. Ich konnte mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Ich hätte ihn nie verlassen, ob mit oder ohne Heirat.«
»Werdet ihr zur Hochzeit kommen, wenn ich Ambrose heirate?«
»Ich wüßte nicht, was uns daran hindern sollte.«
»Ich möchte, daß ihr kommt. Und dann, später. Wenn er die Prüfung bestanden hat, kommt er auf ein Schiff und fährt fort. Kann ich dann nach Haus kommen und bei dir und Papa bleiben? Das Kind in Cam Cottage bekommen?«
»Was für eine Frage! Was solltest du sonst tun?«
»Ich nehme an, ich könnte eine gefallene Frau werden, wie man sagt, aber ich möchte es lieber nicht.«
»Du wärst ohnehin nicht gut in der Rolle.«
Penelope war von einer tiefen Dankbarkeit erfüllt. »Ich habe gewußt, daß du so reagieren würdest. Wie schrecklich wäre es, wenn du so wärst wie andere Mütter.«
»Vielleicht wäre ich dann ein besserer Mensch. Ich bin nämlich kein guter Mensch. Ich bin egoistisch. Ich denke zuviel an mich selbst. Jetzt ist dieser furchtbare Krieg, und es wird noch sehr schlimm werden, ehe es vorbei ist. Söhne und Töchter werden getötet werden, und Väter und Brüder, und alles, was ich empfinden kann, ist Dankbarkeit darüber, daß du bald nach Haus kommen wirst. Du hast mir so sehr gefehlt. Aber bald sind wir wieder zusammen. Wie schlimm es auch werden wird, wir werden wenigstens wieder zusammen sein.«
Ambrose stellte das Glas mit dem doppelten Scotch nicht ab, als er mit seiner Mutter telefonierte.
»Coombe Hotel.« Es war eine weibliche, etwas affektiert klingende Stimme.
»Ich möchte bitte Mrs. Keeling sprechen. Ist sie im Haus?«
»Wenn Sie bitte einen Moment warten würden, ich sehe nach. Ich glaube, sie ist im Salon.«
»Vielen Dank.«
»Dürfte ich um Ihren Namen bitten?«
»Ich bin ihr Sohn. Oberleutnant Keeling.«
»Danke.« Er wartete. »Hallo?«
»Mama!«
»Oh, guten Tag, mein Lieber. Wie schön, deine Stimme zu hören. Von wo rufst du an?«
»Von der Wal-Insel. Hör zu, Mama. Ich muß dir etwas sagen.«
»Ich hoffe, es ist eine gute Nachricht.«
»Ja, eine sehr gute.« Er räusperte sich. »Ich habe mich verlobt und werde bald heiraten.« Verblüfftes Schweigen. »Mama?«
»Ja, ich bin noch da.«
»Alles in Ordnung?«
»Ja. Ja, natürlich. Hast du gesagt, du wirst bald heiraten?«
»Ja. Am ersten Sonnabend im Mai. Im Standesamt von Chelsea. Kannst du kommen?«
Es klang, als lüde er sie zu einer kleinen Party ein. »Aber... Wann?... Wo?... Oh, mein Lieber, du bringst mich ganz durcheinander.«
»Bitte, laß dich nicht durcheinanderbringen. Sie heißt Penelope Stern. Sie wird dir gefallen«, fügte er ohne große Hoffnung hinzu.
»Aber. Wann ist all das passiert?«
»Kürzlich. Deshalb rufe ich dich an. Um dir gleich Bescheid zu sagen.«
» Aber. Wer ist sie?«
»Sie ist beim Frauen-Marinehilfskorps.« Er versuchte, sich etwas einfallen zu lassen, was seine Mutter beruhigen würde. »Ihr Vater ist Maler. Sie leben in Cornwall.« Wieder Schweigen. »Und sie haben ein Haus in der Oakley Street.«
Er erwog, den Viereinhalbliter-Bentley zu erwähnen, aber seine Mutter hatte noch nie viel für Autos übrig gehabt. »Liebling. Entschuldige, daß ich nicht sehr erfreut klinge, aber du bist noch sehr jung. Deine Karriere.«
»Es ist Krieg, Mama.«
»Das weiß ich. Besser als viele andere.«
»Du kommst doch zur Hochzeit?«
»Ja. Ja, selbstverständlich. Ich werde das Wochenende über nach London kommen. Ich wohne am besten im Basil Street.«
»Großartig. Dann kannst du sie kennenlernen.«
»O Ambrose.«
Es klang, als sei sie in Tränen aufgelöst.
»Entschuldige, daß ich dich so damit überrumpelt habe. Aber keine Sorge.« Es piepste dreimal in der Leitung. »Du wirst sie bestimmt mögen«, beteuerte er noch einmal und legte rasch auf, ehe sie ihn anflehen konnte, noch ein paar Münzen in den Zahlschlitz zu werfen.
Dolly Keeling starrte auf den summenden Hörer in ihrer Hand und legte dann langsam auf.
Mrs. Musspratt, die an dem kleinen Schreibtisch unter der Treppe saß und so getan hatte, als addierte sie eine Rechnung, während sie ihre Aufmerksamkeit in Wahrheit einzig und allein auf das Telefongespräch gerichtet hatte, blickte auf, legte den Kopf zur Seite wie ein erwartungsvoller Vogel und lächelte fragend. »Hoffentlich gute Neuigkeiten, Mrs. Keeling.« Dolly riß sich zusammen, ruckte den Kopf ein wenig hoch und setzte eine freudige Miene auf. »O ja. Sehr aufregend. Mein Sohn heiratet!«
»Oh, wie schön. Wie romantisch. Diese tapferen jungen Leute. Wann denn?«
»Wie bitte?«
»Wann soll das frohe Ereignis stattfinden?«
»In zwei Wochen. Am ersten Sonnabend im Mai. In London.«
»Und wer ist die Glückliche?«
Sie wurde etwas zu neugierig. Dolly vergaß sich und ließ es sie deutlich merken. »Ich hatte noch nicht das Vergnügen, sie kennenzulernen«, sagte sie würdevoll. »Vielen Dank, daß Sie mich an den Apparat geholt haben, Mrs. Musspratt.« Damit ließ sie die Frau bei ihren Rechnungen und ging in den Gästesalon zurück.
Das Coombe Hotel war vor Jahren der Landsitz einer wohlhabenden Familie, und der Gästesalon war das Wohnzimmer der damaligen Besitzer gewesen. Eine hohe weiße Marmoreinfassung umschloß eine sehr kleine Feuerstelle, und die Einrichtung bestand aus schwellenden Sofas und Sesseln mit einem Bezug aus weißem, mit Rosen gemustertem Leinen. An den Wänden hingen - viel zu hoch -einige Aquarelle, und durch ein breites Rundbogenfenster sah man in den Garten hinaus, der seit Beginn des Kriegs zunehmend verwahrloste. Mr. Musspratt gab sich redliche Mühe mit dem Rasenmäher, aber der Gärtner war eingezogen worden, und die Rabatten waren voller Unkraut.
In dem Hotel wohnten acht Dauergäste, und vier von ihnen hatten sich zusammengetan und bildeten die selbsternannte Elite, den harten Kern der kleinen Gemeinschaft. Dolly war eine von ihnen. Die anderen waren Colonel Fawcett Smythe und seine Frau und Lady Beamish. Sie spielten abends zusammen Bridge und hatten im Salon die besten Sessel, die vor dem Kamin, und im Speiseraum die besten Tische, die am Fenster, in Beschlag genommen. Die anderen mußten sich mit kalten Ecken begnügen, wo das Licht kaum zum Lesen ausreichte, und mit Tischen am Durchgang zur Geschirrkammer, wo es zog. Aber sie waren ohnehin so kümmerlich und so sehr vom Leben gezeichnet, daß es niemandem einfiel, sie zu bedauern. Colonel Fawcett Smythe und seine Frau waren von Kent nach Devon gezogen. Sie waren beide über siebzig. Der Colonel hatte den größten Teil seines Lebens bei der Army gedient und konnte deshalb jedermann erzählen, was dieser Hitler als nächstes anstellen würde, und sich an Hand bruchstückhafter Informationen aus der Tagespresse einen Reim aus Wunderwaffen und Schiffsbewegungen machen. Er war ein kleiner Mann mit braunem Teint und einem borstigen Schnurrbart, doch was ihm an Zentimetern fehlte, machte er mit einer bellenden Stimme, zackigem Gehabe und militärischem Auftreten wett. Seine Frau war ein recht farbloses Wesen mit schütterem Haarflaum auf dem Kopf. Sie strickte eine Menge, sagte sehr oft »Meine Güte« und stimmte allem zu, was ihr Mann von sich gab, was nur gut war, denn wenn jemand Colonel Fawcett Smythe widersprach, wurde der Offizier im Ruhestand krebsrot im Gesicht und sah aus, als werde er jeden Moment vom Schlag getroffen werden.
Lady Beamish war noch besser. Sie war die einzige von ihnen allen, die sich nicht vor Bomben oder Panzern oder all den Greueln fürchtete, die die Nazis ihr antun könnten. Sie war groß und stämmig, über achtzig Jahre alt, und hatte zwei kühl blickende eisgraue Augen. Sie war entschieden gehbehindert (die Folge eines Jagdunfalls, wie sie einem beeindruckten Publikum berichtet hatte) und konnte sich nur mit Hilfe eines dicken Spazierstocks fortbewegen. Wenn sie sich nicht fortbewegte, legte sie das obere Ende des Stocks auf die Lehne ihres Sessels, wo unweigerlich jemand darüber stolperte oder ihn ans Schienbein bekam. Sie war eigentlich gegen ihren Willen ins Coombe Hotel gezogen, um dort das Ende des Krieges abzuwarten, ihr großes Haus in Hampshire war von der Army requiriert worden, und ihre finanziell notleidende Familie hatte ihr so lange geschmeichelt und gedroht, bis sie sich endlich nach Devon zurückzog. »Ausgemustert und auf Gnadenbrot gesetzt«, murrte sie fortwährend, »wie ein alter Kavalleriegaul.«
Lady Beamishs Mann war ein hoher Beamter in der indischen Zivilverwaltung gewesen, und sie hatte viele Jahre auf dem großen Subkontinent gelebt, dem Kronjuwel des britischen Empire, das sie immer »Indscha« aussprach. Sie mußte ein Fels in der Brandung gewesen sein, dachte Dolly oft, eine große Stütze für ihren Mann, die bei Gartenfesten glänzte und ihm zu Hilfe eilte, wann immer es brenzlig wurde. Man konnte sich unschwer vorstellen, wie sie, nur mit einem Tropenhelm und einem seidenen Sonnenschirm bewaffnet, dem aufrührerischen Einheimischenpöbel entgegentrat und die Leute mit ihrem stählernen Blick in Schach hielt oder, so sie sich nicht in Schach halten lassen wollten, die anderen Damen der britischen Kolonie um sich scharte und ihnen befahl, ihre Unterröcke in Streifen zu reißen und Verbandszeug daraus zu machen.
Sie warteten auf Dolly, wo sie sie verlassen hatte, vor dem spärlichen Feuer auf dem Kaminrost. Mrs. Fawcett Smythe strickte, Lady Beamish knallte Patiencekarten auf ihren tragbaren Spieltisch, und der Colonel stand mit dem Rücken zu den Flämmchen, wärmte sein Hinterteil und beugte und streckte seine rheumatischen Knie wie ein Bühnenpolizist. »So.« Dolly setzte sich wieder in ihren Sessel. »Was war denn?« fragte Lady Beamish befehlend und legte einen schwarzen Buben auf eine rote Dame. »Es war Ambrose. Er heiratet.«
Die Nachricht traf den Colonel unvorbereitet, während er mit gebeugten Knien dastand. Es kostete ihn offenbar einige Konzentration, sie durchzudrücken. »Hm, ich will verdammt sein«, sagte er. »Oh, wie aufregend«, zirpte Mrs. Fawcett Smythe. »Wer ist das Mädchen?« fragte Lady Beamish. »Sie ist. Ihr Vater ist ein Maler.« Lady Beamish zog die Mundwinkel nach unten. »Ein Maler?« Aus ihrer Stimme klang tiefste Mißbilligung. »Er ist sicher sehr berühmt«, sagte Mrs. Fawcett Smythe tröstend.
»Wie heißt sie?«
»Penelope Stern.«
»Penelope Stein?« Der Colonel wurde dann und wann von seinem Gehör im Stich gelassen.
»Großer Gott, nein.« Die armen Juden taten ihnen natürlich allen sehr leid, aber daß der eigene Sohn eine Jüdin heiratete, war unvorstellbar. »Stern.«
»Ich habe noch nie von einem Maler namens Stern gehört«, sagte der Colonel, als wolle Dolly sich über ihn lustig machen. »Sie haben ein Haus in der Oakley Street. Und Ambrose sagt, sie wird mir gefallen.«
»Wann ist die Hochzeit?«
»Anfang Mai.«
»Fahren Sie hin?«
»Selbstverständlich fahre ich hin. Ich werde im Basil Street anrufen und ein Zimmer bestellen müssen. Vielleicht sollte ich ein oder zwei Tage vorher fahren und sehen, ob ich etwas zum Anziehen finde.«
»Wird es eine schöne große Trauung?« fragte Mrs. Fawcett Smythe.
»Nein, sie findet im Standesamt von Chelsea statt.«
»Meine Güte.«
Dolly fühlte sich veranlaßt, für ihren Sohn in die Bresche zu springen. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, daß sie selbst oder er einem ihrer Bekannten leid tat. »Sie wissen doch, im Krieg. und außerdem wird Ambrose jeden Moment auf sein Schiff eingezogen. Die jungen Leute denken praktisch, und vielleicht haben sie recht. Obgleich ich sagen muß, daß ich immer von einer wirklich schönen Trauung in einer Kirche geträumt habe, mit einem Degenspalier. Aber so ist es nun mal.« Sie zuckte tapfer mit den Schulter. »C’est la guerre.«
Lady Beamish fuhr fort, ihre Patience zu legen. »Wo haben sie sich kennengelernt?«
»Er hat es nicht gesagt. Aber sie ist beim Frauen-Marinehilfskorps.«
»Nun, das ist wenigstens etwas«, bemerkte Lady Beamish. Sie bedachte Dolly mit einem scharfen, vielsagenden Blick, dem Dolly tunlichst auswich. Lady Beamish wußte, daß Dolly erst vierundvierzig war. Dolly hatte ihr recht ausführlich von ihren gesundheitlichen Problemen erzählt, den furchtbaren Kopfschmerzen (sie nannte sie Migräneanfälle), die sie im ungelegensten Augenblick bekam, und der lästigen Rückengeschichte, die von den einfachsten häuslichen Tätigkeiten, zum Beispiel Bettenmachen oder Bügeln, ausgelöst werden konnte. Handspritzen zu bedienen oder Krankenwagen zu fahren kam also gar nicht in Frage. Aber Lady Beamish schien das nicht zu genügen, und sie machte dann und wann unfreundliche Bemerkungen über Leute, die Angst vor Bomben hatten oder sich davor drückten, ihren Beitrag zu leisten. Nun erklärte Dolly mit fester Stimme: »Wenn Ambrose sich für sie entschieden hat, ist sie sicher ein Schatz.« Dann fügte sie rasch hinzu: »Außerdem habe ich mir schon immer eine Tochter gewünscht.« Das stimmte nicht. Oben in ihrem Zimmer, allein und unbeobachtet, konnte sie so sein, wie sie wirklich war, konnte die Maske fallenlassen. Überwältigt von Selbstmitleid und dem Gefühl der Einsamkeit, durchbohrt vom Stachel der Eifersucht auf die künftige Schwiegertochter, die dafür sorgen würde, daß ihr Sohn ihre Liebe zurückwies, suchte sie Trost in ihrer Schatzkiste, ihrem Kleiderschrank, der voll war von teuren Sachen. Weiche Seide, hauchzarter Chiffon und feinste Wollstoffe glitten durch ihre Hände. Sie holte ein sehr elegantes Kleid heraus, trat zum Spiegel und hielt es sich an. Eines ihrer Lieblingskleider. Sie war sich immer so hübsch darin vorgekommen. So hübsch. Sie begegnete ihrem Blick im Spiegel und sah, daß ihre Augen sich mit Tränen füllten. Ambrose. Er liebte eine andere. Er würde sie heiraten. Sie ließ das Kleid auf den Polsterstuhl fallen, warf sich aufs Bett und weinte.
Es war Frühling. London blühte und duftete nach Flieder. Die warme Sonne schien auf Bürgersteige und Dächer und wurde von den silbernen Wölbungen der hoch oben schwebenden Sperrballons reflektiert. Es war Mai, ein Freitag im Mai, mittags. Dolly Keeling, die ein Zimmer im Basil Street Hotel genommen hatte, saß an einem Fenster des Salons im ersten Stock auf dem Sofa und wartete auf ihren Sohn und seine Verlobte.
Als er im Laufschritt, die Mütze in der Hand, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe heraufkam, fand sie ihn umwerfend schneidig in seiner Navy-Uniform und freute sich unendlich, ihn wiederzusehen, zumal er allein zu sein schien. Vielleicht kam er, um ihr zu sagen, daß er beschlossen hatte, die Verlobung zu lösen, daß er doch nicht heiraten würde. Sie stand erwartungsvoll auf und ging ihm entgegen.
»Hallo, Mama.« Er beugte sich zu ihr herunter und gab ihr einen Kuß. Seine Größe war eine ihrer Wonnen, weil sie bewirkte, daß sie sich verletzlich und hilflos vorkam.
»O Liebling. wo ist Penelope denn? Ich dachte, ihr wolltet zusammen kommen.«
»Das sind wir auch. Wir sind heute morgen von Pompey hergefahren. Aber sie wollte dir nicht in Uniform vor Augen treten, also hab ich sie in der Oakley Street abgesetzt und bin allein weitergefahren. Sie wird gleich nachkommen.« Die winzige Hoffnung erstarb fast so schnell, wie sie aufgekeimt war, aber sie würde Ambrose immerhin noch eine kleine Weile für sich allein haben. Und so, allein mit ihm, konnte sie besser mit ihm reden.
»Gut, dann warten wir. Komm und setz dich und erzähl mir, was du alles geplant und vorbereitet hast.« Sie begegnete dem Blick eines Kellners, der sich sofort näherte, und bestellte einen Sherry für sich und einen Pink Gin für Ambrose. »Oakley Street. Sind ihre Eltern schon da?«
»Nein. Das ist die schlechte Nachricht. Ihr Vater hat Bronchitis. Sie hat es erst gestern abend erfahren. Sie werden nicht zur Hochzeit kommen können.«
»Aber ihre Mutter könnte doch kommen?«
»Sie sagt, sie muß in Cornwall bleiben und nach dem alten Knaben sehen. Er ist wirklich schon ziemlich alt. Fünfundsiebzig. Ich nehme an, sie wollen kein Risiko eingehen.«
»Aber es sieht komisch aus. nur ich bei der Trauung.«
»Penelope hat eine Tante, die in Putney wohnt. Und Freunde, ein Ehepaar namens Clifford. Sie werden kommen. Das reicht.« Die Drinks wurden serviert, und Dolly ließ sie auf ihre Rechnung schreiben. Sie hoben die Gläser. Ambrose sagte: »Auf dich«, und Dolly lächelte selbstgefällig und war sicher, daß die anderen Anwesenden im Salon des Hotels ihre Blicke nicht losreißen konnten von dem attraktiven jungen Marineoffizier und der hübschen Frau, die viel zu jung aussah, um seine Mutter zu sein. »Und was sind deine weiteren Pläne?«
Er erzählte es ihr. Er habe die Artillerieprüfung bestanden, würde für eine Woche auf die Divisionsakademie gehen und dann endlich in See stechen. »Aber die Hochzeitsreise?«
»Wir machen keine Hochzeitsreise. Morgen wird geheiratet, dann übernachten wir in der Oakley Street, und Sonntag geht’s wieder zurück nach Portsmouth.«
»Und Penelope?«
»Ich setze sie Sonntag morgen in den Zug nach Porthkerris.«
»Porthkerris? Fährt sie denn nicht mit dir nach Portsmouth zurück?«
»Äh. Nein.« Er biß sich auf den Daumennagel und starrte aus dem Fenster, als würde unten auf der Straße gleich etwas Faszinierendes passieren. Was nicht der Fall war. »Sie hat ein bißchen Urlaub.«
»Meine Güte. Wie wenig Zeit ihr für euch habt.«
»Nicht zu ändern.«
»Nein. Wohl nicht.«
Sie wandte sich zur Seite, um ihr Sherryglas hinzustellen, und sah, wie ein Mädchen das Ende der Treppe erreichte, dort stehenblieb und sich umsah, offenbar jemanden suchte. Ein sehr großes Mädchen mit langen dunklen Haaren, die streng aus der Stirn nach hinten gekämmt waren, die Haare eines Schulmädchens, schlicht, ohne die Spur einer Frisur. Das Gesicht mit dem cremeweißen Teint und den großen dunklen Augen fiel wegen des totalen Mangels an Make-up auf - das Schimmern ungepuderter Haut, der blasse Mund, die dunklen, dichten, ungezupften und schön geschwungenen Augenbrauen. Sie trug an diesem warmen Tag Sachen, die sich eher für einen Spaziergang auf dem Land als für einen Lunch in einem Londoner Hotel eigneten. Ein dunkelrotes Baumwollkleid mit weißen Tupfen und einen weißen Gürtel um die schmale Taille. Weiße Sandalen und. Dolly mußte ein zweites Mal hinsehen, um sicher zu sein. Ja, keine Strümpfe. Bloße Beine! Wer beim Himmel mochte sie sein? Und warum blickte sie in ihre Richtung? Und kam auf sie zu? Und lächelte? O barmherziger Gott.
Ambrose stand auf. »Mama«, sagte er, »darf ich dir Penelope vorstellen. «
»Guten Tag«, sagte Penelope.
Dolly konnte gerade noch verhindern, daß sie den Mund aufsperrte. Ihre Kinnbacken ruckten, aber sie preßte die Kiefer aufeinander und verwandelte die Grimasse rasch in ein charmantes Lächeln. Bloße Beine. Keine Handschuhe. Keine Handtasche. Kein Hut. Bloße Beine. Sie hoffte, daß der Oberkellner sie ins Restaurant lassen würde.
»Ich freue mich, Sie kennenzulernen.« Sie gaben sich die Hand. Ambrose holte umständlich einen zweiten Stuhl heran und winkte dem Kellner. Penelope saß in dem hellen Licht, das durch das Fenster in den Raum fiel, und sah Dolly mit einem unverwandten, irritierend wirkenden Blick an. Sie taxiert mich, sagte Dolly sich, und merkte, wie sich irgendwo tief in ihr Zorn regte. Sie hatte kein Recht, ihre künftige Schwiegermutter so ungeniert zu mustern. Dolly hatte Jugend erwartet, Schüchternheit, sogar Scheu. Dies ganz gewiß nicht.
»Es ist schön, Sie kennenzulernen. hoffentlich hatten Sie eine gute Fahrt von Portsmouth hierher. Das heißt, Ambrose hat mir schon erzählt.«
»Was möchtest du trinken, Penelope?«
»Einen Apfelsinensaft oder irgendeinen anderen Saft. Mit Eis, wenn es welches gibt.«
»Keinen Sherry? Oder ein Glas Wein?« lockte Dolly, die immer noch lächelte, um ihre Enttäuschung zu verbergen. »Nein. Ich schwitze und habe Durst. Ein Apfelsinensaft ist genau das, was ich brauche.«
»Nun ja, ich habe eine Flasche Wein zum Lunch bestellt. Wir können ja dann anstoßen.«
»Danke.«
»Es tut mir leid, daß Ihre Eltern morgen nicht da sein können.«
»Ja. Es ist schade. Papa hat sich eine Grippe geholt und sich nicht ins Bett gelegt, und jetzt hat er Atembeschwerden. Der Arzt hat gesagt, daß er mindestens eine Woche liegen muß.«
»Ist sonst niemand da, der nach ihm sehen könnte?«
»Außer Sophie, meinen Sie?«
»Sophie?«
»Meine Mutter. Ich sage Sophie zu ihr.«
»Oh, ich verstehe. Ja. Ist sonst niemand da, der Ihren Vater versorgen könnte?«
»Nur Doris, unsere Einquartierung. Aber sie muß sich um ihre beiden Jungen kümmern. Außerdem ist Papa ein sehr schwieriger Patient. Doris hätte keine Chance bei ihm.« Dolly machte eine resignierte Handbewegung. »Ich nehme an, es geht Ihnen wie uns allen, und Sie haben auch keine Dienstboten mehr?«
»Wir haben noch nie welche gehabt«, entgegnete Penelope. »Oh, vielen Dank, Ambrose, ich sterbe vor Durst.« Sie nahm ihm das Glas aus der Hand, trank es - mit einem einzigen Schluck, wie es schien - halb aus und stellte es dann auf den Tisch. »Noch nie? Wollen Sie sagen, Sie hatten noch nie Hilfe im Haus?«
»Nein. Jedenfalls keine Dienstboten. Die Leute, die bei uns wohnten, haben uns manchmal geholfen, aber Dienstboten haben wir nie gehabt.«
» Aber wer kocht denn?«
»Sophie. Sie kocht sehr gern. Sie ist Französin. Sie kann wunderbar kochen.«
»Und die Hausarbeit?«
Penelope blickte ein bißchen verwirrt, als hätte sie noch nie einen Gedanken an die Arbeit im Haus verschwendet. »Ich weiß nicht. Irgendwie wird immer alles gemacht. Früher oder später.«
»Aha.« Dolly erlaubte sich ein kleines verständnisvolles Lachen. »Das klingt alles sehr amüsant. Ein Künstlerhaushalt. Und ich hoffe, daß ich bald das Vergnügen haben werde, Ihre Eltern kennenzulernen. Hm. Und nun zu morgen. Was werden Sie zur Hochzeit anziehen?«
»Ich weiß nicht.«
»Sie wissen es nicht?«
»Ich hab noch nicht darüber nachgedacht. Irgendwas.«
»Aber Sie müssen es besorgen!«
»Oh, um Gottes willen, nein. Ich brauche nichts zu kaufen. Wir haben in der Oakley Street jede Menge zum Anziehen. Ich werde schon etwas finden.«
»Sie werden schon etwas finden.«
Penelope lachte. »Ich fürchte, ich gebe nicht viel auf Kleider. Wir tun es alle nicht. Und wir werfen alle nie etwas fort. Sophie hat ein paar sehr hübsche alte Sachen im Schrank, ich meine, Sachen, die sie nicht mehr anzieht. Elizabeth Clifford und ich werden nachher ein bißchen herumwühlen.« Sie sah Ambrose an. »Mach kein so ängstliches Gesicht, Ambrose. Ich werde dir bestimmt keine Schande machen.«
Er lächelte schwach. Dolly sagte sich, daß der arme Junge einem von Herzen leid tun konnte. Er und dieses außergewöhnliche Mädchen, das er kennengelernt und zu heiraten beschlossen hatte, hatten keinen einzigen liebevollen Blick gewechselt, sich kein einzigesmal zärtlich berührt oder rasch geküßt. Waren sie ineinander verliebt? Konnten sie überhaupt ineinander verliebt sein, wenn sie so kumpelhaft miteinander umgingen? Warum heiratete er sie, wenn er nicht bis über beide Ohren in sie verliebt war? Warum heiratete er.
Plötzlich fiel ihr eine Möglichkeit ein, die zu schrecklich war, um zuzutreffen, so undenkbar, daß sie sich zwang, den Gedanken beiseite zu drängen.
Aber er wollte sich nicht beiseite drängen lassen. »Ambrose hat gesagt, daß Sie Sonntag nach Hause fahren wollen.«
»Ja.«
»Sie haben Urlaub?«
Ambrose fixierte Penelope angestrengt, um ihren Blick auf sich zu ziehen. Dolly bemerkte es, aber Penelope offenbar nicht. Sie saß da und wirkte vollkommen locker und natürlich. »Ja. Einen Monat.«
»Werden Sie dann auf der Wal-Insel bleiben?« Ambrose fing an, mit der Hand herumzufuchteln, und hielt sich schließlich, als ob ihm nichts besseres damit zu tun einfiel, den Mund zu.
»Nein. Sie werden mich entlassen.« Ambrose stieß einen langen Seufzer aus. »Ent... Für immer?«
»Ja.«
»Ist das üblich?« Sie war sehr stolz, daß sie es immer noch schaffte zu lächeln, aber ihre Stimme war wie ein Messer. Penelope lächelte ebenfalls. »Nein«, antwortete sie. Ambrose war offensichtlich zu dem Schluß gekommen, daß die Situation nur noch schlimmer werden könne, und sprang auf. »Warum gehen wir nicht in den Speisesaal? Ich habe einen Mordshunger.«
Dolly faßte sich, langte gemessen nach ihrer Handtasche und nahm die weißen Handschuhe. Sie stand auf und schaute auf die künftige Frau ihres Sohnes hinunter, die dunklen Augen, die unfrisierte Mähne, die ganze schlichte Erscheinung. Sie sagte: »Ich weiß nicht, ob sie Penelope hineinlassen werden. Sie scheint keine Strümpfe anzuhaben.«
»Oh, um Gottes willen, sie werden es überhaupt nicht bemerken.« Seine Stimme war zornig und ungeduldig, aber Dolly lächelte vor sich hin, denn sie wußte, daß sein Zorn nicht ihr galt, sondern Penelope, weil sie die Katze aus dem Sack gelassen hatte. Sie ist schwanger, sagte sie sich, während sie den beiden durch den Salon zum Speisesaal voranging. Sie wollte ihn sich angeln und hat ihn hereingelegt. Er liebt sie nicht. Sie zwingt ihn, sie zu heiraten. Nach dem Lunch entschuldigte sie sich. Sie wolle auf ihr Zimmer und sich kurz hinlegen. Ein dummer kleiner Migräneanfall, erklärte sie Penelope mit einem kaum wahrnehmbaren Vorwurf in der Stimme. Ich muß sehr vorsichtig sein, die kleinste Aufregung. Penelope blickte ein wenig ratlos, weil der Lunch alles andere als aufregend gewesen war, aber sie drückte Verständnis aus, sie würden sich ja morgen auf dem Standesamt sehen, es sei ein köstliches Essen gewesen, vielen Dank. Dolly betrat den vorsintflutlichen Lift und glitt wie ein Vogel im Käfig nach oben.
Sie schauten ihr nach. Als Ambrose annahm, daß sie außer Hörweite war, drehte er sich zu Penelope. »Warum zum Teufel hast du es ihr sagen müssen?«
»Was? Daß ich schwanger bin? Ich habe es nicht gesagt. Sie hat es erraten.«
»Du hättest ihr keinen Grund geben müssen, es zu erraten.«
»Sie wird es früher oder später doch erfahren. Warum nicht jetzt?«
»Weil. na ja, solche Dinge bringen sie außer Fassung.«
»Hat sie deshalb einen Migräneanfall bekommen?«
»Ja, natürlich.« Sie hatten die Treppe erreicht und gingen nach unten. »Es hat alles in ein falsches Licht gerückt.«
»Dann tut es mir leid. Aber ich sehe wirklich nicht, daß es einen Unterschied macht. Warum sollte es für sie eine Rolle spielen? Wir heiraten. Es geht doch niemanden außer uns etwas an, nicht wahr?«
Ihm fiel keine Antwort darauf ein. Wenn sie so begriffsstutzig war, hatten Erklärungsversuche keinen Sinn. Wortlos traten sie in den Sonnenschein hinaus und gingen die Straße hinunter zu seinem Wagen. Sie legte die Hand auf seinen Arm. Sie lächelte. »O Ambrose, du machst dir doch nicht wirklich Sorgen? Sie wird darüber wegkommen. Wasser unter der Brücke, wie Papa immer sagt. Ein Wunder für neun Tage. Und dann ist es vergessen. Und wenn das Baby da ist, wird sie überglücklich sein. Jede Frau freut sich auf ihr erstes Enkelkind und kann kaum abwarten, es in die Arme zu nehmen.« Ambrose war jedoch nicht so sicher. Sie fuhren ziemlich schnell die Pavilion Road und dann die King’s Road hinunter und bogen in die Oakley Street. Als er vor dem Haus gehalten hatte, fragte sie: »Willst du nicht mit reinkommen? Du kannst Elizabeth kennenlernen. Du wirst sie bestimmt mögen.«
Aber er lehnte ab. Er habe noch einige Dinge zu erledigen. Er würde sie morgen abholen. »Gut.« Penelope war ganz ruhig und beharrte nicht. Sie gab ihm einen Kuß, stieg aus und schlug die Tür zu. »Ich werde gleich in den alten Truhen wühlen und sehen, ob ich ein Hochzeitskleid finde.«
Er lächelte gezwungen. Sah ihr nach, während sie die Eingangsstufen hinauflief und die Haustür aufschloß. Sie winkte kurz und war verschwunden.
Er legte den ersten Gang ein, wendete und fuhr den Weg zurück, den sie gekommen waren. Er fuhr durch Knightsbridge und passierte das Tor zum Hyde Park. Es war sehr warm, doch unter den Bäumen herrschte eine angenehme Kühle, und er hielt und ging ein kleines Stück, sah eine Bank und setzte sich darauf. Die Blätter raschelten leise im Wind, und der Park war voller angenehmer sommerlicher Geräusche. Kinderstimmen und Vogelgezwitscher und das ununterbrochene Brummen des Londoner Verkehrs als Hintergrundmusik.
Er war deprimiert und wütend. Penelope mochte noch so oft sagen, es spiele keine Rolle, und seine Mutter würde sich schon damit abfinden, daß es eine Mußheirat war - denn das war es doch, oder? - , aber er wußte sehr gut, daß sie es nie vergessen und wahrscheinlich nie verzeihen würde. Es war wirklich Pech, daß die Sterns nicht zur Hochzeit kommen konnten. Mit ihren liberalen und unkonventionellen Ansichten hätten sie die Waagschale vielleicht zur anderen Seite hin senken können, und selbst wenn Dolly sich geweigert hätte, die Dinge so zu sehen wie sie, wäre sie sich zumindest bewußt geworden, daß es einen anderen Standpunkt gab als den ihren. Penelope zufolge störte es sie nämlich nicht im geringsten, daß ihre Tochter schwanger war, ganz im Gegenteil, sie waren hocherfreut, und wie sie ihm über ihre Tochter zu verstehen gegeben hatten, erwarteten sie gar nicht, daß er sie zu einer bürgerlichen Hausfrau machte.
Die Nachricht, daß er Vater wurde, war ein Schock gewesen. Er konnte sich nichts auf der Welt vorstellen, was ihn so in seinen Grundfesten hätte erschüttern können. Er war fassungslos gewesen, entsetzt und außer sich vor Zorn - auf sich selbst, weil er in die gefürchtete klassische Falle getappt war, und auf Penelope, weil sie ihn hineingelockt hatte. »Ist es gut?« hatte er gefragt, und sie hatte geantwortet: »O ja. Sehr.« Und er hatte sich seiner Leidenschaft hingegeben und in der Hitze des Augenblicks nicht an die primitivste aller Vorkehrungen gedacht.
Aber sie war sehr lieb und verständnisvoll gewesen. »Wir brauchen nicht zu heiraten, Ambrose«, hatte sie versichert. »Fühl dich bitte nicht dazu verpflichtet.« Und sie hatte so gefestigt und glücklich ausgesehen, so froh über die ganze leidige Geschichte, daß er unwillkürlich eine innere Kehrtwendung gemacht und angefangen hatte, die Sache von der anderen Seite zu betrachten und alle diesbezüglichen Möglichkeiten zu erwägen.
Vielleicht war die Falle, in der er saß, doch ganz angenehm. Es könnte weit schlimmer sein. Sie war auf ihre Weise sehr schön. Und gut erzogen. Nicht irgendein kleines Ladenmädchen, das er in einem Pub in Portsmouth aufgegabelt hatte, sondern die Tochter gutsituierter, wenngleich unkonventioneller Eltern. Eltern, die nicht nur ein Haus, sondern zwei hatten. Das Haus in der Oakley Street war phantastisch, und ein Sommersitz in Cornwall war entschieden ein zusätzlicher Bonus. Er sah sich schon in einem Segelboot durch die Heiford Passage kreuzen. Und außerdem bestand sogar die Möglichkeit, einen Viereinhalbliter-Bentley zu erben. Nein. Er hatte das Richtige getan. Wenn seine Mutter den ersten Schreck über Penelopes Schwangerschaft überwunden hatte, konnte nichts mehr passieren. Außerdem war Krieg. Er konnte jeden Augenblick richtig losgehen, und er würde wahrscheinlich sehr lange dauern, und sie würden sich nicht oft sehen, geschweige denn unter einem Dach wohnen, ehe er vorbei war. Ambrose rechnete felsenfest damit, daß er mit heiler Haut davonkommen würde. Er hatte keine sehr lebhafte Phantasie und wurde nicht von Alpträumen über Maschinenraumexplosionen oder ein nasses Grab im eisigen Wasser des Atlantiks heimgesucht. Und wenn der Krieg vorbei war, würde er wahrscheinlich mehr Neigung als jetzt verspüren, seßhaft zu werden und den Familienvater zu spielen. Er verlagerte sein Gewicht auf der harten und unbequemen Bank. Erst jetzt bemerkte er die Liebespärchen, die nur wenige Meter von ihm entfernt eng umschlungen im Gras lagen. Und ihn auf eine fabelhafte Idee brachten. Er stand auf und ging zum Wagen zurück, verließ den Park, fuhr um den Marble Arch und erreichte die stillen Straßen von Bayswater. Er pfiff leise vor sich hin.
Champagner wirkt nicht bei mir,
Ich geh nicht viel auf Alkohol,
Sag mir also, woher es kommt...
Er hielt vor einem hohen schäbigen Haus und ging die Souterraintreppe zu einem winzigen Vorplatz mit blühenden Topfpflanzen hinunter. Er läutete an der gelb lackierten Tür. Er konnte natürlich Pech haben, aber nachmittags um vier war sie gewöhnlich zu Haus, hielt einen Mittagsschlaf, hantierte in ihrer winzigen Küche oder las eine Illustrierte. Er hatte Glück. Sie öffnete, und sie hatte nur ein dünnes Neglige an, das ihren üppigen Busen eher betonte als verbarg. Ihr blondes Haar war zerzaust. Angie. Sie hatte ihn, als er siebzehn war, sehr umsichtig in die Geheimnisse der Liebe eingeweiht, und er war seitdem immer wieder zu ihr geflüchtet, wenn er Probleme hatte.
»Oh!« Sie machte große Augen und strahlte über das ganze Gesicht. »Ambrose!«
Kein Mann hätte sich eine schönere Begrüßung wünschen können.
»Es ist eine Ewigkeit her, seit du zuletzt da warst. Ich dachte, du schwimmst schon längst irgendwo auf dem Ozean.« Sie streckte einen molligen rosigen Arm aus. »Bleib nicht in der Tür stehen. Komm rein.«
Er tat es.
Als Penelope die Haustür geöffnet hatte und durch die Windfangtür in die Diele trat, beugte Elizabeth Clifford sich oben im ersten Stock über das Treppengeländer und rief ihren Namen. Penelope ging hinauf.
»Wie ist es gegangen?«
»Nicht sehr gut.« Penelope lächelte breit. »Sie gehört zur schlimmsten Sorte. Hut und Handschuhe und all das und außer sich vor Entrüstung, daß ich keine Strümpfe anhatte. Sie sagte, sie würden uns deshalb nicht in den Speisesaal lassen, aber sie haben es natürlich getan.«
»Hat sie herausgefunden, daß du ein Kind erwartest?«
»Ja. Ich habe es nicht gesagt, aber sie hat zwei und zwei zusammengezählt. Ich konnte sehen, wie es ihr auf einmal dämmerte. Ich finde es so am besten. Ambrose war wütend, aber sie kann es ebensogut schon jetzt wissen.«
»Vielleicht hast du recht«, sagte Elizabeth, aber sie hatte Mitleid mit der armen Frau. Junge Leute, auch Penelope, konnten schrecklich herzlos und direkt sein. »Möchtest du eine Tasse Tee oder etwas anderes zu trinken?«
»Gern, aber nicht jetzt. Hör zu, ich muß unbedingt etwas finden, was ich morgen anziehen kann. Hilf mir bitte.«
»Ich hab in weiser Voraussicht schon ein bißchen in meinem alten Schrankkoffer gekramt.« Elizabeth ging ihr voran ins Schlafzimmer, wo ein großer Haufen zerknitterter Kleidungsstücke, einige davon offenbar schon sehr abgetragen, auf dem breiten Doppelbett lag, das sie mit Peter teilte. »Ich finde, dies hier ist ganz hübsch. Ich hatte es mal für Hurlingham gekauft. Ich glaube, es war 1921. Als Peter seine Cricketphase hatte.« Sie nahm ein Kleid aus cremefarbenem, sehr feinem Leinen mit tief angesetzter Taille und Hohlsaumnähten von dem Haufen. »Es sieht ein bißchen mitgenommen aus, aber ich könnte es bis morgen waschen und bügeln. Und hier sind sogar passende Schuhe - du magst doch straßbesetzte Schnallen, nicht wahr? Und seidene Strümpfe im selben Farbton.« Penelope nahm das Kleid, ging damit zum Spiegel, hielt es sich an und betrachtete sich mit halbgeschlossenen Augen, drehte sich ein wenig nach rechts und links, um die Wirkung zu beurteilen. »Eine wunderschöne Farbe, Elizabeth. Wie ganz helles Stroh. Würdest du es mir wirklich leihen?«
» Selbstverständlich.«
»Hättest du zufällig auch einen Hut? Ich glaube, ich sollte einen aufsetzen. Oder mein Haar hochstecken, irgendwas.«
»Und du brauchst einen Unterrock. Der Stoff ist sehr fein, ein bißchen durchscheinend, und man würde deine Beine sehen.«
»Das wäre eine Katastrophe. Dolly Keeling würde in Ohnmacht fallen.«
Sie fingen an zu lachen. Penelope zog lachend das rote Baumwollkleid aus und ließ das feine blaßgelbe Leinen über ihren Kopf nach unten gleiten, und plötzlich wurde ihr wieder leicht ums Herz. Dolly Keeling ging ihr auf die Nerven, aber sie heiratete Ambrose, nicht seine Mutter, und welche Rolle spielte es da, was sie von ihr dachte?
Die Sonne schien. Der Himmel war strahlendblau. Dolly Keeling frühstückte im Bett und stand um elf Uhr auf. Ihre Kopfschmerzen waren zwar nicht fort, aber sie hatten nachgelassen. Sie nahm ein Bad, richtete ihr Haar und legte Make-up auf. Es dauerte sehr lange, denn es kam darauf an, daß sie jung und zugleich untadelig aussah und möglichst alle, auch die Braut, in den Schatten stellte. Als die letzte Wimper zurechtgezupft war, erhob sie sich vom Frisierschemel, zog den dünnen Morgenrock aus und legte ihren Staat an. Ein fliederfarbenes Seidenkleid mit einer weiten, fließenden Jacke aus demselben Material. Ein feiner Strohhut mit einem grobgerippten fliederfarbenen Band, den sie so aufsetzte, daß die Locken am Haaransatz frei blieben. Die hochhackigen, vorne offenen Pumps, die langen weißen Handschuhe, die weiße Handtasche aus Glacéleder. Ein letzter Blick in den Spiegel beruhigte sie und hob ihre Lebensgeister. Ambrose würde stolz auf sie sein. Sie nahm rasch noch zwei Aspirin, betupfte sich mit Houbigant und ging ins Foyer hinunter.
Ambrose wartete schon auf sie. Er sah in seiner Ausgehuniform absolut umwerfend aus und duftete, als sei er gerade eben aus einem teuren Frisiersalon gekommen, was übrigens der Fall war. Auf dem niedrigen Tisch neben ihm stand ein leeres Glas, und als er sie mit einem Kuß begrüßte, stellte sie fest, daß sein Atem nach Cognac roch, und sie zerfloß vor Liebe zu ihrem kleinen Jungen, der ja erst einundzwanzig Jahre alt war und einfach Lampenfieber haben mußte.
Sie gingen hinunter und nahmen ein Taxi zur King’s Road. Während der Fahrt hielt Dolly die Hand ihres Sohnes fest zwischen ihren behandschuhten Fingern. Sie redeten nicht miteinander. Es hatte keinen Sinn zu reden. Sie war ihm eine gute Mutter gewesen. keine Frau hätte mehr für ihn tun können. Und was Penelope anging. na ja, gewisse Dinge blieben besser ungesagt. Das Taxi hielt vor dem eindrucksvollen Rathaus von Chelsea. Sie stiegen aus, und während Ambrose zahlte, drehte Dolly das Gesicht in den angenehmen lauen Windhauch, besann sich aber rasch eines Besseren und strich ihren Rock glatt, vergewisserte sich, daß ihr Hut gut saß und blickte sich dann um. Einige Meter entfernt wartete eine andere Frau, eine bizarr aussehende kleine Person, noch zierlicher als sie, mit den dünnsten schwarzbestrumpften Beinen, die sie jemals gesehen hatte. Richtige Storchenbeine. Ihre Blicke begegneten sich. Dolly sah rasch in eine andere Richtung, aber es war zu spät, denn die andere Frau näherte sich ihr bereits freudestrahlend, streckte die Hand aus, nahm die ihre in einen schraubstockähnlichen Griff und krähte: »Sie müssen die Keeling sein. Ich habe es gewußt. Ich habe es in meinen Knochen gewußt, sobald ich Sie gesehen habe!« Dolly starrte sie an und war überzeugt, daß sie von einer Wahnsinnigen angegriffen wurde, und als Ambrose sich von dem fortfahrenden Taxi abgewandt hatte, erschrak er ebenso wie seine Mutter. »Entschuldigung, ich...«
»Ich bin Ethel Stern. Lawrence Sterns Schwester.« Sie war in eine knallrote Jacke, sicher eine Kindergröße, mit vielen Litzen und anderem Besatz gezwängt und trug eine gewaltige Baskenmütze aus schwarzem Samt. »Sagen Sie Tante Ethel zu mir, junger Mann.« Sie gab Dollys Hand frei und streckte die ihre in Ambroses Richtung aus. Als er sie nicht umgehend nahm, huschte ein furchtsamer Ausdruck über ihre runzligen Züge.
»Sagen Sie bloß nicht, ich hätte die Falschen erwischt!«
»Nein. Nein, natürlich nicht.« Verlegen und peinlich berührt von ihrer absonderlichen Aufmachung war er ein bißchen rot geworden. »Guten Tag. Ich bin Ambrose, und das ist meine Mutter, Dolly Keeling.«
»Ich dachte, ich könnte mich einfach nicht irren. Ich warte schon seit Stunden «, plapperte sie. Ihr Haar war dunkelrot gefärbt und ihr Make-up wie auf gut Glück aufgetragen, als hätte sie es mit geschlossenen Augen gemacht. Ihre nachgezogenen Augenbrauen waren nicht identisch geschwungen, und das dunkle Lippenrot hatte bereits angefangen, in den feinen Hautfurchen um ihren Mund zu zerlaufen. »Normalerweise komme ich immer und überall zu spät, und darum habe ich mir heute besondere Mühe gegeben und war natürlich viel zu früh da.« Sie setzte eine übertrieben traurige Miene auf. Sie sah aus wie ein Liliputanerclown, wie das Äffchen eines Leierkastenmanns. »Meine Güte, ist das mit Lawrence nicht zu blöde? Der arme Teufel, er wird sich schwarz ärgern.«
»Ja«, sagte Dolly schwach. »Wir haben uns so darauf gefreut, ihn kennenzulernen.«
»Er fährt immer so gern nach London. Jeder Vorwand ist ihm recht.« In diesem Moment stieß sie einen gellenden Schrei aus, der Dolly entsetzt zusammenfahren ließ, und fing an, mit beiden Armen herumzufuchteln. Dolly sah ein Taxi aus der anderen Richtung zum Bordstein rollen und halten, und Penelope und ein älteres Ehepaar, sicher diese Cliffords, aussteigen. Alle drei lachten, und Penelope wirkte ungezwungen und kein bißchen nervös.
»Hallo! Da sind wir. Gut abgepaßt, nicht wahr? Guten Tag, Tante Ethel. Wie schön, dich zu sehen. Hallo, Ambrose.« Sie küßte ihn flüchtig auf die Wange. »Du hast Mr. und Mrs. Clifford noch nicht kennengelernt, nicht wahr? Professor Clifford, Mrs. Elizabeth Clifford. Peter und Elizabeth. Und das ist Ambroses Mutter.« Alle bemühten sich, ein freundliches Gesicht zu machen, gaben einander die Hand und sagten: »Sehr angenehm.« Dolly lächelte charmant und nickte, während ihr Blick von einem zum anderen huschte und alles registrierte, so daß sie wie üblich ein rasches Urteil fällen konnte. Penelope sah aus, als hätte sie sich kostümiert, aber zugleich sehr fein - schön und unglaublich distinguiert. Sie war so groß und schlank, und das lange, fließende, cremefarbene, ins Hellgelb spielende Kleid, sicher von ihrer Mutter oder irgendwem anders, vermutete Dolly, unterstrich ihre natürliche Eleganz. Sie hatte ihr Haar zu einem losen Nackenknoten gesteckt und trug einen giftgrünen Strohhut, der anstelle des Bandes einen Kranz von Gänseblümchen hatte.
Mrs. Clifford sah dagegen aus wie eine Gouvernante im Ruhestand. Sie war wahrscheinlich sehr gescheit und gebildet, aber nachlässig gekleidet. Der Professor, der einen dunkelgrauen Nadelstreifenanzug aus Flanell und ein blaues Hemd trug, wirkte etwas eleganter (aber für einen Mann war es immer leichter, gut angezogen zu sein). Er war groß und dünn, hohlwangig und asketisch. Ein richtiger Gelehrtentyp, unbedingt vorzeigbar. Dolly war nicht die einzige, die ihn attraktiv fand. Sie hatte aus dem Augenwinkel heraus beobachtet, wie Tante Ethel ihn mit einer überschwenglichen Umarmung begrüßte, sich buchstäblich an seinen Hals hängte und dabei mit ihren dünnen alten Beinchen strampelte wie eine abgetakelte Soubrette. Sie fragte sich, ob Tante Ethel vielleicht ein bißchen übergeschnappt sei, und hoffte, daß es kein Familienmerkmal sein möge.
Endlich rief Ambrose sie alle mit dem Hinweis zur Ordnung, wenn sie jetzt nicht hineingingen, würden Penelope und er die ihnen zugewiesene Zeit verpassen und müßten unverheiratet wieder gehen. Tante Ethel schob ihre Riesenbaskenmütze zurecht, und sie marschierten in das Gebäude. Die Trauzeremonie dauerte keine zehn Minuten und war vorbei, ehe Dolly eine Gelegenheit gefunden hatte, ihr Spitzentaschentuch herauszuholen und sich die Augen abzutupfen. Dann marschierten sie alle wieder hinaus und fuhren zum Ritz, wo Peter Clifford den Anweisungen aus Cornwall gemäß einen Tisch bestellt hatte.
Nichts kann eine Situation so gut entschärfen wie köstliches Essen und reichlich Champagner auf Kosten eines weltmännischen Gastgebers. Alle verloren ihre Befangenheit oder Voreingenommenheit, sogar Dolly, obgleich Tante Ethel während der Mahlzeit eine Zigarette nach der anderen rauchte, zahlreiche pikante Anekdoten erzählte und laut lachte, ehe sie die Pointe erreicht hatte. Der Professor war äußerst zuvorkommend und aufmerksam und machte Dolly ein Kompliment über ihren Hut, und Mrs. Clifford schien sich aufrichtig für das Leben im Coombe Hotel zu interessieren und wollte alles über die Leute hören, die dort wohnten. Dolly befriedigte ihre Wißbegier und ließ dabei mehr als einmal den Namen Lady Beamish fallen. Und Penelope nahm ihren giftgrünen Hut ab und hängte ihn an den Stuhl, und der liebe Ambrose stand auf und hielt eine wunderbare kleine Rede, in der er Penelope als seine Frau bezeichnete, woraufhin alle einen dezenten Jubelschrei ausstießen. Es war alles in allem ein sehr gelungenes Fest, und als es vorbei war, hatte Dolly das Gefühl, Freunde fürs Leben gefunden zu haben.
Auch das schönste Fest muß einmal zu Ende gehen, und schließlich wurde es Zeit, daß die Damen ihre kleinen Habseligkeiten einsammelten und sich von den Herren die zierlichen goldlackierten Stühle fortrücken ließen, und dann verabschiedeten sich die einzelnen Parteien voneinander, um sich in alle Himmelsrichtungen zu zerstreuen - Dolly wollte zurück zum Basil Street Hotel, die Cliffords zu einem Nachmittagskonzert in der Albert Hall, Tante Ethel nach Putney und das frischvermählte Paar zur Oakley Street.
Während sie angenehm beschwipst im Foyer standen und auf die Taxen warteten, passierte die Sache, die Penelopes Beziehung zu ihrer Schwiegermutter für alle Zeit trüben sollte. Dolly hatte in ihrem Champagnerschwips eine Anwandlung von Sentimentalität und Großmut, nahm Penelopes Hände in die ihren und sagte zu ihr hinaufblickend: »Oh, meine Liebe, jetzt, wo du die Frau von Ambrose bist, wäre es mir lieb, wenn du Marjorie zu mir sagtest.« Penelope kniff erstaunt die Augen zusammen. Es kam ihr sonderbar vor, ihre Schwiegermutter mit Marjorie anzureden, wo sie sehr gut wußte, daß sie Dolly hieß. Aber wenn es das war, was sie wollte.
»Ja, sehr gern. Das werde ich tun.« Sie beugte sich nach unten und küßte die weiche und duftende Wange, die ihr anmutig hingehalten wurde.
Und ein Jahr lang nannte sie sie gehorsam Marjorie. Wenn sie sich schriftlich für ein Geburtstagsgeschenk bedankte, fing sie den Brief mit »Liebe Marjorie.« an. Wenn sie im Coombe Hotel anrief, um Neuigkeiten über Ambrose weiterzugeben oder Grüße von ihm auszurichten, sagte sie »Guten Tag, Marjorie, ich bin’s, Penelope. «
Erst nach vielen Monaten, als es zu spät war, um die Sache auszubügeln, geschweige denn rückgängig zu machen, wurde ihr plötzlich siedendheiß bewußt, was Dolly damals im Foyer des Ritz wirklich gesagt hatte. Sie hatte gesagt: »Oh, meine Liebe, es wäre mir lieb, wenn du Madre zu mir sagtest.«
Am Sonntagmorgen brachte Ambrose seine Braut mit dem Wagen zum Bahnhof Paddington und setzte sie in den Riviera nach Cornwall. Der Zug war wie immer voll von Soldaten und Matrosen mit ihren Taschen und Seesäcken und Gasmasken und Helmen, aber Ambrose fand einen freien Eckplatz, den er mit ihrem Gepäck belegte, damit niemand anders ihn für sich beanspruchen konnte. Sie gingen auf den Bahnsteig zurück, um sich zu verabschieden. Es war schwer, die richtigen Worte zu finden, denn alles war auf einmal neu und ungewohnt. Sie waren nun Mann und Frau, und sie wußten beide nicht recht, wie sie sich verhalten sollten. Ambrose zündete sich eine Zigarette an, rauchte hastig, blickte den Bahnsteig hinauf und hinunter und sah zwischendurch auf die Uhr. Penelope wünschte, der Aufsichtsbeamte möge seine Trillerpfeife zücken, und der Zug möge endlich abfahren, damit es vorbei wäre.
Sie sagte ungewollt heftig: »Ich hasse Abschiede!«
»Du wirst dich daran gewöhnen müssen.«
»Ich weiß nicht, wann ich dich wiedersehen werde. Wirst du schon fort sein, wenn ich in einem Monat zu meiner Entlassung nach Portsmouth komme?«
»Höchstwahrscheinlich.«
»Wohin werden sie dich schicken?«
»Das kann man nur raten. In den Atlantik. Oder ins Mittelmeer. «
»Das Mittelmeer wäre nicht schlecht. Da scheint wenigstens immer die Sonne.«
»Ja.«
Wieder eine Pause.
»Schade, daß Papa und Sophie gestern nicht kommen konnten. Ich möchte so gern, daß du sie kennenlernst.«
»Wenn ich richtig Urlaub bekomme, komme ich vielleicht für ein paar Tage runter nach Cornwall.«
»O ja, tu das.«
»Ich hoffe, es geht alles gut. Ich meine, mit dem Baby.« Sie errötete ein wenig. »Ich bin sicher, daß alles gutgehen wird.« Er blickte wieder auf die Uhr. Sie sagte, am Ende ihrer Weisheit angelangt: »Ich werde dir schreiben. Du mußt.« Aber in diesem Augenblick schrillte die Pfeife des Aufsichtsbeamten. Es folgte das übliche Durcheinander. Leute hasteten in die Wagen, Türen wurden zugeschlagen, Stimmen riefen, ein Mann kam auf den Bahnsteig gerannt und sprang im letzten Moment in den Zug. Sie ließ das Fenster hinunter und beugte sich hinaus. Der Zug begann sich in Bewegung zu setzen.
»Schreibst du mir, damit ich deine neue Adresse weiß, Ambrose?«
Ihm fiel etwas ein. »Ich hab deine Adresse gar nicht!« Sie fing an zu lachen. Er lief nun neben dem Zug her. »Cam Cottage«, rief sie laut, um das Rattern zu übertönen. »Cam Cottage, Porthkerris, Cornwall.«
Der Zug war jetzt zu schnell für ihn, und er lief langsamer, blieb stehen, fing an zu winken. Der Zug verließ den Bahnsteig und rollte durch die Kurve. Sie war nicht mehr zu sehen. Er drehte sich um und schritt vom Ende des Bahnsteigs zu der weit entfernten Treppe. Cam Cottage. Die elisabethanische Villa, die er sich ausgemalt hatte, die Jacht auf dem Heiford - ein Traum, der sich von einer Sekunde zur anderen in nichts auflöste. Cam Cottage. Eine Hütte? Es klang sehr bescheiden, enttäuschend bescheiden, und er hatte unwillkürlich das Gefühl, betrogen worden zu sein. Aber trotzdem. Sie war fort. Und seine Mutter war nach Devon zurückgefahren, und er hatte es fürs erste überstanden. Nun brauchte er nur noch nach Portsmouth zu fahren und sich zum Dienstantritt zurückzumelden. Während er zum Parkplatz schlenderte, wurde ihm bewußt, daß er sich auf eine sonderbare Weise darauf freute, zum Alltag, zur Navy und zu seinen Kameraden zurückzukehren. Mit Männern lebte es sich alles in allem leichter als mit Frauen.
Wenige Tage später, am 10. Mai, marschierten die Deutschen in Frankreich ein, und der Krieg fing richtig an.