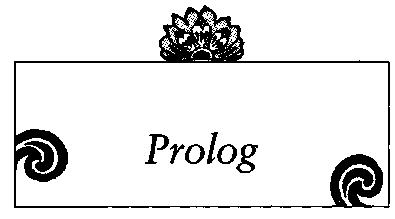Das Taxi, ein alter Rover, in dem es nach abgestandenem Zigarettenqualm roch, rumpelte gemächlich die leere Landstraße entlang. Es war Ende Februar, ein herrlicher, sehr kalter Nachmittag, mit einem bleichen und wolkenlosen Himmel. Die Sonne warf lange Schatten, spendete aber so gut wie keine Wärme, und die gepflügten Felder waren eisenhart gefroren. Aus den Schornsteinen vereinzelter Farmen und kleiner Steincottages stieg Rauch kerzengerade in die unbewegte Luft, und Grüppchen von Schafen, die schwer an ihrer Wolle und dem in ihnen heranwachsenden Leben trugen, drängten sich um die mit frischem Heu gefüllten Futtertröge. Hinten im Wagen saß Penelope Keeling. Sie hatte lange durch das staubige Fenster geblickt und war zu dem Schluß gekommen, daß sie die vertraute Landschaft ringsum noch nie so schön gesehen hatte.
Die Straße machte eine scharfe Kurve, und der hölzerne Wegweiser, der die Abzweigung nach Temple Pudley zeigte, kam in Sicht. Der Fahrer bremste, schaltete krachend in den zweiten Gang und bog in die abschüssige, von hohen Hecken gesäumte Straße ein, die die Aussicht verwehrten. Wenige Augenblicke später waren sie im Dorf mit seinen golden leuchtenden Steinhäusern, dem Zeitungsladen, der Metzgerei, dem Sudeley Arms und der Kirche, die durch einen alten Friedhof und einige dunkle Eiben von der Straße getrennt war.
Es war fast niemand zu sehen. Die Kinder waren in der Schule, und wer irgend konnte, blieb in der bitteren Kälte zu Hause. Nur ein alter Mann mit Fäustlingen und einem dicken Schal führte seinen noch älteren Hund aus.
»Wo ist es?« fragte der Taxifahrer über seine Schulter hinweg. Sie beugte sich vor und wurde sich einer lächerlichen Nervosität und Vorfreude bewußt. »Noch ein kleines Stück. Am Ende des Dorfs. Das weiße Tor rechts. Es ist offen. Da. Das ist es.« Er fuhr durch das Tor und hielt an der Rückseite des Hauses. Sie öffnete die Wagentür, stieg aus und zog das dunkelblaue Cape enger um sich, als sie von der Kälte getroffen wurde. Sie öffnete ihre Tasche, suchte den Schlüssel, ging zur Tür und schloß auf. Der Taxifahrer klappte den Kofferraum auf und holte ihren kleinen Koffer heraus. Sie drehte sich um, um ihn zu nehmen, aber er hielt ihn besorgt fest.
»Ist denn niemand da, der Sie erwartet?«
»Nein, niemand. Ich lebe allein, und sie denken alle, ich sei noch im Krankenhaus.«
»Schaffen Sie es allein?«
Sie lächelte in sein freundliches Gesicht. Er war noch ziemlich jung und hatte wuscheliges blondes Haar. »Natürlich.« Er zögerte, wollte sich nicht aufdrängen. »Wenn Sie möchten, trage ich den Koffer hinein. Ich kann ihn auch nach oben bringen.«
»Oh, das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber ich schaffe es sehr gut...«
»Gern geschehen«, unterbrach er und folgte ihr in die Küche. Sie öffnete eine Tür und führte ihn eine schmale Holztreppe hinauf. Alles roch klinisch sauber. Die gute Mrs. Plackett war in den paar Tagen, die Penelope fort gewesen war, nicht untätig geblieben. Es war ihr ganz lieb, wenn Penelope ab und zu fortging, weil sie dann die Dinge tun konnte, zu denen sie sonst nicht kam, zum Beispiel die weiß gestrichenen Treppenstäbe abwaschen, Putzlappen auskochen und das Messing und Silber polieren.
Die Schlafzimmertür stand weit offen. Sie ging hinein, und der junge Mann folgte ihr und stellte den Koffer ab. »Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?« fragte er. »Nein, vielen Dank. Was bin ich Ihnen schuldig?« Er sagte es leise und ein bißchen verlegen, als wäre es ihm peinlich.
Sie bezahlte und ließ sich das Wechselgeld nicht herausgeben. Er bedankte sich, und sie gingen die Treppe wieder hinunter. Aber er zauderte und schien nicht gehen zu wollen. Wahrscheinlich, sagte sie sich, hat er eine alte Großmutter, für die er die gleiche Verantwortung empfindet. »Sie kommen wirklich zurecht, ja?«
»Aber sicher. Und morgen kommt meine Freundin, Mrs. Plackett. Dann werde ich nicht mehr allein sein.«
Das beruhigte ihn aus irgendeinem Grund. »Dann gehe ich jetzt.«
»Auf Wiedersehen. Und vielen Dank.«
»Keine Ursache.«
Als er fort war, trat sie wieder ins Haus und machte die Tür zu. Sie war allein. Welch eine Erleichterung. Daheim. Ihr eigenes Haus, ihre eigenen Sachen, ihre eigene Küche. Der Ölherd blubberte friedlich vor sich hin, und alles war herrlich warm. Sie löste den Verschluß ihres Capes, zog es aus und legte es über eine Stuhllehne. Auf dem blankgescheuerten Tisch lag ein Stoß Briefe, und sie blätterte ihn durch, doch weil er nichts Wichtiges oder Interessantes zu enthalten schien, ließ sie ihn liegen und ging durch den Raum, um die Glastür zum Wintergarten zu öffnen. Der Gedanke, daß ihre geliebten Pflanzen vor Kälte oder Durst eingehen könnten, hatte sie in diesen letzten Tagen ein wenig beunruhigt, aber Mrs. Plackett hatte das ebensowenig vergessen wie alles andere. Die Erde in den Töpfen war feucht und schwer, die Blätter saftig und grün. Eine frühe Geranie trug eine Krone aus winzigen Knospen, und die Hyazinthen waren wenigstens sieben Zentimeter gewachsen. Hinter den Glasscheiben lag ihr winterlicher Garten, die blattlosen Bäume zeichneten sich wie schwarze Gerippe vor dem bleichen Himmel ab, doch zwischen den Moospolstern unter der Kastanie sah sie Schneeglöckchen und die ersten buttergelben Blüten des Winterlings.
Sie verließ den Wintergarten, ging nach oben und wollte eigentlich auspacken, doch statt dessen gab sie sich dem seligen Gefühl hin, wieder zu Hause zu sein. Sie ging umher, öffnete Türen, betrat jedes Schlafzimmer, um durch jedes Fenster zu sehen, Möbel zu berühren, einen Vorhang glattzustreifen. Alles war so, wie es sein sollte. Nichts hatte sich geändert. Als sie wieder unten in der Küche war, nahm sie die Briefe und ging durch das Eßzimmer ins Wohnzimmer. Hier waren ihre kostbarsten Besitztümer, ihr Sekretär, ihre Blumen, ihre Bilder. Im Kamin war alles für ein Feuer bereitet. Sie riß ein Zündholz an und kniete sich hin, um es an das zusammengerollte Zeitungspapier zu halten. Eine Flamme züngelte, dann glommen die Kienspäne auf und begannen leise zu knistern. Sie legte Scheite auf, und die Flammen züngelten in den Abzug. Jetzt lebte das Haus wieder, und nun, da sie diese angenehme Arbeit hinter sich hatte, gab es keinen Vorwand mehr, ihre Kinder nicht anzurufen und ihnen zu sagen, was sie getan hatte.
Aber welches der Kinder? Sie setzte sich in den Sessel und überlegte. Eigentlich Nancy. Sie war die Älteste, und sie war von der Vorstellung nicht abzubringen, sie sei uneingeschränkt für ihre Mutter verantwortlich. Aber Nancy würde entsetzt sein, sich furchtbar aufregen und ihr heftige Vorwürfe machen. Penelope hatte noch nicht die Kraft, mit Nancy fertig zu werden.
Also Noel? Vielleicht sollte sie mit Noel reden, er war der Mann in der Familie. Aber bei der bloßen Vorstellung, Noel könne ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen, mußte sie unwillkürlich lächeln. »Noel, ich habe das Krankenhaus auf meine eigene Verantwortung hin verlassen und bin wieder zu Hause.« Eine Information, die er höchstwahrscheinlich mit einem »Oh?« quittieren würde. So tat Penelope das, was sie die ganze Zeit vorgehabt hatte. Sie nahm ab und wählte die Nummer von Olivias Büro in London. » Venus.« Das Mädchen in der Telefonzentrale schien den Namen der Zeitschrift zu singen. »Ich hätte gern Olivia Keeling gesprochen.«
»Einen Augenblick bitte.« Penelope wartete. »Vorzimmer Miss Keeling.«
Olivia an den Apparat zu bekommen, war ein bißchen so, als versuche man, mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu plaudern. »Ich möchte bitte Miss Keeling sprechen.«
»Es tut mir leid, Miss Keeling ist gerade in einer Besprechung.«
»Heißt das, daß sie im Konferenzzimmer sitzt, oder ist sie in ihrem Büro?«
»Sie ist in ihrem Büro.« Die Sekretärin klang ungehalten, wie zu erwarten. »Aber sie hat Besuch.«
»Nun, dann stören Sie sie bitte. Ich bin ihre Mutter, und es ist sehr wichtig.«
» Es. es kann nicht warten?«
»Nein, keine Sekunde«, sagte Penelope fest. »Aber ich werde sie nicht lange aufhalten.«
»Sehr gut.«
Wieder Warten. Dann endlich Olivia. »Mama!«
»Entschuldige, daß ich dich störe.«
»Mama, ist etwas nicht in Ordnung?«
»Nein, im Gegenteil.«
»Gott sei Dank. Rufst du aus dem Krankenhaus an?«
»Nein, von zu Hause.«
»Von zu Hause? Wann bist du nach Hause gekommen?«
»Gerade eben. Gegen halb drei.«
»Aber ich dachte, du müßtest noch mindestens eine Woche bleiben.«
»Ja, das war auch so geplant, aber ich habe mich schrecklich gelangweilt, und es hat mich erschöpft. Ich habe nachts kein Auge zugetan, und neben mir lag eine alte Dame, die in einem fort geredet hat. Nein, nicht geredet. Gebrabbelt, das arme Ding. Also habe ich dem Arzt einfach gesagt, ich könne es keine Stunde länger aushalten, und dann habe ich meinen Koffer gepackt und bin gegangen.«
»Du hast dich also selbst entlassen«, sagte Olivia trocken. Es klang resigniert, aber kein bißchen überrascht.
»Genau. Mir fehlt überhaupt nichts. Und ich habe mir ein schönes Taxi mit einem sehr netten Fahrer genommen, und er hat mich nach Hause gebracht.«
»Hat der Arzt denn nicht protestiert?«
»Doch, sehr laut sogar. Aber er konnte ja nicht viel dagegen machen. «
»O Mama!« In Olivias Stimme vibrierte ein Lachen. »Wie unartig. Ich wollte am Wochenende hinunterkommen und dich im Krankenhaus besuchen. Du weißt schon, dir kiloweise Trauben mitbringen und dann alle selbst essen.«
»Du könntest hierher kommen«, sagte Penelope, und dann wünschte sie, sie hätte es nicht gesagt. Vielleicht klang es einsam und sehnsüchtig, womöglich hörte es sich so an, als brauche sie Olivia, um Gesellschaft zu haben.
»Hm. wenn es dir wirklich gut geht, würde ich es gerne noch etwas verschieben. Ich habe dieses Wochenende schrecklich viel zu tun. Hast du schon mit Nancy gesprochen, Mama?«
»Nein. Ich habe daran gedacht, aber dann war es mir irgendwie zuviel. Du weißt ja, wie umständlich sie immer ist. Ich werde sie morgen früh anrufen, wenn Mrs. Plackett hier ist und alles wieder seinen normalen Gang geht. Ich möchte auf jeden Fall verhindern, daß ich wieder abtransportiert werde.«
»Wie fühlst du dich? Ich meine, wirklich?«
»Sehr gut. Nur ein bißchen müde, wie ich schon sagte.«
»Du wirst doch nicht zuviel tun? Ich meine, du wirst nicht sofort in den Garten laufen und anfangen, Beete umzugraben oder Bäume zu versetzen?«
»Nein, ich verspreche es. Außerdem ist sowieso alles noch steinhart gefroren. Man könnte keinen Spaten in die Erde bekommen.«
»Gott sei Dank. Wenigstens etwas. Mama, ich muß jetzt Schluß machen. Ich habe gerade eine Kollegin bei mir.«
»Ich weiß. Deine Sekretärin hat es mir gesagt. Entschuldige, daß ich dich gestört habe, aber ich wollte, daß du Bescheid weißt.«
»Ich bin froh, daß du es getan hast. Halt mich auf dem laufenden, und gönn dir ein bißchen Ruhe.«
»Das werde ich. Auf Wiedersehen, Liebling.«
»Auf Wiedersehen, Mama.«
Sie legte auf, stellte den Apparat wieder auf den Tisch und lehnte sich zurück.
Jetzt hatte sie fürs erste alles erledigt. Sie spürte, daß sie wirklich sehr müde war, aber es war eine angenehme Müdigkeit, gemildert
und versüßt durch ihre Umgebung, als wäre das Haus ein freundliches Wesen, das sie liebevoll in die Arme schloß. Sie spürte in dem warmen, vom Feuerschein beleuchteten Zimmer, wie sie von jenem grundlosen Glücksgefühl überrascht wurde, das sie seit Jahren nicht mehr gekannt hatte. Es ist, weil ich lebe. Ich bin vierundsechzig und habe, wenn man diesen idiotischen Ärzten glauben kann, einen Herzanfall gehabt. Etwas in der Richtung. Ich habe es überlebt, und ich werde es in irgendeine Schublade tun und nie wieder darüber sprechen oder daran denken. Weil ich lebe. Ich kann fühlen, alles berühren, sehen, hören, riechen; ich kann allein zurechtkommen, das Krankenhaus aus eigenem Willen verlassen, mir ein Taxi bestellen und nach Hause fahren. Im Garten kommen die ersten Schneeglöckchen, und es wird bald Frühling. Ich werde ihn erleben. Das alljährliche Wunder beobachten und fühlen, wie die Sonne von Woche zu Woche wärmer wird. Und weil ich lebe, werde ich all das sehen und ein Teil des Wunders sein. Sie erinnerte sich an die Geschichte über Maurice Chevalier. Wie ist es, wenn man siebzig ist? hatte ein Reporter ihn gefragt. Nicht übel, hatte er geantwortet. Wenn man die Alternative bedenkt. Aber Penelope Keeling fühlte sich nicht nur nicht übel, sie fühlte sich tausendmal besser. Das Leben war auf einmal nicht mehr die bloße Existenz, die man als selbstverständlich betrachtet, sondern etwas darüber hinaus, ein Geschenk, das jeden Tag, der einem gegeben wurde, ausgekostet werden mußte. Die Zeit dauerte nicht ewig. Ich werde keinen einzigen Moment verschwenden, versprach sie sich. Sie hatte sich noch nie so stark und optimistisch gefühlt. Als ob sie wieder jung sei und noch einmal von vorn anfinge, und als ob jeden Augenblick etwas Wunderbares geschehen könne.