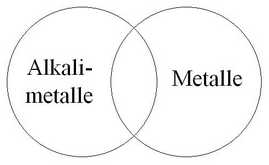Die Lehre von der abstrakten Vorstellung, oder dem Denken.
Kapitel 5. Vom vernunftlosen Intellekt
Eine vollkommene Kenntniß des Bewußtseyns der Thiere müßte möglich seyn; sofern wir es durch bloße Wegnahme gewisser Eigenschaften des unserigen konstruiren können. Jedoch greift in dasselbe andererseits der Instinkt ein, welcher in allen Thieren entwickelter, als im Menschen ist, und in einigen bis zum Kunsttriebe geht.
Die Thiere haben Verstand, ohne Vernunft zu haben, mithin anschauliche, aber keine abstrakte Erkenntniß: sie apprehendiren richtig, fassen auch den unmittelbaren Kausalzusammenhang auf, die obern Thiere selbst durch mehrere Glieder seiner Kette; jedoch denken sie eigentlich nicht. Denn ihnen mangeln die Begriffe, d.h. die abstrakten Vorstellungen. Hievon aber ist die nächste Folge der Mangel eines eigentlichen Gedächtnisses, welchem selbst die klügsten Thiere noch unterliegen, und dieser eben begründet hauptsächlich den Unterschied zwischen ihrem Bewußtseyn und dem menschlichen. Die vollkommene Besonnenheit nämlich beruht auf dem deutlichen Bewußtseyn der Vergangenheit und der eventuellen Zukunft als solcher und im Zusammenhange mit der Gegenwart. Das hiezu erforderte eigentliche Gedächtniß ist daher eine geordnete, zusammenhängende, denkende Rückerinnerung: eine solche aber ist nur möglich mittelst allgemeiner Begriffe, deren Hülfe sogar das ganz Individuelle bedarf, um in seiner Ordnung und Verkettung zurückgerufen zu werden. Denn die unübersehbare Menge gleichartiger und ähnlicher Dinge und Begebenheiten, in unserm Lebenslauf, läßt nicht unmittelbar eine anschauliche und individuelle Rückerinnerung jedes Einzelnen zu, als für welche weder die Kräfte der umfassendesten Erinnerungsfähigkeit, noch unsere Zeit ausreichen würde: daher kann dies Alles nur aufbewahrt werden mittelst Subsumtion unter allgemeine Begriffe und daraus entstehende Zurückführung auf verhältnißmäßig wenige Sätze, mittelst welcher wir sodann eine geordnete und genügende Uebersicht unserer Vergangenheit beständig zu Gebote haben. Bloß einzelne Scenen der Vergangenheit können wir uns anschaulich vergegenwärtigen; aber der seitdem verflossenen Zeit und ihres Inhalts sind wir uns bloß in abstracto bewußt, mittelst Begriffen von Dingen und Zahlen, welche nun Tage und Jahre, nebst deren Inhalt, vertreten. Das Erinnerungsvermögen der Thiere hingegen ist, wie ihr gesammter Intellekt, auf das Anschauliche beschränkt und besteht zunächst bloß darin, daß ein wiederkehrender Eindruck sich als bereits dagewesen ankündigt, indem die gegenwärtige Anschauung die Spur einer frühem auffrischt: ihre Erinnerung ist daher stets durch das jetzt wirklich Gegenwärtige vermittelt. Dieses regt aber eben deshalb die Empfindung und Stimmung, welche die frühere Erscheinung hervorgebracht hatte, wieder an. Demnach erkennt der Hund die Bekannten, unterscheidet Freunde und Feinde, findet den ein Mal zurückgelegten Weg, die schon besuchten Häuser, leicht wieder, und wird durch den Anblick des Tellers, oder den des Stocks, sogleich in die entsprechende Stimmung versetzt. Auf der Benutzung dieses anschauenden Erinnerungsvermögens und der bei den Thieren überaus starken Macht der Gewohnheit beruhen alle Arten der Abrichtung: diese ist daher von der menschlichen Erziehung gerade so verschieden, wie Anschauen von Denken. Auch wir sind, in einzelnen Fällen, wo das eigentliche Gedächtniß seinen Dienst versagt, auf jene bloß anschauende Rückerinnerung beschränkt, wodurch wir den Unterschied Beider aus eigener Erfahrung ermessen können; z.B. beim Anblick einer Person, die uns bekannt vorkommt, ohne daß wir uns erinnern, wann und wo wir sie gesehn haben; desgleichen, wann wir einen Ort betreten, an welchem wir in früher Kindheit, also bei noch unentwickelter Vernunft, gewesen, solches daher ganz vergessen haben, jetzt aber doch den Eindruck des Gegenwärtigen als eines bereits Dagewesenen empfinden. Dieser Art sind alle Erinnerungen der Thiere. Nur kommt noch hinzu, daß, bei den klügsten, dieses bloß anschauende Gedächtniß sich bis zu einem gewissen Grade von Phantasie steigert, welche ihm wieder nachhilft und vermöge deren z.B. dem Hunde das Bild des abwesenden Herrn vorschwebt und Verlangen nach ihm erregt, daher er ihn, bei längerem Ausbleiben, überall sucht. Auf dieser Phantasie beruhen auch seine Träume. Das Bewußtseyn der Thiere ist demnach eine bloße Succession von Gegenwarten, deren jede aber nicht vor ihrem Eintritt als Zukunft, noch nach ihrem Verschwinden als Vergangenheit dasteht; als welches das Auszeichnende des menschlichen Bewußtseyns ist. Daher eben haben die Thiere auch unendlich weniger zu leiden, als wir, weil sie keine andern Schmerzen kennen, als die, welche die Gegenwart unmittelbar herbeiführt. Die Gegenwart ist aber ausdehnungslos; hingegen Zukunft und Vergangenheit, welche die meisten Ursachen unserer Leiden enthalten, sind weit ausgedehnt, und zu ihrem wirklichen Inhalt kommt noch der bloß mögliche, wodurch dem Wunsch und der Furcht sich ein unabsehbares Feld öffnet: von diesen hingegen ungestört genießen die Thiere jede auch nur erträgliche Gegenwart ruhig und heiter. Sehr beschränkte Menschen mögen ihnen hierin nahe kommen. Ferner können die Leiden, welche rein der Gegenwart angehören, bloß physische seyn. Sogar den Tod empfinden eigentlich die Thiere nicht: erst bei seinem Eintritt könnten sie ihn kennen lernen; aber dann sind sie schon nicht mehr. So ist denn das Leben des Thieres eine fortgesetzte Gegenwart. Es lebt dahin ohne Besinnung und geht stets ganz in der Gegenwart auf: selbst der große Haufen der Menschen lebt mit sehr geringer Besinnung. Eine andere Folge der dargelegten Beschaffenheit des Intellekts der Thiere ist der genaue Zusammenhang ihres Bewußtseyns mit ihrer Umgebung. Zwischen dem Thiere und der Außenwelt steht nichts: zwischen uns und dieser stehn aber immer noch unsere Gedanken über dieselbe, und machen oft uns ihr, oft sie uns unzugänglich. Nur bei Kindern und sehr rohen Menschen wird diese Vormauer bisweilen so dünn, daß um zu wissen, was in ihnen vorgeht, man nur zu sehn braucht, was um sie vorgeht. Daher auch sind die Thiere weder des Vorsatzes, noch der Verstellung fähig: sie haben nichts im Hinterhalt. In dieser Hinsicht verhält sich der Hund zum Menschen, wie ein gläserner zu einem metallenen Becher, und dies trägt viel bei ihn uns so werth zu machen: denn es gewährt uns ein großes Ergötzen, alle unsere Neigungen und Affekte, die wir so oft verhehlen, in ihm bloß und baar zu Tage gelegt zu sehn. Ueberhaupt spielen die Thiere gleichsam stets mit offen hingelegten Karten: daher sehn wir mit so vielem Vergnügen ihrem Thun und Treiben unter einander zu, sowohl wenn sie der selben, wie wenn sie verschiedenen Species angehören. Ein gewisses Gepräge von Unschuld charakterisirt dasselbe, im Gegensatz des menschlichen Thuns, als welches, durch den Eintritt der Vernunft, und mit ihr der Besonnenheit, der Unschuld der Natur entrückt ist. Dafür aber hat es durchweg das Gepräge der Vorsätzlichkeit, deren Abwesenheit, und mithin das Bestimmtwerden durch den augenblicklichen Impuls, den Grundcharakter alles thierischen Thuns ausmacht. Eines eigentlichen Vorsatzes nämlich ist kein Thier fähig; ihn zu fassen und zu befolgen ist das Vorrecht des Menschen, und ein höchst folgenreiches. Zwar kann ein Instinkt, wie der der Zugvögel, oder der der Bienen, ferner auch ein bleibender, anhaltender Wunsch, eine Sehnsucht, wie die des Hundes nach seinem abwesenden Herrn, den Schein des Vorsatzes hervorbringen, ist jedoch mit diesem nicht zu verwechseln. – Alles Dieses nun hat seinen letzten Grund in dem Verhältniß zwischen dem menschlichen und dem thierischen Intellekt, welches sich auch so ausdrücken läßt: die Thiere haben bloß eine unmittelbare Erkenntniß, wir neben dieser auch eine mittelbare; und der Vorzug, den in manchen Dingen, z.B. in der Trigonometrie und Analysis, im Wirken durch Maschinen statt durch Handarbeit u.s.w., das Mittelbare vor dem Unmittelbaren hat, findet auch hier Statt. Diesemnach wieder kann man sagen: die Thiere haben bloß einen einfachen Intellekt, wir einen doppelten; nämlich neben dem anschauenden noch den denkenden; und die Operationen beider gehn oft unabhängig von einander vor sich: wir schauen Eines an und denken an ein Anderes; oft wiederum greifen sie in einander. Diese Bezeichnung der Sache macht die oben erwähnte wesentliche Offenheit und Naivetät der Thiere, im Gegensatz der menschlichen Verstecktheit, besonders begreiflich.
Inzwischen ist das Gesetz Natura non facit saltus auch in Hinsicht auf den Intellekt der Thiere nicht ganz aufgehoben; wenn gleich der Schritt vom thierischen zum menschlichen Intellekt wohl der weiteste ist, den die Natur, bei Hervorbringung ihrer Wesen, gethan hat. Eine schwache Spur von Reflexion, von Vernunft, von Wortverständniß, von Denken, von Vorsatz, von Ueberlegung, giebt sich in den vorzüglichsten Individuen der obersten Thiergeschlechter allerdings bisweilen kund, zu unserer jedesmaligen Verwunderung. Die auffallendesten Züge der Art hat der Elephant geliefert, dessen sehr entwickelter Intellekt noch durch die Uebung und Erfahrung einer bisweilen zweihundertjährigen Lebensdauer erhöht und unterstützt wird. Von Prämeditation, welche uns an Thieren stets am meisten überrascht, hat er öfter unverkennbare Zeichen gegeben, die daher in allbekannten Anekdoten aufbewahrt sind: besonders gehört dahin die von dem Schneider, an welchem er, wegen eines Nadelstiches, Rache nahm. Ich will jedoch ein Seitenstück derselben, weil es den Vorzug hat, durch gerichtliche Untersuchung beglaubigt zu seyn, hier der Vergessenheit entreißen. Zu Morpeth, in England, wurde, am 27. August 1830, eine Coroner's inquest gehalten, über den von seinem Elephanten getödteten Wärter Baptist Bernhard: aus dem Zeugenverhör ergab sich, daß er zwei Jahre vorher den Elephanten gröblich beleidigt und jetzt dieser, ohne Anlaß, aber bei günstiger Gelegenheit, ihn plötzlich gepackt und zerschmettert hatte. (Siehe den Spectator und andere Englische Zeitungen jener Tage.) Zur speciellen Kenntniß des Intellekts der Thiere empfehle ich das vortreffliche Buch des Leroy, Sur l'intelligence des animaux, nouv. éd. 1802.
Kapitel 6. Zur Lehre von der abstrakten, oder Vernunft-Erkenntniß
Der äußere Eindruck auf die Sinne, sammt der Stimmung, die er allein und für sich in uns hervorruft, verschwindet mit der Gegenwart der Dinge. Jene Beiden können daher nicht selbst die eigentliche Erfahrung ausmachen, deren Belehrung für die Zukunft unser Handeln leiten soll. Das Bild jenes Eindrucks, welches die Phantasie aufbewahrt, ist schon sogleich schwächer als er selbst, schwächt sich täglich mehr ab und verlischt mit der Zeit ganz. Weder jenem augenblicklichen Verschwinden des Eindrucks, noch dem allmäligen seines Bildes unterworfen, mithin frei von der Gewalt der Zeit, ist nur Eines: der Begriff. In ihm also muß die belehrende Erfahrung niedergelegt seyn, und er allein eignet sich zum sichern Lenker unserer Schritte im Leben. Daher sagt Seneka mit Recht: Si vis tibi omnia subjicere, te subjice rationi (ep. 37). Und ich füge hinzu, daß, um im wirklichen Leben den Andern überlegen zu seyn, überlegt seyn, d.h. nach Begriffen verfahren, die unerläßliche Bedingung ist. Ein so wichtiges Werkzeug der Intelligenz, wie der Begriff ist, kann offenbar nicht identisch seyn mit dem Wort, diesem bloßen Klang, der als Sinneseindruck mit der Gegenwart, oder als Gehörphantasma mit der Zeit verklänge. Dennoch ist der Begriff eine Vorstellung, deren deutliches Bewußtsein und deren Aufbewahrung an das Wort gebunden ist: daher benannten die Griechen Wort, Begriff, Verhältniß, Gedanken und Vernunft mit dem Namen des Ersteren: ho logos. Dennoch ist der Begriff sowohl von dem Worte, an welches er geknüpft ist, als auch von den Anschauungen, aus denen er entstanden, völlig verschieden. Er ist ganz anderer Natur, als diese Sinneseindrücke. Jedoch vermag er alle Resultate der Anschauung in sich aufzunehmen, um sie, auch nach dem längsten Zeitraum, unverändert und unvermindert wieder zurückzugeben: erst hiedurch entsteht die Erfahrung. Aber nicht das Angeschaute, noch das dabei Empfundene, bewahrt der Begriff auf, sondern dessen Wesentliches, Essentielles, in ganz veränderter Gestalt, und doch als genügenden Stellvertreter jener. So lassen sich die Blumen nicht aufbewahren, aber ihr ätherisches Oel, ihre Essenz, mit gleichem Geruch und gleichen Kräften. Das Handeln, welches richtige Begriffe zur Richtschnur gehabt hat, wird, im Resultat, mit der beabsichtigten Wirklichkeit zusammentreffen. – Den unschätzbaren Werth der Begriffe, und folglich der Vernunft, kann man ermessen, wenn man auf die unendliche Menge und Verschiedenheit von Dingen und Zuständen, die nach und neben einander dasind, den Blick wirft und nun bedenkt, daß Sprache und Schrift (die Zeichen der Begriffe) dennoch jedes Ding und jedes Verhältniß, wann und wo es auch gewesen seyn mag, zu unserer genauen Kunde zu bringen vermögen; weil eben verhältnißmäßig wenige Begriffe eine Unendlichkeit von Dingen und Zuständen befassen und vertreten. – Beim eigenen Nachdenken ist die Abstraktion ein Abwerfen unnützen Gepäckes, zum Behuf leichterer Handhabung der zu vergleichenden und darum hin und her zu werfenden Erkenntnisse. Man läßt nämlich dabei das viele Unwesentliche, daher nur Verwirrende, der realen Dinge weg, und operirt mit wenigen, aber wesentlichen, in abstracto gedachten Bestimmungen. Aber eben weil die Allgemeinbegriffe nur durch Wegdenken und Auslassen vorhandener Bestimmungen entstehn und daher je allgemeiner, desto leerer sind, beschränkt der Nutzen jenes Verfahrens sich auf die Verarbeitung unserer bereits erworbenen Erkenntnisse, zu der auch das Schließen aus den in ihnen enthaltenen Prämissen gehört. Neue Grundeinsichten hingegen sind nur aus der anschaulichen, als der allein vollen und reichen Erkenntniß zu schöpfen, mit Hülfe der Urtheilskraft. – Weil ferner Inhalt und Umfang der Begriffe in entgegengesetztem Verhältnisse stehn, also je mehr unter einem Begriff, desto weniger in ihm gedacht wird; so bilden die Begriffe eine Stufenfolge, eine Hierarchie, vom speciellsten bis zum allgemeinsten, an deren unterm Ende der scholastische Realismus, am oberen der Nominalismus beinahe Recht behält. Denn der speciellste Begriff ist schon beinahe das Individuum, also beinahe real: und der allgemeinste Begriff, z.B. das Seyn (d.i. der Infinitiv der Kopula), beinahe nichts als ein Wort. Daher auch sind philosophische Systeme, die sich innerhalb solcher sehr allgemeinen Begriffe halten, ohne auf das Reale herabzukommen, beinahe bloßer Wortkram. Denn da alle Abstraktion im bloßen Wegdenken besteht; so behält man, je weiter man sie fortsetzt, desto weniger übrig. Wenn ich daher solche moderne Philosopheme lese, die sich in lauter sehr weiten Abstraktis fortbewegen; so kann ich bald, trotz aller Aufmerksamkeit, fast nichts mehr dabei denken; weil ich eben keinen Stoff zum Denken erhalte, sondern mit lauter leeren Hülsen operiren soll, welches eine Empfindung giebt, der ähnlich, die beim Versuch sehr leichte Körper zu werfen entsteht: die Kraft nämlich und auch die Anstrengung ist da; aber es fehlt am Objekt, sie aufzunehmen, um das andere Moment der Bewegung herzustellen. Wer dies erfahren will, lese die Schriften der Schellingianer und, noch besser, der Hegelianer. – Einfache Begriffe müßten eigentlich solche seyn, die unauflösbar wären; demnach sie nie das Subjekt eines analytischen Urtheils seyn könnten: dies halte ich für unmöglich; da, wenn man einen Begriff denkt, man auch seinen Inhalt muß angeben können. Was man als Beispiele von einfachen Begriffen anzuführen pflegt, sind gar nicht mehr Begriffe, sondern theils bloße Sinnesempfindungen, wie etwan die einer bestimmten Farbe, theils die a priori uns bewußten Formen der Anschauung; also eigentlich die letzten Elemente der anschauenden Erkenntniß. Diese selbst aber ist für das System aller unserer Gedanken Das, was in der Geognosie der Granit ist, der letzte feste Boden, der Alles trägt und über den man nicht hinaus kann. Zur Deutlichkeit eines Begriffes nämlich ist erfordert, nicht nur, daß man ihn in seine Merkmale zerlegen, sondern auch daß man diese, falls auch sie Abstrakta sind, abermals analysiren könne, und so immerfort, bis man zur anschauenden Erkenntniß herabgelangt, mithin auf konkrete Dinge hinweist, durch deren klare Anschauung man die letzten Abstrakta belegt und dadurch diesen, wie auch allen auf ihnen beruhenden höheren Abstraktionen, Realität zusichert. Daher ist die gewöhnliche Erklärung, der Begriff sei deutlich, sobald man seine Merkmale angeben kann, nicht ausreichend: denn die Zerlegung dieser Merkmale führt vielleicht immerfort nur auf Begriffe, ohne daß zuletzt Anschauungen zum Grunde lägen, welche allen jenen Begriffen Realität ertheilten. Man nehme z.B. den Begriff »Geist« und analysire ihn in seine Merkmale, »ein denkendes, wollendes, immaterielles, einfaches, keinen Raum füllendes, unzerstörbares Wesen«; so ist dabei doch nichts Deutliches gedacht; weil die Elemente dieser Begriffe sich nicht durch Anschauungen belegen lassen: denn ein denkendes Wesen ohne Gehirn ist wie ein verdauendes Wesen ohne Magen. Klar sind eigentlich nur Anschauungen, nicht Begriffe: diese können höchstens deutlich seyn. Darum auch hat man, so absurd es war, »klar und verworren« zu einander gestellt und als synonym gebraucht, als man die anschauende Erkenntniß für eine nur verworrene abstrakte erklärte, weil nämlich diese letztere die allein deutliche wäre. Dies hat zuerst Duns Skotus gethan, aber auch noch Leibnitz hat im Grunde diese Ansicht, als auf welcher seine Identitas indiscernibilium beruht: man sehe Kants Widerlegung derselben, S. 275 der ersten Ausgabe der »Kritik der reinen Vernunft«.
Die oben berührte enge Verbindung des Begriffs mit dem Wort, also der Sprache mit der Vernunft, beruht im letzten Grunde auf Folgendem. Unser ganzes Bewußtseyn, mit seiner Innern und äußern Wahrnehmung, hat durchweg die Zeit zur Form. Die Begriffe hingegen, als durch Abstraktion entstandene, völlig allgemeine und von allen einzelnen Dingen verschiedene Vorstellungen, haben, in dieser Eigenschaft, ein zwar gewissermaaßen objektives Daseyn, welches jedoch keiner Zeitreihe angehört. Daher müssen sie, um in die unmittelbare Gegenwart eines individuellen Bewußtseyns treten, mithin in eine Zeitreihe eingeschoben werden zu können, gewissermaaßen wieder zur Natur der einzelnen Dinge herabgezogen, individualisirt und daher an eine sinnliche Vorstellung geknüpft werden: diese ist das Wort. Es ist demnach das sinnliche Zeichen des Begriffs und als solches das nothwendige Mittel ihn zu fixiren, d.h. ihn dem an die Zeitform gebundenen Bewußtseyn zu vergegenwärtigen und so eine Verbindung herzustellen zwischen der Vernunft, deren Objekte bloß allgemeine, weder Ort noch Zeitpunkt kennende Universalia sind, und dem an die Zeit gebundenen, sinnlichen und insofern bloß thierischen Bewußtseyn. Nur vermöge dieses Mittels ist uns die willkürliche Reproduktion, also die Erinnerung und Aufbewahrung der Begriffe, möglich und disponibel, und erst mittelst dieser die mit denselben vorzunehmenden Operationen, also urtheilen, schließen, vergleichen, beschränken u.s.w. Zwar geschieht es bisweilen, daß Begriffe auch ohne ihre Zeichen das Bewußtseyn beschäftigen, indem wir mitunter eine Schlußkette so schnell durchlaufen, daß wir in solcher Zeit nicht hätten die Worte denken können. Allein dergleichen sind Ausnahmen, die eben eine große Uebung der Vernunft voraussetzen, welche sie nur mittelst der Sprache hat erlangen können. Wie sehr der Gebrauch der Vernunft an die Sprache gebunden ist, sehn wir an den Taubstummen, welche, wenn sie keine Art von Sprache erlernt haben, kaum mehr Intelligenz zeigen, als die Orangutane und Elephanten: denn sie haben fast nur potentiâ nicht actu Vernunft.
Wort und Sprache sind also das unentbehrliche Mittel zum deutlichen Denken. Wie aber jedes Mittel, jede Maschine, zugleich beschwert und hindert; so auch die Sprache: weil sie den unendlich nüancirten, beweglichen und modifikabeln Gedanken in gewisse feste, stehende Formen zwängt und indem sie ihn fixirt, ihn zugleich fesselt. Dieses Hinderniß wird durch die Erlernung mehrerer Sprachen zum Theil beseitigt. Denn indem, bei dieser, der Gedanke aus einer Form in die andere gegossen wird, er aber in jeder seine Gestalt etwas verändert, löst er sich mehr und mehr von jeglicher Form und Hülle ab; wodurch sein selbst-eigenes Wesen deutlicher ins Bewußtseyn tritt und er auch seine ursprüngliche Modifikabilität wieder erhält. Die alten Sprachen aber leisten diesen Dienst sehr viel besser, als die neuen; weil, vermöge ihrer großen Verschiedenheit von diesen, der selbe Gedanke jetzt auf ganz andere Weise ausgedrückt werden, also eine höchst verschiedene Form annehmen muß; wozu noch kommt, daß die vollkommenere Grammatik der alten Sprachen eine künstlichere und vollkommenere Konstruktion der Gedanken und ihres Zusammenhanges möglich macht. Daher konnte ein Grieche, oder Römer, allenfalls sich an seiner Sprache genügen lassen. Aber wer nichts weiter, als so einen einzigen modernen Patois versteht, wird, im Schreiben und Reden, diese Dürftigkeit bald verrathen, indem sein Denken, an so armsälige, stereotypische Formen fest geknüpft, ungelenk und monoton ausfallen muß. Genie freilich ersetzt, wie Alles, so auch dieses, z.B. im Shakespeare.
Von dem, was ich § 9 des ersten Bandes dargelegt habe, daß nämlich die Worte einer Rede vollkommen verstanden werden, ohne anschauliche Vorstellungen, Bilder in unserm Kopfe zu veranlassen, hat schon eine ganz richtige und sehr ausführliche Auseinandersetzung Burke gegeben, in seiner Inquiry into the Sublime and Beautiful, P. 5, Sect. 4 et 5; allein er zieht daraus den ganz falschen Schluß, daß wir die Worte hören, vernehmen und gebrauchen, ohne irgend eine Vorstellung (ideas) damit zu verbinden; während er hätte schließen sollen, daß nicht alle Vorstellungen (ideas) anschauliche Bilder (Images) sind, sondern daß gerade die, welche durch Worte bezeichnet werden müssen, bloße Begriffe (abstract notions) und diese, ihrer Natur zufolge, nicht anschaulich sind, – Eben weil Worte bloße Allgemeinbegriffe, welche von den anschaulichen Vorstellungen durchaus verschieden sind, mittheilen, werden z.B. bei der Erzählung einer Begebenheit, zwar alle Zuhörer die selben Begriffe erhalten; allein wenn sie nachher sich den Vorgang veranschaulichen wollen, wird jeder ein anderes Bild davon in seiner Phantasie entwerfen, welches von dem richtigen, das allein der Augenzeuge hat, bedeutend abweicht. Hierin liegt der nächste Grund (zu welchem sich aber noch andere gesellen) warum jede Thatsache durch Weitererzählen nothwendig entstellt wird: nämlich der zweite Erzähler theilt Begriffe mit, die er aus seinem Phantasiebilde abstrahirt hat und aus denen der Dritte sich wieder ein anderes noch abweichenderes Bild entwirft, welches er nun wieder in Begriffe umsetzt, und so geht es immer weiter. Wer trocken genug ist, bei den ihm mitgetheilten Begriffen stehn zu bleiben und diese weiter zu geben, wird der treueste Berichterstatter seyn.
Die beste und vernünftigste Auseinandersetzung über Wesen und Natur der Begriffe, die ich irgendwo habe finden können, steht in Thom. Reid's Essays on the powers of human mind, Vol. 2, essay 5, ch. 6. – Dieselbe ist seitdem gemißbilligt worden von Dugald Stewart, in dessen Philosophy of the human mind: über diesen will ich, um kein Papier an ihm zu verschwenden, nur in der Kürze sagen, daß er zu den Vielen gehört hat, die durch Gunst und Freunde einen unverdienten Ruf erlangten; daher ich nur rächen kann, mit den Schreibereien dieses Flachkopfes keine Stunde zu verlieren.
Daß übrigens die Vernunft das Vermögen der abstrakten, der Verstand aber das der anschaulichen Vorstellungen sei, hat bereits der fürstliche Scholastiker Picus de Mirandula eingesehn, indem er in seinem Buche De imaginatione, c. 11, Verstand und Vernunft sorgfältig unterscheidet und diese für das diskursive, dem Menschen eigenthümliche Vermögen, jenen aber für das intuitive, der Erkenntnißweise der Engel, ja, Gottes verwandte erklärt. – Auch Spinoza charakterisirt ganz richtig die Vernunft als das Vermögen allgemeine Begriffe zu bilden: Eth. II. prop. 40, schol. 2. – Dergleichen brauchte nicht erwähnt zu werden, wäre es nicht wegen der Possen, welche in den letzten fünfzig Jahren sämmtliche Philosophaster in Deutschland mit dem Begriffe der Vernunft getrieben haben, indem sie, mit unverschämter Dreistigkeit, unter diesem Namen ein völlig erlogenes Vermögen unmittelbarer, metaphysischer, sogenannter übersinnlicher Erkenntnisse einschwärzen wollten, die wirkliche Vernunft hingegen Verstand benannten, den eigentlichen Verstand aber, als ihnen sehr fremd, ganz übersahen, und seine intuitiven Funktionen der Sinnlichkeit zuschrieben.
Wie bei allen Dingen dieser Welt jedem Auskunftsmittel, jedem Vortheil, jedem Vorzug sich sofort auch neue Nachtheile anhängen; so führt auch die Vernunft, welche dem Menschen so große Vorzüge vor den Thieren giebt, ihre besondern Nachtheile mit sich und eröffnet ihm Abwege, auf welche das Thier nie gerathen kann. Durch sie erlangt eine ganz neue Art von Motiven, der das Thier unzugänglich ist, Macht über seinen Willen; nämlich die abstrakten Motive, die bloßen Gedanken, welche keineswegs stets aus der eigenen Erfahrung abgezogen sind, sondern oft nur durch Rede und Beispiel Anderer, durch Tradition und Schrift, an ihn kommen. Dem Gedanken zugänglich geworden steht er sofort auch dem Irrthum offen. Allein jeder Irrthum muß, früher oder später, Schaden stiften, und desto größern, je größer er war. Den individuellen Irrthum muß, wer ihn hegt, ein Mal büßen und oft theuer bezahlen: das Selbe wird im Großen von gemeinsamen Irrthümern ganzer Völker gelten. Daher kann nicht zu oft wiederholt werden, daß jeder Irrthum, wo man ihn auch antreffe, als ein Feind der Menschheit zu verfolgen und auszurotten ist, und daß es keine privilegirte, oder gar sanktionirte Irrthümer geben kann. Der Denker soll sie angreifen; wenn auch die Menschheit, gleich einem Kranken, dessen Geschwür der Arzt berührt, laut dabei aufschrie. – Das Thier kann nie weit vom Wege der Natur abirren: denn seine Motive liegen allein in der anschaulichen Welt, wo nur das Mögliche, ja, nur das Wirkliche Raum findet: hingegen in die abstrakten Begriffe, in die Gedanken und Worte, geht alles nur Ersinnliche, mithin auch das Falsche, das Unmögliche, das Absurde, das Unsinnige. Da nun Vernunft Allen, Urtheilskraft Wenigen zu Theil geworden; so ist die Folge, daß der Mensch dem Wahne offen steht, indem er allen nur erdenklichen Chimären Preis gegeben ist, die man ihm einredet, und die, als Motive seines Wollens wirkend, ihn zu Verkehrtheiten und Thorheiten jeder Art, zu den unerhörtesten Extravaganzen, wie auch zu den seiner thierischen Natur widerstrebendesten Handlungen bewegen können. Eigentliche Bildung, bei welcher Erkenntniß und Unheil Hand in Hand gehn, kann nur Wenigen zugewandt werden, und noch Wenigere sind fähig sie aufzunehmen. Für den großen Haufen tritt überall an ihre Stelle eine Art Abrichtung: sie wird bewerkstelligt durch Beispiel, Gewohnheit und sehr frühzeitiges, festes Einprägen gewisser Begriffe, ehe irgend Erfahrung, Verstand und Urtheilskraft dawären, das Werk zu stören. So werden Gedanken eingeimpft, die nachher so fest und durch keine Belehrung zu erschüttern haften, als wären sie angeboren, wofür sie auch oft, selbst von Philosophen, angesehn worden sind. Auf diesem Wege kann man, mit gleicher Mühe, den Menschen das Richtige und Vernünftige, oder auch das Absurdeste einprägen, z.B. sie gewöhnen, sich diesem oder jenem Götzen nur von heiligem Schauer durchdrungen zu nähern und beim Nennen seines Namens nicht nur mit dem Leibe, sondern auch mit dem ganzen Gemüthe sich in den Staub zu werfen; an Worte, an Namen, an die Vertheidigung der abentheuerlichsten Grillen, willig ihr Eigenthum und Leben zu setzen; die größte Ehre und die tiefste Schande beliebig an Dieses oder an jenes zu knüpfen und danach jeden mit inniger Ueberzeugung hoch zu schätzen, oder zu verachten; aller animalischen Nahrung zu entsagen, wie in Hindustan, oder die dem lebenden Thiere herausgeschnittenen, noch warmen und zuckenden Stücke zu verzehren, wie in Abyssinien; Menschen zu fressen, wie in Neuseeland, oder ihre Kinder dem Moloch zu opfern; sich selbst zu kastriren, sich willig in den Scheiterhaufen des Verstorbenen zu stürzen, – mit Einem Worte, was man will. Daher die Kreuzzüge, die Ausschweifungen fanatischer Sekten, daher Chiliasten und Flagellanten, Ketzerverfolgungen, Autos de Fe, und was immer das lange Register menschlicher Verkehrtheiten noch sonst darbietet. Damit man nicht denke, daß nur finstere Jahrhunderte solche Beispiele liefern, füge ich ein Paar neuere hinzu. Im Jahre 1818 zogen aus dem Würtembergischen 7000 Chiliasten in die Nähe des Ararat; weil das, besonders durch Jung-Stilling angekündigte, neue Reich Gottes daselbst anbrechen sollte4. Gall erzählt, daß zu seiner Zeit eine Mutter ihr Kind getödtet und gebraten habe, um mit dessen Fett die Rheumatismen ihres Mannes zu kuriren5. Die tragische Seite des Irrthums und Vorurtheils liegt im Praktischen, die komische ist dem Theoretischen vorbehalten: hätte man z.B. nur erst drei Menschen fest überredet, daß die Sonne nicht die Ursache des Tageslichts sei; so dürfte man hoffen, es bald als die allgemeine Ueberzeugung gelten zu sehn. Einen widerlichen, geistlosen Scharlatan und beispiellosen Unsinnschmierer, Hegel, konnte man, in Deutschland, als den größten Philosophen aller Zeiten ausschreien, und viele Tausende haben es, zwanzig Jahre lang, steif und fest geglaubt, sogar außer Deutschland die Dänische Akademie, welche für seinen Ruhm gegen mich aufgetreten ist und ihn als einen summus philosophus hat geltend machen wollen. (Siehe hierüber die Vorrede zu meinen »Grundproblemen der Ethik«.) – Dies also sind die Nachtheile, welche, wegen der Seltenheit der Urtheilskraft, an das Daseyn der Vernunft geknüpft sind. Zu ihnen kommt nun noch die Möglichkeit des Wahnsinns: Thiere werden nicht wahnsinnig; wiewohl die Fleischfresser der Wuth, die Grasfresser einer Art Raserei ausgesetzt sind.
Kapitel 7. Vom Verhältniß der anschauenden zur abstrakten Erkenntniß
Da nun, wie gezeigt worden, die Begriffe ihren Stoff von der anschauenden Erkenntniß entlehnen, und daher das ganze Gebäude unserer Gedankenwelt auf der Welt der Anschauungen ruht; so müssen wir von jedem Begriff, wenn auch durch Mittelstufen, zurückgehn können auf die Anschauungen, aus denen er unmittelbar selbst, oder aus denen die Begriffe, deren Abstraktion er wieder ist, abgezogen worden: d. h, wir müssen ihn mit Anschauungen, die zu den Abstraktionen im Verhältniß des Beispiels stehn, belegen können. Diese Anschauungen also liefern den realen Gehalt alles unsers Denkens, und überall, wo sie fehlen, haben wir nicht Begriffe, sondern bloße Worte im Kopfe gehabt. In dieser Hinsicht gleicht unser Intellekt einer Zettelbank, die, wenn sie solide seyn soll, Kontanten in Kassa haben muß, um erforderlichenfalls alle ihre ausgestellten Noten einlösen zu können: die Anschauungen sind die Kontanten, die Begriffe die Zettel. – In diesem Sinne könnten die Anschauungen recht passend primäre, Begriffe hingegen sekundäre Vorstellungen benannt werden: nicht ganz so treffend nannten die Scholastiker, auf Anlaß des Aristoteles (Metaph. VI, 11; XI, 1) die realen Dinge substantias primas, und die Begriffe substantias secundas. – Bücher theilen nur sekundäre Vorstellungen mit. Bloße Begriffe von einer Sache, ohne Anschauung, geben eine bloß allgemeine Kenntniß derselben. Ein durchaus gründliches Verständniß von Dingen und deren Verhältnissen hat man nur, sofern man fähig ist, sie in lauter deutlichen Anschauungen, ohne Hülfe der Worte, sich vorstellig zu machen. Worte durch Worte erklären, Begriffe mit Begriffen vergleichen, worin das meiste Philosophiren besteht, ist im Grunde ein spielendes Hin- und Herschieben der Begriffssphären; um zu sehn, welche in die andere geht und welche nicht. Im glücklichsten Fall wird man dadurch zu Schlüssen gelangen; aber auch Schlüsse geben keine durchaus neue Erkenntniß, sondern zeigen uns nur, was Alles in der schon vorhandenen lag und was davon etwan auf den jedesmaligen Fall anwendbar wäre. Hingegen anschauen, die Dinge selbst zu uns reden lassen, neue Verhältnisse derselben auffassen, dann aber dies Alles in Begriffe absetzen und niederlegen, um es sicher zu besitzen: das giebt neue Erkenntnisse. Allein, während Begriffe mit Begriffen zu vergleichen so ziemlich jeder die Fähigkeit hat, ist Begriffe mit Anschauungen zu vergleichen eine Gabe der Auserwählten: sie bedingt, je nach dem Grade ihrer Vollkommenheit, Witz, Urtheilskraft, Scharfsinn, Genie. Bei jener ersten Fähigkeit hingegen kommt nie viel mehr heraus, als etwan vernünftige Betrachtungen. – Der innerste Kern jeder ächten und wirklichen Erkenntniß ist eine Anschauung; auch ist jede neue Wahrheit die Ausbeute aus einer solchen. Alles Urdenken geschieht in Bildern: darum ist die Phantasie ein so nothwendiges Werkzeug desselben, und werden phantasielose Köpfe nie etwas Großes leisten, – es sei denn in der Mathematik. – Hingegen bloß abstrakte Gedanken, die keinen anschaulichen Kern haben, gleichen Wolkengebilden ohne Realität. Selbst Schrift und Rede, sei sie Lehre oder Gedicht, hat zum letzten Zweck, den Leser zu der selben anschaulichen Erkenntniß hinzuleiten, von welcher der Verfasser ausgieng: hat sie den nicht, so ist sie eben schlecht. Eben darum ist Betrachtung und Beobachtung jedes Wirklichen, sobald es irgend etwas dem Beobachter Neues darbietet, belehrender als alles Lesen und Hören. Denn sogar ist, wenn wir auf den Grund gehn, in jedem Wirklichen alle Wahrheit und Weisheit, ja, das letzte Geheimniß der Dinge enthalten, freilich eben nur in concreto, und so wie das Gold im Erze steckt: es kommt darauf an, es herauszuziehn. Aus einem Buche hingegen erhält man, im besten Fall, die Wahrheit doch nur aus zweiter Hand, öfter aber gar nicht.
Bei den meisten Büchern, von den eigentlich schlechten ganz abgesehn, hat, wenn sie nicht durchaus empirischen Inhalts sind, der Verfasser zwar gedacht, aber nicht geschaut: er hat aus der Reflexion, nicht aus der Intuition geschrieben; und dies eben ist es, was sie mittelmäßig und langweilig macht. Denn was Jener gedacht hat, hätte der Leser, bei einiger Bemühung, allenfalls auch denken können: es sind nämlich eben vernünftige Gedanken, nähere Auseinandersetzungen des im Thema implicite Enthaltenen. Aber dadurch kommt keine wirklich neue Erkenntniß in die Welt: diese wird nur im Augenblick der Anschauung, der unmittelbaren Auffassung einer neuen Seite der Dinge, erzeugt. Wo daher, im Gegentheil, dem Denken eines Autors ein Schauen zum Grunde lag; da ist es, als schriebe er aus einem Lande, wo der Leser nicht auch schon gewesen ist; da ist Alles frisch und neu: denn es ist aus der Urquelle aller Erkenntniß unmittelbar geschöpft. Ich will den hier berührten Unterschied durch ein ganz leichtes und einfaches Beispiel erläutern. Jeder gewöhnliche Schriftsteller wird leicht das tiefsinnige Hinstarren, oder das versteinernde Erstaunen, dadurch schildern, daß er sagt: »Er stand wie eine Bildsäule«; aber Cervantes sagt: »wie eine bekleidete Bildsäule: denn der Wind bewegte seine Kleider.« (Don Quijote, B. 6, Kap. 19.) Solchermaaßen haben alle große Köpfe stets in Gegenwart der Anschauung gedacht und den Blick unverwandt auf sie geheftet, bei ihrem Denken. Man erkennt dies, unter Anderm, daran, daß auch die heterogensten unter ihnen doch im Einzelnen so oft übereinstimmen und wieder zusammentreffen; weil sie eben Alle von der selben Sache reden, die sie sämmtlich vor Augen hatten: die Welt, die anschauliche Wirklichkeit: ja, gewissermaaßen sagen sie sogar alle das Selbe, und die Andern glauben ihnen nie. Man erkennt es ferner an dem Treffenden, Originellen, und der Sache stets genau Angepaßten des Ausdrucks, weil ihn die Anschauung eingegeben hat, an dem Naiven der Aussagen, an der Neuheit der Bilder und dem Schlagenden der Gleichnisse, welches Alles, ohne Ausnahme, die Werke großer Köpfe auszeichnet, denen der Andern hingegen stets abgeht; weshalb diesen nur banale Redensarten und abgenutzte Bilder zu Gebote stehn und sie nie sich erlauben dürfen, naiv zu seyn, bei Strafe ihre Gemeinheit in ihrer traurigen Blöße zu zeigen: statt dessen sind sie preziös. Darum sagte Büffon: le style est l'homme même. Wenn die gewöhnlichen Köpfe dichten, haben sie einige traditionelle, ja konventionelle, also in abstracto überkommene Gesinnungen, Leidenschaften, noble Sentiments u. dgl., die sie den Helden ihrer Dichtungen unterlegen, welche hiedurch zu einer bloßen Personifikation jener Gesinnungen werden, also gewissermaaßen selbst schon Abstrakta und daher fade und langweilig sind. Wenn sie philosophiren, haben sie einige weite abstrakte Begriffe überkommen, mit denen sie, als gelte es algebraische Gleichungen, hin und her werfen, und hoffen, es werde daraus etwas hervorgehn: höchstens sieht man, daß sie Alle das Selbe gelesen haben. Ein solches Hin- und Herwerfen mit abstrakten Begriffen, nach Art der algebraischen Gleichungen, welches man heut zu Tage Dialektik nennt, liefert aber nicht, wie die wirkliche Algebra, sichere Resultate; weil hier der durch das Wort vertretene Begriff keine feste und genau bestimmte Größe ist, wie die durch den Buchstaben der Algebra bezeichnete, sondern ein Schwankendes, Vieldeutiges, der Ausdehnung und Zusammenziehung Fähiges. Genau genommen hat alles Denken, d.h. Kombiniren abstrakter Begriffe, höchstens Erinnerungen aus dem früher Angeschauten zum Stoff, und auch noch indirekt, sofern nämlich Dieses die Unterlage aller Begriffe ausmacht: ein wirkliches, d.h. unmittelbares Erkennen hingegen ist allein das Anschauen, das neue frische Percipiren selbst. Nun aber können die Begriffe, welche die Vernunft gebildet und das Gedächtniß aufbehalten hat, nie alle zugleich dem Bewußtsein gegenwärtig seyn, vielmehr nur eine sehr kleine Anzahl derselben zur Zeit. Hingegen die Energie, mit welcher die anschauliche Gegenwart, in der eigentlich immer das Wesentliche aller Dinge überhaupt virtualiter enthalten und repräsentirt ist, aufgefaßt wird, erfüllt, mit ihrer ganzen Macht, das Bewußtseyn in Einem Moment. Hierauf beruht das unendliche Ueberwiegen des Genies über die Gelehrsamkeit: sie verhalten sich zu einander wie der Text des alten Klassikers zu seinem Kommentar. Wirklich liegt alle Wahrheit und alle Weisheit zuletzt in der Anschauung. Aber leider läßt diese sich weder festhalten, noch mittheilen: allenfalls lassen sich die objektiven Bedingungen dazu, durch die bildenden Künste und schon viel mittelbarer durch die Poesie, gereinigt und verdeutlicht den Andern vorlegen; aber sie beruht eben so sehr auf subjektiven Bedingungen, die nicht Jedem und Keinem jederzeit zu Gebote stehn, ja die, in den hohem Graden der Vollkommenheit, nur die Begünstigung Weniger sind. Unbedingt mittheilbar ist nur die schlechteste Erkenntniß, die abstrakte, die sekundäre, der Begriff, der bloße Schatten eigentlicher Erkenntniß. Wenn Anschauungen mittheilbar wären, da gäbe es eine der Mühe lohnende Mittheilung: so aber muß am Ende jeder in seiner Haut bleiben und in seiner Hirnschaale, und Keiner kann dem Andern helfen. Den Begriff aus der Anschauung zu bereichern, sind Poesie und Philosophie unablässig bemüht. – Inzwischen sind die wesentlichen Zwecke des Menschen praktisch; für diese aber ist es hinreichend, daß das anschaulich Aufgefaßte Spuren in ihm hinterläßt, vermöge deren er es, beim nächsten ähnlichen Fall, wiedererkennt: so wird er weltklug. Daher kann der Weltmann, in der Regel, seine gesammelte Wahrheit und Weisheit nicht lehren, sondern bloß üben: er faßt jedes Vorkommende richtig auf und beschließt, was demselben gemäß ist. – Daß Bücher nicht die Erfahrung, und Gelehrsamkeit nicht das Genie ersetzt, sind zwei verwandte Phänomene: ihr gemeinsamer Grund ist, daß das Abstrakte nie das Anschauliche ersetzen kann. Bücher ersetzen darum die Erfahrung nicht, weil Begriffe stets allgemein bleiben und daher auf das Einzelne, welches doch gerade das im Leben zu Behandelnde ist, nicht herab gelangen: hiezu kommt, daß alle Begriffe eben aus dem Einzelnen und Anschaulichen der Erfahrung abstrahirt sind, daher man dieses schon kennen gelernt haben muß, um auch nur das Allgemeine, welches die Bücher mittheilen, gehörig zu verstehn. Gelehrsamkeit ersetzt das Genie nicht, weil auch sie bloß Begriffe liefert, die geniale Erkenntniß aber in der Auffassung der (Platonischen) Ideen der Dinge besteht, daher wesentlich intuitiv ist. Beim ersten Phänomen fehlt demnach die objektive Bedingung zur anschauenden Erkenntniß; beim zweiten die subjektive: jene läßt sich erlangen; diese nicht.
Weisheit und Genie, diese zwei Gipfel des Parnassus menschlicher Erkenntniß, wurzeln nicht im abstrakten, diskursiven, sondern im anschauenden Vermögen. Die eigentliche Weisheit ist etwas Intuitives, nicht etwas Abstraktes. Sie besteht nicht in Sätzen und Gedanken, die Einer als Resultate fremder oder eigener Forschung im Kopfe fertig herumtrüge: sondern sie ist die ganze Art, wie sich die Welt in seinem Kopfe darstellt. Diese ist so höchst verschieden, daß dadurch der Weise in einer andern Welt lebt, als der Thor, und das Genie eine andere Welt sieht, als der Stumpfkopf. Daß die Werke des Genies die aller Andern himmelweit übertreffen, kommt bloß daher, daß die Welt, die es sieht und der es seine Aussagen entnimmt, so viel klarer, gleichsam tiefer herausgearbeitet ist, als die in den Köpfen der Andern, welche freilich die selben Gegenstände enthält, aber zu jener sich verhält, wie ein Chinesisches Bild, ohne Schatten und Perspektive, zum vollendeten Oelgemälde. Der Stoff ist in allen Köpfen der selbe; aber in der Vollkommenheit der Form, die er in jedem annimmt, liegt der Unterschied, auf welchem die so vielfache Abstufung der Intelligenzen zuletzt beruht: dieser ist also schon in der Wurzel, in der anschauenden Auffassung, vorhanden und entsteht nicht erst im Abstrakten. Daher eben zeigt die ursprüngliche geistige Ueberlegenheit sich so leicht bei jedem Anlaß, und wird augenblicklich den Andern fühlbar und verhaßt.
Im Praktischen vermag die intuitive Erkenntniß des Verstandes unser Thun und Benehmen unmittelbar zu leiten, während die abstrakte der Vernunft es nur unter Vermittelung des Gedächtnisses kann. Hieraus entspringt der Vorzug der intuitiven Erkenntniß für alle die Fälle, die keine Zeit zur Ueberlegung gestatten, also für den täglichen Verkehr, in welchem eben deshalb die Weiber excelliren. Nur wer das Wesen der Menschen, wie sie in der Regel sind, intuitiv erkannt hat und eben so die Individualität des gegenwärtigen Einzelnen auffaßt, wird diesen mit Sicherheit und richtig zu behandeln verstehn. Ein Anderer mag alle dreihundert Klugheitsregeln des Gracian auswendig wissen; dies wird ihn nicht vor Balourdisen und Mißgriffen schützen, wenn jene intuitive Erkenntniß ihm abgeht. Denn alle abstrakte Erkenntniß giebt zuvörderst bloß allgemeine Grundsätze und Regeln; aber der einzelne Fall ist fast nie genau nach der Regel zugeschnitten: sodann soll diese nun erst das Gedächtniß zu rechter Zeit vergegenwärtigen; was selten pünktlich geschieht: dann soll aus dem vorliegenden Fall die propositio minor gebildet und endlich die Konklusion gezogen werden. Ehe das Alles geschehn, wird die Gelegenheit uns meistens schon das kahle Hinterhaupt zugekehrt haben, und dann dienen jene trefflichen Grundsätze und Regeln höchstens, uns hinterher die Größe des begangenen Fehlers ermessen zu lassen. Freilich wird hieraus, mittelst Zeit, Erfahrung und Uebung, die Weltklugheit langsam erwachsen; weshalb, in Verbindung mit diesen, die Regeln in abstracto allerdings fruchtbar werden können. Hingegen die intuitive Erkenntniß, welche stets nur das Einzelne auffaßt, steht in unmittelbarer Beziehung zum gegenwärtigen Fall: Regel, Fall und Anwendung ist für sie Eins, und diesem folgt das Handeln auf den Fuß. Hieraus erklärt sich, warum, im wirklichen Leben, der Gelehrte, dessen Vorzug im Reichthum abstrakter Erkenntnisse liegt, so sehr zurücksteht gegen den Weltmann, dessen Vorzug in der vollkommenen intuitiven Erkenntniß besteht, die ihm ursprüngliche Anlage verliehen und reiche Erfahrung ausgebildet hat. Immer zeigt sich zwischen beiden Erkenntnißweisen das Verhältniß des Papiergeldes zum haaren: wie jedoch für manche Fälle und Angelegenheiten jenes diesem vorzuziehn ist; so giebt es auch Dinge und Lagen, für welche die abstrakte Erkenntniß brauchbarer ist, als die intuitive. Wenn es nämlich ein Begriff ist, der, bei einer Angelegenheit, unser Thun leitet; so hat er den Vorzug, ein Mal gefaßt, unveränderlich zu seyn; daher wir, unter seiner Leitung, mit vollkommener Sicherheit und Festigkeit zu Werke gehn. Allein diese Sicherheit, die der Begriff auf der subjektiven Seite verleiht, wird aufgewogen durch die auf der objektiven Seite ihn begleitende Unsicherheit: nämlich der ganze Begriff kann falsch und grundlos seyn, oder auch das zu behandelnde Objekt nicht unter ihn gehören, indem es gar nicht, oder doch nicht ganz, seiner Art wäre. Werden wir nun, im einzelnen Fall, so etwas plötzlich inne; so sind wir aus der Fassung gebracht: werden wir es nicht inne; so lehrt es der Erfolg. Daher sagt Vauvenargues: Personne n'est sujet à plus de fautes, que ceux qui n'agissent que par réflexion. – Ist es hingegen unmittelbar die Anschauung der zu behandelnden Objekte und ihrer Verhältnisse, die unser Thun leitet; so schwanken wir leicht bei jedem Schritt: denn die Anschauung ist durchweg modifikabel, ist zweideutig, hat unerschöpfliche Einzelheiten in sich, und zeigt viele Seiten nach einander: wir handeln daher ohne volle Zuversicht. Allein diese subjektive Unsicherheit wird durch die objektive Sicherheit kompensirt: denn hier steht kein Begriff zwischen dem Objekt und uns, wir verlieren dieses nicht aus dem Auge: wenn wir daher nur richtig sehn, was wir vor uns haben und was wir thun; so werden wir das Rechte treffen. – Vollkommen sicher ist demnach unser Thun nur dann, wann es von einem Begriffe geleitet wird, dessen richtiger Grund, Vollständigkeit und Anwendbarkeit auf den vorliegenden Fall völlig gewiß ist. Das Handeln nach Begriffen kann in Pedanterei, das nach dem anschaulichen Eindruck in Leichtfertigkeit und Thorheit übergehn.
Die Anschauung ist nicht nur die Quelle aller Erkenntniß, sondern sie selbst ist die Erkenntniß kat' exochên, ist allein die unbedingt wahre, die ächte, die ihres Namens vollkommen würdige Erkenntniß: denn sie allein ertheilt eigentliche Einsicht, sie allein wird vom Menschen wirklich assimilirt, geht in sein Wesen über und kann mit vollem Grunde sein heißen; während die Begriffe ihm bloß ankleben. Im vierten Buche sehn wir sogar die Tugend eigentlich von der anschauenden Erkenntniß ausgehn: denn nur die Handlungen, welche unmittelbar durch diese hervorgerufen werden, mithin aus reinem Antriebe unserer eigenen Natur geschehn, sind eigentlich Symptome unsers wahren und unveränderlichen Charakters; nicht so die, welche aus der Reflexion und ihren Dogmen hervorgegangen, dem Charakter oft abgezwungen sind, und daher keinen unveränderlichen Grund und Boden in uns haben. Aber auch die Weisheit, die wahre Lebensansicht, der richtige Blick und das treffende Urtheil, gehn hervor aus der Art, wie der Mensch die anschauliche Welt auffaßt; nicht aber aus seinem bloßen Wissen, d.h. nicht aus abstrakten Begriffen. Wie der Fonds oder Grundgehalt jeder Wissenschaft nicht in den Beweisen, noch in dem Bewiesenen besteht, sondern in dem Unbewiesenen, auf welches die Beweise sich stützen und welches zuletzt nur anschaulich erfaßt wird; so besteht auch der Fonds der eigentlichen Weisheit und der wirklichen Einsicht jedes Menschen nicht in den Begriffen und dem Wissen in abstracto, sondern in dem Angeschauten und dem Grade der Schärfe, Richtigkeit und Tiefe, mit dem er es aufgefaßt hat. Wer hierin excellirt, erkennt die (Platonischen) Ideen der Welt und des Lebens: jeder Fall, den er gesehn, repräsentirt ihm unzählige; er faßt immer mehr jedes Wesen seiner wahren Natur nach auf, und sein Thun, wie sein Urtheil, entspricht seiner Einsicht. Allmälig nimmt auch sein Antlitz den Ausdruck des richtigen Blickes, der wahren Vernünftigkeit und, wenn es weit kommt, der Weisheit an. Denn die Ueberlegenheit in der anschauenden Erkenntniß ist es allein, die ihren Stämpel auch den Gesichtszügen aufdrückt; während die in der abstrakten dies nicht vermag. Dem Gesagten gemäß finden wir unter allen Ständen Menschen von intellektueller Ueberlegenheit, und oft ohne alle Gelehrsamkeit. Denn natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand. Der Gelehrte hat vor Solchen allerdings einen Reichthum von Fällen und Thatsachen (historische Kenntniß) und Kausalbestimmungen (Naturlehre), Alles in wohlgeordnetem, übersehbarem Zusammenhange, voraus; aber damit hat er doch noch nicht die richtigere und tiefere Einsicht in das eigentlich Wesentliche aller jener Fälle, Thatsachen und Kausalitäten. Der Ungelehrte von Scharfblick und Penetration weiß jenes Reichthums zu entrathen: mit Vielem hält man Haus, mit Wenig kommt man aus. Ihn lehrt Ein Fall aus eigener Erfahrung mehr, als manchen Gelehrten tausend Fälle, die er kennt, aber nicht eigentlich versteht: denn das wenige Wissen jenes Ungelehrten ist lebendig; indem jede ihm bekannte Thatsache durch richtige und wohlgefaßte Anschauung belegt ist, wodurch dieselbe ihm tausend ähnliche vertritt. Hingegen ist das viele Wissen der gewöhnlichen Gelehrten todt; weil es, wenn auch nicht, wie oft der Fall ist, aus bloßen Worten, doch aus lauter abstrakten Erkenntnissen besteht: diese aber erhalten ihren Werth allein durch die anschauliche Erkenntniß des Individuums, auf die sie sich beziehn, und die zuletzt die sämmtlichen Begriffe realisiren muß. Ist nun diese sehr dürftig; so ist ein solcher Kopf beschaffen, wie eine Bank, deren Assignationen den haaren Fonds zehnfach übersteigen, wodurch sie zuletzt bankrott wird. Daher, während manchem Ungelehrten die richtige Auffassung der anschaulichen Welt den Stämpel der Einsicht und Weisheit auf die Stirne gedrückt hat, trägt das Gesicht manches Gelehrten von seinen vielen Studien keine andern Spuren, als die der Erschöpfung und Abnutzung, durch übermäßige, erzwungene Anstrengung des Gedächtnisses zu widernatürlicher Anhäufung todter Begriffe: dabei sieht ein solcher oft so einfältig, albern und schaafmäßig darein, daß man glauben muß, die übermäßige Anstrengung der dem Abstrakten zugewendeten, mittelbaren Erkenntnißkraft bewirke direkte Schwächung der unmittelbaren und anschauenden, und der natürliche, richtige Blüh werde durch das Bücherlicht mehr und mehr geblendet. Allerdings muß das fortwährende Einströhmen fremder Gedanken die eigenen hemmen und ersticken, ja, auf die Länge, die Denkkraft lahmen, wenn sie nicht den hohen Grad von Elasticität hat, welcher jenem unnatürlichen Strohm zu widerstehn vermag. Daher verdirbt das unaufhörliche Lesen und Studiren geradezu den Kopf; zudem auch dadurch, daß das System unserer eigenen Gedanken und Erkenntnisse seine Ganzheit und stetigen Zusammenhang einbüßt, wenn wir diesen so oft willkürlich unterbrechen, um für einen ganz fremden Gedankengang Raum zu gewinnen. Meine Gedanken verscheuchen, um denen eines Buches Platz zu machen, käme mir vor, wie was Shakespeare an den Touristen seiner Zeit tadelt, daß sie ihr eigen Land verkaufen, um Anderer ihres zu sehn. Jedoch ist die Lesewuth der meisten Gelehrten eine Art fuga vacui, der Gedankenleere ihres eigenen Kopfes, welche nun das Fremde mit Gewalt hereinzieht: um Gedanken zu haben, müssen sie welche lesen, wie die leblosen Körper nur von außen Bewegung erhalten; während die Selbstdenker den lebendigen gleichen, die sich von selbst bewegen. Es ist sogar gefährlich, früher über einen Gegenstand zu lesen, als man selbst darüber nachgedacht hat. Denn da schleicht sich mit dem neuen Stoff zugleich die fremde Ansicht und Behandlung desselben in den Kopf, und zwar um so mehr, als Trägheit und Apathie anrathen, sich die Mühe des Denkens zu ersparen und das fertige Gedachte anzunehmen und gelten zu lassen. Dies nistet sich jetzt ein, und fortan nehmen die Gedanken darüber, gleich den in Gräben geleiteten Bächen, stets den gewohnten Weg: einen eigenen, neuen zu finden, ist dann doppelt schwer. Dies trägt viel bei zum Mangel an Originalität der Gelehrten. Dazu kommt aber noch, daß sie vermeinen, gleich andern Leuten, ihre Zeit zwischen Genuß und Arbeit theilen zu müssen. Nun halten sie das Lesen für ihre Arbeit und eigentlichen Beruf, überfressen sich also daran, bis zur Unverdaulichkeit. Da spielt nun nicht mehr bloß das Lesen dem Denken der Prävenire, sondern nimmt dessen Stelle ganz ein: denn sie denken an die Sachen auch gerade nur so lange, wie sie darüber lesen, also mit einem fremden Kopf, nicht mit dem eigenen. Ist aber das Buch weggelegt, so nehmen ganz andere Dinge ihr Interesse viel lebhafter in Anspruch, nämlich persönliche Angelegenheiten, sodann Schauspiel, Kartenspiel, Kegelspiel, Tagesbegebenheiten und Geklatsch. Der denkende Kopf ist es dadurch, daß solche Dinge kein Interesse für ihn haben, wohl aber seine Probleme, denen er daher überall nachhängt, von selbst und ohne Buch: dies Interesse sich zu geben, wenn man es nicht hat, ist unmöglich. Daran liegt's. Und daran liegt es auch, daß Jene immer nur von Dem reden, was sie gelesen, er hingegen von Dem, was er gedacht hat, und daß sie sind, wie Pope sagt:
For ever reading, never to be read7
Der Geist ist seiner Natur nach ein Freier, kein Fröhnling: nur was er von selbst und gern thut, geräth. Hingegen erzwungene Anstrengung eines Kopfes, zu Studien, denen er nicht gewachsen ist, oder wann er müde geworden, oder überhaupt zu anhaltend und invita Minerva, stumpft das Gehirn so ab, wie Lesen im Mondschein die Augen. Ganz besonders thut dies auch die Anstrengung des noch unreifen Gehirns, in den frühen Kinderjahren: ich glaube, daß das Erlernen der Lateinischen und Griechischen Grammatik vom sechsten bis zum zwölften Jahre den Grund legt zur nachherigen Stumpfheit der meisten Gelehrten. Allerdings bedarf der Geist der Nahrung, des Stoffes von außen. Aber wie nicht Alles was wir essen dem Organismus sofort einverleibt wird, sondern nur sofern es verdaut worden, wobei nur ein kleiner Theil davon wirklich assimilirt wird, das Uebrige wieder abgeht, weshalb mehr essen als man assimilliren kann, unnütz, ja schädlich ist; gerade so verhält es sich mit Dem was wir lesen: nur sofern es Stoff zum Denken giebt, vermehrt es unsere Einsicht und eigentliches Wissen. Daher sagte schon Herakleitos polymathia noun ou didaskei, (multiscitia non dat intellectum): mir aber scheint die Gelehrsamkeit mit einem schweren Harnisch zu vergleichen, als welcher allerdings den starken Mann völlig unüberwindlich macht, hingegen dem Schwachen eine Last ist, unter der er vollends zusammensinkt. –
Die in unserm dritten Buch ausgeführte Darstellung der Erkenntniß der (Platonischen) Ideen, als der höchsten dem Menschen erreichbaren und zugleich als einer durchaus anschauenden, ist uns ein Beleg dazu, daß nicht im abstrakten Wissen, sondern in der richtigen und tiefen anschaulichen Auffassung der Welt die Quelle wahrer Weisheit liegt. Daher auch können Weise in jeder Zeit leben, und die der Vorzeit bleiben es für alle kommenden Geschlechter: Gelehrsamkeit hingegen ist relativ: die Gelehrten der Vorzeit sind meistens Kinder gegen uns und bedürfen der Nachsicht.
Dem aber, der studirt, um Einsicht zu erlangen, sind die Bücher und Studien bloß Sprossen der Leiter, auf der er zum Gipfel der Erkenntniß steigt: sobald eine Sprosse ihn um einen Schritt gehoben hat, läßt er sie liegen. Die Vielen hingegen, welche studiren, um ihr Gedächtniß zu füllen, benutzen nicht die Sprossen der Leiter zum Steigen, sondern nehmen sie ab und laden sie sich auf, um sie mitzunehmen, sich freuend an der zunehmenden Schwere der Last. Sie bleiben ewig unten, da sie Das tragen, was sie hätte tragen sollen.
Auf der hier auseinandergesetzten Wahrheit, daß der Kern aller Erkenntniß die anschauende Auffassung ist, beruht auch die richtige und tiefe Bemerkung des Helvetius, daß die wirklich eigenthümlichen und originellen Grundansichten, deren ein begabtes Individuum fähig ist, und deren Verarbeitung, Entwickelung und mannigfaltige Benutzung alle seine, wenn auch viel später geschaffenen Werke sind, nur bis zum fünfunddreißigsten, spätestens vierzigsten Lebensjahre in ihm entstehn, ja, eigentlich die Folge der in frühester Jugend gemachten Kombinationen sind. Denn sie sind eben nicht bloße Verkettungen abstrakter Begriffe, sondern die ihm eigene, intuitive Auffassung der objektiven Welt und des Wesens der Dinge. Daß nun diese bis zu dem angegebenen Alter ihr Werk vollendet haben muß, beruht theils darauf, daß schon bis dahin die Ektypen aller (Platonischen) Ideen sich ihm dargestellt haben, daher später keine mehr mit der Stärke des ersten Eindrucks auftreten kann; theils ist eben zu dieser Quintessenz aller Erkenntniß, zu diesen Abdrücken avant la lettre der Auffassung, die höchste Energie der Gehirnthätigkeit erfordert, welche bedingt ist durch die Frische und Biegsamkeit seiner Fasern und durch die Heftigkeit, mit der das arterielle Blut zum Gehirn ströhmt: diese aber ist am stärksten nur so lange das arterielle System über das venöse ein entschiedenes Uebergewicht hat, welches schon mit den ersten dreißiger Jahren abnimmt, bis endlich nach dem zweiundvierzigsten Jahr das venöse System das Uebergewicht erhält; wie dies Cabanis vortrefflich und belehrend auseinandergesetzt hat. Daher sind die zwanziger und die ersten dreißiger Jahre für den Intellekt was der Mai für die Bäume ist: nur jetzt setzen sich die Blüthen an, deren Entwickelung alle späteren Früchte sind. Die anschauliche Welt hat ihren Eindruck gemacht und dadurch den Fonds aller folgenden Gedanken des Individuums gegründet. Dieses kann durch Nachdenken das Aufgefaßte sich verdeutlichen, es kann noch viele Kenntnisse erwerben, als Nahrung der ein Mal angesetzten Frucht, es kann seine Ansichten erweitern, seine Begriffe und Urtheile berichtigen, durch endlose Kombinationen erst recht Herr des erworbenen Stoffes werden, ja, seine besten Werke wird es meistens viel später produciren, wie die größte Wärme erst dann anfängt, wann die Tage schon abnehmen; aber neue Urerkentnnisse, aus der allein lebendigen Quelle der Anschauung, hat es nicht mehr zu hoffen. Im Gefühl hievon bricht Byron in die wunderschöne Klage aus:
No more – no more – Oh! never more on me
The freshness of the heart can fall like dew,
Which out of all the lovely things we see
Extracts emotions beautiful and new,
Hived in our bosoms like the bag o' the bee:
Thinkst thou the honey with those objects grew?
Alas! 'twas not in them, but in thy power
To double even the sweetness of a flower.8
Durch alles Bisherige hoffe ich die wichtige Wahrheit in helles Licht gestellt zu haben, daß alle abstrakte Erkenntniß, wie sie aus der anschaulichen entsprungen ist, auch allen Werth allein durch ihre Beziehung auf diese hat, also dadurch, daß ihre Begriffe, oder deren Theilvorstellungen, durch Anschauungen zu realisiren, d.h. zu belegen sind; imgleichen, daß auf die Qualität dieser Anschauungen das Meiste ankommt. Begriffe und Abstraktionen, die nicht zuletzt auf Anschauungen hinleiten, gleichen Wegen im Walde, die ohne Ausgang endigen. Begriffe haben ihren großen Nutzen dadurch, daß mittelst ihrer der ursprüngliche Stoff der Erkenntniß leichter zu handhaben, zu übersehn und zu ordnen ist; aber so vielfältige, logische und dialektische Operationen mit ihnen auch möglich sind; so wird aus diesen doch nie eine ganz ursprüngliche und neue Erkenntniß hervorgehn, d.h. eine solche, deren Stoff nicht schon in der Anschauung läge, oder auch aus dem Selbstbewußtseyn geschöpft wäre. Dies ist der wahre Sinn der dem Aristoteles zugeschriebenen Lehre nihil est in intellectu, nisi quod antea fuerit in sensu: es ist ebenfalls der Sinn der Locke'schen Philosophie, welche dadurch, daß sie die Frage nach dem Ursprung unserer Erkenntnisse endlich ein Mal ernstlich zur Sprache brachte, für immer Epoche in der Philosophie macht. Es ist, in der Hauptsache, auch was die Kritik der reinen Vernunft lehrt. Auch sie nämlich will, daß man nicht bei den Begriffen stehn bleibe, sondern auf den Ursprung derselben zurückgehe, also auf die Anschauung; nur noch mit dem wahren und wichtigen Zusatz, daß was von der Anschauung selbst gilt, sich auch auf die subjektiven Bedingungen derselben erstreckt, also auf die Formen, welche im anschauenden und denkenden Gehirn, als seine natürliche Funktionen, prädisponirt liegen; obgleich diese wenigstens virtualiter der wirklichen Sinnesanschauung vorhergängig, d.h. a priori sind, also nicht von dieser abhängen, sondern diese von ihnen: denn auch diese Formen haben ja keinen andern Zweck, noch Tauglichkeit, als auf eintretende Anregung der Sinnesnerven die empirische Anschauung hervorzubringen; wie aus dem Stoffe dieser, andere Formen nachmals Gedanken in abstracto zu bilden bestimmt sind. Die Kritik der reinen Vernunft verhält sich daher zur Locke'schen Philosophie wie die Analysis des Unendlichen zur Elementargeometrie; ist jedoch durchaus als Fortsetzung der Locke'schen Philosophie zu betrachten. – Der gegebene Stoff jeder Philosophie ist demnach kein anderer, als das empirische Bewußtsein, welches in das Bewußtseyn des eigenen Selbst (Selbstbewußtseyn) und in das Bewußtseyn anderer Dinge (äußere Anschauung) zerfällt. Denn dies allein ist das Unmittelbare, das wirkliche Gegebene. Jede Philosophie, die, statt hievon auszugehn, beliebig gewählte abstrakte Begriffe, wie z.B. Absolutum, absolute Substanz, Gott, Unendliches, Endliches, absolute Identität, Seyn, Wesen u.s.w. u.s.w. zum Ausgangspunkt nimmt, schwebt ohne Anhalt in der Luft, kann daher nie zu einem wirklichen Ergebniß führen. Dennoch haben Philosophen zu allen Zeiten es mit dergleichen versucht; daher sogar Kant bisweilen, nach hergebrachter Weise und mehr aus Gewohnheit, als aus Konsequenz, die Philosophie als eine Wissenschaft aus bloßen Begriffen definirt. Eine solche aber würde eigentlich unternehmen, aus bloßen Theilvorstellungen (denn das sind die Abstraktionen) herauszubringen, was in den vollständigen Vorstellungen (den Anschauungen), daraus jene, durch Weglassen, abgezogen sind, nicht zu finden ist. Die Möglichkeit der Schlüsse verleitet hiezu, weil hier die Zusammenfügung der Urtheile ein neues Resultat giebt; wiewohl mehr scheinbar als wirklich, indem der Schluß nur heraushebt, was in den gegebenen Urtheilen schon lag; da ja die Konklusion nicht mehr enthalten kann, als die Prämissen. Begriffe sind freilich das Material der Philosophie, aber nur so, wie der Marmor das Material des Bildhauers ist: sie soll nicht aus ihnen, sondern in sie arbeiten, d.h. ihre Resultate in ihnen niederlegen, nicht aber von ihnen, als dem Gegebenen ausgehn. Wer ein recht grelles Beispiel eines solchen verkehrten Ausgehns von bloßen Begriffen haben will, betrachte die Institutio theologica des Proklos, um sich das Nichtige jener ganzen Methode daran zu verdeutlichen. Da werden Abstrakta, wie hen, plêthos, agathon, paragon kai paragomenon, autarkes, aition, kreitton, kinêton, akinêton, kinoumenon (unum, multa, bonum, producens et productum, sibi sufficiens, causa, melius, mobile, immobile, motum) u.s.w. aufgerafft, aber die Anschauungen, denen allein sie ihren Ursprung und allen Gehalt verdanken, ignorirt und darüber vornehm weggesehn: dann wird aus jenen Begriffen eine Theologie konstruirt, wobei das Ziel, der theos, verdeckt gehalten, also scheinbar ganz unbefangen verfahren wird, als wüßte nicht, schon beim ersten Blatt, der Leser, so gut wie der Autor, wo das Alles hinaussoll. Ein Bruchstück davon habe ich bereits oben angeführt. Wirklich ist dies Produkt des Proklos ganz besonders geeignet, deutlich zu machen, wie ganz untauglich und illusorisch dergleichen Kombinationen abstrakter Begriffe sind, indem sich daraus machen läßt, was Einer will, zumal wenn er noch dazu die Vieldeutigkeit mancher Worte benutzt, wie z.B. kreitton. Bei persönlicher Gegenwart eines solchen Begriffsarchitekten brauchte man nur naiv zu fragen, wo denn all die Dinge seien, von denen er so Vieles zu berichten hat, und woher er die Gesetze, aus denen er seine sie betreffenden Folgerungen zieht, kenne? Da würde er denn bald genöthigt seyn, auf die empirische Anschauung zu verweisen, in der ja allein die reale Welt sich darstellt, aus welcher jene Begriffe geschöpft sind. Alsdann hätte man nur noch zu fragen, warum er nicht ganz ehrlich von der gegebenen Anschauung einer solchen Welt ausgienge, wo er bei jedem Schritt seine Behauptungen durch sie belegen könnte, statt mit Begriffen zu operiren, die doch allein aus ihr abgezogen sind und daher weiter keine Gültigkeit haben können, als die, welche sie ihnen ertheilt. Aber freilich, das ist eben sein Kunststück, daß er durch solche Begriffe, in denen, vermöge der Abstraktion, als getrennt gedacht wird was unzertrennlich, und als vereint was unvereinbar ist, weit über die Anschauung, die ihnen den Ursprung gab und damit über die Gränzen ihrer Anwendbarkeit hinausgeht zu einer ganz andern Welt, als die ist, welche den Baustoff hergab, aber eben deshalb zu einer Welt von Hirngespinsten. Ich habe hier den Proklos angeführt, weil eben bei ihm dies Verfahren, durch die unbefangene Dreistigkeit, mit der es durchgeführt ist, besonders deutlich wird; aber auch beim Plato findet man einige, wenn gleich minder grelle Beispiele der Art, und überhaupt liefert die philosophische Litteratur aller Zeiten eine Menge dergleichen. Die der unserigen ist reich daran: man betrachte z.B. die Schriften der Schelling'schen Schule und sehe die Konstruktionen, welche aufgebaut werden aus Abstraktis wie Endliches, Unendliches, – Seyn, Nichtseyn, Andersseyn, – Thätigkeit, Hemmung, Produkt, – Bestimmen, Bestimmtwerden, Bestimmtheit, – Gränze, Begränzen, Begränztseyn, – Einheit, Vielheit, Mannigfaltigkeit, – Identität, Diversität, Indifferenz, – Denken, Seyn, Wesen u.s.f. Nicht nur gilt von Konstruktionen aus solchem Material alles oben Gesagte: sondern, weil durch dergleichen weite Abstrakta unendlich Vieles gedacht wird, kann in ihnen nur äußerst wenig gedacht werden: es sind leere Hülsen. Dadurch aber wird nun der Stoff des ganzen Philosophirens erstaunlich gering und ärmlich, woraus jene unsägliche und marternde Langweiligkeit entsteht, die allen solchen Schriften eigen ist. Wollte ich nun gar an den Mißbrauch erinnern, den Hegel und seine Gesellen mit dergleichen weiten und leeren Abstraktis getrieben haben; so müßte ich besorgen, daß dem Leser übel würde und mir auch: denn die allerekelhafteste Langweiligkeit schwebt über dem hohlen Wortkram dieser widerlichen Philosophaster.
Daß ebenfalls in der praktischen Philosophie aus bloßen abstrakten Begriffen keine Weisheit zu Tage gefördert wird, ist wohl das Einzige, was zu lernen ist aus den moralischen Abhandlungen des Theologen Schleiermacher, mit deren Vorlesung derselbe, in einer Reihe von Jahren, die Berliner Akademie gelangweilt hat, und die jetzt kürzlich zusammengedruckt erschienen sind. Da werden zum Ausgangspunkt lauter abstrakte Begriffe genommen, wie Pflicht, Tugend, höchstes Gut, Sittengesetz u. dgl., ohne weitere Einführung, als daß sie eben in den Moralsystemen vorzukommen pflegen, und werden nun behandelt als gegebene Realitäten. Ueber dieselben wird dann gar spitzfindig hin und her geredet, hingegen gar nie auf den Ursprung jener Begriffe, auf die Sache selbst losgegangen, auf das wirkliche Menschenleben, auf welches doch allein jene Begriffe sich beziehn, aus dem sie geschöpft seyn sollen, und mit dem es die Moral eigentlich zu thun hat. Gerade deshalb sind diese Diatriben eben so unfruchtbar und nutzlos, wie sie langweilig sind; womit viel gesagt ist. Leute, wie diesen nur gar zu gern philosophirenden Theologen, findet man zu allen Zeiten, berühmt, während sie leben, nachher bald vergessen. Ich rathe hingegen lieber Die zu lesen, welchen es umgekehrt ergangen: denn die Zeit ist kurz und kostbar.
Wenn nun, allem hier Gesagten zufolge, weite, abstrakte, zumal aber durch keine Anschauung zu realisirende Begriffe nie die Erkenntnißquelle, der Ausgangspunkt, oder der eigentliche Stoff des Philosophirens seyn dürfen; so können doch bisweilen einzelne Resultate desselben so ausfallen, daß sie sich bloß in abstracto denken, nicht aber durch irgend eine Anschauung belegen lassen. Erkenntnisse dieser Art werden freilich auch nur halbe Erkenntnisse seyn: sie zeigen gleichsam nur den Ort an, wo das zu Erkennende liegt; aber es bleibt verhüllt. Daher soll man auch nur im äußersten Fall und wo man an den Gränzen der unsern Fähigkeiten möglichen Erkenntniß angelangt ist, sich mit dergleichen Begriffen begnügen. Ein Beispiel der Art wäre etwan der Begriff eines Seyns außer der Zeit; desgleichen der Satz: die Unzerstörbarkeit unsers wahren Wesens durch den Tod ist keine Fortdauer desselben. Bei Begriffen dieser Art wankt gleichsam der feste Boden, der unser sämmtliches Erkennen trägt: das Anschauliche. Daher darf zwar bisweilen und im Nothfall das Philosophiren in solche Erkenntnisse auslaufen, nie aber mit ihnen anheben.
Das oben gerügte Operiren mit weiten Abstraktis, unter gänzlichem Verlassen der anschaulichen Erkenntniß, aus der sie abgezogen worden und welche daher die bleibende, naturgemäße Kontrole derselben ist, war zu allen Zeiten die Hauptquelle der Irrthümer des dogmatischen Philosophirens. Eine Wissenschaft aus der bloßen Vergleichung von Begriffen, also aus allgemeinen Sätzen aufgebaut, könnte nur dann sicher seyn, wenn alle ihre Sätze synthetische a priori wären, wie dies in der Mathematik der Fall ist: denn nur solche leiden keine Ausnahmen. Haben die Sätze hingegen irgend einen empirischen Stoff; so muß man diesen stets zur Hand behalten, um die allgemeinen Sätze zu kontroliren. Denn alle irgendwie aus der Erfahrung geschöpften Wahrheiten sind nie unbedingt gewiß, haben daher nur eine approximative Allgemeingültigkeit; weil hier keine Regel ohne Ausnahme gilt. Kette ich nun dergleichen Sätze, vermöge des Ineinandergreifens ihrer Begriffssphären, an einander; so wird leicht ein Begriff den andern gerade da treffen, wo die Ausnahme liegt: ist aber dies im Verlauf einer langen Schlußkette auch nur ein einziges Mal geschehn; so ist das ganze Gebäude von seinem Fundament losgerissen und schwebt in der Luft. Sage ich z.B. »die Wiederkäuer sind ohne vordere Schneidezähne«, und wende dies und was daraus folgt auf die Kameele an; so wird Alles falsch: denn es gilt nur von den gehörnten Wiederkäuern. – Hieher gehört gerade was Kant das Vernünfteln nennt und so oft tadelt: denn dies besteht eben in einem Subsumiren von Begriffen unter Begriffe, ohne Rücksicht auf den Ursprung derselben, und ohne Prüfung der Richtigkeit und Ausschließlichkeit einer solchen Subsumtion, wodurch man dann, auf längerm oder kürzerm Umwege, zu fast jedem beliebigen Resultat, das man sich als Ziel vorgesteckt hatte, gelangen kann; daher dieses Vernünfteln vom eigentlichen Sophisticiren nur dem Grade nach verschieden ist. Nun aber ist, im Theoretischen, Sophisticiren eben das, was im Praktischen Schikaniren ist. Dennoch hat selbst Plato sich sehr häufig jenes Vernünfteln erlaubt: Proklos hat, wie schon erwähnt, diesen Fehler seines Vorbildes, nach Weise aller Nachahmer, viel weiter getrieben. Dionysius Areopagita, De divinis nominibus, ist ebenfalls stark damit behaftet. Aber auch schon in den Fragmenten des Eleaten Melissos finden wir deutliche Beispiele von solchem Vernünfteln (besonders §§ 2-5 in Brandis Comment. Eleat.): sein Verfahren mit den Begriffen, die nie die Realität, aus der sie ihren Inhalt haben, berühren, sondern, in der Atmosphäre abstrakter Allgemeinheit schwebend, darüber hinwegfahren, gleicht zum Schein gegebenen Schlägen, die nie treffen. Ein rechtes Muster von solchem Vernünfteln ist ferner des Philosophen Sallustius Büchelchen De Diis et mundo, besonders c. c. 7, 12 et 17. Aber ein eigentliches Kabinetstück von philosophischem Vernünfteln, übergehend in entschiedenes Sophisticiren, ist folgendes Räsonnement des Platonikers Maximus Tyrius, welches ich, da es kurz ist, hersetzen will. »Jede Ungerechtigkeit ist die Entreißung eines Guts: es giebt kein anderes Gut, als die Tugend: die Tugend aber ist nicht zu entreißen: also ist es nicht möglich, daß der Tugendhafte Ungerechtigkeit erleide von dem Bösen. Nun bleibt übrig, daß entweder gar keine Ungerechtigkeit erlitten werden kann, oder daß solche der Böse von dem Bösen erleide. Allein der Böse besitzt gar kein Gut; da nur die Tugend ein solches ist: also kann ihm keines genommen werden. Also kann auch er keine Ungerechtigkeit erleiden. Also ist die Ungerechtigkeit eine unmögliche Sache.« – Das Original, durch Wiederholungen weniger koncis, lautet so: Adikia esti aphairesis agathou; to de agathon ti an eiê allo ê aretê; – hê de aretê anaphaireton. Ouk adikêsetai toinyn ho tên aretên echôn, ê ouk estin adikia aphairesis agathou; ouden gar agathon aphaireton, oud' apoblêton, oud' heleton, oude lêiston. Eien oun, oud' adikeitai ho chrêstos, oud' hypo tou mochthêrou; anaphairetos gar. Leipetai toinyn ê mêdena adikeisthai kathapax, ê ton mochthêron hypo tou homoiou; alla tô mochthêrô oudenos metestin agathou; hê de adikia ên agathou aphairesis ho de mê echôn ho, ti aphairesthê, oude eis ho, ti adikêsthê, echei (Sermo 2). Auch ein modernes Beispiel von solchem Beweisen aus abstrakten Begriffen, wodurch ein offenbar absurder Satz als Wahrheit aufgestellt wird, will ich noch hinzufügen und nehme es aus den Werken eines großen Mannes, des Jordanus Brunus. In seinem Buche Del Infinito, universo e mondi (S. 87 der Ausgabe von A. Wagner) läßt er einen Aristoteliker (mit Benutzung und Uebertreibung der Stelle I, 5 De coelo des Aristoteles) beweisen, daß jenseit der Welt kein Raum seyn könne. Die Welt nämlich sei eingeschlossen von der achten Sphäre des Aristoteles; jenseit dieser aber könne kein Raum mehr seyn. Denn: gäbe es jenseit derselben noch einen Körper; so wäre dieser entweder einfach oder zusammengesetzt. Nun wird aus lauter erbetenen Principien sophistisch bewiesen, daß kein einfacher Körper daselbst seyn könne; aber auch kein zusammengesetzter: denn dieser müßte aus einfachen bestehn. Also ist daselbst überhaupt kein Körper; – dann aber auch kein Raum. Denn der Raum wird definirt als »das, wir in Körper seyn können«: nun ist aber eben bewiesen, daß daselbst keine Körper seyn können. Also ist auch kein Raum da. Dies Letztere ist der Hauptstreich dieses Beweisens aus abstrakten Begriffen. Im Grunde beruht er darauf, daß der Satz »wo kein Raum ist, können keine Körper seyn« als ein allgemein verneinender genommen und demnach simpliciter konvertirt wird: »wo keine Körper seyn können, da ist kein Raum«. Aber jener Satz ist, genau betrachtet, ein allgemein bejahender, nämlich dieser: »alles Raumlose ist körperlos«: er darf also nicht simpliciter konvertirt werden. Jedoch läßt nicht jeder Beweis aus abstrakten Begriffen, mit einem Ergebniß, welches der Anschauung offenbar widerstreitet (wie hier die Endlichkeit des Raumes), sich auf so einen logischen Fehler zurückführen. Denn das Sophistische liegt nicht immer in der Form, sondern oft in der Materie, in den Prämissen und in der Unbestimmtheit der Begriffe und ihres Umfangs. Hiezu finden sich zahlreiche Belege bei Spinoza, dessen Methode es ja ist, aus Begriffen zu beweisen; man sehe z.B. die erbärmlichen Sophismen, in seiner Ethica, P. IV, prop. 29-31, mittelst der Vieldeutigkeit der schwankenden Begriffe convenire und commune habere. Doch verhindert Dergleichen nicht, daß den Neo-Spinozisten unserer Tage Alles, was er gesagt hat, als ein Evangelium gilt. Besonders sind unter ihnen die Hegelianer, deren es wirklich noch einige giebt, belustigend, durch ihre traditionelle Ehrfurcht vor seinem Satz omnis determinatio est negatio, bei welchem sie, dem scharlatanischen Geiste der Schule gemäß, ein Gesicht machen, als ob er die Welt aus den Angeln zu heben vermöchte; während man keinen Hund damit aus dem Ofen locken kann; indem auch der Einfältigste von selbst begreift, daß wenn ich, durch Bestimmungen, etwas abgränze, ich eben dadurch das jenseit der Gränze Liegende ausschließe und also verneine.
Also an allen Vernünfteleien obiger Art wird recht sichtbar, welche Abwege jener Algebra mit bloßen Begriffen, die keine Anschauung kontrolirt, offen stehn, und daß mithin für unsern Intellekt die Anschauung. Das ist, was für unsern Leib der feste Boden, auf welchem er steht: verlassen wir jene, so ist Alles instabilis tellus, innabilis unda. Man wird dem Belehrenden dieser Auseinandersetzungen und Beispiele die Ausführlichkeit derselben zu Gute halten. Ich habe dadurch den großen, bisher zu wenig beachteten Unterschied, ja, Gegensatz zwischen dem anschauenden und dem abstrakten oder reflektirten Erkennen, dessen Feststellung ein Grundzug meiner Philosophie ist, hervorheben und belegen wollen; da viele Phänomene unsers geistigen Lebens nur aus ihm erklärlich sind. Das verbindende Mittelglied zwischen jenen beiden so verschiedenen Erkenntnißweisen bildet, wie ich § 14 des ersten Bandes dargethan habe, die Urtheilskraft. Zwar ist diese auch auf dem Gebiete des bloß abstrakten Erkennens thätig, wo sie Begriffe nur mit Begriffen vergleicht: daher ist jedes Urtheil, im logischen Sinn dieses Worts, allerdings ein Werk der Urtheilskraft, indem dabei allemal ein engerer Begriff einem weiteren subsumirt wird. Jedoch ist diese Thätigkeit der Urtheilskraft, wo sie bloß Begriffe mit einander vergleicht, eine geringere und leichtere, als wo sie den Uebergang vom ganz Einzelnen, dem Anschaulichen, zum wesentlich Allgemeinen, dem Begriff, macht. Da nämlich dort, durch Analyse der Begriffe in ihre wesentlichen Prädikate, ihre Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit auf rein logischem Wege muß entschieden werden können, wozu die Jedem einwohnende bloße Vernunft hinreicht; so ist die Urtheilskraft dabei nur in der Abkürzung jenes Processes thätig, indem der mit ihr Begabte schnell übersieht, was Andere erst durch eine Reihe von Reflexionen herausbringen. Ihre Thätigkeit im engern Sinne aber tritt allerdings erst da ein, wo das anschaulich Erkannte, also das Reale, die Erfahrung, in das deutliche, abstrakte Erkennen übertragen, unter genau entsprechende Begriffe subsumirt und so in das reflektirte Wissen abgesetzt werden soll. Daher ist es dieses Vermögen, welches die festen Grundlagen aller Wissenschaften, als welche stets im unmittelbar Erkannten, nicht weiter Abzuleitenden bestehn, aufzustellen hat. Hier in den Grundurtheilen liegt daher auch die Schwierigkeit derselben, nicht in den Schlüssen daraus. Schließen ist leicht, urtheilen schwer. Falsche Schlüsse sind eine Seltenheit, falsche Urtheile stets an der Tagesordnung. Nicht weniger hat die Urtheilskraft im praktischen Leben, bei allen Grundbeschlüssen und Hauptentscheidungen, den Ausschlag zu geben; wie denn der richterliche Ausspruch, in der Hauptsache, ihr Werk ist. Bei ihrer Thätigkeit muß, – auf ähnliche Art, wie das Brennglas die Sonnenstrahlen in einen engen Fokus zusammenzieht, – der Intellekt alle Data, die er über eine Sache hat, so eng zusammenbringen, daß er sie mit Einem Blick erfaßt, welchen er nun richtig fixirt und dann mit Besonnenheit das Ergebniß sich deutlich macht. Zudem beruht die große Schwierigkeit des Unheils in den meisten Fällen darauf, daß wir von der Folge auf den Grund zu gehn haben, welcher Weg stets unsicher ist; ja, ich habe nachgewiesen, daß hier die Quelle alles Irrthums liegt. Dennoch ist in allen empirischen Wissenschaften, wie auch in den Angelegenheiten des wirklichen Lebens, dieser Weg meistens der einzige vorhandene. Das Experiment ist schon ein Versuch, ihn in umgekehrter Richtung zurückzulegen: daher ist es entscheidend und bringt wenigstens den Irrthum zu Tage; vorausgesetzt, daß es richtig gewählt und redlich angestellt sei, nicht aber wie die Neutonischen Experimente in der Farbenlehre; aber auch das Experiment muß wieder beurtheilt werden. Die vollkommene Sicherheit der Wissenschaften a priori, also der Logik und Mathematik, beruht hauptsächlich darauf, daß in ihnen uns der Weg vom Grunde auf die Folge offen steht, der allemal sicher ist. Dies verleiht ihnen den Charakter rein objektiver Wissenschaften, d.h. solcher, über deren Wahrheiten Alle, welche dieselben verstehn, auch übereinstimmend urtheilen müssen; welches um so auffallender ist, als gerade sie auf den subjektiven Formen des Intellekts beruhen, während die empirischen Wissenschaften allein es mit dem handgreiflich Objektiven zu thun haben.
Aeußerungen der Urtheilskraft sind auch Witz und Scharfsinn: in jenem ist sie reflektirend, in diesem subsumirend thätig. Bei den meisten Menschen ist die Urtheilskraft bloß nominell vorhanden: es ist eine Art Ironie, daß man sie den normalen Geisteskräften beizählt, statt sie allein den monstris per excessum zuzuschreiben. Die gewöhnlichen Köpfe zeigen selbst in den kleinsten Angelegenheiten Mangel an Zutrauen zu ihrem eigenen Urtheil; eben weil sie aus Erfahrung wissen, daß es keines verdient. Seine Stelle nimmt bei ihnen Vorurtheil und Nachurtheil ein; wodurch sie in einem Zustand fortdauernder Unmündigkeit erhalten werden, aus welcher unter vielen Hunderten kaum Einer losgesprochen wird. Eingeständlich ist sie freilich nicht; da sie sogar vor sich selber zum Schein urtheilen, dabei jedoch stets nach der Meinung Anderer schielen, welche ihr heimlicher Richtpunkt bleibt. Während jeder sich schämen würde, in einem geborgten Rock, Hut oder Mantel umherzugehn, haben sie Alle keine andern, als geborgte Meinungen, die sie begierig aufraffen, wo sie ihrer habhaft werden, und dann, sie für eigen ausgebend, damit herumstolziren. Andere borgen sie wieder von ihnen und machen es damit eben so. Dies erklärt die schnelle und weite Verbreitung der Irrthümer, wie auch den Ruhm des Schlechten: denn die Meinungsverleiher von Profession, also Journalisten u. dgl., geben in der Regel nur falsche Waare aus, wie die Ausleiher der Maskenanzüge nur falsche Juwelen.
Kapitel 8. Zur Theorie des Lächerlichen
Auf dem in den vorhergegangenen Kapiteln erläuterten, von mir so nachdrücklich hervorgehobenen Gegensatz zwischen anschaulichen und abstrakten Vorstellungen beruht auch meine Theorie des Lächerlichen; weshalb das zu ihrer Erläuterung noch Beizubringende seine Stelle hier findet, obgleich es, der Ordnung des Textes nach, erst weiter unten folgen müßte.
Das Problem des überall identischen Ursprungs und damit der eigentlichen Bedeutung des Lachens wurde schon von Cicero erkannt, aber auch sofort als unlösbar aufgegeben. (De orat., II. 58.) Der älteste mir bekannte Versuch einer psychologischen Erklärung des Lachens findet sich in Hutchesons Introduction into moral philosophy Bk. I, ch. I, § 14. – Eine etwas spätere anonyme Schrift, Traité des causes physiques et morales du rire, 1768, ist als Ventilation des Gegenstandes nicht ohne Verdienst. Die Meinungen der von Home bis zu Kant sich an einer Erklärung jenes der menschlichen Natur eigenthümlichen Phänomens versuchenden Philosophen hat Platner zusammengestellt, in seiner Anthropologie, § 894. – Kants und Jean Pauls Theorien des Lächerlichen sind bekannt. Ihre Unrichtigkeit nachzuweisen halte ich für überflüssig; da Jeder, welcher gegebene Fälle des Lächerlichen auf sie zurückzuführen versucht, bei den allermeisten die Ueberzeugung von ihrer Unzulänglichkeit sofort erhalten wird.
Meiner im ersten Bande ausgeführten Erklärung zufolge ist der Ursprung des Lächerlichen allemal die paradoxe und daher unerwartete Subsumtion eines Gegenstandes unter einen ihm übrigens heterogenen Begriff, und bezeichnet demgemäß das Phänomen des Lachens allemal die plötzliche Wahrnehmung einer Inkongruenz zwischen einem solchen Begriff und dem durch denselben gedachten realen Gegenstand, also zwischen dem Abstrakten und dem Anschaulichen. Je größer und unerwarteter, in der Auffassung des Lachenden, diese Inkongruenz ist, desto heftiger wird sein Lachen ausfallen. Demnach muß bei Allem, was Lachen erregt, allemal nachzuweisen seyn ein Begriff und ein Einzelnes, also ein Ding oder ein Vorgang, welcher zwar unter jenen Begriff sich subsumiren, mithin durch ihn sich denken läßt, jedoch in anderer und vorwaltender Beziehung gar nicht darunter gehört, sondern sich von Allem, was sonst durch jenen Begriff gedacht wird, auffallend unterscheidet. Wenn, wie zumal bei Witzworten oft der Fall ist, statt eines solchen anschaulichen Realen, ein dem hohem oder Gattungsbegriff untergeordneter Artbegriff auftritt; so wird er doch das Lachen erst dadurch erregen, daß die Phantasie ihn realisirt, d.h. ihn durch einen anschaulichen Repräsentanten vertreten läßt, und so der Konflikt zwischen dem Gedachten und dem Angeschauten Statt findet. Ja, man kann, wenn man die Sache recht explicite erkennen will, jedes Lächerliche zurückführen auf einen Schluß in der ersten Figur, mit einer unbestrittenen major und einer unerwarteten, gewissermaaßen nur durch Schikane geltend gemachten minor; in Folge welcher Verbindung die Konklusion die Eigenschaft des Lächerlichen an sich hat.
Ich habe, im ersten Bande, für überflüssig gehalten, diese Theorie an Beispielen zu erläutern; da Jeder dies, durch ein wenig Nachdenken über ihm erinnerliche Fälle des Lächerlichen, leicht selbst leisten kann. Um jedoch auch der Geistesträgheit derjenigen Leser, die durchaus im passiven Zustand verharren wollen, zu Hülfe zu kommen, will ich mich hier dazu bequemen. Sogar will ich, in dieser dritten Auflage, die Beispiele vermehren und anhäufen; damit es unbestritten sei, daß hier, nach so vielen fruchtlosen, früheren Versuchen, die wahre Theorie des Lächerlichen gegeben und das schon vom Cicero aufgestellte, aber auch aufgegebene Problem definitiv gelöst sei. –
Wenn wir bedenken, daß zu einem Winkel zwei auf einander treffende Linien erfordert sind, welche, wenn verlängert, einander schneiden, die Tangente hingegen den Kreis nur an einem Punkte streift, an diesem Punkte aber eigentlich mit ihm parallel geht, und wir demgemäß die abstrakte Ueberzeugung von der Unmöglichkeit eines Winkels zwischen Kreislinie und Tangente gegenwärtig haben; nun aber doch auf dem Papier ein solcher Winkel uns augenscheinlich vorliegt; so wird dieses uns leicht ein Lächeln abnöthigen. Das Lächerliche in diesem Fall ist zwar äußerst schwach: hingegen tritt gerade in ihm der Ursprung desselben aus der Inkongruenz des Gedachten zum Angeschauten ungemein deutlich hervor. – Je nachdem wir, beim Auffinden einer solchen Inkongruenz, vom Realen, d.i. Anschaulichen, zum Begriff, oder aber umgekehrt vom Begriff zum Realen übergehn, ist das dadurch entstehende Lächerliche entweder ein Witzwort, oder aber eine Ungereimtheit, im hohem Grade, zumal im Praktischen, eine Narrheit; wie im Text auseinandergesetzt worden. Um nun Beispiele des ersten Falles, also des Witzes, zu betrachten, wollen wir zunächst die allbekannte Anekdote nehmen vom Gaskogner, über den der König lachte, als er ihn bei strenger Winterkälte in leichter Sommerkleidung sah, und der darauf zum König sagte: »Hätten Ew. Maj. angezogen, was ich angezogen habe; so würden Sie es sehr warm finden«, – und auf die Frage, was er angezogen habe: »Meine ganze Garderobe.« – Unter diesem letztern Begriff ist nämlich, so gut wie die unübersehbare Garderobe eines Königs, auch das einzige Sommerröckchen eines armen Teufels zu denken, dessen Anblick auf seinem frierenden Leibe sich jedoch dem Begriff sehr inkongruent zeigt. – Das Publikum eines Theaters in Paris verlangte einst, daß die Marseillaise gespielt werde, und gerieth, als dies nicht geschah, in großes Schreien und Toben; so daß endlich ein Polizeikommissarius in Uniform auf die Bühne trat und erklärte, es sei nicht erlaubt, daß im Theater etwas Anderes vorkomme, als was auf dem Zettel stehe. Da rief eine Stimme: Et vous, Monsieur, êtes-vous aussi sur l'affiche? welcher Einfall das einstimmigste Gelächter erregte. Denn hier ist die Subsumtion des Heterogenen unmittelbar deutlich und ungezwungen. – Das Epigramm:
»Bav ist der treue Hirt, von dem die Bibel sprach:
Wenn seine Heerde schläft, bleibt er allein noch wach«,
subsumirt unter den Begriff eines bei der schlafenden Heerde wachenden Hirten, den langweiligen Prediger, der die ganze Gemeinde eingeschläfert hat und nun ungehört allein fortbelfert. – Analog ist die Grabschrift eines Arztes: »Hier liegt er, wie ein Held, und die Erschlagenen liegen um ihn her«; – es subsumirt unter den dem Helden ehrenvollen Begriff des »von Getödteten umringt Liegens« den Arzt, der das Leben erhalten soll. – Sehr häufig besteht das Witzwort in einem einzigen Ausdruck, durch den eben nur der Begriff angegeben wird, unter welchen der vorliegende Fall subsumirt werden kann, welcher jedoch Allem, was sonst darunter gedacht wird, sehr heterogen ist. So im Romeo, wenn der lebhafte, aber soeben tödtlich verwundete Merkutio seinen Freunden, die ihn Morgen zu besuchen versprechen, antwortet: »Ja, kommt nur, ihr werdet einen stillen Mann an mir finden«, unter welchen Begriff hier der Todte subsumirt wird: im Englischen kommt aber noch das Wortspiel hinzu, daß a grave man zugleich den ernsthaften, und den Mann des Grabes bedeutet. – Dieser Art ist auch die bekannte Anekdote vom Schauspieler Unzelmann: nachdem auf dem Berliner Theater alles Improvisiren streng untersagt worden war, hatte er zu Pferde auf der Bühne zu erscheinen, wobei, als er gerade auf dem Proscenio war, das Pferd Mist fallen ließ, wodurch das Publikum schon zum Lachen bewogen wurde, jedoch sehr viel mehr, als Unzelmann zum Pferde sagte: »Was machst denn du? weißt du nicht, daß uns das Improvisiren verboten ist?« Hier ist die Subsumtion des Heterogenen unter den allgemeineren Begriff sehr deutlich, daher das Witzwort überaus treffend und die dadurch erlangte Wirkung des Lächerlichen äußerst stark. – Hieher gehört ferner eine Zeitungsnachricht vom März 1851 aus Hall: »Die jüdische Gaunerbande, deren wir erwähnt haben, wurde wieder bei uns, unter obligater Begleitung, eingeliefert.« Diese Subsumtion einer Polizeieskorte unter einem musikalischen Ausdruck ist sehr glücklich; wiewohl sich schon dem bloßen Wortspiel nähernd. – Hingegen ist es ganz der hier in Rede stehenden Art, wenn Saphir, in einem Federkrieg gegen den Schauspieler Angeli, diesen bezeichnet als »den an Geist und Körper gleich großen Angeli« – wo, vermöge der stadtbekannten winzigen Statur des Schauspielers, unter den Begriff »groß« das ungemein Kleine sich anschaulich stellt; – so auch, wenn der selbe Saphir die Arien einer neuen Oper »gute alte Bekannte« nennt, also unter einen Begriff, der in andern Fällen zur Empfehlung dient, gerade die tadelhafte Eigenschaft bringt; – eben so, wenn man von einer Dame, auf deren Gunst Geschenke Einfluß hätten, sagen wollte, sie wisse das utile dulci zu vereinigen; wodurch man unter den Begriff der Regel, welche vom Horaz in ästhetischer Hinsicht empfohlen wird, das moralisch Gemeine bringt; – eben so, wenn man, um ein Bordell anzudeuten, es etwan bezeichnete als einen »bescheidenen Wohnsitz stiller Freuden«. – Die gute Gesellschaft, welche, um vollkommen fade zu seyn, alle entschiedenen Aeußerungen und daher alle starken Ausdrücke verbannt hat, pflegt, um skandalöse, oder irgendwie anstößige Dinge zu bezeichnen, sich dadurch zu helfen, daß sie solche, zur Milderung, mittelst allgemeiner Begriffe ausdrückt: hiedurch aber wird diesen auch das ihnen mehr oder minder Heterogene subsumirt, wodurch eben, in entsprechendem Grade, die Wirkung des Lächerlichen entsteht. Dahin also gehört das obige utile dulci: desgleichen: »er hat auf dem Ball Unannehmlichkeiten gehabt«, – wenn er geprügelt und herausgeschmissen worden; oder »er hat des Guten etwas zu viel gethan«, – wenn er betrunken ist; wie auch »die Frau soll schwache Augenblicke haben«, – wenn sie ihrem Mann Hörner aufsetzt; u.s.w. Ebenfalls gehören dahin die Aequivoken, nämlich Begriffe, welche an und für sich nichts Unanständiges enthalten, unter die jedoch das Vorliegende gebracht auf eine unanständige Vorstellung leitet. Sie sind in der Gesellschaft sehr häufig. Aber ein vollkommenes Muster der durchgeführten und großartigen Aequivoke ist die unvergleichliche Grabschrift auf den Justice of peace von Shenstone, als welche, in ihrem hochtrabenden Lapidarstil, von edeln und erhabenen Dingen zu reden scheint, während unter jeden ihrer Begriffe etwas ganz Anderes zu subsumiren ist, welches erst im allerletzten Wort, als unerwarteter Schlüssel zum Ganzen, hervortritt und der Leser laut auflachend entdeckt, daß er bloß eine sehr schmutzige Aequivoke gelesen hat. Sie herzusetzen und gar noch zu übersetzen ist in diesem glatt gekämmten Zeitalter schlechterdings unzulässig: man findet sie in Shenstone's Poëtical works, überschrieben Inscription. Die Aequivoken gehn bisweilen in das bloße Wortspiel über, von welchem im Text das Nöthige gesagt worden.
Auch wider die Absicht kann die jedem Lächerlichen zum Grunde liegende Subsumtion des in einer Hinsicht Heterogenen unter einen ihm übrigens angemessenen Begriff Statt finden: z.B. einer der freien Neger in Nordamerika, welche sich bemühen, in allen Stücken den Weißen nachzuahmen, hat ganz kürzlich seinem gestorbenen Kinde ein Epitaphium gesetzt, welches anhebt: »Liebliche, früh gebrochene Lilie«. – Wird hingegen, mit plumper Absichtlichkeit, ein Reales und Anschauliches geradezu unter den Begriff seines Gegentheils gebracht; so entsteht die platte, gemeine Ironie. Z.B. wenn bei starkem Regen gesagt wird: »das ist heute ein angenehmes Wetter«; – oder, von einer häßlichen Braut: »der hat sich ein schönes Schätzchen ausgesucht«; – oder von einem Spitzbuben: »dieser Ehrenmann«; u. dgl. m. Nur Kinder und Leute ohne alle Bildung werden über so etwas lachen: denn hier ist die Inkongruenz zwischen dem Gedachten und dem Angeschauten eine totale. Doch tritt, eben bei dieser plumpen Uebertreibung in der Bewerkstelligung des Lächerlichen, der Grundcharakter desselben, besagte Inkongruenz, sehr deutlich hervor. – Dieser Gattung des Lächerlichen ist, wegen der Uebertreibung und deutlichen Absichtlichkeit, in etwas verwandt die Parodie. Ihr Verfahren besteht darin, daß sie den Vorgängen und Worten eines ernsthaften Gedichtes oder Dramas unbedeutende, niedrige Personen, oder kleinliche Motive und Handlungen unterschiebt. Sie subsumirt also die von ihr dargestellten platten Realitäten unter die im Thema gegebenen hohen Begriffe, unter welche sie nun in gewisser Hinsicht passen müssen, während sie übrigens denselben sehr inkongruent sind; wodurch dann der Widerstreit zwischen dem Angeschauten und dem Gedachten sehr grell hervortritt. An bekannten Beispielen fehlt es hier nicht: ich führe daher nur eines an, aus der Zobeide von Carlo Gozzi, Akt 4, Scene 3, wo zweien Hanswürsten, die sich soeben geprügelt haben und davon ermüdet ruhig neben einander liegen, die berühmte Stanze des Ariosto (Orl. fur. I, 22) oh gran bontà de cavalieri antichi u.s.w. ganz wörtlich in den Mund gelegt ist. – Dieser Art ist auch die in Deutschland sehr beliebte Anwendung ernster, besonders Schiller'scher Verse auf triviale Vorfälle, welche offenbar eine Subsumtion des Heterogenen unter den allgemeinen Begriff, welchen der Vers ausspricht, enthält. So z.B. wann Jemand einen recht charakteristischen Streich hat ergehn lassen, wird es selten an Einem fehlen, der dazu sagt: »Daran erkenn' ich meine Pappenheimer.« Aber originell und sehr witzig war es, als Einer an ein eben getrautes junges Ehepaar, dessen weibliche Hälfte ihm gefiel, die Schlußworte der Schiller'schen Ballade »Die Bürgschaft« (ich weiß nicht wie laut) richtete:
»Ich sei, erlaubt mir die Bitte,
In eurem Bunde der Dritte.«
Die Wirkung des Lächerlichen ist hier stark und unausbleiblich, weil unter die Begriffe, durch welche Schiller uns ein moralisch edeles Verhältniß zu denken giebt, ein verbotenes und unsittliches, aber richtig und ohne Veränderung subsumirt, also dadurch gedacht wird. – In allen hier angeführten Beispielen des Witzes findet man, daß einem Begriff, oder überhaupt einem abstrakten Gedanken, ein Reales, unmittelbar, oder mittelst eines engern Begriffes, subsumirt wird, welches zwar, nach der Strenge, darunter gehört, jedoch himmelweit verschieden ist von der eigentlichen und ursprünglichen Absicht und Richtung des Gedankens. Demgemäß besteht der Witz, als Geistesfähigkeit, ganz allein in der Leichtigkeit, zu jedem vorkommenden Gegenstande einen Begriff zu finden, unter welchem er allerdings mitgedacht werden kann, jedoch allen andern darunter gehörigen Gegenständen sehr heterogen ist.
Die zweite Art des Lächerlichen geht, wie erwähnt, in umgekehrter Richtung, vom abstrakten Begriff zu dem durch diesen gedachten Realen, also Anschaulichen, welches nun aber irgend eine Inkongruenz zu demselben, die übersehn worden, an den Tag legt, wodurch eine Ungereimtheit, mithin in praxi eine närrische Handlung, entsteht. Da das Schauspiel Handlung erfordert, so ist diese Art des Lächerlichen der Komödie wesentlich. Hierauf beruht Voltaire's Bemerkung: J'ai cru remarquer aux spectacles, qu'il ne s'élève presque jamais de ces éclats de rire universels, qu'à l'occasion d'une méprise (Préface de l'enfant prodigue.) Als Beispiele dieser Gattung des Lächerlichen können die folgenden gelten. Als Jemand geäußert hatte, daß er gern allein spatzieren gienge, sagte ein Oesterreicher zu ihm: »Sie gehn gern allein spatzieren; ich halt auch: da können wir zusammen gehn.« Er geht aus von dem Begriff »ein Vergnügen, welches Zwei lieben, können sie gemeinschaftlich genießen«, und subsumirt demselben den Fall, der gerade die Gemeinschaft ausschließt. Ferner der Bediente, welcher das abgeschabte Seehundsfell am Koffer seines Herrn mit Makassaröl bestreicht, damit es wieder behaart werde; wobei er ausgeht von dem Begriff »Makassaröl macht Haare wachsen«; – die Soldaten in der Wachtstube, welche dem eben eingebrachten Arrestanten an ihrem Kartenspiel Theil zu nehmen erlauben, weil er aber dabei schikanirt, wodurch Streit entsteht, ihn hinauswerfen: sie lassen sich leiten durch den allgemeinen Begriff »schlechte Gesellen wirft man hinaus«, – vergessen aber, daß er zugleich Arrestant, d.h. Einer, den sie festhalten sollen, ist. – Zwei Bauerjungen hatten ihre Flinte mit grobem Schrot geladen, welches sie, um ihm feines zu substituiren, heraus haben wollten, ohne jedoch das Pulver einzubüßen. Da legte der Eine die Mündung des Laufes in seinen Hut, den er zwischen die Beine nahm, und sägte zum Andern: »Jetzt drücke du ganz sachte, sachte, sachte los: da kommt zuerst das Schrot.« Er geht aus von dem Begriff »Verlangsamung der Ursache giebt Verlangsamung der Wirkung.« – Belege sind ferner die meisten Handlungen des Don Quijote, welcher unter Begriffe, die er aus Ritterromanen geschöpft, die ihm vorkommenden ihnen sehr heterogenen Realitäten subsumirt, z.B. um die Unterdrückten zu beschützen, die Galeerensklaven befreit. Eigentlich gehören auch alle Münchhausianaden hieher: nur sind sie nicht närrische Handlungen, die vollzogen, sondern unmögliche, die als wirklich geschehn dem Zuhörer aufgebunden werden. Bei denselben ist allemal die Thatsache so gefaßt, daß sie, bloß in abstracto, mithin komparativ a priori gedacht, als möglich und plausibel erscheint; aber hinterher, wenn man zur Anschauung des individuellen Falls herabkommt, also a posteriori, thut sich das Unmögliche der Sache, ja, das Absurde der Annahme hervor und erregt Lachen, durch die augenfällige Inkongruenz des Angeschauten zum Gedachten: z.B. wenn die im Posthorn eingefrorenen Melodien in der warmen Stube aufthauen; wenn Münchhausen, bei strengem Frost, auf dem Baume sitzend, sein herabgefallenes Messer am gefrierenden Wasserstrahl seines Urins in die Höhe zieht, u.s.w. Dieser Art ist auch die Geschichte von zwei Löwen, welche Nachts die Scheidewand durchbrochen und in ihrer Wuth sich gegenseitig auffressen; so daß am Morgen nur noch die beiden Schwänze gefunden werden.
Noch giebt es Fälle des Lächerlichen, wo der Begriff, unter welchen das Anschauliche gebracht wird, weder ausgesprochen, noch angedeutet zu werden braucht, sondern vermöge der Ideenassociation von selbst ins Bewußtseyn tritt. Das Lachen, in welches Garrick, mitten im Tragiren, ausbrach, weil ein vorn im Parterre stehender Fleischer, um sich den Schweiß abzuwischen, einstweilen seinem großen Hunde, der, mit den Vorderpfoten auf die Parterreschranke gestützt, nach dem Theater hinsah, seine Perrücke aufgesetzt hatte, war dadurch vermittelt, daß Garrick vom hinzugedachten Begriff eines Zuschauers ausgieng. Eben hierauf beruht es, daß gewisse Thiergestalten, wie Affen, Kangurus, Springhaasen u. dgl. uns bisweilen lächerlich erscheinen, weil etwas Menschenähnliches in ihnen uns veranlaßt, sie unter den Begriff der menschlichen Gestalt zu subsumiren, von welchem wieder ausgehend, wir ihre Inkongruenz zu demselben wahrnehmen.
Die Begriffe, deren hervortretende Inkongruenz zur Anschauung uns zum Lachen bewegt, sind nun entweder die eines Andern, oder unsere eigenen. Im ersten Fall lachen wir über den Andern: im zweiten fühlen wir eine oft angenehme, wenigstens belustigende Ueberraschung. Kinder und rohe Menschen lachen daher bei den kleinsten, sogar bei widrigen Zufällen, wenn sie ihnen unerwartet waren, also ihren vorgefaßten Begriff des Irrthums überführten. – In der Regel ist das Lachen ein vergnüglicher Zustand: die Wahrnehmung der Inkongruenz des Gedachten zum Angeschauten, also zur Wirklichkeit, macht uns demnach Freude und wir geben uns gern der krampfhaften Erschütterung hin, welche diese Wahrnehmung erregt. Der Grund hievon liegt in Folgendem. Bei jenem plötzlich hervortretenden Widerstreit zwischen dem Angeschauten und dem Gedachten behält das Angeschaute allemal unzweifelhaftes Recht: denn es ist gar nicht dem Irrthum unterworfen, bedarf keiner Beglaubigung von außerhalb, sondern vertritt sich selbst. Sein Konflikt mit dem Gedachten entspringt zuletzt daraus, daß dieses mit seinen abstrakten Begriffen nicht herabkann zur endlosen Mannigfaltigkeit und Nüancirung des Anschaulichen. Dieser Sieg der anschauenden Erkenntniß über das Denken erfreut uns. Denn das Anschauen ist die ursprüngliche, von der thierischen Natur unzertrennliche Erkenntnißweise, in der sich Alles, was dem Willen unmittelbares Genügen giebt, darstellt: es ist das Medium der Gegenwart, des Genusses und der Fröhlichkeit: auch ist dasselbe mit keiner Anstrengung verknüpft. Vom Denken gilt das Gegentheil: es ist die zweite Potenz des Erkennens, deren Ausübung stets einige, oft bedeutende Anstrengung erfordert, und deren Begriffe es sind, welche sich so oft der Befriedigung unserer unmittelbaren Wünsche entgegenstellen, indem sie, als das Medium der Vergangenheit, der Zukunft und des Ernstes, das Vehikel unserer Befürchtungen, unserer Reue und aller unserer Sorgen abgeben. Diese strenge, unermüdliche, überlästige Hofmeisterin Vernunft jetzt ein Mal der Unzulänglichkeit überführt zu sehn, muß uns daher ergötzlich seyn. Deshalb also ist die Miene des Lachens der der Freude sehr nahe verwandt.
Wegen des Mangels an Vernunft, also an Allgemeinbegriffen, ist das Thier, wie der Sprache, so auch des Lachens unfähig. Dieses ist daher ein Vorrecht und charakteristisches Merkmal des Menschen. Jedoch hat, beiläufig gesagt, auch sein einziger Freund, der Hund, einen analogen, ihm allein eigenen und charakteristischen Akt vor allen andern Thieren voraus, nämlich das so ausdrucksvolle, wohlwollende und grundehrliche Wedeln. Wie vortheilhaft sticht doch diese, ihm von der Natur eingegebene Begrüßung ab, gegen die Bücklinge und grinzenden Höflichkeitsbezeugungen der Menschen, deren Versicherung inniger Freundschaft und Ergebenheit es an Zuverlässigkeit, wenigstens für die Gegenwart, tausend Mal übertrifft. –
Das Gegentheil des Lachens und Scherzes ist der Ernst. Demgemäß besteht er im Bewußtseyn der vollkommenen Uebereinstimmung und Kongruenz des Begriffs, oder Gedankens, mit dem Anschaulichen, oder der Realität. Der Ernste ist überzeugt, daß er die Dinge denkt wie sie sind, und daß sie sind wie er sie denkt. Eben deshalb ist der Uebergang vom tiefen Ernst zum Lachen so besonders leicht und durch Kleinigkeiten zu bewerkstelligen; weil jene vom Ernst angenommene Uebereinstimmung, je vollkommener sie schien, desto leichter selbst durch eine geringe, unerwartet zu Tage kommende Inkongruenz aufgehoben wird. Daher je mehr ein Mensch des ganzen Ernstes fähig ist, desto herzlicher kann er lachen. Menschen, deren Lachen stets affektirt und gezwungen herauskommt, sind intellektuell und moralisch von leichtem Gehalt; wie denn überhaupt die Art des Lachens, und andererseits der Anlaß dazu, sehr charakteristisch für die Person ist. Daß die Geschlechtsverhältnisse den leichtesten, jederzeit bereit liegenden und auch dem schwächsten Witz erreichbaren Stoff zum Scherze abgeben, wie die Häufigkeit der Zoten beweist, könnte nicht seyn, wenn nicht der tiefste Ernst gerade ihnen zum Grunde läge.
Daß das Lachen Anderer über Das, was wir thun oder ernstlich sagen, uns so empfindlich beleidigt, beruht darauf, daß es aussagt, zwischen unsern Begriffen und der objektiven Realität sei eine gewaltige Inkongruenz. Aus dem selben Grunde ist das Prädikat »lächerlich« beleidigend. – Das eigentliche Hohngelächter ruft dem gescheiterten Widersacher triumphirend zu, wie inkongruent die Begriffe, welche er gehegt, zu der sich jetzt ihm offenbarenden Wirklichkeit gewesen. Unser eigenes bitteres Lachen, bei der sich uns schrecklich enthüllenden Wahrheit, durch welche fest gehegte Erwartungen sich als täuschend erweisen, ist der lebhafte Ausdruck der nunmehr gemachten Entdeckung der Inkongruenz zwischen den Gedanken, die wir, in thörichtem Vertrauen auf Menschen oder Schicksal, gehegt, und der jetzt sich entschleiernden Wirklichkeit.
Das absichtlich Lächerliche ist der Scherz: er ist das Bestreben, zwischen den Begriffen des Andern und der Realität, durch Verschieben des Einen dieser Beiden, eine Diskrepanz zu Wege zu bringen; während sein Gegentheil der Ernst in der wenigstens angestrebten genauen Angemessenheit Beider zu einander besteht. Versteht nun aber der Scherz sich hinter den Ernst; so entsteht die Ironie: z.B. wenn wir auf die Meinungen des Andern, welche das Gegentheil der unserigen sind, mit scheinbarem Ernst eingehn und sie mit ihm zu theilen simuliren; bis endlich das Resultat ihn an uns und ihnen irre macht. So verhielt sich Sokrates dem Hippias, Protagoras, Gorgias und andern Sophisten, überhaupt oft seinem Collocutor gegenüber. – Das Umgekehrte der Ironie wäre demnach der hinter den Scherz versteckte Ernst, und dies ist der Humor. Man könnte ihn den doppelten Kontrapunkt der Ironie nennen, – Erklärungen wie »der Humor ist die Wechseldurchdringung des Endlichen und Unendlichen« drücken nichts weiter aus, als die gänzliche Unfähigkeit zum Denken Derer, die an solchen hohlen Floskeln ihr Genügen haben. – Die Ironie ist objektiv, nämlich auf den Andern berechnet; der Humor aber subjektiv, nämlich zunächst nur für das eigene Selbst da. Demgemäß finden die Meisterstücke der Ironie sich bei den Alten, die des Humors bei den Neueren. Denn näher betrachtet, beruht der Humor auf einer subjektiven, aber ernsten und erhabenen Stimmung, welche unwillkürlich in Konflikt geräth mit einer ihr sehr heterogenen, gemeinen Außenwelt, der sie weder ausweichen, noch sich selbst aufgeben kann; daher sie, zur Vermittelung, versucht, ihre eigene Ansicht und jene Außenwelt durch die selben Begriffe zu denken, welche hiedurch eine doppelte, bald auf dieser bald auf der andern Seite liegende Inkongruenz zu dem dadurch gedachten Realen erhalten, wodurch der Eindruck des absichtlich Lächerlichen, also des Scherzes entsteht, hinter welchem jedoch der tiefste Ernst versteckt ist und durchscheint. Fängt die Ironie mit ernster Miene an und endigt mit lächelnder, so hält der Humor es umgekehrt. Als ein Beispiel von diesem kann schon der oben angeführte Ausdruck des Merkutio gelten. Desgleichen im Hamlet: Polonius: »Gnädigster Herr, ich will ehrerbietigst Abschied von Ihnen nehmen. – Hamlet: Sie können nichts von mir nehmen, was ich williger hergäbe; – ausgenommen mein Leben, ausgenommen mein Leben, ausgenommen mein Leben.« – Sodann, vor der Aufführung des Schauspiels bei Hofe, sagt Hamlet zur Ophelia: »Was sollte ein Mensch Anderes thun, als lustig seyn? Denn seht nur, wie vergnügt meine Mutter aussieht, und mein Vater ist doch erst vor zwei Stunden gestorben. – Ophelia: Vor zwei Mal zwei Monaten, gnädigster Herr. – Hamlet: So lang ist's her?! Ei, da mag der Teufel noch schwarz gehn! ich will mir ein munteres Kleid machen lassen.« – Ferner auch in Jean Pauls »Titan«, wenn der tiefsinnig gewordene und nun über sich selbst brütende Schoppe öfter seine Hände ansehend zu sich sagt: »Da sitzt ein Herr leibhaftig und ich in ihm: wer ist aber solcher?« – Als wirklicher Humorist tritt Heinrich Heine auf, in seinem »Romancero«: hinter allen seinen Scherzen und Possen merken wir einen tiefen Ernst, der sich schämt unverschleiert hervorzutreten. – Demnach beruht der Humor auf einer besondern Art der Laune (wahrscheinlich von Luna), durch welchen Begriff, in allen seinen Modifikationen, ein entschiedenes Ueberwiegen des Subjektiven über das Objektive, bei der Auffassung der Außenwelt, gedacht wird. Auch jede poetische, oder künstlerische Darstellung einer komischen, ja sogar possenhaften Scene, als deren verdeckter Hintergrund jedoch ein ernster Gedanke durchschimmert, ist Produkt des Humors, also humoristisch. Dahin gehört z.B. eine kolorirte Zeichnung von Tischbein: sie stellt ein ganz leeres Zimmer dar, welches seine Beleuchtung allein von dem im Kamin lodernden Feuer erhält. Vor diesem steht ein Mensch, in der Weste, so daß, von seinen Füßen ausgehend, der Schatten seiner Person sich über das ganze Zimmer streckt. »Das ist Einer«, kommentirte Tischbein dazu, »dem in der Welt nichts hat gelingen wollen und der es zu nichts gebracht hat: jetzt freut er sich, daß er doch einen so großen Schatten werfen kann.« Sollte ich nun aber den hinter diesen Scherz versteckten Ernst aussprechen; so könnte ich es am besten durch folgende dem Persischen Gedichte Anwari Soheili entnommene Verse:
»Ist einer Welt Besitz für dich zerronnen,
Sei nicht im Leid darüber, es ist nichts;
Und hast du einer Welt Besitz gewonnen,
Sei nicht erfreut darüber, es ist nichts.
Vorüber gehn die Schmerzen und die Wonnen,
Geh' an der Welt vorüber, es ist nichts.« –
Daß heut zu Tage in der Deutschen Litteratur »humoristisch« durchgängig in der Bedeutung von »komisch« überhaupt gebraucht wird, entspringt aus der erbärmlichen Sucht, den Dingen einen vornehmeren Namen zu geben, als ihnen zukommt, nämlich den einer über ihnen stehenden Klasse: so will jedes Wirthshaus Hotel, jeder Geldwechsler Banquier, jede Reiterbude Cirkus, jedes Konzert Musikalische Akademie, das Kaufmannskomptoir Büreau, der Töpfer Thonkünstler heißen, – demnach auch jeder Hanswurst Humorist. Das Wort Humor ist von den Engländern entlehnt, um eine, bei ihnen zuerst bemerkte, ganz eigenthümliche, sogar, wie oben gezeigt, dem Erhabenen verwandte Art des Lächerlichen auszusondern und zu bezeichnen; nicht aber um jeden Spaaß und jede Hanswurstiade damit zu betiteln, wie jetzt in Deutschland allgemein, ohne Opposition, geschieht, von Litteraten und Gelehrten; weil der wahre Begriff jener Abart, jener Geistesrichtung, jenes Kindes des Lächerlichen und Erhabenen, zu subtil und zu hoch seyn würde für ihr Publikum, welchem zu gefallen, sie bemüht sind, Alles abzuplatten und zu pöbelarisiren. Je nun, »hohe Worte und niedriger Sinn« ist überhaupt der Wahlspruch der edeln »Jetztzeit«: demgemäß heißt heut zu Tage ein Humorist, was ehemals ein Hanswurst genannt wurde.
Kapitel 9. Zur Logik überhaupt
Logik, Dialektik und Rhetorik gehören zusammen, indem sie das Ganze einer Technik der Vernunft ausmachen, unter welcher Benennung sie auch zusammen gelehrt werden sollten, Logik als Technik des eigenen Denkens, Dialektik des Disputirens mit Andern und Rhetorik des Redens zu Vielen (concionatio); also entsprechend dem Singular, Dual und Plural, wie auch dem Monolog, Dialog und Panegyrikus.
Unter Dialektik verstehe Ich, in Uebereinstimmung mit Aristoteles (Metaph. III, 2, et Analyt. post. I, 11), die Kunst des auf gemeinsame Erforschung der Wahrheit, namentlich der philosophischen, gerichteten Gespräches. Ein Gespräch dieser Art geht aber nothwendig, mehr oder weniger, in die Kontroverse über; daher Dialektik auch erklärt werden kann als Disputirkunst. Beispiele und Muster der Dialektik haben wir an den Platonischen Dialogen; aber für die eigentliche Theorie derselben, also für die Technik des Disputirens, die Eristik, ist bisher sehr wenig geleistet worden. Ich habe einen Versuch der Art ausgearbeitet und eine Probe desselben im zweiten Band der Parerga mitgetheilt; daher ich die Erörterung dieser Wissenschaft hier ganz übergehe.
In der Rhetorik sind die rhetorischen Figuren ungefähr was in der Logik die syllogistischen, jeden Falls aber der Betrachtung würdig. Zu Aristoteles Zeit scheinen sie noch nicht Gegenstand theoretischer Untersuchung gewesen zu seyn; da er in keiner seiner Rhetoriken von ihnen handelt, und wir in dieser Hinsicht an den Rutilius Lupus, den Epitomator eines spätem Gorgias, verwiesen sind.
Alle drei Wissenschaften haben das Gemeinsame, daß man, ohne sie gelernt zu haben, ihre Regeln befolgt, welche sogar selbst erst aus dieser natürlichen Ausübung abstrahirt sind. – Daher haben sie, bei vielem theoretischen Interesse, doch nur geringen praktischen Nutzen: theils weil sie zwar die Regel, aber nicht den Fall der Anwendung geben; theils weil während der Praxis gewöhnlich keine Zeit ist, sich der Regeln zu erinnern. Sie lehren also nur was Jeder schon von selbst weiß und übt: dennoch ist die abstrakte Erkenntniß desselben interessant und wichtig. Praktischen Nutzen wird die Logik, wenigstens für das eigene Denken, nicht leicht haben. Denn die Fehler unsers eigenen Räsonnements liegen fast nie in den Schlüssen, noch sonst in der Form, sondern in den Urtheilen, also in der Materie des Denkens. Hingegen können wir bei der Kontroverse bisweilen einigen praktischen Nutzen von der Logik ziehn, indem wir die, aus deutlich oder undeutlich bewußter Absicht, trügerische Argumentation des Gegners, welche er unter dem Schmuck und der Decke fortlaufender Rede vorbringt, auf die strenge Form regelmäßiger Schlüsse zurückführen und dann ihm Fehler gegen die Logik nachweisen, z.B. einfache Umkehrung allgemein bejahender Urtheile, Schlüsse mit vier Terminis, Schlüsse von der Folge auf den Grund, Schlüsse in der zweiten Figur aus lauter affirmirenden Prämissen u. dgl. m. –
Mir dünkt, daß man die Lehre von den Denkgesetzen dadurch vereinfachen könnte, daß man deren nur zwei aufstellte, nämlich das vom ausgeschlossenen Dritten und das vom zureichenden Grunde. Ersteres so: »Jedem Subjekt ist jegliches Prädikat entweder beizulegen oder abzusprechen« Hier liegt im Entweder Oder schon, daß nicht Beides zugleich geschehn darf, folglich eben Das, was die Gesetze der Identität und des Widerspruchs besagen: diese würden also als Korollarien jenes Satzes hinzukommen, welcher eigentlich besagt, daß jegliche zwei Begriffssphären entweder als vereint, oder als getrennt zu denken sind, nie aber als Beides zugleich; mithin daß, wo Worte zusammengefügt sind, welche Letzteres dennoch ausdrücken, diese Worte einen Denkproceß angeben, der unausführbar ist: das Innewerden dieser Unausführbarkeit ist das Gefühl des Widerspruchs. – Das zweite Denkgesetz, der Satz vom Grunde, würde besagen, daß obiges Beilegen oder Absprechen durch etwas vom Urtheil selbst Verschiedenes bestimmt seyn muß, welches eine (reine oder empirische) Anschauung, oder aber bloß ein anderes Urtheil seyn kann: dieses Andere und Verschiedene heißt alsdann der Grund des Unheils. Sofern ein Urtheil dem ersten Denkgesetz genügt, ist es denkbar; sofern es dem zweiten genügt, ist es wahr, wenigstens logisch oder formell wahr, wenn nämlich der Grund des Urtheils wieder nur ein Urtheil ist. Die materielle, oder absolute Wahrheit aber ist zuletzt doch immer nur das Verhältniß zwischen einem Urtheil und einer Anschauung, also zwischen der abstrakten und der anschaulichen Vorstellung. Dies Verhältniß ist entweder ein unmittelbares, oder aber vermittelt durch andere Urtheile, d.h. durch andere abstrakte Vorstellungen. Hienach ist leicht abzusehn, daß nie eine Wahrheit die andere umstoßen kann, sondern alle zuletzt in Uebereinstimmung seyn müssen; weil im Anschaulichen, ihrer gemeinsamen Grundlage, kein Widerspruch möglich ist. Daher hat keine Wahrheit die andere zu fürchten. Trug und Irrthum hingegen haben jede Wahrheit zu fürchten; weil, durch die logische Verkettung aller, auch die entfernteste ein Mal ihren Stoß auf jeden Irrthum fortpflanzen muß. Dieses zweite Denkgesetz ist demnach der Anknüpfungspunkt der Logik an Das, was nicht mehr Logik, sondern Stoff des Denkens ist. Folglich besteht in der Uebereinstimmung der Begriffe, also der abstrakten Vorstellung, mit dem in der anschaulichen Vorstellung Gegebenen, nach der Seite des Objekts, die Wahrheit, und nach der Seite des Subjekts, das Wissen.
Das obige Vereint- oder Getrennt-seyn zweier Begriffssphären auszudrücken ist die Bestimmung der Kopula: »ist – ist nicht.« Durch diese ist jedes Verbum mittelst seines Particips ausdrückbar. Daher besteht alles Urtheilen im Gebrauch eines Verbi, und umgekehrt. Demnach ist die Bedeutung der Kopula, daß im Subjekt das Prädikat mitzudenken sei – nichts weiter. Jetzt erwäge man, worauf der Inhalt des Infinitivs der Kopula, »Seyn«, hinausläuft. Dieser nun aber ist ein Hauptthema der Professorenphilosophie gegenwärtiger Zeit. Indessen muß man es mit ihnen nicht so genau nehmen: die meisten nämlich wollen damit nichts Anderes, als die materiellen Dinge, die Körperwelt, bezeichnen, welcher sie, als vollkommen unschuldige Realisten, im Grund ihres Herzens, die höchste Realität beilegen. Nun aber so geradezu von den Körpern zu reden scheint ihnen zu vulgär: daher sagen sie »das Seyn«, als welches vornehmer klingt – und denken sich dabei die vor ihnen stehenden Tische und Stühle.
»Denn, weil, warum, darum, also, da, obgleich, zwar, dennoch, sondern, wenn – so, entweder – oder«, und ähnliche mehr, sind eigentlich logische Partikeln ; da ihr alleiniger Zweck ist, das Formelle der Denkprocesse auszudrücken. Sie sind daher ein kostbares Eigenthum einer Sprache und nicht allen in gleicher Anzahl eigen. Namentlich scheint zwar (das zusammengezogene »es ist wahr«) der deutschen Sprache ausschließlich anzugehören: es bezieht sich allemal auf ein folgendes, oder hinzugedachtes aber, wie wenn auf so.
Die logische Regel, daß die der Quantität nach einzelnen Urtheile, also die, welche einen Einzelbegriff (notio singularis) zum Subjekt haben, eben so zu behandeln sind, wie die allgemeinen Urtheile, beruht darauf, daß sie in der That allgemeine Urtheile sind, die bloß das Eigene haben, daß ihr Subjekt ein Begriff ist, der nur durch ein einziges reales Objekt belegt werden kann, mithin nur ein einziges unter sich begreift: so, wenn der Begriff durch einen Eigennamen bezeichnet wird. Dies kommt aber eigentlich erst in Betracht, wenn man von der abstrakten Vorstellung abgeht zur anschaulichen, also die Begriffe realisiren will. Beim Denken selbst, beim Operiren mit den Urtheilen, entsteht daraus kein Unterschied; weil eben zwischen Einzelbegriffen und Allgemeinbegriffen kein logischer Unterschied ist: »Immanuel Kant« bedeutet logisch: »alle Immanuel Kant«. Demnach ist die Quantität der Urtheile eigentlich nur zwiefach: allgemeine und partikulare. Eine einzelne Vorstellung kann gar nicht das Subjekt eines Unheils seyn; weil sie kein Abstraktum, kein Gedachtes, sondern ein Anschauliches ist: jeder Begriff hingegen ist wesentlich allgemein, und jedes Urtheil muß einen Begriff zum Subjekt haben.
Der Unterschied der besondern Urtheile (propositiones particulares) von den allgemeinen beruht oft nur auf dem äußern und zufälligen Umstande, daß die Sprache kein Wort hat, um den hier abzuzweigenden Theil des allgemeinen Begriffs, der das Subjekt eines solchen Unheils ist, für sich auszudrücken, in welchem Fall manches besondere Urtheil ein allgemeines seyn würde. Z.B. das besondere Urtheil: »einige Bäume tragen Galläpfel«, wird zum allgemeinen, weil man für diese Abzweigung des Begriffs Baum ein eigenes Wort hat: »alle Eichen tragen Galläpfel«. Eben so verhält sich das Urtheil: »einige Menschen sind schwarz«, zu dem: »alle Mohren sind schwarz«. – Oder aber jener Unterschied beruht darauf, daß im Kopfe des Urtheilenden der Begriff, welchen er zum Subjekt des besondern Unheils macht, sich nicht deutlich abgesondert hat von dem allgemeinen Begriff, als dessen Theil er ihn bezeichnet, sonst er statt dessen ein allgemeines Urtheil würde aussprechen können: z.B. statt des Urtheils: »einige Wiederkäuer haben obere Vorderzähne«, dieses: »alle ungehörnten Wiederkäuer haben obere Vorderzähne«.
Das hypothetische und das disjunktive Urtheil sind Aussagen über das Verhältniß zweier (beim disjunktiven auch mehrerer) kategorischer Urtheile zu einander. – Das hypothetische Urtheil sagt aus, daß von der Wahrheit des ersten der hier verknüpften kategorischen Urtheile die des zweiten abhängt, und von der Unwahrheit des zweiten die des ersten; also, daß diese zwei Sätze, in Hinsicht auf Wahrheit und Unwahrheit, in direkter Gemeinschaft stehn. – Das disjunktive Urtheil hingegen sagt aus, daß von der Wahrheit des einen der hier verknüpften kategorischen Urtheile die Unwahrheit der übrigen abhänge, und umgekehrt; also daß diese Sätze, in Hinsicht auf Wahrheit und Unwahrheit, in Widerstreit stehn. – Die Frage ist ein Urtheil, von dessen drei Stücken eines offen gelassen ist: also entweder die Kopula: »ist Kajus ein Römer – oder nicht?« oder das Prädikat: »ist Kajus ein Römer – oder etwas Anderes?« oder das Subjekt: »ist Kajus ein Römer – oder ist es ein Anderer?« – Die Stelle des offen gelassenen Begriffs kann auch ganz leer bleiben, z.B. was ist Kajus? – wer ist ein Römer?
Die epagôgê, inductio, bei Aristoteles, ist das Gegentheil der apagôgê. Diese weist einen Satz als falsch nach, indem sie zeigt, daß was aus ihm folgen würde, nicht wahr ist; also durch die instantia in contrarium. Die epagôgê hingegen weist die Wahrheit eines Satzes dadurch nach, daß sie zeigt, daß was aus ihm folgen würde, wahr ist. Sie treibt demnach durch Beispiele zu einer Annahme hin; die apagôgê treibt eben so von ihr ab. Mithin ist die epagôgê, oder Induktion, ein Schluß von den Folgen auf den Grund, und zwar modo ponente: denn sie stellt aus vielen Fällen die Regel auf, aus der diese dann wieder die Folgen sind. Eben deshalb ist sie nie vollkommen sicher, sondern bringt es höchstens zu sehr großer Wahrscheinlichkeit. Indessen kann diese formelle Unsicherheit, durch die Menge der aufgezählten Folgen, einer materiellen Sicherheit Raum geben; in ähnlicher Weise, wie in der Mathematik die irrationalen Verhältnisse, mittelst Decimalbrüchen, der Rationalität unendlich nahe gebracht werden. Die apagôgê hingegen ist zunächst der Schluß vom Grunde auf die Folgen, verfährt jedoch nachher modo tollente, indem sie das Nichtdaseyn einer nothwendigen Folge nachweist und dadurch die Wahrheit des angenommenen Grundes aufhebt. Eben deshalb ist sie stets vollkommen sicher und leistet durch ein einziges sicheres Beispiel in contrarium mehr, als die Induktion durch unzählige Beispiele für den aufgestellten Satz. So sehr viel leichter ist widerlegen, als beweisen, umwerfen, als aufstellen.
Kapitel 10. Zur Syllogistik
Wiewohl es sehr schwer hält, über einen seit mehr als zwei Tausend Jahren von Unzähligen behandelten Gegenstand, der überdies nicht durch Erfahrungen Zuwachs erhält, eine neue und richtige Grundansicht aufzustellen; so darf dies mich doch nicht abhalten, den hier folgenden Versuch einer solchen dem Denker zur Prüfung vorzulegen.
Ein Schluß ist die Operation unserer Vernunft, vermöge welcher aus zwei Urtheilen, durch Vergleichung derselben, ein drittes entsteht, ohne daß dabei irgend anderweitige Erkenntniß zu Hülfe genommen würde. Die Bedingung hiezu ist, daß solche zwei Urtheile einen Begriff gemein haben: denn sonst sind sie sich fremd und ohne alle Gemeinschaft. Unter dieser Bedingung aber werden sie Vater und Mutter eines Kindes, welches von Beiden etwas an sich hat. Auch ist besagte Operation kein Akt der Willkür, sondern der Vernunft, welche, der Betrachtung solcher Urtheile hingegeben, ihn von selbst, nach ihren eigenen Gesetzen, vollzieht: insofern ist er objektiv, nicht subjektiv, und daher den strengsten Regeln unterworfen.
Beiläufig fragt sich, ob der Schließende durch den neu entstandenen Satz wirklich etwas Neues erfährt, etwas ihm vorher Unbekanntes? – Nicht schlechthin; aber doch gewissermaaßen. Was er erfährt, lag in Dem, was er wußte: also wußte er es schon mit. Aber er wußte nicht, daß er es wußte, welches ist, wie wenn man etwas hat, aber nicht weiß, daß man es hat; wo es so gut ist, als hätte man es nicht. Nämlich er wußte es nur implicite, jetzt weiß er es explicite: dieser Unterschied aber kann so groß seyn, daß ihm der Schlußsatz als eine neue Wahrheit erscheint. Z.B.
Alle Diamanten sind verbrennlich:
Also sind einige Steine verbrennlich.
Das Wesen des Schlusses besteht folglich darin, daß wir uns zum deutlichen Bewußtseyn bringen, die Aussage der Konklusion schon in den Prämissen mitgedacht zu haben: er ist demnach ein Mittel, sich seiner eigenen Erkenntniß deutlicher bewußt zu werden, näher zu erfahren, oder inne zu werden, was man weiß. Die Erkenntniß, welche der Schlußsatz liefert, war latent, wirkte daher so wenig, wie latente Wärme aufs Thermometer wirkt. Wer Salz hat, hat auch Chlor; aber es ist als hätte er es nicht: denn nur wenn es chemisch entbunden ist, kann es als Chlor wirken; also erst dann besitzt er es wirklich. Eben so verhält sich der Erwerb, welchen ein bloßer Schluß aus schon bekannten Prämissen liefert: eine vorher gebundene oder latente Erkenntniß wird dadurch frei. Diese Vergleiche könnten zwar etwas übertrieben scheinen, sind es jedoch wohl nicht. Denn, weil wir viele der aus unsern Erkenntnissen möglichen Schlüsse sehr bald, sehr schnell und ohne Förmlichkeit vollziehn, weshalb auch keine deutliche Erinnerung derselben bleibt; so scheint es, daß keine Prämissen zu möglichen Schlüssen lange unbenutzt aufbewahrt blieben, sondern wir zu allen Prämissen, die im Bereich unsers Wissens liegen, auch schon die Konklusionen fertig hätten. Allein dies ist nicht immer der Fall: vielmehr können, in einem Kopfe, zwei Prämissen lange Zeit ein isolirtes Daseyn haben, bis endlich ein Anlaß sie zusammenführt, wo dann die Konklusion plötzlich hervorspringt, wie aus Stahl und Stein, erst wann sie an einander schlagen, der Funke. Wirklich liegen, sowohl zu theoretischen Einsichten, als zu Motiven, welche Entschlüsse herbeiführen, die von außen aufgenommenen Prämissen oft lange in uns und werden, zum Theil durch undeutlich bewußte, selbst wortlose Denkakte, mit unserm übrigen Vorrath von Erkenntnissen verglichen, ruminirt und gleichsam durcheinandergeschütttelt, bis endlich die rechte Major auf die rechte Minor trifft, wo diese alsbald sich gehörig stellen und nun die Konklusion mit Einem Male dasteht, als ein uns plötzlich aufgegangenes Licht, und ohne unser Zuthun, als wäre sie eine Inspiration: da begreifen wir nicht, wie wir und wie Andere Das so lange nicht erkannt haben. Freilich wird im glücklich organisirten Kopf dieser Proceß schneller und leichter vor sich gehn, als im gewöhnlichen: und eben weil er spontan, ja ohne deutliches Bewußtseyn vollzogen wird, ist er nicht zu erlernen. Daher sagt Goethe:
Weiß, der es erfunden und der es erreicht.«
Als ein Gleichniß des geschilderten Gedankenprocesses kann man jene Vorhängschlösser betrachten, die aus Ringen mit Buchstaben bestehn: am Koffer eines Reisewagens hängend werden sie so lange geschüttelt, bis endlich die Buchstaben des Wortes gehörig zusammentreffen und das Schloß aufgeht. Uebrigens aber ist dabei zu bedenken, daß der Syllogismus im Gedankengange selbst besteht, die Worte und Sätze aber, durch welche man ihn ausdrückt, bloß die nachgebliebene Spur desselben bezeichnen: sie verhalten sich zu ihm, wie die Klangfiguren aus Sand zu den Tönen, deren Vibrationen sie darstellen. Wann wir etwas überdenken wollen, rücken wir unsere Data zusammen, sie konkresciren zu Urtheilen, welche sämmtlich schnell aneinandergehalten und verglichen werden, wodurch sich augenblicklich die daraus möglichen Konklusionen, mittelst des Gebrauchs aller drei syllogistischen Figuren, absetzen; wobei jedoch, wegen der großen Schnelligkeit dieser Operationen, nur wenige, bisweilen gar keine Worte gebraucht werden und bloß die Konklusion förmlich ausgesprochen wird. So geschieht es denn auch bisweilen, daß, indem wir auf diesem Wege, oder auch auf dem bloß intuitiven, d.h. durch ein glückliches Apperçu, irgend eine neue Wahrheit uns zum Bewußtseyn gebracht haben, wir nun zu ihr, als der Konklusion, die Prämissen suchen, d.h. einen Beweis für dieselbe aufstellen möchten: denn die Erkenntnisse sind in der Regel früher da, als ihre Beweise. Wir durchwühlen alsdann den Vorrath unserer Erkenntnisse, um zu sehn, ob wir nicht darin irgend eine Wahrheit finden können, in welcher die neu entdeckte schon implicite enthalten wäre, oder zwei Sätze, durch deren regelmäßige Aneinanderfügung diese sich als Resultat ergäbe. – Hingegen liefert den förmlichsten und großartigsten Syllogismus, und zwar in der ersten Figur, jeder gerichtliche Proceß. Die Civil- oder Kriminal-Uebertretung, wegen welcher geklagt wird. Ist die Minor: sie wird vom Kläger festgestellt. Das Gesetz für solchen Fall ist die Major. Das Urtheil ist die Konklusion, welche daher, als ein Nothwendiges, vom Richter bloß »erkannt« wird.
Jetzt aber will ich versuchen, von dem eigentlichen Mechanismus des Schließens die einfachste und richtigste Darstellung zu geben.
Das Urtheilen, dieser elementare und wichtigste Proceß des Denkens, besteht im Vergleichen zweier Begriffe; das Schließen im Vergleichen zweier Urtheile. Inzwischen wird gewöhnlich, in den Lehrbüchern, das Schließen ebenfalls auf ein Vergleichen von Begriffen zurückgeführt, wiewohl von dreien; indem nämlich aus dem Verhältniß, welches zwei dieser Begriffe zum dritten haben, dasjenige, welches sie zu einander haben, erkannt würde. Dieser Ansicht läßt sich die Wahrheit auch nicht absprechen, und indem dieselbe Anlaß zu der, auch von mir im Text gelobten, anschaulichen Darstellung der syllogistischen Verhältnisse mittelst gezeichneter Begriffssphären giebt, hat sie den Vorzug, die Sache leicht faßlich zu machen. Allein mir scheint, daß hier, wie in so manchen Fällen, die Faßlichkeit auf Kosten der Gründlichkeit erreicht wird. Der eigentliche Denkproceß beim Schließen, mit welchem die drei syllogistischen Figuren und ihre Nothwendigkeit genau zusammenhängen, wird dadurch nicht erkannt. Wir operiren nämlich beim Schließen nicht mit bloßen Begriffen, sondern mit ganzen Urtheilen, denen die Qualität, die allein in der Kopula und nicht in den Begriffen liegt, wie auch die Quantität, durchaus wesentlich ist, wozu auch sogar noch die Modalität kommt. Jene Darstellung des Schlusses als eines Verhältnisses dreier Begriffe fehlt darin, daß sie die Urtheile sogleich in ihre letzten Bestandtheile (die Begriffe) auflöst, wobei das Bindungsmittel dieser verloren geht und das den Urtheilen als solchen und in ihrer Ganzheit Eigenthümliche, welches gerade die Nothwendigkeit der aus ihnen hervorgehenden Konklusion herbeiführt, aus den Augen gebracht wird. Sie verfällt hiedurch in einen Fehler, der dem analog ist, den die organische Chemie begienge, wenn sie, z.B. in der Analyse der Pflanzen, diese sogleich in ihre letzten Bestandtheile auflöste, wo sie denn bei allen Pflanzen Karbon, Hydrogen und Oxygen erhalten, aber die specifischen Unterschiede verlieren würde, welche zu gewinnen man bei den nähern Bestandtheilen, den sogenannten Alkaloiden, stehn bleiben und sich hüten muß, diese gleich wieder zu zersetzen. – Aus drei gegebenen Begriffen läßt sich noch kein Schluß ziehn. Da sagt man freilich: das Verhältniß zweier derselben zum dritten muß dabei gegeben seyn. Der Ausdruck dieses Verhältnisses sind, aber gerade die jene Begriffe verbindenden Urtheile: also sind Urtheile, nicht bloße Begriffe, der Stoff des Schlusses. Demnach ist Schließen wesentlich ein Vergleichen zweier Urtheile: mit diesen, mit den durch sie ausgedrückten Gedanken, und nicht bloß mit drei Begriffen, geht der Denkproceß in unserm Kopfe, auch wenn er unvollständig oder gar nicht durch Worte bezeichnet wird, vor sich, und als solchen, als ein Aneinanderhalten der ganzen, unzerlegten Urtheile, muß man ihn in Betrachtung nehmen, um den technischen Hergang beim Schließen eigentlich zu verstehn, woraus dann auch die Nothwendigkeit dreier, wirklich vernunftgemäßer, syllogistischer Figuren sich ergeben wird.
Wie man, bei der Darstellung der Syllogistik mittelst Begriffssphären, diese sich unter dem Bilde von Kreisen denkt; so hat man, bei der Darstellung mittelst ganzer Urtheile, sich diese unter dem Bilde von Stäben zu denken, die, zum Behuf der Vergleichung bald mit dem einen, bald mit dem andern Ende aneinandergehalten werden: die verschiedenen Weisen aber, nach denen dies geschehn kann, geben die drei Figuren. Da nun jede Prämisse ihr Subjekt und ihr Prädikat enthält; so sind diese zwei Begriffe als an den beiden Enden jedes Stabes befindlich vorzustellen. Verglichen werden jetzt die beiden Urtheile hinsichtlich der in ihnen beiden verschiedenen Begriffe: denn der dritte Begriff muß in beiden, wie schon erwähnt, der selbige seyn; daher er keiner Vergleichung unterworfen, sondern Das ist, woran, d.h. in Bezug worauf, die beiden andern verglichen werden: es ist der Medius. Dieser ist sonach immer nur das Mittel und nicht die Hauptsache. Die beiden disparaten Begriffe hingegen sind der Gegenstand des Nachdenkens, und ihr Verhältniß zu einander, mittelst der Urtheile, in denen sie enthalten sind, herauszubringen, ist der Zweck des Syllogismus: daher eben redet die Konklusion nur von ihnen, nicht aber vom Medius, als welcher ein bloßes Mittel, ein Maaßstab war, den man fallen läßt, sobald er gedient hat. Ist nun dieser in beiden Sätzen identische Begriff, also der Medius, in einer Prämisse, das Subjekt derselben; so muß der zu vergleichende Begriff ihr Prädikat seyn, und umgekehrt. Sogleich stellt sich hier a priori die Möglichkeit dreier Fälle heraus: entweder nämlich wird das Subjekt der einen Prämisse mit dem Prädikat der andern verglichen, oder aber das Subjekt der einen mit dem Subjekt der andern, oder endlich das Prädikat der einen mit dem Prädikat der andern. Hieraus entstehn die drei syllogistischen Figuren des Aristoteles: die vierte, welche, etwas naseweis, hinzugefügt worden, ist unächt und eine Afterart: man schreibt sie dem Galenus zu; jedoch beruht dies bloß auf Arabischen Auktoritäten. Jede der drei Figuren stellt einen ganz verschiedenen, richtigen und natürlichen Gedankengang der Vernunft beim Schließen dar.
Ist nämlich, in den zwei zu vergleichenden Urtheilen, das Verhältniß zwischen dem Prädikat des einen und dem Subjekt des andern der Zweck der Vergleichung; so entsteht die erste Figur. Diese allein hat den Vorzug, daß die Begriffe, welche in der Konklusion Subjekt und Prädikat sind, beide auch schon in den Prämissen in der selben Eigenschaft auftreten; während in den zwei andern Figuren stets einer von ihnen in der Konklusion seine Rolle wechseln muß. Dadurch aber hat in der ersten Figur das Resultat stets weniger Neuheit und Ueberraschendes, als in den beiden andern. Jener Vorzug der ersten Figur wird nur dadurch erreicht, daß das Prädikat der Major verglichen wird mit dem Subjekt der Minor; nicht aber umgekehrt: welches daher hier wesentlich ist und herbeiführt, daß der Medius die beiden ungleichnamigen Stellen einnimmt, d.h. in der Major Subjekt und in der Minor Prädikat ist; woraus eben wieder seine untergeordnete Bedeutung hervorgeht, indem er figurirt als ein bloßes Gewicht, welches man beliebig bald in die eine, bald in die andere Waagschaale legt. Der Gedankengang bei dieser Figur ist, daß dem Subjekt der Minor das Prädikat der Major zukommt, weil das Subjekt der Major dessen eigenes Prädikat ist; oder im negativen Fall, aus dem selben Grunde, das Umgekehrte. Hier wird also den durch einen Begriff gedachten Dingen eine Eigenschaft beigelegt, weil sie einer andern anhängt, die wir schon an ihnen kennen; oder umgekehrt. Daher ist hier das leitende Princip: nota notae est nota rei ipsius, et repugnans notae repugnat rei ipsi.
Vergleichen wir hingegen zwei Urtheile in der Absicht, das Verhältniß, welches die Subjekte beider zu einander haben mögen, herauszubringen; so müssen wir zum gemeinsamen Maaßstab das Prädikat derselben nehmen: dieses wird demnach hier der Medius und muß folglich in beiden Urtheilen das selbe seyn. Daraus entsteht die zweite Figur. Hier wird das Verhältniß zweier Subjekte zu einander bestimmt, durch dasjenige, welches sie zu einem und dem selben Prädikat haben. Dies Verhältniß kann aber nur dadurch bedeutsam werden, daß das selbe Prädikat dem einen Subjekt beigelegt, dem andern abgesprochen wird, als wodurch es zu einem wesentlichen Unterscheidungsgrunde beider wird. Denn würde es beiden Subjekten beigelegt; so könnte dies über ihr Verhältniß zu einander nicht entscheidend seyn: weil fast jedes Prädikat unzähligen Subjekten zukommt. Noch weniger würde es entscheiden, wenn man es beiden abspräche. Hieraus folgt der Grundcharakter der zweiten Figur, daß nämlich die beiden Prämissen entgegengesetzte Qualität haben müssen: die eine muß bejahen, die andere verneinen. Daher ist hier die oberste Regel: sit altera negans: deren Korollarium ist: e meris affirmativis nihil sequitur; eine Regel, gegen welche in einer losen, durch viele Zwischensätze verdeckten Argumentation bisweilen gesündigt wird. Aus dem Gesagten geht der Gedankengang, den diese Figur darstellt, deutlich hervor: es ist die Untersuchung zweier Arten von Dingen, in der Absicht sie zu unterscheiden, also festzustellen, daß sie nicht gleicher Gattung sind; welches hier dadurch entschieden wird, daß der einen Art eine Eigenschaft wesentlich ist, welche der andern fehlt. Daß dieser Gedankengang ganz von selbst die zweite Figur annimmt und nur in dieser sich scharf ausprägt, zeige ein Beispiel:
Alle Fische haben kaltes Blut;
Kein Wallfisch hat kaltes Blut:
Also ist kein Wallfisch ein Fisch.
Hingegen stellt dieser Gedanke sich in der ersten Figur matt, gezwungen und zuletzt ausgeflickt dar:
Keines, was kaltes Blut hat, ist ein Wallfisch;
Alle Fische haben kaltes Blut:
Also ist kein Fisch ein Wallfisch
Und folglich kein Wallfisch ein Fisch. –
Auch ein Beispiel mit bejahender Minor:
Kein Mohammedaner ist ein Jude;
Einige Türken sind Juden:
Also sind einige Türken keine Mohammedaner.
Als das leitende Princip für diese Figur stelle ich demnach auf: für die Modi mit verneinender Minor: cui repugnat nota, etiam repugnat notatum: und für die mit bejahender Minor: notato repugnat id cui nota repugnat. Deutsch läßt es sich so zusammenfassen: zwei Subjekte, die zu einem Prädikat in entgegengesetztem Verhältnisse stehn, haben zu einander ein negatives.
Der dritte Fall ist der, daß es die Prädikate zweier Urtheile sind, deren Verhältniß zu erforschen wir die Urtheile zusammenstellen: hieraus entsteht die dritte Figur, in welcher demgemäß der Medius in beiden Prämissen als Subjekt auftritt. Er ist auch hier das tertium comparationis, der Maaßstab, der an beide zu untersuchende Begriffe gelegt wird, oder gleichsam ein chemisches Reagens, an welchem man beide prüft, um aus ihrem Verhältniß zu ihm, das zu erfahren, welches zwischen ihnen selbst Statt findet: demzufolge sagt dann die Konklusion aus, ob zwischen ihnen beiden ein Verhältniß von Subjekt und Prädikat vorhanden ist und wie weit sich dieses erstreckt. Demnach stellt in dieser Figur sich das Nachdenken über zwei Eigenschaften dar, welche man entweder für unvereinbar, oder aber für unzertrennlich zu halten geneigt ist und, um dieses zu entscheiden, sie in zwei Urtheilen zu Prädikaten eines und des selben Subjekts zu machen versucht. Hiedurch ergiebt sich nun, entweder daß beide Eigenschaften einem und dem selben Dinge zukommen, folglich ihre Vereinbarkeit, oder aber, daß ein Ding zwar die eine, jedoch nicht die andere hat, folglich ihre Trennbarkeit: Ersteres in allen Modis mit zwei affirmirenden, Letzteres in allen mit einer negirenden Prämisse: z.B.
Einige Thiere können sprechen;
Alle Thiere sind unvernünftig:
Also können einige Unvernünftige sprechen.
Nach Kant (Die falsche Spitzfindigkeit, § 4) würde nun dieser Schluß nur dadurch konklusiv seyn, daß wir in Gedanken hinzufügten: »also einige Unvernünftige sind Thiere«. Dies scheint hier aber durchaus überflüssig und keineswegs der natürliche Gedankengang zu seyn. Um aber den selben Gedankenproceß direkt mittelst der ersten Figur zu vollziehn, müßte ich sagen:
»Alle Thiere sind unvernünftig;
Einige Sprechenkönnende sind Thiere«,
welches offenbar nicht der natürliche Gedankengang ist: ja, die alsdann sich ergebende Konklusion »einige Sprechenkönnende sind unvernünftig« müßte umgekehrt werden, um den Schlußsatz zu erhalten, den die dritte Figur von selbst ergiebt und auf welchen der ganze Gedankengang es abgesehn hat. – Nehmen wir noch ein Beispiel:
Alle Alkalimetalle schwimmen auf dem Wasser;
Alle Alkalimetalle sind Metalle:
Also einige Metalle schwimmen auf dem Wasser.
Bei der Versetzung in die erste Figur muß die Minor umgekehrt werden, lautet also: »einige Metalle sind Alkalimetalle«: sie besagt mithin nur, daß einige Metalle in der Sphäre »Alkalimetalle« liegen, so:
während unsere wirkliche Erkenntniß ist, daß alle Alkalimetalle in der Sphäre »Metalle« liegen, so:
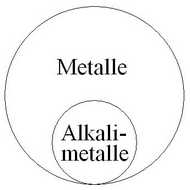
Folglich müßten wir, wenn die erste Figur die allein normale seyn soll, um naturgemäß zu denken, weniger denken, als wir wissen, und unbestimmt denken, während wir bestimmt wissen. Diese Annahme hat zu viel gegen sich. Ueberhaupt also ist zu leugnen, daß wir, beim Schließen in der zweiten und dritten Figur, im Stillen einen Satz umkehren. Vielmehr stellt die dritte und auch die zweite Figur einen eben so vernunftgemäßen Gedankenproceß dar, wie die erste. Betrachten wir jetzt noch ein Beispiel der andern Art der dritten Figur, wo die Trennbarkeit der beiden Prädikate das Ergebniß ist; weshalb hier eine Prämisse negirend seyn muß:
Kein Buddhaist glaubt einen Gott;
Einige Buddhaisten sind vernünftig:
Also glauben einige Vernünftige keinen Gott.
Wie in den obigen Beispielen die Vereinbarkeit, so ist jetzt die Trennbarkeit zweier Eigenschaften das Problem der Reflexion, welches auch hier dadurch entschieden wird, daß man sie an einem Subjekt vergleicht und an diesem die eine ohne die andere nachweist: dadurch erreicht man seinen Zweck unmittelbar, während man ihn durch die erste Figur nur mittelbar erreichen könnte. Denn um den Schluß auf diese zu reduciren, müßte man die Minor umkehren, mithin sagen: »Einige Vernünftige sind Buddhaisten«, welches nur ein verfehlter Ausdruck des Sinnes derselben wäre, als welcher besagt: »Einige Buddhaisten sind denn doch wohl vernünftig.«
Als das leitende Princip dieser Figur stelle ich demnach auf: für die bejahenden Modi: ejusdem rei notae, modo sit altera universalis, sibi invicem sunt notae particulares: und für die verneinenden Modi: nota rei competens, notae eidem repugnanti, particulariter, repugnat, modo sit altera universalis. Zu deutsch: Werden von einem Subjekte zwei Prädikate bejaht, und zwar wenigstens eines allgemein, so werden sie auch von einander partikulär bejaht; hingegen partikulär verneint, sobald eines derselben dem Subjekt widerspricht, von dem das andere bejaht wird: nur muß Jenes oder Dieses allgemein geschehn.
In der vierten Figur soll nun das Subjekt der Major mit dem Prädikat der Minor verglichen werden: allein in der Konklusion müsse Beide ihren Werth und ihre Stelle wieder vertauschen, so daß als Prädikat auftritt, was in der Major Subjekt war und als Subjekt, was in der Minor Prädikat war. Hieran wird sichtbar, daß diese Figur bloß die muthwillig auf den Kopf gestellte erste, keineswegs aber der Ausdruck eines wirklichen und der Vernunft natürlichen Gedankenganges ist.
Hingegen sind die drei ersten Figuren der Ektypos dreier wirklicher und wesentlich verschiedener Denkoperationen. Diese haben das Gemeinsame, daß sie in der Vergleichung zweier Urtheile bestehn; aber eine solche wird nur dann fruchtbar, wann sie einen Begriff gemeinschaftlich haben. Diesen können wir, wenn wir uns die Prämissen unter dem Bilde zweier Stäbe versinnlichen, als einen Haken denken, der sie mit einander verbindet: ja, man könnte, beim Vortrage, sich solcher Stäbe bedienen. Die drei Figuren unterscheiden sich hingegen dadurch, daß jene Urtheile verglichen werden entweder hinsichtlich ihrer beiden Subjekte, oder aber ihrer beiden Prädikate, oder endlich hinsichtlich des Subjekts des einen und des Prädikats des andern. Da nun jeder Begriff bloß sofern er bereits Theil eines Urtheils ist die Eigenschaft hat, Subjekt oder Prädikat zu seyn; so bestätigt dies meine Ansicht, daß im Syllogismus zunächst nur Urtheile verglichen werden, Begriffe aber bloß sofern sie Theile von Urtheilen sind. Beim Vergleich zweier Urtheile kommt es aber wesentlich darauf an, in Hinsicht auf was man sie vergleicht, nicht aber darauf, wodurch man sie vergleicht: jenes sind die disparaten Begriffe derselben, Letzteres der Medius, d.h. der in beiden identische Begriff. Es ist daher nicht der rechte Gesichtspunkt, den Lambert, ja eigentlich schon Aristoteles und fast alle Neueren genommen haben, bei der Analyse der Schlüsse vom Medius auszugehn, ihn zur Hauptsache und seine Stellung zum wesentlichen Charakter der Schlüsse zu machen. Vielmehr ist seine Rolle nur eine sekundäre und seine Stellung eine Folge des logischen Werthes der im Syllogismus eigentlich zu vergleichenden Begriffe. Diese sind zweien Substanzen, die chemisch zu prüfen wären, zu vergleichen, der Medius aber dem Reagens, an welchem sie geprüft werden. Er nimmt daher allemal die Stelle ein, welche die zu vergleichenden Begriffe leer lassen, und kommt in der Konklusion nicht mehr vor. Er wird gewählt je nachdem sein Verhältniß zu beiden Begriffen bekannt ist und er sich zu der einzunehmenden Stelle eignet: daher kann man ihn in vielen Fällen auch beliebig gegen einen andern vertauschen, ohne daß es den Syllogismus afficirt: z.B. in dem Schluß:
Kajus ist ein Mensch:
kann ich den Medius »Mensch« vertauschen mit »animalische Wesen«. In dem Schluß:
Alle Diamanten sind Steine;
Alle Diamanten sind brennbar:
kann ich den Medius »Diamant« vertauschen mit »Anthracit«. Als äußeres Merkmal, daran man sogleich die Figur eines Schlusses erkennt, ist allerdings der Medius sehr brauchbar. Aber zum Grundcharakter einer zu erklärenden Sache muß man ihr Wesentliches nehmen: dieses ist hier aber, ob man zwei Sätze zusammenstellt, um ihre Prädikate, oder ihre Subjekte, oder das Prädikat des einen und das Subjekt des andern zu vergleichen.
Also um als Prämissen eine Konklusion zu erzeugen, müssen zwei Urtheile einen gemeinschaftlichen Begriff haben, ferner nicht beide verneinend, auch nicht beide partikular seyn, endlich im Fall die beiden in ihnen zu vergleichenden Begriffe ihre Subjekte sind, dürfen sie auch nicht beide bejahend seyn.
Als ein Sinnbild des Syllogismus kann man die Voltaische Säule betrachten: ihr Indifferenzpunkt in der Mitte stellt den Medius vor, der das Zusammenhaltende der beiden Prämissen ist, vermöge dessen sie Schlußkraft haben: die beiden disparaten Begriffe hingegen, welche eigentlich das zu Vergleichende sind, werden durch die beiden heterogenen Pole der Säule dargestellt: erst indem diese, mittelst ihrer beiden Leitungsdrähte, welche die Kopula der beiden Urtheile versinnlichen, zusammengebracht werden, springt bei ihrer Berührung der Funke, – das neue Licht der Konklusion hervor.
Kapitel 11. Zur Rhetorik
Beredsamkeit ist die Fähigkeit, unsere Ansicht einer Sache, oder unsere Gesinnung hinsichtlich derselben, auch in Andern zu erregen, unser Gefühl darüber in ihnen zu entzünden und sie so in Sympathie mit uns zu versetzen; dies Alles aber dadurch, daß wir, mittelst Worten, den Strohm unserer Gedanken in ihren Kopf leiten, mit solcher Gewalt, daß er den ihrer eigenen von dem Gange, den sie bereits genommen, ablenkt und in seinen Lauf mit fortreißt. Dies Meisterstück wird um so größer seyn, je mehr der Gang ihrer Gedanken vorher von dem unserigen abwich. Hieraus wird leicht begreiflich, warum die eigene Ueberzeugung und die Leidenschaft beredt macht, und überhaupt Beredsamkeit mehr Gabe der Natur, als Werk der Kunst ist: doch wird auch hier die Kunst die Natur unterstützen.
Um einen Andern von einer Wahrheit, die gegen einen von ihm festgehaltenen Irrthum streitet, zu überzeugen, ist die erste zu befolgende Regel eine leichte und natürliche: man lasse die Prämissen vorangehn, die Konklusion aber folgen. Dennoch wird diese Regel selten beobachtet, sondern umgekehrt verfahren; weil Eifer, Hastigkeit und Rechthaberei uns treiben, die Konklusion, laut und gellend, dem am entgegengesetzten Irrthum Hängenden entgegen zu schreien. Dies macht ihn leicht kopfscheu, und nun stemmt er seinen Willen gegen alle Gründe und Prämissen, von denen er schon weiß, zu welcher Konklusion sie führen. Daher soll man vielmehr die Konklusion völlig verdeckt halten und allein die Prämissen geben, deutlich, vollständig, allseitig. Wo möglich spreche man sogar die Konklusion gar nicht aus: sie wird sich in der Vernunft der Hörer nothwendig und gesetzmäßig von selbst einfinden, und die so in ihnen selbst geborene Ueberzeugung wird um so aufrichtiger, zudem von Selbstgefühl, statt von Beschämung, begleitet seyn. In schwierigen Fällen kann man sogar die Miene machen, zu einer ganz entgegengesetzten Konklusion, als die man wirklich beabsichtigt, gelangen zu wollen. Ein Muster dieser Art ist die berühmte Rede des Antonius im »Julius Cäsar« von Shakespeare.
Beim Vertheidigen einer Sache versehn Viele es darin, daß sie alles Ersinnliche, was sich dafür sagen läßt, getrost vorbringen, Wahres, Halbwahres und bloß Scheinbares durcheinander. Aber das Falsche wird bald erkannt, oder doch gefühlt, und verdächtigt nun auch das mit ihm zusammen vorgetragene Triftige und Wahre: man gebe also dieses rein und allein, und hüte sich, eine Wahrheit mit unzulänglichen und daher, sofern sie als zulänglich aufgestellt werden, sophistischen Gründen zu vertheidigen: denn der Gegner stößt diese um und gewinnt dadurch den Schein, auch die darauf gestützte Wahrheit selbst umgestoßen zu haben: d.h. er macht argumenta ad hominem als argumenta ad rem geltend. Zu weit, auf der andern Seite, gehn vielleicht die Chinesen, indem sie folgenden Spruch haben: »Wer beredt ist und eine scharfe Zunge hat, mag immer die Hälfte eines Satzes unausgesprochen lassen; und wer das Recht auf seiner Seite hat, kann drei Zehntel seiner Behauptung getrost nachgeben.«
Kapitel 12. Zur Wissenschaftslehre
Aus der in sämmtlichen vorhergegangenen Kapiteln gegebenen Analyse der verschiedenen Funktionen unsers Intellekts erhellt, daß zu einem regelrechten Gebrauch desselben, sei es in theoretischer oder in praktischer Absicht, Folgendes erforderlich ist: 1) die richtige anschauende Auffassung der in Betracht genommenen realen Dinge und aller ihrer wesentlichen Eigenschaften und Verhältnisse, also aller Data. 2) Die Bildung richtiger Begriffe aus diesen, also die Zusammenfassung jener Eigenschaften unter richtige Abstrakta, welche jetzt das Material des nachfolgenden Denkens werden. 3) Die Vergleichung dieser Begriffe, theils mit dem Angeschauten, theils unter sich, theils mit dem übrigen Vorrath von Begriffen; so daß richtige, zur Sache gehörige und diese vollständig befassende und erschöpfende Urtheile daraus hervorgehn: also richtige Beurtheilung der Sache. 4) Die Zusammenstellung, oder Kombination dieser Urtheile zu Prämissen von Schlüssen: diese kann nach Wahl und Anordnung der Urtheile sehr verschieden ausfallen und doch ist das eigentliche Resultat der ganzen Operation zunächst von ihr abhängig. Es kommt hiebei darauf an, daß, aus so vielen möglichen Kombinationen jener verschiedenen zur Sache gehörigen Urtheile, die freie Ueberlegung gerade die zweckdienlichen und entscheidenden treffe. – Ist aber bei der ersten Funktion, also bei der anschauenden Auffassung der Dinge und Verhältnisse, irgend ein wesentlicher Punkt übersehn worden; so kann die Richtigkeit aller nachfolgenden Operationen des Geistes doch nicht verhindern, daß das Resultat falsch ausfalle: denn dort liegen die Data, der Stoff der ganzen Untersuchung. Ohne die Gewißheit, daß diese richtig und vollständig beisammen seien, soll man sich, in wichtigen Dingen, jeder definitiven Entscheidung enthalten. –
Ein Begriff ist richtig; ein Unheil wahr; ein Körper real; ein Verhältniß evident.- Ein Satz von unmittelbarer Gewißheit ist ein Axiom. Nur die Grundsätze der Logik und die aus der Anschauung a priori geschöpften der Mathematik, endlich auch das Gesetz der Kausalität, haben unmittelbare Gewißheit. – Ein Satz von mittelbarer Gewißheit ist ein Lehrsatz, und das dieselbe Vermittelnde ist der Beweis. – Wird einem Satz, der keine unmittelbare Gewißheit hat, eine solche beigelegt; so ist er eine petitio principii. – Ein Satz, der sich unmittelbar auf die empirische Anschauung beruft, ist eine Assertion: seine Konfrontation mit derselben verlangt Urtheilskraft. – Die empirische Anschauung kann zunächst nur einzelne, nicht aber allgemeine Wahrheiten begründen: durch vielfache Wiederholung und Bestätigung erhalten solche zwar auch Allgemeinheit, jedoch nur eine komparative und prekäre, weil sie immer noch der Anfechtung offen steht. – Hat aber ein Satz absolute Allgemeingültigkeit; so ist die Anschauung, auf die er sich beruft, keine empirische, sondern a priori. Vollkommen sichere Wissenschaften sind demnach allein Logik und Mathematik: sie lehren uns aber auch eigentlich nur, was wir schon vorher wußten. Denn sie sind bloße Verdeutlichungen des uns a priori Bewußten, nämlich der Formen unsers eigenen Erkennens, die eine der des denkenden, die andere der des anschauenden. Wir spinnen sie daher ganz aus uns selbst heraus. Alles andere Wissen ist empirisch.
Ein Beweis beweist zu viel, wenn er sich auf Dinge oder Fälle erstreckt, von denen das zu Beweisende offenbar nicht gilt, daher er durch diese apagogisch widerlegt wird. – Die Deductio ad absurdum besteht eigentlich darin, daß man, die aufgestellte falsche Behauptung zum Obersatze nehmend und eine richtige Minor hinzufügend, eine Konklusio erhält, welche erfahrungsmäßigen Thatsachen oder unbezweifelbaren Wahrheiten widerspricht. Auf einem Umwege aber muß eine solche für jede falsche Lehre möglich seyn; sofern der Verfechter dieser doch wohl irgend eine Wahrheit erkennt und zugiebt: denn alsdann müssen die Folgerungen aus dieser und andererseits die aus der falschen Behauptung sich so weit fortführen lassen, bis zwei Sätze sich ergeben, die einander geradezu widersprechen. Von diesem schönen Kunstgriff achter Dialektik finden wir im Plato viele Beispiele.
Eine richtige Hypothese ist nichts weiter, als der wahre und vollständige Ausdruck der vorliegenden Thatsache, welche der Urheber derselben in ihrem eigentlichen Wesen und innern Zusammenhang intuitiv aufgefaßt hatte. Denn sie sagt uns nur, was hier eigentlich vorgeht.
Den Gegensatz der analytischen und synthetischen Methode finden wir schon beim Aristoteles angedeutet, deutlich beschrieben jedoch vielleicht zuerst beim Proklos, als welcher ganz richtig sagt: Methodoi de paradidontai kallistê men hê dia tês analyseôs ep' archên homologoumenên anagousa to zêtoumenon; hên kai Platôn, hôs phasi, Laodamanti paredôken. k. t. l. (Methodi traduntur sequentes: pulcherrima quidem ea, quae per analysin quaesitum refert ad principium, de quo jam convenit; quam etiam Plato Laodamanti tradidisse dicitur.) In primum Euclidis librum, L. III. Allerdings besteht die analytische Methode im Zurückführen des Gegebenen auf ein zugestandenes Princip; die synthetische hingegen in dem Ableiten aus einem solchen. Sie haben daher Analogie mit der, Kapitel 9 erörterten epagôgê und apagogê; nur daß letztere nicht auf das Begründen, sondern stets auf das Umstoßen von Sätzen gerichtet ist. Die analytische Methode geht von den Thatsachen, dem Besondern, zu den Lehrsätzen, dem Allgemeinen, oder von den Folgen zu den Gründen; die andere umgekehrt. Daher wäre es viel richtiger, sie als die induktive und die deduktive Methode zu bezeichnen: denn die hergebrachten Namen sind unpassend und drücken die Sache schlecht aus.
Wollte ein Philosoph damit anfangen, die Methode, nach der er philosophiren will, sich auszudenken; so gliche er einem Dichter, der zuerst sich eine Aesthetik schriebe, um sodann nach dieser zu dichten: Beide aber glichen einem Menschen, der zuerst sich ein Lied sänge und hinterher danach tanzte. Der denkende Geist muß seinen Weg aus ursprünglichem Triebe finden: Regel und Anwendung, Methode und Leistung müssen, wie Materie und Form, unzertrennlich auftreten. Aber nachdem man angelangt ist, mag man den zurückgelegten Weg betrachten. Aesthetik und Methodologie sind, ihrer Natur nach, jünger als Poesie und Philosophie; wie die Grammatik jünger ist als die Sprache, der Generalbaß jünger als die Musik, die Logik jünger als das Denken.
Hier finde beiläufig eine Bemerkung ihre Stelle, durch die ich einem einreißenden Verderb, solange es noch Zeit ist, Einhalt thun möchte. – Daß das Lateinische aufgehört hat, die Sprache aller wissenschaftlichen Untersuchungen zu seyn, hat den Nachtheil, daß es nicht mehr eine unmittelbar gemeinsame wissenschaftliche Litteratur für ganz Europa giebt, sondern Nationallitteraturen; wodurch dann jeder Gelehrte zunächst auf ein viel kleineres, zudem in nationalen Einseitigkeiten und Vorurtheilen befangenes Publikum beschränkt ist. Sodann muß er jetzt die vier Europäischen Hauptsprachen, neben den beiden alten, erlernen. Hiebei nun wird es ihm eine große Erleichterung seyn, daß die termini technici aller Wissenschaften (mit Ausnahme der Mineralogie), als ein Erbtheil von unsern Vorgängern, Lateinisch oder Griechisch sind. Daher auch alle Nationen diese weislich beibehalten. Nur die Deutschen sind auf den unglücklichen Einfall gerathen, die termini technici aller Wissenschaften verdeutschen zu wollen. Dies hat zwei große Nachtheile. Erstlich wird der fremde und auch der deutsche Gelehrte genöthigt, alle Kunstausdrücke seiner Wissenschaft zwei Mal zu erlernen, welches, wo deren viele sind, z.B. in der Anatomie, unglaublich mühsam und weitläuftig ist. Wären die andern Nationen nicht, in diesem Stücke, klüger als die Deutschen; so hätten wir die Mühe, jeden terminus technicus fünf Mal zu erlernen. Fahren die Deutschen damit fort; so werden die auswärtigen Gelehrten die, überdies meistens viel zu ausführlichen, dazu in einem nachlässigen, schlechten, oft auch noch affektirten und geschmackwidrigen Stile, häufig auch mit einer unartigen Rücksichtslosigkeit gegen den Leser und dessen Bedürfnisse abgefaßten Bücher derselben vollends ungelesen lassen. – Zweitens sind jene Verdeutschungen der termini technici fast durchgängig lange, zusammengeflickte, ungeschickt gewählte, schleppende, dumpftönende, sich von der übrigen Sprache nicht scharf absondernde Worte, welche daher sich dem Gedächtniß schwer einprägen; während die von den alten, unvergeßlichen Urhebern der Wissenschaften gewählten Griechischen und Lateinischen Ausdrücke die sämmtlichen entgegengesetzten guten Eigenschaften haben und durch ihren sonoren Klang sich leicht einprägen. Was für ein häßliches, kakophonisches Wort ist nicht schon »Stickstoff « statt Azot! »Verbum, Substantiv, Adjektiv«, behält und unterscheidet sich doch leichter, als Zeitwort, Nennwort, Beiwort, oder gar »Umstandswort« statt Adverbium. Ganz unausstehlich und dazu noch gemein und barbiergesellenhaft ist es in der Anatomie. Schon »Pulsader und Blutader« sind der augenblicklichen Verwechselung leichter ausgesetzt, als Arterie und Vene; aber vollends verwirrend sind Ausdrücke wie »Fruchthälter, Fruchtgang und Fruchtleiter« statt uterus, vagina und tuba Faloppii, die doch jeder Arzt kennen muß und mit denen er in allen Europäischen Sprachen ausreicht; desgleichen »Speiche und Ellenbogenröhre« statt radius und ulna, die ganz Europa seit Jahrtausenden versteht: wozu alle jene ungeschickte, verwirrende, schleppende, ja abgeschmackte Verdeutschung? Nicht weniger widerlich ist die Uebersetzung der Kunstausdrücke in der Logik, wo denn unsere genialen Philosophieprofessoren die Schöpfer einer neuen Terminologie sind und fast Jeder seine eigene hat: bei G. E. Schulze z.B. heißt das Subjekt »Grundbegriff«, das Prädikat »Beilegungsbegriff«: da giebt es »Beilegungsschlüsse, Voraussetzungsschlüsse und Entgegensetzungsschlüsse«, die Urtheile haben »Größe, Beschaffenheit, Verhältniß und Zuverlässigkeit« d.h. Quantität, Qualität, Relation und Modalität. Die selbe widerwärtige Wirkung jener Deutschthümelei wird man in allen Wissenschaften finden. – Die Lateinischen und Griechischen Ausdrücke haben zudem noch den Vorzug, daß sie den wissenschaftlichen Begriff als einen solchen stämpeln und ihn aussondern aus den Worten des gemeinen Verkehrs und den diesen anklebenden Ideenassociationen; während z.B. »Speisebrei«, statt Chymus, von der Kost kleiner Kinder zu reden, und »Lungensack«, statt pleura, nebst »Herzbeutel«, statt pericardium, eher von Metzgern als von Anatomen herzurühren scheint. Endlich hängt an den antiken terminis technicis die unmittelbarste Nothwendigkeit der Erlernung der alten Sprachen, welche durch den Gebrauch der lebenden zu gelehrten Untersuchungen mehr und mehr in Gefahr geräth, beseitigt zu werden. Kommt es aber dahin, verschwindet der an die Sprachen gebundene Geist der Alten aus dem gelehrten Unterricht; dann wird Rohheit, Plattheit und Gemeinheit sich der ganzen Litteratur bemächtigen. Denn die Werke der Alten sind der Nordstern für jedes künstlerische oder litterarische Streben: geht der euch unter; so seid ihr verloren. Schon jetzt merkt man an dem jämmerlichen und läppischen Stil der meisten Schreiber, daß sie nie Latein geschrieben habenA3. Sehr passend nennt man die Beschäftigung mit den Schriftstellern des Alterthums Humanitätsstudien: denn durch sie wird der Schüler zuvörderst wieder ein Mensch, indem er eintritt in die Welt, die noch rein war von allen Fratzen des Mittelalters und der Romantik, welche nachher in die Europäische Menschheit so tief eindrangen, daß auch noch jetzt Jeder damit betüncht zur Welt kommt und sie erst abzustreifen hat, um nur zuvörderst wieder ein Mensch zu werden. Denkt nicht, daß eure moderne Weisheit jene Weihe zum Menschen je ersetzen könne: ihr seid nicht, wie Griechen und Römer, geborene Freie, unbefangene Söhne der Natur. Ihr seid zunächst die Söhne und Erben des rohen Mittelalters und seines Unsinns, des schändlichen Pfaffentrugs und des halb brutalen, halb geckenhaften Ritterwesens. Geht es gleich mit Beiden jetzt allgemach zu Ende, so könnt ihr darum doch noch nicht auf eigenen Füßen stehn. Ohne die Schule der Alten wird eure Litteratur in gemeines Geschwätze und platte Philisterei ausarten. – Aus allen diesen Gründen also ist es mein wohlgemeinter Rath, daß man der oben gerügten Deutschmichelei ungesäumt ein Ende mache.
Ferner will ich hier die Gelegenheit nehmen, das Unwesen zu rügen, welches seit einigen Jahren, auf unerhörte Weise, mit der deutschen Rechtschreibung getrieben wird. Die Skribler, in jeder Gattung, haben nämlich so etwas vernommen von Kürze des Ausdrucks, wissen jedoch nicht, daß diese besteht in sorgfältigem Weglassen alles Ueberflüssigen, wozu denn freilich ihre ganze Schreiberei gehört; sondern vermeinen es dadurch zu erzwingen, daß sie die Worte beschneiden, wie die Gauner die Münzen, und jede Silbe, die ihnen überflüssig scheint, weil sie den Werth derselben nicht fühlen, ohne Weiteres abknappen. Z.B. unsere Vorfahren haben, mit richtigem Takt, »Beweis« und »Verweis«, hingegen »Nachweisung« gesagt: der feine Unterschied, analog dem zwischen »Versuch« und »Versuchung«, »Betracht« und »Betrachtung«, ist den dicken Ohren und dicken Schädeln nicht fühlbar; daher sie das Wort »Nachweis« erfunden haben, welches sogleich in allgemeinen Gebrauch gekommen ist: denn dazu gehört nur, daß ein Einfall recht plump und ein Schnitzer recht grob sei. Demgemäß ist die gleiche Amputation bereits an unzähligen Worten vorgenommen worden: z.B. statt »Untersuchung« schreibt man »Untersuch«, ja, gar statt »allmälig, mälig«, statt »beinahe, nahe«, statt »beständig, ständig«. Unterfienge sich ein Franzose près statt presque, ein Engländer most statt almost zu schreiben; so würde er einstimmig als ein Narr verlacht werden: in Deutschland aber gilt man durch so etwas für einen originellen Kopf. Chemiker schreiben bereits »löslich und unlöslich« statt »unauflöslich« und werden damit, wenn ihnen nicht die Grammatiker auf die Finger schlagen, die Sprache um ein werthvolles Wort bestehlen: löslich sind Knoten, Schuhriemen, auch Konglomerate, deren Cäment erweicht wird, und alles diesem Analoge: auflöslich hingegen ist was in einer Flüssigkeit ganz verschwindet, wie Salz im Wasser. »Auflösen« ist der terminus ad hoc, welcher Dies und nichts Anderes besagt, einen bestimmten Begriff aussondernd: den aber wollen unsere scharfsinnigen Sprachverbesserer in die allgemeine Spülwanne »Losen« gießen: konsequenter Weise müßten sie dann auch statt »ablösen (von Wachen), auslösen, einlösen« u.s.w. überall »lösen« setzen, und in diesem, wie in jenem Fall der Sprache die Bestimmtheit des Ausdrucks benehmen. Aber die Sprache um ein Wort ärmer machen heißt das Denken der Nation um einen Begriff ärmer machen. Dahin aber tendiren die vereinten Bemühungen fast aller unserer Bücherschreiber seit zehn bis zwanzig Jahren: denn was ich hier an einem Beispiele gezeigt habe, ließe sich an hundert andern nachweisen, und die niederträchtigste Silbenknickerei grassirt wie eine Seuche. Die Elenden zählen wahrhaftig die Buchstaben und nehmen keinen Anstand, ein Wort zu verkrüppeln, oder eines in falschem Sinne zu gebrauchen, sobald nur zwei Buchstaben dabei zu lukriren sind. Wer keiner neuen Gedanken fähig ist, will wenigstens neue Worte zu Markte bringen, und jeder Tintenklexer hält sich berufen, die Sprache zu verbessern. Am unverschämtesten treiben es die Zeitungsschreiber, und da ihre Blätter, vermöge der Trivialität ihres Inhalts, das allergrößte Publikum, ja ein solches haben, das größtentheils nichts Anderes liest; so droht durch sie der Sprache große Gefahr; daher ich ernstlich anrathe, sie einer orthographischen Censur zu unterwerfen, oder sie für jedes ungebräuchliche, oder verstümmelte Wort eine Strafe bezahlen zu lassen: denn was könnte unwürdiger seyn, als daß Sprachumwandelungen vom allerniedrigsten Zweig der Litteratur ausgiengen? Die Sprache, zumal eine relative Ursprache, wie die Deutsche, ist das köstlichste Erbtheil der Nation und dabei ein überaus komplicirtes, leicht zu verderbendes und nicht wieder herzustellendes Kunstwerk, daher ein noli me tangere. Andere Völker haben dies gefühlt und haben gegen ihre, obwohl viel unvollkommneren Sprachen große Pietät bewiesen: daher ist Dante's und Petrarka's Sprache nur in Kleinigkeiten von der heutigen verschieden, Montaigne noch ganz lesbar, und so auch Shakespeare in seinen ältesten Ausgaben. – Dem Deutschen ist es sogar gut, etwas lange Worte im Munde zu haben: denn er denkt langsam und sie geben ihm Zeit zum besinnen. Aber jene eingerissene Sprachökonomie zeigt sich in noch mehreren charakteristischen Phänomenen: sie setzen z.B., gegen alle Logik und Grammatik, das Imperfektum statt des Perfektums und Plusquamperfektums; sie stechen oft das Auxiliarverbum in die Tasche; sie brauchen den Ablativ statt des Genitivs; sie machen, um ein Paar logische Partikeln zu lukriren, so verflochtene Perioden, daß man sie vier Mal lesen muß, um hinter den Sinn zu kommen: denn bloß das Papier, nicht die Zeit des Lesers wollen sie sparen: bei Eigennamen deuten sie, ganz hottentottisch, den Kasus weder durch Flexion, noch Artikel an: der Leser mag ihn rathen. Besonders gern aber eskrokiren sie die doppelten Vokale und das tonverlängernde h, diese der Prosodie geweihten Buchstäben; welches Verfahren gerade so ist, wie wenn man aus dem Griechischen das h und o verbannen und statt ihrer e und o setzen wollte. Wer nun Scham, Märchen, Maß, Spaß schreibt, sollte auch Lon, Son, Stat, Sat, Jar, Al u.s.w. schreiben. Die Nachkommen aber werden, da ja die Schrift das Abbild der Rede ist, vermeinen, daß man auszusprechen hat, wie man schreibt: wonach dann von der Deutschen Sprache nur ein gekniffenes, spitzmäuliges, dumpfes Konsonantengeräusch übrig bleiben und alle Prosodie verloren gehn wird. Sehr beliebt ist auch, wegen Ersparniß eines Buchstabens, die Schreibart »Literatur« statt der richtigen »Litteratur«. Zu ihrer Vertheidigung wird das Particip des Verbums linere für den Ursprung des Wortes ausgegeben. Linere heißt aber schmieren: daher möchte für den größten Theil der Deutschen Buchmacherei die beliebte Schreibart wirklich die richtige seyn, so daß man eine sehr kleine Litteratur und eine sehr ausgedehnte Literatur unterscheiden könnte. – Um kurz zu schreiben, veredele man seinen Stil und vermeide alles unnütze Gewäsche und Gekaue: da braucht man nicht, des theuren Papiers halber, Silben und Buchstaben zu eskrokiren. Aber so viele unnütze Seiten, unnütze Bogen, unnütze Bücher zu schreiben, und dann diese Zeit- und Papiervergeudung an den unschuldigen Silben und Buchstaben wieder einbringen zu wollen, – das ist wahrlich der Superlativ Dessen, was man auf Englisch pennywise and poundfoolish nennt. – Zu beklagen ist es, daß keine Deutsche Akademie daist, dem litterarischen Sanskülottismus gegenüber die Sprache in ihren Schutz zu nehmen, zumal in einer Zeit, wo auch die der alten Sprachen Unkundigen es wagen dürfen, die Presse zu beschäftigen. Ueber den ganzen, heut zu Tage mit der Deutschen Sprache getriebenen, unverzeihlichen Unfug habe ich mich des Weiteren ausgelassen in meinen Parergis, Bd. II, Kap. 23. –
Von der bereits in meiner Abhandlung »Ueber den Satz vom Grunde«, § 51, vorgeschlagenen und auch hier, § 7 und 15 des ersten Bandes, wieder berührten, obersten Eintheilung der Wissenschaften, nach der in ihnen vorherrschenden Gestalt des Satzes vom Grunde, will ich eine kleine Probe hiehersetzen, die jedoch ohne Zweifel mancher Verbesserung und Vervollständigung fähig seyn wird.
I. Reine Wissenschaften a priori.
1. Die Lehre vom Grunde des Seyns.
a) im Raum: Geometrie.
b) in der Zeit: Arithmetik und Algebra.
2. Die Lehre vom Grunde des Erkennens: Logik.
II. Empirische oder Wissenschaften a posteriori.
Sämmtlich nach dem Grunde des Werdens, d.i. dem Gesetz der Kausalität, und zwar nach dessen drei Modis.
1. Die Lehre von den Ursachen:
a) Allgemeine: Mechanik, Hydrodynamik, Physik, Chemie.
b) Besondere: Astronomie, Mineralogie, Geologie, Technologie, Pharmacie.
2. Die Lehre von den Reizen:
a) Allgemeine: Physiologie der Pflanzen und Thiere, nebst deren Hülfswissenschaft Anatomie.
b) Besondere: Botanik, Zoologie, Zootomie, vergleichende Physiologie, Pathologie, Therapie.
3. Die Lehre von den Motiven:
a) Allgemeine: Ethik, Psychologie.
b) Besondere: Rechtslehre, Geschichte.
Die Philosophie oder Metaphysik, als Lehre vom Bewußtseyn und dessen Inhalt überhaupt, oder vom Ganzen der Erfahrung als solcher, tritt nicht in die Reihe; weil sie nicht ohne Weiteres der Betrachtung, die der Satz vom Grunde heischt, nachgeht, sondern zuvörderst diesen selbst zum Gegenstande hat. Sie ist als der Grundbaß aller Wissenschaften anzusehn, ist aber höherer Art als diese und der Kunst fast so sehr als der Wissenschaft verwandt. – Wie in der Musik jede einzelne Periode dem Ton entsprechen muß, zu welchem der Grundbaß eben fortgeschritten ist; so wird Jeder Schriftsteller, nach Maaßgabe seines Faches, das Gepräge der zu seiner Zeit herrschenden Philosophie tragen. – Ueberdies aber hat jede Wissenschaft noch ihre specielle Philosophie: daher man von einer Philosophie der Botanik, der Zoologie, der Geschichte u.s.w. redet. Hierunter ist vernünftigerweise nichts Anderes zu verstehn, als die Hauptresultate jeder Wissenschaft selbst, vom höchsten, d.h. allgemeinsten Standpunkt aus, der innerhalb derselben möglich ist, betrachtet und zusammengefaßt. Diese allgemeinsten Ergebnisse schließen sich unmittelbar an die allgemeine Philosophie an, indem sie ihr wichtige Data liefern und sie der Mühe überheben, diese im philosophisch unbearbeiteten Stoffe der Specialwissenschaften selbst zu suchen. Diese Specialphilosophien stehn demnach vermittelnd zwischen ihren speciellen Wissenschaften und der eigentlichen Philosophie. Denn da diese die allgemeinsten Aufschlüsse über das Ganze der Dinge zu ertheilen hat; so müssen solche auch auf das Einzelne jeder Art derselben herabgeführt und angewandt werden können. Die Philosophie jeder Wissenschaft entsteht inzwischen unabhängig von der allgemeinen Philosophie, nämlich aus den Datis ihrer eigenen Wissenschaft selbst: daher sie nicht zu warten braucht, bis jene endlich gefunden worden; sondern schon vorher ausgearbeitet, zur wahren allgemeinen Philosophie jedenfalls passen wird. Diese hingegen muß Bestätigung und Erläuterung erhalten können aus den Philosophien der einzelnen Wissenschaften: denn die allgemeinste Wahrheit muß durch die specielleren belegt werden können. Ein schönes Beispiel der Philosophie der Zoologie hat Goethe geliefert an seinen Reflexionen über Dalton's und Pander's Skelette der Nagethiere. (Hefte zur Morphologie, 1824.) Aehnliche Verdienste um die selbe Wissenschaft haben Kielmayer, Delamark, Geoffroy St. Hilaire, Cuvier u.a.m., sofern sie Alle die durchgängige Analogie, die innere Verwandtschaft, den bleibenden Typus und den gesetzmäßigen Zusammenhang der thierischen Gestalten hervorgehoben haben. – Empirische Wissenschaften, rein ihrer selbst wegen und ohne philosophische Tendenz betrieben, gleichen einem Antlitz ohne Augen. Sie sind inzwischen eine passende Beschäftigung für gute Kapacitäten, denen jedoch die höchsten Fähigkeiten abgehn, welche auch eben den minutiösen Forschungen solcher Art hinderlich sein würden. Solche koncentriren ihre ganze Kraft und ihr gesammtes Wissen auf ein einziges abgestecktes Feld, in welchem sie daher, unter der Bedingung gänzlicher Unwissenheit in allem Uebrigen, die möglichst vollständige Erkenntniß erlangen können; während der Philosoph alle Felder übersehn, ja, in gewissem Grad darauf zu Hause seyn muß; wobei diejenige Vollkommenheit, welche man nur durch das Detail erlangt, nothwendig ausgeschlossen bleibt. Dafür aber sind jene den Genfer Arbeitern zu vergleichen, deren Einer lauter Räder, der Andere lauter Federn, der Dritte lauter Ketten macht; der Philosoph hingegen dem Uhrmacher, der aus dem Allen erst ein Ganzes hervorbringt, welches Bewegung und Bedeutung hat. Auch kann man sie den Musicis im Orchester vergleichen, jeder von welchen Meister auf seinem Instrument ist, den Philosophen hingegen dem Kapellmeister, der die Natur und Behandlungsweise jedes Instruments kennen muß, ohne jedoch sie alle, oder auch nur eines, in großer Vollkommenheit, zu spielen. Skotus Erigena begreift alle Wissenschaften unter dem Namen Scientia, im Gegensatz der Philosophie, welche er Sapientia nennt. Die selbe Distinktion haben schon die Pythagoreer gemacht; wie zu ersehn ist aus Stobaei Florilegium, Vol. I, p. 20, wo sie sehr klar und artig auseinandergesetzt ist. Aber ein überaus glückliches und pikantes Gleichniß des Verhältnisses beider Arten geistiger Bestrebungen zu einander haben die Alten so oft wiederholt, daß man nicht mehr weiß, wem es angehört. Diogenes Laertius (II, 79) schreibt es dem Aristippos zu, Stobäos (Floril. tit. IV, 110) dem Ariston Chios, dem Aristoteles sein Scholiast (S. 8 der Berliner Ausgabe), Plutarch aber (De puer. educ. c. 10) dem Bion, qui ajebat, sicut Penelopes proci, quum non possent cum Penelope concumbere, rem cum ejus ancillis habuissent; ita qui philosophiam nequeunt apprehendere, eos in aliis nullius pretii disciplinis sese conterere. In unserm überwiegend empirischen und historischen Zeitalter kann die Erinnerung daran nicht schaden.
Kapitel 13. Zur Methodenlehre der Mathematik
Die Eukleidische Demonstrirmethode hat aus ihrem eigenen Schooß ihre treffendeste Parodie und Karikatur geboren, an der berühmten Streitigkeit über die Theorie der Parallelen und den sich jedes Jahr wiederholenden Versuchen, das elfte Axiom zu beweisen. Dieses nämlich besagt, und zwar durch das mittelbare Merkmal einer schneidenden dritten Linie, daß zwei sich gegen einander neigende (denn dies eben heißt »kleiner als zwei rechte seyn«), wenn genugsam verlängert, zusammentreffen müssen; welche Wahrheit nun zu komplicirt seyn soll, um für selbstevident zu gelten, daher sie eines Beweises bedarf, der nun aber nicht aufzubringen ist; eben weil es nichts Unmittelbareres giebt. Mich erinnert dieser Gewissensskrupel an die Schillersche Rechtsfrage:
»Jahre lang schon bedien' ich mich meiner Nase zum Riechen:
Hab' ich denn wirklich an sie auch ein erweisliches Recht?«
ja, mir scheint, daß die logische Methode sich hiedurch bis zur Niaiserie steigere. Aber gerade durch die Streitigkeiten darüber, nebst den vergeblichen Versuchen, das unmittelbar Gewisse als bloß mittelbar gewiß darzustellen, tritt die Selbstständigkeit und Klarheit der intuitiven Evidenz mit der Nutzlosigkeit und Schwierigkeit der logischen Ueberführung in einen Kontrast, der nicht weniger belehrend, als belustigend ist. Man will hier nämlich die unmittelbare Gewißheit deshalb nicht gelten lassen, weil sie keine bloß logische, aus dem Begriffe folgende, also allein auf dem Verhältniß des Prädikats zum Subjekt, nach dem Satze vom Widerspruch, beruhende ist. Nun ist aber jenes Axiom ein synthetischer Satz a priori und hat als solcher die Gewährleistung der reinen, nicht empirischen Anschauung, die eben so unmittelbar und sicher ist, wie der Satz vom Widerspruch selbst, von welchem alle Beweise ihre Gewißheit erst zur Lehn haben. Im Grunde gilt dies von jedem geometrischen Theorem, und es ist willkürlich, wo man hier die Gränze zwischen dem unmittelbar Gewissen und dem erst zu Beweisenden ziehn will. – Mich wundert, daß man nicht vielmehr das achte Axiom angreift: »Figuren, die sich decken, sind einander gleich«. Denn das Sichdecken ist entweder eine bloße Tautologie, oder etwas ganz Empirisches, welches nicht der reinen Anschauung, sondern der äußern sinnlichen Erfahrung angehört. Es setzt nämlich Beweglichkeit der Figuren voraus; aber das Bewegliche im Raum ist allein die Materie. Mithin verläßt dies Provociren auf das Sichdecken den reinen Raum, das alleinige Element der Geometrie, um zum Materiellen und Empirischen überzugehn. –
Die angebliche Ueberschrift des Platonischen Lehrsaals, Ageômetrêtos mêdeis eisitô, auf welche die Mathematiker so stolz sind, war ohne Zweifel dadurch motivirt, daß Plato die geometrischen Figuren als Mittelwesen zwischen den ewigen Ideen und den einzelnen Dingen ansah, wie dies Aristoteles in seiner Metaphysik öfter erwähnt (besonders I, c. 6, p. 887, 998 et Scholia, p. 827, Ed. Berol.). Ueberdies ließ der Gegensatz zwischen jenen für sich bestehenden, ewigen Formen, oder Ideen, und den vergänglichen einzelnen Dingen sich an den geometrischen Figuren am leichtesten faßlich machen und dadurch der Grund legen zur Ideenlehre, welche der Mittelpunkt der Philosophie Plato's, ja, sein einziges ernstliches und entschiedenes theoretisches Dogma ist: beim Vortrag desselben gieng er darum von der Geometrie aus. In gleichem Sinn wird uns gesagt, daß er die Geometrie als Vorübung betrachtete, durch welche der Geist der Schüler sich an die Beschäftigung mit unkörperlichen Gegenständen gewöhnte, nachdem derselbe bis dahin, im praktischen Leben, es nur mit körperlichen Dingen zu thun gehabt hatte (Schol. in Aristot., p. 12, 15). Dies also ist der Sinn, in welchem Plato die Geometrie den Philosophen empfahl: man ist daher nicht berechtigt, denselben weiter auszudehnen. Vielmehr empfehle ich, als Untersuchung des Einflusses der Mathematik auf unsere Geisteskräfte und ihres Nutzens für wissenschaftliche Bildung überhaupt, eine sehr gründliche und kenntnißreiche Abhandlung, in Form der Recension eines Buches von Whewell, in der Edinburgh Review vom Januar 1836: ihr Verfasser, der sie später, zusammen mit einigen andern Abhandlungen, unter seinem Namen herausgegeben hat, ist W. Hamilton, Professor der Logik und Metaphysik in Schottland. Dieselbe hat auch einen Deutschen Uebersetzer gefunden und ist für sich allein erschienen, unter dem Titel: »Ueber den Werth und Unwerth der Mathematik «, aus dem Englischen, 1836. Das Ergebniß derselben ist, daß der Werth der Mathematik nur ein mittelbarer sei, nämlich in der Anwendung zu Zwecken, welche allein durch sie erreichbar sind, liege; an sich aber lasse die Mathematik den Geist da, wo sie ihn gefunden hat, und sei der allgemeinen Ausbildung und Entwickelung desselben keineswegs förderlich, ja sogar entschieden hinderlich. Dies Ergebniß wird nicht nur durch gründliche dianoiologische Untersuchung der mathematischen Geistesthätigkeit dargethan, sondern auch durch eine sehr gelehrte Anhäufung von Beispielen und Auktoritäten befestigt. Der einzige unmittelbare Nutzen, welcher der Mathematik gelassen wird, ist, daß sie unstäte und flatterhafte Köpfe gewöhnen kann, ihre Aufmerksamkeit zu fixiren. – Sogar Cartesius, der doch selbst als Mathematiker berühmt war, urtheilte eben so über die Mathematik. In der Vie de Descartes par Baillet, 1693, heißt es, Liv. II, eh. 6, p.54: Sa propre expérience l'avait convaincu du peu d'utilité des mathématiques, surtout lorsqu' on ne les cultive que pour elles mêmes. – – – Il ne voyait rien de moins solide, que de s'occuper de nombres tout simples et de figures imaginaires u.s.f.