Anhang

John Steinbeck schrieb The Acts of King Arthur and His Noble Knights nach Malorys Erzählungen in der Version des Winchester-Manuskripts. Sein Werk geht über eine Redaktion weit hinaus, da John die ursprünglichen Erzählungen erweiterte. Es wurde 1958/59 in der englischen Grafschaft Somerset geschrieben und blieb unvollendet. John hat es weder korrigiert noch redigiert.
Die folgenden Auszüge aus seinen Briefen zeigen, daß er zwei Entwürfe von Teilen des Buchs schrieb. Diese Briefe waren an Elizabeth Otis, seine literarische Agentin von 1931 bis zu seinem Tod, 1968, und an mich gerichtet (ERO bezieht sich auf Elizabeth Otis, CHASE auf mich). Sie schildern einige seiner Gedanken, zeigen, wie er arbeitete, und geben manche seiner Ideen über die Schriftstellerei wieder. John schloß King Arthur nicht ab und äußerte sich auch nicht darüber, warum oder inwiefern er sich blockiert fühlte, falls er es überhaupt war, als er die Arbeit daran einstellte.
Was klar zutage tritt, ist sein großes und echtes Interesse an diesem Thema. In den folgenden Briefen schildert ein Romancier seine Hoffnungen, einige seiner Pläne und wie er diese Phase seines schriftstellerischen Schaffens durchschritt.
CHASE HORTON
AN ERO – NEW YORK, 11. NOVEMBER 1956
Ich werde mich unverzüglich an den Morte machen. Behalten wir die Sache für uns, bis ich sie hinter mir habe. Es [das Buch] hat noch immer ganz den alten Zauber.
AN ERO – NEW YORK, 19. NOVEMBER 1956
Ich habe in den letzten Tagen in den Malory reingeschnuppert. Und mit Entzücken. Solange ich nicht weiß, was in der Welt vor sich geht, würde ich mich gerne daran versuchen. Versuchen werde ich es auf jeden Fall.
Nun zur Arbeitsweise. In diesem Punkt bin ich etwas unschlüssig. Schon als ich das Buch zum erstenmal las, ungefähr in Louis’ Alter, muß ich in Wörter verliebt gewesen sein, weil mich die alten und obsolet gewordenen Ausdrücke entzückten. Ich frage mich aber, ob sie für Kinder von heute auch so reizvoll wären. Sie sind ja mehr durch Bilder als durch Töne geschult. Ich habe vor, einen Probelauf zu machen – nicht alle alten Formen herausnehmen, nicht die gesamte Satzstruktur Malorys beseitigen, aber gängige, einfache Wörter einfügen und Sätze umdrehen, deren Sinn noch immer unklar ist.
Verschiedene Dinge werde ich nicht tun. Ich werde den Text nicht entschärfen. Pendragon hat Cornwalls Weib genommen, so war es nun einmal. Ich glaube, daß Kinder solche Dinge nicht nur verstehen, sondern sie auch akzeptieren, solange sie nicht durch eine Moralisiererei verwirrt werden, die die Wirklichkeit durch Verschweigen zu eliminieren versucht. Diese Männer hatten Frauen, und dabei wird es bei mir bleiben. Außerdem habe ich vor, die Kapitelüberschriften beizubehalten und dabei die Malory-Caxton-Sprache unangetastet zu lassen. Ich glaube, das ist eine hübsche Idee.
Sobald ich ein Stück davon fertig habe, werde ich in einem einleitenden Essay mein persönliches Interesse an dem Zyklus darlegen, wann es sich zum erstenmal zeigte und wohin es führte – in die Philologie hinein und auf der anderen Seite wieder hinaus. In diesem Essay werde ich auch aufzuschreiben versuchen, wie sich nach meiner Meinung dieses Buch auf unsere Sprache, unser Denken, unsere moralischen Einstellungen und unsere Ethik ausgewirkt hat.
Ich habe das Gefühl, daß diese Arbeit sehr rasch vorangehen wird – wenn nicht zu viele Unterbrechungen eintreten. Ich denke aber auch, daß ich in diesem Fall Unterbrechungen verkraften kann. Ich stelle fest, daß ich es [das Buch] nach all diesen Jahren noch sehr gut kenne.
Noch etwas anderes möchte ich nicht tun. Es gibt in diesem Buch zahlreiche Stellen, die unklar sind, wie Dichtung das eben an sich hat. Sie sind nicht wortwörtlich zu nehmen. Ich beabsichtige nicht, sie wortwörtlich-verständlich zu machen. Nur zu gut erinnere ich mich, welches Entzücken es mir selbst bereitet hat, Mutmaßungen anzustellen.
Nun zum Titel … ich weiß nicht, was auf Caxtons Einband stand, aber auf seiner Titelseite hieß es:
The Birth, Life and Acts of King Arthur, of his Noble Knights of the Round Table, their marvelous enquests and adventures, the achieving of the San Greal and in the end Le Morte Darthur with the Dolorous Death and Departing out of this World of them All.
Vielleicht werde ich mich dafür entscheiden, ein Stück vom Anfang zu nehmen und das Buch The Acts of King Arthur zu nennen. Natürlich würde ich den Grund dafür in der Einleitung erklären – und dabei Caxtons Titelseite zitieren. Aber das Buch besteht viel mehr aus Taten als aus Tod.
Jedenfalls … über all das läßt sich diskutieren. Die Hauptsache ist, daß ich mir klarwerde, ob ich dazu überhaupt imstande bin oder nicht. Und der beste Weg, dies festzustellen, besteht darin, sich an die Arbeit zu machen.
Haben Sie eine Caxton-Ausgabe? Ich hätte gern, daß Sie meine Fassung beim Lesen damit vergleichen, so daß Sie mir Ratschläge erteilen können.
Als nächstes: Was würden Sie davon halten, wenn wir Chase zu einer Art Chef vom Dienst machten? Sein Wissen und sein Interesse sind anscheinend sehr groß, und er könnte mir nützlich sein, wenn ich mich festfahre. Es wäre gut, jemanden zu haben, mit dem man sich besprechen kann. Und er könnte eine Einleitung bekommen, die meinem Essay vorausginge. Lassen Sie mich bitte wissen, was Sie dazu meinen.
AN ERO – NEW YORK, 3. DEZEMBER 1956
Mit der Arbeit an den Arthur-Erzählungen geht es gut und fröhlich voran. Dieser Brief ist als ein Fortgangsbericht und eine Werbeschrift gedacht. Was das Arthur-Buch betrifft, stelle ich fest, daß ich dafür bestens vorbereitet bin. Ich habe etwas Angelsächsisch gelernt und natürlich, wie jedermann, eine Menge aus dem Alt- und Mittelenglischen gelesen. Warum ich »wie jedermann« schreibe, weiß ich nicht, denn ich stelle fest, daß das nur sehr wenige Leute getan haben.
Das Winchester-Manuskript enthält jedoch eine große Zahl Wörter, deren allgemeine Bedeutung ich zwar erfasse, die aber auch Spezialbedeutungen haben können. Es ist schwierig, für die älteren Sprachen Lexika aufzutreiben. Ich habe jedoch die Leute von der Bibliothek und Fannie darangesetzt und hoffe, noch diese Woche einiges brauchbare Material zu bekommen.
Meine Begeisterung für diese Arbeit wächst. Ich vergleiche immer wieder Caxton mit dem Winchester-Manuskript und sehe dabei, daß Caxton sich sehr stark davon unterscheidet. Er hat nicht nur redigiert, sondern auch in vielen Fällen den Text anders angeordnet. Obwohl er seine Ausgabe nur wenige Jahre nach Malorys Tod herausbrachte, unterscheidet sich seine Sprache stark von der des Winchester-Manuskripts. Ich neige zu der Annahme, daß es dafür zwei Gründe gibt. Zum einen war Caxton als Drucker und Redakteur ein Stadtmensch, Malory hingegen ganz und gar ein Mann des Landes – und auch geraume Zeit hinter Gittern. Außerdem ist das Winchester-Manuskript die Arbeit kopierender Mönche und steht vermutlich Malory viel näher. Ich stelle fest, daß ich das Winchester-Manuskript mehr heranziehe als Caxton. Wenn überhaupt jemand redigiert, dann besorge ich das schon lieber selbst. Dazu kommt noch, daß das Winchester hübsche Nuancen enthält, die Caxton gestrichen hat.
Wir werden uns schon recht bald – genauer gesagt, sobald ich den Merlin-Teil fertig habe – zusammensetzen und über die Arbeitsweise sprechen, nach der ich vorgehe, und zu einer Entscheidung gelangen.
AN ERO – NEW YORK, 2. JANUAR 1957
Ihr Brief traf heute nachmittag ein, und herzlichen Dank für Ihre Ermahnung, das Tempo zu drosseln. Ich weiß nicht, woher ich dieses Wettrennen mit der Zeit habe – es kommt vermutlich auch von der fixen Idee, ich könnte verhungern oder pleite gehen. Ich weiß schon seit einiger Zeit, daß sich diese Arbeit nicht übers Knie brechen läßt. Sie verlangt viel Lesen, aber auch eine Menge Nachdenken, und ich bin kein Schnelldenker.
Arthur ist keine dramatische Figur. Sie haben recht. Und hier ist vielleicht der Hinweis angebracht, daß das auch für Jesus oder Buddha gilt. Vielleicht können die großen symbolischen Gestalten keine dramatischen Personen sein, denn wenn sie es wären, würden wir uns nicht mit ihnen identifizieren. Darüber nachzudenken, lohnt sich ohne Zweifel. Was Arthurs Fähigkeiten als Kämpfer oder als Herrscher betrifft, ist es durchaus denkbar, daß Malory diese Dinge nicht notwendig fand. Das Blut, das war ihm wichtig, und als nächstes die Salbung. Angesichts von Blut und Salbung war Tüchtigkeit nicht notwendig, während Tüchtigkeit ohne beides wenig oder gar keine Chance hatte, etwas zu bewirken. Sie werden auch feststellen, daß hier kein sittliches Gesetz waltet. Als Mann war König Arthur ein Mörder, als König jedoch konnte er es nicht sein. Dies ist ein Denken, das wir nur schwer nachvollziehen können, gleichwohl aber war es real.
Ich habe vor, nächste Woche in die Stadt zu kommen. Ich möchte in die Morgan Library gehen und mit den Leuten dort sprechen. Und außerdem ist es an der Zeit, einmal Luft zu schnappen.
AN ERO – NEW YORK, 3. JANUAR 1957
Nur Lesen und Lesen und nichts als Lesen, und es kommt mir vor, als hörte ich Musik, an die ich mich erinnere.
Bemerkenswerte Dinge in den Büchern. Kleine bedeutungsvolle Splitter, die einen Augenblick herausgucken, und ein paar Philologen, die Beobachtungen machen und sich dann beinahe angstvoll zurückziehen oder das Gesagte einschränken. Wenn ich mit dieser Arbeit fertig bin – falls ich das jemals schaffen sollte –, würde ich gerne ein paar Bemerkungen über die Arthur-Legende niederschreiben. Irgendwo fehlt in dem Puzzle ein Stück, und gerade dieses Stück hält die ganze Sache zusammen. So viele Gelehrte haben enorm viel Zeit dem Versuch gewidmet herauszufinden, ob es Arthur überhaupt gegeben hat, und dabei die schlichte Wahrheit aus den Augen verloren, daß er immer wieder aufs neue existiert. Collingwood stellt fest, es habe einen Ursus oder Bären gegeben, auf keltisch Artur, den Nennius, wie Collingwood zitiert, mit Ursus horribilis übersetzt habe. Doch der Ursus horribilis ist der Grizzlybär, und der wurde meines Wissens noch nie außerhalb von Nordamerika angetroffen. Sie sehen also, in was man hineingerät. Ich kann mir gut vorstellen, daß jemand, wenn er nur wollte, darin versinken und viele glückliche Jahre damit zubringen könnte, sich mit anderen Spezialisten über das Wort Bär und seine keltische Form Artur herumzuschlagen.
Zwölf war die übliche Zahl für die Gefolgschaft eines Mannes oder die Anhänger eines Prinzips. Der Symbolik war nicht auszuweichen. Und ob der Gral der Kelch von Golgatha oder der gälische Kessel war, den später Shakespeare verwendete, ist ohne den geringsten Belang, denn das Prinzip, auf dem beides gründete, war das ewigwährende oder vielmehr das immer wieder erneuerte Leben. Alle solchen Dinge finden unvermeidlich ihren richtigen Platz, aber was mich interessiert, ist das Verbindende – die sich durchziehende Linie mit dem fehlenden Stück in der Mitte.
Schön zu beobachten ist auch, wie Malory beim Schreiben das Schreiben lernt. Die wuchernden Sätze, die unklar gezeichneten Figuren, die wirren Begebenheiten in den frühen Abschnitten, das alles gibt sich, während er weiterschreibt, so daß seine Sätze freier strömen, sein Dialog einen überzeugenden Biß bekommt und seine handelnden Personen mehr menschlich und weniger symbolisch werden, obwohl er sich sehr müht, das Symbolische zu erhalten. Und dies hat, davon bin ich überzeugt, seinen Grund darin, daß er beim Schreiben das Schreiben lernte. Er brachte es darin zur Meisterschaft, und man kann zusehen, wie sich das abspielt. Und bei allem, was ich daran mache, werde ich nicht versuchen, daran etwas zu verändern. Ich werde mich an seine wachsende Perfektion halten, und wer weiß, vielleicht lerne ich dabei selbst. Es ist eine wunderbare Arbeit, wenn ich nur die Unrast loswerden könnte, die mich antreibt, ein Gefühl, daß schon seit langem immer stärker wird. Das ist der eigentliche Fluch, und warum und für wen? Vielleicht habe ich zu viele Bücher geschrieben und hätte besser nur ein einziges schreiben sollen. Aber Malory hatte mir einen großen Vorteil voraus: er war ja so oft im Gefängnis, und dort hat ihn nichts zur Eile angetrieben, außer dann, wenn ihn hin und wieder der Wunsch packte auszubrechen.
AN CHASE – SAG HARBOR, 9. JANUAR 1957
Ich lese immerzu und in einem fort, und ich bin so langsam. Ich bewege buchstäblich die Lippen dabei. Elaine schafft es, vier Bücher zu lesen, während ich mich durch ein einziges murmle. Aber daran wird sich wohl nichts mehr ändern. Jedenfalls, ich habe viel Freude daran, und es gibt keine Unterbrechungen.
Fahre nächsten Montag nach New York hinein. Nächste Woche werde ich mich mit Adams von der P.M. Library zum Lunch treffen. Ich habe den Donnerstag vorgeschlagen, falls er da frei ist, und sonst den Mittwoch oder Freitag. Er will Dr. Buhler mitbringen, dessen Namen Sie von seinen Arbeiten über das Mittelalter und die Renaissance kennen werden. Adams sagt von Buhler: »Er hat etwas von der prallen Lebenslust seines Themas.« Jedenfalls, sie sind in jeder Hinsicht sehr hilfsbereit. Hoffentlich sind Sie auch zum Lunch frei. Ich habe die Colony Bar vorgeschlagen, nächsten Donnerstag 12.30 Uhr, den 17., glaube ich. Sollten Sie an diesem Tag keine Zeit haben, gebe ich Ihnen telephonisch Bescheid, aber ich würde es sehr schön finden, wenn Sie dabeisein könnten.
Mir kommen viele Ahnungen, aber ich werde sie in diesem Zustand belassen. Nichts ist so gefährlich wie das Theoretisieren halbseriöser oder halbinformierter Philologen. Ich bin mir ziemlich sicher, daß auch für Malory sehr vieles nur Ahnungen waren. Kann gar nicht ausdrücken, wie dankbar ich Ihnen dafür bin, daß Sie die Bücher geschickt haben, aber es wird mich viel Zeit kosten, den Rückstand aufzuholen. Ich rufe Sie an, sobald ich in der Stadt bin.
AN CHASE – NEW YORK, 18. FEBRUAR 1957
Die Vorstellung, daß Sie mir Dank schulden, ist lächerlich. Es wäre schwer, Sie für die Unmenge an Arbeit und Gedanken zu entschädigen, die Sie in diese Sache investieren. Und in der Zukunft dräut noch mehr Arbeit. Gottlob ist es eine Arbeit, die wir beide gern tun …
Soweit es mir gelingt – es gelingt nicht sehr weit –, versuche ich im Augenblick, alles andere von mir fernzuhalten, bis ich das Grundgerüst gezimmert habe und sehe, was ich brauchen kann.
AN CHASE – NEW YORK, 14. MÄRZ 1957
Unser Malory hat es mit den Wörtern ziemlich genau genommen. Er spricht nie von »Frensshe [französischen] Büchern« – sondern nur von einem »Frensshe book«. Anders ausgedrückt, er brauchte keine Bibliothek, und es spricht auch kaum etwas dafür, daß er eine benutzt hätte. Nicht ein einziges Mal ist bei ihm von der englischen Stabreimdichtung oder von Geoffrey of Monmouth die Rede. Er war kein Mann aus der Gelehrtenwelt. Er war ein Romanschreiber. Genauso wie Shakespeare ein Dramatiker war. Wir wissen, woher Shakespeare seine Vorlagen aus der englischen Geschichte bezogen haben muß, da die Parallelen zu augenfällig sind, aber woher hatte er sein Verona, sein Venedig, sein Padua, sein Rom, sein Athen? Aus irgendeinem Grund ist es Mode anzunehmen, daß diese großen Männer, Malory und Shakespeare, nicht lasen und nicht zuhörten. Sie sollen alles per Osmose aufgenommen haben. Ich habe die Sammlung Mabinogion vor dreißig Jahren gelesen, und trotzdem bringe ich in Sweet Thursday die Geschichte von dem armen Ritter, der sich eine Frau aus Blumen machte. Und irgendwo anders habe ich noch einmal die Geschichte von dem Mann erzählt, der eine Maus wegen Diebstahls aufknüpfte. Und mein Gedächtnis kann sich mit dem Erinnerungsvermögen Malorys oder Shakespeares nicht messen.
Ich möchte mich auch ein bißchen über den Ansatz einer Hypothese auslassen, daß der Morte d’Arthur gewissermaßen eine politische Protestschrift gewesen sein könnte.
Wenn Shakespeare den Thron schmähen wollte, griff er – er war ja nicht auf den Kopf gefallen – nicht den Thron der Tudor an, sondern die älteren Dynastien, auf die Elisabeth vielleicht ein bißchen neidisch war, weil sie von einem walisischen Emporkömmling abstammte. Ein Frontalangriff auf die Krone war eine Selbstmordgarantie, was man in Malorys so gut wie in Shakespeares Zeit wußte. Aber wie dachte man wohl, wenn man für Neville, den Herzog von Warwick, war – und Eduard IV. saß auf dem Thron? Ein solcher König konnte gar nicht recht handeln.
Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Als The Grapes of Wrath [Die Früchte des Zorns] explodierten, waren allerhand Leute ziemlich wütend auf mich. Der Undersheriff des Bezirks Santa Clara war ein guter Freund von mir und sagte folgendes: »Gehn Sie auf keinen Fall allein in irgendein Hotelzimmer. Sorgen Sie dafür, daß Sie für jede Minute ein Alibi haben. Und wenn Sie die Ranch verlassen, lassen Sie sich von ein oder zwei Freunden begleiten, vor allem aber: halten Sie sich nie allein in einem Hotel auf.«
»Warum das?« fragte ich ihn. Er antwortete: »Vielleicht exponiere ich mich, aber die Typen wollen Sie in eine Falle, eine inszenierte Vergewaltigung, locken. Sie gehen allein in ein Hotel, und eine Frau kommt herein, reißt sich die Kleider vom Leib, zerkratzt sich das Gesicht und fängt an zu kreischen, und dann versuchen Sie mal, aus dem Schlamassel rauszukommen. Ihrem Buch werden sie nichts tun, weil es einfachere Methoden gibt.«
Es ist ein schreckliches Gefühl, Chase, vor allem, weil die Sache funktioniert. Niemand hätte mehr geglaubt, was in meinem Buch steht. Ich bin nirgends mehr allein hingegangen, bis sich der Lärm gelegt hat. Und das waren keine Hirngespinste.
Der ritterliche Gefangene [Malory] war unglücklich dran, doch nicht von Schuld geplagt. Und das macht einem alle diese Geschichten von Rittern verdächtig, die durch Zauberei in Gefangenschaft gerieten. Bis vor kurzem konnten wir einen Mann einfach dadurch zugrunde richten, daß wir ihn einen Kommunisten nannten, und selbst wenn die Beschuldigung von einem notorischen Lügner kam, konnte er gleichwohl ruiniert werden. Wie leicht muß das erst im 15. Jahrhundert gewesen sein.
Wir wissen, warum Cervantes im Gefängnis war. Kennen wir bei Malory wirklich den Grund?
Ich muß Ihnen sagen, Chase, ich habe noch nie mit jemandem zusammengearbeitet, mit dem es mir mehr Freude machte. Sie fangen auf die gleiche Art Feuer wie ich. Wenn wir unsere Arbeit gut machen, wird das bei der Philologenzunft einen kleinen Wirbel auslösen. Aber es macht wirklich Spaß, nicht? Und die Parallelen zu unserer eigenen Zeit drängen sich einem nur so auf.
AN CHASE – FLORENZ, 9. APRIL 1957
Ich werde gefragt, wann ich mit der Morte-Geschichte fertig sein werde, und ich antworte vorsichtig und sage, in zehn Jahren. Der Umfang der Arbeit gibt mir jedoch das Gefühl, daß dies eine unvorsichtige Schätzung sein könnte.
Ich glaube, ich habe Elizabeth geschrieben, daß Dr. Vinaver von der ihm zugeschickten Rohübersetzung des ersten Teils höchst angetan war und daß er jede ihm mögliche Unterstützung angeboten hat. Und dabei war das wirklich eine sehr rohe Übersetzung. Ich bin zu Besserem imstande.
AN ERO – FLORENZ, 19. APRIL 1957
Ich werde mich später zu einer Besprechung mit Professor Sapori treffen. Er ist die Autorität auf dem Gebiet der Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und ein faszinierender Mann. Ich werde auch Berenson sehen, sobald es ihm möglich ist. Er weiß, wo alles ist, und kennt sich in den kleinsten Dingen aus.
Sie sehen also, daß ich hier nicht untätig gewesen bin. Ich stehe staunend vor der enormen Mühe, die sich Chase gibt. Er leistet Phantastisches. Sagen Sie ihm bitte, wie sehr ich das zu würdigen weiß, und auch, daß ich ihm alles zuschicken werde, was ich hier aufstöbern kann. Wenn ihn die Schadensersatzklage interessieren sollte, ließen sich vielleicht in der Morgan Library ein paar Nachschlagewerke finden, aber ich werde schon bald alle hier und in Rom zu Rate gezogenen Quellen für die Bibliographie zusammengestellt haben, die ein imponierendes Bauwerk abgeben wird, wenn wir erst einmal durch sind. Ich bekomme immer mehr ein Gefühl für die damalige Zeit. Wenn er The Merchant of Prato von Iris Origo, im Verlag Jonathan Cape, 1957{*}, noch nicht gelesen hat, sagen Sie ihm bitte, es würde ihn sicher interessieren. Es sind sozusagen die toskanischen Paston Letters, zusammengestellt aus 150000 Briefen eines Handelshauses in Prato, im 14. und frühen 15. Jahrhundert geschrieben, und eine hervorragende Arbeit. Ich besitze ein Exemplar davon und werde es ihm schicken, sollte er Schwierigkeiten haben, es aufzutreiben. Übrigens finde ich, es wäre ratsam, die von mir gesammelten Bücher nach Hause zu Chase zu senden, sobald ich mit ihnen fertig bin. Wir werden, sobald wir durch sind, eine ziemlich imposante Bibliographie beisammen haben, und ich könnte nicht glücklicher darüber sein.
AN ERO UND CHASE – ROM, 26. APRIL 1957
Ich hatte Briefe von der Amerikanischen Botschaft und von Graf Bernardo Rucelai aus Florenz, der ein alter Freund des Kustos ist. Infolgedessen wurde ich sehr gut aufgenommen. Das Archiv ist das Unglaublichste, was man je gesehen hat, meilenweit nichts als reine Information. Es fiel mir schwer, mich davon loszureißen. Ich suche nach bestimmten Dingen, die ich brauche, und die US Information Agency will mir jemanden zur Verfügung stellen, der nachsieht, ob das Material, das ich haben möchte, vorhanden ist. Übrigens, Chase, mit Florenz und jetzt Rom vergrößert sich die Bibliographie sprunghaft. Vielleicht finde ich ja nicht, was ich möchte, aber der Versuch kann nicht schaden, und offenbar hat bisher hier oder in Rom noch niemand gesucht.
Ich habe in der letzten Zeit alle gelehrten Arbeiten über den Morte und über die Gründe für die verschiedenen Einstellungen Malorys gelesen, und dabei trieb sich in meinem Kopf immerfort ein Gedanke herum, lästig und einfach nicht ganz zu erwischen; ich wußte, irgend etwas war an all den Untersuchungen verkehrt, konnte aber nicht genau sagen, was. Warum blieb Lancelots Suche erfolglos, und warum hatte Galahad Erfolg? Wie ist die Einstellung zur Sünde oder die Einstellung zu Guinevere? Wie steht es mit der Rettung vor dem Scheiterhaufen? Wie sieht die Beziehung zwischen Arthur und Lancelot aus? All das ist so oft hin und her gewendet worden, und bis heute scheint, wie in der Causa Alger Hiss, etwas zu fehlen. Dann wachte ich heute morgen gegen fünf Uhr auf, war sofort hellwach, aber mit dem Gefühl, irgendeine gewaltige Aufgabe sei geleistet. Ich stand auf, schaute hinaus, wo gerade die Sonne über den Dächern von Rom hochstieg, und versuchte zu rekonstruieren, was das für eine Aufgabe gewesen und wie sie, wenn überhaupt, gelöst worden war, und plötzlich kam alles zurück, ganz und in einem Stück. Und ich glaube, es beantwortet meine nagenden Zweifel. Es kann keine Theorie sein, weil es sich nicht beweisen lassen wird. Es muß leider ganz und gar intuitiv bleiben, und deshalb wird die Wissenschaft es nie ernsthaft in Betracht ziehen.
Man hat sich mit Malory als Übersetzer beschäftigt, als Rebellen, mit seiner religiösen Einstellung, mit Malory als einem Experten in Courtoisie, in beinahe allen Eigenschaften, die einem nur einfallen, nur nicht mit dem, was er war – ein Schriftsteller. Der Morte ist der erste und einer der größten Romane in englischer Sprache. Ich werde versuchen, das so klar und einfach auszudrücken, wie ich es vermag. Und nur ein Schriftsteller konnte ihn erschaffen. Ein Romancier schreibt nicht nur eine Geschichte auf, sondern er geht selbst in diese Geschichte ein. Er erscheint, in einem stärkeren oder einem geringeren Maß, in jeder einzelnen seiner Figuren. Und weil er in der Regel ein Mann mit moralischer Intention ist und als ein ehrlicher Mann zu Werke geht, schreibt er die Dinge so wahrheitsgetreu auf, wie es ihm möglich ist. Grenzen ziehen ihm seine Erfahrungen, seine Art der Beobachtung, sein Wissen und seine Gefühle.
Man kann sagen, ein Roman, das ist der Mensch, der ihn schreibt. Nun trifft es beinahe immer zu, daß ein Romancier, wenn auch vielleicht unbewußt, sich mit einer Haupt- oder Zentralfigur in seinem Roman identifiziert. In diese Figur legt er nicht nur, was er zu sein glaubt, sondern auch, was er zu sein hofft. Wir können diesen Sprecher als Ich-Darsteller bezeichnen. Sie werden einen solchen in jedem meiner Bücher und in den Romanen aller Autoren finden, an die ich mich erinnern kann. Ganz klar und beinahe mit Händen zu greifen in Hemingways Romanen. Der Soldat, romantisch, immer in irgendeiner Weise verstümmelt – Hand, Hoden. Diese Versehrungen sind die Symbole seiner Begrenzungen. Ich nehme an, meine eigene Symbolfigur hat meinen Wunschtraum von Weisheit und Angenommensein. Bei Malory habe ich den Eindruck, daß sein Ich-Darsteller wohl Lancelot ist. Alles Vollkommene, das Malory kannte, ist in diese Figur eingegangen, alles, dessen er sich selbst für fähig hielt. Doch da er ein ehrlicher Mann war, fand er auch Fehler an sich, Eitelkeit, Gewalttätigkeit, sogar Illoyalität, und diese Fehler gingen dann natürlich auch in seine Traumfigur ein. Und vergessen Sie nicht, daß der Schriftsteller Dinge und Begebenheiten so an- und umordnen kann, daß sie dem näherkommen, wie er sie in seinen Hoffnungen gerne gesehen hätte.
Und nun kommen wir zum Gral, zur Gralssuche. Ich glaube, es ist wahr, daß jeder Mann, ob Schriftsteller oder nicht, sobald er in die Jahre der Reife kommt, tief in seinem Innern spürt, er wird an der Gralssuche scheitern. Er kennt seine Mängel, seine Schwächen und ist sich seiner vergangenen Sünden bewußt, Sünden wie Grausamkeit, Rücksichtslosigkeit, Illoyalität, Ehebruch, und diese verhindern, daß er den Gral gewinnt. Und deshalb muß der Ich-Darsteller unter dem gleichen schrecklichen Gefühl des Versagens leiden wie sein Schöpfer. Lancelot konnte wegen Malorys eigener Schwächen und Sünden den Gral nicht erschauen. Er weiß, er hat sein Ziel nicht erreicht, und alle seine vortrefflichen Eigenschaften, sein Mut, seine Ritterlichkeit, können in seinen Augen seine Laster und Irrtümer, seine Torheiten nicht wettmachen.
Ich glaube, so ergeht es, von jeher, jedem Mann auf der Welt, aber festgehalten wird es im wesentlichen nur von den Schriftstellern. Doch für jeden Mann und für jeden Romancier bietet sich eine tröstliche Antwort an. Der Ich-Darsteller vermag den Gral nicht zu erringen, aber dafür gelingt es seinem Sohn, dem Sohn ohne Makel, der Frucht seines Samens und seines Blutes, der seine Tugenden, nicht aber seine Mängel geerbt hat. Und so kann Galahad die Gralssuche vollenden, und weil er aus Lancelots und aus Malorys Samen kommt, hat Malory-Lancelot doch in gewisser Weise die Suche vollendet, ist er im Sproß seiner Lenden zu dem Ruhm gelangt, den seine eigenen Mängel ihm verwehrten.
Ja, so ist es. Es ist für mich so gewiß wie nur irgend etwas. Gott weiß, ich habe es selbst oft genug erlebt. Und dies macht in meinen Augen all die Inkonsequenzen und dunklen Stellen wett, die die Wissenschaft am Morte entdeckt hat. Und wenn der Morte unausgeglichen und sprunghaft ist, dann weil sein Verfasser sprunghaft war. Manchmal zuckt es feurig auf, dann wieder begegnet man einem schwermütigen Traum, dann aufwallendem Zorn. Denn der Schriftsteller ordnet die Natur um, so daß sie ein verständliches Muster ergibt, und er ist auch ein Lehrer, vor allem aber ist er ein Mensch, Träger aller menschlichen Fehler und Tugenden, Ängste und tapferen Gesinnungen. Und ich habe bisher noch nicht eine einzige Abhandlung gesehen, die in Betracht zieht, daß die Geschichte des Morte die Geschichte Sir Thomas Malorys und seiner Zeit ist, die Geschichte seiner Träume von menschlicher Anständigkeit und seines Wunsches, dem Zyklus eine gute Gestalt zu geben, geformt allein von jener Grundaufrichtigkeit, die Lügen nicht zuläßt.
So, das war das Problem, und das war die Lösung, und sie erschien beglückend mit der Morgensonne auf den braunen Mauern Roms. Ich wüßte nun gerne, ob Sie überhaupt etwas Einleuchtendes daran finden. Mein Herz und mein Kopf sagen mir, sie ist richtig, ich weiß aber nicht, wie um alles in der Welt ich sie beweisen kann, außer daß ich sie so klar ausspreche, wie ich es nur vermag, so daß der Leser vielleicht sagen wird: »Natürlich, so muß es gewesen sein. Was sonst könnte die Erklärung sein?«
Lassen Sie mich bitte wissen, was Sie von diesem schwindelerregenden Sprung von Induktion halten. Kann es sein, Sie empfinden ebenso tief wie ich, daß es wahr ist?
Es liegt mir sehr viel daran zu erfahren, was Sie dazu meinen.
VON ERO AN J. S. – NEW YORK, 3. MAI 1957
Ihr Brief über Malory von dieser Woche ist einer der eindrucksvollsten Briefe, die jemals von Ihnen oder sonst jemandem geschrieben wurden. Inzwischen sind Sie wieder zu Hause. Der schöpferische Prozeß hat begonnen. Ich habe noch nie erlebt, daß er so genau beschrieben wurde. Zeit, Ort, Gefühl und Atmosphäre. Der Romancier tritt auf.
Wunderbar, daß Sie allmählich ernsthaft über meine Freundin Guinevere nachdenken, die man bisher so vernachlässigt hat. Vielleicht werden Sie mit ihr nicht viel anfangen wollen, aber sie muß in dem Bild eine wichtige Rolle gespielt haben.
AN ERO UND CHASE – FLORENZ, 9. MAI 1957
Ich schreibe weiterhin in Heftumschläge wie diesen, weil es mir beinahe unmöglich ist, einen Brief für sich zu schreiben. Ich gehe jeden Tag zu den Handwerkerläden und schreibe zugleich meine kleinen Zeitungsschmierereien (die trotzdem ihre Zeit brauchen), und ich gehe auch das durch, was meine Frau im Archiv zutage fördert.
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh und dankbar und erleichtert ich bin, daß Sie meiner Sicht Malorys recht geben. Sie hat mir einen ganz neuen Auftrieb und ein klar erkennbares Ziel gegeben, das ich vorher nie hatte. Und Ihr Rückhalt gibt mir das Gefühl, daß ich irgendwie festen Boden unter den Füßen habe. Chase, Ihre Briefe sind von ganz großem Nutzen für mich und werden zum häufigen Nochmallesen abgelegt. Auch ich, Elizabeth, habe diesen Mangel empfunden, was Guinevere betrifft. Sie war immer Symbol, während sie in Wahrheit eine tolle Frau gewesen sein muß. Ich lese seit einiger Zeit viel über Frauen im Mittelalter und glaube jetzt zu wissen, warum die moderne Wissenschaft sie [Guinevere] sich nur als Symbol vorstellen kann. Damals hat man die Frauen einfach anders angesehen. Das zeigt sich an jeder Phase des Lebens von Frauen, wie es von Zeitgenossen geschildert wird. Baldini gibt ein besonders klares Bild. Malory tut das, glaube ich, auch. Chase, ich weiß, was Sie meinen, wenn Sie schreiben, daß es aussichtslos sei, die Wissenschaft jemals zu einer einhelligen Meinung zu bewegen. Ich könnte ein Kapitel einfügen, in dem ich nichts anderes als ihre Meinungsverschiedenheiten durch die Jahrhunderte aufzähle. Aber was soll’s, ich könnte über weiß Gott was Kapitel einfügen. Ich weiß nicht, in welche Richtung sich die Arbeit jetzt bewegt, aber ich habe immerhin Geschmack daran und eine Tonlage dafür gefunden, und das ist der einzige richtige Anfang. Und ich glaube auch nicht, daß es verkehrt ist, soviel Material durchzuarbeiten, wie ich nur kann. Mit ein bißchen Zeit und einem gewissen Instinkt wird schon etwas von mir selbst zutage treten. Jedenfalls war es bisher immer so. Und alle möglichen Gefühle beginnen sich zur Ebene des Denkens hinaufzuwinden. Aber ich möchte sie noch einige Zeit nicht dort oben haben. Ich will, daß das Ganze noch ziemlich lange herumbrodelt.
AN CHASE – FLORENZ, 17. MAI 1957
Den gestrigen Abend verbrachte ich mit Professor Armando Sapori. Er ist schon ziemlich betagt und kränkelt in letzter Zeit, hat mich aber trotzdem gebeten, ihn aufzusuchen. Ich fragte ihn im Laufe des Abends mehrmals, ob ich gehen sollte, denn ich fürchtete, ihn zu ermüden, doch jedesmal forderte er mich auf, noch zu bleiben. Er spricht kein Englisch, aber einer seiner Studenten, Julio [Giulio] Fossi, dolmetschte für uns, wenn es notwendig wurde. Er [Sapori] ist ein hochgebildeter Mann und drückt sich dabei so einfach aus, daß ich ihn zumeist sehr gut verstand. Während er sprach, kehrte das Mittelalter zurück – die Amalfi-Liga, der Beginn der Renaissance, die Überlieferung des griechischen Denkens und die Idee der Kommune von den Arabern übernommen.
Neulich stieß ich auf Stracheys Bände von Southeys Morte-Übertragung. Die Fassung war gereinigt, damit man sie unbesorgt braven Schuljungen in die Hand geben konnte. Könnten Sie sie uns beschaffen? Die Übersetzung ist gut, aber von einer Entschärfung für Schuljungen will ich nichts wissen. Sollen sich die Jungen selbst vorsehen – und Jungen werden Gott nicht dafür danken.
AN CHASE UND ERO – GRAND HOTEL,
STOCKHOLM, 4. JULI 1957
Ich nahm einen Brief in Angriff, und jetzt haben wir endlich eine gewisse Ordnung in unsere Planung gebracht. Im ersten Teil dieses Briefes hatte ich bis London geplant. Wenn wir am 15. Juli in den Norden aufbrechen, haben wir zehn Tage. Wir würden durch Warwickshire hinauffahren, dann zum [Hadrians-]Wall und dann, nachdem wir uns vor Hadrian verbeugt haben, im Westen langsam südwärts, um uns etwas von Wales und auch Glastonbury und Tintagel etc. anzusehen.
Ich werde die Bücher mitnehmen, die Sie geschickt haben, und außer dem Kartenatlas habe ich auch die großformatigen Karten von einem Teil des Landes, vor allem von Warwickshire.
AN ERO UND CHASE – LONDON, 13. JULI 1957
Wir werden also am Montag mit einem Chauffeur namens Jack in einem Humber losfahren. Wir sind bewaffnet mit Büchern, Papieren, Ihren Briefen, Kameras und Skizzenblöcken – letztere nur zum Angeben, weil wir nicht zeichnen können. Wir freuen uns beide sehr auf diese Fahrt. Natürlich werden wir eine Menge Dinge nicht sehen, aber eine Menge doch. Der beigelegten Liste können Sie entnehmen, was wir vorhaben.
Reiseplan
Von diesem Ausgangspunkt aus werden wir das für
uns interessante Gebiet in Warwickshire abfahren.
Donnerstag Grand Hotel, Manchester (Vinaver)
Freitag Lord Crew Armes, Blanchland
Sonnabend Rothbury und der [Hadrians-]Wall
Sonntag Wall und hinunter nach Wales, möglicherweise nach Malvern
Montag Tresanton St. Mawes bei Falmouth
Dienstag Winchester (Manuskripte)
AN ERO UND CHASE – LONDON, 14. JULI 1957
Während ich mich vergangene Nacht herumwälzte und -warf, kam mir eine Idee, die mir viel Einleuchtendes zu haben schien, und ich möchte Sie fragen, was Sie davon halten. Der Jammer mit solchen Einfällen ist meine Unwissenheit. Ich meine damit, daß vielleicht schon viele Leute darauf gekommen sind und daß das Gebiet möglicherweise schon gründlich beackert ist. Jedenfalls werde ich die Gedanken so aufschreiben, wie sie mir gekommen sind, und dabei so tun, als wären sie bisher noch niemandem eingefallen. Leider habe ich meinen Morte nicht bei mir, weil er bereits zum Schiff geschickt worden ist. Also werde ich mich ein bißchen auf mein Gedächtnis stützen müssen, mit dem es nicht sehr weit her ist. Okay, die Sache geht so:
Wenn man sich mit einem Mann beschäftigt, über den nur wenige und nur karge Daten bekannt sind, kann man dreierlei Richtungen einschlagen, um eine Art realer Welt um ihn aufzubauen: sein Werk (am wichtigsten), die Zeit, in der er lebte (wichtig, weil er ein Kind dieser Zeit war) und schließlich die Menschen, mit denen er umging oder vielleicht umgegangen ist. Im Fall Malorys hat man seine Verbindung mit Beauchamp [Richard Neville, Earl of Warwick], dem gelehrten, vollkommenen Ritter, weltklug, romantisch, tapfer und erfahren, stark herausgestellt. Es erscheint mir völlig einleuchtend, daß man sich damit so eingehend beschäftigt hat. Doch es gibt einen anderen Mann, einen, der mir in meiner Lektüre nicht begegnet ist, aber über den eine Menge bekannt sein muß: seinen Verleger Caxton. Wenn ich mich recht erinnere, läßt Caxton in seiner Vorrede nirgendwo erkennen, daß er Malory kannte. Ja, seine Worte scheinen dafür zu sprechen, daß dies nicht der Fall war. Wir wissen, daß es zwei, vermutlich drei und vielleicht noch mehr Kopien des Morte gab. Doch seit der Vollendung des Buches waren erst ganz wenige Jahre vergangen, als Caxton es druckte. Ich glaube nicht, daß es in Partien, so, wie es fertig wurde, herauskam, und deshalb müssen wir annehmen, daß der Morte kaum vor 1469 zum erstenmal erschienen sein kann. Zwischen diesem Datum und der Zeit, als Caxton es druckte, lag nur eine sehr kleine Spanne, die nicht ausreichte, daß die Handschriften in großem Umfang kopiert, unter die Leute gebracht, dem Gedächtnis eingeprägt und gelesen oder vorgetragen wurden.
Warum suchte Caxton ausgerechnet diesen Text aus und druckte ihn als Buch? Wäre es sein Wunsch gewesen, die Arthur-Sage als ein potentiell populäres Buch zu drucken, hätte er die Stabreimdichtung, die ungleich bekannter war, wählen oder die klassischen Erzählungen übersetzen lassen können, den Romaunt, den Lancelot etc. Aber er entschied sich für das Werk eines Unbekannten ohne einen Hintergrund von Bildung und Gelehrsamkeit, für einen Mann, der im Gefängnis saß. Ich kann nicht glauben, daß Malorys Morte zu der Zeit, als Caxton ihn druckte, schon weithin bekannt war. Warum also druckte er ihn? Ich glaube, diesem Problem kommt man nur näher, wenn man sich damit befaßt, für welche Texte er sich sonst entschied. Hat Caxton auch andere unbekannte Werke unbekannter Männer gedruckt? Ich weiß es nicht, doch das läßt sich leicht eruieren. Ich habe hier keine Bibliothek, in der ich mich umsehen könnte.
Wie sahen Caxtons geschäftliche Gepflogenheiten, seine Gepflogenheiten als Herausgeber aus? Ich habe das Gefühl, daß er kein sehr risikofreudiger Mann war, abgesehen davon, daß er mit seinen beweglichen Lettern die Organisationen der Kopisten gegen sich aufbrachte. Ließe sich ein Muster seiner Aktivitäten herausfinden? Kann es so gewesen sein, daß das neue Werk eines unbekannten Schriftstellers Caxton derart vor Genie zu sprühen schien, daß er als Kenner davon angezogen wurde? Es war keine Epoche, in der Romanschriftsteller allgemein Unterstützung erfuhren. Malory hatte vermutlich keinen Rückhalt an Schule, College oder Kirche. Sein Buch war nicht revolutionär wie Wiclifs Bibel-Übersetzung, und es hatte auch nicht die Faszination der Häresien der Lollarden. Es war ein in der Tradition stehendes Werk, das von überlieferten Geschichten handelte. Caxton hätte sich ohne Mühe Übersetzungen aus der Feder namhafter und geachteter Männer beschaffen können. Malory hatte keinen Rückhalt beim Adel, keinen Förderer, und ich glaube, solche Unterstützung war von einigem Nutzen, wenn der Autor wollte, daß sein Buch gut aufgenommen wurde. War Caxton ein hellsichtiger Herausgeber mit einem großen Gespür für literarische Vorzüge im Gegensatz zu traditionellen und geschäftlichen Wertmaßstäben? Ich weiß über diese Dinge nichts, wüßte aber gern darüber Bescheid. Es scheint sich nämlich folgendes Bild zu ergeben: der erste Buchdrucker in England wählte für eine seiner frühen, wenn auch nicht ersten Produktionen die Arbeit eines unbekannten Schriftstellers beziehungsweise, falls er doch bekannt war, eines Mannes, der als ein Räuber, Notzüchtiger und gemeiner Verbrecher galt und im Gefängnis gestorben war. Daß sein Buch sofort Erfolg hatte, daran gibt es keinen Zweifel, aber wie um alles in der Welt konnte Caxton ahnen, daß es so kommen würde? All dies sind Fragen, aber Fragen, auf die ich gerne eine Antwort hätte. Wieviel ist über Caxton bekannt? Mein eigenes Wissen ist ein Abgrund von Unwissenheit. Aber sind solche Überlegungen schon einmal im Zusammenhang mit dem Morte angestellt worden?
Ich könnte mir vorstellen, daß Chase – falls er über diese Fragen nicht bereits nachgedacht und sie gelöst hat – darauf reagieren wird wie ein Hund, dem man den Schwanz in Benzin taucht und dann anzündet. In meiner Lektüre bin ich nie auf solche Fragen gestoßen. Verflixt, es ist wirklich zu dumm, daß ich keine Bibliothek zur Verfügung habe. Und morgen werden wir schon unterwegs sein. Entschuldigen Sie, daß ich Ihnen dieses dornige Problem zuschiebe, und wir sollten nicht versäumen, uns sofort nach meiner Rückkehr darüber zu unterhalten und den Versuch zu machen, vielleicht einiges davon zu klären. Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, daß Caxton gut dokumentiert ist. Wenn heute nicht Sonntag wäre, würde ich ausgehen und versuchen, ein Buch über Caxton aufzutreiben. Aber in London ist alles hoffnungslos zu.
AN ERO – SAG HARBOR, 7. AUGUST 1957
Ich bin auch in die Rylands Library in Manchester gegangen, um einen der beiden noch vorhandenen Erstdrucke Caxtons zu inspizieren. Dr. Vinaver hat mich sehr unterstützt, mir jede erdenkliche Hilfe angeboten, und mir seine Dokumente und seine Bibliographie zugänglich gemacht. Er war begeistert, wie ich an das Thema herangehe, und sagte, das sei seit Jahren der erste neue Ansatz. Ich fuhr auch zum Winchester College, um mir das Manuskript des Morte anzusehen, das im 15. Jahrhundert von Mönchen geschrieben und erst 1936 wiederaufgefunden wurde.
Da meine Arbeit an diesem Thema verlangt, daß ich die Landschaft kenne, in der Malory lebte und wirkte, mietete ich mir einen Wagen mit Fahrer und fuhr zu Malorys Geburtsort in Warwickshire und auch dorthin, wo er in Gefangenschaft gewesen war. Dann fand ich, es sei notwendig, Alnwick Castle, Wales, Glastonbury, Tintagel und all jene Schauplätze zu besichtigen, die mit König Arthur verbunden sind. Diese Reise, zehn Tage wie im Flug, führte mich von einem Ende Englands zum andern, da ich mir einen Eindruck von der Topographie, von den Farben der Erde, vom Marsch- und Moor- und Waldland und vor allem davon verschaffen wollte, in welcher Beziehung die Schauplätze untereinander stehen. Elaine erstellte eine umfangreiche photographische Dokumentation aller Stätten, die wir während dieses großen Unternehmens besichtigten. Diese Arbeit ist dazu bestimmt, die aufwendigste und, wie ich hoffe, bedeutendste von allen zu werden, die ich bisher in Angriff genommen habe. Während der ganzen Reise ergänzte ich meine Bibliothek durch Bücher, Dokumente, Photographien und sogar Mikrofilm-Aufnahmen von Dokumenten, die den Sammlungen nicht entnommen werden können. Die Arbeit gewährt mir große Befriedigung, und ebenso der Respekt und der Zuspruch von Seiten der Autoritäten auf diesem Gebiet. Weit davon entfernt, mich als einen lästigen Störfaktor zu empfinden, gaben sie sich die größte Mühe, mir jede ihnen nur mögliche Unterstützung zu gewähren.
AN CHASE – NEW YORK, 4. OKTOBER 1957
Es scheint mir kein Problem zu sein, wie Malory an Bücher herankam. Hätte er keine bekommen, wäre er ein Dummkopf gewesen, und ein Dummkopf war er nicht.
Verdammt – dieses Thema dehnt sich endlos, nicht? Ich freue mich darauf, Sie am Dienstag zu sehen. Und ich habe mir vorgenommen, die ganze Woche zu Hause zu bleiben, so daß wir alles noch einmal durchgehen können. Auch scheint meine Energie allmählich wiederzukehren. Dem Himmel sei Dank dafür! Ich war schon ganz verzagt.
Malory zeigt sich unsicher beim »Ritter auf dem Karren«, vermutlich, weil ihm das nichts sagte. Das Faktum, daß Karren früher ausschließlich für verurteilte Gefangene verwendet wurden, war ihm, falls er es kannte, nicht genug. Es gibt zahlreiche Stellen im Morte, an denen er sich unsicher fühlt, weil er weder den Grund noch den Hintergrund kennt, wenn er sich aber sicher ist – in der Behandlung von Menschen und Landschaft –, zeigt er nicht die geringste Schwäche.
AN CHASE – NEW YORK, 25. OKTOBER 1957
Natürlich bin ich ganz aus dem Häuschen über das Lesegerät für die Mikrofilme. Es wiegt zwar acht Kilo, aber man kann eine große Bibliothek in einem Schuhkarton mit sich herumtragen. Wir werden damit eine Menge Spaß haben. Als Archie MacLeish Direktor der Kongreßbibliothek war, hat er viele Dinge, die nicht bewegt werden durften, auf Mikrofilm aufgenommen. Ich bin überzeugt, daß manche von den Universitäten und vermutlich auch die New York Public Library das auch tun. Ließe sich irgendwie herausfinden, was die verschiedenen Sammlungen auf Film aufgenommen haben und ob man es ausleihen kann?
Hoffentlich hat Ihr Gerät einen Rücklauf. Es kommt ja ziemlich oft vor, daß man zurückgehen möchte. Wird das nicht toll sein, die Sachen aufzuspüren, die wir haben wollen und die man nicht ausleihen kann? Wirklich aufregend. Ich habe soeben den zweiten Band von Henry V.{*} zu Ende gelesen. Ich glaube, Wylie ist gestorben, nachdem er die Korrekturfahnen des ersten Bandes gelesen hatte. Jedenfalls steht es so in der Einleitung zu Band II. Seine Detailschilderung ist großartig. Und haben Sie das bemerkt: es hat ihn derart hineingezogen, daß er die alten Wörter verwendete und sogar die alten Konstruktionen. Es ist ein großartiges historisches Werk, und es läßt sich durchaus vorstellen, daß Henry für Malory die Arthur-Symbolfigur war.
Im Augenblick halte ich mich von Malory fern. Doch wenn ich zu ihm zurückkehre, dann wohl mit einer neuen Dimension, und das, mein Freund, ist ganz allein Ihr Verdienst. Diese Arbeit ist eine Gemeinschaftsarbeit, machen Sie sich da keine anderen Vorstellungen. Daß ich die Schlußfassung schreiben werde, mindert daran gar nichts. Im Augenblick tue ich mich an den Büchern gütlich. Und dafür werde ich mir so viel Zeit nehmen, wie ich brauche – oder vielmehr möchte, und das ist viel. Ich habe sogar das Briefeschreiben eingestellt, von Ihnen und Elizabeth abgesehen. Ich möchte das Schreiben verlernen und wieder ganz neu lernen, wenn es aus dem Stoff herauswächst. Und darin werde ich ganz stur bleiben.
AN CHASE – NEW YORK, 4. MÄRZ 1958
Gestern habe ich die allerersten Zeilen des Buches geschrieben, entweder für die erste gedruckte Seite oder für das Vorsatzblatt. Ich lege sie hier bei.{*}
Ich nehme an, das ist das erste Mal, daß ich einen Anfang als erstes schreibe. Es ist vermutlich auch die einzige Stelle in der ganzen Geschichte, die in der Sprache des 15. Jahrhunderts geschrieben ist. (Vielleicht abgesehen von einer Fußnote oder Material, das hinten angehängt werden wird.)
AN ERO – NEW YORK, 4. MÄRZ 1958
Ich denke, die Zeit ist reif für einen Bericht über die Entwicklung in Sachen Malory. Ich möchte auch eine Art Absichtserklärung für die unmittelbare Zukunft abgeben, was diese Arbeit betrifft. Wie Sie wissen, ziehen sich die Recherchen, das Lesen und das Sammeln von Fakten jetzt schon sehr, sehr lange hin, und diese Arbeit muß mindestens bis zum Herbst fortgesetzt werden. Es wird Ihnen klar sein, daß ich mit Informationen vollgepumpt bin, wovon einiges vielleicht noch nicht gut verarbeitet ist und manches möglicherweise nur sehr langsam verdaut wird. Wie immer hat nicht so sehr die einzelne Information, sondern das Geflecht die stärkste Wirkung auf mich, trotzdem aber scheint sich eine ganz beträchtliche Menge an Faktenmaterial in mir zu speichern. Ich habe buchstäblich Hunderte von Büchern über das Mittelalter gelesen, und ich muß noch in ein paar weitere hundert zumindest kurz hineinsehen, ehe ich so weit bin, daß ich mich ans Schreiben machen kann. Die gewaltige Sammlung von Notizen, die Chase und ich zusammengetragen haben, ist eine Notwendigkeit, auch wenn sie in der Arbeit, die vor mir liegt, nicht sichtbar verwertet wird. Ohne dieses Material an die Arbeit zu gehen, würde heißen, ohne Fundament zu arbeiten. Wie Sie ja wissen, habe ich vergangenes Jahr einige Zeit in England verbracht und etliche Orte und Gegenden aufgesucht, die in der Arbeit aufscheinen werden, um ihre Atmosphäre in mich aufzunehmen. Ich glaubte, das Gebiet ziemlich gut beackert zu haben. Erst nach weiterer Lektüre stelle ich jetzt fest, daß mein Wissen noch Lücken aufweist. Ich finde es notwendig, noch einmal nach England zu reisen, um dort weiterzumachen, wo ich aufgehört habe, oder vielmehr, um die Lücken in meinem optischen Informationsstand zu schließen. Ich denke, das beste Datum dafür wäre der 1. Juni. Ich muß hin und einige Zeit in Glastonbury, in Colchester und in Teilen von Cornwall, in der Gegend von Tintagel, verbringen und dann noch einmal in den Norden fahren, um mich diesmal ein bißchen länger in Alnwick und in Bamborough Castle, in Northumberland, aufzuhalten. Diese beiden letztgenannten sind sehr wichtig, weil das eine vielleicht das von Malory erwähnte Maiden’s Castle war und das andere Joyous Garde gewesen sein könnte. Und ich muß mir alle diese Schauplätze optisch und atmosphärisch zu eigen machen, die nicht nur erwähnt werden, sondern auch zu Malorys Lebensumwelt im 15. Jahrhundert gehörten. Fotos nützen überhaupt nichts. Dorthin zu fahren wird mir großen Auftrieb geben. Es würde mich sehr freuen, wenn Chase mich an diese Orte begleiten könnte, da unsere Recherchen ja aufeinander abgestimmt waren.
Ich habe vor, den Juni in England zu verbringen, abschließende topographische Informationen zu sammeln und auch bestimmte Autoritäten zu konsultieren, zum Beispiel Professor Vinaver von der University of Manchester und andere Koryphäen auf dem Gebiet des 15. Jahrhunderts. Ich werde um den 1. Juli nach Amerika zurückreisen und dann meine Lektüre im Licht dessen, was ich auf dieser Reise entdeckt habe, bis in den Oktober fortsetzen. Und wenn ich das heute nach meinem Wissensstand und meiner seelischen Verfassung überhaupt abschätzen kann, müßte ich im Herbst mit der Arbeit an diesem Buch anfangen können. Sobald ich mich einmal daran gesetzt habe, werde ich natürlich dabei bleiben, bis ein großer Teil davon abgeschlossen ist.
Einen Informationshintergrund für dieses Buch zu schaffen, das war eine langwierige, mühevolle, aber auch überaus lohnende Anstrengung. Ich zweifle sehr, ob ich es ohne Chase Hortons Beistand überhaupt geschafft hätte. Zu schaffen wäre es sicher gewesen, doch nicht in der Exaktheit, der Spannweite und der Universalität, die seiner Mitarbeit zu verdanken ist.
Ich komme nun zu einem präziseren Punkt. Zunächst der Titel. Darüber möchte ich mit Ihnen noch ausführlicher diskutieren, aber ich denke, ich kann in diesem Brief die Sache doch anschneiden. Als Caxton im 15. Jahrhundert die erste Ausgabe eines Buches von Sir Thomas Malory druckte, gab er ihm einen Titel, und wir wissen nicht, ob dieser der von Malory selbst verwendete war oder nicht. Vielleicht hat Caxton ihn sich ausgedacht. Der volle Titel wurde nach und nach auf MORTE D’ARTHUR verkürzt, aber dies waren im ursprünglichen Titel nur drei Wörter und wurde dem Buch keineswegs gerecht. Der volle Titel bei Caxton lautet, wie Sie sich erinnern werden: THE BIRTH, LIFE AND ACTS OF KING ARTHUR, OF HIS NOBLE KNIGHTS OF THE ROUND TABLE, THEIR MARVELLOUS ENQUESTS AND ADVENTURES, THE ACHIEVING OF THE SAN GREAL, AND IN THE END LE MORTE D’ARTHUR WITH THE DOLOROUS DEATH AND DEPARTING OUT OF THIS WORLD OF THEM ALL. Das also ist der Titel, den Caxton verwendete, und mir wird immer unklar bleiben, warum dieses ganze umfangreiche Werk schließlich MORTE D’ARTHUR genannt wurde, was ja nur einen ganz kleinen Teil davon betrifft. Ich schlage deshalb vor, dem Buch einen Titel zu geben, der etwas anschaulicher macht, worum es in diesem Buch insgesamt geht. Einen Titel wie beispielsweise THE ACTS OF KING ARTHUR, was genügt, oder nötigenfalls auch THE ACTS OF KING ARTHUR AND HIS NOBLE KNIGHTS. Dies würde viel besser zusammenfassen, wovon das gesamte Werk handelt. Es gäbe auch eine Art neuer Sicht des ganzen Themas, vom Leben, nicht vom Tod her gesehen. Wir wollen uns später darüber unterhalten, aber ich glaube, ich bin bereit, das Wort »Morte« wegzulassen, weil es sich nur auf einen ganz kleinen Teil des Buches bezieht. Und wenn Caxtons Nachfolger aus dem Gesamttitel ein paar wenige Worte herausziehen konnten – warum kann ich nicht ein paar mehr herausnehmen, vor allem wenn sie treffender sind? Hier geht es ja im wesentlichen nicht um die Geschichte von Arthurs Tod, sondern um Arthurs Leben. Ich finde, es ist sehr wichtig, das im Titel auszudrücken. Wir werden natürlich nie erfahren, welchen Namen Malory selbst dem Werk gegeben hat. Es kann durchaus sein, daß Caxton den Titel nahm, den Malory verwendete, und das wäre dann der volle.
Was die genaue Arbeitsweise angeht, nach der ich vorgehen werde, so nimmt sie in meinem Kopf allmählich Gestalt an, aber ich glaube nicht, daß sie schon weit genug durchdacht ist, um jetzt darüber zu sprechen. Wir müssen aber ausführlich darüber diskutieren, ehe ich mich im Herbst an die eigentliche Arbeit mache. Außer meinen Tag- und Nachtträumereien über das Buch besteht, so finde ich, meine erste Aufgabe darin, meine Recherchen über das Mittelalter zu vervollständigen und in England das Material zu sammeln, das ich bei meiner letzten Reise ausgelassen habe.
Ich werde mich mit Chase über die Möglichkeit unterhalten, daß er in England zu mir stößt, weil ich glaube, daß zwei Augenpaare Nützlicheres leisten könnten, als nur ein einziges, und die Informationen, die zwei Leute zusammentragen, ließen sich zu einem Ganzen verbinden.
Meine Absicht geht dahin, den Text in eine Sprache zu bringen, die ein Leser von heute versteht und akzeptiert. Ich finde, es ist nicht nur wichtig, das zu tun, sondern es dient auch einem höchst nützlichen Zweck, da diese Erzählungen zusammen mit dem Neuen Testament die Basis des größten Teils der modernen englischen Literatur bilden. Und es läßt sich zeigen – und wird auch gezeigt werden –, daß der Mythos von König Arthur noch in der Gegenwart fortlebt und ein inhärenter Bestandteil des sogenannten »Western« ist, der heute einen so breiten Raum in den Fernsehprogrammen einnimmt – die gleichen handelnden Personen, die gleichen dramaturgischen Methoden, die gleichen Handlungen, nur etwas andere Waffen und zweifellos eine andere Topographie. Aber wenn man statt Indianern und Banditen Sachsen und Pikten und Dänen einsetzt, hat man genau die gleiche Geschichte. Wir begegnen dem Kult des Pferdes, dem Kult des Ritters. Der Bezug zur Gegenwart ist sehr eng, und ebenso zeigt die Gegenwart mit ihren Ungewißheiten sehr enge Parallelen zu den Unsicherheiten des 15. Jahrhunderts.
Es ist eigentlich eine Art nostalgischer Rückkehr in die gute alte Zeit. So war es, glaube ich, bei Malory, und ich glaube auch, daß unsere Fernsehautoren von heute das gleiche tun – exakt das gleiche, und seltsamerweise kommen sie auch zu genau den gleichen Symbolen und Methoden.
Daraus ergibt sich, daß die Arbeit, wie ich sie im Sinn habe, nicht unbedingt auf eine bestimmte historische Periode begrenzt ist, sondern Bezüge zur Gegenwart und deutliche Wurzeln in unserer lebendigen Literatur hat.
AN ERO UND CHASE – NEW YORK, 14. MÄRZ 1958
Es scheint, daß Krisensituationen für mich etwas Notwendiges sind. Neulich lag ich nachts wach im Bett und dachte, wie schön es wäre, wenn ich unter einem Sperrfeuer aus Schleudersteinen und Pfeilen – nicht sehr wahrscheinlich – zu Malory durchbrechen könnte, und plötzlich fiel mir ein, daß ich unter Druck dieser oder jener Art immer besser gearbeitet habe: Geldnöte, Todesfälle, emotionale Verwirrungen, Scheidungen – immer irgend etwas. Ja. die einzigen unproduktiven Zeiten, an die ich mich erinnern kann, waren solche ohne Druck. Wenn sich aus meinem bisherigen Weg überhaupt ein Fazit ziehen läßt, dann die Erkenntnis, daß Krisensituationen für mein kreatives Überleben notwendig sind – ein lächerlicher, ja, widerwärtiger Gedanke, aber so ist es nun einmal. Und deshalb flehe ich vielleicht besser nicht um eine Schonpause, sondern um Hunger, Pest, Katastrophen und Bankrott. Dann würde ich vermutlich wie ein Besessener arbeiten. Ich meine das einigermaßen ernst.
Ein merkwürdiges Gefühl des Schwebens ist über mich gekommen, ein Gefühl, wie wenn man in einem Kanu auf einem nebelverhangenen See dahintreibt, während Geister, Kobolde, aus Nebelschwaden gebildet, vorüberziehen – nur halb zu erkennen, nur teilweise sichtbar. Es wäre vernünftig, sich gegen dieses Verlorensein im Unbestimmten zu wehren, doch aus mehreren Gründen, die ich später darlegen werde, tue ich es nicht.
Es ist ja schön und gut, wenn man mit dem Vorteil der Rückschau auf das Mittelalter blickt. Die Geschichte ist, zumindest zum Teil, abgeschlossen. Wir wissen – in einem gewissen Maß –, was sich abgespielt hat und warum, wissen, wer oder was die bewegenden Kräfte waren. Dieses Wissen ist natürlich vielfach durch ein Denken gefiltert, das mit dem Denken des Mittelalters keinen gemeinsamen Erfahrungshintergrund hat. Aber der Autor des Morte wußte nicht, was sich vor seiner Zeit abgespielt hatte, was sich in seiner eigenen Zeit alles abspielte, noch auch, was in der Zukunft lag. Er hatte, wie auch wir heute, keinen Überblick, war rat- und hilflos – er wußte nicht, ob York oder Lancaster Sieger bleiben werde, und ebensowenig wußte er, daß das von allen Problemen das belangloseste war. Er muß empfunden haben, daß die Welt der Wirtschaft aus den Fugen geraten war, da es mit der Autorität der Grundherrn bergab ging. Die Revolten der nicht als Menschen zählenden Leibeigenen müssen ihn konsterniert haben. Überall ringsum hörte er Stimmen religiöser Schismen raunen, und das unvorstellbare Chaos einer Erschütterung der Kirche muß ihn umgetrieben haben. Diesen Umbrüchen, die wir nur gesund finden, konnte er sicher nur mit bangem Entsetzen entgegensehen.
Und aus diesem teuflischen Gebrodel des Wandels – so ähnlich dem heutigen – versuchte er eine Welt der Ordnung, eine Welt der Tugenden zu erschaffen, regiert von Mächten, die ihm vertraut waren. Und wie sah sein Baumaterial aus? Keine Regale mit wohlgeordneten Quellenwerken, nicht einmal die öffentlichen Urkunden seiner Zeit, keine einzige Gewißheit in bezug auf die Chronologie, denn ein solches System existierte nicht. Er besaß nicht einmal ein Wörterbuch irgendeiner anderen Sprache. Vielleicht hatte er ein paar Handschriften, ein Meßbuch, vielleicht die Stabreimdichtungen. Darüber hinaus hatte er nur sein Gedächtnis und seine Hoffnungen und seine Ahnungen. Wenn ihm ein Wort nicht einfallen wollte, mußte er ein anderes nehmen oder ein neues erfinden.
Und wie waren seine Erinnerungen beschaffen? Ich will es Ihnen sagen. Er erinnerte sich an dieses und an jenes Stück von dem, was er gelesen hatte. Er erinnerte sich an den tiefen und furchteinflößenden Wald und den Schlammbrei der Sümpfe. Er erinnerte sich, ohne sie bewußt zurückzuholen, an Geschichten, die am Kamin in der Halle des Gutshauses von Troubadouren aus der Bretagne erzählt worden waren, oder wußte noch davon, ohne sich genau zu erinnern. Und ebenso barg sein Gedächtnis, was nachts im Schafstall erzählt worden war – von einem Hirten, dessen Vater in Wales gewesen war und dort kymrische Geschichten von wundersamen und mystischen Dingen gehört hatte. Möglicherweise hatte er auch einige der »triads« und vielleicht auch manche Zeile aus den dunkelsinnigen Gedichten behalten, weil die Worte und Wendungen so machtvoll zum Unbewußten sprachen, obgleich ihre genaue Bedeutung verlorengegangen war. Der Schriftsteller hatte auch einen Himmel, über den die Historie zog wie Wolken, ohne zeitliche Ordnung, mit Menschen und Begebenheiten, die alle gleichzeitig nebeneinander existierten. Unter ihnen waren Freunde, Verwandte, Könige, alte Götter und Helden der Vorzeit, Geister und Engel und ein Tohuwabohu von Gefühlen und verlorengegangenen und wiederentdeckten Traditionen.
Und schließlich hatte er sich selbst als literarisches Material – seine Laster und Niederlagen, seine Hoffnungen und Beunruhigungen, die Dinge, die ihn zornig machten, seine Gefühle der Unsicherheit, was die Zukunft betraf, und seine Verwirrung angesichts einer rätselhaften Vergangenheit. Jeder Mensch, dem er begegnet, und jede Begebenheit, die ihm irgendwann in seinem Leben widerfahren war, war in ihm. Und in ihm waren auch seine körperlichen Beschwerden, die permanenten Bauchschmerzen, verursacht von der Kost seiner Zeit, die der Gesundheit nicht zuträglich war, vielleicht auch schlechte Zähne – eine allgemeine Plage –, möglicherweise eine zum Stillstand gekommene Syphilis oder die Enkelkinder der Pocken in entstellten Genen. Er hatte das kraftvolle, von Zweifeln unangefochtene System der Kirche, Erinnerungen an früher gehörte Musik, verfügte über die unbewußte Gabe der Naturbeobachtung, unbewußt, weil planvolle Beobachtung eine Eigenschaft späteren Datums ist. Er hatte den ganzen angehäuften Schatz des Volksglaubens seiner Zeit – Magie und Wahrsagerei und Prophezeiung, die Hexenkunst und ihre Schwester, die Heilkunst. All dies steckt nicht nur im Verfasser des Morte – es macht den Schriftsteller selbst aus.
Richten wir nun den Blick auf mich – den Schriftsteller, der, wenn er den Morte darstellt, auch den Mann darstellen muß, der ihn schrieb. Warum war und ist es notwendig, so viele Dinge zu lesen – von denen die meisten vermutlich nicht herangezogen werden? Ich finde es notwendig, möglichst viel darüber in Erfahrung zu bringen, was Malory wußte und was er empfunden haben mag, aber darüber hinaus muß ich mir auch klarmachen, was er nicht wußte, nicht wissen und auch nicht empfinden konnte. Ein Beispiel: Wüßte ich nichts über die Zeitumstände und die Einstellungen gegenüber Zinsbauern und Leibeigenen im Mittelalter, könnte ich nicht verstehen, warum Malory keinerlei Mitgefühl mit ihnen hat. Einer der größten Irrtümer bei der Rekonstruktion einer anderen Ära liegt in unserer Neigung, den Menschen jener Zeit ähnliche Gefühle und Einstellungen zuzuschreiben, wie wir sie haben. Ja, wenn ein Mensch von heute einem aus dem 15. Jahrhundert gegenüberstünde, wäre eine Kommunikation undenkbar, sofern er nicht gründliche Studien betriebe. Ich halte es immerhin für möglich, daß ein moderner Mensch mittels Wissen und Anstrengung das Denken eines Menschen aus dem 15. Jahrhundert verstehen und sich in einem gewissen Maß darin einfühlen kann – das Umgekehrte aber wäre ganz und gar unmöglich.
Ich glaube nicht, daß irgendwelche von den Recherchen für dieses Projekt Zeitvergeudung waren, denn wenn ich Malorys Denken vielleicht auch nicht in allem verstehe, so weiß ich doch wenigstens, was er nicht gedacht und gefühlt haben kann.
Wenn man all das bisher Gesagte bedenkt, muß einem klarwerden, daß das Gegenteil eine ausgesprochen schwierige Sache werden wird. Beim Übersetzen kann ich nicht alles aus dem Morte vermitteln, weil der moderne Mensch, so wie er denkt, ohne großes Wissen und viel Einfühlung in jene Zeiten ganz außerstande ist, einen großen Teil davon aufzunehmen. Wo dies der Fall ist, bleibt allein der Rekurs auf Parallelen. Vielleicht gelingt es mir, ähnliche Empfindungen oder Bildvorstellungen zu evozieren, identische aber können es nicht sein.
Die Schwierigkeiten in bezug auf diese Arbeit liegen für mich jetzt auf der Hand. Doch auch die Habenseite darf nicht geringgeachtet werden. Es gibt Volksgebräuche, -sagen und -sitten, die nie verlorengegangen und von Generation zu Generation weitergegeben worden sind. Dieser mythische Komplex hat sich essentiell nur wenig verändert, wenn auch seine Einkleidung von Epoche zu Epoche und von Ort zu Ort verschieden sein kann. Und innerhalb der Legende gewähren die Möglichkeiten der Identifikation Sicherheit, geradezu eine Gruppe von Reaktionen auf mentale Reize.
Dazu kommt, daß die Antriebe und Sehnsüchte der Menschen sich nicht verändert haben. Das wahre Verlangen eines Menschen richtet sich darauf, reich zu sein, behaglich zu leben, von anderen wahrgenommen und geliebt zu werden. Diesen Zielen gelten alle seine Wünsche, widmet er die meisten seiner Energien. Nur wenn es ihm versagt bleibt, sie zu erreichen, schlägt er eine andere Richtung ein. Innerhalb dieses Musters gibt es die Möglichkeit einer freien Kommunikation zwischen dem Verfasser des Morte und mir und all jenen, die mein Werk vielleicht lesen werden.
AN CHASE – LONDON, MAI 1958
Willkommen im London des 15. Jahrhunderts! Wir sind gerade von zweieinhalb Wandertagen mit Vinaver zurückgekommen. Da wir wegen einer Landwirtschaftsausstellung in Winchester für diese Nacht keine Hotelzimmer bekommen konnten, fahren wir morgen in der Frühe hin, so daß Vinaver selber John das Manuskript zeigen kann. Wir werden dort mit dem Direktor der Bibliothek zu Mittag essen, uns die Manuskripte ansehen und dann nach London zurückfahren. Sobald wir zurück sind, werden wir Sie augenblicklich anrufen, vermutlich so gegen halb sieben.
Wir haben für morgen (Mittwoch) abend eine Dinnerparty zu Ehren Malorys und als Willkommen für Chase Horton geplant – das Ehepaar Watson, die Vinavers, wir und Sie. Hoffentlich sind Sie nicht zu müde; die Vinavers müssen am Donnerstagmorgen nach Manchester zurückfahren, und dies ist für sie die einzige Möglichkeit, Sie kennenzulernen. Wir werden hier in unseren Zimmern einen Drink nehmen und unten im Grill essen.
Kann es nicht erwarten, Sie zu sehen!
Sehr liebevolle Grüße von uns beiden,
Elaine
Mittw. vormittag:
Soeben Telegramm erhalten. Rechnen darauf, daß Sie sich uns anschließen, einerlei, wie spät es wird.
AN ERO – NEW YORK, 7. JULI 1958
Ich glaube, dieser Brief ist mehr eine Art Wendepunkt als ein Arbeitsbericht, obwohl er das auch werden wird. Soweit es sich absehen läßt, sind die langwierigen, mühsamen und kostspieligen Recherchen für meine neue Arbeit am Morte d’Arthur beinahe abgeschlossen. Das heißt, ganz vollständig können sie nie sein, doch jetzt ist die Zeit gekommen, ans Schreiben selbst zu gehen.
Sie wissen ja von den Hunderten gekaufter und ausgeliehener Bücher, von den vielen Büchern, in denen ich nachgeschlagen habe, von den Mikrofilmen von Handschriften, die dem Studium nicht zugänglich sind, von der endlosen Korrespondenz mit Leuten aus diesem Fachgebiet und schließlich den beiden Reisen nach England und der nach Italien, unternommen, um Quellenmaterial zu erschließen und sich mit den Schauplätzen vertraut zu machen, die Malory beeinflußt haben müssen. Manche dieser Stätten befinden sich noch in dem Zustand, in dem er sie im 15. Jahrhundert kannte, und bei den anderen war es notwendig, einen Eindruck zu gewinnen, wie das Erdreich und die Atmosphäre, das Gras und das Licht, tagsüber wie nachts, beschaffen waren. Ein Autor wird von seiner Umgebung sehr stark beeinflußt, und ich war der Ansicht, daß ich den Menschen Malory erst und nur dann kenne, wenn ich die Stätten, die er gesehen hatte, und die Landschaften kenne, die sein Leben und sein Schreiben beeinflußt haben müssen.
Ich habe von Fachleuten auf diesem Gebiet Entgegenkommen und Zuspruch erfahren, vor allem von Dr. Buhler von der Morgan Library und Professor Vinaver von der University of Manchester. All denjenigen, die mir ihr reiches Wissen, ihre Bücher und Manuskripte zur Verfügung gestellt haben, wird natürlich in einer eigenen Vorbemerkung gedankt werden, aber ich möchte an dieser Stelle auf die gewaltige Arbeit hinweisen, die Chase Horton für die Vorbereitung dieses Projekts geleistet hat. Er hat nicht nur Hunderte von Büchern und Handschriften ausfindig gemacht, gekauft und geprüft, sondern mit seinem genialen Talent fürs Recherchieren Richtungen aufgezeigt und Quellen ausfindig gemacht, bei denen es sehr fraglich ist, ob ich sie gefunden hätte. Während der soeben abgeschlossenen Reise nach England hat er mit seinem Einsatz, seiner Planung und seinem Scharfblick Unschätzbares geleistet. Lassen Sie mich wiederholen: ich glaube nicht, daß ich ohne seinen Beistand diese Arbeit hätte bewältigen können oder das Thema so erfaßt hätte, wie ich es hoffentlich erfaßt habe.
Nun, da ich endlich ans eigentliche Schreiben gehe, muß ich ein Unbehagen eingestehen, das einem Gefühl der Furcht nahekommt. Es ist eine Sache, Material zusammenzutragen, aber eine ganz andere, es in endgültiger Form auf dem Papier Gestalt werden zu lassen. Doch dafür ist nun die Zeit gekommen. Ich habe vor, jetzt anzufangen und – abgesehen von den Dingen, die immer dazwischenkommen, und den normalen, von der Gesundheit und Familienpflichten bedingten Unterbrechungen – mich so rasch voranzuarbeiten, wie mein Wissen und mein Leistungsvermögen es mir möglich machen.
Ich habe viele Überlegungen zur Art des Vorgehens angestellt und bin schließlich zu dem Ergebnis gekommen, daß die beste Methode für mich aussieht wie im folgenden dargelegt. Vom Morte d’Arthur existiert nur eine einzige vollständige Fassung, und das ist Caxtons erste Ausgabe, die sich in der Morgan Library in New York befindet. Dann gibt es natürlich die ältere Handschrift im Winchester College in England, die in gewissen Punkten von Caxton abweicht und – abgesehen davon, daß am Ende bedauerlicherweise acht Bogen fehlen – vielleicht die einzige unanfechtbare Quelle ist. Wie die Dinge liegen, muß jede Arbeit an Malory sich auf eine Kombination dieser zwei Quellen stützen. Ich habe die beiden Originale nicht nur gesehen und geprüft, sondern besitze auch Mikrofilme von ihnen. Diese beiden Quellen müssen mir also als Grundlage für meine Übersetzung dienen. Den Caxton-Mikrofilm hat mir die Morgan Library freundlicherweise zur Verfügung gestellt, und den von den Winchester-Handschriften habe ich von der Kongreßbibliothek. Das also ist mein Ausgangsmaterial für die Übersetzung.
Ich habe vor, in ein modernes Englisch zu übersetzen und dabei Rhythmus und Tonfall zu bewahren – oder vielmehr den Versuch einer Neuerschaffung in einer Form zu machen, die auf das Ohr des Lesers von heute die gleiche Wirkung haben wird, wie sie das Mittelenglische im 15. Jahrhundert hatte. Ich werde an jedem Arbeitstag, bei fünf Tagen in der Woche, eine vorgegebene Zahl Seiten von der Übersetzung schreiben: sechs bis acht Seiten Übersetzung pro Tag. Außerdem werde ich jeden Tag die Interpretationen, Beobachtungen und Hintergrundfakten aus unserer umfangreichen Lektüre in Form eines Arbeitsjournals festhalten. Dadurch, daß ich beides nebeneinander tue, hoffe ich die interpretierenden Bemerkungen einzubringen, während die Erzählungen übertragen werden. Nach Abschluß der Übersetzung müßte ich dann eine große Menge interpretierenden Materials beisammen haben, das in den Geist der Erzählungen und in ihre Sinnaussage eingegangen ist. Die Einleitung, die einen sehr wichtigen Teil der Arbeit bilden sollte, werde ich für zuletzt aufheben, denn sie muß ein Gesamtbild der Arbeit in ihren beiden Teilen, Übersetzung wie Interpretation, bringen.
Ich denke, das ist zunächst einmal alles. Nach den jahrelangen Vorbereitungen brenne ich darauf, mich an die Arbeit zu machen. Gleichzeitig fürchte ich mich auch davor, finde aber, das ist nur gesund. Ich habe sehr viel Geld und noch mehr Zeit in dieses Projekt investiert. Wenn man den Umfang der Arbeit und den Umstand bedenkt, daß ich sie ganz allein bewältigen muß, ist es nur zu verständlich, daß mich eine lähmende Demut überkommt. Von jetzt an kann mir niemand mehr helfen. Jetzt geht es ums Schreiben, die einsamste Arbeit auf der Welt. Wenn ich daran scheitere, trägt nur ein einziger Mensch auf der Welt die Verantwortung dafür, aber ich könnte ein kleines Gebet von Ihnen und allen anderen Leuten gebrauchen, die der Meinung sind, diese Arbeit sollte die beste und auch die befriedigendste meines Lebens werden. Ein Gebet, das ist jetzt so ungefähr der einzige Beistand, auf den ich hoffen kann. Ihres. Und jetzt trete ich ein in die Dunkelheit meiner eigenen Gedankenwelt.
AN ERO – NEW YORK, 9. JULI 1958
Gestern begann ich mit dem allerersten Stück der Übersetzung, und heute habe ich daran weitergearbeitet. Vielleicht wird mir am Ende der Woche nicht zusagen, was ich fabriziert habe, doch vorläufig gefällt es mir. Es ist absolut faszinierend – der Prozeß, meine ich. Und ich habe sehr viele Ideen weggelassen, auf die ich seinerzeit gekommen war.
Sie erinnern sich, als ich zum erstenmal davon sprach, wollte ich Malorys Rhythmen und Sprachklänge beibehalten. Aber seither habe ich viel gelernt und viel nachgedacht. Und vielleicht gehen meine Gedanken in die gleiche Richtung wie die Malorys. Als er anfing, versuchte er, die »Frensshe« Bücher nicht anzutasten – im großen und ganzen Chrétien de Troyes. Aber beim Schreiben veränderte er dann doch. Er begann für das Ohr des 15. Jahrhunderts und für das englische Denken und Fühlen zu schreiben. Erst das hat seiner Arbeit ihre Größe gegeben. Seine Prosa war für die Menschen seiner Zeit akzeptabel, weil verständlich. Die Erzählungen und die Beziehungen zwischen ihnen sind unsterblich. Aber Ton und Erzählmethode verändern sich. Das Ohr des 20. Jahrhunderts kann die Ausdrucksform des 15. Jahrhunderts nicht aufnehmen, weder den Ton, noch den Satzbau, noch den Stil. Die natürliche Ausdrucksweise von heute ist kürzer und konziser. Und genau darauf mußte seltsamerweise auch Malory mit seinem Quellenmaterial achten. Als er Sicherheit gewann, begann er den Text für seine eigene Zeit zu kürzen und zu verknappen. Und er erklärte auch einige Dinge, deren Sinn dunkel war. Und eben das versuche nun auch ich zu tun. Ich möchte den Stoff nicht im Gewand der damaligen Zeit gestalten, sondern ihn unter Beibehaltung des Inhalts und der Details in eine unserer Zeit gemäße Form gießen.
Etwas Verblüffendes geschieht, sobald man von den Beschränkungen der Sprache des 15. Jahrhunderts abgeht. Die Erzählungen schließen sich sofort auf, sie kommen aus ihrer Gruft heraus. Die Kleingeister unter den Philologen werden diese Methode sicher nicht gutheißen, aber Vinaver und Buhler wird sie, glaube ich, sehr gefallen, denn es ist Malory – nicht wie er schrieb, sondern wie er heute schreiben würde. Ich kann Ihnen viele Beispiele nennen, was den Wortgebrauch betrifft. Nehmen wir das Wort worship, wie Malory es verwendet. Es ist ein altes englisches Wort, worth-ship, und bedeutet hohes Ansehen, das man durch persönliche Eigenschaften, Mut oder Ehrenhaftigkeit, erwarb. Es war nicht möglich, worshipfulness zu erben. Nur der eigene Charakter oder eigenes Tun trug einem die Bezeichnung ein. Mit dem 13. Jahrhundert nahm das Wort allmählich eine religiöse Konnotation an, die es ursprünglich nicht gehabt hatte. Und heute hat es seine Originalbedeutung verloren und ist zu einem Wort von rein religiösem Gehalt geworden. Vielleicht ist honor oder noch besser renown an seine Stelle getreten. Früher einmal hatte renown die Bedeutung, daß jemand wegen seiner persönlichen Qualitäten einen neuen Namen erhielt, und heute bedeutet es, daß man gefeiert wird, wenn auch noch immer wegen persönlicher Verdienste. Es ist nicht möglich, renown zu erben. Ich möchte Ihnen damit nur eine Vorstellung von meinem Experiment vermitteln. Und bislang scheint es zu gelingen. Inzwischen bin ich mit der Arbeit so vertraut, daß sie mir keine Angst mehr macht. Der Text muß auch ein bißchen erläutert werden. Zum Beispiel wenn Malory schreibt: »Uther sent for this duke charging him to bring his wife with him for she was called a fair lady and passing wise and her name was called Igraine.« Nun, jeder, der im 15. Jahrhundert dieser Geschichte zuhörte, wußte sofort, daß Uther auf Igraine schon scharf war, ehe er sie noch zu sehen bekam – und wenn der Hörer es nicht wußte, konnte der Erzähler es seinem Publikum durch eine hochgezogene Augenbraue oder ein Zwinkern oder einen beziehungsvollen Tonfall begreiflich machen. Unsere Leser hingegen, die nur die gedruckte Seite vor sich haben, müssen durch das Wort aufgeklärt werden. Und davor habe ich nun keine Scheu mehr. Viele der scheinbaren Lücken wurden zweifellos vom Erzähler durch Mimik und Gestik ausgefüllt, ich aber muß sie mit Wörtern schließen. Während ich früher Bedenken gehabt hätte, irgend etwas hinzuzufügen, zögere ich heute nicht mehr. Sie, Chase und Vinaver haben mir diese Furcht genommen.
Jedenfalls, ich habe mich in Bewegung gesetzt und fühle mich recht wohl und unbeschwert. Ich arbeite in der Garage, bis mein neues Arbeitszimmer fertig ist, und es geht gut so. Dem Himmel sei Dank für das große Oxford Dictionary. Ein Glossar ist etwas sehr Unbefriedigendes, das große Oxford-Lexikon aber ist das großartigste Buch auf der Welt. Ich stelle fest, daß ich ständig hinrenne. Und wo Malory, wie es oft geschieht, zwei Adjektive von derselben Bedeutung verwendet, nehme ich nur ein einziges. Denn einerseits muß ich den Text erweitern, und andererseits muß ich ihn für unser heutiges Auge und Ohr zusammenziehen. Es mag reizvoll sein zu lesen: »… to bring his wyf with him for she was called a fayre lady and passing wyse and her name was called Igraine.« Doch in unserer Zeit sagt es dem Leser mehr, wenn da steht: »… to bring his wife, Igraine with him for she was reputed to be not only beautiful but clever.«
Ich hoffe sehr, das liest sich für Sie nicht wie ein Vandalenakt. Ich glaube, der Inhalt ist nun ebenso gut und wahr und von ebensolchem Gegenwartsbezug, wie er es damals war, aber ich bin auch überzeugt, daß das Buch nur mit dieser Methode aus seiner mittelalterlichen Gruft befreit werden kann. Wenn es oder vielmehr sie (die Erzählungen) im 15. Jahrhundert erfunden worden wären, sähe die Sache anders aus – aber so war es ja nicht. Wenn Malory für seine Zeit Chrétien umschreiben konnte, dann kann ich Malory für meine Zeit umschreiben. Tennyson schrieb ihn für seine gefühlsselige viktorianische Leserschaft um und glättete. Unsere Leser aber können die Schroffheiten vertragen. Malory beseitigte einiges vom repetitiven Charakter der »Frensshe« Bücher. Ich finde es notwendig, die meisten Wiederholungen bei Malory zu tilgen.
Ich habe die Absicht, Ihnen regelmäßig in dieser Art zu schreiben. Es ist besser als Tagebucheintragungen, weil es an einen Adressaten gerichtet ist. Heben Sie die Briefe bitte auf. Ich werde meine Einleitung darauf aufbauen.
AN ERO UND CHASE – NEW YORK, 11. JULI 1958
In dem neuen Häuschen kann ich meine Wörterbücher unterbringen und muß nicht jedesmal ins Haus laufen, wenn ich ein Wort nachschlagen will. Aber es macht eigentlich nichts. Ich bin einfach schlecht aufgelegt. Ich werde mich an die Arbeit machen und meine schlechte Stimmung etwas austrocknen lassen.
Dabei habe ich recht gut gearbeitet und zudem an einem höchst schwierigen Teil. Wenn Malory alles in einen einzigen Korb zu werfen versucht – Handlung und Genealogie, Gegenwart und Zukunft, Persönlichkeit und Sitten –, muß ich es, soweit ich es kann, gewissermaßen auseinanderklauben. Ich bewege mich sehr langsam voran und bemühe mich, nicht zu viele Fehler zu machen, die später ausgebügelt werden müssen. Dieses Vorwärts und Rückwärts in der Zeit muß vielleicht noch überarbeitet werden. Damals, als die Leute wußten, daß die erste Elaine, Igraines Schwester, Gawains Mutter war, war es ja ganz in Ordnung, dieses Faktum einzuführen, ehe Gawain noch geboren war. Einen modernen Leser könnte es jedoch verwirren, da für ihn Genealogie nicht so schrecklich interessant ist, sofern es sich nicht um seine eigene handelt.
Elaine ist soeben mit Briefen von Ihnen beiden hereingekommen, und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr es mich freut, daß Sie mein Vorgehen gutheißen. Für mich war es, als hielte ich mir die Nase zu und spränge mit den Füßen voran in kaltes Wasser. Und es steht im Gegensatz zu allen hergebrachten Methoden der Arthur-Experten, aber, bei Gott, ich wette, Vinaver wird es gut finden.
Nun zu Charakter und Persönlichkeit. Ich bin überzeugt, daß beides da ist und seinerzeit verstanden wurde. Meine Aufgabe ist es, die »Stenographie« zu verstehen und beides herauszuarbeiten. Nehmen Sie ein verlorengegangenes Stückchen wie das folgende: Igraine hat ein Mann beigewohnt, den sie für ihren Gatten hielt, und später entdeckt sie, daß ihr Ehemann damals schon tot war. Nun schreibt Malory, als er sie zum erstenmal erwähnt, sie sei eine schöne und über die Maßen kluge Dame. Als sie erfährt, daß ihr Gemahl tot ist und daß sie auf eine Art, die sie nicht verstehen kann, getäuscht wurde, schreibt Malory: »Thenne she marvelled who that knight was that lay with her in the likeness of her lord. So she mourned pryvely and held her pees.«
Mein Gott! Hier hat man alles, was man an Charakter braucht, wenn man es nur mit einer Wiederholung zuspitzt. Ich habe folgendermaßen übersetzt: »When news came to Igraine that the duke her husband was slain the night before, she was troubled and she wondered who it was that lay with her in the image of her husband. But she was a wise woman and she mourned privately and did not speak of it.«
Sie sehen, es ist alles da. Ein ganzer Charakter – eine Frau, allein in einer feindseligen und rätselhaften Welt. Sie tat das einzig Sichere. »She held her pees.« Das Buch strotzt von solchen Dingen. Sie müssen nur in unser heutiges Blickfeld gebracht werden. Malorys Zuhörer kannten die Situation genau, in der Igraine war, ein moderner Leser hingegen hat keine Vorstellung vom Leben einer Frau im 15. Jahrhundert. Sie mußte sehr klug sein, um überhaupt am Leben zu bleiben.
Und lustige Dinge gibt es auch – manchmal nehmen sie die Form kleiner ironischer Bemerkungen, dann wieder satirische Gestalt an. Merlin spielt mit kindlicher Freude Possen, wenn er zaubert. Es bedarf nur eines Wortes, um zu zeigen, wieviel Spaß er daran hatte. Er ist wie ein Kind, das sich freut, wenn es Menschen in Erstaunen versetzen kann. Dann natürlich Merlins Ende – eine grausame, entsetzliche Situation und zum Totlachen komisch. Ein alter Mann, vernarrt in eine junge Frau, die ihm das Geheimnis seines Zaubers entlockt und die Magie dann gegen ihn richtet. Es ist die Geschichte meines Lebens und des Lebens vieler anderer Leute und kommt immer wieder vor, ein herzloser Witz – der mächtige, an Wissen reiche Mann, der von einem dummen, schlauen Mädchen seine wohlverdiente Strafe erhält. Oh, von solchen Dingen findet sich hier eine ganze Menge. Und ich verliere immer mehr meinen scheuen Respekt davor. Ich glaube, ich darf nicht übervorsichtig oder allzu respektvoll sein, sonst verliere ich, was er sagt. Aber ich möchte doch zunächst sehr langsam und sorgfältig arbeiten und sehr aufpassen, daß mir nichts von dem entgeht, was er sagt. Vermutlich werde ich im Laufe der Arbeit rascher werden.
Jetzt möchte ich einen Augenblick über Arthur als Helden sprechen. Für mich besteht kein Zweifel daran, daß Malory in ihm einen Helden sah, aber er war auch ein gesalbter König. Diese zweite Eigenschaft führte eher dazu, ihn Malory zu entrücken. Im 15. Jahrhundert hatte die Anschauung, daß der König kein Unrecht tun könne, noch unverminderte Gültigkeit. An seinen Irrtümern waren seine Ratgeber schuld. Das war nicht nur eine Idee – es war Faktum. Wenn er kein Unrecht begehen konnte, ist der Faktor des Mitgefühls aus dem Spiel. Trotzdem aber läßt Malory ihn eine Sünde mit seiner Halbschwester begehen, und damit sein Schicksal auf sich herabbeschwören. Ich weiß, daß in einigen der späteren Erzählungen Arthur uns nur als eine Art Scheherazade erscheint, aber er war auch das Herz der Bruderschaft. Ich glaube, daß ich daran etwas machen kann. Begreiflicherweise war Malory wohl mehr an fehlbaren Menschen interessiert – Menschen, die imstande waren, Irrtümer und sogar Verbrechen zu begehen. Auch uns Menschen von heute interessieren ja Verbrechen mehr als Tugenden. Doch für den heutigen Menschen ist nicht mehr nachvollziehbar, daß Malory die Bedeutung des Herrschers nie aus den Augen verlor. Hier gewinnt Elizabeths Idee vom Kreis besonderes Gewicht. Der Kreis konnte ohne Arthur nicht bestehen. Er verschwand ja auch, als Arthur nicht mehr da war. Nun, das sind einfache Dinge – aber warum hat niemand diesen Mann gelesen? Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, daß die Philologen ihn überhaupt nicht gelesen haben – zumindest nicht mit der Absicht zu verstehen, was Malory sagen wollte und was er seinen Zuhörern vermittelte. Ich könnte mich darüber endlos auslassen und werde es vermutlich auch tun, weil es mir selbst die Dinge klarmacht, wenn ich sie zu erklären versuche. Außerdem: Je tiefer ich eindringe, desto lohnender erscheint es mir. Der Text wird mitnichten kleiner – er bauscht sich größer und größer auf. Das Problem sind die einfachen Dinge, von denen manche in unserer Zeit nicht verstanden werden und manche vielleicht nicht verstanden werden können. Das Kostbare des Bluterbes – das ist eine Sache, an der ich arbeiten muß. Die Vorstellung, daß das einfache Volk eigentlich eine andere Spezies war, von Menschen aus dem Adel so verschieden wie Kühe. Hier ist kein Snobismus im Spiel. So war es einfach. Ich werde das jetzt für eine kleine Weile beiseitelegen.
AN CHASE – NEW YORK, 14. JULI 1958
Danke für Ihren guten Brief und auch für die Bücher, die ständig eintreffen. Man kann wohl nie genug Bücher haben.
Ich denke, ich werde weiterhin diese Arbeitsbriefe an Sie und Elizabeth schicken. Es ist sehr nützlich, sie zu schreiben, während ich am Arbeiten bin, finden Sie nicht?
AN CHASE – NEW YORK, 28. JULI 1958
Ich war in der letzten Zeit ziemlich unaufmerksam zu Ihnen, aber nicht undankbar. Die Bücher, die Sie mir geschickt haben, sind großartig. Nur war hier ein solcher Wirbel, daß ich immer mehr durcheinandergeraten bin. Das ist alles. Heute soll mit meinem Häuschen angefangen werden. Ich denke, danach wird alles ganz anders aussehen. Zumindest wird es mit dem Trubel ein Ende haben. Es ist alles aus Fertigbauteilen, so daß es innerhalb von nur ungefähr drei Tagen zusammengesetzt werden kann.
AN ERO UND CHASE – NEW YORK, 11. AUGUST 1958
Joyous Garde ist jetzt fertig. Zumindest ist es soweit fertig, daß ich darin arbeiten kann. Nach der Arbeit bleiben natürlich noch hundert kleine Verfeinerungen, die ich vornehmen und anbringen werde. Ich hatte noch nie einen Arbeitsraum wie diesen.
Ich werde jeden Tag am Morgen hier sein und arbeiten, bis ich finde, daß mein Tagewerk getan ist. Daß ich in jede Richtung sehen kann, lenkt mich ganz und gar nicht ab. Im Gegenteil. Daß ich in alle Richtungen sehen kann, erspart mir das Hinschauen. Das liest sich vielleicht widersprüchlich, ist es aber nicht. Es ist schlicht und einfach die Wahrheit. Nun ist es vorbei mit dem Herumtrödeln, mit den Ausreden und den Klagen. Jetzt bestehe ich darauf, daß ich an die Arbeit gehe, und es gibt absolut keine Ausrede mehr, nicht an die Arbeit zu gehen … Nie hatte jemand einen besseren Platz zum Schreiben.
Ich habe jetzt so ungefähr alles, was sich nach meiner Vorstellung irgend jemand, insbesondere ich, nur wünschen kann. Ein Boot, ein Haus, Joyous Garde, Freunde und Arbeit. Dazu bleibt mir neben der Arbeit noch etwas Zeit für all das übrige. Ich habe in der letzten Zeit viel über meine Zeitnot gegrübelt, was wohl von der Frustration darüber kam, daß ich wegen einer immer mehr überhandnehmenden Unordnung nicht zum Arbeiten kam. Jetzt ist das alles beseitigt, zumindest heute vormittag. Ich habe in der letzten Zeit schrecklich viel gejammert.
Das ist bei mir nichts Neues. Ich glaube, ich war schon immer so. Aber jetzt werde ich mir wirklich Mühe geben, damit das ein Ende hat. Zumindest ist das heute vormittag mein Vorsatz. Und ich hoffe sehr, daß er Bestand hat.
AN CHASE – NEW YORK, 21.OKTOBER 1958
Mir ist klar, nach all den Monaten unserer gemeinsamen Arbeit muß es recht primadonnenhaft wirken, daß ich mich so abgeschottet habe. Und es war mir nicht möglich, dafür eine einfache Erklärung zu geben, nicht einmal mir selbst. Sozusagen wie ein Motor, bei dem es in mehreren Zylindern nicht zündet, und ich kann nicht recht sagen, was daran schuld ist, obwohl ich – da ich von Motoren etwas verstehe – weiß, daß es nicht mehr als vier oder fünf Ursachen geben kann oder daß vielleicht mehrere Faktoren an den Schwierigkeiten beteiligt sind. Aber das ist mein Problem. Das einzige, was Sie tangiert, ist der Umstand, daß der Motor nicht läuft. Das Ganze muß etwas kränkend für Sie sein, und das möchte ich nicht. Es kommt von meinen eigenen Unsicherheiten.
Sie werden sich erinnern, daß ich einmal mit meiner eigenen Arbeit unzufrieden war, weil sie etwas Flaches bekommen hatte, und mehr als ein Jahr nichts getan habe. Es war ein Versuch, dieser Flachheit eine Chance zu geben, daß sie vergeht, und ich hoffte, ich könnte danach einen neuen Anfang mit einer Sprache machen, die mir vielleicht wie neu vorkommen würde. Aber als ich mich dann dranmachte, konnte von einer neuen Sprache überhaupt keine Rede sein. Es war eine blasse Imitation der alten, nicht so gut wie diese, weil ich eingerostet war, weil die Schreibmuskeln verkümmert waren. Also pickte ich daran herum und war darüber sehr bekümmert, denn ich wollte unbedingt, daß diese Arbeit das Beste würde, was ich jemals geschrieben hatte. Meine eigene Stagnation und totale Unfähigkeit, etwas zu tun, machten mich völlig ratlos. Schließlich beschloß ich, die Sache liegenzulassen und zu versuchen, die Muskeln an etwas anderem zu kräftigen – an etwas Kurzem, vielleicht sogar Leichtgewichtigem, obwohl ich weiß, daß es leichtgewichtige Dinge nicht gibt. Aber auch das fruchtete nichts. Ich schrieb fünfundsiebzig Seiten von dem Neuen, las sie und warf sie in den Papierkorb. Dann schrieb ich fünfzig Seiten und warf sie ebenfalls weg. Und dann kam mir blitzartig die Erleuchtung, was diese neue Sprache war. Sie war die ganze Zeit herumgelegen, man brauchte nur die Hand danach auszustrecken, und noch niemand hatte sie literarisch genutzt. Bei meiner »leichtgewichtigen« Sache ging es um das Amerika der Gegenwart. Warum sie nicht auf amerikanisch schreiben? Das Amerikanische ist eine hochkomplizierte und überaus kommunikative Sprache. Es wurde in Dialogen, bei unernsten Dingen und vielleicht von ein paar Sportreportern verwendet. Benutzt wurde es auch, wenn ein Ich-Erzähler eine Geschichte erzählt, meines Wissens aber nicht als ein legitimes literarisches Idiom. Während ich darüber nachdachte, hörte ich den Klang in den Ohren. Und dann probierte ich es aus, es kam mir richtig vor, und es begann dahinzuströmen. Es ist keine einfache Sache, aber ich finde sie gut. Für mich. Und plötzlich empfand ich, was Chaucer empfunden haben muß, als er feststellte, daß er in der Sprache schreiben konnte, die um ihn herum gesprochen wurde, und niemand ihn ins Gefängnis sperrte – oder Dante, als er das Florentinische, das die Leute sprachen, doch nicht zu schreiben wagten, zu poetischer Würde erhob. Ich gebe zu, mit diesen beiden Beispielen greife ich etwas hoch, aber unsereiner darf auf Chaucer doch wenigstens einen Blick werfen.
Jetzt scheint es in mir zu strömen, und ich stelle fest, daß ich abends nicht einschlafen kann, weil die Mythen immerfort an meinem akustischen Aufnahmeapparat vorbeifließen, und die Figuren wie Indianerhäuptlinge über meinen optischen springen. Ich spreche nicht von der Sprache der Analphabeten, obwohl die Traditionalisten sie als solche betrachten werden, genauso wie es bei Chaucer war. Die amerikanische Sprache ist etwas Neues unter der Sonne. Sie ist imstande, die ganze Hochbildung, die man besitzt, mit der Alltagssprache unserer eigenen Zeit zu verbinden. Sie ist nicht verniedlichend-oberflächlich und ist auch nicht regional begrenzt. Die Formen sind aus uns selbst herausgewachsen, haben aber alles aufgenommen, was schon vorher dagewesen ist. Vor allem aber hat sie eine Leichtigkeit und einen Fluß, einen Ton und einen Rhythmus wie sonst nichts auf der Welt. Es gibt keinen Zweifel, woher sie kommt, die Gebilde, die sie hervorgebracht hat, ihre Nebentöne sind aus unserem Kontinent gewachsen und aus den zwanzig Generationen vor uns in diesem Land. Sie gründet auf dem Englischen, ist aber gedüngt mit und befruchtet von den Idiomen der Neger und Indianer, vom Italienischen, Spanischen, Jiddischen, Deutschen, alles derart vermengt und vergoren, daß etwas Neues ans Licht getreten ist.
Damit also arbeite ich, und dies ist der Grund, warum ich manchmal himmelhochjauchzend und dann wieder zu Tod betrübt und verzweifelt bin. Aber es ist eine schöpferische Verzweiflung. Es ist eine gewöhnliche Sprache, wie es alle lebenden Sprachen sind. Ihre Figuren sind aus uns selbst herausgewachsen. Nun, das wär’s so ungefähr. Ich weiß nicht, ob ich es gut machen werde, doch wenn ich es nur ein Zehntel so gut mache, wie ich möchte, wird es besser werden, als ich erhoffen darf.
Wir kommen nächste Woche hinein und quartieren uns ein. Und wenn Ihnen verschwommen vorkommt, was ich schreibe, dann wissen Sie jetzt, warum. Ich bin glücklich und perplex, als hätte ich das große Los gezogen.
AN ERO – NEW YORK, 3. JANUAR 1959
Da die Arbeit nur sehr zäh vorankommt, grüble ich im Kreis herum über Dinge nach, was wieder die Arbeit nicht vorankommen läßt. Das Gefühl, all dies schon einmal erlebt zu haben, ist fast immer da. Ich zähle darauf, daß Somerset mir das gewisse Neue geben wird, das ich brauche.
Ich hege die große Hoffnung, daß ich auf Avalon mit dem uralten Wissen, dem Wissen vor dem Wissen, Verbindung aufnehmen kann und daß dies vielleicht ein Sprungbrett zum Wissen über das Wissen hinaus abgeben wird. Es ist vermutlich eine dreiste Hoffnung, aber alles, was ich im Augenblick erlangen kann. Und wahrscheinlich klammere ich mich an Hoffnungen. Zum Beispiel an die Hoffnung, zu einem Gefühl zu gelangen, das nicht verdünnt und verwässert ist. Möglicherweise ist das, womit ich zu kämpfen habe, einfach das Alter, ein Herabbrennen des Feuers, aber ich glaube es doch eigentlich nicht. Ich denke, es ist Ratlosigkeit, oder man könnte es auch einen Konflikt der Interessen nennen, wovon jedes das andere in einem gewissen Maß neutralisiert. Doch daran wäre niemand anders schuld außer mir selbst. Ich kann mir etwas abverlangen, wenn die Sache dafür steht. Und ich habe, falls das überhaupt möglich ist, einen noch höheren Respekt vor dem Metier als jemals vorher, weil ich seine gewaltigen Ansprüche und, in einem gewissen Maß, meine eigene Begrenztheit kenne. Die zornigen jungen Männer und die der Beat-Generation versuchen einfach, den anderen drei Dimensionen die Geschwindigkeit hinzuzufügen, wie es ja richtig ist. Denn mittlerweile ist endlich von den Sphären der reinen, abstrakten Mathematik nach unten gesickert, daß die Zeit die vierte Dimension ist. Aber das muß nicht unbedingt heißen: schnell. Es kann ebensogut langsam bedeuten, solange die Zeit in ihrem Ablauf die Dimension ist. Es verlangt eine Sprache, die noch nicht geschaffen ist, aber die Beats arbeiten daran, und vielleicht werden sie sie erfinden. Die Methode, Zeit noch an etwas anderem zu messen als an Sonne, Mond und in Jahren ist sehr jungen Datums. Als Julius Caesar den Anspruch erhob, von Venus abzustammen, stellte er sich seine Vorfahren nicht als ferne Ahnen vor. Faktoren wie Lichtgeschwindigkeit und Begriffe für das bisher nicht in Begriffe Gebrachte werfen nur Sand ins Getriebe, in meines wie in ihres. Mir ist klar, daß ich das, wonach ich mich in Somerset umsehen will, ebensogut hier finden kann. Ich bin kein solcher Narr, daß ich das nicht wüßte. Was ich mir wünsche, das ist ein Zündfunke, nicht eine Explosion. Die Explosion ist hier. Aber mein Wunsch geht dahin, auf den verwunschenen Feldern von Cornwall und in dem Bergwerksgebiet mit seinen Zinn- und Bleigruben, in den Dünen und den lebendigen Geistern der Dinge einen Weg oder ein Symbol oder einen Zugang zu finden. Ein alter Mann auf dem St. Michael’s Mount erzählte uns, er fange im Mondschein Wildkaninchen in Fallen und komme so zu seinen Mahlzeiten. Es ist irgendwo dort so alltäglich, daß die Einheimischen wissen, es ist da, es aber nicht sehen. Vielleicht ist das mein Zündfunke. Ich weiß es nicht. Aber möglich wäre es. Ich hoffe sehr, daß ich es bald wissen werde, falls es nicht so ist, damit ich nicht an Dinge klopfe, die wie Türen aussehen, aber keine Eingänge sind. Und seien Sie versichert, daß ich nach der Zukunft suche, wenn ich das Gerümpel der Vergangenheit durchstöbere. Das ist keine Sehnsucht nach dem Abgeschlossenen und Sicheren. Meine Suche gilt nicht einem toten, sondern einem schlafenden Arthur. Und wenn er schläft, dann schläft er überall, nicht nur in einer Höhle in Cornwall. So, jetzt ist es endlich einmal durchgedacht und ausgesprochen, und ich wollte es schon seit langem aussprechen.
Wenn es also ganz danach aussieht, daß eine Reise in den äußersten Süden Englands notwendig wird, ist das richtig, aber es geht mir um noch viel mehr. Nicht nur, daß die Zeit oder das Kontinuum wichtig ist, sondern ich erkenne allmählich auch, daß eine Reise zwei Zwecke und Ziele hat – wovon man sich entfernt ebenso wie das, worauf man zugeht.
AN CHASE – NEW YORK, 28. JANUAR 1959
Der einzige Waffenruhm, der in Malorys Erinnerung England zugefallen war, war der historische Sieg des Langbogens bei Crecy [recte: Crécy] und später bei Agincourt [recte: Azincourt]. Gesetze der Eduards machten Übungen mit dem Bogen obligatorisch. Als Malory Monks Kirby angriff, geschah dies mit Pickeln, Rammen, Bogen und Pfeilen. Er wurde beschuldigt, Buckingham mit Bogen und Pfeilen aufgelauert zu haben.
Auf seinen Raubzügen begleiteten ihn Freibauern. Die Waffe des Freibauern war der Langbogen. Malory schrieb sich eine gewisse taktische Begabung zu, wie aus manchen der Schlachtpläne im Morte hervorgeht. Doch im Morte ist weder vom Bogen noch davon die Rede, daß der Freibauer als Soldat eingesetzt wurde. Gemeine werden erwähnt, Freibauern hingegen nicht. Und doch gab es in der Geschichte seiner Gegenwart keinen englischen Erfolg, an dem der Bogen nicht beteiligt gewesen war. Ist es nicht bemerkenswert, daß kein Hinweis auf den Bogen in den Text geriet?
Die ganze Sache läßt mir keine Ruhe. Das Winchester-Mskr. kann früheren Datums sein oder auch nicht. Es ist auf Papier mit einem Wasserzeichen geschrieben wie denen von anno 1475. Zur Ausbesserung eines Risses ist ein Stück Pergament aufgeklebt, aus einer Ablaßbulle Innozenz’ VIII. von 1489, gedruckt von Caxton. Das Kopieren hatte noch viele Jahre nach Caxton nicht ganz aufgehört. Es ist also denkbar, daß das Winchester-Manuskript nach Caxtons Drucklegung des Morte geschrieben wurde. Es ist weitgehend in der Chancery-Kursiv- oder -Schreibschrift geschrieben, die das Modell für Caxtons frühe Drucktypen abgab. Es kann durchaus konservative Geister gegeben haben, die an die Druckerpresse einfach nicht glauben wollten. Genauso wie es heute Leute gibt, die sich noch immer nicht mit Paperbacks oder der Linotype anfreunden mögen. Zahlreiche Bücher werden nach wie vor im Handsatz gedruckt. Es ist gut vorstellbar, daß Bücherliebhabern der Buchdruck billig und wertlos erschien. Das ist nur eine Frage. Ich gedenke, eine Menge Fragen zu stellen.
Warum gelangt jeder Kommentator zu der Überzeugung, daß ein Mann alles, was er wußte, gelesen haben müsse? In einem Zeitalter der Rezitation muß das Gedächtnis der Menschen ungleich besser geschult gewesen sein als heute. Zum Beispiel müssen sich Männer von niedrigem Stand, wenn sie einen angesehenen Rezitator hörten, in vielen Fällen das Gehörte eingeprägt haben, und wenn sie mit anderen zusammenkamen, haben sie vermutlich wiederholt, was sie davon behalten hatten.
1450 besaß John Fastolf, ein reicher Mann, neben Meßbüchern und einem Psalter ganze achtzehn Bücher. Und das galt schon als eine ansehnliche Bibliothek. Er besaß, nebenbei bemerkt, das Liber de Ray Aethaur. Ist es denkbar, daß Malory von den »Frensshe« Büchern nicht in bewußter Absicht abwich, sondern weil ihn sein Gedächtnis im Stich ließ? Nur eine Frage. Ich habe viele Fragen.
Das Gedächtnis war für einen großen Teil der Bevölkerung das einzige Auf Zeichnungsgerät. Dem Inhalt von Vereinbarungen und Verträgen wurde dadurch Dauer verliehen, daß man sie jungen Gefolgsleuten ins Gedächtnis prügelte. Die Ausbildung der walisischen Dichter bestand nicht in Übungen, sondern im Auswendiglernen. Sobald einer 10000 Gedichte beherrschte, bekam er eine Anstellung. Das war immer so. Das Instrument, das vom geschriebenen Wort zerstört wurde, muß höchst imponierend gewesen sein. Die Pastons erwähnen, daß sie ihren Boten den Brief lesen ließen, so daß er ihn Wort für Wort aufsagen konnte, falls er ihm gestohlen wurde oder abhanden kam. Und manche von diesen Briefen waren sehr kompliziert. Wenn Malory im Gefängnis war, brauchte er vermutlich keine Bücher. Er kannte sie. Wenn meine Bibliothek aus nur zwölf Büchern bestünde, wüßte ich sie auswendig. Und wie viele Männer im 15. Jahrhundert hatten kein Gedächtnis? Nein – zu dem Buch, das man besaß, muß das entliehene und auch das gehörte Buch getreten sein. Herodots gewaltige Geschichte der Perserkriege war allen Athenern bekannt, und sie haben das Buch nicht gelesen, sondern es wurde ihnen vorgelesen.
Ich reite deswegen darauf herum, weil ich finde, dieser Punkt des Gedächtnisses hat nicht genug Beachtung gefunden. Alles Gehörte wurde katalogisiert, bis die Bibliothek der Erinnerungen gewaltige Ausmaße erreichte – und alles im Kopf gespeichert. In Shakespeares Zeit konnte sich ein Mann mit einem guten Gedächtnis eine ganze Szene aus einem Stück merken und sie hinterher niederschreiben. Das war die einzige Möglichkeit, sie zu stehlen.
Ich möchte nicht, daß Sie den Eindruck bekommen, mir sei allmählich allzusehr darum zu tun, wer Malory war. Ich finde nicht, daß das sehr wichtig ist. Aber ich möchte doch dahinterkommen, was er war und wie er sich zu dem entwickelte, was er war. Wenn der Malory des Morte der Malory der Verhöre und Anklagen und der Gefängnisausbrüche war, dann war er kein Junge aus dem höchsten Adel, der einsam in einem Elfenbeinturm saß. Sein Umgang bestand aus Tagelöhnern, Freibauern, Schneidern – und was ist zu Richard Irysheman zu sagen? Und die Namen – Smyth, Row, David, Wale, Walman, Breston, Thorpe, Hellorus, Hände, Tidman, Gibb, Sharpe? Das sind keine Namen von Adeligen. Es sind Bauern oder Gildenmitglieder. Es waren auch vom Leben abgehärtete Männer, ganz und gar eingestellt auf jene rauhen Zeiten.
Ich weiß, man kann sagen, die Form habe gewisse ritterliche Konventionen verlangt. Doch besonders in den letzten Teilen kamen ihm Dinge unter, die ihm vertraut waren, Bäume, Pflanzen, Wasser, Erdreich, Sprachgewohnheiten, Kleidungssitten. Warum dann nicht auch die Waffen, die er kannte – Bogen und Pfeile? Unter Beauchamp diente er mit einer Lanze und zwei Bogenschützen. Das ist ungefähr die übliche Mischung damals. Bei Agincourt [recte: Azincourt] waren von den geschätzten 6000 englischen Kämpfern etwa 4000 Bogenschützen. Sollte man also nicht erwarten, daß ein Mann, der später, aber bei ganz ähnlicher Taktik in Frankreich diente, ein bißchen von dem, was ihm vertraut war, mit unterbrachte, als er schließlich über den Krieg schrieb? In vielen anderen Punkten tat er das ja. Seine Vertrautheit mit Menschen und Tieren drängte die Konventionen des Versromans beiseite und nahm herein, was für die damalige Zeit ungeheuer realistisch war.
Inzwischen sind mehrere Tage vergangen. Ich kann wieder einmal nicht genug betonen, wie wenig die Philologen die mündliche Überlieferung in Betracht gezogen haben. Da sie Bücher als Kommunikationsträger gewöhnt sind, entgeht ihnen, daß noch vor gar nicht so langer Zeit die Bücher und das Bücherschreiben die seltenste Form der Vermittlung waren. Man denke nur an die Millionen Regeln für das Alltagsleben, für das Spinnen, die Landwirtschaft, das Fasten, Bierbrauen, Bauen, Jagen zusammen mit Handwerk und Kunsthandwerk! Nichts davon aufgeschrieben und gleichwohl weitergegeben. Ich möchte diesen Punkt stark betonen, vor allem in meinem eigenen Kopf.
Zweiter Punkt: die Vorstellung, daß der Zyklus Besitz der Auserwählten, der des Lesens und Schreibens Kundigen, der Kreise der Gelehrten gewesen sei. So war es nicht. Chaucer selbst hat uns die Antwort gegeben. Er und auch Boccaccio haben die zyklische Form nicht erfunden. Die Geschichten wurden erzählt, im Gedächtnis gespeichert, wiedererzählt. Und erst ganz zuletzt wurden sie aufgeschrieben. Und das Verblüffende daran ist, wie rein und mit wie wenig Veränderungen sie auf uns gekommen sind. Ein sorgloser Schreiber konnte größeren Unfug anrichten als hundert Erzähler.
Diesmal habe ich den Brief fertig bekommen.
AN CHASE – SOMERSET, 24. MÄRZ 1959
Die Landschaft wird jetzt saftig wie eine Pflaume. Alles ist am Sprießen. An den Eichen zeigt sich jene Färbung geschwollener Knospen, bevor sie grau und dann grün werden. Die Apfelblüten sind zwar noch nicht da, aber es kann nicht mehr sehr lange dauern. Wir hatten Ostwind, direkt aus Finnland und vom Weißen Meer her, und es war kalt. Dann schlug der Wind um und kam von Westen, wie in der Ode an [den Westwind]{*}, und sofort strömte die Wärme des Golfstroms ins Land. Ich bin jetzt zur Arbeit bereit, und das macht mir natürlich Angst. Muß mir die Nase zuhalten und mit den Füßen voran hineinspringen. Es hat gewissermaßen etwas Unwiderrufliches an sich. Ich nehme an, ich werde darüber hinwegkommen.
Der Mikrofilmprojektor arbeitet gut. Er steht in der tiefen Laibung meines Fensters und projiziert auf meinen Arbeitstisch. Alles in allem wird man hier in eine ferne Vergangenheit versetzt. Elaine ist auch sehr davon angetan. Diese Stimmung habe ich schon lange Zeit nicht mehr erlebt. Das 20. Jahrhundert erscheint einem ganz fern. Und in diesem Zustand möchte ich es einige Zeit halten. Raketen auf den Mond, das hat noch gefehlt! Ich frage mich, wie lange Eduard IV. sich halten kann.
Es war ein glücklicher Zufall, der mich hierher zog. Wie Sie wissen, dachte ich anfangs, es würde einige Zeit in Anspruch nehmen, bis ich mich eingewöhnt habe und ans Schreiben gehe. Aber es ist anders gekommen. Die Arbeit geht mir von der Hand, wie sie soll. Ich frage mich, warum ich so lange gebraucht habe, meinen Weg zu finden. Auf einer Wiese in Somerset ist mir die Erleuchtung gekommen, und das ist wahr gesprochen. Und Sie haben es vermutlich schon die ganze Zeit gewußt. Ich habe mir folgendes durch den Kopf gehen lassen:
»Malory schrieb diese Geschichten für seine Zeit und an sie gerichtet. Wer sie hörte, erkannte jedes Wort und verstand jede Anspielung. Nichts daran war dunkel, er schrieb die klare, gemeine Rede seiner Zeit und seines Landes. Doch das hat sich verändert – die Wörter und die Anspielungen sind nicht mehr Gemeingut, denn seither ist eine neue Sprache ins Leben getreten. Malory hat die Geschichten nicht erfunden. Er schrieb sie einfach für seine Zeit auf, und seine Zeit verstand sie.« Und plötzlich, Chase, hatte ich hier, auf seinem Heimatboden, keine Angst mehr vor Malory und werde auch nie mehr Angst vor ihm haben. Dies mindert meine Bewunderung nicht, aber es behindert mich auch nicht. Nur ich kann dieses Buch für meine Zeit schreiben. Und was den Schauplatz betrifft – der Schauplatz ist nicht eine kleine Insel inmitten eines silbernen Meeres, sondern die Welt geworden.
Und damit begannen, beinahe wie durch einen Zauber, die Worte zu strömen, in einem gezügelten, straffen, ökonomischen Englisch, ohne Akzent, nicht ortsgebunden. Ich habe kein Wort zu Papier gebracht, das nicht auf seine Allgemeinverständlichkeit abgewogen wurde. Wo meine Zeit Lücken nicht schließen kann, erweitere ich, und wo meine Zeit unwillig über Wiederholungen würde, streiche ich. Das gleiche hat Malory für seine Zeit getan. So einfach ist die Sache, und ich glaube, meine Prosa ist die beste, die ich je geschrieben habe. Ich hoffe, daß es so ist, und ich glaube es auch. Dort, wo ich auf dunkle Stellen oder auf Paradoxes stoße, lasse ich mich von der Intuition, meiner Urteilskraft und der Aufnahmefähigkeit unserer Zeit leiten.
Ich bemühe mich, das Produktionstempo zu drosseln. Ich möchte nicht, daß es ein Sturzbach wird, sondern ruhig herausfließt, jedes Wort eine Notwendigkeit, die Sätze melodisch ins Ohr dringend. Was für eine Freude! Mich plagen keine Zweifel mehr. Ich kann es schreiben, und ob ich es kann! Wollte Sie das nur wissen lassen. Und ich schreibe es ja auch, »ludly sing cucu«
AN ERO – SOMERSET, 30. MÄRZ 1959
Ich habe vergessen, wie lange es her ist, seit ich Ihnen geschrieben habe. Die Zeit verliert ihre ganze Bedeutung. Der Friede, von dem ich geträumt habe, ist da, ist Wirklichkeit, dick wie ein Stein und fühlbar, etwas zum Anfassen. Die Arbeit geht ihren gemächlichen, stetigen Gang, wie der Schritt beladener Kamele. Und ich habe so viel Freude an der Arbeit. Vielleicht kommt es von der langen Pause oder vielleicht ist es nur die Wirkung von Somerset, aber die Tricks sind weg, und ebenso ist das Polierte, sind die technischen Kniffe und ist der Stil verschwunden, all das, worin ich nur eine Art literarischer Couture sehen kann, wechselnd wie die Jahreszeiten. Statt dessen sind die Wörter, die meiner Feder zuströmen, ehrliche, kraftvolle Wörter, und sie brauchen keine Adjektive als Krücken. Es sind viel mehr, als ich überhaupt benötigen werde. Und sie fügen sich zu Sätzen zusammen, die mir einen Rhythmus, so ehrlich und unerschütterlich wie ein Herzschlag, zu haben scheinen. Ihr Ton klingt mir süß in die Ohren, wie mit der Kraft und der Selbstgewißheit unbeschwerter Kinder oder alter Männer, die auf ein erfülltes Leben zurückblicken.
Ich komme mit meiner Übersetzung des Morte voran, aber von einer Übersetzung hat die Arbeit nicht mehr als Malorys Werk. Ich behalte alles bei, aber es ist ebenso sehr von mir, wie sein Werk von ihm war. Ich habe Ihnen geschrieben, daß ich glaube, ich habe vor Malory keine Angst mehr, weil ich weiß, ich kann für meine Zeit besser schreiben, als er es gekonnt hätte, genauso wie er für seine Zeit besser schrieb als irgendein anderer.
Die Freude, die ich daran habe, läßt sich nicht beschreiben. Ich stehe schon früh am Morgen auf, damit ich den Vögeln eine Zeitlang zuhören kann. Sie sind um diese Stunde stark beschäftigt. Manchmal tue ich mehr als eine Stunde nichts anderes als schauen und lauschen, und daraus erwächst eine Fülle von Ruhe und Frieden und etwas, was ich nur als ein kosmisches Gefühl bezeichnen kann. Und wenn dann die Vögel ihre Geschäfte besorgt haben und die Landschaft an ihr Tagewerk geht, steige ich hinauf zu meinem kleinen Zimmer, um zu arbeiten. Und die Zeit, die zwischen Hinsetzen und dem Beginn des Schreibens vergeht, wird mit jedem Tag kürzer.
AN ERO – SOMERSET, 5. APRIL 1959
Wieder eine Woche vorüber, und womit ist sie vergangen? Mit der täglichen Arbeit und Briefeschreiben und der Ankunft des Frühlings und Gartenarbeit und Besuchen bei Morlands in Glastonbury, um beim Bearbeiten der Schafshäute zuzusehen, wie sie seit prähistorischen Zeiten bearbeitet werden. Ich weiß erstens nicht, wie die Woche so rasch vergehen, und zweitens nicht, wie in dieser Woche so viel zustande gebracht werden konnte.
Die Arbeit macht mir nach wie vor Freude und zugleich ist sie eine Strapaze. Seit Ende vergangener und bis in die nächste Woche die Schlacht bei Bedgrayne, ein schreckliches Tohuwabohu, sogar bei Malory. Ich muß nicht nur klären, was sich abspielte, sondern auch warum und stark kürzen. Die Menschen von heute können endlos Baseball-Berichte lesen, deren Erzählniveau nicht sehr hoch ist, und die Menschen des 15. Jahrhunderts waren imstande, sich unzählige Zweikämpfe ohne viel Abwechslung erzählen zu lassen. Ich muß eine Brücke herstellen, dergestalt, daß die Schlacht wichtig und packend bleibt, sich aber nicht in hundert einzelnen Rittern verliert, die gegeneinander anstürmen, und dennoch den Eindruck erhalten, daß eine Schlacht damals aus vielen Einzelkämpfen von Mann zu Mann bestand. Das ist das gräßlichste Schlamassel im ganzen ersten Teil. Malory bringt es fertig, den Kämpfen nicht weniger als sechs Seiten zu opfern, doch für die beiden wichtigsten Ereignisse im ersten Teil – wie Mordred empfangen wird und die Begegnung mit Guinevere – hat er nur jeweils zwei Zeilen übrig. Ich kann nicht viel Zeit dafür aufwenden, aber ich muß ihre ungeheure Bedeutung herausarbeiten. Wie Sie sehen, nie ein langweiliger Augenblick.
Nun eine Frage für Chase zum Nachgrübeln: Wenn die Schlacht zu Ende ist und Merlin sich schnurstracks nach Northumberland begibt und »hys mayster Blayse« alle Einzelheiten und Namen der Teilnehmer berichtet. Und Blayse schrieb die »batayle« Wort für Wort auf, so wie Merlin sie ihm erzählte … Und Merlin berichtete Blayse über alle zu Arthurs Zeit geschlagenen Schlachten und über all die ruhmvollen Taten der Mitglieder von Arthurs Hof, und Blayse schrieb sie nieder … Nun – wer zum Teufel war dieser Blayse, oder wie sah Merlin ihn? Kommt er in den »Frensshe« Büchern vor? Hat Merlin ihn erfunden? Ich würde gern erfahren, was Chase dazu meint.
AN CHASE – SOMERSET, 9. APRIL 1959
Ich muß aufpassen, daß ich nicht wiederhole, was ich bereits Elizabeth geschrieben habe und was Sie zweifellos gesehen haben. Heute morgen ein Brief von Jackson. Sie haben die Wörterbücher, und ich habe sie bestellt. Sie haben kein Lexikon des Kornischen, schlagen mir aber vor, es hier in der Gegend zu versuchen, was ich tun werde. Auch kein mittelenglisches, und mein eigenes habe ich nicht mitgebracht. Sie schreiben, die Michigan University Press habe es von Oxford [der Oxford University Press] übernommen. Ich glaube, meines ist von Oxford, aber ich habe es zu Hause gelassen. Zum Teufel, ich brauche eines. Könnten Sie mir bitte entweder mein eigenes oder ein anderes schicken? Ich denke, das ist alles, was ich brauchen werde. Es geht zumeist um Wörter und ihre Bedeutungen. Das übrige werde ich bei Malory oder in meinem eigenen Kopf finden. Ich komme jetzt im Merlin-Teil zu einer völlig neuen Sicht Arthurs und infolgedessen, nehme ich an, auch zu einer neuen Sicht von Malory und mir selbst. Enorm Tiefgründiges hier für den, der sich dafür interessiert. Vom Traum an (Schlangen) und durch die Verfolgung des Tiers bis zur Erkennungsszene mit der Mutter ist alles aus einem Guß. Aber Sie werden ja sehen, was ich daran gemacht habe, wenn ich es Ihnen schicke. Ich werde es, um einem Verlust vorzubeugen, sicherheitshalber auf Band sprechen und wahrscheinlich den handgeschriebenen Text an Sie schicken. Mary Morgan kann ihn abtippen, mehrere Kopien auf Durchschlagpapier, und dann bekomme ich vielleicht eine davon, aber für den Fall, daß irgend etwas passieren sollte, habe ich immerhin die Bandaufnahme. Es passiert aber nie, wenn man Vorsichtsmaßregeln trifft. Ich hätte gern, daß Sie eine Vereinheitlichung der Namen von Personen und Lokalitäten in Angriff nehmen und sie auch mit den heute gebräuchlichen identifizieren, zumindest, soweit möglich, die Schauplätze, an die Malory beim Schreiben dachte. Was die Personennamen angeht, sollten sie aufs einfachste und so reduziert werden, daß sie sich leicht aussprechen lassen. Und alle ungewöhnlichen vereinheitlichen. Das ist für sich schon eine Menge Arbeit, aber ich weiß, daß Sie bereits viel daran gemacht haben und also gut vorbereitet sind. Der Merlin-Teil war eine Hundearbeit mit all dem Wirrwarr darin, aber ich glaube, es wird Ihnen gefallen, wie ich die Schlacht bei Bedgrayne angepackt habe – eine Passage, kann ich Ihnen versichern, die sehr schwer darzustellen ist. Ich kann Ihnen auch gar nicht oft genug sagen, was für eine gute Idee es war hierherzukommen. Wenn sonst nichts, allein die Ruhe und das Arbeitstempo lohnen es.
Nächste Woche drei Tage in London. Sozusagen, um mir für den Ritter mit den zwei Schwertern den Gaumen frei zu spülen. Das ist ein Stück mit großem Tiefgang und in seiner Art ganz und gar anders. Es atmet den Geist der griechischen Tragödie – ein Mensch gegen das Schicksal, von seinem Tun und Wollen nicht zu beeinflussen, und ich muß daraus machen, was ich nur kann. Die Form ist im Morte schon ganz da, aber manchmal außerhalb der Perspektive des Lesers von heute. Das ist meine Aufgabe: die Episode ins moderne Blickfeld zu bringen. Und ich bin wirklich begierig darauf zu erfahren, was Sie von dem halten, was ich daraus mache. Wie es scheint, hat bisher noch niemand diesen Versuch gemacht. Ich frage mich, warum.
Vinaver sagt, niemand denkt daran, zu Malory zurückzugehen. Nun, ich tue es, und ich finde es sehr lohnend und hoffe, daraus etwas Lohnendes zu machen.
Wir haben Aprilwetter, sehr wechselhaft mit Schauern und dann wieder strahlendem Sonnenschein in den letzten Tagesstunden. Gestern abend ist der Gasofen ausgegangen. Ich mußte ihn wieder zum Funktionieren bringen, und dabei habe ich wieder etwas gelernt.
Im uralten hinteren Teil von Mr. Windmills
Eisenwarenhandlung gibt es eine Schmiedeesse und Werkzeuge aus dem
Mittelalter. Mr. Arthur Strand arbeitet noch heute damit und kann
alles machen, was man nur wünscht. Wir haben uns angefreundet.
Vielleicht werde ich ihn bitten, mir ein Beil zu machen oder
wenigstens eines umzuschmieden. Vielleicht erlaubt er mir auch, daß
ich selber eines auf seiner Esse mache. Ich hätte gern ein Beil von
der Art, wie es die skandinavischen und sächsischen Krieger zum
Kämpfen und Hacken mit sich umhertrugen. Die modernen Beile haben
alle ein gerades Blatt, so wie hier: 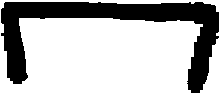 Dabei wird die Wucht des
Schlages auf die ganze Länge des Blattes verteilt. Das alte
hingegen war so geformt:
Dabei wird die Wucht des
Schlages auf die ganze Länge des Blattes verteilt. Das alte
hingegen war so geformt: 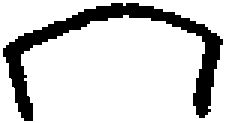 Die Wucht des Aufpralls war auf einen kleinen
Bereich konzentriert, was dem Beil eine viel größere
Durchschlagskraft verlieh. Mit dem alten Beil kann man deswegen
praktisch schnitzen. Ich muß mit Mr. Arthur darüber sprechen.
Vermutlich kann er auch ein paar Breitbeile für mich auftreiben. An
den Abenden nehme ich mir wieder meine Schnitzarbeit vor … Ich kann
dabei ungestört weiterdenken, und gleichzeitig haben die Hände
etwas zu tun. Im Augenblick schnitze ich Löffel für die Küche – aus
Stücken von altem Eichenholz.
Die Wucht des Aufpralls war auf einen kleinen
Bereich konzentriert, was dem Beil eine viel größere
Durchschlagskraft verlieh. Mit dem alten Beil kann man deswegen
praktisch schnitzen. Ich muß mit Mr. Arthur darüber sprechen.
Vermutlich kann er auch ein paar Breitbeile für mich auftreiben. An
den Abenden nehme ich mir wieder meine Schnitzarbeit vor … Ich kann
dabei ungestört weiterdenken, und gleichzeitig haben die Hände
etwas zu tun. Im Augenblick schnitze ich Löffel für die Küche – aus
Stücken von altem Eichenholz.
Ich denke, ich mache ein bißchen an der Kopie weiter. Ich bin noch nicht richtig in Arbeitsstimmung.
AN CHASE – SOMERSET, 11. APRIL 1959
(Fortsetzung des Briefes vom 9. April 1959)
Heute ist Sonnabend. Ich weiß nicht, wie die Zeit vergangen ist. Ich werde den Merlin-Teil entweder heute oder morgen abschließen und finde ihn wirklich gut. Doch wenn ich auf den Seiten zurückgehe, finde ich viele Kleinigkeiten, an denen ich noch etwas ändern möchte. Deshalb finde ich, es wäre ein Fehler von mir, Ihnen das Manuskript zu schicken, nur damit es schnell geht. Ich werde es hier abtippen lassen und das Typoskript korrigieren, bevor ich es absende. Das bringt den Text seinem richtigen Zustand viel näher. Ich bin dann mehrmals darübergegangen, so daß das, was Sie bekommen werden, auf eine korrigierte dritte Rohfassung hinausläuft, und wenn dann Mary Morgan die Umarbeitungen hineintippt, wird es dem Endzustand viel näher sein. Es wird zwar länger dauern, bis Sie es bekommen, aber ich denke, das Warten wird sich lohnen.
So, der Merlin-Teil ist beinahe geschafft und viel tiefer und wärmer im Ton ausgefallen, als ich gedacht hatte. Ich hoffe sehr, daß es mir gelingt, das Beste daraus zu machen. Meine Arbeit bisher bereitet mir viel Freude. Ich weiß zwar nicht, ob es beim zweiten Lesen dabei bleiben wird. Aber das Gefühl befriedigt einen doch.
Ich habe ein paar ganz ordentliche Kochlöffel geschnitzt, und sie sind mir so gut gelungen, daß ich Salatgabeln entworfen habe, die ich für Elaine schnitzen möchte. Die Mulde der einen wird die Tudor-Rose, und die der anderen das dreifache päpstliche Kreuz zeigen, und wenn sie beim Salatmischen aneinanderstoßen, kommt in die Schüssel auch eine Kleinigkeit Geschichte. Ich hoffe, daß sie mir hübsch gelingen. Eine nette Idee, finde ich.
Jetzt ist es Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Ich werde das hier [den Brief] später beenden. Jetzt muß ich einen sonderbaren Kampf schildern, und dann kommt das Schwert – das Schwert der Schwerter.
Inzwischen habe ich das geschafft – und es gefällt mir. Ich werde den Brief jetzt abschließen und auf die Post geben. Heute sind Bücher eingetroffen, die wir bestellt hatten. Zwei Bände Geschichte Somersets, 1832, mit allen Einzelheiten über Dugdale. Das ist eine Freude!
Ich gehe jetzt nach unten, um mich an den Somerset-Büchern zu erfreuen. Graham Watson hat sie für uns aufgetrieben, und es sind große Raritäten.
AN ERO – SOMERSET, 10. APRIL 1959
Wieder eine Woche, die schnell vergeht. Ich werde den Merlin-Teil diese Woche abschließen, das Schwierigste von allem, wie ich finde. Ich glaube auch, daß Malory damit die größte Mühe gehabt haben muß, denn hier müssen der Hintergrund und die Wirrnisse um Arthurs Geburt und Thronbesteigung, die Rebellion und das Geheimnis seiner Geburt untergebracht werden. Es läuft auf eine lange und dissonante Chronik hinaus. Aber ich denke, es ordnet sich jetzt zu etwas, das auch in moderner Prosa Fluß bekommt. Allerdings kann es natürlich nicht die abgerundete oder elliptische Form mancher der späteren Erzählungen gewinnen, die keine Rückblenden verlangen und in denen das Figurenensemble nicht so gewaltig ist. Die Schlacht bei Bedgrayne hat mir furchtbar zu schaffen gemacht, aber ich glaube, jetzt kommt sie richtig heraus. Ich mußte darauf achten, daß sie ständig in Bewegung und Wallung ist, und habe sowohl etwas von der Erregtheit wie von der Traurigkeit zu vermitteln versucht, die darin liegen. Das Ende des Buches ist gewissermaßen eine Art magischer Traum, erfüllt von Trübsal und schlimmer Vorahnung, der Traum eines Psychiaters vom Himmel, wenn er sich etwas daraus machte. Vom Schlangentraum bis zu dem Punkt, an dem Arthur die Legitimität seines Thronanspruchs enthüllt wird, ist alles aus einem Guß. Ich habe den Eindruck, daß Arthur der Erkenntnis entgehen wollte, denn er ängstigte sich davor, was sich ihm vielleicht enthüllen würde. Er sucht sogar nach Problemen, versucht sich mit Taten vom Denken abzulenken. Das ist Erfahrungen aus unserer eigenen Zeit nicht unähnlich, selbst die Kleidungssymbole haben wir noch unverändert. Ich behandle all dies wie die Randbezirke eines Traums. Jedenfalls, es geht voran, und nach dieser schrecklichen ersten Erzählung kann nichts mehr kommen, was ebenso schwierig ist.
AN CHASE – SOMERSET, 11. APRIL 1959
(von Elaine Steinbeck)
Von Jackson sind heute vormittag die beiden Bände History and Antiquities of Somerset von Phelps gekommen, und wir mußten sie einen Tag lang verstecken, damit überhaupt etwas gearbeitet wurde. Sie werden uns eine wunderbare Lektüre am Kaminfeuer bescheren. – John arbeitet heute an der Sequenz »The Lady of the Lake« und taucht nur alle zwei, drei Stunden auf, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Er fängt an, mit dem Buch zu leben und zu atmen. Abends schnitzt er Löffel für unsere Küche und spricht dabei über Arthur und Merlin.
Heute berichtet uns Eugène Vinaver in einem Brief, welches Heimweh er nach Frankreich hat, aber er fügt hinzu: »Es ist besser, hier zu sein, solange ich mit einem englischen Buch beschäftigt bin. Englische Wörter fallen einem leichter ein, wenn die Blumen und die Bäume um einen herum englische Namen tragen.« Er spricht zwar von sich, aber ich glaube, es trifft auch auf John zu, finden Sie nicht auch? Man hat das Gefühl, Arthur ist hier.
Vinaver zitiert auch etwas, was John einmal geschrieben hat: »Ich erzähle diese alten Geschichten, aber es geht mir eigentlich nicht darum, sie zu erzählen. Ich weiß nur, welche Gefühle ich bei den Lesern auslösen möchte, wenn ich sie erzähle.« Ist das nicht wunderbar gesagt? Vinaver meint, es sei der wahrste und bedeutendste Satz, den er in all den unzähligen Büchern über Bücher gefunden habe.
AN ERO – SOMERSET, 12. APRIL 1959
Diese langen und schwerfälligen Chroniken werden wohl weitergehen. Wieder eine Woche vorbei oder vielmehr Vergangenheit, und heute sind wir seit einem Monat in diesem Haus.
Ein Monat in diesem Haus, und es kommt einem wie unser eigenes vor. Ich hatte gedacht, es würde mindestens einen Monat und möglicherweise noch länger dauern, bis ich mich in meinen Arbeitssessel zwänge, und heute schließe ich den Merlin-Teil ab, die schwerste und komplexeste von all diesen Erzählungen. Malory hat sich dabei auch nicht wohl gefühlt. Er war verdrossen und unschlüssig, wie er anfangen sollte, ist zurückgegangen und vorwärtsgestürmt, und manchmal widersprach er dem, was er eine Seite vorher geschrieben hatte. Aber ich glaube, ich habe jetzt Ordnung hineingebracht, zumindest soweit, daß ich selbst zufrieden bin. Nichts wird mehr so schwer werden. Ich spüre, was im Kopf dieses Mannes vor sich ging. Er schrieb Dinge nieder, ohne zu wissen, daß er sie hinschrieb, und das macht den Reichtum aus, wenn er auch mitunter sehr tief verborgen ist. Nun, wir werden ja sehen, ob es gut geworden ist oder nicht. Ich habe so ein Gefühl, das mir sagt, ja.
Drei Tage in London und dann zurück zu der merkwürdigen und düsteren Geschichte von dem Ritter mit den zwei Schwertern. Ich glaube, ich verstehe sie – eine Art Tragödie von Fehlern aus guter Absicht, von denen jeder aus dem letzten erwächst, und sie türmen sich aufeinander, bis eine Umkehr unmöglich wird. Es ist die einzige Erzählung ihrer Art in dem ganzen Zyklus. Wenn ich damit fertig bin, sind wir mitten im Frühling, und dann werde ich mir einen oder zwei Tage in der Woche frei nehmen, um mich umzusehen. Das Gerüst wird dann stehen, und ich werde keine Angst haben, eine Pause einzulegen. Doch bis dahin möchte ich meinen Arbeitsrhythmus nicht unterbrechen.
Meine Freude an der Arbeit hält an, ja, sie nimmt noch zu. Ich glaube, ich habe aus Arthur einen Charakter herausgeholt, den man versteht. Er war ja für unsre modernen Augen immer die schwächste und kälteste Figur. Und wenn ich dazu imstande bin, werden die reicher angelegten Episoden, Lancelot und Gawain, ein reines Kinderspiel sein. Ich habe für Merlin auch eine Schlußzeile. Dieser Kunstgriff war im 15. Jahrhundert nicht bekannt, aber der Leser von heute braucht ihn. Und so bekommt er ihn.
AN CHASE – SOMERSET, 20. ARPIL 1959
Zu den Büchern: Ich möchte Sie bitten, daß Sie versuchen, die von Ihnen erwähnten Lexika zu besorgen. Es eilt jetzt nicht so sehr damit, weil ich ja das angelsächsische, das mittelenglische und das zweibändige Oxford habe. Das große Oxford-Lexikon habe ich Bob Belt geschenkt, der dieses Haus für uns gefunden hat. Er wird sicher ein sehr bedeutender Bühnenautor, und einem Autor könnte man kein besseres Geschenk machen. Er war den Tränen nahe.
Ich habe den Merlin-Teil zur Hälfte überarbeitet und mir die Sache wieder anders überlegt. Die Frau eines der Lehrer an der King’s School kann gut tippen. Ich möchte den Text abgetippt sehen, ehe er an Sie abgeht. Ich werde sie bitten, vier Kopien zu machen. Dann ist es natürlich noch keine Endfassung, aber im getippten Zustand wird es viel besser aussehen. Damit bekommen Sie etwas zum Anfassen, etwas, womit Sie spielen können. Ich habe jetzt ein kleines Tonbandgerät, auf dem ich zurückspulen kann. Es vermittelt mir einen viel besseren Eindruck von den Wörtern, wenn ich den Text abhöre. Ich spüre Fehler auf, von deren Vorhandensein ich nichts geahnt hatte. Mein Gott, welche Ausmaße diese Sache in meinem Kopf annimmt! Es ist unmöglich, den Merlin in die Form einer dichten Short story zu bringen. Er ist in einem gewissen Maß episodisch. Aber ich bemühe mich, ihm Kontinuität, Glaubwürdigkeit, Stimmungsdichte und Gefühlsgehalt zusammen mit einer Art Erklärung seiner Existenz zu geben. Im Grunde geht es um die Bildung eines Königtums. Erinnern Sie sich, daß ich immer wieder geschrieben habe, Malory habe sich in diesem Teil nicht wohl gefühlt? Nun, so ist es mir auch ergangen. Aber so wie er dabei lernte, lerne jetzt auch ich. Und ich habe bei diesem Stoff ein Gefühl der Freiheit, wie ich es noch nie hatte. Ich hoffe sehr, daß es Ihnen gefallen wird. Ich glaube, es ist gut geschrieben – auf seine Art so gut, wie Malorys Buch es auf seine Art war. Ich bin in Hochstimmung.
AN ERO UND CHASE – SOMERSET, 20. APRIL 1959
Ich habe den Anfang vom Merlin geschrieben. Das Ganze sollte vielleicht durchgesehen und noch einmal geschrieben werden. Ich habe so viel über meine eigene Arbeitsweise gelernt, daß die frühen Teile gewissermaßen schon veraltet sind. Das passiert wohl immer. Jedenfalls, ich werde mir überlegen, was ich daran tun möchte, bevor ich es abschicke. Was ich mache, gefällt mir noch immer. In London habe ich eine Zeichenplatte bestellt, die man kippen kann. Mein Rücken und Hals ermüden zu rasch.
AN ERO UND CHASE – SOMERSET, APRIL 1959
Was geht im Kopf eines Mannes vor, der schreibt – Romancier oder Kritiker? Schreibt ein Schriftsteller nicht auf, was ihn am stärksten geprägt hat, in der Regel in sehr frühen Jahren? Hat ihn der Heroismus beeindruckt, dann schreibt er darüber, und waren die stärksten Eindrücke Enttäuschung und ein Gefühl der Entwürdigung – dann ist das sein Thema. Und sollte die tiefste Regung der Neid gewesen sein, muß er alles angreifen, was er für den Erfolg hält, den er selbst ersehnt.
Vielleicht liegt irgendwo auf diesem Terrain auch der Grund meines Interesses und meiner Freude an dem, was ich tue. Malory lebte in einem Zeitalter, so brutal und gnadenlos und korrupt, wie die Welt nur jemals eines hervorgebracht hat. Im Morte verharmlost er diese Dinge keineswegs, die Grausamkeit und die Gier und die Mordlust und den kindlichen Egoismus. All das ist da. Aber er läßt nicht zu, daß es die Sonne verdunkelt. Seite an Seite damit finden sich Hochherzigkeit und Tapferkeit und Größe und die gewaltige Traurigkeit des Tragischen an Stelle frustrierter Mickrigkeit. Und vermutlich das macht ihn zu einem großen Schriftsteller, Williams hingegen nicht. Ein Autor mag noch so glanzvoll einen Teil des Lebens darstellen – wenn die Sonne erlischt, hat er nicht die ganze Welt gesehen. Tag und Nacht, sie existieren beide. Das eine oder das andere zu ignorieren, heißt, die Zeit zweizuteilen und nur einen Teil davon zu wählen, so wie man, wenn es um eine Entscheidung geht, von zwei Zündhölzern das kürzere zieht. Ich habe viel für Williams übrig und bewundere sein Werk, aber so wie er nur ein halber Mann ist, ist er auch nur ein halber Schriftsteller. Malory war ein ganzer. In der gesamten Literatur gibt es nichts Abstoßenderes als den Kindermord, den Arthur ins Werk setzt, weil eines dieser Kinder ihn vielleicht töten wird, wenn es herangewachsen ist. Williams und viele andere unserer Zeit würden es dabei bewenden lassen und sagen: »So ist es nun einmal.« Wenn Arthur seinem Schicksal begegnet, sich dagegen zur Wehr setzt und es zugleich auf sich nimmt – das in seiner herzzerreißenden Großartigkeit zu gestalten, wäre ihnen niemals möglich gewesen. Wie kann es sein, daß wir so vieles vergessen haben? Wir produzieren talentierte Pygmäen wie Hofnarren, die erheiternd wirken, weil sie Größe mimen; sie – ich sollte sagen: wir – bleiben aber trotzdem Zwerge. Ein Künstler soll nach allen Seiten offen sein, für Licht und Düsternis jeglicher Art. Doch unsere Epoche schließt ganz bewußt sämtliche Fenster, zieht alle Jalousien herunter, und später schreit sie dann nach einem Psychiater um Licht.
Nun – es hat einmal echte Männer gegeben, und vielleicht wird es sie wieder geben. Ich habe einen Freund – er bleibt natürlich ungenannt –, der den Grund seiner Misere darin zu finden glaubt, daß eine Frau ihn abgewiesen hat. Und er vergißt dabei die buchstäblich Hunderte von Frauen, die ihn akzeptierten. Ich habe ihm das kürzlich in einem Brief geschrieben, aber keine Ahnung, wie er es aufnehmen wird.
Ich bin heute ernst gestimmt, vielleicht weil ich einen Abschnitt im Merlin umschreiben wollte, aber nicht damit zurechtkam. Ich wußte, was ich sagen wollte und fand nicht die richtigen Wörter dafür. Ich werde sie aber finden, weil ich Zeit habe.
Um zum vorletzten Absatz zurückzuspringen – ich bin von ein paar Frauen abgelehnt worden, aber, mein Gott, bei ein paar wunderbaren angekommen. Das zu vergessen, wäre eine Dummheit, und über die anderen nachzugrübeln, wäre, als könnte ich nicht verschmerzen, daß mein Aussehen nicht allen zusagt. Ich bin dankbar dafür, daß es einigen gefällt.
AN CHASE – SOMERSET, 25. APRIL 1959
Das kornische Wörterbuch brauche ich nicht für diese, sondern für künftige Arbeit. Also schicken Sie es ruhig mit dem Schiff. Wenn wir damals klargesehen hätten, hätte Mary es mitbringen können. Jegliche Nachschlagewerke über dieses Gebiet sind mir willkommen. Vor dem Walisischen graut mir, weil ich es nicht aussprechen kann.
Gestern war ein ausgezeichneter Tag für mich, und ich bin ein gutes Stück im Ritter mit den zwei Schwertern vorangekommen – eine merkwürdige, vom Schicksal umschattete Geschichte. Hoffentlich gelingt es mir, etwas an die Oberfläche zu bringen – den unsichtbaren Ritter etc. und das grausige Gemetzel in Verbindung mit Sanftheit. Nebenher habe ich ein Beil aus der hiesigen Gegend zu der Form eines sächsischen Beils verkürzt, um damit Holz zu bearbeiten, und eine Abfallgrube gegraben.
Meine Zeichenplatte, die sich kippen läßt, ist gekommen. Macht aus einem Kartentisch einen Zeichentisch. Jetzt werden mir Hals und Schultern nicht mehr so verdammt müde.
AN ERO UND CHASE – SOMERSET, 1. MAI 1959
Etwas Wunderbares gestern. Es war ein goldener Tag, die Apfelbäume blühen, und ich stieg zum erstenmal nach Cadbury-Camelot hinauf. Ich glaube nicht, daß ich mich an einen ähnlich starken Eindruck erinnern kann. Konnte vom Bristol Channel bis zu den Spitzen der Mendip Hills und alle den kleinen Dörfern sehen. Den Felshügel von Glastonbury und König Alfreds Türme auf der anderen Seite. Ich werde noch oft hinaufgehen, aber was für ein Tag, wenn man das alles zum erstenmal sieht! Ich bin um die ganze obere Mauer herumgegangen. Und ich weiß nicht, welche Empfindungen mich bewegten, aber es waren sehr viele – wie die aus einem Vulkankrater langsam hochsteigenden heißen Blasen aus geschmolzenem Gestein, ein leises Erdbeben der Erleuchtung. Ich war auch innerlich dafür bereit. Ich werde nachts und im Regen wieder hingehen, doch das heute war, um Tennyson zu zitieren, edel Gold … mystisch … wundervoll. So, daß sich einem die Härchen am Nacken aufstellten. Mary ist hier, und sie hat uns begleitet – und war sehr bewegt. Morgen, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, werde ich wieder nach Glastonbury fahren, zur Abtei. Auch dafür bin ich jetzt innerlich bereit.
Ich hoffe, heute den Ritter mit den zwei Schwertern abzuschließen. Ich hoffe sehr, daß er mir gelungen ist. Merlin ist aus dem Haus und wird gerade abgetippt. Ich weiß nicht, wann der Teil fertig sein wird, aber ich schicke ihn Ihnen, sobald ich ihn durchgesehen habe. Ich denke, Balin ist gut geworden, aber ich muß es mir erst auf dem Band anhören, bevor ich es wirklich weiß. Was für eine magische und verhängnisvolle Geschichte!
Nun möchte ich eine Bitte äußern. Wir sollen England am oder vor dem 11. Juni verlassen und wiedereinreisen. Ich hatte vor, das Innenministerium um eine Verlängerung zu ersuchen, statt Zeit und Geld für einen Stempel im Paß zu verschwenden. Anders läge der Fall, wenn es einen Anlaß für die Fahrt gäbe. Vergangene Nacht überkam mich im Bett die Idee eines Anlasses, eines sehr begründeten. Ich weiß inzwischen, wie die für die Arbeit einschlägigen Gegenden aussehen, abgesehen von einer – der Bretagne. Und da es jetzt auf den Krieg gegen Rom und den ganzen Komplex der keltischen Wanderungen, vorwärts und rückwärts, zugeht, wäre es mir von großem Nutzen, wenn ich mich ein paar Tage in der Bretagne umsähe. Das wäre der beste Grund, England auf einige Tage zu verlassen. – Von Calais bis zum Mont St. Michel. Was meinen Sie dazu, Chase? Und würden Sie mir bitte geographisches und historisches Material über die Gegend mit Beziehung zum Mythos wie zu der Bretagne in Malorys Zeit besorgen, so, wie er sie selbst wohl gesehen hat? Ich finde, die Idee hat sehr viel für sich, und sie schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe.
Zeit für mich, an die Arbeit zu gehen. Ich werde den Brief später zu Ende schreiben. Ich bin mit Balin fertig und hundemüde. Aber ich denke, ich habe etwas von mir hineingebracht. Es ist meine innige Hoffnung.
Jetzt muß ich meine Salatpflänzchen in Kistchen umsetzen, bevor ich sie im Garten einpflanze. Gesät wurden sie auf meinem Fensterbrett.
AN CHASE – SOMERSET, 4. MAI 1959
Wieder ein Wochenbeginn. Elaine und Mary sind nach Wells gefahren, was mir einen schönen langen Tag zum Arbeiten verschafft. Fange an mit Torre und Pellinore, Guineveres Vermählung etc. Die Hälfte des abgetippten Merlin ist zurückgekommen. Der Rest Anfang dieser Woche, und ich werde einen Durchschlag an Sie und Elizabeth mit der starken Hoffnung abschicken, daß es Ihnen gefallen wird. Ich schlage vor, daß Sie, nachdem Sie es gelesen haben, wieder Malory zur Hand nehmen, um zu sehen, was ich daran gemacht habe. Sie werden dann sofort verstehen, warum. Ich habe gestern den Balin-Teil auf Band gesprochen, ihn abgehört, und er klingt ziemlich gut. Natürlich braucht alles noch eine Menge Verfeinerungen, doch das Wesentliche ist da, und ich finde nicht, daß mir vom Original viel entgangen ist. Die Arbeit ist überaus mühselig. Sie werden feststellen, daß ich sämtliche Prophezeiungen Merlins, die mit späteren Erzählungen zu tun haben, herausgelassen habe. Sie nehmen einfach alles vorweg. Außerdem konnte Malory nie auf einen Höhepunkt hin schreiben. Er verschenkte ihn dreimal, ehe er ihn schließlich erreichte. Die schwierigste Arbeit war die Schlacht. Nichts wird wieder so mühsam werden … ich beseitige die ermüdenden Details, behalte aber zugleich den Ablauf des Geschehens und den Schlachtplan bei. Aber bei Malory sind enorme Tiefgründigkeiten in kurzen Wendungen versteckt. Ich muß sehr aufpassen, daß ich sie nicht übersehe, und mitunter muß ich sie etwas verstärken, damit sie sichtbar werden.
AN ERO – SOMERSET, 5. MAI 1959
Der letzte Teil vom Merlin müßte heute abgetippt sein, und ich werde sofort per Luftpost einen Durchschlag an Sie abschicken. Ich werde wie auf Kohlen sitzen, bis ich weiß, was Sie davon halten. Inzwischen bin ich schon ein gutes Stück in den Teil Torre und Pellinore gediehen, die erste der von einer Ausfahrt handelnden Erzählungen mit dem Anfang der Tafelrunde. Von da an wird Arthur zu einem Heros, beinahe ohne Charakter. Doch das ist allen Heroen eigen, und ihn menschlich zu machen, könnte eine Revolution bedeuten. Er ist weiß Gott von menschlichen Figuren umgeben, und vielleicht ist es notwendig – als Kontrast. Arthur wird ja ein bißchen wie der Kalif in Tausendundeiner Nacht, gewissermaßen ein Schiedsrichter über bestandene Abenteuer und eine Art milder Kommentator. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen werde. Aber jeder Tag ist eine große Herausforderung. Jeder Tag bringt irgend etwas.
Inzwischen ist es Nachmittag geworden und das Merlin-Typoskript eingetroffen. Ich denke, ich werde ein bißchen später nach Bruton fahren und die Kopie an Sie abschicken, weil ich ganz versessen darauf bin, daß Sie sie bekommen. Habe ich es verkehrt angepackt? Mir erscheint es richtig, aber ich kann mich sehr täuschen. Es muß irgendeinen Grund geben, warum sich noch niemand diese Arbeit richtig vorgenommen hat. Vielleicht ist sie nicht zu schaffen … aber ich glaube das eigentlich nicht. Ich denke, der Grund liegt darin, daß man es im Gewand der Zeit statt zeitlos darzustellen versucht hat. Nun, Sie werden ja sehen, ob es so richtig ist. Und gut oder schlecht, ich habe das Gefühl, daß die Prosa gut ist. Übrigens werde ich an niemanden außer Ihnen einen Durchschlag schicken. Ich habe hier ein Original und zwei Kopien. Möchte oder braucht Chase eine? Es verlangt noch eine Unmenge Arbeit, ich weiß, aber das ist ja vorläufig nur ein Entwurf.
Im Postamt werden sie durchdrehen, wenn ich es per Luftpost abschicke. Sie halten uns ohnehin für schrecklich verschwenderisch, und damit werde ich bei ihnen den Eindruck erwecken, daß ich bekloppt bin. Wir geben ihnen mehr zu tun als der ganze Ort Bruton.
Ach was – so sind wir nun mal. Und ich bin heute schon ein gutes Stück weit in Torre und Pellinore vorangekommen.
Herzliche Grüße an alle dort drüben. Es tut mir leid, daß ich wegen dieser Sache so nervös bin, aber ich sitze ja schon lange daran, und das ist die erste Probe, der Säuretest – die schwierigste der Erzählungen und die erste.
AN CHASE – SOMERSET, 7. MAI 1959
Ein kleines Sich-warm-Laufen vor meinem Tagespensum. Gestern habe ich Gawains Ausfahrt in Torre und Pellinore abgeschlossen, und heute mache ich mit der zweiten weiter. Ich hoffe, das Ganze irgendwann während des Wochenendes abzuschließen.
Ich habe jetzt ein Zeichenbrett auf dem Tisch, das leicht gekippt ist und mir große Erleichterung verschafft. Ich werde nicht mehr so müde, wie wenn ich mich nach vorne beugen muß … Ich werde diesen Brief heute nicht beenden, denn ich bekomme ja doch sofort eine postwendende Antwort, wenn ich ihn abschicke. Lassen Sie mich doch bitte Ihre Reaktion auf den von mir geschickten Text wissen, sobald Sie die Zeit dafür finden. Vielleicht sollte ich von jetzt an lieber zwei Durchschläge senden. Ich lasse ein Original und drei Kopien machen.
Inzwischen haben wir Sonntag, und ich bin soeben mit den drei Ausfahrten fertig geworden. Morgen Merlins Tod, und wenn ich Glück habe, nächste Woche Morgan Le Fay, eine kurze Sache. Aber sie gibt mehr her, und ich glaube, in den Ausfahrten habe ich einiges Gold entdeckt. Die großen Sachen kommen natürlich erst noch.
Wieder einmal ein Montag. Die Wochen rasen vorbei und verschwinden wie die Kaninchen in einem Schießstand. Wir sind jetzt zwei Monate hier. Können Sie sich das vorstellen? Ich nicht. Die Zeit kommt mir so kurz vor, daß ich das Gefühl habe, nicht genug gearbeitet zu haben, obwohl ich weiß, daß das Gegenteil der Fall ist. Ich habe sehr viel gearbeitet. Auf dieses dünne Papier zu schreiben, macht kein Vergnügen. Ich liebe das Propatriapapier, sogar das weiße englische.
Ich habe am Mittwoch eine Partie Typoskript bekommen und werde sie mitschicken … Es wird viel mehr von Malory darin sein als im Merlin, wo ich immer gefunden habe, daß er mit seinem Stoff ins Schwimmen kam. Heute gehe ich Merlins Tod an, eine grausige Geschichte, die lächerliche Niederlage eines großen, in allen Epochen verehrten Mannes. Ich werde sehen müssen, was ich daraus machen kann. Es ist der Ausrutscher auf einer Bananenschale, wie er jedem passiert. Und es ist an der Zeit, daß ich dazu komme, denn es könnte ein paar falsche Anläufe geben.
AN CHASE – SOMERSET, 11. MAI 1959
Die Sache ist die, daß ein Tag nicht genug Stunden hat, um das zu tun, was ich tun möchte. Ich habe gestern Merlins Tod und die Fünf Könige beendet. Und mache heute mit Morgan le Fay weiter. Meine Version von Merlins Ende gefällt mir. Es ist eine traurige und allgemeingültige Geschichte. Vielleicht hat sie deswegen die Zeiten überdauert. Das und die Vermählung werden am Mittwoch abgetippt werden.
Gestern drei Dutzend Salatpflanzen eingepflanzt. Ich fand zwischen den Gräsern im hinteren Teil des Gartens einige Erdbeerpflanzen, alle in Blüte, und habe das Unkraut darum herum gejätet. Dort hinten entdecke ich alle möglichen Dinge.
Meine Orthographie – noch nie sehr sicher und konsequent – ist ganz und gar von Malory infiziert. »Batayle« kommt mir viel normaler vor als »battle«, irgendwie kriegerischer, obwohl es nicht das gleiche wie »battle« bedeutet.
Was für ein Leben! Gestern war ich sehr fleißig – Schreiben und Grasmähen mit einer Sense. Um neun Uhr, noch bevor es dunkel war, ging ich ins Bett und schlief sofort ein. Heute morgen Dunst auf den Wiesen, durch den die Sonne brennt. Alle Leute sagen, es sei der schönste Frühling seit vielen Jahren. Und manche fürchten in der Erinnerung an die letzten paar Jahre, wir werden später dafür büßen müssen. Nun, man wird ja sehen.
Ich werde vielleicht aus dem Haus gehen müssen, aber mit Widerwillen. Ich hasse auch alles, was den langsamen, stetigen Fluß dieser Übersetzung unterbricht. Ich spüre, daß sie jetzt allmählich frei strömt und einen guten Klang bekommt.
Nun ist die Zeit um. Ans Werk, heißt es jetzt.
Ich werde das hier abschicken.
AN ERO UND CHASE – SOMERSET, 13. MAI 1959
Dann Ihre Bemerkungen zu dem Ihnen zugeschickten Abschnitt und der Umstand, daß Chase fast gar nichts dazu sagt. Ich muß mir meine Antwort sehr genau überlegen und darf nicht in Unklarheiten abrutschen. Zu behaupten, ich sei nicht betroffen gewesen, wäre unwahr. Ich war es. Ich frage mich, ob vielleicht die 3000 Meilen zwischen uns etwas ausmachen. Es liegt auf der Hand, daß ich meine Absicht nicht verständlich machen konnte, ich zweifle aber, ob ich es an Ort und Stelle gekonnt hätte. Begreiflicherweise suche ich nach Argumenten zu meiner Verteidigung beziehungsweise zur Rechtfertigung der Arbeit, so wie ich sie angehe. Lassen Sie mich als erstes sagen, ich bin hoffentlich zu professionell, um mich von dem Schock lähmen zu lassen. Die Antwort scheint darin zu liegen, daß Sie etwas Bestimmtes erwartet hatten, aber nicht bekommen haben. Daher ist es Ihr gutes Recht, verwirrt und enttäuscht zu sein, wie Sie schreiben. Ich hatte Ihnen nie meinen Plan dargelegt, vielleicht weil ich mich noch vorantastete. Ich kann darauf hinweisen, daß dies ein unkorrigierter erster Entwurf ist, dazu gedacht, Stil und Arbeitsweise festzulegen, und daß die Schnitzer und Irrtümer später beseitigt werden, doch damit ist es nicht getan. Vielleicht nahm ich an, ich hätte Ihnen gesagt, daß es mir im Augenblick darum geht, nicht den ganzen Zyklus mit den tausend Verzweigungen, zu dem er geführt hat, zu bringen, sondern mich dicht an Malory zu halten, der im 15. Jahrhundert schrieb. Und all die Lektüre, die ganzen Recherchen waren nicht umsonst, weil ich bei Malory Dinge sehe und zu verstehen glaube, die ich vorher nicht hätte sehen können. Und schließlich hatte ich keineswegs die Absicht, den Text in die Umgangssprache des 20. Jahrhunderts zu transponieren, sowenig wie Malory ihn in die des 15. Jahrhunderts brachte. Auch damals sprachen die Menschen nicht so. Übrigens sprachen die Leute auch nicht so, wie Shakespeare sie sprechen läßt, außer in den Rüpelszenen. Das sind, ich weiß, alles negative Argumente.
Ich weiß, Sie haben T. H. Whites Once and Future King gelesen. Es ist ein wunderbar ausgedachtes Buch. Alles, was Sie in meiner Umarbeitung gerne gefunden hätten, finden Sie dort im höchsten Grad. Aber so etwas hatte ich nicht vorgehabt, und möchte ich, denke ich, auch jetzt nicht.
Wo beginnt der Mythos – die Sage? Hinter der keltischen Version erstreckt sie sich zeitlich zurück nach Indien und vermutlich sogar in eine noch frühere Zeit. Während ihrer Wanderung teilt sie sich in mehrere Ströme auf – ein Teil geht nach Griechenland, ein Teil taucht im semitischen Bereich auf, ein anderer gelangt durch Georgien und Rußland und Deutschland nach Skandinavien und füllt sich mit nordischem Sagengut auf, und ein anderer Teil erscheint in Iberien und im keltischen Gallien und strömt nordwärts nach Britannien, Irland, Schottland, von wo er nach einer Inkubationszeit wieder in alle Himmelsrichtungen hinauszieht. Wo soll man eine Schranke setzen, eine Grenze ziehen? Ich entschied mich dafür, mit Malory zu beginnen, der am besten schrieb, besser als die Franzosen, besser ist als die Teile aus [der Sammlung] Mabinogion und unserem allgemeinen Verständnis heute näher. White hat die Geschichte in brillanter Weise in die Dialekte des England der Gegenwart übertragen. Ich wollte das nicht. Ich wollte ein Englisch, weder zeit- noch ortsgebunden, so wie es die Sage selbst ist. Die Menschen der Sage sind keine Menschen, wie wir sie kennen. Sie sind Figuren. Christus ist keine Person, er ist eine Figur. Buddha ist ein hockendes Symbol. Als Person ist der Arthur bei Malory ein Narr. Als Sagengestalt ist er zeitlos. Man kann ihn nicht vom Menschlichen her erklären, sowenig wie man Jesus erklären kann. Als Mensch ist Jesus ein Narr. Zu jedem Zeitpunkt in seiner Geschichte hätte er die Entwicklung aufhalten oder in eine andere Richtung lenken können. Er hat in der ganzen Folge der Ereignisse nur einen einzigen menschlichen Augenblick – das »lama asabthani«, wenn die Qual übermächtig wird. Es ist dem Helden wesenseigen, ein Narr zu sein. Der heutige literarische Prototyp, der Sheriff im Western, wie ihn Gary Cooper verkörpert, ist unweigerlich ein Narr. Er wäre ein armseliger Wicht, wenn er klug wäre. Die Klugheit, ja, sogar die Weisheit ist in allen Mythen dem Schurken vorbehalten. Ich schreibe diesen Text nicht, damit er angenehm für das Ohr des 20. Jahrhunderts ist. Vielleicht ist mein Ehrgeiz zu groß, aber ich bemühe mich darum, die Sage dem heutigen Verstehen zu erschließen, nicht sie gefällig darzubieten. Mir geht es um das ferne Gefühl des Mythos, nicht um das private Empfinden des Menschen der Gegenwart, der heute so und morgen anders denkt, sich allerdings, davon bin ich überzeugt, in seinem tieferen Empfindungsvermögen überhaupt nicht verändert. Kurzum, ich versuche nicht, ein populäres, sondern ein Buch zu schreiben, das von Dauer ist. All das hätte ich Ihnen sagen sollen.
Es war und ist noch immer bei alledem meine Absicht, jeder der Erzählungen einen – wie soll ich es nennen? – Essay, eine Erläuterung, einen Nachtrag folgen zu lassen. Darin beabsichtige ich, die realen, die spekulativen, die erklärenden, vielleicht sogar die charakterisierenden Elemente aufzunehmen, aber für sich stehend. Mir ist zum Beispiel nichts davon bekannt, daß Merlin ein Druide oder Nachhall eines Druiden war, und Malory hat es gewiß keinesfalls angenommen. In den Einschüben kann ich spekulieren, daß es so gewesen sein könnte, obwohl ich vermute, daß die Idee hinter Merlin viel älter ist als der Druidismus. Merlins Pendants finden sich in jedem großen Zyklus – in Griechenland, in der Bibel und in den Volksmythen, bis zurück zu den Anfängen. Chase macht die kluge Bemerkung, daß Sachsen und Sarazenen [bei Malory] vermutlich das gleiche sind. Fremde von weither. Sie treten immer auf. Für Malory waren die zuletzt aufgetretenen geheimnisvollen und mächtigen Fremden Sarazenen. Die Sachsen gehörten, sofern er kein Kelte war, irgendwie zu ihm, obwohl er sich vermutlich eine normannische Abkunft zuschrieb – aus Gründen des sozialen Prestiges.
Na schön, werden Sie sagen – wenn das Ihre Absicht ist, wo bleiben dann diese erhellend gedachten Kommentare? Nun, sie sind aus zwei Gründen noch nicht geschrieben. Erstens lerne ich so viel aus den Erzählungen, und zweitens möchte ich den Rhythmus nicht unterbrechen. Ich fand, daß sich ein Rhythmus eingestellt hatte, und war darüber erfreut. Außerdem müssen diese Erzählungen ihrer Natur nach schmucklos sein, und in dem, was ich hinzugefügt habe, habe ich mich bemüht, diese Kargheit zu bewahren.
Ich weiß, es wirkt so, als wollte ich meine These verteidigen, und genauso ist es auch. Aber ein paar Dinge verstehe ich nicht. Sie schreiben, der Mord an den Babys sei die eines Königs unwürdige Neuauflage der Herodes-Geschichte. Aber das ist ja das Thema der ganzen Sage. Die Herodes-Geschichte ist einfach eine weitere Version des zeitlosen Prinzips, daß menschliches Planen das Schicksal nicht von seinem Lauf abzubringen vermag. Die ganze Sage ist eine Neuerzählung uralter menschlicher Erfahrung. Sie ist eine Version von »Macht verdirbt«.
Was mich – Sie werden das verstehen – am traurigsten gestimmt hat, ist der Ton der Enttäuschung in Ihrem Brief. Wenn ich meine Arbeit mit Skepsis betrachtet hätte, hätte ich mir einfach gesagt, Sie haben mich durchschaut. Aber ich fand, daß ich gute Arbeit leiste, und innerhalb der Grenzen, die ich mir gezogen habe, finde ich das auch jetzt noch.
Die erste Erzählung ist die mit weitem Abstand formloseste, schwierigste und am meisten überfrachtete von allen.
Die Geschichte von dem Ritter mit den zwei Schwertern ist direkter, aber nicht minder geheimnisvoll.
Schließlich – und ich werde danach den Punkt nicht weiter strapazieren – habe ich das Gefühl, daß ich auf etwas zustrebe, was für mich großen Wert hat. Es liest sich nicht wie von mir, weil ich das nicht will. Und dabei kommt mir der Gedanke, ob es Ihnen nicht lieber wäre, wenn ich die Erzählungen nicht jeweils schicke, sobald sie fertig sind, sondern bis zuletzt warte, wenn die Zwischenkapitel eingefügt sind. Ich hatte daran gedacht, nach 400 oder 450 Seiten zurückzugehen und diesen Teil, weil es einen Band abgeben wird, abzuschließen, bevor ich weitermache. Vielleicht werden es zwei Fassungen, einmal nur die Übersetzung und dann Übersetzung plus Zwischenkapitel. Was die Übersetzung angeht, steht für mich eines fest: Sie ist von allen, die bisher gemacht wurden, weitaus die beste. Aber Sie müssen mir Ihre Meinung zu diesem Brief schreiben. In diesem Sinne – Mais, je marche!
AN ERO – SOMERSET, 14. MAI 1959
Jetzt habe ich einen Tag lang nachgedacht und eine Nacht mit Herzklopfen verbracht, seit ich den Brief umschrieb. Ich habe auch den beigelegten Durchschlag etwas korrigiert. Der erste war unkorrigiert, und mein Standpunkt ist noch immer ungefähr der gleiche. Vielleicht mache ich es nicht gut genug. Aber wenn es sich nicht lohnt, es so zu machen, wie ich es versuche, dann bin ich ganz auf dem Holzweg, nicht nur darin, sondern auch in vielen anderen Dingen, und das ist natürlich durchaus denkbar. Alan Lerner macht zur Zeit ein Musical über König Arthur, und es wird sehr hübsch werden und eine Masse Dollar einspielen – aber das ist nicht das, was ich möchte. Es geht mir um etwas anderes. Vielleicht habe ich in meinem Eifer, mich zu verteidigen, verfehlt, was ich eigentlich sagen wollte. Vielleicht versuche ich etwas zu sagen, was sich nicht sagen läßt, oder etwas zu tun, was meine Fähigkeiten übersteigt. Aber Malorys Werk hat etwas, was der Zeit länger standhält als T. H. White, länger Bestand haben wird als Alan Lerner oder Mark Twain. Kann sein, ich weiß nicht, was es ist – aber ich spüre es. Und wie gesagt, wenn ich auf dem Holzweg bin, dann auf einem wirklich kolossalen.
Aber sehen Sie nicht – ich muß auf dieses Gefühl setzen. Ich weiß, es ist nicht die Literatur, die das heutige Ohr aufnimmt, ohne sich anstrengen zu müssen, aber dieses Ohr ist ja von der Madison Avenue, vom Rundfunk, vom Fernsehen und Mickey Spillane etwas dressiert. Der Held gilt beinahe als etwas Abgeschmacktes, sofern er nicht im Western auftritt. Eine Tragödie eine echte Tragödie – ist lächerlich, es sei denn, sie spielt sich in einer Wohnung in Brooklyn ab. Könige, Götter und Heroen vielleicht ist ihre Zeit vorbei, aber ich kann es nicht glauben. Vielleicht, weil ich es nicht glauben mag. In diesem Land hier bin ich umgeben von den Werken von Heroen, erbaut seit dem ersten Auftreten des Menschen. Ich weiß nicht, wie die Monolithen in diesen Kreisen ohne Werkzeuge aufgestellt werden konnten, aber dazu hat es mehr gebraucht als kleine Gaunereien und faule Schuljungen und die Kümmernisse übergewichtiger Damen auf der Psychiatercouch. Irgend jemand hat eine gewaltige Erdmasse bewegt und nicht nur, um »einen Dollar zu kassieren«. Wenn es mit alledem vorbei ist, habe ich irgendwo den Anschluß verpaßt. Und das könnte leicht der Fall sein.
Ich bin heute traurig gestimmt – nicht verzweifelt, sondern zweifelnd. Ich weiß, ich muß meinem Impuls folgen. Vielleicht wird es besser werden, wie Malory besser wurde – und er wurde besser. Wenn ich den Sommer und Herbst durchgearbeitet habe … und es wirkt dann immer noch lahm, werde ich das Ganze abblasen, aber ich habe zu viele Jahre davon geträumt, zu viele Nächte, um den Kurs zu ändern. Ich habe nie gedacht, diese Arbeit würde ungeheuer populär werden, aber doch geglaubt, sie würde eine ständige Leserschaft gewinnen, nicht weil ich den Text verändert, sondern weil ich den Zugang zu ihm erschlossen habe. Ich selbst habe mich verändert, weil ich meiner überdrüssig war, habe meine Kunststückchen aufgegeben, weil ich nicht mehr daran glaubte. Eine Entwicklung war vorbei, und vielleicht war auch meine Zeit vorbei. Es ist durchaus möglich, daß ich mich nur noch wie eine in zwei Stücke geschnittene Schlange winde, von der wir früher glaubten, sie könnte erst sterben, wenn die Sonne unterging. Doch wenn es so ist, dann muß ich mich eben weiter winden, bis die Sonne untergeht.
Ach was, blödes Zeug! Ich glaube an diese Arbeit. Sie hat etwas unsagbar Einsames. Es kann gar nicht anders sein.
AN ERO – SOMERSET, MAI 1959
Ich bin gerührt über Ihren Brief mit dem unausgesprochenen Vertrauen in etwas, was Ihnen eigentlich nicht sehr gefällt. Ich hatte natürlich nicht die Absicht, Ihnen ein falsches Bild zu vermitteln. Wie mir scheint, meinten wir nicht dieselben Dinge. Eine der Schwierigkeiten dürfte in dem großen Umfang dieser Arbeit liegen. Ich wollte, ich könnte mit Chase darüber sprechen. Ich stimme ihm zu, an welchen Stellen man die Bände aufhören lassen könnte. Aber was die römische Episode betrifft, werden meine Bedenken immer größer. Sie hat, scheint mir, nie richtig hineingepaßt. Es passiert ja kaum etwas. Die beiden großen und durchgehaltenen Erzählungen sind die um Lancelot und Tristan. Die Lancelot-Geschichte bricht in der Mitte ab, Tristan erscheint, und dann Lancelot und die Gral-Sequenz und der morte. Ich werde mir sehr sorgfältig durch den Kopf gehen lassen, ob ich die Geschichte mit dem Kaiser nicht weglasse. Damit würde der erste Band bis zum Beginn von Tristan gehen. Im Augenblick – aber das kann sich natürlich ändern – denke ich daran, das alles zu übersetzen, aber vielleicht die Sache mit dem Kaiser wegzulassen, dann zurückzugehen, die übersetzten Teile mit noch größerer Freiheit zu überarbeiten und anschließend zwischen die Erzählungen meine eigene Arbeit einzuschieben, in die ein großer Teil des Wissens eingehen würde, das Chase und ich zusammengetragen haben. Das würde dann einen sehr profunden und gewichtigen ersten Band abgeben. Auch wüßten wir dann, wo wir stehen und ob die Arbeitsmethode standhält. Es sollte auch so weit abgeschlossen sein, daß es in diesem Zustand fast schon gedruckt werden könnte. Wenn meine Methode den Anforderungen nicht genügen sollte – und ich muß damit rechnen, daß es sein könnte –, dann sollte ich mit Tristan fortfahren und schließlich den Gral und den morte machen. Ich denke, das wäre der Probeband. Sollte sich zeigen, daß er nichts taugt, könnten wir den ganzen Plan entweder aufgeben oder abändern. Das bedeutet also vom Anfang bis zum Ende des ersten Teils von Lancelot, unter Weglassung von Kaiser Claudius. Was halten Sie beide davon? Es ist mehr als möglich, daß ich, ehe ich nach Hause komme, diesen ersten Band zumindest in der Rohfassung abschließe. Wenn ich die ganze Arbeit mache und dann feststelle, daß sie nichts taugt – das wäre zuviel! Lassen Sie sich die Sache bitte durch den Kopf gehen.
Ich kenne eines der Probleme mit den Dingen, die ich Ihnen zuschicke, und wieder kommt es davon, daß ich die Sache nicht richtig klargemacht habe oder nicht ausführlich genug erklärt habe. In manchen Partien der Übersetzung habe ich mich bemüht, den Sinn von Malorys Text möglichst getreu und vollständig herauszubringen. Sie sind nicht in der endgültigen Form. Sobald sie stehen, dienen sie als Arbeitsrohstoff, und ich werde nicht noch einmal zu Malory zurückgehen, sondern anhand meiner Übertragung arbeiten, die in diesem Stadium keine Beziehung zum Mittelenglischen mehr haben wird. Ich weiß, das ist ein weiter Umweg, aber für mich die einzige Möglichkeit, der machtvollen und ansteckenden Prosa Malorys aus dem Weg zu gehen. Also haben Sie bitte ein bißchen Geduld mit mir. Ich glaube zu wissen, was ich will, und bemühe mich, es zu erreichen.
AN CHASE – SOMERSET, 22. MAI 1959
Danke für Ihre schriftliche Vertrauenserklärung. Man kann weitermachen, auch wenn man auf Widerstand trifft, aber anders ist es viel leichter. Ich lerne jeden Tag etwas Neues. In einer so umfangreichen Sache wie dieser ist es unmöglich, erst einmal einen großen Block herauszuschnitzen. Es ist wie bei meiner Schnitzarbeit – das Holz hat auch seinen Willen und gibt zu erkennen, welchen Weg es gehen will, und wenn man gegen seine Wünsche handelt, schnitzt man schlecht.
Gestern habe ich den ersten Teil von Morgan – Accolon betitelt – abgeschlossen. Ein unglaublicher Charakter und ein Teufelsweib. Ich werde einen Essay über Malorys Einstellung zu den Frauen mit hineinnehmen.
Ich bin ein schlechter Philologe, habe zudem nicht viele Nachschlagewerke zur Hand und bin obendrein skeptisch gegenüber vielen dieser Werke, die unbesehen akzeptiert werden, nur weil sie gedruckt sind. Manchmal liegt eine Wahrheit in einem Namen oder einer Bezeichnung tiefer verborgen als irgendwo sonst. Nun, hier ist eine These, eine Art induktiver Spekulation, die nach Ihrem Herzen sein dürfte. Ich kam in der Nacht darauf, als ich lange über Cadbury nachdachte. Denken Sie an die Ortsnamen – Cadbury, Caddington, Cadely, Cadeleigh, Cadishead, Cadlands, Cadmore, Cadnaur, Cadney, Cadwell. Nach dem Oxford-Band »Place Names« [Ortsnamen] bezieht sich das erste Element auf jemanden namens Cada …
Dann die Chad-Orte, beginnend mit Chadacre und viele andere mehr bis zu Chadwick als letztem. Diese werden Ceadvalla zugeordnet, dem keltischen Gegenstück. Es gibt noch zahlreiche andere Variationen. Wenn Sie nun die Cad-Wörter im Wörterbuch durchgehen, dann sehen Sie, worauf so viele von ihnen hindeuten. Caddy, cadet, caduceus, das arabische cadi [Kadi], und dann kommen Sie auf Cadmos [Kadmos], einen Phönizier, der Theben gründete und das Alphabet nach Griechenland brachte. Caduceus [Kaduzeus], der Heroldsstab, später Sinnbild des Wissens, insbesondere des ärztlichen, und der Schlangenstab, der heute noch auf Nummernschildern verwendet wird. Cadmos hat auch die Drachenzähne gesät, vielleicht eine andere Version des Turmbaus von Babel, doch das Wesentliche ist, daß der Mythos ihm zuschreibt, er sei aus Phönizien gekommen. Waren die Trojaner Vorläufer der Phönizier? Geographisch dürften sie der gleichen Gruppe angehört haben, und der Name Brut [Brutus] ist hier ebenso fest eingewurzelt wie die trojanische Tradition.
Aber kehren wir zu den Cads zurück. Wir wissen, daß die einzigen Fremden, die in einem Zeitraum von 1500 bis 2000 Jahren auf diese Inseln kamen, Phönizier waren, daß sie Dekor, Ideen, vermutlich die Schrift und sicherlich ihre Vorstellungen direkt aus dem Mittelmeerraum mitbrachten. Sie hielten diese Inseln auch vor der Welt geheim, um nicht bekannt werden zu lassen, aus welcher Quelle sie ihre Metalle bezogen. Damit wollten sie ihr Monopol auf das Zinn schützen, aus dem sämtliche Bronze in der damals bekannten Welt gemacht wurde. Und woher kamen diese Phönizier? Nun, ihre letzte Zwischenstation war Cadiz – ein phönizisches Wort, das sich niemals verändert hat.
Ist die Mutmaßung zu weit hergeholt, daß die Cad-Namen wie die Cead-Wörter, die »Cedric«-Wörter aus Cadiz kamen, das seinen Namen von Cadmos hatte, der nach dem Mythos von außerhalb die Kultur brachte? Solche Dinge haben ein sehr langes Leben. Cadi ist bis auf den heutigen Tag ein Richter, Caddie ein Gentleman, Cadet ein junger Adeliger, Caduau ein Geschenk oder eine Bestechungssumme. Ich habe keine Ahnung von den semitischen Sprachen. Aber ich wette, Sie werden den hebräischen und anderen semitischen Ursprüngen der Silbe Cad oder Kad bis zurück zu den Mesopotamiern-Babyloniern, Tyriern etc. nachspüren. Warum sollen diese reichen und geradezu mythischen Menschen, die auf Schiffen kamen und seltsame und schöne Dinge mitbrachten, nicht Namen ihrer Herkunft gehabt haben? Die Leute aus Cadiz, die Leute des Cadmos, der das Wissen brachte, die Boten der Götter? Den Steinzeitmenschen müssen sie götterähnlich erschienen sein. Sie haben wohl ihre Götter und ihre Gewänder aus tyrrhenischem Purpur mitgebracht; ihre Dekors sind noch auf frühem englischem Metall und Schmuck zu sehen. Ihre Faktoren{*} dürften im Kreis der Einheimischen gelebt haben, und die Erinnerung an sie drang allmählich in die Ortsnamen ein. Es besteht kaum ein Zweifel, daß sie das Christentum auf diese Inseln brachten, noch ehe es in Rom Fuß faßte.
In keinem meiner Nachschlagewerke finde ich auch nur die Spur eines Hinweises auf diese These. Es wird angenommen, daß nach 1500 Jahren ständiger Verbindung mit dem West Country die einzigen über Wissen und Kultur verfügenden Menschen verschwanden und keine Erinnerungsspur hinterließen. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube, daß die Erde selbst laut von ihnen kündet.
Was meinen Sie?
AN CHASE – SOMERSET, 25. MAI 1959
(von Elaine Steinbeck)
Dies ist mehr oder weniger eine Art Postskriptum zu dem Brief, den ich am Sonnabend an Elizabeth schrieb. Übers Wochenende las mir John die neuesten Manuskriptseiten vor, und sie sind sehr, sehr viel besser. Er hat sich auch Vinavers Bemerkungen über Malory noch einmal vorgenommen und sagt zu mir: »Malory hat das Französische gekürzt und überarbeitet, also kann ich das gleiche mit Malory tun.« Ich glaube, die Steinbeck-Version erwacht langsam zum Leben, und ich möchte unbedingt, daß Sie das erfahren. Er sagt, dieser erste Entwurf ist nicht mehr als das, ein erster Entwurf, und er wird daraus seine eigene Fassung machen. Ich sagte zu ihm: »Warum hast du das denn nicht geschrieben?«, und darüber wurde er ungehalten! Sie sehen, es bildet sich langsam heraus. Ich finde, Sie haben beide viel dazu beigetragen, daß Klarheit geschaffen wurde.
AN CHASE – SOMERSET, 8. JUNI 1959
Ich habe über E. O. nachgedacht. Wissen Sie, in den langen Jahren unserer Verbindung hat es kaum einen Augenblick ohne eine persönliche Krise gegeben. Sie muß sich oft von Herzen wünschen, daß wir alle mit gebrochenem Rückgrat in der Hölle liegen. Wenn wir doch einfach brav unsere kleinen Sachen schrieben, sie bei ihr ablieferten, das Geld oder die Ablehnung akzeptierten, je nachdem, und unser Privatleben aus der Sache heraushielten. Wir müssen ihr sehr auf die Nerven gehen. Und auch wie das jetzt läuft, muß für sie etwas Altgewohntes und Ermüdendes sein. Wir decken sie mit unseren Sorgen und Nöten ein, und das sind sicher immer die gleichen. Es würde mich gar nicht überraschen, wenn sie plötzlich aufbegehrte. Statt fabelhaft fehlerfreier Manuskripte bekommt sie Ausreden und Theater und Kummer und Hin und Her und Rechnungen. Die Schriftsteller sind ein trauriger Verein. Zu ihren Gunsten läßt sich nur sagen, daß sie immerhin besser als die Schauspieler sind, aber das heißt nicht sehr viel. Ich frage mich, wie lange es her sein mag, daß einer ihrer Klienten sie gefragt hat, wie sie sich fühlt – falls es überhaupt jemals vorkommt. Es ist ein undankbares Geschäft mit undankbaren Kindem. Um wie vieles schärfer als einer Schlange Zahn sticht es, mit einem Autor zu tun zu haben. Von allem, was ein Autor tut, ist das Schreiben, so scheint es, das Geringste. Wenn seine Seelenqualen, seine Begierden, seine Irrtümer in Buchform veröffentlicht werden könnten, würde die Welt bis zum Nabel in Büchern stecken. Einer der positiveren Aspekte des Fernsehens liegt darin, daß es einiges davon absorbiert.
Nun zurück zu Malory oder vielmehr zu meiner Interpretation seiner Interpretation, auf die hoffentlich meine Interpretation meiner Interpretation folgen wird. Beim Arbeiten überrascht mich immer wieder, daß ein großer Teil des Stoffes blanker Unsinn ist. Sehr vieles darin ergibt überhaupt keinen Sinn. Zwei Drittel bestehen aus müßigem Geplapper von Kindern, die im Dunkeln träumen. Und wenn man dann drauf und dran ist, das Ganze angeödet hinzuwerfen, fällt einem das Kongreßprotokoll ein oder der Sacco- und Vanzetti-Prozeß oder der »Präventivkrieg« oder unsere Parteiprogramme oder Rassenprobleme, die nicht vernünftig gelöst werden können, oder Familienprobleme oder die Beatniks, und das öffnet einem die Augen dafür, daß die Welt vom Unsinn angetrieben wird – daß der Widersinn einen großen Teil der Weltläufe ausmacht und daß das fahrende Rittertum auch nicht verrückter war als unser heutiges Gruppendenken und -handeln. So sind eben die Menschen. Wenn man sie und ihr Treiben unter die Lupe der Vernunft nähme, würde man den ganzen Verein ertränken. Und wenn ich die Sache dann so richtig sarkastisch sehe, denke ich an mein eigenes Leben, wie ich damit umgegangen bin, und es ist keine Spur anders. Ich sitze im gleichen Boot mit der verblödeten Spezies. Ich bin mit der Unvernunft verschwistert, da gibt es kein Entrinnen. Aber auch die Unvernunft ist wie die aus Dämpfen und Drogen geborenen Offenbarungen der pythischen Priesterin in Delphi, die erst post factum plausibel werden.
Ich arbeite jetzt an Gawain, Ewain und Marhalt, nachdem ich ein bißchen Zeit mit der jungen Generation verloren habe. Aus diesem Teil hängen die losen Fäden heraus, er ist voller Details ohne Sinn, voller Versprechungen, die dann nicht gehalten werden. Der weiße Schild zum Beispiel – er wird nie wieder erwähnt. Ich glaube, es gelingt mir, der Episode etwas Leben einzuhauchen, vielleicht aber nicht genug. Je weiter ich vorankomme, um so mehr schwindet meine Scheu davor. Aber eine gewisse Ehrfurcht vor dem Stoff ist notwendig, denn wenn man diese Erzählungen achselzuckend abtut, tut man die Menschen ab.
Es gibt zwei Kategorien Menschen auf der schöpferischen Ebene. Die große Masse der mehr Kreativen denkt nicht. Sie ist zutiefst überzeugt, daß die Zeit, als die Welt noch in Ordnung war, dahingegangen ist. Menschen, die am Status quo hängen, wissen zwar, daß es für sie keine Rückkehr in die Zeit der Vollkommenheit gibt, kämpfen aber darum, sich nicht zu weit davon zu entfernen. Und dann gibt es den Kreativen, der an die Möglichkeit zur Vervollkommnung glaubt, an ein Fortschreiten – er ist selten, er richtet nicht sehr viel aus, unterscheidet sich aber zweifellos von den anderen. Lachen und Weinen – beides wird von einander nicht unähnlichen Muskelzuckungen ausgelöst, beides treibt Tränen in die Augen und bewirkt, daß einem die Nase läuft, und beides schenkt Erleichterung, wenn es vorüber ist. Marihuana stimuliert induziertes Lachen und die Sekundärwirkung von Alkohol falsche Tränen, und beides führt zu einem Kater. Und diese beiden physischen Gefühlsmanifestationen lassen sich entwickeln und steigern. Wenn ein Ritter von einem Gefühl derart übermannt wird, daß er ohnmächtig zu Boden sinkt, so ist das, glaube ich, buchstäblich die Wahrheit. Es war Konvention, wurde akzeptiert, und so tat er es. So viele Dinge, die ich tue und empfinde, spiegeln die Konvention und das, was akzeptiert wird. Ich frage mich, wieviel davon andere Beweggründe hat.
Ist es nicht merkwürdig, was es für Parallelen gibt? Vor ungefähr einem Monat, als ich mich mit Kritzeleien auf die Arbeit vorbereitete, schrieb ich einen kurzen Text und legte ihn in meinem Ordner ab, wo er sich noch befindet. Ich zitiere daraus:
Wenn ich über ein expandierendes Universum, über Novas und Rote Zwerge, von gewaltigen Umbrüchen, Explosionen, dem Verschwinden von Sonnen und der Geburt anderer lese, und wenn mir dann bewußt wird, daß die Nachrichten von solchen Ergebnissen, mit Lichtwellen transportiert, Dinge melden, die sich vor Jahrmillionen zugetragen haben, frage ich mich manchmal, was gegenwärtig dort geschehen mag. Wie wollen wir wissen, daß ein Prozeß und eine Konstellation, die so weit zurückliegen, sich nicht radikal verändert oder umgekehrt haben? Es ist denkbar, daß das, was die großen Teleskope heute aufnehmen, überhaupt nicht existiert, daß diese ungeheuren Emanationen der Gestirne vielleicht schon vorüber waren, ehe unsere eigene Welt Form gewann, daß die Milchstraße nur eine Erinnerung ist, getragen auf den Armen des Lichts.
AN ERO – SOMERSET, JUNI 1959
Ach ja! Ich kann Ihnen nur beipflichten – Arthur ist ein Trottel. Man wird so weit gebracht, daß man schreien möchte: Nicht schon wieder! Paß doch auf – er hat eine Knarre! Wie wir es früher in den alten Filmen taten, wenn unser angebeteter Held in die Höhle des Schurken tappte. Genauso wie Arthur. Aber es geht noch weiter und erwischt sogar die Schlauen. Denken Sie an Morgan – ohne sich zu vergewissern, ob ihr Plan, Arthur zu ermorden, geglückt ist, macht sie munter weiter, als wäre es so. Aber es ist ja Literatur. Wenn Sie wollen, denken Sie an den Jehova im Alten Testament. Da haben wir einen Gott, den General Motors nicht einmal als Lehrling nähme. Er macht etwas falsch, wird dann wütend darüber und schlägt sein Spielzeug kaputt. Denken Sie an Hiob. Es hat fast den Anschein, daß Dämlichkeit in der Literatur etwas Notwendiges ist. Schlau dürfen nur die Bösewichter sein. Könnte es nicht sein, daß der Spezies Haß auf die Intelligenz und Furcht davor eingebaut sind, so daß die Helden notwendigerweise Dummköpfe sein müssen? Fast immer wird Klugheit mit Bösartigkeit gleichgesetzt. Es ist rätselhaft, aber so sieht’s aus.
Ich habe das Gefühl, daß ich jetzt bei den Geschichten von Ewain, Gawain und Marhalt so richtig in Fahrt gekommen bin. Zum einen sind sie besser erzählt, und zum zweiten baue ich sie aus. Wo Malory eine Begebenheit anfängt und sie dann vergißt, nehme ich sie wieder auf. Die Erzählung ist lang und meine Version davon in manchen Teilen noch länger, aber ich kürze auch hin und wieder. Ich habe Spaß dabei.
Immer wieder erstaunt mich die Einstellung zu Frauen. Malory hat für sie nicht viel übrig, es sei denn, sie sind blutlos. Und auch nicht für Zwerge – hier zeigt sich beinahe eine Angst um die eigene Männlichkeit. Nun waren die Menschen im 15. Jahrhundert keine Trottel. Wir wissen aus den Paston Letters und aus vielen anderen Quellen, daß sie durchtriebene Teufel und durchaus imstande waren, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Die Menschen des 15. Jahrhunderts hatten mit den Menschen in der Arthur-Sage nicht mehr Ähnlichkeit als der Alte Westen mit dem Western. Doch in beiden Fällen findet sich die Sehnsucht nach der kindlichen Einfachheit einer Zeit, in der die Großen nicht klug waren. Irgend jemand war klug genug, Malory während seines letzten Lebensabschnitts hinter Gittern zu verwahren, ohne ihn irgendwann vor den Richter zu bringen. Hier ist keine Tugendhaftigkeit im Spiel. Irgendein verdammt schlauer Kopf wollte ihn nicht auf freien Füßen sehen. Die Welt war nicht jung und unschuldig, als Malory schrieb, sie war alt und sündhaft und zynisch. Und sie ist auch heute, in einer Zeit, da die gekonnt geschriebene Story ohne jede Tiefe und der Western in Blüte stehen, nicht unschuldig. Könnte es sein, daß Mickey Spillane die wahre Zukunftsliteratur verkörpern wird? Denkbar ist es zumindest.
Gestern nachmittag stieg ich nach der Arbeit auf den Cruch Hill, wo eine Gruppe Schuljungen unter der Anleitung trefflicher Leute aus dem British Museum mit Ausgrabungen beschäftigt ist. Eine Festung aus der Jungsteinzeit und darüber eine aus der Eisenzeit und über beidem ein römischer Tempel. Die Menschen aus der Jungsteinzeit haben ein wunderbares System von Mauern und Wehranlagen gebaut. Mein Gott, was sie geleistet, wieviel Erdreich und Gestein sie bewegt haben! Eine Großtat. Und ganz Somerset ist mit solchen gewaltigen Befestigungsanlagen übersät. Damals muß hier eine kopfstarke und wohlorganisierte Bevölkerung gelebt haben. Man kann ohne Maschinen keine Berge verschieben, es sei denn, man verfügt über Menschen in großer Zahl. Und der Umfang und die konsequente Gestaltung der Anlage sprechen nicht nur für eine straffe Organisation, sondern auch für eine große Kontinuität. An dem Werk – alles nach einem einheitlichen Konzept – muß generationenlang gearbeitet worden sein. Die Linien sind sauber und gerade gezogen, und der Plan blieb unverändert. Es ist erstaunlich.
AN ERO – SOMERSET, JUNI 1959 (SONNTAG)
Elaine ist in der Kirche, und ich stecke mitten in meinem Tagespensum. Heute morgen sagte sie zu mir: »Du bittest Elizabeth, sich um allen möglichen Kram zu kümmern. Ich bin mir sicher, sie hätte lieber einen Klienten, der nur schreibt und ihr Texte schickt.«
Ja, das ist wahr. Sie hat recht. Als Klient war ich immer ein hoffnungsloser Fall.
Angesichts dessen, finde ich, wäre es angebracht, Ihnen einmal in einem Brief zu sagen, daß ich weiß, wieviel Sie tun und die ganze Zeit getan haben, und Ihnen zweitens einen Brief zu schreiben, in dem nichts von Kümmernissen, Bitten, Klagen, Erklärungen oder Ausflüchten steht. Wäre das für Sie nicht eine Erholung?
Ich möchte Ihnen etwas sagen, was mir endlich klargeworden ist: Der Arthur-Zyklus ist, wie praktisch alles Sagengut, das die Zeiten überdauert hat und in tiefen Schichten wurzelt, eine Mischung aus Tiefgründigkeit und kindlichem Unsinn. Aber wenn man das Tiefgründige bewahrt und den Unsinn hinauswirft, geht etwas vom Wesensgehalt verloren. Hier werden Träume erzählt, unveränderliche, allgemein-menschliche Träume, und sie haben die Inkonsequenz von Träumen. Na bitte, sage ich – wenn es sich um Träume handelt, werde ich ein paar von mir dazutun, und das habe ich getan.
Inzwischen ist es viel später, und ich habe einen wunderbaren Arbeitstag hinter mir, angefüllt mit köstlichen Aufregungen, vielleicht nicht gerechtfertigt, gleichwohl aber genossen. Es ist eine verrückte Geschichte, aber irgendwo steckt irgendein Sinn darin.
Seit Monaten spreche ich jetzt unausgesetzt von mir. Wie geht es denn Ihnen? Werden Sie ein bißchen ausspannen? Werden Sie nach Sag Harbor hinausfahren? Mir fällt kein schönerer Wunsch ein als der, sie könnten einen Abstecher hierher machen und sich in unserem »Kuhstall« einquartieren, der ein sehr angenehmer Raum ist. Ich wünschte, sie könnten die Atmosphäre hier spüren, sie einfach in sich einsickern lassen. Ich habe nichts davon erwähnt, aber schon seit einiger Zeit versuche ich, einen Gedanken in ihre Richtung zu strahlen, von der Hoffnung bewegt, er würde unterwegs an Stärke gewinnen, so daß Sie sich eines Morgens sagen würden, Sie müßten einfach hierherkommen, ohne auch nur einen Grund dafür zu wissen. Manchmal sitze ich da, streite mit Ihnen, ringe sogar geistig mit Ihnen und versuche, Ihre Argumente zu Fall zu bringen. »Unsinn«, sagen Sie. »Es ist kostspielig. Ich mag die Provinz nicht. Ich habe keinen Grund hinzufahren.«
»Aber es ist nicht unsinnig und nicht einmal kostspielig. Und Provinz ist es eigentlich nicht. Es kommt einem vor, als hätte man noch nie eine so bevölkerte Gegend erlebt, und hier ist nach der Plackerei richtig wohl sein. Irgend etwas hier klärt den Blick.« Sie darauf: »Mein Blick ist mir klar genug. Es bringt nichts.« Ich: »Aber hier gibt es etwas, von dem ich glaube, es wird eine verwandte Saite in Ihnen zum Klingen bringen. Ich möchte einfach, daß Sie es sehen und spüren. Es hat einem etwas zu sagen – was, das weiß ich nicht, aber ich weiß, was für ein Gefühl es einem gibt.« Und dann werfen Sie den Kopf zurück wie ein Pony, wie ich es oft an Ihnen erlebt habe, recken das Kinn nach vorne und wechseln das Thema. »Sie wollen es sich also nicht überlegen?«
»Nein.«
»Ich werde nicht lockerlassen. Hier ist eine Macht, die ich auf Sie ansetzen werde.«
»Tun Sie das lieber nicht, und lassen Sie mich in Frieden.«
»Hier gibt es viel mehr als nur Wiesen und Hecken – viel, viel mehr als nur das. In der Erde sind Stimmen.«
»Gehn Sie weg.«
»Nein, das werde ich nicht tun. Ich werde warten, bis Sie eingeschlafen sind, und ein Geschwader Somerset-Feen schicken, die Sie umsurren wie Moskitos – richtig zähe Feen.«
»Ich werde sie mit Insektenspray beschießen.«
AN ERO – SOMERSET, JULI 1959 (SONNABEND)
Die Arbeit geht erfreulich und gut von der Hand. Ich werde Ihnen nichts davon schicken, bis ich genug beisammen habe, daß ich Ihnen den neuen Weg zeigen kann, den ich eingeschlagen habe, und der mir selbst sehr gut gefällt. Ich habe auch einen großen Plan, um dem Ganzen eine Einheit zu geben. Aber wie ich schon – in einem früheren Brief – gesagt habe: Ich werde ihn mir nicht wieder ausreden. Das tue ich zu oft. Soviel immerhin kann ich Ihnen verraten: Wenn es weiter so gut geht, kann ich im Oktober unbeschwert nach Hause fahren, weil ich weiß, daß ich es überall zu Ende schreiben kann. Und es fängt auch an, in meinem Kopf eine richtig abgerundete Form zu gewinnen, und Millionen Einfälle werden ausgebrütet und schwärmen umher, und das ist für mich das beste Leben, das ich mir denken kann. Allerdings muß man sehr viel Geduld haben, bis man es bekommt.
Jetzt ein paar Worte an Chase. Sie werden ihm wie eine Wiederholung vorkommen, denn ich bin mir sicher, daß er mir darüber schon geschrieben hat. Ich hätte es nur gerne alles in ein und demselben Brief. Um den Monatsbeginn will ich oder vielmehr wollen wir nach Wales fahren. Ich hätte gern, daß Chase mir einen Reiseplan entwirft. Ich möchte ihn im Gedächtnis speichern, so daß ich jederzeit darauf zurückgreifen kann.
Es freut mich, daß Shirley die »Triple Quest« gefällt. So lautet übrigens der Titel. Ich versichere Ihnen, der Lancelot ist viel besser. Ich habe endlich die Tür geöffnet.
Jetzt möchte ich Ihnen von einem Wunder berichten, einem von der Sorte, wie sie hier geschehen. Vorgestern schrieb ich über einen Raben, einen tollen Burschen und Freund von Morgan le Fay. Gestern morgen um acht saß ich an meinem Schreibtisch, und draußen vor der Tür war ein lautes krächzendes Quaken zu hören. Ich dachte, es sei ein Riesenfrosch. Ich weckte Elaine auf, die oben schlief. Sie schaute zum Fenster hinaus, und da saß ein riesiger Rabe, der auf meine Tür einpickte und krächzte – ein Monster von einem Vogel. Der erste Rabe, den wir gesehen haben. Nun, wie erklären Sie sich das? Ich hätte nicht einmal davon berichtet, wenn Elaine, die Wahrheitsliebende, ihn nicht auch gesehen hätte.
AN CHASE – SOMERSET, 3. JULI 1959
(von Elaine Steinbeck)
Gestern fuhren wir durch Plush Folly – eine neue Ergänzung für unsere Liste von Ortsnamen. Es ist in Dorset. Wir hatten einen herrlichen Nachmittag. John läßt einen seiner Ritter hier durchs Land ziehen und brauchte ein paar geographische Details. Ja, auf diese Weise kann man den Vorteil nutzen, in Europa zu sein. Wir fuhren südwärts bis unterhalb von Dorchester und stiegen zum Maiden Castle hinauf, einer ausgedehnten Hügelfestung aus der Zeit 2000 v. Chr. Es ist ein eindrucksvoller, oben abgeflachter Hügel mit acht Gräben, tief und mit steilen Wänden. Dort oben könnte man sicher einer Masse Menschen Schutz bieten. Von oben blickten wir nach Dorchester hinab und konnten klar die Form der römischen Stadtanlage erkennen. Die vier römischen Zugänge zur Stadt sind heute mit Bäumen gesäumt und heißen »The Walks«.
Wir fuhren auch nach Cerne Abbas, um uns den Dorset Giant anzusehen, einen aus einem Kreidehügel herausgehauenen, mehrere hundert Fuß großen Mann. Er macht einen grimmigen Eindruck und schwingt eine Keule über dem Kopf. Außerdem ist er überaus priapisch. John meint, er sei das Werk irgendeines archaischen Volkes, als Symbol der Fruchtbarkeit gedacht. Ich glaube, die Absicht war, Angst und Schrecken bei vorüberkommenden Damen auszulösen, die dann zu Hause zu ihren Ehemännern sagen würden: »Steh nicht so da, als wolltest du es mit ihnen aufnehmen.«
Ich habe Ihren Brief über Bodmin Moor und Caerleon on Usk zusammen mit der von Ihnen markierten Karte im Auto, bei unseren anderen Landkarten und den Reiseführern. John sagt, er möchte sich schon bald beides ansehen.
Wir stecken bis über die Ohren in verdickter Devonshire-Sahne, da jetzt die Erd- und Himbeeren Hochsaison haben. Unsere Beeren kommen aus dem Garten der Discoves – und manchmal mache ich selbst »Devonshire cream« für uns. Jedesmal, wenn unsere Bekannten uns Sahne schenken, lasse ich sie in einem flachen Töpfchen sechs Stunden auf dem warmen Teil des Herds stehen und dann mehrere Stunden auf dem kühlen Steinboden der Küche. Wenn sie klumpig zu werden beginnt, schöpfe ich den Rahm oben ab, stelle ihn zum Kaltwerden in den Kühlschrank und serviere ihn mit Beeren. Ein Gedicht! – Ich wäre ohne das Constance Spry Cookery Book verloren und benutze es täglich. Ich habe gelernt, wie man ein richtiges indisches Curry-Gericht zubereitet. Die Zutaten gibt es im Bombay Emporium in London zu kaufen. Im Herbst machen wir eine Curry-Dinner-Party.
Ich hoffe, morgen Text zu bekommen. Ich habe Mittwoch bei Mrs. Webb vorbeigeschaut, um sie daran zu erinnern. Sie tippte gerade eine Stelle, wo John ein Mädchen die Leibwäsche eines Ritters waschen und sie zum Trocknen an einen Stachelbeerbusch hängen läßt, ehe sie die Nacht im Wald verbringen. Sie wollte wissen, ob ich weiß, daß in England die Babys aus Stachelbeerbüschen herauskommen. Ich wußte es nicht und John auch nicht, und er war entzückt.
AN ERO UND CHASE – SOMERSET, 13. JULI 1959
Natürlich habe ich nichts geschrieben, während ich unterwegs war. Ich denke immer, ich werde es tun, tue es aber doch nicht. Ich habe mir allerdings eine Unmenge Gedanken gemacht und werde meinen Anfang von Lancelot wegwerfen und noch einmal beginnen, weil ich jetzt zu wissen glaube, wie es gehen muß. Und nach dem Lancelot, denke ich fast, werde ich zurückgehen und noch mal von vorne anfangen. Vielleicht habe ich jetzt den Bogen raus. Es dauert seine Zeit.
Chase, vielen Dank für die Arbeit am Maiden Castle. Mein Verdacht läßt mich noch immer nicht los. Der Grund liegt vor allem darin, daß ich weiß, wie in Mexiko die Sache ablief. Spanier kamen ins Land, hörten ein aztekisches Wort und benannten den betreffenden Ort nach dem Wortklang auf spanisch um. Es gibt Hunderte solcher Beispiele. Etwa Cuernavaca – Kuhhorn. Der aztekische Name lautete Cuanahuatl, was ein bißchen wie Cuernavaca klingt, aber Ort der Adler bedeutet. Es war der Klang, worauf es ankam, nicht die Bedeutung. Ich habe den Verdacht, daß das »Maiden« in Maiden Castle nach dem Klang eines Wortes in einer früheren Sprache gebildet ist, und möchte wetten, es handelt sich um die indogermanische Wortwurzel »mei«, was verändert oder angehäuft oder unnatürlich bedeutet. Und die großen Schanzen sind »Haufen«.
Aber all das ist nur interessant, nicht mehr. Ich versuche, an den »Menschen« der Erzählungen zu arbeiten. Es freut mich, daß Ihnen die »Triple Quest« ein bißchen gefällt, Chase. Zumindest liefert sie eine gewisse Erklärung für das Auftreten der drei Damen. Der Lancelot-Teil, so wie ich jetzt den Anfang sehe, beginnt mir etwas einzuleuchten, sogar im Hinblick auf den Grund für die Gralssuche, die später folgt. Man hat immer angenommen, daß der Gral zuerst kommt und dann die Suche. Aber angenommen, eine Ausfahrt wurde notwendig und als Ziel dafür der Gral gesetzt? Ich bin jedoch nicht gewillt, noch weitere Probeläufe zu machen. Wenn es fertig ist, werde ich es als fait accompli schicken. Vielleicht habe ich schon zu viele Testläufe gemacht. Trotzdem ist mir jetzt wohler.
AN ERO – SOMERSET, 25. JULI 1959
Nachdem ich Ihr Telegramm erhalten hatte, schickte ich gestern den allerersten Teil vom Lancelot, was ich für richtig halte. Sollte er unterwegs verlorengehen, habe ich hier eine Kopie, zwar schwach, aber durchaus leserlich. Und außerdem ist mir noch nie etwas verlorengegangen. Dieses Mskr. nimmt allmählich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem an, was ich zustande bringen möchte. Sie werden sehen, daß ich mich zwar an die Geschichte halte, aber Dinge, die unklar sind, peu à peu mit Eigenem überbaue und Dinge, die entweder keinen Sinn hatten oder ihn inzwischen eingebüßt haben, überhaupt beseitige. Und wenn diese Arbeit etwas von einem Traum an sich hat – nun ja, das ganze Leben hat etwas davon. Die meisten Menschen leben zeit ihres Lebens in einem Halbtraum und nennen ihn Realität. Und überall dort, wo ich, wie erwähnt, die Geschichte mit der Gegenwart verbinden kann, indem ich eine damals wie heute glaubwürdige Situation ausbaue, habe ich das getan. Und da dieser Stoff etwas eigentümlich Dekoratives hat, habe ich versucht, ihm etwas von der Art mittelalterlicher Malerei zu geben, ein bißchen zeremoniell, aber nicht immer. Zumeist mußte ich die Personen überhaupt erst einmal zum Leben erwecken. In diesem ersten Teil – und er ist beileibe noch nicht fertig – mußte Lancelot sich noch nicht seinem doppelten Ich stellen. Er ist moralisch noch nicht auf die Probe gestellt worden. Deswegen habe ich Lancelot wohl ins Herz geschlossen: er muß sich einer Prüfung stellen, besteht sie nicht und bleibt gleichwohl ein edler Charakter.
Sie zeigen sich besorgt über Vinavers Einfluß auf die Art, wie ich arbeite. Ich kann es natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich denke doch, er wird der erste sein, der ihr Beifall zollt. Er ist nicht der steife Gelehrte, für den Sie ihn halten. Und er kennt die Veränderungen, die andere daran [am Morte] vorgenommen haben. Ich möchte beinahe wetten, daß er meine Eingriffe gutheißt, und wenn nicht, würde es keine große Wirkung haben, weil ich schon soweit vorangekommen sein werde. Ich fange jetzt wirklich an, die Arbeit um ihrer selbst willen zu lieben, und lasse das bißchen Geist, das in mir steckt, zu seinen eigenen Quellen gehen. Um darauf noch einmal zurückzukommen: Ich finde die Analyse der Hexerei recht gelungen und, soweit mir bekannt ist, auch neuartig.
Ich stimme mit Ihnen überein, daß es am besten ist, dort weiterzumachen, wo ich jetzt bin, und erst zuletzt zum Anfang zurückzugehen. Ich werde auch versuchen, in diesem ersten Entwurf sämtliche Nebenepisoden zu beseitigen und die Hauptstoßrichtung zu verfolgen. Tristan, das ist eine ganz andere Geschichte. Sie kann warten. Aber die Sache, die ich jetzt in den Griff bekommen möchte, das ist Lancelot, Arthur, Guinevere … Jedenfalls, ich werde sehen, was ich aus diesem Haupt- und Zentralthema machen kann. Und wissen Sie was? Im Titel sollte nicht Arthur, sondern Lancelot stehen. Er ist mein ein und alles. In ihn kann ich mich hineinversetzen. Und allmählich gelingt mir das auch bei Guinevere, und so werde ich mich schließlich auch in Arthur einfühlen.
AN ERO – SOMERSET, 28. JULI 1959
Schwierigkeiten mit der Arbeit heute – teilweise geht es um eine heikle Entscheidung über Form und Auslassung. Der verdammte Malory hat sich an dieser Ausfahrt festgebissen und rennt von einer Keilerei zur nächsten. Auch ist er so besessen davon, Menschenmassen mit einem Fetzen blutigen Stoffs zu heilen, daß er Personen und Anlässe heillos durcheinanderbringt. Dann läßt er Lancelot sich mit Sir Kays Rüstung verkleiden und vergißt plötzlich alles wieder. Und ich muß diese Dinge ans Licht ziehen und ihnen irgendeinen Sinn geben oder sie rausstreichen. Ungefähr drei von acht Abenteuern sind wirklich gut, aber gerade für die hat er gar nichts übrig. Alles sehr schwierig. Ich denke, es ist mir in dieser Erzählung bislang gelungen, den Leser halbwegs bei der Stange zu halten, und ich möchte nicht, daß sie sich auf Malorys übliche Art totläuft. Aber wenn ich einfach darauflosschufte, werde ich einen Weg aus dem Schlamassel finden. Ich muß. Der beste Weg ist der einfachste, aber es verlangt schrecklich viel Nachdenken, bis einem das Einfache gelingt.
Ich habe einen erfreulichen Brief von Shirley erhalten. Es freut mich schrecklich, daß sie die »Triple Quest« gut findet. Ich weiß, man gibt derjenigen Ausfahrt den Vorzug, in der man sich selbst am stärksten wiederfindet. Hoffentlich gefällt Ihnen das Stück vom Lancelot, das ich abgeschickt habe. Und ich hoffe auch, diesen ersten Lebensabschnitt des alten Knaben noch diese Woche abzuschließen und an Sie in Marsch zu setzen. Danach wird sein Leben komplizierter. Diesen ersten Teil könnte man Kindheit eines Ritters nennen – voller wundersamer Dinge. Aber später muß Lancelot sich mit einigen ziemlich heiklen Erwachsenenproblemen herumschlagen, Problemen, die seither keineswegs aus der Welt verschwunden sind.
AN ERO – SOMERSET, 28. JULI 1959
Wenn alles gutgeht, müßte ich mit diesem Stück heute fertig werden, doch da es noch früh am Vormittag ist, werde ich einen Brief an Sie anfangen. Sie werden feststellen, daß ich in diesem ganzen Abschnitt stärker von Malory abgehe als im übrigen Text. Dieser Abschnitt ist vor allem vom Magischen bestimmt, man könnte ihn als die Unschuldsphase eines Lebens bezeichnen, in der Drachen und Riesen hausen – die inneren Monster, die kommen später. Ich habe mehrere der schwerer verständlichen Abenteuer bei Malory herausgenommen, andere hingegen stark und in einer Art erweitert, die den Meister vielleicht tief bestürzen würde. Ich muß die letzte Szene des Abschnitts heute schaffen, und sie ist schwierig. Und sollte sie sich so auswachsen wie manche von den anderen, könnte es sein, daß ich sie nicht fertig bekomme. Ich hoffe es zwar, aber wenn nicht, spielt es auch keine Rolle. Als Übung in Metaphorik war dies eine sehr interessante Arbeit. Ich habe mich den ganzen Abschnitt hindurch bemüht, die Phantasie des Lesers zum Weiterspinnen anzustacheln, aber keine Ahnung, ob es mir geglückt ist. Bei diesem Teil war mein Bestreben, es so hinzubekommen, daß er wie ein lebendiges Wandgemälde wirkt, zeremoniell, ein bißchen überladen und irreal, und dennoch mit allen Eigenschaften des Realen. Mehr als alles andere aber möchte ich, daß er glaubwürdig wirkt. Nun ist Lancelot bisher kein schrecklich komplizierter Charakter, aber heute kommt ein solcher daher – Guinevere, ein ganz schöner Brocken. Ich glaube, ich weiß, wie ich sie angehen werde, aber wir werden ja sehen.
Später am Sonntag … Nun, es ist doch fertig geworden, soll’s der Teufel holen! Es ist noch sehr provisorisch, aber es muß jetzt auf seinen eigenen Beinen stehen. Und morgen werde ich es an Sie abschicken, falls das Postamt offen ist.
AN CHASE – SOMERSET, 1. AUGUST 1959
In der letzten Zeit habe ich nicht sehr oft geschrieben, denn ich war bis jetzt ganz in der Arbeit verloren, wie Sie an dem Text sehen werden, der gerade an Sie abgeschickt wird. Ich habe gestern nach einer langen und schwierigen Bataille die letzte Episode im ersten Buch von Lancelot beendet, sehr zu meiner Zufriedenheit, und ich kann wirklich ohne Eitelkeit sagen, daß sie zum erstenmal Hand und Fuß hat, insofern die ganze nekromantische Atmosphäre überhaupt Sinn macht. Ich habe endlich das Gefühl, daß ich Boden unter die Füße bekomme. Heute muß ich die ganze Serie der Ausfahrten zu einem Paket zusammenschnüren, zwei Figuren entwickeln, Gründe für das Ganze liefern und schließlich einen Übergang zum nächsten Lancelot fabrizieren. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Die Schreibwut hat mich gepackt. Sie werden den Text noch sehr unfertig finden, aber das spielt keine Rolle. Der Wesensgehalt ist da, und die Textur auch. Und nur Ihnen wird auffallen, was für eine Unmenge an Lektüre hier eingeflossen ist. Es ist vollgestopft mit Mittelalter, hoffentlich so subtil eingeschoben, daß es nicht als Geprunke mit gelehrtem Wissen wirkt.
Ich habe immerfort Bitten an Sie, Sachen für mich zu erledigen, und hier kommt schon wieder eine. Ich benütze jetzt zum Schreiben Cross-Kugelschreiber. Sie eignen sich besonders gut für die Kopien, da sie mit einem dünnen, aber festen Strich schreiben und schwer in der Hand liegen. Ich habe drei davon, und der eine ist schon ziemlich hinüber. Ich glaube, Sie wissen, welche ich meine. Ich habe ein paar Minen gekauft, und Mary Morgen hat noch weitere geschickt, trotzdem aber geht mein Vorrat zur Neige. Ich wechsle gern die Kulis, bevor sie zu ermüden scheinen und eine Ruhepause brauchen, ehe ich eine brauche. Könnten Sie mir also bitte per Luftpost zwei Kulis und folgende Minen schicken: acht mit dem feinsten Strich, den die Firma produziert, drei mit einem mittleren Strich, zwei mit einem breiten Strich und alle mit der schwärzesten Schreibflüssigkeit, die es gibt. Ich habe große Angst, daß sie mir ausgehen, und wenn mir das Schreiben gut von der Hand geht, werde ich derart zum Gewohnheitstier, daß ein Wechsel des Schreibgeräts mich irritiert.
Muß jetzt an die Arbeit gehen. Ich möchte gerne noch vor dem Wochenende den ersten Lancelot-Teil an Elizabeth mitschicken.
AN CHASE – SOMERSET, 9. AUGUST 1959
Der Ausflug war recht ergiebig, und ich habe die meisten Dinge gesehen, die ich sehen wollte – im wesentlichen fließende Gewässer, Topographie, Farben etc. Caerleon war gut, und der Usk sogar noch besser.
Auch kam der abgetippte erste Teil vom Lancelot. Und außerdem bemerkenswert ordentlich getippt. Ich habe es nicht allzu genau geprüft, aber es wirkt sehr sorgfältig. Und ja, ich beabsichtige, anschließend in den zweiten Lancelot-Teil zu gehen. Ich sehe keinen Grund, warum ich ihn mit dem langen Tristan unterbrechen sollte. Also … jeglicher Kommentar Ihrerseits ist mir willkommen. Ich werde ein paar Tage lang lesen müssen, ehe ich anfange, weil ich Lancelot keine weiteren langen und sinnlosen Abenteuer bestehen lassen will, es sei denn, sie tragen zur Entwicklung der Geschicke der drei Personen bei.
AN ERO UND CHASE – SOMERSET, 10. AUGUST 1959
Ich habe darauf gewartet, Chase, daß Sie die Anachronismen aufgreifen. Ich wußte alles, was dazu zu sagen ist, und habe sie absichtlich eingefügt, was allerdings nicht heißen soll, daß sie schließlich nicht doch weggelassen werden. Ich habe mir darüber sehr viele Gedanken gemacht. Ja, das ist überhaupt eines der heikelsten der zahlreichen Probleme, und vielleicht muß man in einem einleitenden Essay darauf eingehen. Wie ordnet man Arthur zeitlich ein? Malory glaubte, er habe im 5. Jahrhundert gelebt, denn er ließ anno 454 nach Christi Geburt Galahad den »Gefährlichen Sitz« einnehmen. Sodann steckte er seine Ritter in Rüstungen aus dem 15. Jahrhundert und erlegte den Ritterkodex aus dem 12./13. Jahrhundert einem seltsam entvölkerten und ruinierten Land auf, das einen an England nach dem ersten Auftreten der Pest und an die Verwüstung nach den Rosenkriegen denken läßt. Seine Städte sind Märchen-, man könnte sogar sagen Walt-Disney-Gebilde. Aber wie würde man einen Dux bellorum aus dem 5. Jahrhundert kleiden, wenn man sich für diese Epoche entschiede, und zumal einen von römischer Herkunft und mit römischem Hintergrund? Ich weiß, was die spätrömische Reiterei trug, und es hatte nichts mit der vom Kopf bis zum Fuß reichenden Plattenpanzerung des 15. Jahrhunderts zu tun. Die Turnierlanze war unbekannt, das Rittertum noch nicht erfunden.
Eines hat Malory getan – er siedelte seinen Text in einem »Früher« an. Das ist nun eine ganz eigene Zeit, und ich habe versucht, sie zu übernehmen. Eine Differenzierung der Vergangenheit ist relativ jungen Datums. Julius Caesar hatte keine Schwierigkeiten mit seiner Abstammung von Venus und empfand sie nicht als etwas sehr Fernes. Herodot gibt der Vergangenheit, die er schildert, keine zeitliche Tiefe. Galahad ist Nachkomme von Joseph von Arimathia im achten Glied, und Lancelot stammt im siebten Grad von Jesus Christus ab, wenn mir auch unklar ist, wie das zuwege gebracht wurde. Ich möchte hier nicht den Schulmeister spielen. Und nach einer Diskussion werde ich vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Ich habe die Wahl unter folgenden Möglichkeiten – ich kann mich für eine bestimmte Periode entscheiden und dabei bleiben, was diese ganze Arbeit auf eine umgrenzte Zeit fixieren würde und mir nicht gefällt, weil die Erzählungen einen überzeitlichen Charakter haben; oder ich kann, wie alle anderen, die Vergangenheit zu einem großen, bunt zusammengesetzten Tableau machen, das »Früher« heißt. Nun, das ist ja tatsächlich das Bild, das die meisten Menschen von der Vergangenheit haben. In diesem Muster könnte das Pfahldorf wie der toskanische Kaufmann Platz finden, weil beide dem »Früher« angehören. Das einzige, was darin keine Aufnahme finden kann, ist das »Heute«, das Gegenwärtige. Andererseits wieder müssen die menschlichen Probleme alle Probleme von heute sein. Malory brachte alle Probleme aus seinem, dem 15. Jahrhundert, im »Früher« unter. Und ich muß im »Früher« die Probleme unserer Zeit unterbringen. Ich möchte, daß Sie das mit mir durchdiskutieren. Vielleicht bin ich auf dem verkehrten Weg. Ich glaube, daß diese Erzählungen moralische Parabeln sind. Aesop legte seine Weisheit und seine Morallehren Tieren in den Mund. Ich muß die Weisheit oder vielmehr beides Rittern in den Mund legen, aber es ist, genauso wie es bei Malory war, die Gegenwart, über die ich schreibe. Wenn ich die Arbeit zu einem zeitgebundenen Text mache, werden die Probleme seltsamerweise Probleme dieser Zeit. Indem ich sie aber vor einen riesigen zeitlosen Bühnenvorhang des »Früher« stelle, hoffe ich, sie für das »Jetzt« doppelt gültig zu machen. Verstehen Sie überhaupt, was ich sagen will? Und ist es einleuchtend? Ich sollte in meiner Einleitung wohl auf dieses Problem eingehen. Aber wir werden über all dies diskutieren, lange bevor wir etwas Gedrucktes zu sehen bekommen.
AN ERO – SOMERSET, 22. AUGUST 1959
Die Arbeit wächst nicht zusammen. Sie wissen das, und ich weiß es auch. Sie ist noch nicht aus einem Guß. Wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, kommt eine Zeit, in der sie Gestalt gewinnen muß, und dafür kann niemand außer mir selbst sorgen. Sie muß etwas Geschlossenes werden, und das ist sie noch nicht. Dann überlegte ich: Ich bin jetzt hier, und ein Zimmer hier ist ebenso gut wie ein Zimmer in New York. Fingernägel kann ich überall kauen. Und deshalb werde ich den Rest meiner Zeit hier nicht mit Schreiben, sondern mit Schauen, mit Speichern verbringen. Wir hoffen, um den 15. Oktober auf der Flandre nach Hause reisen zu können, wenn wir eine Passage bekommen. Die letzten zwei Wochen oder zehn Tage werden wir uns in London aufhalten. Auch dort möchte ich mir allerhand ansehen. Dann werde ich einen großen Vorrat beisammen haben, aus dem ich mich bedienen kann. Und ich arbeite ungleich besser, wenn ich einen Schauplatz gesehen habe. Wir werden die angrenzenden Gebiete bis September abklappern und, sobald der Verkehr schwächer wird, in größere Entfernungen schweifen. Und nur wir zwei. Ich kann mit niemandem sonst reisen. Dann, wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich auf mich gestellt sein. Mit Recht nennt man die Schriftstellerei den einsamsten Beruf der Welt. Vielleicht wird die Arbeit dann eine Form annehmen. Wer weiß? Aber es gibt einen Punkt, wenn man den hinter sich gelassen hat, kann einem niemand mehr helfen, bis es geschafft ist.
Aber ich glaube, mit dem Speicherprozeß habe ich recht. Ich möchte die ganze Küste vom Bristol Channel bis Land’s End kennenlernen. Ich habe so viel gelernt, als ich den See sah und die Gezeiten beobachtete. Gezeiten waren nämlich sehr wichtig.
Gerald Wellesley hat angerufen und gesagt, Sir Philip Antrobus, dem sowohl Stonehenge als auch Amesbury Abbey (wo Guinevere starb) gehören, sei einer seiner ältesten Freunde und werde sich freuen, wenn wir uns dort umsehen wollen. Das werden wir tun, sobald ich von ihm eine Antwort auf einen Brief bekomme. Das ist aber ein seltsamer Name: Antrobus. Das Oxforder Ortsnamen-Lexikon gibt keine Wurzel an, schreibt aber, es sei schwerlich englischen Ursprungs. Ich werde die Familie im Burke’s nachsehen, sobald ich dazu komme, bei Alex Barclay vorbeizuschauen. Könnte es nicht einfach das griechische Wort anthropos sein, was Mensch bedeutet? Jedenfalls ist es ganz anders als alle englischen Namen, die ich jemals gehört habe. Aber wie dem auch sei, wir werden uns wahrscheinlich nächste Woche einige Zeit dort aufhalten. Der ganze Salisbury-Komplex fasziniert mich. Es ist wahrscheinlich das älteste Bevölkerungszentrum in ganz England. Vielleicht kann mir Sir Philip Zugang zu Stonehenge verschaffen, damit ich mir das Aufstellen der umgestürzten Steine aus der Nähe ansehen kann, das zur Zeit vom Ministry of Works [Ministerium für öffentliche Bauten] durchgeführt wird. Ich möchte sehen, was darunter war. Vielleicht noch weitere Queräxte. Auf jeden Fall werde ich mein Vergrößerungsglas mitnehmen, damit ich mir die Dinge genau ansehen kann. Außerdem möchte ich einen ausgiebigen Blick auf Old Sarum werfen. Manchmal, wenn ich die Augen zusammenkneife, kann ich Sachen richtig sehen. Den Tag, an dem Elaine in London war, habe ich zum größten Teil auf den Cadbury-Hügeln verbracht und bin allein in den Gräben umhergewandert. Ich weiß jetzt, warum Caerleon dort ist, wo es ist, aber gelesen habe ich darüber noch nie etwas. Das eben meine ich mit den Gezeiten: wenn man in einem Boot in der Mündung des Usk die hereinkommende Flut erwischt, trägt sie einen in einem Schwung bis nach Caerleon, und das gleiche gilt umgekehrt bei einsetzender Ebbe. Diese Dinge waren damals sehr wichtig. Ich weiß eine Menge über Camelot, seit ich hier allein umherwandere. Es geht darum zu spüren, »wie es einst war«.
AN CHASE – SOMERSET, 27. AUGUST 1959
Heute vormittag habe ich meinen neunten Brief in Sachen Kugelschreiber an das Customs and Excise Office [die Finanzbehörde für indirekte Steuern] in London geschrieben. Ich mußte mir eine Einfuhrgenehmigung beschaffen, vier Briefe schreiben, Formulare ausfüllen, noch einmal drei Briefe. Ich habe den Leuten jetzt erklärt, wenn sie die verdammten Dinger nicht freigeben können, sollen sie sie konfiszieren und ins Meer werfen. Sobald man mit irgendwelchen Ämtern zu tun bekommt, kriegt man Scherereien. Ich könnte meinen Briefwechsel vermutlich an den Punch verkaufen.
Gestern nach Amesbury gefahren und dort den Tag mit dem bewußten Antrobus verbracht, dem es gehört und dem bis vor kurzem auch Stonehenge gehört hat. Er hat uns überall herumgeführt. Von der frühen Kirche nur noch Spuren erhalten.
Nach ihrer (der Familie) Überlieferung ist es so, daß Amesbury oder Almsbury als Name von einem Ambrosius Aurelius{*} abgeleitet ist und der Sitz jener Familie und daher Eigentum Arthurs war, weswegen Guinevere hierhergeschickt wurde. In der Kirche wird ein gemeißelter Kopf aufbewahrt, von dem sie annehmen, es handle sich um eine Darstellung dieses Aurelius Ambrosius, doch als ich näher hinsah, bemerkte ich darauf eine Lilienkrone. Es sind reizende Leute. Er ist dreiundachtzig und sieht aus wie sechzig. Ich fragte ihn wegen seines eigenartigen Namens – Antrobus. Die Familie stammt aus Cheshire, eine ziemlich alte Baronetcy. Er sagte, sie nähmen an, der Name sei vielleicht französischen Ursprungs und komme von »entre bais«. Er war erstaunt und interessiert, als ich die Vermutung äußerte, es könnte sich um das griechische Wort anthropos handeln.
Heute geht es nach Glastonbury, wo ich wieder beim Ausgraben zusehen will. Nächste Woche fahren wir in den Süden, um den ganzen Cornwall-Komplex abzuklappern. Wir werden vielleicht eine Woche oder zehn Tage fort sein. Alles, um Material für die Zukunft zu speichern. Ich bin unzufrieden damit, wie ich an die ganze Sache herangehe, ganz und gar unzufrieden. Vielleicht ergibt sich irgend etwas Neues. Ich weiß es nicht.
Ich werde Ihnen später über weitere Pläne schreiben. Wir haben vor, hier am 1. Oktober unsere Zelte abzubrechen und am 15. auf der Flandre nach Hause zu fahren, falls wir Plätze bekommen.
Ist es nicht eigenartig, daß Malory, der den Weg von Amesbury nach Glastonbury kannte, Stonehenge nicht erwähnte, obwohl er daran vorbeikommen mußte? Ich glaube, ich kenne den Grund. Werde ihn Ihnen aber erst verraten, wenn wir uns sehen.
AN ERO – SOMERSET, 10. SEPTEMBER 1959
Es war eine sehr gute Fahrt. Wir waren acht Tage unterwegs, und ich kenne jetzt die Küste von der Themse bis zum Bristol Channel sehr genau. Eines Tages werde ich mir die walisische Küste um St. David’s Head und weiter nach Norden vornehmen. Küsten sind mir anscheinend sehr wichtig. Ich kann nicht recht sagen, warum.
Was meine Arbeit betrifft – damit bin ich zutiefst unzufrieden. Es hört sich einfach wie ein Aufguß an, wie eine Wiederholung von Dingen, die ich früher geschrieben habe. Vielleicht ist die Flamme erloschen. Das ist ja bekanntlich schon vorgekommen, und ich weiß nicht, warum es nicht auch mir passieren sollte. Ich schreibe voll Begeisterung Dinge aufs Papier, und dann zeigt sich, daß es das gleiche alte Zeug ist, nichts Neues, Frisches, nichts, was nicht schon besser gesagt worden wäre. Vielleicht liegt meine Zukunft in gefälligen, geschickt gemachten Zeitungsartikeln mit einem Körnchen Originalität und ohne jeden Tiefgang.
Nun ja, darüber können wir sprechen, wenn ich zu Hause bin. Ich habe einen Haufen Material auf den Armen und weiß nicht, was ich damit anfangen soll, und ich bin zu alt, um mir etwas vorzumachen.
Sagen Sie bitte Chase, daß ich die Kulis schließlich doch noch bekam, nachdem ich den Leuten in einem letzten Brief geschrieben hatte, sie sollen sie ins Meer werfen oder sonst damit machen, was ihnen gefällt.
AN ERO – LONDON, 2. OKTOBER 1959
Jetzt zu meiner Arbeit. Ich habe nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht. Mir scheint, daß ich möglicherweise eine Lösung habe, aber ich möchte sie Ihnen lieber möglichst anhand einiger Beispiele erzählen. Im Augenblick begutachte ich meine Idee wie eine Kundin das Angebot in Klein’s Souterrain. Sie würde, wenn ich sie umsetzen könnte, die meisten Schwierigkeiten beheben. Ich werde jedenfalls weiter darüber nachgrübeln.
Wir gehen jetzt zur Themse. Ich schreibe bald wieder.
AN ERO – NEW YORK
(ohne Datumsangabe), 1959 (MITTWOCH)
Chase hat hoffentlich nicht den Eindruck, daß ich ihn abgehängt habe. Ich kann an nichts anderes denken, solange ich diese Arbeit nicht hinter mir habe. Ich habe auch bei Pat vorbeigeschaut und mit ihm lange Kaffee getrunken. Er drängt mich, halb melancholisch, halb scherzhaft, mir die Arbeit am Malory vorzunehmen, damit er es, wie er sagt, »zu seinen Lebzeiten noch zu sehen bekommt«. Aber im Grund, wissen Sie, ist es gar kein Scherz. Ich habe vor, bis nach Neujahr kein Wort daran zu schreiben. Noch zuviel zu lesen und in Ruhe zu überlegen. Und Chase hat eine solche Unmenge Material für mich zusammengetragen.
(Keine Briefe zum Thema Morte d’Arthur von Ende 1959 bis zur folgenden Datumsangabe.)
AN CHASE – SAG HARBOR, 15. MAI 1965
Ich bin ganz Ihrer Meinung, daß die Handschriften, Artefakte und Illuminationen, deren Liste Sie beigefügt haben, für unsere Arbeit insofern sehr interessant und wertvoll wären, als sie zeigen, wie weit das Arthur-Thema verbreitet war und daß es beinahe universell übernommen wurde, und das schon in sehr früher Zeit. Sie werden neben diesen noch viele weitere Zeugnisse in Italien finden, und ich hoffe, daß sie dranbleiben. Ich habe noch ein paar andere Dinge im Kopf, von denen ich glaube, sie könnten sehr nützlich sein, wenn es oder vielmehr sie sich im Verlauf Ihrer Reisen in Italien erledigen ließen.
Es wäre gut, wenn Sie Professor Sapori ausfindig machen und sich mit ihm unterhalten könnten. Er ist Florentiner, hatte aber einen Lehrstuhl für Geschichte an der Universität Pisa und hat ihn, glaube ich, noch inne. Wie Sie wissen, ist er die Autorität auf dem Gebiet der mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte, und da Florenz der Mittelpunkt des ökonomischen Systems von ganz Europa war, ist er am richtigen Platz.
Zu Saporis Spezialgebieten gehören die Beziehungen zu den arabischen Händlern in der Zeit der Gründung der Amalfi-Liga und danach. Soviel ich weiß, hat noch niemand die Frage aufgeworfen, ob der Arthus-Zyklus im islamischen Bereich Fuß gefaßt hat und/oder ob sich vielleicht eine Parallele entdecken ließe. Und ebensowenig darüber, ob sich die Sage auf einen indogermanischen Ursprung zurückführen läßt. Wir wissen, daß die Legende vom hl. Georg tatsächlich aus dem Orient kam. Eine der ersten Erwähnungen findet sich in Ägypten. Es wäre interessant festzustellen, ob es irgendeinen Namen in Hindi oder Sanskrit gibt, der eine gewisse Ähnlichkeit mit Arthur oder Artu oder sonst einer Variation dieses Lautes hat.
Wir wissen, daß Arthur in den Kreis der neun Berühmtheiten und manchmal in den der drei Unsterblichen aufgenommen wurde, doch wann es dazu kam, weiß ich jedenfalls nicht. Das Thema gelangte vermutlich mit den normannischen Herrschern nach Sizilien, kann dort aber auch mit dem gleichen Phänomen zusammengestoßen sein, das aus der arabischen Welt in den Westen gelangte.
Wenn es Ihnen irgend möglich ist, sollten Sie die Vatikanische Bibliothek aufsuchen. Eine Besuchserlaubnis kann man durch den United States Information Service bekommen. Es gibt noch sehr viele weitere Dinge, die zu untersuchen sind, und ich werde Ihnen darüber schreiben, sobald mir etwas einfällt.
Hoffentlich geht mit Ihren Plänen alles gut.
VON CHASE AN J. S. – NEW YORK, 18. JUNI 1965
Als wir im April über die Verbreitung des Arthur-Stoffes durch ganz Europa sprachen, kamen wir auf Italien als ein Land, in dem bereits im Jahr 1100 der Mann auf der Straße mit diesem Stoff allgemein vertraut war. Das Arthur-Thema wurde zur Unterhaltung dargeboten, gewiß, aber es war darüber hinaus noch viel mehr.
Im Mai sandte ich Ihnen eine kurze Liste von Handschriften und Skulpturen, die sich in Italien erhalten haben. Wir waren beide der Ansicht, daß es für die Planung Ihrer Arbeit über König Arthur von Nutzen wäre, wenn ich mir einiges davon ansehen und begutachten könnte. Diese Gespräche hatten eine soeben abgeschlossene Reise nach Italien zur Folge. Die Reise hat unsere Vorstellung bestätigt, daß sowohl bei den einfachen Leuten wie bei den Bewohnern der ritterlichen Burgen ein starkes Interesse am Arthur-Stoff bestand. Mehrere Jahrhunderte lang waren Erzählungen, Sagen und Rezitationen aus dem arthurianischen Zyklus die allerersten Unterhaltungsnummern.
In Rom ist die aus Elfenbein geschnitzte Spiegelkapsel von Interesse. Die beste Spiegelkapsel befindet sich im Kloster Cluny in Frankreich.
Im Bargello in Florenz ist ein sizilianischer Bettüberwurf mit vielen Arthur-Szenen zu sehen. Er stammt aus der Zeit um 1395 n. Chr.
In der Biblioteca Nazionale in Florenz befindet sich eine aus dem Jahr 1446 stammende Handschrift, die viele der Figuren und Szenen aus dem Arthur-Zyklus zeigt. Diese ausgezeichnete Bibliothek besitzt darüber hinaus noch weiteres Arthur-Material.
Die Kathedrale von Modena hat über einem Eingang eine Archivolte, auf der Arthur, Gawain und mehrere weitere arthurianische Figuren dargestellt sind; als Entstehungszeit dieser Türumrahmung geben manche Wissenschaftler das frühe Datum 1106 an. Ich habe in Italien erfahren, daß man von sämtlichen dieser Objekte Mikrofilmkopien bestellen kann. Ich habe Photographien von einigen dieser Gegenstände beigelegt und werde Ihnen noch weitere Aufnahmen und Notizen zeigen.
Wie Sie gesagt haben: »Das ist eine Suche, die niemals ein Ende findet.«
AN CHASE – SAG HARBOR, 22. JUNI 1965
Ich habe Ihren Brief von neulich zusammen mit Ihrem Bericht über die Funde an Arthur-Material erhalten, die Sie während Ihrer vor kurzem unternommenen Reise gemacht haben. Alles sehr interessant, und ich nehme an, Sie sind mittlerweile überzeugt, daß die Reise, wie ich meinte, notwendig war. Es trifft zwar zu, daß die meisten Stücke des Puzzles bekannt sind, aber es geht, wie ich wiederholt dargelegt habe, um ihre Stellung, darum, wie sie architektonisch plaziert sind. Zum Beispiel muß, was wichtig ist, Arthurs Position auf einer Türwölbung durch ihre relative Beziehung zu anderen Figuren auf demselben Türbogen bewertet werden. Wie Sie wissen, wurde König Arthur zu unterschiedlichen Zeiten einmal zu den »Neun«, dann zu den »Sieben« und den »Drei« gezählt. Mangels Literatur lassen sich die Beziehungen zwischen diesen Rangveränderungen nur dadurch klären, daß man die Gebäude, an denen diese Gruppen erscheinen, in Relation zueinander datiert.
Es würde mich freuen, wenn Sie sich weiter mit den sizilianischen Bettüberwürfen beschäftigen und die Figuren darauf nach dem Grad ihrer Bedeutung zueinander in Beziehung setzen könnten. Ich habe den starken Verdacht, daß diese Beziehungen – wie in der symbolischen Volkskunst zumeist – einen Schlüssel oder eine Aussage enthalten, die für uns nur deshalb geheimnisvoll sind, weil wir sie nicht verstehen.
Alles in allem, Chase, glaube ich, daß Ihre Nachforschungen in Italien, wenn auch nicht vollständig, die Tür zu einem neuen Bereich von Recherchen geöffnet haben, dem Sie sich hoffentlich weiter widmen wollen. Wie bei den meisten Themen gibt es noch weite interessante und wichtige Gebiete, die noch nicht mit dem neuen Auge inspiziert worden sind, mit dem wir sie betrachten können.
Ich habe die Hoffnung, daß Sie während Ihrer nächsten Reise Gelegenheit haben werden, in Rom in die Vatikanische Bibliothek hineinzukommen. Wie Sie wissen, hat im 15. Jahrhundert der englische Adel bei Kontroversen dieser oder jener Art beinahe jedesmal an den Papst appelliert. Ich habe selbst einiges Malory-Material im Vatikan gefunden und bin sicher, daß noch mehr davon vorhanden ist (Monks Kirby etc.). Um Ihnen künftige Arbeit dieser Art zu erleichtern, habe ich vor, an den Monsignore zu schreiben, der die Oberaufsicht über die Dokumentensammlung des Vatikans führt, damit er eine Besuchserlaubnis für Sie erwirkt und Ihnen bei der Durchsicht der Bestände behilflich ist. Ich habe die vatikanischen Behörden immer sehr hilfsbereit gefunden, bis auf das Heilige Offizium, das aber ohnehin nicht zu unseren Weidegründen gehört.
Und damit ich es nicht vergesse – meine Gratulation zu Ihren neuen Funden. Es war nicht nur Glück, wie Sie bescheiden beteuern. Es war auch das geschulte Auge, das wußte, wonach es Ausschau zu halten und wie es den Fund, war er gemacht, zu betrachten hatte.
Ich sehe jetzt Licht am Ende des Tunnels dieser langen, langen Arbeit. Hoffentlich können wir uns bald zusammensetzen und die Aufräumoperation besprechen.
Jetzt spannen Sie erst einmal ein bißchen aus und schöpfen neue Kraft für künftige Anstrengungen. Für den Wißbegierigen gibt es kein Rasten.
AN ERO – NEW YORK, 8. JULI 1965
Ich mühe mich mit der Arthur-Geschichte weiter voran. Ich glaube, ich bin auf eine Idee gekommen, doch zu meinem eigenen Schutz werde ich sie niemandem verraten. Wenn ich dann ein Stück weit damit gearbeitet habe und es kommt mir mißlungen vor, kann ich es einfach vernichten. Doch im Augenblick kommt mir der Einfall nicht schlecht vor. Merkwürdig und anders schon, schlecht aber nicht.