6
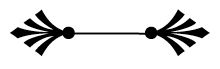
Sonntag, 26. August 1838
Im Haus war es still und friedlich. Alle waren in der Messe, und John arbeitete in der Bibliothek. Seine Reise nach Richmond ließ sich nicht länger aufschieben, doch er hatte nicht das Herz, seiner Frau das zu sagen. Ihr war zwar morgens noch immer übel, aber sein Gefühl sagte ihm, dass sie die Reise eher wegen ihres Vaters nicht antreten wollte. Auf jeden Fall musste er in Kürze aufbrechen, wenn er vor der Geburt des Kindes wieder zurück sein wollte.
Als sich die Tür öffnete, schaute er auf und war überrascht, Paul zu sehen. Seit ihrem Streit im Stall war sein Bruder nur ein einziges Mal auf Charmantes gewesen, und zwar bei Georges Hochzeit. Er hat die Nase voll von Agatha und bringt sie zurück, dachte John belustigt.
Mit ernstem Gesicht ließ sich Paul ihm gegenüber auf einem Sessel nieder.
»Was führt dich ausgerechnet am Sonntagmorgen nach Charmantes?« Er fürchtete, dass er Pauls Problem nicht ohne Frederic lösen konnte.
»John …«
Irgendetwas stimmte nicht. Paul war leichenblass und sein Blick unstet und voll Sorge.
»Was ist geschehen? Du siehst aus, als ob du einem Geist begegnet wärst.«
»Agatha …«, begann Paul. »Ich bin wegen Agatha hier. Sie ist … mein Gott … sie ist verrückt geworden.«
»Merkst du das erst jetzt?«, witzelte John.
»Das ist kein Scherz, John. Seit Vater sie aus dem Haus gewiesen hat, hat sie sich in ihrem Schmerz gesuhlt. Aber seit vergangener Nacht befindet sie sich in einer Art Delirium. Sie hält mich für Vater und sagt nichts Vernünftiges mehr, obwohl sie ständig redet. Sie behauptet Dinge …«
John runzelte die Brauen. »Was genau?«
»Sie sagt immer, dass sie unseren Vater lange vor deiner Mutter geliebt hat, und sie beschimpft Elizabeth, dass sie ihr den Mann gestohlen hätte.«
John seufzte. »Das kennen wir doch längst. Warum heult sie immer noch? Sie hat doch Vater zu ihrer Sichtweise bekehrt, und du hast deinen Teil bekommen. Was will sie denn noch?«
»Sie will Vater! Ich sage dir, sie ist wahnsinnig. Sie verwechselt deine Mutter mit Colette und behauptet Dinge … keine Ahnung, ob die stimmen, aber …«
»Was genau hat sie gesagt, Paul?«
Paul suchte Johns Blick. »Es ging um Colette.«
»Und?«
»Agatha hat behauptet, dass Robert und sie dafür gesorgt hätten, dass Colette … dass sie verschwand.«
Verblüfft lehnte sich John zurück. »Verschwand?«
»John.« Paul mochte es kaum aussprechen. »Im letzten Jahr, als Colette so krank war … Agatha hat sich persönlich um sie gekümmert … und dafür gesorgt, dass sie sich schlecht fühlte. Sie hat erreicht, dass Robert Blackford Colette behandelte. Zuerst ein Mal in der Woche, später zwei Mal und zuletzt jeden Tag. Zu Anfang wollte Colette seine Besuche verhindern und klagte, dass sie sich anschließend jedes Mal schlechter fühle. Als Robert daraufhin das Mittel änderte – jedenfalls behauptete er das –, ging es ihr vorübergehend besser. Nach Weihnachten war ich länger verreist und dachte, sie bei meiner Rückkehr gesund und wohlauf vorzufinden. Aber Charmaine sagte mir, dass es ständig bergab gegangen sei. Blackford schob es auf eine schwache Lunge, aber inzwischen … inzwischen bin ich ratlos. Nach Colettes Tod konnte Agatha Vaters Frau werden. Aber …« Er konnte die Worte kaum über die Lippen bringen. »Aber Pierre stand als dein Nacherbe in Vaters Testament. Als Agatha das hörte, war sie außer sich und womöglich wütend …«
Wie Licht in ein dunkles Zimmer fällt, so war John der Zusammenhang mit einem Mal klar, und schon fügte sich eines zum anderen: Agathas ständige Bemühungen, ihn von seinem Vater zu entfremden, ihre triumphierende Miene, als er selbst seinen Namen aus Frederics Testament strich, Blackfords überstürzte Abreise, der tobende Phantom, der aus dem Stall ausbricht, Pierre, der unbemerkt zum See schleicht … Ich bin Auntie gefolgt … sie gab ihm einen Beutel … ich glaube mit Schmuck …
John sprang auf und rannte zur Tür, aber Paul packte ihn am Arm. »Wohin willst du?«
»In die Kirche!«
Der lateinische Singsang hallte von den Wänden der Kapelle wider, und die morgendliche Kühle schwand zusehends, als mit den Sonnenstrahlen auch die Hitze ins Kirchenschiff drang. Father Benito kehrte der kleinen Gemeinde den Rücken zu und beeilte sich ein wenig mit der Zeremonie. Er hob die Hostie zum Kruzifix empor. »Hoc est enim corpus meum …«
In diesem Moment knallte die Tür geräuschvoll gegen die Wand. Der Priester verharrte in andächtiger Stille und reckte das Brot zum Himmel, aber innerlich verfluchte er die rüde Unterbrechung der heiligen Zeremonie. Schritte hallten durch den Mittelgang, doch Benito widerstand der Versuchung, sich umzudrehen. Er legte die Hostie auf den Teller zurück, aber als er den Kelch heben wollte, wurde ihm gewaltsam der Arm auf den Rücken gedreht, sodass der Kelch umstürzte, über den Altar rollte und roter Wein das weiße Leinen verunzierte. Brutal wurde Benito herumgerissen, bis er einem blindwütigen John Auge in Auge gegenüberstand. »Was wissen Sie? Heraus mit der Sprache!«
Charmaine schrie auf, als Johns Fäuste Benitos Gewänder packten und ihn dicht zu sich heranzogen. Aus dem Augenwinkel sah Benito, wie Paul die Kapelle betrat. »Was wissen Sie?«, brüllte John wieder.
»Ich weiß nicht, was Sie meinen«, stotterte Benito.
»Das wissen Sie verdammt genau! Heraus damit, bevor ich Ihnen hier und jetzt das Lebenslicht ausblase!«
Charmaine wollte aufspringen, aber Frederic hielt sie fest und starrte unverwandt auf die Szene, die sich vor dem Altar abspielte. »Was machst du da, John?«, rief sie besorgt. »Was ist los?«
Aber John hatte nur Augen für den Priester und legte ihm die Hände um den Hals. »Sie wurden von meiner Tante bezahlt! Wofür?«
»Das waren Spenden für die Bedürftigen«, krächzte Father Benito.
»Wollen Sie sterben?« John verstärkte seinen Griff, sodass Benito die Augen aus dem Kopf quollen.
»John, lass ihn los!«, schrie Charmaine entsetzt. Dann bemerkte sie Paul. Warum ist er hier? Was geht hier vor?
»Sie haben die Wahl! Sagen Sie mir die Wahrheit, dann verschone ich Sie. Verstanden?«
Endlose Minuten geschah gar nichts, nur Benitos Gesicht färbte sich immer stärker. Hilflos sah Charmaine von Frederic zu Paul, aber beide starrten wie gebannt auf die Szene. Inzwischen war die kleine Gemeinde aufgesprungen und stand wie erstarrt da. Totenstille lag über dem Raum. Als Charmaine schon glaubte, dass der Priester ohnmächtig umsinken würde, vernahm sie plötzlich seine raue Stimme. »Ihre Tante und Ihr Onkel haben Colette vergiftet …«
Der Mann verdrehte die Augen, und seine Lider flatterten. »Weiter, Benito!«, zischte John und lockerte seinen Griff ein wenig, damit der Mann Luft holen konnte. »Reden Sie, Sie Bastard!«
»Blackford … er hat den Jungen entführt … und im See ertränkt.«
Entsetzen malte sich auf Benitos Zügen, als John ihn wie besinnungslos würgte und in die Höhe hob, sodass er den Boden unter den Füßen verlor.
Charmaine schrie aus vollem Hals, aber Paul stürzte sich bereits auf seinen Bruder, und George schützte den Altar. John stieß den Priester so heftig von sich, dass der Mann taumelte und rückwärts zu Boden fiel. »Ich sollte Sie umbringen, Sie gieriger Scharlatan!«
Paul ging dazwischen und gestattete, dass Benito sich aufrappelte. »George, nimm Bud mit und bringt den Mann ins Gefängnis.«
»Nein!«, widersprach Frederic. »Bringt ihn erst einmal in den Stall und wartet dort auf mich.«
George schob den Priester hinaus, und die Stallknechte, die der Messe beigewohnt hatten, schlossen sich ihnen an. Jeannette klammerte sich an Charmaine, barg ihr Gesicht an ihrem Busen und schluchzte haltlos. Yvette dagegen stand aufrecht wie ein Soldat und starrte fassungslos und ungläubig vor sich hin.
»John! O John!« Als Frederic sie endlich losließ, wollte Charmaine zu ihm laufen, aber John hörte sie gar nicht und eilte zur Kirchentür.
»Wohin gehst du denn?«, rief sie ihm nach.
Doch sie bekam keine Antwort und sah nur hilflos zu Paul.
Der rannte ihm nach. »Wo willst du denn hin, John?«
»Zu Westphal. Komm mit.«
Wie betäubt zog sich die übrige Familie in den Wohnraum zurück. Frederic sank auf einen Sessel und zog Jeannette auf seinen Schoß. Sie barg ihr Gesicht an seiner Hemdbrust und wimmerte mitleiderregend. Blicklos starrte er vor sich hin, strich seiner Tochter übers Haar und tätschelte ihr den Rücken, bis die Tränen langsam versiegten.
Charmaine musste die Augen schließen, so sehr schmerzte ihr Herz. Ihr war, als ob Colette und Pierre ein zweites Mal gestorben seien. Vergiftet! Wieso hatte sie das nicht erkannt? Kein Wunder, dass Colette sich so elend gefühlt hatte! Die Anzeichen waren alle da. Und Pierre! Sein Tod war kein Unglück gewesen! Sie stöhnte. Ich habe ihn nicht gut genug beschützt! Guter Gott, ich habe ihn nicht beschützt! Warum tötete man einen so unschuldigen bildhübschen Jungen? Durch Colettes Tod konnte Agatha viel gewinnen, aber Pierre … warum?
»Warum nur, Papa?« Yvettes Stimme zitterte. »Warum haben sie Mama und Pierre getötet?«
»Weil sie schlecht und böse sind«, antwortete Frederic mit harter Stimme. Er hob Jeannettes Gesicht an und wischte ihr mit sanfter Hand die Tränen von den Wangen. »Besser?«, fragte er leise.
Die Kleine seufzte. »Ich glaube schon.«
»Gut. Ich muss jetzt mit Father Benito sprechen. Ist es in Ordnung, wenn ich dich bei Charmaine und Nana Rose lasse?« Als das Mädchen nickte, küsste er sie auf die Stirn. Dann stand er auf und setzte Jeannette auf seinen Sessel. Er tätschelte Yvettes Kopf. »Sie werden ihre gerechte Strafe bekommen, mein Kind. Das verspreche ich dir.«
Betrübt lächelte Yvette zu ihrem Vater auf. »Gib auf dich acht, Papa.«
»Ganz sicher, Yvette.«
Er schaute zu Rose und Mercedes hinüber, sah, wie sie traurig den Kopf schüttelten, und ging dann zu Charmaine, die an der Tür stand. »Es dauert nicht lange.« Mit diesen Worten drückte er ihre Schulter und war fort.
Je größer der Reichtum, desto tiefer der Schmerz …
John und Paul galoppierten auf direktem Weg in die Stadt. Westphals Haus lag genau gegenüber der Bank. Sie sprangen vom Pferd und klopften energisch an die Tür. Trotzdem dauerte es eine halbe Ewigkeit, bis geöffnet wurde.
»Was ist los?«, fragte Stephen erstaunt, als John und Paul zusammen vor seiner Tür standen.
»Holen Sie Ihre Schlüssel und öffnen Sie die Bank«, forderte John.
»Die Bank öffnen? Aber heute ist Sonntag! Außerdem esse ich gerade.«
»Öffnen Sie die Bank!«
Stephen sah Paul an.
»Tun Sie, was er sagt, Stephen.«
Sie warteten auf der Schwelle, während Westphal seine Schlüssel holte. Dann gingen sie zur Bank hinüber.
In der Eile hatte Stephen Mühe mit dem Schloss. »Was ist denn so dringend?«
»Ich möchte Blackfords Konto sehen«, antwortete John.
Stephen war wütend. »Das kann ich unmöglich machen! Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre.«
»Blackford ist ein Mörder«, entgegnete John. »Er hat die Insel im April auf Nimmerwiedersehen verlassen. Vermutlich hat er sein gesamtes Geld mitgenommen. Ich will wissen, wie viel es war und auf welche Bank es transferiert wurde.«
»Das ist nicht Ihr Ernst!«, widersprach Westphal.
John sah ihn einige Augenblicke lang nur an. »Was ich gesagt habe, entspricht der Wahrheit. Benito St. Giovanni hat gestanden. Langsam verliere ich die Geduld. Zeigen Sie mir jetzt die Dokumente, oder muss ich sie mir selbst holen?«
Hilflos sah Stephen zu Paul hinüber. »Es stimmt, Stephen. Wir müssen herausfinden, wohin Blackford verschwunden ist.«
Kopfschüttelnd betrat Westphal sein Büro. Ein paar Augenblicke später hatte er die fraglichen Papiere gefunden und reichte sie John, der sich sofort an den Schreibtisch setzte und die Dokumente studierte.
Nach ein paar Minuten sah er zu Paul auf. »Agatha hat ihren Bruder reichlich für seine Dienste entlohnt. Seit April ’36 hat er mehrere große Einzahlungen getätigt. Ich würde sagen, dass damals die Vergiftung begann. Aber die größte Summe gab es eine Woche nach Pierres Tod. Damals hat sie ihm Thomas Wards gesamten Besitz überschrieben.«
John rieb sich die Stirn und wandte sich dann an Westphal. »Hier: Ihre Unterschrift belegt, dass Blackford sein gesamtes Geld als Verrechnungsscheck, ausgestellt auf die Bank of Richmond, erhalten hat. Ich bezweifle allerdings, dass er in Virginia bleibt. Hat er Ihnen das eigentliche Ziel seiner Reise verraten?«
Westphal zuckte die Schultern. »Nein. Er hat lediglich angedeutet, dass er sich zur Ruhe setzen will. Aber vielleicht hilft Ihnen ja dies hier weiter.«
John war überrascht, als Westphal ihm einen Brief von Benito Giovanni in die Hand drückte. »Benito hat mir diesen Brief zu treuen Händen übergeben«, erklärte Stephen. »Falls ihm etwas zustößt, sollte ich Ihrem Vater diesen Brief aushändigen.«
John musste nicht mehr lesen, was der Kirchenmann als Versicherung gegen ein vorzeitiges Ableben niedergeschrieben hatte.
George und Gerald bewachten Benito, der mit auf dem Rücken gefesselten Händen und gesenktem Kopf auf einem Futtertrog hockte. »Lasst uns allein«, sagte Frederic, als er den Stall betrat.
»Wir warten draußen«, antwortete Gerald.
Frederic wartete, bis sich das Tor geschlossen hatte. Dann nahm er eine Peitsche vom Haken und trat vor den Priester hin. Benito hob den Kopf und zuckte zusammen.
»Nun, guter Mann, ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen.« Frederic schlug die Peitsche auf seine Handfläche. »Und Sie werden mir jede einzelne beantworten, oder Sie hängen noch vor Sonnenuntergang. Haben Sie mich verstanden?«
Der Priester nickte kaum merklich.
»Gut. Woher haben Sie Ihre Informationen?«
»Agatha hat ihre Sünden gebeichtet, und als Sühne hat sie mir Geld für die Armen gegeben.«
Frederic runzelte die Stirn. »Noch eine Lüge, Benito, und ich knüpfe die Schlinge höchstpersönlich!«
Der Priester schluckte. Er war am Ende seines Lateins. »Als Sie mich nach Colettes Tod zu sich gerufen haben, wusste ich, dass man Lügen über sie verbreitet hat.«
»Lügen?«
»Vor vielen Jahren hat mir Colette ihre Affäre mit John gebeichtet, aber auf dem Totenbett hat sie keine weiteren ehebrecherischen Beziehungen eingestanden. Sie war Ihnen also nicht untreu gewesen.« Er senkte den Kopf und wartete.
»Und doch ließen Sie mich das Gegenteil glauben!«
»Ich habe nie behauptet, dass Ihre Frau Ehebruch begangen hat«, widersprach Benito. »Wenn Sie sich erinnern, habe ich mich nur geweigert, ihr Beichtgeheimnis zu enthüllen.«
Die Peitsche sauste durch die Luft und verfehlte ihr Ziel nur um Haaresbreite. »Lügner!«, zischte Frederic zornig. »Sie ließen mich im Glauben, dass es ein Geheimnis gäbe! Und dann haben Sie genau dieses Geheimnis benutzt, um Geld von Agatha und Robert Blackford zu fordern! Na los … heraus mit der Wahrheit!«
»Ganz im Gegenteil«, flüsterte der Priester und sah zu Boden. »Bis zu Agathas Hochzeit habe ich niemals Geld gefordert.« Als die Peitsche erneut durch die Luft zischte, hob er mutig den Kopf. »Erst als Agatha Sie zum Altar geschleppt hat, habe ich ihre Motive durchschaut. Bis dahin dachte ich, dass sie und ihr Bruder nur gelogen hätten, um Sie vor dem Hungertod zu bewahren!«
»Ach ja? Und haben Sie diese Lüge meinem Wohl zuliebe ebenfalls unterstützt?«
»So gesehen … ja. Wenn Sie das zur Vernunft brächte …«
»Schluss damit!«, schnarrte Frederic. »Wenn Sie am Leben bleiben wollen, dann lassen Sie die Scheinheiligkeit! Und nun heraus mit der Sprache: Wann haben Sie herausgefunden, dass Colette vergiftet wurde? Und nichts als die Wahrheit, wenn ich bitten darf!«
»Das habe ich lediglich vermutet«, räumte Benito ein. »Es kam mir sonderbar vor, dass Agatha trotz lauter Proteste immer gewissenhaft bezahlt hat. Ich merkte schnell, dass sie etwas Wichtiges zu verbergen hatte. So gesehen war ich nicht unvorbereitet, als sie eines Tages erklärte, dass dies ihr letzter Besuch sei. Sie wüssten inzwischen, dass Colette Ihnen nicht untreu war. Damals setzte ich alles auf eine Karte und behauptete, dass Colette vergiftet worden sei. Agatha warf mir vor, keine Beweise zu besitzen, aber abgestritten hat sie die Sache nicht. Als ich obendrein andeutete, dass Pierres Tod ein höchst seltsamer Zufall sei, wurde sie aschfahl. Erst da habe ich begriffen, wie skrupellos und herzlos die beiden sind.«
»Sie sind um keinen Deut besser!« Diese vorgebliche Offenheit widerte Frederic an. »Wenn Sie mit Ihrem Wissen zu mir gekommen wären, könnte Pierre heute noch leben.«
»Das konnte ich nicht, denn ich war meiner Sache doch nicht sicher! Erst nachdem es passiert ist … nach dem Tod des Jungen!«
»Aber Sie hatten einen Verdacht! Und Sie haben auf Kosten zweier unschuldiger Seelen den Luxus genossen, den Ihnen mein Geld verschafft hat!«
Betreten sah Benito Frederic an. Das brachte ihn erst recht in Wut. »Suchen Sie bloß nicht nach Entschuldigungen!« Schnalzend traf die Peitsche das Gesicht des Mannes und riss ihm Wange und Nasenrücken auf.
Der Priester schrie vor Schmerz. »Es tut mir leid!«
»Wie viel hat Agatha Ihnen für Ihr Schweigen bezahlt?«
Als Benito schwieg, traf die Peitsche Hals und Schulter. »War es das wert?«
Wieder schrie der Priester auf. »Gnade! Lassen Sie Gnade walten!«
»Meine Söhne haben bisher Ihr Leben geschont, Sie mieser Bastard! Was für ein Priester sind Sie überhaupt? Oder haben Sie uns die ganzen Jahre etwas vorgemacht?«
»Nein. Ich bin wirklich Priester. Das schwöre ich!«
»Umso schlimmer für Sie, Sie Teufel!«
Frederic hob drohend die Peitsche, und Benito St. Giovanni kauerte sich auf dem Futtertrog zusammen. »Bitte, nicht schlagen!«
»Wo ist Blackford?«
»Ich weiß es nicht … er hat die Insel verlassen.«
»Aber warum? Warum hat er Charmantes verlassen? Hatte er Angst vor Ihnen? Konnte er vielleicht nicht zahlen? Haben Sie ihn so weit gebracht?«
»Nein … ich meine, ich weiß es nicht! Agatha hat immer für beide bezahlt. Ich habe keine Ahnung, warum er weggegangen ist. Er hat es einfach getan!«
»Sie wissen mehr als das!«, rief Frederic. »Und das sagen Sie mir lieber! Was genau hat Blackford mit der Sache zu tun? Seine Schwester hatte einiges zu gewinnen, aber wo lag sein Vorteil?«
»Laut Agatha hat Blackford Sie verachtet, weil Sie ihn zu Unrecht beschuldigt haben.«
»Ich hab ihn beschuldigt?«
»Sie haben ihn für den Tod Ihrer ersten Frau verantwortlich gemacht.«
»Also war es Rache? Das kann nicht sein. Nein, unmöglich. Warum hat er sich dann an dem Jungen vergriffen? Warum?«
Benito zitterte. »Ich … ich weiß es nicht. Er hat sonst nichts gesagt. Ich weiß nur, dass er auch Geld von Agatha bekommen hat.«
»Ja, ja, Agatha steckt hinter allem. Aber welche Macht hatte sie über ihren Bruder, dass er sogar mordete? Auf der Insel ging es ihm doch bestens. Warum hat er das alles für seine Schwester aufs Spiel gesetzt?«
»Ich habe keine Ahnung, und das ist die Wahrheit.«
»Waren Sie denn gar nicht neugierig? Das kann ich nicht glauben.«
»Glauben Sie, was Sie wollen. Ich weiß es wirklich nicht!«
Frederic spielte mit der Peitsche, woraufhin Benito noch rasch »Vermutlich ging es ihm ums Geld!« hinzufügte.
Die lahme Entgegnung entlockte Frederic ein Stirnrunzeln. »Warum ist er dann geflohen?«
»Ich schwöre, ich weiß es nicht. Vielleicht hatte er nur Angst, dass alles auffliegen könnte. So, wie es jetzt passiert ist.«
»Angst vor dem Augenblick der Wahrheit, meinen Sie?« Frederic betrachtete die Peitsche und warf sie dann angewidert ins Stroh.
Benito hob den Kopf. Aus dem wulstigen Striemen auf seiner Stirn sickerte Blut und vereinigte sich mit den Tropfen, die aus seiner Nasenwurzel hervorquollen. »Was werden Sie jetzt mit mir machen?«, fragte er fast flehentlich.
»John hat Ihr Leben geschont. Ich bin der Meinung, dass er die Sache entscheiden soll.«
Er rief George und Gerald herein. »Bringt den Mann ins Gefängnis unter dem Versammlungsraum und sorgt dafür, dass er gut bewacht wird. John wird sich dann später um ihn kümmern.«
John wurde von Ekel, Hilflosigkeit, tiefer Verzweiflung und Schuldgefühlen gequält. Colette und Pierre wurden ermordet, und ich habe sie nicht beschützt. Blackfords heimliches Verschwinden machte alles noch schlimmer. Wie hatte sein Vater dem nur zusehen können? Paul war entschuldigt. Er hatte viel gearbeitet und war lange unterwegs gewesen. Aber sein Vater war immer hier … sozusagen nebenan, während dieser ungeheuerliche Plan in die Tat umgesetzt wurde. Sein Hass gegenüber seinem Onkel stand seiner Verachtung für Frederic in nichts nach.
Auf dem Ritt nach Charmantes schwiegen sie lange, bis Paul sich schließlich ein Herz fasste. »Ich weiß, dass du Vater Vorwürfe machst, aber er war ebenso ahnungslos wie wir alle. Er hätte doch nie gedacht, dass Colette …«
»Wirklich nicht?« John ließ Paul nicht aussprechen und warf ihm verbittert einen Blick zu. »Wäre es auch passiert, wenn einer von uns beiden mit Colette verheiratet gewesen wäre?«
Paul holte geräuschvoll Luft. John liebte Colette … hatte sie wirklich innig geliebt.
»Sag, wäre es passiert?«
»Ich weiß es nicht, John.«
»Du weißt es nicht? Nun ja, du suchst Entschuldigungen … möchtest ihn schützen. Doch ich erinnere mich bis zum heutigen Tag an alles, was ich durch ihn erleiden musste. Ich war nur dumm, als ich mir in den letzten Monaten eingeredet habe, dass die Vergangenheit hinter uns liegt. Hier ist sie ja schon wieder … direkt vor meiner Nase.«
»Aber Vater hat sich so sehr bemüht, die Dinge ins Lot zu bringen, John.«
»So? Und wie? Indem er mir jetzt einen Knochen hinwirft? Im letzten Sommer hätte er mir helfen können! Nein, Paul, Vater war auf meine Liebe zu Pierre eifersüchtig und wollte sie zerstören. Er hat alles so eingefädelt, dass ich Pierre hätte entführen können, aber das hätte bedeutet, ihn von seinen Schwestern und Charmaine zu trennen, und hätte mir auf lange Sicht seinen Hass eingetragen. Wenn ich ebenso grausam gehandelt hätte wie er, hätte ihn das entlastet. Das allein war seine Absicht gewesen und sonst nichts.«
»Du irrst dich, John. Es gibt sicher vieles, was Vater nicht mehr ändern kann, aber auf keinen Fall will er dich weiter verletzen. Am Morgen vor deiner Abreise hat er dir das Sorgerecht für Pierre und die Zwillinge übertragen. Ich habe die unterschriebenen Papiere selbst gesehen … und zwar lange bevor Blackford sich an Pierre vergriffen hat.«
John war sichtlich überrascht, doch bevor er reagieren konnte, sprach Paul bereits weiter. »Während der qualvollen Tage vor Pierres Tod hat Vater sich zurückgezogen, und zwar aus Respekt vor dir und deinem großen Kummer und nicht aus Gleichgültigkeit! Ich bin von Pierres Bett weg oft zu ihm gegangen. Er hat damals weder gegessen noch geschlafen und genauso viel gelitten wie du … und sich mit Schuldgefühlen gequält. Er hat den Jungen geliebt und macht sich auch heute noch große Vorwürfe.« Er wandte sich ab, weil er seinen Schmerz kaum verbergen konnte.
Die Minuten dehnten sich. Außer dem Hufschlag war nichts zu hören. Paul hing seinen Gedanken nach. Ob er sie am besten einfach aussprach? »Vater hat Colette auch geliebt, John. Das glaubst du vielleicht nicht, aber so war es. Vielleicht willst du auch nicht hören, dass Colette ihn ebenso geliebt hat. Ich habe es von ihr selbst gehört. Sie leiden zu sehen, das war für Vater das Schlimmste, und als sie starb, war er am Boden zerstört.«
In einem Anfall von Wut biss John die Zähne zusammen. Geht er mit allen so um, die er liebt? Doch sein Zorn schwand, als er die Verzweiflung in den Augen seines Bruders sah, und er begriff, dass Paul ihm die Tatsachen so berichtete, wie er sie erlebt hatte.
»Ich weiß nicht, was die beiden einander entfremdet hat, John. Aber heute weiß ich, dass meine Mutter sicher auch dabei ihre Hand im Spiel hatte.« Pauls eigene Bürde wog so schwer, dass er nichts weiter sagen konnte, und so schwiegen sie.
»Das ist nicht dein Ernst!«, rief Charmaine. »Du kannst mich doch so kurz vor der Geburt nicht allein lassen!«
Sie sah zu, wie John im Ankleidezimmer auf und ab lief und seine Sachen aus den Schränken nahm und in einem großen Koffer verstaute, der auf dem Boden lag. John sagte nichts und packte einfach nur weiter. Als seine Frau sein Schweigen nicht länger ertragen konnte, trat sie ihm in den Weg.
»Das ist doch der pure Wahnsinn!«, protestierte sie. »Und außerdem viel zu gefährlich!«
»Dieser Mann hat meinen Sohn ermordet, Charmaine!« John blieb stehen und sah ihr in die Augen. »Er kommt mir damit nicht davon!«
»Du wirst ihn niemals finden. Er ist schon so lange fort!«
»Ich werde ihn finden! Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich finde ihn.«
»Aber es kann Jahre dauern, ihn aufzuspüren. Warum überlässt du das denn nicht der Polizei? Die ist doch dafür ausgerüstet!«
»So, wie sie deinen Vater festgenommen haben?«, fragte er spöttisch. »Was würdest du denn tun, wenn du deinen Vater finden und zur Verantwortung ziehen könntest?«
Die Frage ließ Charmaine für einen Moment verstummen. »Und was ist mit unserem Leben? Kannst du wirklich so einfach weggehen?«
Er ließ die Schlösser zuschnappen. »Nichts zu tun, das ist kein Leben.«
Sie wandte sich ab, weil ihr die Tränen in die Augen traten. »Ich werde sehr allein sein und ständig um deine Sicherheit bangen.«
»Aber du bist nicht allein. Die Zwillinge sind bei dir, und George, Rose und Mercedes auch. Ich werde dir immer Nachricht schicken.« Er trat hinter sie und umfasste ihre Schultern, aber sie entzog sich ihm.
»Du liebst sie mehr als mich«, brach es aus ihr heraus. »Immer noch liebst du sie mehr!«
»Sag so etwas nicht, Charmaine …«
»Wenn du mich mehr lieben würdest, würdest du nicht weggehen!«, schrie sie.
»Das ist doch kein Wettbewerb zwischen dir und einer Toten.«
»Dann bleib bei mir«, flüsterte sie.
Er drehte Charmaine zu sich um, doch sie setzte eine abweisende Miene auf. John beugte sich vor und küsste sie auf die Wange. Dann trat er einen Schritt zurück und sah sie einen Augenblick an, bevor er nach seiner Kappe griff, sie aufsetzte und den Raum verließ.
Charmaine warf sich aufs Bett und vergrub den Kopf in den Kissen. Sie kämpfte mit den Tränen und schwor, dass sie wegen ihm nicht weinen wollte. Einige Minuten lang hielt sie durch, aber dann machten die Gedanken sie wahnsinnig. Er begibt sich in große Gefahr. Wird er gesund zurückkommen? Vielleicht sehe ich ihn nie wieder!
Sie sprang auf und rannte aus dem Zimmer, die Treppe hinunter, weiter durchs Foyer und quer über die Wiese bis hinüber zum Stall. Im Halbdunkel stieß sie geradewegs mit Gerald zusammen.
»Was ist los, Ma’am?«
»Master John … ist er noch da?«
»Er hat uns bereits verlassen, Ma’am … gut fünf Minuten ist das her.«
Travis hatte gerade Frederics Koffer mit einem zufriedenen »Ihr Koffer ist gepackt, Sir« geschlossen, als die Tür aufflog und Charmaine atemlos und tränenüberströmt im Rahmen stand.
»Er lässt uns tatsächlich allein!«, schluchzte sie und sah mit flehentlichem Blick zu Frederic und dann zu Paul. »Bitte, haltet ihn auf!«
»Das Schiff setzt in einer halben Stunde Segel«, kommandierte John, als er an Bord der Raven ging.
Ein Blick auf sein Gesicht – und Kapitän Wilkinson wusste, dass es nichts zu diskutieren gab. »Darf ich wissen, warum?«, fragte er aus Sorge, wann seine Ladung jemals englischen Boden erreichen würde.
»Das erkläre ich Ihnen später.«
Jonah Wilkinson erteilte seine Befehle, und prompt murrten einige Matrosen. Sofortige Rückkehr in die Staaten, das hieß, dass es keinen freien Tag auf Charmantes geben würde wie geplant. Doch der Befehl des Kapitäns duldete keinen Widerstand, und so setzten die Männer gehorsam Segel.
Nachdem der letzte Teil der Ladung eilig an Bord gebracht worden war, gab Wilkinson Befehl zum Ablegen. Die Leinen wurden eingeholt, der Anker hochgezogen, und dann löste sich das Schiff vom Kai.
Ein lauter Schrei ließ alle innehalten. Jonah Wilkinson runzelte die Stirn, doch dann erkannte er Paul, der angerannt kam und mit beiden Armen in der Luft herumfuchtelte. Auch die übrigen Anwesenden auf dem Kai schrien und winkten. John eilte an Wilkinsons Seite.
»Am besten werfen wir die Leinen noch einmal aus«, schlug der Kapitän vor.
»Was gibt es?«, brüllte John, in der Hoffnung, dass Paul ihm noch etwas Wichtiges im Zusammenhang mit den grauenhaften Enthüllungen mitzuteilen hätte.
»Bring die Raven zurück!«, rief Paul.
Während Jonah von einem zum anderen blickte, sah er, wie Frederic über den Kai humpelte. »Komm zurück!«, befahl er. »Die Raven soll noch einmal anlegen!«
John hatte seinen Vater ebenfalls gesehen und fluchte. »Wir segeln weiter!«, forderte er.
»Aber John …«
»Haben Sie mich nicht verstanden? Weiter, sage ich!«
Wilkinson sah zu Frederic hinüber, der ihm das Anlegen befahl, und dann wieder zu John. »Werft die Leinen aus!«, kommandierte er.
»Verdammt!« Fluchend schlug John gegen die Reling, während die Männer die Leinen festzurrten, die Gangway auf den Pier schoben und sein Vater an Bord kam.
»Was hast du hier verloren?«, fauchte John ihn an.
»Charmaine schickt mich. Sie will nicht, dass du fährst. Sie hat Angst um dich.«
»Ich muss das erledigen. Ich habe es ihr erklärt.«
»Aber sie ist deine Frau. Du solltest sie nicht allein lassen. Nicht ausgerechnet jetzt.«
»Sag mir nicht, was ich tun soll und was nicht!«, brüllte John. »Und jetzt verlasse bitte das Schiff. Ich habe zu tun.«
»Tu es nicht, John. Daraus erwächst nichts Gutes.«
»Glaubst du denn, ich könnte mit dem Gedanken leben, dass der Mörder meines Kindes und deiner Frau frei herumläuft? Was bist du nur für ein Mann, Vater? Wie kannst du ihn davonkommen lassen? Hat Colette dir denn gar nichts bedeutet? Und was ist mit Pierre? Ein unschuldiges Kind, das nur das Pech hatte, in diese verkommene Familie hineingeboren zu sein?«
»Du hast mit jedem deiner Worte recht«, sagte Frederic. John war so verblüfft, dass er für einen Moment sogar seinen Zorn vergaß. »Aus diesem Grund bitte ich dich, auf Charmantes zu bleiben und mich die Sache auf meine Art erledigen zu lassen.«
»Wie bitte?«
»Du hast mich genau verstanden. Du hast ein neues Leben begonnen, und Charmaine ist schwanger. Sie braucht dich jetzt an ihrer Seite. Mich dagegen hält hier nichts. Ich sorge dafür, dass Blackford festgenommen wird. Das verspreche ich dir.«
»Nein, Vater, ich muss das selbst tun. Eines Tages wird auch Charmaine verstehen, dass dies der einzige Weg ist, um mit der Vergangenheit abzuschließen.«
Nachdenklich sah Frederic seinen Sohn an. Dann nickte er. »Nun gut, dann machen wir es eben auf deine Weise.«
»Wir?«
»Ich fahre mit dir.«
»Das kommt nicht infrage.«
»Dann haben wir ein Problem. Das Schiff segelt nicht ohne mich.« Er befahl, seine Koffer unter Deck zu bringen.
Verärgert wandte John sich ab. Wie gewöhnlich behielt sein Vater die Oberhand. Egal. Nach ihrer Ankunft in Richmond würde er ihn schon abschütteln und sich allein auf die Suche machen.
»Setzen Sie Segel, Jonah.« Dann wandte sich Frederic an Paul, der unten auf dem Kai stand. »Sag Charmaine, dass ich ihn gesund nach Hause zurückbringe.«
Während Paul nickte, legte die Raven ein zweites Mal ab.
Yvette und Jeannette wechselten bedeutungsvolle Blicke, als Charmaine mit verschränkten Armen und tränennassem Gesicht auf der Veranda auf und ab lief.
»Johnny kommt schon gesund zurück, Mademoiselle«, sagte Jeannette zuversichtlich, um Charmaine zu trösten.
»Aber nur, wenn er die verrückte Idee aufgibt!«, stieß sie hervor.
»Er muss Dr. Blackford unbedingt finden«, erklärte Yvette hitzig. »Ich hoffe, dass John ihn umbringt, so wie Blackford Mama und Pierre umgebracht hat!«
Charmaine verschlug es den Atem. »Was, wenn Dr. Blackford ihn zuerst umbringt …?«
Das hatten die Mädchen nicht bedacht. Zuvor hatte Yvette sogar Charmaines Liebe zu Pierre und ihrer Mutter in Zweifel gezogen. »Warum wäre sie sonst so wütend auf John?« Doch nun schämte sie sich und war sehr besorgt.
Jeannette dagegen strahlte vor Zuversicht. »Keine Sorge, Mademoiselle, Papa passt bestimmt auf John auf.«
Sie erkannten Alabaster schon von Weitem. Paul galoppierte direkt auf das Haus zu und sprang kurz vor der Veranda vom Pferd. Auf Charmaines fragenden Blick hin schüttelte er noch auf den Stufen den Kopf. »Sie sind fort … beide.«
Sie drehte ihm den Rücken zu, damit er ihr Gesicht nicht sah. Sie schwankte zwischen Wut und tiefer Sorge.
Paul wollte sie beruhigen. »Alles wird gut, Charmaine. Vater hat versprochen, ihn gesund nach Hause zu bringen.« Als sie trotzig schwieg, fuhr er fort: »Für John ist diese Sache äußerst wichtig. Bestimmt …«
»Nein, Paul«, sagte sie, ohne sich umzudrehen, »Sie hatten recht. John wird mich nie so lieben, wie er Colette geliebt hat. Deshalb ist er fort … und ich hasse ihn dafür!«
Paul bemerkte, dass die Zwillinge einander fragende Blicke zuwarfen. »Dies ist weder die Zeit noch der Ort, um darüber zu sprechen, Charmaine«, erklärte er energisch. »Sobald John wieder da ist, werden Sie anders darüber denken.«
Sie fing an zu weinen. »Er kommt nie mehr zurück! Das fühle ich. Ich fühle es einfach!«
Wortlos legte Paul die Arme um Charmaine und drehte sie zu sich herum. Dann hielt er sie einfach nur fest, bis sie sich wieder beruhigt hatte. »Solch trübe Gedanken sind in Ihrem Zustand gar nicht gut. Kommt, Mädchen, wir wollen Charmaine ein wenig aufheitern.« Mit diesen Worten führte er sie ins Haus.
Montag, 27. August 1838
Der Ozean war so glatt und blau, dass Frederic ihn nicht vom Himmel unterscheiden konnte. Es war die Farbe von Colettes Augen. Wie hatte er nur zulassen können, dass seiner wunderschönen Frau so etwas angetan wurde? Und dem süßen unschuldigen Pierre? Mit schmerzvollem Herzen und lähmendem Schuldbewusstsein sah er zu John hinüber. Genau wie gestern stand er auch heute reglos am Bug und starrte nach vorn, als ob er das Schiff durch seine Blicke vorantreiben könnte. Frederic holte tief Luft und ging dann zu seinem Sohn an die Reling hinüber. Viele Minuten lang standen sie stumm nebeneinander.
»Woran denkst du?«, fragte Frederic schließlich.
John biss die Zähne zusammen. Er wollte mit diesem Mann nicht reden. Der kameradschaftliche Umgang der letzten Monate war nur eine Farce gewesen, die ihnen die Augen für den gegenseitigen Hass verschlossen hatte. Aber deswegen war der Hass nicht fort, sondern eher stärker geworden.
»John?«
John löste seinen Blick vom Horizont und sah seinen Vater mit verzerrtem Grinsen an. »Woran ich denke? Willst du das wirklich wissen? Ich denke zum Beispiel an meine feine Tante und meinen sogenannten Onkel, und ich denke daran, dass sie Colette fast ein ganzes Jahr lang vergiftet haben. Ich denke an Colettes Mann, der sie dem Sohn gestohlen und dann so sehr geliebt hat, dass sie in eine Affäre flüchtete, und der sie dann ein Leben lang für diese Untreue bestraft hat … und nicht einen einzigen Augenblick lang misstrauisch wurde.« Voller Abscheu schüttelte er den Kopf. »Selbst deine eigene Tochter hat gespürt, dass etwas Schreckliches vor sich ging.«
Frederics überraschte Miene vergrößerte nur Johns Abscheu. »Ja, so war es! Yvette hat mir erzählt, dass ihre Mutter sich nach den Besuchen ihres fürsorglichen Arztes jedes Mal schlechter gefühlt hat. Sie hat Auntie und Blackford sogar verfolgt und ausgeforscht! Aber ihr Vater … mein Vater … nein, der war nie misstrauisch, hat nie etwas vermutet! Oder hast du etwas vermutet? War das vielleicht deine Strafe? Hast du Colette einfach dem Henker überantwortet?«
Er schrie so laut, dass sogar die Matrosen aufmerksam wurden und so taten, als ob sie nicht zuhörten.
»Denkst du wirklich, dass es so war?«, fragte Frederic bekümmert.
»Ich denke es nicht … ich weiß es!«
»Um Himmels willen, John, ich hatte doch keine Ahnung …«
»Halt einfach den Mund, Vater! Deine Untaten hören nie auf! Ich klage Agatha und Blackford an, das stimmt, aber dich noch weit mehr!«
Frederics Schmerz wurde so unerträglich, dass er förmlich explodierte. Als John sich abwenden wollte, packte er ihn am Kragen und stieß ihn an die Reling zurück. John schnappte nach Luft, aber er wehrte sich nicht. »Eines will ich endgültig klarstellen: Colette war meine Frau! Du kannst mir vorwerfen, dass ich nicht genau hingesehen habe, aber du warst ebenfalls blind! Wo waren denn deine Augen, als Pierre entführt wurde? Da hattest du nur Augen für dein verdammtes Pferd!«
John ballte die Fäuste. »Dafür sollte ich dich umbringen!«
Frederic trat einen Schritt nach vorn, bis sein Gesicht nur eine Handbreit von dem seines Sohnes entfernt war. »Ich habe dein grenzenloses Selbstmitleid, deinen bösartigen Spott und deine Wutanfälle endgültig satt!«
Ein teuflisches Lachen war die Antwort. »Wutanfälle? Spott? Selbstmitleid? Dieses Buch hast du selbst geschrieben, Vater. Nur deshalb hat Colette dich nicht verlassen.«
»Das würdest du gern glauben, nicht wahr? Wenn Colette dich wirklich geliebt hätte, hätte sie keinen Blick mehr an mich verschwendet, als du sie mitnehmen wolltest.«
»Verdammt sollst du sein! Fahr zur Hölle!«
John holte aus, doch Frederic packte seine Handgelenke und verhinderte den Schlag. John hielt dagegen, und so stolperten sie quer über das Deck und krachten mit solcher Gewalt gegen die Ankerwinde, dass die Zahnräder knirschten.
»Genug!«, schrie Jonah Wilkinson und drängte sich zwischen die Kontrahenten. Seine Matrosen verstanden das als Signal und zerrten die Streithähne auseinander. »Sind Sie völlig verrückt geworden? Sparen Sie sich Ihre Energie lieber für die Suche nach dem Mörder!« Er blieb zwischen den beiden stehen, damit sie einander nicht sofort wieder an die Gurgel gingen. »Was ist denn in Sie gefahren?«, beschimpfte er Frederic. »John ist doch Ihr Sohn! Und Sie …« Mit zerfurchtem Gesicht sah er John an. »Ich bitte mir etwas mehr Respekt aus! Dieser Mann ist schließlich Ihr Vater.«
»Meinen Respekt bekommt er nie wieder!« Vater und Sohn starrten einander nur wortlos an, und dabei blieb es bis zum Abend.
John kochte vor Wut. Die Worte seines Vaters kehrten sein Innerstes nach außen. Wenn Colette dich wirklich geliebt hätte, hätte sie keinen Blick mehr an mich verschwendet … Er packte einen Stuhl und donnerte ihn so heftig gegen die Wand, dass die Einzelteile durch die Gegend flogen. Nachdem die erste Wut verraucht war, überdachte er die Vorwürfe: Spott, Wutanfälle, Selbstmitleid … Er sank auf sein Bett und barg den Kopf in den Händen. Verdammt soll er sein! Er darf nicht das letzte Wort haben!
Als er seine Kabine verließ, war der Himmel zwar dunkel, aber die Decks badeten im Mondlicht. Er konnte nicht schlafen und hoffte auf eine kühle Brise, um sein erhitztes Gemüt abzukühlen. Ein Teil der Mannschaft hockte auf dem Achterdeck und loste aus, wer als Nächster unter dem Sternenhimmel Wache schieben musste. Ihre leise Unterhaltung und das gleichförmige Rauschen des Ozeans verbreiteten eine friedvolle Stimmung, wie er sie seit Tagen nicht mehr erlebt hatte. Er lehnte sich an die Reling und starrte auf die Wellenkämme hinunter, die im Mondlicht immer wieder glitzernd in sich zusammenfielen.
Überrascht sah John auf, als sich Kapitän Wilkinson zu ihm gesellte. Aus Respekt vor dem Mann versuchte er ein Lächeln.
Es dauerte ganze zehn Minuten, bis Jonah schließlich das Wort ergriff. »Warum hassen Sie ihn?«
»Das wissen Sie sehr gut, Jonah.« John drehte sich um und lehnte sich gegen die Reling. »Manche Dinge ändern sich nie.«
»Aber Sie haben inzwischen eine Frau, und ein Kind ist unterwegs. Womöglich ein Sohn. Wäre es da nicht an der Zeit, die Vergangenheit zu begraben?«
»Wenn das nur so einfach wäre!« John verschränkte die Arme. »Sie kennen die Geschichte von Beginn an und haben auch gehört, was in den letzten beiden Tagen geschehen ist. Die alte Wunde wurde wieder geöffnet. Niemand hat sie versorgt, und jetzt eitert sie und wartet auf den Tod.«
»Dazu haben Sie beide alles Denkbare getan«, bemerkte Jonah. »Können Sie denn nicht einsehen, dass Ihr Vater diese Frau geliebt, ja, tief und innig geliebt hat und Colette seine Gefühle erwiderte?«
John hob den Kopf. »Warum will mir das nur jeder einreden? Sie hat ihn nicht geliebt! Niemals!«
»Ich habe genau das Gegenteil beobachtet«, widersprach ihm der Kapitän. »Als ich nach der Hochzeit nach Charmantes kam, habe ich die beiden häufig in der Stadt und auch im Herrenhaus zusammen gesehen. Frederic hat mich manches Mal zum Dinner eingeladen. Colette war hinreißend, und es gab nicht den geringsten Zweifel, dass sie in ihn verliebt war. Ihr Vater hat sie angebetet, als ob sie eine Prinzessin sei … Wie ein junger Mann!«
Johns Miene konnte Jonah nicht täuschen. Er kannte den jungen Mann, seit er alt genug war, um über die Gangway an Bord der Raven zu klettern, und es war ihm sehr wichtig, dass er endlich der Wahrheit ins Gesicht sah. Seine Vorurteile nagten an ihm und würden ihn früher oder später auffressen, wenn er sie nicht aufgab. »Ich weiß, dass Sie Colette geliebt haben, John. Und vielleicht hat sie Sie auch geliebt. Aber dieselben Gefühle empfand sie auch für Ihren Vater.«
»Wenn sie ihn wirklich geliebt hat, wie Sie sagen, warum hat sie sich dann mir zugewandt?«
»Das weiß ich nicht. Aber warum stellen Sie diese Frage nicht Ihrem Vater? Hören Sie ihm zu und beherzigen Sie vor allem seine Antwort. Ihr Vater ist ein guter Mann, John, und es wäre jammerschade, wenn Sie die Welt verlassen müssten, ohne das je erfahren zu haben.«
Dienstag, 28. August 1838
Paul fluchte leise, als er die letzte Schublade herauszog und auf den Boden des kleinen Häuschens warf. George trat gegen einen Stuhl und rieb seine Hände sauber. »Das war’s. Offenbar hat er wirklich alles gespendet, wie er behauptet hat.«
Paul schüttelte den Kopf und rieb seinen Nacken. »Das bezweifle ich. Yvette hat gesehen, dass Agatha ihm Schmuck übergeben hat. Den konnte er nicht so leicht zu Geld machen. Jedenfalls nicht hier auf Charmantes.«
George seufzte. »Aber es ist nichts da!«
»Ich traue dem Mann nicht über den Weg, George. Ich will ihn aus dem Gefängnis an einen geheimen Ort bringen lassen, wo er ganz allein ist und nicht die geringste Möglichkeit zur Flucht hat.«
»Was wird dein Vater mit ihm machen?«
»Keine Ahnung. Ich will, dass Benito lebt und es ihm gut geht, wenn Vater und John zurückkommen.«
Er ging zum Fenster und starrte in den Wald hinaus. »Ich kann nicht nach Espoir zurück«, murmelte er. »Sonst erwürge ich sie.«
George legte dem Freund die Hand auf die Schulter. »Du kannst nichts dafür, Paul. Nichts von alledem ist deine Schuld.«
Mit Tränen in den Augen nickte Paul. »Ich weiß das, aber ich bin so empört … Ich fühle mich so …«
»Wir sind alle empört und fühlen uns schrecklich hilflos«, sagte George. »Aber gib uns ein wenig Zeit. Wir werden uns schon wieder erholen. Auch du. Und was Agatha angeht, so ist sie bei Jane Faraday unter guter Aufsicht. Wenn es dir recht ist, fahre ich auch gern ab und zu nach Espoir hinüber.«
Paul wandte sich zu ihm um. »Du bist ein wirklich guter Freund, George. Ich bin froh, dass ich dich hier habe.«
John sah schon von Weitem, dass Frederic an der Reling lehnte und auf den Ozean blickte. Er hielt die Luft an und machte sich auf eine neue Auseinandersetzung gefasst. Er traute Jonah Wilkinsons Worten nicht. Immerhin hatte sein Vater Colette vergewaltigt. Wie konnte sie einen solchen Mann geliebt haben?
»Na gut, Vater, Colette hat mich also nicht geliebt?«
Frederic wandte sich um und verschränkte die Arme. »Ich hätte das nicht sagen sollen.«
Die Antwort gefiel John nicht. »Soll das heißen, dass du unrecht hattest?«
»Nein, aber ich hätte es trotzdem nicht sagen dürfen.«
»Warum ist sie aus deinem Bett zu mir gekommen, wenn sie mich nicht geliebt hat?« Als Frederic schwieg, fuhr er fort: »Im Unterschied zu dir musste ich sie nicht zwingen. Sie kam ganz freiwillig.«
John weidete sich daran, dass Frederic den Kopf sinken ließ. »Nun, Vater«, begann er mit schiefem Grinsen, »warst du etwa müde, sie ständig zu zwingen, oder …«
»Du bist für die Wahrheit noch nicht reif«, schnitt ihm sein Vater das Wort ab.
»Versuche es doch.«
Abschätzend sah Frederic seinen Sohn an. »Colette ist zu dir gekommen, weil ich sie fünf lange Jahre nicht geliebt habe. Sie war einsam …«
John prustete los, aber die ernste Miene seines Vaters ließ ihn innehalten. »Aber ich habe Colette geliebt!«, stieß er hervor.
»In diesem Punkt unterscheiden wir uns, mein Sohn, denn ich liebe sie noch immer.«
»Wie rührend!«
»Aber wahr.« Frederic wandte sich wieder dem Ozean zu. »Ich wurde auch verletzt.«
»Aber du hast uns doch alle gestraft – nicht ich!«
»Das ist richtig, aber aus anderen Gründen, als du meinst.«
»Warum also?«
Frederic atmete tief durch. »Von dem Moment an, als ich Colette zum ersten Mal sah, war ich von ihrer Ähnlichkeit mit deiner Mutter fasziniert. Es war jedoch weniger ihr Aussehen, als die Art, wie sie ging und sich bewegte, ihr Selbstbewusstsein, ihr Lächeln und das übermütige Funkeln ihrer Augen. Auch kleine Dinge wie eine Handbewegung oder ein kaum wahrnehmbares Lispeln. Anfangs irritierten mich diese Ähnlichkeiten, doch je mehr ich sie ignorieren wollte, desto mehr zogen sie mich an.«
»Weil Colette dich an meine Mutter erinnert hat, hattest du das Recht, ihr Gewalt anzutun?«
»Aber nein«, antwortete Frederic leise.
»Warum hast du es dann getan? Warum hast du sie mir gestohlen? Hasst du mich so sehr?«
»Ich hasse dich überhaupt nicht, John!«
»Ach nein?« Angesichts der Ungeheuerlichkeiten, unter denen er ein Leben lang gelitten hatte, schrie John die Frage förmlich heraus. »Warst du so wütend, weil ich dir Elizabeth genommen habe, dass du mir dafür Colette rauben musstest? Ich habe sie geliebt. Hast du das denn nicht gesehen?«
Frederic stand wie betäubt da, als er das Ausmaß dieser Qual begriff. Guter Gott, glaubt John das wirklich?
»Wie konntest du mir das antun?«, fragte John.
»Ich habe es doch nicht dir getan, John«, wandte Frederic ein. »Auch wenn du mir nicht glaubst, aber ich bedauere es ehrlich.« Einen Moment lang hielt er inne und wagte nicht, mehr zu sagen. John starrte ihn ungläubig an, und ihm wurde immer elender zumute. Es ging jetzt um alles oder nichts. »Ich habe Colette falsch eingeschätzt«, begann Frederic zögernd. Seine Brust schmerzte. »Ich war überzeugt, dass sie dich nur zum Narren hält … mich zum Narren hält. Ich habe einige Gespräche mit ihrer Freundin mitbekommen und in den Augen ihrer Mutter die Angst vor der Armut gelesen. Ich nahm also an, dass Colette dich nicht liebte und nur nach einem reichen Ehemann suchte. In dieser Nacht wollte ich ihr nur ein wenig auf den Zahn fühlen, ihr klarmachen, dass sie mit dem Feuer spielt. Aber das Feuer ist außer Kontrolle geraten. Als ich sie küsste, schmolzen die Jahre dahin, und mir war, als ob ich deine Mutter im Arm hielte. Das ist keine Entschuldigung, ich weiß, aber die Sehnsucht war einfach stärker als ich.«
Frederic musste tief Luft holen, so sehr schmerzte sein Herz. »Sie hat sich nicht gewehrt. Später habe ich überlegt, dass sie womöglich keinen Mut dazu hatte. Doch als es geschah, war ich sicher, dass ich mich nicht getäuscht und sie schon andere Liebhaber vor mir hatte. Ich konnte nicht mehr aufhören … und ich wollte es auch gar nicht. Auf jeden Fall habe ich sie nicht verletzt, John.« Er schluckte. »Als es vorbei war, erkannte ich meinen Fehler. Colette war rein und unberührt … und ich schämte mich. Aber gleichzeitig war ich über meinen Irrtum glücklich. Den nächsten Tag über konnte ich nicht aufhören, an sie zu denken, und noch in der Nacht ging ich zu ihr und machte ihr einen Antrag. Ich versprach, ihre Familie zu unterstützen. Ja, ich wollte die Dinge in Ordnung bringen, aber mehr als alles andere wollte ich, dass sie meine Frau wird. Ich redete mir ein, dass das Schicksal es so bestimmt hätte. Sie gehörte zu mir und nicht zu dir. Du warst noch jung, viel zu jung, um schon zu heiraten. Und du warst auch nicht in sie verliebt, bestenfalls hatte sie dir den Kopf verdreht. Du würdest eine andere Frau finden. Ich ignorierte deine Gefühle.« Er schloss die Augen. »Ich habe ihr das alles gesagt und ihr außerdem zu bedenken gegeben, dass sie vielleicht schon ein Kind erwartete. Mein Kind. Als sie einsah, dass sie als entehrte Braut nicht wieder zu dir zurückkehren konnte, hat sie meinen Antrag angenommen.«
Frederic sah John an und fragte sich, wie er seine Worte aufgenommen hatte. Diese Geschichte zu erzählen war sicher ebenso schwer, wie sie anzuhören. »Ich hatte nichts geplant, John. Es ist einfach passiert.«
»Ich will nichts mehr davon hören!«, zischte John.
Frederic ergriff seinen Arm, bevor er sich abwenden konnte. »Beantworte mir nur eine Frage, John: Wenn ich willens bin, deine Gefühle für Colette anzuerkennen und deine Affäre mit ihr zu vergessen, warum kannst du dann nicht akzeptieren, dass ich sie ebenfalls geliebt habe?«
John riss sich los. »Ich brauche deine Vergebung nicht! Ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe mir nur genommen, was mir zuerst gehört hat.«
Frederic wiegte den Kopf, weil John das unmöglich glauben konnte. »Ich hätte sie freigeben sollen«, murmelte er. »Fünf Jahre lang habe ich mir einzureden versucht, dass ich sie nicht liebte. Es wäre leichter gewesen, sie gehen zu lassen.«
»Und warum hast du es nicht getan?«
»Weil ich sie geliebt habe«, sagte Frederic schlicht. »Ich hätte nicht ertragen, wenn sie aus meinem Leben verschwunden wäre. Sie bei mir zu haben, selbst wenn sie mich nicht liebte, war besser, als sie nie mehr zu sehen.«
»Du gibst also zu, dass sie dich nicht geliebt hat?«
»Das dachte ich«, korrigierte Frederic. »Im ersten Jahr unserer Ehe waren wir glücklich … Ich war glücklich wie seit Jahren nicht mehr und schöpfte neuen Lebensmut. Ich dachte, sie sei ebenfalls glücklich. Sie hat es zwar nie gesagt, aber ich spürte in meinem Herzen, dass ihre Liebe gewachsen war.
Dann wurde sie schwanger, und wir waren überglücklich. Bis zu der Nacht, als die Zwillinge zur Welt kamen. Es war eine schlimme Nacht, und die Wehen waren lang und schmerzhaft. Ich blieb die ganze Zeit über an Colettes Seite und hatte immer nur Angst, sie zu verlieren … wie damals in der Nacht, als du geboren wurdest. Irgendwann entfaltete das Laudanum seine Wirkung, und sie war nicht mehr ganz bei Sinnen. Sie rief wieder und wieder deinen Namen und ließ keinen Zweifel daran, wem ihre Liebe in Wahrheit gehörte.«
Er ließ den Kopf sinken. Die Erinnerung war einfach zu schmerzhaft. Und John dachte an den Streit in derselben Nacht, der Colettes Wehen ausgelöst und womöglich ihren Verstand getrübt hatte.
»Ich habe zu Gott gefleht, sie mir zu lassen, John. Ich schwor, sie nie wieder anzurühren, wenn sie nur am Leben bliebe. Als sie sich erholte, hielt ich mich von ihr fern. Zu Anfang konnte ich meinen Schwur halten, doch je mehr Zeit verging, desto inständiger hoffte ich, dass sie sich mir zuwenden würde. Als es nicht dazu kam, schloss ich, dass sie mich nie geliebt hatte.
Ich stürzte mich in die Arbeit. Zuerst auf Charmantes und dann auf Espoir. Als du nach Charmantes zurückkamst, wurde die Lage noch schwieriger. Ich mache dir keine Vorwürfe, John, und Colette auch nicht. Die mache ich mir nur selbst. Aber damals wollte ich allen anderen die Schuld geben, nur mir nicht.
Nach dem Schlaganfall flehte ich zu Gott, dass er mich zu sich zu nehmen solle, damit ihr miteinander glücklich werden könntet. Aber Gott hat mich nicht erhört.
Die Jahre vergingen, und dann war Colette plötzlich schwer krank. Ich hatte Angst, sie zu verlieren, und ich verfluchte mich wegen der Pein, die ich ihr zugefügt hatte, und wegen der Zeit, die ich vergeudet hatte. Ich öffnete ihr mein Herz, sagte ihr, dass ich sie immer geliebt hätte, und bat sie um Vergebung. Und sie sagte, dass sie mir schon vor Jahren vergeben habe, dass sie mich liebte … aber angenommen habe, dass ich ihr den Fehltritt nie verziehen hätte und sie deshalb nicht mehr begehrte. Guter Gott, wie konnte sie nur denken, dass ich sie nicht mehr wollte?«
Seine Augen schimmerten feucht, und seine Stimme klang heiser. »In dieser Nacht starb sie in meinen Armen, John. Als ich morgens aufwachte, war sie tot. Sie starb in meinen Armen …«
Frederic rannen die Tränen über die Wangen, und John wandte sich mit brennenden Augen ab und ließ ihn stehen.
Mittwoch, 29. August 1838
Keine vier Tage später legte die Raven in Richmond an. John schulterte seinen Koffer und ging rasch von Bord, doch als er den Kopf wandte, sah er, wie sein Vater mühsam humpelnd mit ihm Schritt zu halten versuchte. Es war nicht geplant … es ist einfach passiert … so fängt es immer an … mit einem Ausrutscher, einem unschuldigen Ausrutscher …
»Mist!«
John rief einen Wagen. Dann drehte er sich zu seinem Vater um, nahm ihm den Koffer ab und half ihm beim Einsteigen.
»Viel Glück!«, rief ihnen Jonah Wilkinson nach.
»Bleiben Sie im Hafen, bis ich mich morgen bei Ihnen melde!«, rief John zur Raven hinüber. »Es könnte sein, dass wir dringend ein Schiff brauchen.«
Für einen Mittwoch herrschte in der Bank reger Betrieb, doch John und Frederic ließen sich direkt zu Thomas Ashmore führen, der die Bank leitete und mit John bekannt war. »Ich brauche Informationen über einen gewissen Robert Blackford«, sagte John, nachdem er seinen Vater vorgestellt und die beiden Männer einander begrüßt hatten.
Der Manager wurde vorsichtig. »Um welche Informationen geht es genau?«
»Robert Blackford hat Les Charmantes vor vier Monaten verlassen und sein nicht unbeträchtliches Vermögen auf diese Bank transferiert. Wir müssen den Mann finden. Deshalb möchte ich wissen, wann er den Schuldschein bei Ihnen eingelöst hat, ob er noch ein Konto bei dieser Bank unterhält oder ob das Geld zu einer anderen Bank transferiert wurde.«
»Nun, John«, entgegnete Ashmore, »das sind sehr private Informationen. Können Sie mir einen guten Grund nennen, warum ich Ihnen die herausgeben soll?«
»Der Mann ist ein Mörder, Ashmore.«
»Nun, John, warum wenden Sie sich dann nicht an die Behörden?«
»Weil ich ihn selbst finden will, A…«, murmelte John zwischen zusammengebissenen Zähnen und überhörte Frederics Kichern.
»Nun, John …«
»Ist ›nun, John‹ alles, was Sie dazu zu sagen haben?«, fiel ihm Frederic ins Wort.
Ashmore sah Frederic von der Seite her an. »Nun, Sir …«
»Offenbar ja«, stellte Frederic fest. »Im vergangenen Jahr war dieses Institut als eines von wenigen nicht von der Bankenpanik betroffen. Richtig, Mr Ashmore?«
Der Mann nickte, aber seine Augen wurden groß wie Untertassen.
»Ich möchte behaupten, dass ich dank meines Vermögens einen Großteil dazu beigetragen habe. Wenn Sie also eine neue Panik vermeiden möchten, so besorgen Sie die Auskünfte, die mein Sohn verlangt. Falls Sie in zehn Minuten nicht zurück sind, werde ich meine sämtlichen Konten schließen und mir das Geld in bar auszahlen lassen. Haben Sie mich verstanden?«
»Ja, Sir.« Ashmore schluckte und eilte davon.
Sehr gut!, dachte John.
Joshua Harrington war zufällig Zeuge dieses Disputs geworden und erkannte zu seiner Überraschung John Duvoisin, als dieser sich in den nächstbesten Sessel fallen ließ.
»Mr Duvoisin?«
John sah auf und überlegte angestrengt, welcher Name zu diesem Gesicht gehörte.
»Mr John Duvoisin?«
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte John, während Frederic die beiden Männer interessiert beobachtete.
»Ich bin Joshua Harrington. Wir sind uns vor Jahren einmal begegnet. Ich habe überlegt, ob Ihre Frau Sie wohl nach Richmond begleitet …?«
»Charmaine?« John war sichtlich verwirrt. Wer ist dieser Mann? Irgendwie kam ihm der Name bekannt vor.
»Ja, genau. Charmaine hat längere Zeit bei meiner Frau und mir gelebt, bevor sie Gouvernante auf Les Charmantes wurde.«
John rieb sich die Stirn. Aber natürlich!
»Wir machen uns große Sorgen um sie«, fuhr Joshua fort. »Ihr letzter Brief … nun, wir würden sie sehr gern treffen und mit eigenen Augen sehen, dass sie … bei guter Gesundheit ist.«
Die stumme Botschaft, dass Charmaine durch eine Ehe mit ihm in Gefahr sein könne, ärgerte John. »Ich habe dringende Geschäfte zu erledigen und wollte Charmaine die Reise in ihrem Zustand nicht zumuten.«
Joshuas erhobene Brauen verrieten, dass seine schlimmsten Befürchtungen offenbar berechtigt waren.
»Es geht ihr gut«, fügte John rasch hinzu, »aber sie ist trotzdem lieber zu Hause geblieben.«
Als Thomas Ashmore zurückkehrte, verabschiedete sich John mit einem Nicken.
Kurze Zeit später verließen John und Frederic mit den gewünschten Informationen die Bank. Blackford hatte sein Geld am fünfzehnten April eingezahlt und konnte sofort über das Konto verfügen, da das Vermögen der Familie und das Siegel von Les Charmantes die nötige Sicherheit garantierten. Ein Viertel des Geldes ließ er sich in bar auszahlen, und der größere Teil wurde mit Hilfe eines neuen Wechsels auf eine New Yorker Bank transferiert.
Auf schnellstem Weg kehrten Frederic und John in den Hafen zurück, um die Schiffsunterlagen für den Monat Mai einzusehen und festzustellen, wann genau Robert Blackford nach New York City gereist war.
Im Wagen herrschte Stille. John starrte aus dem Fenster, und Frederic beobachtete ihn. »Liebst du Charmaine?«, fragte er unvermittelt.
Mit gerunzelten Brauen sah John seinen Vater an. »Was meinst du damit?«
»Es ist doch eine ganz einfache Frage.«
»Ja, ich liebe Charmaine.«
Frederic wandte sich ab und sah aus dem Fenster.
»Ist das alles, Vater? Mehr willst du nicht wissen? Ich kenne dich besser. Also, was ist der wirkliche Grund deiner Frage?«
»Mr Harrington hast du diesen Eindruck jedenfalls nicht vermittelt. Der Mann war sichtlich besorgt, aber du hast ihm dieses Gefühl nicht genommen. Als er ging, schien er mir sogar noch beunruhigter als zuvor.«
»Er wird es überleben«, entgegnete John trocken.
»Sicher, aber was ist mit Charmaine? Glaubst du, dass sie es auch überlebt?« Er ließ John einen Moment lang überlegen. »Du hättest ihr sagen können, dass du es für Pierre tust. Das hätte ich verstanden. Aber auf dem Schiff ist es dir in deiner Wut nur um Colette gegangen.«
»Meine Wut, Vater, richtet sich nur gegen dich und sonst gegen niemanden. Willst du wirklich wissen, wie sehr ich dich hasse, weil du mir die kostbaren drei Jahre gestohlen hast, die ich mit meinem Sohn hätte verbringen können? Wenn du Agatha besser durchschaut hättest, könnte Pierre heute noch leben, nicht wahr?«
»So ist es«, räumte Frederic mit leiser Stimme ein. »Aber Charmaine sieht nur ein Gesicht vor sich, wenn du davonläufst, und dieses Gesicht gehört nicht Pierre. Du solltest nach Hause fahren und mir die Suche nach Blackford überlassen.«
»Kommt nicht infrage! Ich lasse mir die Genugtuung nicht nehmen, ihm ins Gesicht zu sehen, wenn ich ihm gegenübertrete! Er wird sich wünschen, bereits gestorben zu sein und in der Hölle zu schmoren!«
»Wir sind aus ähnlichem Holz geschnitzt, mein Sohn, aber möchtest du Charmaine deswegen vielleicht verlieren?«
»Charmaine hat vorher auf mich gewartet, Vater, und sie wird das wieder tun.«
»Bist du sicher? Wie du weißt, liebt dein Bruder sie auch. Das habe ich seinen Augen angesehen.«
John murrte unwillig, aber Frederic nahm keine Rücksicht darauf. »Deinen Augen … denselben Augen, mit denen du Colette nach unserer Hochzeit angesehen hast.«
»Damals waren meine Augen voller Hass.«
»Und voll abgrundtiefem Schmerz und Sehnsucht«, vollendete Frederic. »Seltsam, dass man etwas am meisten begehrt, wenn es unerreichbar geworden ist.«
»Charmaine liebt Paul nicht, sonst hätte sie sich lange vor meiner Rückkehr für ihn entschieden.«
»Ich bete, dass du recht hast. Aber du hast ihr das Herz gebrochen. In ihrem Kummer könnte sie sich in die nächstbesten Arme flüchten, die ihr Trost bieten.«
John war zwar ein wenig verunsichert, doch als der Hafen in Sicht kam, gab es Wichtigeres zu tun. Er nahm sich vor, noch am Abend einen Brief an Charmaine zu schreiben und ihr zu sagen, dass er sie trotz des abrupten Abschieds unverändert liebte.
Gedankenverloren schlug Charmaine eine disharmonische Tonfolge nach der anderen auf dem Piano an. Mercedes und George waren mit den Mädchen in die Stadt gefahren, da Charmaine seit Tagen trüber Stimmung war. Nicht einmal die Nachricht, dass die beiden Nachwuchs erwarteten, hatte sie aufheitern können. In der Stille wanderten ihre Gedanken über den Ozean bis nach Richmond. Mit jedem Tag schwand die Hoffnung, dass John noch anderen Sinnes wurde und zurückkam. Es war dumm gewesen, ihn zu lieben … äußerst dumm sogar! Sie war so in Gedanken versunken, dass sie überhaupt nicht mitbekam, als Paul den Raum betrat.
Einige Augenblicke lang sah er sie an. Sie war in einer traurigen Verfassung, und keiner konnte sie zur Vernunft bringen. Seine Prophezeiung an ihrem Hochzeitstag hatte sich bewahrheitet. Wie leicht es doch wäre, ihre trübe Stimmung auszunutzen und ihre Zweifel zu bestätigen.
Er ging zum Piano und legte ihr die Hand auf die Schulter. »Es ist ungewöhnlich still im Haus«, sagte er, als sie den Kopf hob. »Wir müssen reden.« Er zog sich einen Stuhl heran und ergriff ihre Hände. »Ich weiß, dass Sie auf John wütend sind, aber so kann das trotzdem nicht weitergehen. Bis zu seiner Rückkehr könnten Wochen vergehen, und so lange wollen Sie doch wohl nicht trauern, oder?«
»Sie haben recht, Paul! Warum soll ich hier herumsitzen und mich nach ihm sehnen, wenn er nicht den kleinsten Gedanken an mich verschwendet?«
»So ist es richtig. Ich habe versprochen, immer für Sie da zu sein. Wenn Sie also genug haben … Meine Arme sind weit geöffnet.«
Entsetzt sprang Charmaine auf. »Wenn Sie glauben, dass ich ihn so schnell vergesse, empfinde ich das als Beleidigung! Ich bin vielleicht wütend auf ihn, aber …«
Paul grinste. »Und ich dachte, Sie hassen ihn!«
»Das tue ich auch.« Entwaffnet sank sie wieder auf die Klavierbank. »Ich hasse ihn wirklich … und wenn er zurückkommt, wird er genau das hören! Aber …«
»… Sie lieben ihn auch«, ergänzte Paul. »Sie lieben ihn so sehr, dass sie ihn sogar hassen, weil er Blackford jagt. Aber daran ist nichts Falsches.«
»Und wenn er nicht zurückkommt, Paul? Ich mache mir solch große Sorgen.«
»Aber, aber Charmaine. So gewitzt wie John ist keiner. Er weiß, was er tut. Wenn er Blackford nicht finden kann, dann kann es niemand. Außerdem ist Vater bei ihm und passt auf ihn auf. Ich bin sicher, dass den beiden nichts passiert.« Paul wurde nachdenklich. »Ist es vielleicht Schicksal, dass sie plötzlich aufeinander angewiesen sind? Vielleicht kommen sie ja mit sich und mit der Vergangenheit versöhnt zurück.«
Sie wünschte, dass sich seine Worte bewahrheiteten. Offenbar hatte er sich ebenfalls Gedanken gemacht und wollte sie trösten. Sie streichelte seine Wange. »Ich bete darum, dass Sie recht behalten«, sagte sie leise. »Und von heute an habe ich auch keine schlechte Laune mehr. Das verspreche ich.«
Paul ergriff ihre Hand und küsste ihre Handfläche. »Ich möchte nur, dass Sie glücklich sind.«
Die Aufzeichnungen der Schiffsrouten ergab, dass Blackford Richmond am sechzehnten Mai auf der Seasprit verlassen hatte und am achtzehnten in New York City eingetroffen war. Er hatte also drei Monate Vorsprung, um seine Spur zu verwischen.
Während Frederic auf dem Kai wartete, ging John zurück auf die Raven und sprach mit dem Kapitän. Sie vereinbarten, früh am Morgen Segel zu setzen und die Ladung Zucker und Tabak, die eigentlich für England bestimmt war, stattdessen auf einer Auktion in New York zu versteigern.
Zurück im Wagen wandte sich John an seinen Vater. »Auf dem Rückweg zum Haus möchte ich noch schnell einen Besuch machen.«
Frederic nickte und fragte sich, was John damit meinte.
Schweren Herzens kam Joshua Harrington zu Hause an und fragte sich, wie er seiner Frau beibringen sollte, was er soeben gehört hatte.
Aber Loretta wusste augenblicklich, dass etwas nicht in Ordnung war. »Was ist los?«
»Ich habe John Duvoisin in der Bank getroffen.«
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. »War Charmaine auch dabei?«
»Leider nein, meine Liebe. Ich fürchte, dass es zwischen den Eheleuten nicht zum Besten steht. John hat sie zu Hause gelassen, weil sie schwanger ist. Ich wusste doch, dass es nicht gut gehen würde!«
Loretta überlegte, ob sich diese Bemerkung auf Charmaines Ehe mit John bezog oder auf ihre Idee, das Mädchen nach Les Charmantes zu schicken? Charmaine hatte in ihren Briefen oft von düsteren Ereignissen berichtet: von Colettes Tod, von Frederics Hochzeit mit Agatha, von der Rückkehr des verlorenen Sohns und von dem schrecklichen Unglück, bei dem der kleine Pierre ertrunken war. Ob es noch andere Widrigkeiten gab, die auf der Familie lasteten? Manchmal war den Harringtons nicht recht wohl bei der Vorstellung, dass Charmaine dort lebte. Allerdings hatte sie nie den Wunsch nach einer Rückkehr nach Richmond angedeutet. Stattdessen schrieb sie, dass sie bei den Mädchen bleiben wolle, und berichtete von Johns Rückkehr nach Virginia und Frederics gesundheitlichen Fortschritten und Pauls bevorstehender Eröffnung seines eigenen Unternehmens. Offenbar verbrachte sie viel Zeit mit ihm, aber ihre Gefühle, Absichten oder Ziele erwähnte sie mit keinem Wort. Loretta machte sich zwar so ihre Gedanken, aber mit zwanzig Jahren war Charmaine inzwischen eine erwachsene Frau, die ihre eigenen Entscheidungen traf.
Allerdings hatte Father Michaels seltsamer Besuch vor fast fünf Monaten Lorettas Unruhe erneut geschürt. Keine zwei Wochen darauf hatten die Harringtons Raymond und Mary Stanton nach deren Rückkehr von Paul Duvoisins festlicher Eröffnung getroffen. Mary brannte förmlich darauf, den neuesten Klatsch über die unerwartete Hochzeit loszuwerden, die alle Ereignisse dieser Woche überstrahlt hatte.
»Sie haben nichts davon gewusst?«, wunderte sich Mary, als Loretta sie ungläubig ansah. »Sicher hat Ihnen Charmaine von ihren Gefühlen für diesen Mann berichtet? Dass er ihr den Hof gemacht hat? Nein?«
Als Loretta nur die Schultern zuckte, breitete Mrs Stanton mit Wonne ihr Wissen aus. »Es war überhaupt sehr seltsam.« Sie legte eine kleine Pause ein, um sich alles wieder ins Gedächtnis zu rufen. »Vor dem Ball habe ich noch mit Charmaine gesprochen. Sie war schlicht gekleidet, wie sich das für eine Gouvernante gehört, und hatte die Kinder bei sich. Ihren Kavalier für den Abend erwähnte sie mit keinem Wort. Zwei Stunden später verschwand sie, um die Kinder ins Bett zu bringen. Mit ihrer Rückkehr hat niemand gerechnet … und schon gar nicht am Arm von John Duvoisin und in einer so eleganten Robe! Die beiden haben fast den ganzen Abend miteinander getanzt. Was Paul anging, so war er zwar der Begleiter von Anne London, aber jeder konnte sehen, dass er außer sich war und Charmaine mit Blicken verfolgte. Entweder passte ihm ihre Anwesenheit nicht … oder ihr Begleiter.« Mary schüttelte den Kopf, als ob sie es noch immer nicht glauben könnte. »Und dann erst das Getuschel, als er mit ihr tanzte! Irgendetwas stimmte da ganz und gar nicht!«
Loretta schauderte zwar bei dem Gedanken an den Tratsch der Leute, aber nun wollte sie auch noch den Rest erfahren und ermunterte Mrs Stanton fortzufahren.
»Ich habe gehört, dass John am nächsten Morgen bei der Messe in der Kapelle neben ihr saß, obgleich er sonst nie in der Kirche zu finden ist. Charmaine hielt ihren Kopf die ganze Zeit über gesenkt, was zu nicht enden wollenden Spekulationen über ihr Verhältnis zum Erben des Hauses Anlass gab. Aber mit der Erklärung, die John am Ende der Messe abgab, hatte keiner gerechnet: Die beiden waren zwei Stunden zuvor getraut worden! Aus verlässlicher Quelle weiß ich, dass Paul völlig außer sich war!«
»Und Charmaine?«, fragte Loretta. »Wie hat sie reagiert?«
»Anne London behauptet, dass sie sehr verlegen gewesen sei, als ob« – sie dämpfte ihre Stimme zu einem Flüstern –, »als ob sie sich für irgendetwas schämte.«
»Aber, Mary«, entrüstete sich Loretta, »das wissen Sie doch gar nicht! Bestimmt empfindet Mr Duvoisin sehr viel für Charmaine, wenn er ihr sogar einen Antrag gemacht hat.«
»Und warum hat es keine richtige Hochzeitsfeier gegeben? Die kann er sich doch wohl leisten, oder?«
Fürwahr, eine gute Frage.
Einige Wochen lang sorgten sich Joshua und Loretta nach Kräften, bis endlich ein fröhlicher, unbeschwerter Brief von Charmaine eintraf. Vermutlich wird Sie meine Neuigkeit sehr überraschen, schrieb sie, aber vor knapp zwei Wochen habe ich John Duvoisin geheiratet. Mr Harrington soll sich nicht beunruhigen. Ich bin sehr glücklich. Wie ich Ihnen schon vor einiger Zeit schrieb, ist John ganz und gar nicht der Mann, für den ich ihn bei unserer ersten Begegnung gehalten habe …
Loretta war zwar noch leicht besorgt, doch in ihren Augen hatte Charmaine die richtige Entscheidung getroffen. Die junge Frau hatte, und das war unbestreitbar, gut für sich gesorgt, auch wenn dem Mann, den sie sich ausgesucht hatte, nicht der beste Ruf vorausging.
Heute jedoch lebten ihre Befürchtungen wieder auf. Es gefiel ihr nicht, dass Charmaine so schnell schwanger wurde und zu Hause bleiben musste, während ihr Mann auf Reisen ging. Bekümmert sah sie ihren Mann an. »Was meinst du, Joshua, was ist unserer Charmaine widerfahren?«
»Das mag ich mir nicht ausdenken. Ich mache mir lieber ein eigenes Bild.«
»Und wie?«
»Ich reise nach Charmantes«, erklärte er, »und wenn du dich nicht vor der Überfahrt fürchtest, meine Liebe, so darfst du mich herzlich gerne begleiten.«
»Glaubst du vielleicht, dass ich dir gestatten würde, allein zu verreisen?«
Der Wagen hielt vor dem Tor von St. Jude, und John half seinem Vater auf das Pflaster hinunter. »Was machen wir hier?«, fragte Frederic verwundert.
»Wir betreiben nur einige Nachforschungen«, erklärte John, als sie das Kloster betraten. »Ich habe einen guten Freund, der Auskünfte über Father Benito einholen kann. Schließlich dürfen wir seine Rolle bei dem Geschehenen nicht vergessen.«
Eine Nonne öffnete die Tür. John nahm seine Kappe ab, und dann wurden sie in einen karg möblierten Raum geführt, der als eine Art Büro diente. Sie hatten gerade Platz genommen, als ein hochgewachsener Priester eintrat. John erhob sich und schüttelte ihm die Hand. »John«, sagte der Mann erfreut, bevor er Frederic bemerkte. »Das muss dein Vater sein.«
Aus seiner Miene schloss Frederic, dass er wohl über ihr Verhältnis im Bilde war. John machte die beiden miteinander bekannt, und Michael schüttelte Johns Vater die Hand. Seine direkte Art nahm Frederic seine Befangenheit.
»Bitte, behalten Sie doch Platz«, sagte Michael und zog sich einen Stuhl heran. »Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, John. Ich versuche schon seit Monaten, Sie zu erreichen.«
»Wir sind gerade erst in Richmond angekommen.«
Der Priester sah Frederic an. »Ich hoffe, Ihre Reise ist gut verlaufen.«
»Kommen wir zum Wesentlichen, Michael«, entgegnete John. »Dies ist kein Höflichkeitsbesuch. Wir haben erfahren, dass sowohl mein Sohn als auch Colette ermordet wurden.«
John berichtete, was geschehen war, und Michael lauschte mit angehaltenem Atem und registrierte bewegt die traurigen Mienen von Vater und Sohn. »Möge Gott den armen Seelen Frieden schenken«, murmelte er, als John geendet hatte. »Ich bin zutiefst betroffen. Womit kann ich helfen?«
John riss sich zusammen. »Wir brauchen Informationen über einen gewissen Father Benito St. Giovanni. Vor ungefähr zwanzig Jahren ist sein Schiff vor Charmantes auf Grund gelaufen, und er wäre beinahe ertrunken. Nachdem er sich erholt hatte, ist er als Priester auf der Insel geblieben.«
»Er war als Missionar auf eine andere karibische Insel unterwegs«, erklärte Frederic. »Doch er fand Gefallen an Charmantes und behauptete, dass er mit päpstlichem Segen unterwegs sei. Auf Charmantes musste zwar niemand bekehrt werden, aber einen Priester benötigten wir trotzdem.«
John schnaubte verächtlich. »Wenn man ihn überhaupt so nennen kann.«
»Warum sagen Sie das, John?«
»Weil Benito von den Morden wusste und meine Tante erpresst hat.«
»Sind Sie sicher?«
»Absolut. Benito hat alles gestanden. Außerdem haben wir als Beweis einen Brief von seiner Hand.«
»Barmherziger Gott!«, murmelte der Priester. »Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Ich schreibe an den Vatikan, aber bis zu einer Antwort wird einige Zeit vergehen. Wann kommen Sie nach Richmond zurück?«
»Das hängt davon ab, wie lange es dauert, Blackford in New York aufzuspüren und …« John brach ab, doch der Glanz in seinen Augen beunruhigte Michael.
»Und?«, drängte er, aber ohne Erfolg. »Sie haben nicht vor, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen, nicht wahr, John?« Als er schwieg, sah Michael zu Frederic hinüber. »Sie haben nicht vor, ihn umzubringen, nicht wahr?« Als auch er nichts sagte, war Michael äußerst beunruhigt. »Sie dürfen das nicht tun, John! Ich kann verstehen, dass Sie auf Rache sinnen, aber eine solche Tat bringt keine Erleichterung. Versprechen Sie mir, dass Sie nichts Unbesonnenes tun!«
»Das kann ich nicht versprechen, Michael.«
Der Priester schüttelte den Kopf. »Suchen Sie den Mann und alarmieren Sie die Behörden. Aber überlassen Sie der Polizei alles Weitere. Und unserem Herrgott!«
»Unser Herrgott«, stieß John geringschätzig hervor, »hat zugelassen, dass der Verbrecher meinen kleinen Sohn entführt, seinen Kopf unter Wasser drückt und zusieht, wie er mit Ärmchen und Beinchen zappelt, bis kein Leben mehr in ihm ist!« Er brach in Tränen aus. »Sagen Sie mir nicht, dass Rache meiner Seele keinen Frieden schenkt! Verdammt! Ich finde meinen Frieden erst, wenn dieser Mensch seinen letzten Atemzug getan hat!«
Wieder sah Michael Frederic an. »Sie müssen ihm das ausreden, Mr Duvoisin! Man wird ihn als Mörder verfolgen …!«
»Ich glaube nicht, dass ich das kann«, sagte Frederic, »denn ich will Blackford ebenfalls leiden sehen.«
»Sie sind ja wahnsinnig! Dieser Mensch ist es nicht wert, dass Sie Ihre Seele opfern. Er ist längst verdammt, aber Sie dürfen ihm auf diesem Weg nicht folgen!«
Stille.
Kalte Furcht überkam Michael. »Was kann ich nur tun, damit Sie Ihre Meinung ändern?«, fragte er verzweifelt.
»Beten Sie für uns«, entgegnete Frederic.
Michael schüttelte den Kopf. John erhob sich eilig. »Je nachdem, wie lange wir in New York aufgehalten werden, reisen wir unter Umständen auf direktem Weg nach Charmantes zurück. Es wäre mir lieb, wenn Sie die Antwort des Vatikans an Stuart Simons weiterleiten könnten. Er kann sicherstellen, dass sie mich zuverlässig erreicht.«
»Ich würde die Antwort gern persönlich nach Charmantes bringen«, sagte Michael leise.
John wurde neugierig. »Und warum?«
»Ich will jemanden besuchen«, sagte Michael. »Und zwar jemanden, der in Ihren Diensten steht.«
Jetzt rätselte auch Frederic. »Und wen?«
»Die Gouvernante Ihrer Töchter … Charmaine Ryan.«
Frederic war verblüfft, aber John begriff gar nichts mehr. »Charmaine?«, fragte er. Woher kannte Michael sie?
Der Priester schmunzelte. »Ich habe Ihren Rat befolgt, John, und unmittelbar nach Ihrer Abreise Loretta und Joshua Harrington aufgesucht. Als Marie starb, hat Charmaine bei den Harringtons gearbeitet.«
Bisher hatte er John noch nie sprachlos erlebt, und so verwirrt erst recht nicht. »Geht es Ihnen gut, John?«
»Er ist nur erschrocken«, erklärte Frederic, »denn Sie sind heute schon der zweite Mensch, der sich nach seiner Frau erkundigt.«
»Nach seiner Frau?«, stieß Michael hervor. Unmöglich! Dieser Zufall wurde immer unglaublicher! »Aber Sie haben mir nie gesagt, dass Sie Charmaine kennen!«
»Sie haben ja auch noch nie ihren Namen genannt!«
»Aber Sie wussten doch, dass Charmaine Maries Tochter ist?«
»Ich hatte nicht die leiseste Ahnung«, sagte John fast unhörbar. Am ersten Morgen nach seiner Ankunft auf Charmantes war ihm Charmaine seltsam bekannt vorgekommen. Marie … Charmaine war Maries Tochter! Seine Gedanken überschlugen sich. John Ryan hatte Marie getötet! Sein Blick verdunkelte sich. »Mein Gott«, stieß er hervor, als sich endlich eines zum anderen fügte. John Ryan ist nicht Charmaines Vater! Das war alles so unglaublich, dass er den Kopf in den Nacken warf und nur noch lachte. »Warten Sie nur, bis Charmaine das hört!«
»Bitte nicht, John«, warnte Michael mit einem Seitenblick auf Frederic. Er wollte die Sache gern vertraulich behandelt wissen. »Sie sagen niemandem etwas! Zuvor möchte ich Charmaine sehen.«
»Sie wollen es ihr nicht sagen?«, fragte John fast übermütig. »Aber das müssen Sie, Michael! Sie hasst den Mann, den sie für ihren Vater hält.«
»John, bitte!«, bat Michael und sah wieder Frederic an.
John folgte seinem Blick. »Meinen Vater kann Ihr kleines Geheimnis nicht erschrecken. Er hat im Leben viel gemacht, worauf er nicht gerade stolz ist. Glauben Sie mir, er kann Ihr Geheimnis besser bewahren als Sie die Beichten.«
Auf dem Weg zu Johns Stadthaus wollte Frederic alles über Charmaines Mutter wissen.
»Ich habe Marie Ryan vor einigen Jahren kennengelernt. Sie hat damals in St. Jude gearbeitet und mir Mut gemacht, als ich nicht mehr leben wollte. Genau wie Charmaine war auch sie meine Rettung. Durch sie habe ich mich mit Father Michael angefreundet. Die beiden haben meinem Leben neuen Sinn gegeben und, wie ich meine, auch eine bessere Richtung. Wenn ich von Maries schwierigem Leben gewusst hätte, hätte ich ihr natürlich geholfen. Ich schäme mich, es einzugestehen, aber wir haben die ganze Zeit ausschließlich von mir gesprochen.«
Er sah aus dem Fenster, doch im Grunde sah er in sich hinein. Beim Gedanken an Charmaine spürte er plötzlich, wie sehr er sie vermisste.
Nach dem gemeinsamen Dinner setzte sich John an seinen Schreibtisch und wählte die Worte sorgfältig, bevor er sie zu Papier brachte. Er sprach davon, wie sehr er sie liebte und sich danach sehnte, die Qual endlich hinter sich zu lassen. Danach verfasste er noch schnell einen Brief an Paul, bevor er seinem Vater eine gute Nacht wünschte.
Frederic blieb in dieser Nacht lange auf und sann über die Vergangenheit, die neuen Erkenntnisse und alles nach, was ihnen noch bevorstand. Er ging zum Kamin hinüber und betrachtete die kleine Zeichnung, die dort hing: ein schwarzes Pferd, das hoch in die Luft stieg. Fantom vermisst dich, Johnny! Genau wie wir. In Liebe, Yvette. Seufzend strich Frederic über das Blatt. Es war ausgebleicht und an den Ecken ein wenig eingerissen. Was habe ich mir nur gedacht, als ich diese Familie auseinanderriss? Bevor er zu Bett ging, betete er, dass er zumindest dieses eine Mal im Leben etwas richtig machte.
In dieser Nacht kniete Michael lange vor dem Kruzifix, das über seinem Bett hing, und kurz vor Morgengrauen stand sein Entschluss endgültig fest. Er suchte Sister Elizabeth auf und erklärte ihr seine Pläne. Dann warf er ein paar Kleidungsstücke in einen fadenscheinigen Beutel und verließ St. Jude.
Stille durchdrang das Foyer, verhüllte die Räume, sickerte in jede Nische und den kleinsten Spalt und mischte sich mit der Dunkelheit zu einer schaurigen Düsternis. Es war kurz vor Mitternacht. Gebeugt stieg Agatha die Treppe empor und neigte lauschend den Kopf, während sich ihre Hände um die Balustrade krampften. »Frederic?«, flüsterte sie. »Bist du es? Robert! Wo bist du? Ist es vollendet?«
Auf einem Tisch fand sie eine Lampe, entzündete den Docht und trieb die Dunkelheit in den Schatten zurück. »Wer ist da?«, schrie sie. Sie fühlte eine Bewegung zu ihrer Linken und wirbelte herum. »Elizabeth? Bist du es?« Unerschrocken trat sie einen Schritt näher. »Ich habe doch gesagt, dass du nicht wiederkommen sollst! Frederic gehört jetzt mir!«
Ein kühler Windstoß umwirbelte ihre schmale Gestalt und trug ihr ein Wispern zu. »Er ist fort … er kommt nie mehr zurück …« Ihr Blick huschte den Korridor entlang und trieb die Erscheinung ins Treppenhaus zurück. Es stimmte. Frederic war vor Tagen weggegangen und nicht zurückgekommen, seit sie ihm alles erklärt hatte. Sie dachte, er würde sie verstehen, doch jetzt war sie furchtsam.
Paul war nicht wach geworden. Dabei müsste er doch hungrig sein. Müsste gestillt werden. Panik packte sie. Hatte Frederic ihr Kind entführt? Oder hatte Robert ihn wieder geholt? Sie hatte ihm doch gesagt, dass er dieses Mal Pierre nehmen sollte! Wieder flüsterte eine geisterhafte Stimme von unten, als ob sie ihre Gedanken lesen könnte. »Pierre, mon caillou …«
Agatha lief die Treppe hinunter, stolperte über den Saum ihres Morgenmantels und hätte beinahe die Lampe fallen lassen. Mit schreckgeweiteten Augen erkannte sie Colette, die nach der Hand ihres kleinen Jungen griff.
»Du!«, zischte Agatha. »Wo ist Robert?« Sie sah sich um. »Er sollte deinen Jungen entführen!« Ein wildes Lachen hallte von den Wänden wider. »Frederic soll spüren, wie es ist, wenn man ihm sein Kind aus den Armen reißt!«
»Mein Junge ist bei mir sicher«, entgegnete Colette.
Agathas Blicke irrten umher. »Wo ist Robert? Wo ist er?«
Colette lächelte. »Er ist fort … mit dem anderen Kind …«
»Mit Elizabeths Bastard?«
»Nein. John ist bei Frederic in Sicherheit.«
Furcht packte Agatha. »Paul?«, rief sie und suchte wie besessen in allen Ecken. »Nein! Robert hat es versprochen! Er hat versprochen, mich glücklich zu machen … hat versprochen, dass er mir Paul nie wieder wegnimmt!«
»Aber Sie haben Robert unglücklich gemacht!«, hauchte Colette. »Er ist wütend auf Sie.«
So war es. Robert hasste sie, weil er inzwischen wusste, dass sie ihn nur benutzt hatte.
Die Haustür flog auf, und die kühle Nachtluft lockte sie nach draußen. »Wo ist er hingegangen?«, fragte Agatha flehend. »Wohin bringt er mein Kind?«
Colette ging voraus. »Sie haben ihm doch befohlen, den Jungen zu ertränken …«
Plötzlich wusste Agatha alles. Verzweifelt rannte sie der Erscheinung nach, die jedoch immer außerhalb ihrer Reichweite blieb. »O Gott!«, schluchzte sie.
»Den haben Sie lange genug missachtet …«
»Bitte!«, rief Agatha. »Nicht meinen Sohn! Nicht meinen Paul!«
Der Kai war nicht weit entfernt, und Agatha rannte wie besessen zum Wasser. Sie sah ein kleines Boot auf den Wellen tanzen. »Robert! Nein! Bitte! Du hast den falschen Jungen!«
In der Nähe des Kais standen inzwischen die ersten Holzhütten. Die Männer glaubten, einen Schrei gehört zu haben, aber sie kamen zu spät. Sie rieben sich noch den Schlaf aus den Augen, als sie ein Platschen vernahmen. Oder waren das nur die Wellen, die sich am Kai brachen? Achselzuckend kehrten sie in ihre Hütten zurück.
Donnerstag, 30. August 1838
Im Hafen von Richmond herrschte große Geschäftigkeit. Als John und Frederic bei der Raven anlangten, standen Jonah Wilkinson und Stuart Simons auf dem Kai. John war hocherfreut, Stuart zu sehen, denn bis zu ihrem nächsten Wiedersehen konnten unter Umständen Monate vergehen.
»Hallo, John«, begrüßte ihn der Verwalter. »Eigentlich habe ich die Ankunft der Destiny erwartet, aber mit der Raven und Ihnen habe ich nicht gerechnet.«
John stellte seinem Vater Stuart vor. Dann nahm er den Freund beiseite und wanderte mit ihm den Kai entlang.
»Jonah hat berichtet, was geschehen ist«, sagte Stuart. »Es tut mir entsetzlich leid, John.«
»Ich komme schon zurecht.« Rasch wandte er sich einem anderen Thema zu. »Erinnern Sie sich noch, dass Sie im Hafen nach einem gewissen John Ryan herumgefragt haben?«
»Ja. Was ist mit ihm?«
»Hat ihn denn irgendjemand gesehen?«
»Keine Ahnung. Ich habe seitdem nicht mehr nachgefragt.« Als John die Stirn runzelte, fügte er hinzu: »Möglich ist es immerhin.«
»Verbreiten Sie das Gerücht, dass ich eine Belohnung für alle brauchbaren Hinweise zahle. Wenn Sie den Mann ausfindig gemacht haben, dann entlohnen Sie ihn so üppig, dass er gar nicht anders kann, als täglich zur Arbeit zu erscheinen.«
»Und warum das alles?«, fragte Stuart verwundert.
»Wenn er regelmäßig kommt, bieten Sie ihm irgendwann eine besser bezahlte Arbeit auf einem unserer Schiffe an, das nach Charmantes fährt. Sobald er sich an Bord befindet, senden Sie mir eine Nachricht.«
»Aber woher weiß ich, wo ich Sie erreiche?«
»Am besten fügen Sie die Nachricht den Rechnungen bei. Falls ich nicht auf Charmantes bin, weiß Paul, was zu tun ist. Ich habe ihm alles erklärt.« Er zog zwei Umschläge aus seiner Tasche. »Stellen Sie sicher, dass diese Briefe umgehend mit der Destiny nach Charmantes gelangen.«
»Aber die Destiny fährt von hier aus mit einer Tabakladung nach Liverpool!«
»Laden Sie nur die Hälfte«, wies John ihn an. »Wenn die Raven nächste Woche aus New York nach Richmond zurückkommt, kann sie für die Destiny einspringen. Und was die Destiny angeht, so kann Paul die halbe Ladung einfach mit Zucker auffüllen.« Er übergab Stuart die Umschläge. »Es ist äußerst wichtig, dass diese Briefe umgehend nach Charmantes gelangen.«
John wusste nicht, dass Father Michael Andrews früh am Morgen an Bord der Raven gegangen war. Frederic hatte ihm geraten, unter Deck zu bleiben, bis sie den Hafen hinter sich hatten. Als der Priester irgendwann an Deck erschien, war John verärgert. »Was soll das?« Er sah von einem zum anderen. »Habe ich jetzt zwei Väter, die auf mich aufpassen?«
»Sie können toben, so viel Sie wollen. Das beeindruckt mich nicht. Ich habe meinen Auftrag von höherer Stelle.«
»Hoffentlich können Sie auch auf Wasser wandeln, Michael. Eine fromme Bemerkung, und ich werfe Sie über Bord.«
Die Nachricht von Agathas Tod erreichte Paul, als er früh am Morgen in die Stadt kam. Keine Stunde später ging er bereits auf Espoir an Land. Man hatte die Leiche so belassen, wie man sie am Strand gefunden hatte, und nur eine Decke über sie gebreitet. Mit einer Mischung aus Verachtung, Hass und Trauer sah Paul auf den Körper hinunter. Schweren Herzens gab er schließlich seinen Männern den Auftrag, einen Sarg für Agathas Beerdigung zu zimmern.
In dieser Nacht saß er einsam und allein in seinem großen Haus, das seinen geschäftlichen Erfolg repräsentierte. In den letzten vier Monaten hatten bereits drei Handelssegler die Insel verlassen, deren Fracht ihm eine Menge Geld einbrachte. Dennoch war er bei Weitem nicht so zufrieden wie damals, als er sich noch für seinen Vater abgeplagt hatte. Als er zu Bett ging, hallte sein Schritt durch das leere Haus, und er konnte lange keinen Schlaf finden.
Michael klopfte an Johns Kabine, bevor er die Luft anhielt und eintrat. John saß an einem kleinen Tischchen. Stirnrunzelnd sah er auf. »Keine Angst, ich will Ihnen keine Predigt halten, aber ich möchte gern über Charmaine reden.«
John lehnte sich bequem zurück und legte seine Füße auf das Tischchen. Dann lud er Michael ein, auf dem schmalen Bett Platz zu nehmen. »Ich liebe Charmaine über alles«, erklärte er unvermittelt und lächelte.
Michael erwiderte sein Lächeln. »Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen?«
»Du lieber Himmel, Michael! Woher soll ich das wissen! Als ich nach Colettes Tod nach Charmantes kam, war Charmaine die Gouvernante der Kinder. Anfangs mochte ich sie nicht, doch wie ich heute weiß, habe ich sie damals falsch eingeschätzt …« Ich habe Colette falsch eingeschätzt. Er runzelte die Stirn. »Da ich damals möglichst viel Zeit mit Pierre verbringen wollte, haben wir uns ständig gesehen. Charmaine war wie eine Mutter zu ihm. Als er starb, war sie genauso verzweifelt wie ich. Und doch hat sie mich getröstet. Heute weiß ich, dass ich sie schon bei meiner Abreise im Herbst geliebt habe. Aber nach den schrecklichen Ereignissen hatte ich keinen Platz für solche Gefühle. Das änderte sich erst, als ich Charmaine im April wiedersah.« Er grinste. »Es war ein Geschenk des Himmels, als ich merkte, dass sie genau wie ich empfand.«
Nachdenklich sah er vor sich hin. »Falls es Ihren Gott tatsächlich gibt, so hat er das bestens geplant. Ich sage Ihnen eines, Michael, und das ist ein Versprechen: Sie konnten Marie nicht schützen, aber dafür müssen Sie sich nie wieder um Charmaine sorgen.«
»Und was ist mit Colette?«, fragte Michael. »Sie sagten einmal, dass Sie nie wieder jemanden so lieben könnten.«
»Damals habe ich das auch geglaubt«, murmelte John. »Doch es ist anders gekommen.«
»Genügt das womöglich, um Ihrem Vater und sich selbst zu verzeihen?«
Johns Miene wurde abweisend. »Das weiß ich nicht.«
»Ihr Vater hat Ihnen verziehen, nicht wahr?«
Als John aufstand, wechselte Michael klugerweise das Thema. »Wann hat denn die Hochzeit stattgefunden?«
»Unmittelbar nach Pauls Fest. Es war nur eine kleine Feier mit Father Benito …« John brach ab, und Michael wusste, was er dachte. Was, wenn dieser Priester überhaupt kein Priester war? »Sobald wir die Sache in New York erledigt haben, werden wir auf Charmantes eine große Hochzeit feiern. Und Sie werden uns trauen, nicht wahr, Michael?«
»Das wäre mir eine große Ehre.«
»Ich muss Ihnen übrigens noch etwas sagen: Sie werden Großvater.«
Michael fragte sich, ob die Überraschungen jemals endeten. Aber das Thema kam ihm wie gerufen. »Ein Kindchen?«, sagte er versonnen. »Wann wird er oder sie denn erwartet?«
»Um Weihnachten herum.«
»Und Sie finden es richtig, ausgerechnet jetzt so lange von zu Hause fort zu sein?«
John stand auf und ging unruhig auf und ab. »Sie klingen wie mein Vater.«
»Wir sorgen uns eben um Sie … und um Ihren kleinen Sohn oder Ihre Tochter.«
»Das glaube ich gern.« Unvermittelt blieb er stehen. »Kommt die Predigt jetzt doch noch?«
»John …«
»Sie verschwenden Ihre Zeit, Michael.«
»Sie sind einer der ehrenwertesten Menschen, die ich kenne, John. Schon deshalb ist meine Zeit nicht vergeudet. Und da Sie obendrein mit meiner Tochter verheiratet sind, kann ich nicht einfach schweigen. Wir alle haben unsere Mission auf dieser Erde.«
Johns Blick strafte sein spöttisches Grinsen Lügen, aber er sparte sich jegliche Widerworte.
Freitag, 31. August 1838
Da Agatha Blackford Ward Duvoisin unmöglich neben Frederics früheren Frauen beigesetzt werden konnte, hatte Paul ihr ein Grab am anderen Ende des Friedhofs ausheben lassen. Charmaine, Mercedes und George waren die einzigen Trauergäste. Jeannette und Yvette hatten sich geweigert und wollten nicht einmal Paul zu Gefallen mitkommen. Und Charmaine mochte die Mädchen nicht zwingen, für eine Frau zu beten, die ihre Mutter und ihren Bruder ermordet hatte.
Da die Beisetzung ohne priesterlichen Segen stattfand, war es an Paul, die Abschiedsworte zu formulieren. Er beschränkte sich auf einen einzigen Satz: »Möge Gott Ihnen verzeihen und Ihnen den Frieden schenken, den Sie in diesem Leben nicht gefunden haben.« Charmaine senkte den Kopf und ließ ihren Tränen freien Lauf. Aber sie weinte nicht um Agatha, sondern allein um deren Sohn.
Als Charmaine spät am Abend die Bibliothek betrat, fiel ein schmaler Lichtstreifen aus dem Korridor bis zu dem Sessel, in dem Paul saß. Er war eingeschlafen, und die Lampe war heruntergebrannt. Wieder stiegen ihr die Tränen in die Augen. Ihn zu lieben wäre sehr viel leichter gewesen, dachte sie. Heute hätte er jemanden gebraucht, der ihn liebte. Sie dachte an die unschuldigen Zeiten zurück, als seine entblößte Brust und sein Lächeln ihre Knie zittern ließen. Diese zarten Gefühle einer aufkeimenden Liebe würde sie für immer in ihrem Gedächtnis bewahren.
»Paul?«, flüsterte sie. »Paul?«
Seine Lider zitterten, und wie in Trance begriff er, wo er sich befand. Er rieb sich die Augen. »Ich muss eingeschlafen sein.«
»Warum gehen Sie nicht zu Bett? Es war doch ein sehr anstrengender Tag.«
»Nein, nein. Ich könnte ohnehin nicht schlafen.«
Er stand auf und reckte sich. Dann ging er zum Seitentisch und goss sich einen Drink ein. »Möchten Sie auch einen?« Aber sie schüttelte den Kopf.
»Das Baby hat sich heute zum ersten Mal bewegt«, sagte sie in der Hoffnung, seine Melancholie zu vertreiben.
Das schiefe Lächeln zeigte, dass ihre Bemühungen nicht viel Erfolg hatten. »Und wie geht es Ihnen?«
»Schon sehr viel besser. Vielen Dank. Rose hatte recht. Die ersten Monate sind tatsächlich die schlimmsten.«
»Sie werden von Tag zu Tag hübscher, Charmaine.« Als ob er ihre Gedanken erraten hätte, lächelten plötzlich auch seine Augen.
Welch albernes Herumgerede, dachte sie … und wandte sich mutig einem Thema zu, das ihr auf der Seele brannte. »Wir haben bisher nie darüber gesprochen, Paul, und vielleicht ist das jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt, aber John hat mir alles über das Verhältnis zwischen Ihrem Vater und Agatha erzählt und …« Sie hielt einen Augenblick lang inne und suchte nach den richtigen Worten. »Sie sollen einfach wissen, dass Sie der liebenswerteste Mann sind, den ich kenne. Sie sind nicht für das Schicksal Ihrer Familie verantwortlich. Ich denke das nicht, und ich bin sicher, John auch nicht.«
Paul hörte ihr aufmerksam zu, doch eine Regung konnte sie nicht ausmachen.
»Ich habe lange mit dem Gefühl gelebt, einfach nur hilflos zu sein«, fuhr sie fort. »Doch ich musste erkennen, dass ich meinen Vater nicht ändern oder gar verhindern konnte, was er getan hat. Heute ist Agatha nur noch eine böse Erinnerung. Aber sie hat der Welt etwas ganz Wunderbares geschenkt … und zwar Sie, Paul.«