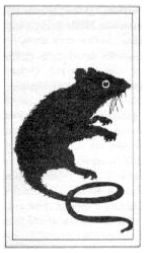
13
Verlorene Magie
Sofort brach der Dämon frei. Jene durchgesickerte Magie seiner unmittelbaren Umgebung war nichts, verglichen mit der Magie seines Ausbruchs. Ein greller Blitz, ein ohrenbetäubender Knall – da wurde Bink von der Explosion durch die Höhle geschleudert. Er krachte gegen eine Wand. Als er wieder zu sich kam, sah er, wie die Höhle langsam zusammenbrach. Riesige Felsbrocken stürzten herab und wurden zu Sand zertrümmert. Die ganze Welt schien in den Raum hineinzustürzen, den der Dämon freigemacht hatte. Damit hatte Bink nicht gerechnet: Er hatte an die Möglichkeit einer willkürlichen Zerstörung durch X(A/N)th oder die eines allmählichen Verlusts der Magie gedacht, aber nicht an eine achtlose Vernichtung im Zuge des Verschwindens des Dämonen.
Was hatte er getan? fragte er sich, als ihn der Staub zu ersticken drohte und nur die funkenstiebenden Felsen die Szene erhellten. Warum hatte er nicht auf die Warnung der Gehirnkoralle gehört und den Dämon in Frieden gelassen? Warum hatte er seiner Liebe zu Juwel nicht nachgegeben und –
Seiner Liebe? Nein, das stimmte ja gar nicht, dachte er inmitten der einstürzenden Trümmer. Er liebte Juwel nicht mehr!
Das bedeutete aber, daß die Magie tatsächlich verschwunden war. Der Liebestrank wirkte nicht mehr. Jetzt würde sein Talent ihn nicht länger schützen. Das Land Xanth war nun Mundania gleich.
Bink schloß die Augen und weinte. Die Luft war voller Staub, der ihm in den Augen brannte, und Angst hatte er außerdem auch, aber es war noch mehr als nur das. Er weinte um Xanth. Er hatte die Einzigartigkeit der ihm vertrauten Welt vernichtet. Selbst wenn er diesen Höhleneinsturz überleben sollte – wie konnte er jemals damit leben?
Er wußte nicht, wie die Gemeinschaft, zu der er ja gehörte, darauf reagieren würde. Was würde aus den Drachen und den Gewirrbäumen und den Zombies werden? Wie konnten die Menschen ohne Magie leben? Es war, als sei die gesamte Bevölkerung plötzlich in die schäbige Kategorie der Nicht-Talentierten verbannt worden.
Nach und nach beruhigte sich das Gestein. Bink stellte fest, daß er mit Felsstaub beschmiert und auch zerkratzt war, aber seine Gliedmaßen und sein Schwert waren noch intakt. Wie durch ein Wunder hatte er überlebt.
Und die anderen? Er spähte durch das Geröll. Mattes Licht fiel durch ein Loch an der Decke herein. Das war offenbar der Fluchtweg des Dämons gewesen. X(A/N)th mußte einfach emporgeschossen sein und sich seinen Weg achtlos durch den Fels gebahnt haben.
Welch eine Macht!
»Magier! Juwel!« rief Bink, doch er erhielt keine Antwort. Der Steinschlag war derart heftig gewesen, daß nur die Stelle, an der er gelegen hatte, davon verschont geblieben war. Sein Talent mußte ihn, kurz bevor es verlosch, noch gerettet haben. Doch das war nun vorbei.
Er bahnte sich seinen Weg über den Schutt. Staub wirbelte auf und bedeckte alles. Bink begriff, daß er zwar das Entweichen des Dämons mitbekommen hatte, wahrscheinlich aber eine Zeitlang auch ohnmächtig gewesen war. Es hatte sich eine Unmenge Staub angesammelt! Und doch wies sein Kopf nicht einmal eine Schramme auf und schmerzte auch nicht. Freilich konnte die physische und magische Explosion des entweichenden Dämons manche Widersprüche begründen.
»Magier!« rief er erneut, obwohl er wußte, daß es zwecklos war. Er, Bink, hatte überlebt – aber seine Freunde hatten im kritischen Augenblick nicht den gleichen Schutz genossen wie er. Irgendwo unter diesem Geröllberg …
Er erspähte ein Glitzern, eine matte Spiegelung, ein schwaches Glimmen zwischen zwei dunklen Steinen. Er schob sie auseinander. Da war es: die Flasche mit Crombie. Auf der Flasche lag ein Lumpen. Bink hob die Flasche auf und ließ den Lumpen herabfallen – da sah er, daß es die Überreste von Grundy dem Golem waren. Die kleine Menschengestalt hatte ihr Leben der Magie verdankt. Nun bestand Grundy nur noch aus ein paar Stoffetzen.
Bink schloß wieder die Augen. Eisige Trauer überkam ihn. Er hatte getan, was ihm als richtig erschienen war – aber er hatte die Konsequenzen nicht wirklich bedacht. Moralische Spitzfindigkeiten ließen sich nicht greifen, Leben und Tod dagegen waren sehr greifbar. Doch mit welchem Recht hatte er diese Wesen zum Tode verurteilt? War das seine Moral gewesen: sie im Namen der Moral umzubringen?
Er steckte den Lumpen zusammen mit der Flasche in seine Tasche. Offenbar hatte der Golem als letztes versucht, die Flasche mit seinem Körper zu schützen. Mit Erfolg. So hatte Grundy also sein Leben für das des Greifen geopfert, dem er gedient hatte. Er hatte sich gesorgt und hatte also seine Wirklichkeit tatsächlich erlangt – gerade noch rechtzeitig, um sie von widrigen Umständen wieder zerschmettern zu lassen. Wo blieb denn da die Moral?
Da kam ihm plötzlich ein anderer Gedanke, und er holte die Flasche wieder hervor. War Crombie immer noch dort drin? In welcher Gestalt? Wenn die Magie verschwunden war, war er möglicherweise tot – es sei denn, daß in der Flasche noch etwas Magie übriggeblieben war –
Es war wohl besser, sie nicht zu öffnen! So gering Crombies Chancen wahrscheinlich waren, hingen sie vermutlich von dieser Flasche ab. Wenn er ihn freiließ und die Magie sich in der Luft verflüchtigte – würde Crombie dann wieder als Mensch hervorkommen, als Greif oder als flaschengroße, komprimierte Masse? Bink war gerade bereits ein gewaltiges Risiko eingegangen, als er den Dämon freigelassen hatte. Bei seinem Freund durfte er kein ähnliches Risiko eingehen. Er steckte die Flasche wieder in die Tasche.
Wie trübselig dieses Loch doch war! Allein mit einer Flasche, einem kaputten Golem und seinem Entsetzen. Das ethische Prinzip, auf dessen Grundlage er seine Entscheidung getroffen hatte, war ihm nun völlig schleierhaft. Der Dämon Xanth war bereits über tausend Jahre lang ein Gefangener gewesen. Da hätten ihm ein, zwei weitere Jahrhunderte doch wohl auch kaum schaden können, oder?
Bink stellte fest, daß er sich doch noch nicht an der tiefsten Stelle des Lochs befand. Das Geröll ließ ein noch tieferes Loch frei, in dem dunkles Wasser zu sehen war. Der See! Aber sein Spiegel hatte sich drastisch gesenkt. Jetzt waren darin die dunkelgrauen Windungen einer ehemals unter Wasser gelegenen Gestalt zu erkennen. Das war also die
Gehirnkoralle! Sie war tot. Ohne die mächtige Magie des Dämons konnte sie nicht existieren.
»Ich fürchte, du hast recht gehabt, Koralle«, sagte Bink niedergeschlagen. »Du hast mich durchgelassen, und ich habe dich zerstört. Dich und unsere Welt.«
Es roch nach Rauch. Nicht nach dem gesunden Duft eines munteren Feuers, sondern nach der verkohlenden Fäulnis nur teilweise brennender Vegetation. Offenbar hatte der Dämon irgendein Gestrüpp entzündet, sofern es hier unter der Erde überhaupt Gestrüpp gab. Wahrscheinlich hatte die intensive Magie das bewirkt und einen echten Brand zurückgelassen. Vermutlich würde das Feuer hier unten nicht lange brennen, aber auf jeden Fall verpestete es die Luft ganz erheblich.
Dann hörte er ein zartes Stöhnen. Das war doch wohl nicht die Koralle! Er kletterte in die Richtung des Geräuschs – und entdecke Juwel, die in einer Erdspalte stak und aus einer Kopfwunde blutete, aber ganz eindeutig noch am Leben war. Hastig hob er sie aus der Ritze und schleppte sie an eine heller erleuchtete Stelle. Er lehnte sie gegen einen Felsen und schlug ihr sanft mit den Fingerspitzen auf die Wangen, damit sie wieder zu Bewußtsein gelangte. Sie bewegte sich. »Weck mich nicht auf, Bink. Laß mich in Frieden sterben.«
»Die anderen habe ich schon alle umgebracht«, sagte er verstockt. »Wenigstens du wirst wieder –«
»An meine Arbeit gehen können? Das kann ich nicht ohne Magie.«
Irgend etwas an ihr war seltsam. Bink dachte angestrengt nach, dann fiel es ihm ein. »Du duftest ja gar nicht!«
»Das war Magie.« Sie seufzte. »Na ja, wenn ich am Leben bin, bin ich wohl am Leben. Aber es wäre mir wirklich lieber, wenn du mich sterben ließest.«
»Dich sterben lassen! Das würde ich nie tun. Ich –«
Sie sah ihn mit einem wissenden Blick an. Selbst mit staub- und blutverkrustetem Gesicht war sie noch schön. »Die Magie ist doch weg. Du liebst mich doch gar nicht mehr.«
»Deshalb bin ich es dir trotzdem schuldig, dich nach Hause zu bringen«, erwiderte Bink. Er blickte empor und suchte nach dem geeignetsten Weg, ohne den rätselhaften Ausdruck auf ihrem Gesicht zu bemerken.
Sie durchsuchten das Geröll, konnten den Magier aber nicht finden. In gewisser Hinsicht war Bink sogar erleichtert. Nun durfte er hoffen, daß Humfrey das Ganze überlebt hatte und bereits vor ihm aufgebrochen war.
Bink spähte hinauf zu dem Austrittsloch des Dämons. »Da kommen wir nie hoch«, meinte er bedrückt. »Dazu ist die Felswand zu steil.«
»Ich kenne einen Weg. Ohne den Schaufler wird das nicht ganz leicht sein, aber es gibt auch natürliche Gänge und – oh!«
Ein Ungeheuer versperrte ihm den Weg. Es ähnelte einem Drachen, besaß aber weder Flügel noch Feueratem. So glich es mehr einer sehr langen Schlange mit Beinen.
»Das ist ein Tunneldrache, glaube ich«, sagte Juwel. »Aber irgend etwas fehlt.«
»Ja, die Magie«, antwortete Bink. »Er verwandelt sich in ein mundanisches Wesen – und versteht das alles nicht.«
»Meinst du etwa, daß ich mich auch in eine mundanische Frau verwandeln werde?« fragte sie, keineswegs unerfreut.
»Ich glaube schon. Es gibt ja eigentlich auch kaum Unterschiede zwischen einer Nymphe und –«
»Gewöhnlich lassen sie die Leute in Ruhe«, fuhr sie beunruhigt fort. Bevor Bink etwas sagen konnte, fügte sie hinzu: »Es sind ziemlich scheue Drachen.«
Ach so. Eine typisch nymphische Gedankenfolge. Bink behielt seine Hand am Schwertgriff. »Dies ist aber eine ungewöhnliche Situation.«
Tatsächlich griff die Schlange mit aufgesperrtem Maul an. Obwohl sie für einen Landdrachen relativ klein war, war sie immer noch ein beachtliches Tier. Ihr Kopf war etwas größer als Binks, und ihr Körper war sehnig und kräftig. Bink hatte nicht genügend Armfreiheit, um mit seinem Schwert voll ausholen zu können, deshalb hielt er es vorgestreckt.
Die Schlange biß nach der Klinge, was sehr dumm von ihr war, denn die verzauberte Klinge würde ihr mit großer Wahrscheinlichkeit das Maul zerreißen. Die Zähne schnappten zu – und die Klinge wurde Bink aus der Hand gerissen.
Da fiel es ihm wieder ein: Ohne Magie war der Zauber des Schwerts auch verschwunden. Er mußte es selbst zur Wirkung bringen, und zwar ganz und gar allein. Die Schlange schleuderte das Schwert beiseite und riß wieder das Maul auf. Ihre Unterlippe blutete. Die Klinge hatte sie also leicht verletzt, doch nun stand Bink dem Ungeheuer mit leeren Händen gegenüber.
Der Kopf stieß vor. Bink tänzelte zurück. Doch als der Vorstoß der Schlange ihn verfehlte und ihr Kopf sich senkte, hieb er ihr mit der Faust darauf. Das Ding zischte vor Wut und Verblüffung, als sein kinnloses Kinn gegen den Boden prallte. Doch Bink hatte bereits seinen Fuß auf den Schlangennacken gestemmt und hielt ihn unten. Mit scharrenden Beinen versuchte die Schlange sich loszureißen, doch Bink hatte sie säuberlich und sicher festgenagelt.
»Mein Schwert!« rief er. Hastig reichte Juwel es ihm, mit der Spitze zuerst. Bink griff bereits danach, als er es merkte. Beim Zurückweichen hätte er beinahe das Gleichgewicht und auch die Kontrolle über seinen Gegner verloren. »Andersrum!« fauchte er.
»Ach so.« Sie hatte nicht daran gedacht, daß er das Schwert am Griff packen mußte. Sie verstand überhaupt nichts von Waffen. Vorsichtig ergriff sie das Schwert an der Klinge und hielt es ihm entgegen.
Doch als er es packte, gelang es der Schlange, sich loszureißen. Bink sprang mit erhobenem Schwert einen Schritt zurück.
Das Ding hatte genug. Es wich unbeholfen zurück und verschwand seitlich in einem Loch. »Du bist aber tapfer!« sagte Juwel.
»Ich war dumm, mich von ihr entwaffnen zu lassen«, knurrte er. Er war überhaupt nicht stolz auf diese Begegnung. Er hatte durch und durch tapsig reagiert und überhaupt nicht elegant. Es war einfach ein dummes, sinnloses Handgemenge gewesen. »Gehen wir, bevor ich noch einen schlimmeren Fehler begehe. Ich habe dich aus deinem Heim verschleppt und werde dich auch wieder heil zurückbringen, bevor ich dich verlasse. Das ist nur recht und billig.«
»Recht und billig«, wiederholte sie leise.
»Stimmt irgendwas nicht?«
»Was soll ich denn machen, ohne Magie?« fragte sie wütend. »Jetzt wird nichts mehr klappen!«
Bink dachte nach. »Du hast recht. Ich habe dir deinen ganzen Lebensinhalt genommen. Ich nehme dich wohl besser an die Oberfläche mit.«
Sie sah ihn erfreut an, doch dann verdüsterte sich ihre Miene wieder. »Nein, das hat keinen Zweck.«
»Ist schon in Ordnung. Ich hab’ dir ja gesagt, daß der Trank nicht mehr wirkt. Ich liebe dich nicht und werde dich auch nicht belästigen. Du kannst dich in einem der Dörfer niederlassen oder vielleicht auch im Palast des Königs arbeiten. Ohne Magie wird es zwar nicht mehr besonders sein, aber schlimmer als hier unten kann es auch nicht werden.«
»Wer weiß«, murmelte sie.
Sie schritten weiter. Juwel kannte das Labyrinth der Höhlen recht gut, nachdem sie einmal aus den Dämonentiefen hervorgekommen waren, und führte sie stetig, wenn auch mit Umwegen, nach oben. Abgesehen von der unmittelbaren Umgebung des Dämonen war nicht viel zerstört, doch die Magie war überall verschwunden, so daß alle Wesen verrückt spielten. Ratten versuchten, ihn mit ihrer Nagemagie zu treffen, und als es ihnen nicht gelang, versuchten sie es mitihren Zähnen. Da sie ebensowenig Übung mit dem Gebrauch ihrer Zähne im Nahkampf hatten wie Bink mit dem Gebrauch eines entzauberten Schwerts, war der Kampf einigermaßen fair. Mit scharfen Schwerthieben trieb er sie zurück. Die Klinge mochte zwar nicht mehr magisch aufgeladen sein, aber ihre Schneide war noch immer sehr scharf und konnte durchaus verwunden und töten.
Doch es kostete viel Kraft, das Schwert zu schwingen, so daß sein Arm bald ermattete. Früher war das Schwert durch einen Zauber leichter gemacht worden und ließ sich auch müheloser führen. Die Ratten kamen wieder näher, hielten sich gerade außerhalb seiner Reichweite und versuchten seine Fußsohlen anzunagen, wenn er klettern mußte. Juwel erging es nicht besser: Sie besaß nicht einmal ein Messer und mußte sich Binks Messer ausleihen, um sich zu verteidigen. Ein Ungeheuer konnte man noch töten, aber diese Tiere hier schienen zahllos zu sein. Zum Glück waren es keine Nickelfüßler, aber sie erinnerten deutlich daran.
»Der Weg … er wird an manchen Stellen völlig finster sein«, sagte Juwel. »Daran habe ich nicht gedacht … ohne Magie gibt es natürlich kein magisches Licht. Ich fürchte mich vor der Dunkelheit.«
Bisher hatte es noch ein Restleuchten gegeben, aber das ließ bereits nach. Bink blickte die nahen Ratten an. »Aus gutem Grund«, meinte er. »Wir müssen wenigstens sehen können, wogegen wir kämpfen.« Ohne sein Talent fühlte er sich halbnackt, obwohl es ihn doch nur vor Magie schützte und jetzt völlig nutzlos gewesen wäre. Rein praktisch gesehen, hatte sich seine Lage nicht geändert, da er nicht mehr von Magie bedroht wurde. Das würde auch nie wieder vorkommen. »Feuer … wir brauchen Feuer, Licht. Fackeln … wenn wir Fackeln herstellen könnten …«
»Ich weiß, wo es Feuersteine gibt!« sagte Juwel. Doch dann besann sie sich wieder. »Aber ich glaube nicht, daß die ohne Magie funktionieren.«
»Weißt du, wo es trockenes Gras gibt … Stroh meine ich? Irgend etwas, das man zusammenwickeln und verbrennen kann? Und – aber ich weiß ja gar nicht, wie die Mundanier Feuer machen, deshalb –«
»Ich weiß, wo es magisches Feuer gibt –« Sie brach ab. »Oh, das ist ja wirklich schrecklich! Keine Magie …« Sie sah den Tränen nahe aus. Bink wußte, daß Nymphen keinen standfesten Charakter besaßen. Und doch hatte auch er geweint, als ihm zum ersten Mal klar geworden war, was er angerichtet hatte.
»Ich weiß!« rief Bink zu seiner eigenen Überraschung. »Da hat doch irgend etwas gebrannt … ich habe es vorhin gerochen. Wenn wir dorthin gingen –«
»Großartig!« rief sie erfreut.
Sie folgten ihrem Geruchsinn und waren schon bald am Ziel: ein offenbar von Kobolden angelegter magischer Garten, der nun verdorrt und braun war. Das tote Laub schwelte, und der Rauch erfüllte in mehreren Schichten den oberen Teil der Gartenhöhle. Die Kobolde hatten sich natürlich sogleich davongemacht. Sie hatten sich so sehr vor dem Feuer gefürchtet, daß sie nicht einmal den Versuch gemacht hatten, es zu löschen.
Bink und Juwel sammelten das bestmögliche Material, flochten es zu einem unregelmäßigen Seil und entzündeten ein Ende. Das Ding knisterte und flammte kurz auf, dann erlosch es mit furchtbar stinkendem Qualm. Doch nach mehreren Versuchen gelang es ihnen schließlich, es am Brennen zu halten. Es genügte, wenn es so lange schwelte, bis sie eine offene Flamme brauchten, was sie durch kräftiges Pusten mühelos erreichen konnten. Juwel trug das Seil, was ihr ein dringend notwendiges Gefühl der Sicherheit verlieh, während Bink so beide Hände für eventuelle Kämpfe freihielt.
Nun waren die Kobolde die schlimmsten Gegner. Offensichtlich waren sie wütend darüber, daß sie in ihren Garten eingedrungen waren. Jetzt, im Dunkeln, wurden sie frecher. Sie schienen eine Kreuzung von Menschen und Ratten zu sein. Nun, da die Magie verschwunden war, hatte auch ihre Menschenähnlichkeit nachgelassen, so daß der Rattenaspekt stärker zum Vorschein trat. Doch das mochte wohl vor allem an ihren Gewohnheiten liegen, dachte Bink. Körperlich glichen sie immer noch grobschlächtigen kleinen Männern mit großen weichen Füßen und kleinen harten Schädeln.
Das Problem bei Kobolden war, daß sie die Intelligenz von Menschen und die moralischen Skrupel von Ratten besaßen. Sie verschwanden einfach im Dunkeln, aber feige waren sie nicht. Es lag einfach daran, daß sie allein, zu dritt oder zu sechst gegen Binks Schwert nichts hätten ausrichten können, und für eine größere Zahl von Angreifern war die Höhle zu klein. Deshalb hielten sie sich fern – aber sie gaben nicht auf.
»Ich glaube, sie wissen, daß ich den Dämon befreit habe«, murmelte Bink. »Jetzt wollen sie Rache üben. Ich kann es ihnen nicht verdenken.«
»Du hast getan, was du für richtig gehalten hast!« sagte Juwel empört.
Er legte den Arm um ihre schlanke Hüfte. »Und du tust auch, was du für richtig hältst, indem du mir dabei hilfst, zur Oberfläche zurückzufinden – obwohl wir beide wissen, daß ich falsch gehandelt habe. Ich habe die Magie von Xanth zerstört.«
»Nein, du hast nicht falsch gehandelt«, sagte sie. »Du hast Mitleid für den Dämon gehabt und –«
Er drückte sie fester. »Danke, daß du das sagst. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich –« Er brach ab. »Ich hatte es ja ganz vergessen! Ich bin ja gar nicht mehr in dich verliebt!«
»Es macht mir auch so nichts aus«, meinte sie. Doch er nahm verlegen den Arm zurück. Er hörte das böse Kichern eines Kobolds, hob einen Stein und warf ihn nach dem Wesen. Aber er verfehlte es natürlich.
Bink sammelte eine Anzahl Steine und warf sie auf jeden Kobold, den er erblickte. Mit der Zeit wurde er immer treffsicherer, so daß die Kobolde weiter zurückwichen. Steine hatten eine ganz besondere Magie an sich, die mit echter Magie nichts zu tun hatte. Sie waren hart und scharf und zahlreich, und Bink konnte wesentlich besser zielen als jeder Kobold. Trotzdem gaben sie nicht auf. Beauregards Warnung war keine Übertreibung gewesen: Solch mutigen und zähen Kobolden war er noch nie zuvor begegnet.
Bink hätte gerne Rast gemacht, weil er sehr müde war, aber das konnte er nicht riskieren. Wenn er ruhte, könnte er einschlafen, und das wiederum könnte zu einer Katastrophe führen. Natürlich hätte Juwel solange Wache halten können, aber sie war schließlich nur eine Nymphe oder, genauer, eine junge Frau, und er fürchtete, daß die Kobolde sie überrumpeln würden. In den Händen der Kobolde drohte ihr ein noch wesentlich schlimmeres Schicksal als ihm.
Verstohlen blickte er sie an. Dieser harte Marsch forderte bereits seine Opfer. Ihr Haar hatte seinen ursprünglichen Schimmer verloren und hing in glanzlosen Strähnen herab. Sie erinnerte ihn irgendwie an Chamäleon – aber nicht in ihrer Schönheitsphase.
Langsam kamen sie voran. Als sie sich der Oberfläche näherten, wurde der Anstieg immer beschwerlicher. »Mit der Oberwelt gibt es kaum Verbindung«, sagte Juwel keuchend. »Das hier ist der beste Weg, aber wie man ihn ohne Flügel oder Seile bezwingt, weiß ich auch nicht.«
Bink wußte es auch nicht. Wenn dies ein geeigneter Weg gewesen wäre, hätte Crombies Talent ihn beim Einstieg angezeigt. Durch einen Riß im Boden über ihren Köpfen war der Tageshimmel zu erkennen, doch die Wände ragten steil von unten nach oben und waren feucht und glitschig. Ohne Magie war es unmöglich, hier hochzuklettern.
»Wir können hier nicht lange bleiben«, sagte Juwel beunruhigt. »Vor dem Eingang steht ein Gewirrbaum, und seine Wurzeln können ziemlich zornig werden.« Erschrocken hielt sie inne. »Immer der gleiche Fehler! Ohne Magie –«
Deshalb hatte Crombie diesen Weg also auch nicht angezeigt. Ein Greifer! Aber die böse Magie war nun zusammen mit der guten verschwunden. »Los!« rief er.
Er entdeckte die Wurzeln des Greifers und riß sie aus dem Gestein. Dort, wo sie sich nicht mühelos herausreißen ließen, schnitt er sie ab. Schnell verknüpfte er sie zu einem kräftigen, wenn auch zottigen Seil. Greiferwurzeln waren belastbar, denn sie dienten dazu, ihre um sich schlagenden Opfer schnell auszuschalten. Keine Frage: Dieses Seil würde sein Gewicht mit Sicherheit halten!
»Aber wie bekommen wir es oben fest?« fragte Juwel ängstlich.
»Da oben ist ein großer Wurzelstamm, der die schmalste Stelle kreuzt«, sagte Bink.
Sie blickte empor. »Der ist mir ja noch nie aufgefallen, obwohl ich schon oft hier war, um den Greifer zu ärgern und um davon zu träumen, wie er wohl auf der Oberfläche aussieht. Du hast wirklich eine gute Beobachtungsgabe.«
»Und du machst wirklich nette Komplimente. Diesmal wirst du die Welt auf der Oberfläche sehen. Ich werde dich erst verlassen, wenn du in sicheren Händen bist. Vielleicht im Dorf des Magischen Staubes.«
Sie wandte wortlos den Blick ab. Besorgt blickte er sie durch den Rauch des glimmenden Krautseils an. »Was ist? Habe ich etwas Verkehrtes gesagt?«
Sie blickte ihn mit plötzlicher Entschiedenheit an. »Bink, erinnerst du dich an unsere erste Begegnung?«
Er lachte. »Als ob ich die vergessen könnte! Du warst so schön und verschmiert, fast so verschmiert, wie wir es jetzt beide sind! Und ich hatte gerade den Trank –« Achselzuckend brach er ab, weil er nicht schon wieder über diesen peinlichen Vorfall reden wollte. »Weißt du, fast tut es mir leid, daß es jetzt vorbei ist. Du bist wirklich eine schrecklich liebe Nymphe, und ohne deine Hilfe –«
»Damals hast du mich geliebt und ich dich nicht«, sagte sie. »Du warst gerissen, und ich war dumm. Du hast mich angelockt, mich gepackt und geküßt.«
Bink scharrte unruhig mit den Füßen. »Es tut mir leid, Juwel. Ich … es wird nicht wieder vorkommen.«
»Das glaubst du!« sagte sie, warf die Arme um seinen Hals und gab ihm einen Kuß auf den halb geöffneten Mund. So schmutzig sie auch war, war es doch eine bemerkenswerte Erfahrung, und fast glaubte er den Zwang des Liebestranks wieder zu spüren. Vorher hatte er sie geliebt, ohne sie zu kennen. Nun kannte er sie und verstand ihre nymphische Beschränkung und achtete sie dafür, daß sie so angestrengt versuchte, über ihren eigenen Schatten zu springen. Und er mochte sie mehr, als schicklich war. Unter der künstlichen Liebe hatte sich eine echte Zuneigung entwickelt, und diese Zuneigung hatte Bestand. Was würde Chamäleon wohl denken, wenn sie diese Umarmung gesehen hätte?
Juwel ließ ihn wieder los. »So dreht sich das Karussell«, sagte sie. »Ich bin komplizierter als noch vor ein paar Stunden, und du bist simpler geworden. Und jetzt mach, daß du raufkommst!«
Was sie wohl damit meinte? Verwundert beschwerte Bink das Seil mit einem großen Stein und warf es in Richtung Wurzelstamm. Er verfehlte sein Ziel, weil das Seil so schwer war. Er versuchte es erneut, doch immer noch war das Seil zu schwer. Schließlich machte er aus dem Seil ein Knäuel, das er emporwarf. Es fiel wieder herunter – ohne über die Wurzel gefallen zu sein. Doch das war schon ein Fortschritt, und nach mehreren Versuchen hatte er endlich Erfolg. Der Stein fiel herab und riß das Seil mit sich, es verhakte sich, doch mit einem scharfen Ruck hatte Bink schließlich auch diese Schwierigkeit überwunden. Dann knotete er die beiden Enden zusammen und erhielt so eine Schlaufe, die klettersicher war.
»Ich werde zuerst emporklettern, dann kannst du dich in die Schlaufe setzen, und ich ziehe dich hoch«, sagte er. Er wußte, daß sie zu schwach war, um aus eigener Kraft emporzuklettern.
»Laß die Fackel hoch aufflackern, damit die Kobolde fernbleiben.«
Sie nickte. Bink atmete mehrmals tief durch und merkte, wie dies seinem ermüdeten Körper neue Kräfte zuführte. Dann packte er das Seil und begann mit dem Aufstieg.
Der Anfang war angenehmer, als er erwartet hatte, doch schon bald wurde es wesentlich schlimmer. Seine ohnehin schon müden Arme erlahmten sehr schnell. Er umklammerte das Seil mit beiden Beinen, um seine Arme auszuruhen, die sich auch zögernd erholten. Wenn er jetzt doch etwas Heilelixier gehabt hätte! Aber Juwel wartete – genau wie die Ratten und Kobolde. Er durfte keine Zeit verschwenden. Mit immer kleiner werdenden Klimmzügen zog er sich mühsam empor. Sein Atem ging schwer, und seine Arme fühlten sich an wie mit Wasser vollgesogene Holzstämme, doch er gab nicht auf.
Plötzlich – es war wie ein Wunder – war er oben. Vielleicht war sein Verstand von der unablässigen Anstrengung auch etwas abgestumpft und erwachte nun zu neuem Leben. Er umklammerte die große, etwas pelzige Wurzel. Nie hätte er sich träumen lassen, daß er einmal froh sein würde, einen Gewirrbaum umarmen zu dürfen!
Er warf ein Bein hoch, verfehlte sein Ziel, merkte, wie er stürzte. Fast eine Erleichterung, dieser freie Fall! Doch das Seil war auch noch da, und er umschlang es keuchend. Nur noch eine kurze Strecke, und doch – was für eine Anstrengung!
Oben an der Spitze befand sich ein Knoten. Bink stemmte die Beine dagegen, um sich mit seinen relativ erholten Beinmuskeln emporzustemmen. Irgendwie gelang es ihm, um die Wurzeln herumzuklettern. Jetzt sah er, daß sich unter der pelzigen Schicht rauhe Rinde verbarg, an der man sich gut festhalten konnte. Er packte zu und gelangte schließlich auf die Oberseite, wo er ermattet nach Luft japste. Er war sogar zu erschöpft, um erleichtert zu sein.
»Bink!« rief Juwel von unten. »Bist du in Ordnung?«
Das rüttelte ihn auf. Seine Arbeit war noch lange nicht zu Ende!
»Das sollte ich eigentlich dich fragen! Halten die Ratten sich zurück? Kannst du dich in die Schlaufe setzen, damit ich dich hochziehe?« Er wußte zwar nicht, wie er das in seinem gegenwärtigen Zustand schaffen wollte, aber das konnte er ihr schlecht sagen.
»Ich bin nicht in Ordnung. Ich komme nicht mit hoch.«
»Juwel! Pack endlich das Seil! Wenn du das andere Ende hinter dir hochziehst, können die Ratten dich nicht erreichen!«
»Es sind nicht die Ratten, Bink. Ich habe mein ganzes Leben hier unten gelebt. Ich kann mit Ratten umgehen und zur Not sogar mit Kobolden, solange ich mein Licht habe. Du bist das Problem. Du bist ein attraktiver Mann.«
»Ich? Das verstehe ich nicht.« Doch das stimmte nicht ganz: Sie meinte keineswegs seine derzeitige Verfassung, in der er sicherlich noch häßlicher sein mußte als Chesters Gesicht (ach, der edle Zentaur – in welchem Zustand mochte er sich wohl befinden?). Die Zeichen waren deutlich genug gewesen, er hatte sich einfach nur geweigert, sie wahrzunehmen.
»Als du den Liebestrank eingenommen hast, da bist du ein ehrlicher Mensch geblieben«, rief Juwel ihm zu. »Du warst stark, stärker als jede Nymphe es sein kann. Du hast den Trank niemals als Entschuldigung benutzt, um deine Suche abzubrechen oder deine Freunde zu verraten. Ich habe diese Ehrlichkeit bewundert und versucht, ihr nachzueifern. Die einzige Ausnahme war der Kuß, den du gestohlen hast, und den habe ich mir zurückgeholt. Ich liebe dich, Bink, und jetzt – «
»Aber du hast doch nie von diesem Trank getrunken!« protestierte er. »Und selbst wenn, die Magie ist doch verschwunden –«
»Nein, ich habe nie davon getrunken«, stimmte sie ihm zu. »Deshalb konnte der Verlust der Magie mir auch nicht meine Liebe nehmen. Ich wurde gezwungen, aus meiner nymphischen Unschuld herauszuwachsen. Jetzt sehe ich, wie die Dinge wirklich sind, und ich weiß, daß es für mich kein Gegenmittel gibt außer der Zeit. Ich kann nicht mit dir kommen.«
»Aber da unten gibt es doch kein Leben für dich!« rief Bink erschüttert. Seine Liebe zu ihr war magischer Art gewesen, doch ihre zu ihm war wirklich. Ihre Liebe war besser, als die seine je gewesen war. In der Tat, ihre Nymphenzeit war wohl vorbei.
»Irgendwie muß sich doch eine Lösung finden –«
»Die gibt es auch, und ich werde sie wählen. Als ich sah, wie du mich opfertest, als der Zauber auf dir lag, wußte ich, daß es völlig hoffnungslos sein würde, wenn alles vorbei wäre. Es ist eine Ironie des Schicksals, daß meine Liebe zu dir nur dann erblüht ist, als du mich aufgegeben hast, eben weil du es getan hast. Denn du bist dabei deinen Prinzipien und deinen früheren Verpflichtungen treu geblieben. Das werde ich nun auch tun. Lebwohl, Bink!«
»Nein, nicht!« rief er. »Komm da unten raus! Es muß noch eine bessere Möglichkeit geben –«
Doch da rutschte das Seil bereits herunter und glitt über die Wurzeln hinweg. Sie hatte die Schlaufe unten wieder aufgeknüpft und zog das Seil nun in die Tiefe. Er wollte danach greifen – zu spät. Das Ende des Seils glitt über die Wurzel und fiel in die Dunkelheit hinab.
»Juwel!« schrie er. »Tu das nicht! Ich liebe dich zwar nicht, aber ich mag dich doch. Ich –« Aber das war eine Sackgasse. Sie hatte recht: Selbst als er sie geliebt hatte, hatte er gewußt, daß er sie nie besitzen würde. Und daran hatte sich nichts geändert.
Er erhielt keine Antwort aus der Tiefe. Die Nymphe hatte sich für den ehrenhaften Weg entschieden und war allein davongegangen, hatte ihn freigegeben. Er hätte an ihrer Stelle ebenso gehandelt.
Es blieb ihm nichts mehr übrig, als nach Hause zurückzukehren. »Lebwohl, Juwel!« rief er und hoffte, daß sie ihn noch hören konnte. »Du hast zwar nicht meine Liebe, aber meine Achtung. Du bist eine Frau geworden.«
Er hielt inne und lauschte, doch es war nichts mehr zu hören. Schließlich erhob er sich von der Wurzel und blickte sich um. Er befand sich in einer tiefen Erdspalte, die er nun als Teil der großen Spalte erkannte, die das Land Xanth in zwei Hälften teilte. Der Baum war unten in der Spalte verwurzelt, reichte aber bis an die Oberkante, und einer seiner Zweige wuchs über den Rand der Schlucht hinaus. Ohne Magie konnte man gefahrlos an ihm emporklettern. Das ganze Gebiet war jetzt frei von magischen Bedrohungen. Jetzt konnte er in einem Tag den Palast des Königs erreichen.
Er erblickte einige Käfer, die mit zuckenden Scheren in der Sonne lagen. Mitleidig schob er sie sanft mit dem Fuß in den Schatten. Arme kleine Dinger!
Da erkannte er sie. Das waren ja Nickelfüßler, ihrer Magie beraubt! Wie tief sie gefallen waren!
Doch als er sich vom letzten Greifarm des Gewirrbaums auf die Oberfläche schwang, mußte er feststellen, daß sie ihm unvertraut war. Die Spalte verlief in Nord-Süd-Richtung, es sei denn, der Verlust der Magie hatte irgendwie die Sonnenbahn umgekehrt. Das mußte eine andere Schlucht sein, nicht die Spalte. Also hatte er sich doch verlaufen.
Als er darüber nachdachte, kam er zu dem Schluß, daß er sich wahrscheinlich südlich der Spalte befand, also auch südlich des Palastes. Deshalb war es wohl das beste, sich in nördlicher Richtung in Bewegung zu setzen, bis er an die Spalte oder ein anderes bekanntes Landschaftsmerkmal gelangte.
Die Reise war schwieriger als erwartet. Zwar gab es keinerlei feindliche, hindernde Magie, aber eben auch keine freundliche, fördernde Magie. Die Landschaft hatte sich grundlegend verändert und war mundanisch geworden. Es gab weder fliegendes Obst noch Schuhbäume oder Jeansbüsche, so daß er seine zerlumpte Kleidung nicht erneuern konnte. Auch Wassermelonen zum Trinken waren nicht zu sehen, so daß er sich nach gewöhnlicher Nahrung und nach gewöhnlichem Wasser umsehen mußte. Und dabei wußte er kaum, wonach er Ausschau halten sollte. Die Tiere, vom Verlust ihrer Magie wie betäubt, mieden ihn. Sie waren nicht so klug zu begreifen, daß er ja auch seiner Magie entledigt worden war. Das war ein echter Segen.
Es war später Nachmittag. Er wußte nicht, wie viele Stunden oder gar Tage er unter der Oberfläche verbracht hatte, doch hier konnte er sich wenigstens am Lauf der Sonne orientieren. Er würde die Nacht im Wald verbringen müssen. Das war offenbar ungefährlich. Er konnte ja auf einen Baum steigen.
Er hielt Ausschau nach einem geeigneten Baum. Viele der Bäume dieses Waldes schienen abgestorben zu sein. Vielleicht schliefen sie auch nur in diesem Winter der fehlenden Magie. Es würde möglicherweise Monate oder sogar Jahre dauern, bis man das volle Ausmaß dieses Winters erkannte. Einige der Bäume gediehen gut. Das mußten mundanische Arten sein, die nun in keinem Konkurrenzkampf mit der Magie mehr standen.
War es besser, auf einen gesunden mundanischen oder auf einen abgestorbenen magischen Baum zu steigen?
Bink zitterte. Es wurde langsam kühl, und er konnte keine Deckenbüsche ausmachen. Doch es war nicht nur die Kälte, die ihn erschauern ließ. Er war müde und einsam und voller Reue. Morgen würde er seinen Freunden im Palast gegenübertreten müssen, um ihnen zu gestehen –
Doch bestimmt ahnten sie bereits, daß alles seine Schuld war. Nicht die Beichte machte ihm Sorgen, sondern die Strafe. Juwel war klug genug gewesen, ihn zu meiden: Zu Hause stand ihm keine Zukunft mehr offen.
Die Gegend kam ihm entfernt vertraut vor. Durchs Unterholz führten Pfade wie von Ameisenlöwen und –
»Das ist es!« rief er plötzlich. »Hier sind wir auf den magischen Pfad zum Dorf des Magischen Staubes gekommen!«
Er spähte durch das schüttere Laubwerk über seinem Kopf. Da war er ja: ein Pfad aus Stämmen und Schlingpflanzen, der von den strammsten Ästen herabhing. Er führte zwar nicht in Loopings durch die Luft, aber schließlich war er ja auch nicht mehr magisch.
Er kletterte an der niedrigsten Stelle empor und betrat den Hängepfad. Das Ding wirkte gefährlich und unsicher, sackte unter seinem Gewicht nach unten und schwang bedrohlich hin und her, brach aber nicht durch. So gelangte er schließlich zum Dorf.
Er hatte eine Szene der Niedergeschlagenheit erwartet, doch statt dessen schien das ganze Dorf fröhlich zu feiern. Wieder loderte ein großes Freudenfeuer, Männer und Frauen aller Art tanzten drumherum.
Männer? Wie waren die denn hierhergekommen? Das hier war doch ein Frauendorf!
Bink schritt auf die Gruppe zu und suchte nach Trolla, der Anführerin.
Ein Mann erblickte ihn, als er eben vom Hängepfad herunterstieg. »Hallo, Freund!« rief der Mann. »Willkommen daheim! Wer ist denn deine Witwe?«
»Witwe?« fragte Bink verständnislos.
»Deine Frau – bevor die Gorgone dich erwischt hat. Sie wird froh sein, dich wiederzusehen.«
Die Gorgone! Plötzlich begriff Bink, was gemeint war. »Ihr seid die Steinmänner! Befreit durch den Verlust der Magie!«
»Ja, du denn nicht?« Der Mann lachte. »Dann sprichst du wohl besser mit dem Chef.«
»Trolla«, sagte Bink. »Wenn sie noch hier sein sollte …«
»Wer fragt da nach Trolla?« fragte ein riesiger, häßlicher Troll. Na ja, ein durchschnittlicher Troll. Riesig und häßlich waren sie ja alle.
Binks Hand schwebte über seinem Schwertgriff. »Ich will nur mit ihr sprechen.«
»Schon gut«, sagte der Troll gutgelaunt. Er legte die Hände trichterförmig an den Mund. »He, du Aas, komm rüber!«
Ein Dutzend junger Frauen blickte erstaunt zu ihm herüber. Offenbar dachten sie, daß er sie gemeint habe. Bink mußte ein Lächeln unterdrücken. »Äh, die Gorgone«, sagte er. »Was ist denn aus der geworden?«
»Och, wir wollten sie ja aufknüpfen, nachdem wir, na, du weißt schon …« sagte der Troll. »Sie sah ja gar nicht so schlecht aus, die Schlampe, bis auf diese Schlangenlocken. Aber sie ist in den See gehüpft, und bevor wir begriffen hatten, daß da keine Ungeheuer mehr drin waren, hatte sie schon zu viel Vorsprung. Als wir sie zuletzt gesehen haben, lief sie in Richtung Norden.«
Richtung Norden. Also zum Schloß des Magiers Humfrey. Bink war zwar froh, daß sie entkommen war, wußte aber, daß sie den Magier dort nicht auffinden würde.
Trolla kam freudig auf Bink zu.
»Bink! Du hast es geschafft!«
»Ja, ich hab’s geschafft!« erwiderte er ernst. »Ich habe es geschafft, die Magie von Xanth zu vernichten. Ich habe das Land in Mundania verwandelt. Jetzt komme ich zurück, um den Preis dafür zu zahlen.«
»Den Preis!« rief der Troll. »Du hast uns alle befreit! Du bist ein Held!«
So hatte Bink die Sache noch gar nicht betrachtet. »Dann seid ihr gar nicht böse über den Verlust der Magie?«
»Böse?« rief Trolla ungläubig. »Böse, daß mein Mann wieder zurück ist? Wie zum Anbeißen?« Sie umarmte den Troll mit einer Heftigkeit, die jedem normalen Mann die Rippen zerdrückt hätte.
Ein weiblicher Greif kam auf sie zugeflogen. »Aak?« fragte sie.
»Und hier ist die Greifin, die euch geführt hat, vom Midas Zauber befreit«, sagte Trolla. »Wo ist denn euer prächtiger Greif abgeblieben?«
Bink hielt es für klüger, nichts von der Flasche zu erzählen. »Er ist … verhindert. Er war ja eigentlich ein verwandelter Mann. Er hat nett über die Greifendame gesprochen, bittet aber … ihn zu entschuldigen.«
Die Greifin wandte sich enttäuscht ab. Offenbar hatte sie keinen männlichen Partner.
»Komm, wir werden dich heute abend königlich feiern«, lenkte Trolla ab. »Dann kannst du uns alles erzählen.«
»Ich, äh, ich bin ziemlich müde«, wehrte Bink ab. »Mir wäre es lieber, nicht alles erzählen zu müssen. Mein Freund, der Gute Magier, wird … vermißt, ebenso der Zentaur, und die Erinnerungen würden –«
»Ja, du mußt dich ablenken«, meinte Trolla. »Wir haben noch ein paar übriggebliebene Frauen, Töchter der älteren Dorfbewohnerinnen. Sie fühlen sich sehr einsam und –«
»Ich, äh, nein danke«, sagte Bink schnell. Er hatte schon viel zu viele gebrochene Herzen auf dem Gewissen. »Nur etwas zu essen vielleicht und ein Nachtlager, falls ihr Platz haben solltet …«
»Platz ist bei uns im Augenblick Mangelware, denn unsere Bevölkerung hat sich verdoppelt. Aber die Mädchen werden sich schon um dich kümmern, dann haben sie etwas zu tun. Sie werden gern ihr Zimmer mit dir teilen.«
Bink war zu müde, um weitere Einwände vorzubringen. Doch die »Mädchen« erwiesen sich als Feen und Elfen, die sich zwar in schmeichelhafter Weise um ihn sorgten, sich für ihn als Mann jedoch nicht wirklich interessierten. Sie machten sich ein Spiel daraus, ihm dieses und jenes zu holen und ihn Happen um Happen abwechselnd zu füttern und dabei fröhlich zu schnattern und zu kichern. Sie gestatteten ihm keinen Teller. Alles mußte, Bissen um Bissen, aus dem Nebenzimmer geholt werden. Dann betteten sie ihn auf dreißig kleine bunte Kissen und schwirrten um ihn herum, um ihm mit ihren glänzenden Flügeln Luft zuzufächeln. Natürlich konnten sie nicht mehr fliegen, da ihre Magie verschwunden war, und schon bald würden ihre Schwingen abfallen, wenn sie sich in mundanische Wesen verwandelten, doch im Augenblick sahen sie wirklich sehr anmutig aus. Er schlief dabei ein, als er die Wesen zählte, die fröhlich über ihn hinwegsprangen.
Doch am Morgen hatte ihn die traurige Wirklichkeit wieder eingeholt: nun ging es nach Hause. Er war froh, daß seine Suche wenigstens ein bißchen Gutes bewirkt hatte. Vielleicht hatte sein Talent das vor seinem Verschwinden noch so eingerichtet, daß er wenigstens in der ersten Nacht ein gutes, sicheres Lager fand. Aber was den Rest von Xanth anging – welche Hoffnung blieb da noch?
Die Greifin begleitete ihn ein Stückchen, und in verblüffend kurzer Zeit fand er sich am toten Wald wieder: ein einigermaßen vertrautes Gebiet. Er dankte ihr, wünschte ihr noch alles Gute und schritt weiter, Richtung Norden.
Nun packte ihn die Einsamkeit. Der Mangel an Magie war so total und deprimierend! Alle kleinen Annehmlichkeiten waren verschwunden. Es gab keine Pfeifenwinden mehr, die ihren gewundenen Rauch von sich gaben. Kein Baum wich ihm mit seinen Ästen mehr aus oder verhängte einen Ausweichzauber. Alles war hoffnungslos mundanisch geworden. Wieder fühlte er sich müde, aber nicht nur vom Wandern. War das Leben ohne Magie eigentlich überhaupt noch lebenswert?
Nun, Chamäleon würde jetzt in ihrer ›normalen‹ Phase steckenbleiben, die ihm am besten gefiel: weder schön noch klug, aber alles in allem sehr nett. Ja, damit würde er wohl eine Weile leben können, bis es langweilig würde, immer vorausgesetzt, daß man ihm überhaupt gestatten würde –
Er blieb plötzlich stehen. Er hörte Getrappel wie von Hufen auf einem Trampelpfad. Ein Feind? Es war ihm fast egal – Hauptsache Gesellschaft!
»Haaalloooo!« rief er.
»Ja?« Es war eine Frauenstimme. Er lief darauf zu.
Vor ihm stand eine Zentaurin auf dem Pfad. Sie war nicht sonderlich hübsch. Ihre Flanken waren matt, ihr Schweif war voller Zecken (eine Dame konnte sie natürlich nicht fortfluchen), und ihr menschlicher Oberkörper und ihr Gesicht waren zwar offensichtlich recht weiblich, aber nicht besonders gut proportioniert. Ein Fohlen folgte ihr, und das war nicht nur unattraktiv, sondern regelrecht häßlich, wenn man von seinem glatten Hinterteil einmal absah. Eigentlich glich es –
»Chester!« rief Bink. »Das ist Chesters Fohlen!«
»He, du bist ja Bink!« erwiderte die Zentaurin. Doch sie glich in keiner Weise der Schönheit, auf deren Rücken er einmal geritten war. Was war nur geschehen?
Aber er war geistesgegenwärtig genug, sich unverbindlich zu äußern. »Was tust du denn hier? Ich dachte, du wolltest im Zentaurendorf bleiben, bis –« Doch das war schon wieder eine Falle, denn Chester würde nie wieder zurückkehren.
»Ich trabe zum Palast, um herauszufinden, wodurch das Wunder bewirkt wurde«, sagte sie. »Ist dir bewußt, daß die Obszönität aus Xanth verbannt worden ist?«
Blink erinnerte sich, daß Cherie Magie für obszön hielt, zumindest, wenn sie sich bei Zentauren zeigte. Bei anderen duldete sie sie zwar als notwendiges Übel, weil sie sich für liberal hielt, aber sie zog es vor, sie nur in klinischem Ton zu diskutieren.
Nun, da hatte er etwas beizusteuern! Er war froh, daß der Wandel wenigstens einer Person zusagte. »Ich fürchte, daß ich
dafür verantwortlich bin.«
»Du hast die Magie abgeschafft?« fragte sie erstaunt.
»Das ist eine lange Geschichte«, sagte Bink. »Und eine schmerzliche. Ich erwarte nicht, daß andere sie ebenso leicht hinnehmen werden wie du.«
»Steig auf«, sagte sie. »Du bist zu langsam zu Fuß. Ich bringe dich zum Palast, und du kannst mir die ganze Geschichte erzählen. Die Neugier bringt mich ja fast um!«
Es konnte durchaus sein, daß es die Geschichte war, die sie tatsächlich umbringen würde, wenn sie nämlich die Wahrheit über Chester erfuhr. Aber er mußte es ihr sagen. Also stieg er auf und klammerte sich fest, während sie lostrabte. Er hatte sich schon auf einen tagelangen Marsch eingestellt, doch das war jetzt wohl nicht mehr nötig. Sie würden noch vor Nachteinbruch am Palast ankommen.
Dann berichtete er von seinen Erlebnissen. Er ertappte sich dabei, wie er versehentlich mehr Einzelheiten erzählte, als wirklich nötig gewesen wäre, und er merkte, daß er das nur tat, weil er sich vor der Enthüllung fürchtete – wie Chester seinen schrecklichen Kampf verloren hatte. Sicher, er hätte wohl gewonnen, wenn der Böse Blick, der eigentlich Bink hätte treffen sollen, ihn nicht gelähmt hätte, aber das würde sie wohl kaum trösten. Cherie war jetzt eine Witwe, und er war es, der es ihr beibringen mußte …
Da unterbrach ein Schrei seinen Bericht. Ein Drache erschien – aber was war das doch für ein erbärmliches Ungeheuer! Die einst so glänzenden Schuppen hatten eine fleckiggraue Färbung angenommen, und als er Feuer schnauben wollte, kam lediglich Staub hervor. Das Tier sah bereits abgemagert und kränklich aus. Er war von Magie abhängig, wenn er auf die Jagd gehen wollte.
Dennoch griff der Drache sie an, entschlossen, die Zentaurin samt Reiter und Fohlen zu vertilgen. Bink zückte sein Schwert, und Cherie trabte tänzelnd weiter, bereit, sich sofort mit einem heftigen Tritt zu verteidigen. Selbst ein abgekämpfter Drache dieser Größe stellte noch eine große Gefahr dar.
Da erblickte Bink eine Narbe am Hals des Drachen. »He, kennen wir uns nicht?« rief er. Der Drache hielt inne. Dann hob er den Kopf als Zeichen des Wiedererkennens.
»Chester, Crombie und ich sind diesem Drachen begegnet und haben mit ihm einen Pakt geschlossen«, sagte Bink. »Wir haben gemeinsam gegen die Nickelfüßler gekämpft.«
»Die Nickelfüßler sind jetzt harmlos«, sagte Cherie. »Ihre Scheren besitzen keine –« Sie schürzte angewidert die Lippen. »… Magie mehr. Ich bin direkt in die Spalte getrabt und habe auf ihnen herumgetrampelt. Sie konnten mir nichts anhaben.«
»Drache, die Magie ist aus Xanth verschwunden«, sagte Bink. »Du mußt jetzt lernen, ohne dein Feuer zu jagen und zu kämpfen. Nach und nach wird deine stärkste mundanische Eigenart zum Tragen kommen und sich herauskristallisieren, vielleicht auch erst bei deinen Nachkommen. Ich schätze, das dürfte eine große Schlange ergeben. Es tut mir leid.«
Der Drache starrte ihn entsetzt an. Dann wirbelte er herum und eilte, halb galoppierend, halb gleitend davon.
»Mir tut es auch leid«, meinte Cherie. »Ich merke gerade erst, daß Xanth ohne Magie nicht mehr dasselbe ist. Zauber haben durchaus ihren Platz. Für Wesen wie dieses da … ist die Magie völlig natürlich.« Für ihre Verhältnisse war das ein beachtliches Zugeständnis.
Bink fuhr mit seinem Bericht fort. Nun konnte er sich nicht länger drücken und sagte ihr, was er sagen mußte. »Und so habe ich Crombie in seiner Flasche dabei«, schloß er. Und wartete ab und spürte, wie sich ihr Körper versteifte.
»Aber Chester und Humfrey –«
»Sind unten geblieben«, sagte er. »Weil ich den Dämon freigelassen habe.«
»Aber du weißt doch gar nicht, ob sie tot sind«, sagte sie, und ihre Muskeln waren derart angespannt, daß das Reiten richtig unbequem wurde. »Man wird sie suchen und zurückbringen –«
»Ich weiß nicht«, erwiderte Bink trübe. Diese Entwicklung des Gesprächs gefiel ihm überhaupt nicht.
»Humfrey hat sich wahrscheinlich bloß verirrt. Deshalb hast du ihn auch nicht gefunden. Er war vom Höhleneinbruch wahrscheinlich völlig durcheinander. Ohne seine Wissensmagie könnte man ihn mit einem Kobold verwechseln. Und Chester … der ist viel zu zäh, um … um … er ist einfach nur konserviert. Du hast doch selbst gesagt, daß das ein Einmachsee war –«
»Ja, das stimmt«, gab Bink zu. »Ich … aber er war so weit ausgelaufen, daß ich die Windungen der Gehirnkoralle erkennen konnte.«
»Aber er ist nicht ganz ausgelaufen! Er ist immer noch da unten, ganz in der Tiefe, wie der Greif in der Flasche, das weiß ich genau. Wir können ihn suchen und wiederbeleben –«
Bink schüttelte den Kopf. »Nicht ohne Magie.«
Sie warf ihn ab. Bink flog durch die Luft und sah, wie der Boden auf seinen Kopf zustürzte, wußte, daß sein Talent nichts mehr würde dagegen tun können – und landete in Cheries Armen. Sie war im letzten Augenblick hinter ihm her gesprungen, um ihn aufzufangen. »Tut mir leid, Bink. Es ist nur … ja, ja, Obszönität stört mich einfach. Zentauren haben keine …« Sie stellte ihn wieder auf die Füße, ohne ihren Satz zu Ende zu führen. Sie mochte vielleicht nicht mehr schön sein, aber Zentaurenkräfte besaß sie immer noch.
Stark, aber nicht schön. Zur Zeit der Magie hatte sie wunderschöne Brüste besessen. Jetzt war sie zwar immer noch üppig, aber doch etwas hängebrüstig, wie die meisten menschlichen und humanoiden Frauen ähnlichen Umfangs. Ihr Gesicht war früher herzerfrischend keck gewesen, doch nun wirkte es nur noch durchschnittlich. Woran konnte dieser rapide Wandel wohl liegen? Doch wohl nur am Verlust der Magie.
»Ich will mal eins klären«, sagte Bink. »Du meinst also, daß jede Magie obszön ist –«
»Nicht jede Magie, Bink! Für einige von euch scheint sie ganz natürlich zu sein – aber ihr seid ja nur Menschen. Bei einem Zentauren ist das etwas anderes. Wir sind zivilisiert.«
»Angenommen, daß Zentauren auch Magie besäßen?«
Sie blickte ihn mit beherrschtem Ekel an. »Es ist wohl besser, wenn wir uns auf den Weg machen, damit es nicht zu spät wird. Es ist noch ein gutes Stück.«
»So wie Herman der Einsiedler, Chesters Onkel«, beharrte Bink. »Er konnte doch Irrlichter herbeirufen.«
»Er ist aus unserer Gemeinschaft verbannt worden«, sagte sie. Sie hatte einen mürrischen Ausdruck, der ihn an Chester
erinnerte.
»Angenommen, andere Zentauren besäßen auch Magie –«
»Bink, warum bist du so eklig? Willst du etwa, daß ich dich allein in der Wildnis zurücklasse?« Sie winkte ihrem Fohlen, das schnell an ihre Seite trabte.
»Angenommen, du besäßest selbst ein magisches Talent?« fragte er. »Würdest du das dann immer noch obszön finden?«
»Das reicht!« schnaubte sie. »Ich dulde kein solch widerliches Verhalten, nicht einmal von einem Menschen. Komm, Chet.« Und sie machte sich auf den Weg.
»Verdammt, Mähre, hör mir doch mal zu!« schrie Bink. »Weißt du, weshalb Chester mich auf meiner Suche begleitet hat? Weil er sein magisches Talent entdecken wollte. Wenn du die Magie bei Zentauren ablehnst, dann lehnst du auch Chester ab … denn er besitzt Magie, gute Magie, die –«
Sie wirbelte herum und hob die Vorderhufe, um ihn niederzutrampeln.
Bink wich tänzelnd zurück. »Gute Magie«, wiederholte er. »Nicht so was Dummes, wie grüne Blätter purpurn zu färben, oder so was Negatives wie anderen Leuten heiße Fußsohlen anzuhexen. Er spielt eine magische Flöte, eine silberne Flöte, die schönste Musik, die ich je gehört habe. Tief in seinem Inneren hat er ein unwahrscheinlich schönes Wesen, aber er hat es unterdrücken müssen, weil –«
»Ich werde dich flachtrampeln!« wieherte sie und hieb mit ihren Vorderhufen nach ihm. »Du hast nicht das geringste Recht, auch nur anzudeuten –«
Doch er war jetzt ganz kühl und sachlich, während sie blind vor Wut war. Er wich ihren Tritten aus, wie er einem wilden Einhorn ausgewichen wäre, ohne ihr den Rücken zuzuwenden oder weiter zurückzutreten als absolut erforderlich. Er hätte sie ein halbes Dutzend Male mühelos abstechen können, doch er hatte sein Schwert nicht einmal gezogen. Die ganze Diskussion war zwar rein akademischer Art, da es in Xanth ja überhaupt keine Magie mehr gab, aber er war geradezu verstiegen in seiner Absicht, sie dazu zu zwingen, die Wahrheit einzugestehen. »Und du Cherie – du besitzt auch Magie. Du gibst dich so, wie du dich geben willst, du verklärst dich. Das ist eine Art von Illusion, die –«
Voller Wut schlug sie mit beiden Vorderhufen auf einmal nach ihm aus. Er hatte ihre empfindlichsten Gefühle verletzt, indem er ihr gesagt hatte, daß sie selbst obszön sei. Aber er war auf ihre Reaktionen gefaßt und wich ihnen mühelos aus. Nun war seine Stimme sein Schwert, und er hatte vor, damit auch zu siegen. Er hatte genug von Täuschungen, einschließlich Selbsttäuschungen. Jetzt wollte er endlich reinen Tisch machen. In gewisser Weise griff er sich damit selbst an: seine Scham über das, was er Xanth angetan hatte, indem er den Dämon freigab. »Ich fordere dich heraus!« rief er. »Blick dich mal selbst in einem See an! Dann wirst du schon den Unterschied bemerken. Deine Magie ist fort!«
Selbst in ihrer Wut merkte sie immerhin noch, daß sie nichts erreichte. »Also gut, ich werde hineinsehen!« schrie sie. »Und dann verpasse ich dir einen Tritt, daß du bis zum Mond fliegst.«
Zufälligerweise waren sie vor kurzem an einem kleinen Teich vorbeigekommen. Schweigend kehrten sie zu ihm zurück, und Bink tat es bereits leid, was er ihr angetan hatte. Die Zentaurin besah ihr Spiegelbild. Sie war sich sicher gewesen, was sie dort sehen würde, war aber ehrlich genug, sich ihre Illusion nun nehmen zu lassen. »O nein!« schrie sie entsetzt. »Ich bin ja abstoßend, widerlich, häßlicher als Chester.«
»Nein, du bist sehr schön – mit Magie!« beharrte Bink, der versuchte, etwas wiedergutzumachen. »Weil die Magie zu dir ebenso natürlich gehört wie auch zu mir. Du hast nicht den geringsten Grund, sie noch länger abzulehnen, genausowenig wie natürliche Funktionen wie Essen oder Fortpflanzung oder –«
»Hau ab!« kreischte sie. »Du Ungeheuer, du –« In einem neuen Wutanfall stampfte sie mit ihrem Huf in das Wasser.
»Hör zu, Cherie!« rief Bink. »Du hast gesagt, daß Chester gerettet werden könnte. Darauf baue ich ja gerade. Ich wage nicht, Crombies Flasche zu öffnen, weil dieser Vorgang nach Magie verlangt, und es gibt keine mehr. Und Chester muß aus dem gleichen Grund lebendig im See begraben bleiben. Wir brauchen die Magie! Es ist völlig unwichtig, ob wir sie mögen oder nicht. Ohne sie ist Chester so gut wie tot. Wir kommen einfach nicht weiter, wenn du …«
Mit größtem Zögern nickte sie schließlich. »Ich hätte nie geglaubt, daß ich jemals Obszönität dulden könnte. Aber für Chester würde ich alles tun. Selbst –« Sie schluckte schwer und kniff den Schweif ein. »… sogar Magie. Aber –«
»Wir brauchen eine neue Suche!« sagte Bink in plötzlicher Erkenntnis, während er sich das Gesicht wusch. »Eine Suche, um dem Land Xanth die Magie wiederzugeben! Wenn wir alle zusammenarbeiten, Menschen und Zentauren und alle anderen Wesen von Xanth, dann finden wir vielleicht einen anderen Dämon –« Doch er brach ab, als ihm bewußt wurde, wie hoffnungslos dieses Unterfangen sein würde. Wie sollten sie X(A/N)th oder irgendein anderes supermagisches Wesen herbeirufen? Die Dämonen interessierten sich doch überhaupt nicht für dieses Land.
»Ja«, meinte Cherie und fand ihre Hoffnung wieder, als Bink die seine gerade wieder verloren hatte. »Vielleicht weiß der König ja, was wir tun müssen. Steig wieder auf, ich werde einen Galopp einlegen.«
Bink saß wieder auf, und sie raste los. Sie war zwar nicht ganz so kräftig und schnell wie Chester, aber er mußte ihre schlanke Hüfte dennoch umklammern, damit er nicht herabstürzte. »Und mit Magie … werde ich wieder schön sein …« murmelte sie wehmütig in den Wind.
Bink nickte müde, während Cherie weiter durch die traurige Wildnis jagte. Dann fiel er beinahe mit einem Ruck herunter, weil sie plötzlich scharf abbremste.
Vor ihnen standen zwei riesige zottige Gestalten. »Aus dem Weg, ihr Ungeheuer!« schrie Cherie ohne jede Gehässigkeit. »Es geht um das öffentliche Wohl. Das könnt ihr nicht blockieren!«
»Wir wollen niemals nichts blockieren. Geh aus dem Weg, und wir passieren«, sagte eines der Ungeheuer.
»Knacks der Oger!« rief Bink. »Was machst du denn hier, so weit weg von zu Hause?«
»Kennst du dieses Ungeheuer etwa?« fragte Cherie.
»Und ob! Außerdem kann ich ihn jetzt sogar ohne Dolmetscher verstehen.«
Der Oger, der nun einem grobschlächtigen Hünen von einem Mann glich, blickte Bink unter seiner fliehenden Stirn an. »Du Mann, den wir auf der Suche getroffen? Ich mit Liebster auf Hochzeitszoffen.«
»Hochzeitszoffen?« murmelte Cherie.
»Aha, das ist also unser Dornröschen!« sagte Bink und musterte die Ogerin. Sie war so häßlich, wie man es sich nur vorstellen konnte. Doch unter ihrer Behaarung, die aussah wie ein Mop, mit dem man gerade Erbrochenes aufgewischt hatte, und ihrem sackartigen groben Kleid wirkte sie zarter, als man es von einer Ogerin erwartet hätte. Dann fiel es ihm wieder ein: Sie war ja auch gar keine echte Ogerin, sondern eine Schauspielerin aus der Truppe der Strudelungeheuer. Wahrscheinlich konnte sie auch schön aussehen, wenn sie sichMühe gab. Doch warum tat sie es dann nicht? »Äh, eine Frage –«
Die Frau, nicht dumm, begriff sofort, worauf er hinauswollte. »Ja, ich mal gehabt anders Gesicht«, sagte sie zu Bink. »Doch mag ich diese Mühle nicht. Ich finden Mann, besser als jedes Ungeheuer. Gefällt mir besser, bleibt mir treuer.«
Dann hatte die Primadonna also einen Ehemann gefunden, der ihr entsprach! Nach seiner Begegnung mit den Ungeheuern war Bink geneigt, ihr zuzustimmen. Sie behielt die Ogerin Verkleidung bei, die ja ohnehin nur eine physische Spiegelung ihrer normalen Persönlichkeit war, während sie Knacks beibrachte, deutlicher zu sprechen. Eine ganz schön clevereUngeheuerdame! »Äh, gratuliere«, sagte Bink. Und seitwärts,
zu Cherie gewandt: »Sie haben auf unseren Rat hin geheiratet. Humfrey, Crombie, Chester, der Golem und ich haben es ihnen empfohlen. Na ja, Humfrey hat geschlafen. Es war eine schöne Geschichte.«
»Zweifellos«, meinte Cherie zweifelnd.
»Ich hau’ ihm prima auf den Schopf«, sagte die hübsche
Oger-Dame. »Ist ziemlich hart, wie Holz sein Kopf.«
»Oger sind sehr leidenschaftlich«, murmelte Bink.
Knacks war es offensichtlich zufrieden. Wahrscheinlich hatte er es besser getroffen als mit einer echten Ogerin, dachte Bink. Egal, welche Fehler die Schauspielerin haben mochte, sie wußte sicherlich, wie man mit ihm umgehen mußte.
»Hat der Verlust der Magie euch stark beeinträchtigt?« fragte Bink. Die beiden Oger blickten ihn verständnislos an.
»Sie haben es nicht mal bemerkt!« rief Cherie. »Das ist wahre Liebe!«
Das Ogerpärchen machte sich wieder auf den Weg, und Cherie setzte sich wieder in Bewegung. Sie wirkte nachdenklich. »Sag mal, Bink, nur als abstraktes Beispiel – wollen Männer sich wirklich manchmal wie Tiere vorkommen?«
»Manchmal ja«, sagte Bink und dachte an Chamäleon. Wenn sie in ihren dumm-schönen Phasen war, schien sie nur dafür zu leben, ihm zu gefallen, und er fühlte sich sehr männlich. Wenn sie dagegen in ihrer klug-häßlichen Phase war, stieß sie ihn sowohl durch ihren Intellekt als auch durch ihr Aussehen ab. So gesehen war sie eigentlich klüger, wenn sie dumm war, als wenn sie klug war. Aber das war ja jetzt wohl alles vorbei. Sie würde nun auf immer in ihrer ›normalen‹ Phase bleiben und alle Extreme meiden. Sie würde ihn nie wieder abstoßen – oder auch anheizen …
»Und ein Zentaur? Wenn er sich zu Hause als Hengst fühlen könnte …?«
»Ja. Männer wollen das Gefühl haben, gebraucht und verlangt zu werden und Herr im Haus zu sein, auch wenn sie es gar nicht sind. Die Ogerin weiß schon, was sie tut.«
»Sieht so aus«, meinte Cherie. »Sie ist durch und durch falsch, eine bloße Schauspielerin, und doch ist er so glücklich, daß er alles für sie tun würde. Aber Zentaurinnen können auch schauspielern, wenn es sein muß …« Schweigend lief sie weiter.