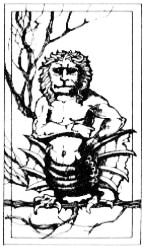
1
Das Skelett im Kleiderschrank
Der Zauberschnüffler näherte sich Bink in gemächlichem Tempo. Seine gelenkige Schnauze schnüffelte eifrig. Als er ihn dann erreicht hatte, gebärdete er sich wie wild vor Entzücken, stieß flötende Geräusche aus, wedelte mit seiner buschigen Rute und rannte unablässig im Kreis um Bink herum.
»Klar, Schnüffler, ich mag dich ja auch!« sagte Bink und kauerte sich nieder, um das Tier zu umarmen. Der Zauberschnüffler gab ihm einen feuchten Kuß auf die Nase. »Du warst einer der ersten, die an meine Magie geglaubt haben, als –«
Bink hielt inne, denn das Wesen benahm sich seltsam. Es tanzte plötzlich nicht mehr umher, sondern machte einen bedrückten, beinahe verängstigten Eindruck. »Was ist los, kleiner Freund?« fragte Bink besorgt. »Habe ich irgendwas gesagt, was dich verletzt hat? Entschuldige!«
Doch der Schnüffler zog den Schwanz ein und schlich sich davon. Bink starrte ihm betrübt nach. Es war fast, als sei die Magie plötzlich abgestellt worden, so daß das Wesen seine Funktion plötzlich verloren hatte. Doch Binks Talent war, wie alle magischen Talente, angeboren. Solange er lebte, lebte es mit ihm. Es mußte irgend etwas anderes gewesen sein, was den Schnüffler vertrieben hatte.
Bink blickte sich beunruhigt um. Im Osten befand sich der Obstgarten von Schloß Roogna, dessen Bäume alle möglichen exotischen Früchte trugen, aber auch Gemüse und verschiedene Gegenstände wie Kirschbomben und Türknäufe. Im Süden lag die ungezähmte Wildnis des Landes Xanth. Bink erinnerte sich daran, wie bedrohlich der Urwald ihm und seinen Gefährten damals erschienen war, als er sie hierhin getrieben hatte. Doch das war lange her. Heute waren die Bäume freundlich gesinnt. Ihr einziger Wunsch war es gewesen, daß auf Schloß Roogna ein Magier leben sollte, der es wieder seiner ursprünglichen Größe entgegenführen würde. Das hatte König Trent auch getan, und nun wirkte die beträchtliche Kraft dieses Ortes im Dienste des Königreichs. Alles schien in bester Ordnung zu sein.
Also dann, an die Arbeit! Heute abend sollte ein Ball stattfinden, und seine Schuhe waren ziemlich durchgetreten. Er schritt an den Rand des Obstgartens, wo sich ein Schuhbaum hin verirrt und Wurzeln gefaßt hatte. Schuhe liebten die Bewegung und das Reisen und pflanzten sich oft an den unwahrscheinlichsten Orten an.
Dieser Baum trug einige reife Schuhe. Bink musterte sie, ohne welche zu pflücken, bis er sicher war, ein passendes Paar für sich gefunden zu haben. Er drehte sie vom Ast ab, schüttelte die Samen heraus und zog sie vorsichtig über seine Füße. Sie waren recht bequem und sahen auch nett aus, weil sie noch frisch waren.
Er machte sich auf den Rückweg, wobei er mit vorsichtigen Bewegungen versuchte, die Schuhe einzulaufen, ohne sie zu sehr zu belasten. Dabei mußte er immer noch an das Erlebnis mit dem Zauberschnüffler denken. War es ein Omen? Hier im Lande Xanth trafen Omen stets ein, aber es war nur selten möglich, sie richtig zu verstehen, bevor es zu spät war. Würde ihm etwas Schlimmes widerfahren? Das war doch recht unwahrscheinlich. Bink wußte, daß er ohne jede Übertreibung davon ausgehen konnte, daß erst ganz Xanth vom Unheil heimgesucht werden mußte, bevor ihm selbst Schaden zugefügt werden konnte. Er mußte das Omen also falsch gedeutet haben. Der Zauberschnüffler litt wahrscheinlich nur unter schlechter Verdauung und hatte sich deswegen davonmachen müssen.
Bald erblickte er sein Heim. Es war ein schöner Hüttenkäse direkt am Rande der Palastanlagen, in den er nach seiner Heirat eingezogen war. Die Rinde war schon lange hart geworden und hatte den größten Teil ihres Aromas verloren, und die Wände bestanden aus feinkörnigem kremgelbem, versteinertem Käse. Es war weit und breit eine der schönsten Hütten, doch da er den Käse nicht selbst ausgehöhlt hatte, hielt er es für unangemessen, damit zu prahlen.
Bink atmete tief durch, beruhigte sich etwas und öffnete die vordere Rindentür. Ein süßlicher Duft von reifem Käse schlug ihm entgegen, zusammen mit einem markerschütternden Schrei.
»Bist du’s, Bink? Wird aber auch Zeit! Wohin hast du dich denn schon wieder verdrückt, gerade jetzt, wo es so viel Arbeit gibt? Du nimmst aber auch nicht die geringste Rücksicht auf andere!«
»Ich brauchte Schuhe«, sagte er knapp.
»Schuhe!« rief sie ungläubig. »Du hast doch Schuhe, Idiot!« Im Augenblick war seine Frau wesentlich klüger als er, denn Chamäleons Intelligenz schwankte in einem monatlichen Zyklus, genau wie ihr Aussehen. Wenn sie schön war, war siedumm – und zwar beides im Übermaß. Wenn sie schlau war, war sie häßlich. Äußerst schlau und äußerst häßlich. Im Augenblick befand sie sich auf dem Höhepunkt dieser letzteren Phase. Deshalb hatte sie sich auch von der Außenwelt zurückgezogen und sich praktisch in ihrem Zimmer eingesperrt.
»Heute abend brauche ich aber schöne«, sagte er mit so viel Geduld, wie er nur aufbringen konnte. Doch noch während er die Worte aussprach, merkte er, daß er es recht unglücklich ausgedrückt hatte. Jede Anspielung auf schönes Aussehen brachte sie im Augenblick zur Weißglut.
»Den Teufel brauchst du, du Dämlack!«
Er wünschte sich, daß sie ihm nicht ständig seine geringere Intelligenz unter die Nase reiben würde. Normalerweise war sie eigentlich klug genug, das nicht zu tun. Bink wußte wohl, daß er kein Genie war, aber ausgesprochen dumm war er auch nicht. Sie war es, auf die beides zutraf. »Ich muß am Jubiläumsball teilnehmen«, erklärte er, obwohl sie das natürlich bereits wußte.
»Es wäre eine Beleidigung der Königin, wenn ich dort schlampig gekleidet auftreten würde.«
»Blödmann!« schrie sie ihn aus ihrem Versteck an. »Du bekommst sowieso ein Kostüm verpaßt! Kein Mensch wird deine Stinkkähne sehen!«
Hmph, das stimmte allerdings. Er war umsonst Schuhe holen gegangen.
»Aber das ist mal wieder typisch für deine Ichsucht«, fuhr sie in gerechtem Zorn fort. »Auf die Party zu verschwinden, während ich leidend zu Hause sitze und in die Wände beiße.« Das war durchaus wörtlich gemeint: Der Käse war zwar alt und hart, aber wenn sie wütend war, biß sie häufig hinein, und im Augenblick war sie eigentlich fast immer wütend.
Trotzdem versuchte er, konstruktiv und positiv gestimmt zu bleiben. Er war erst ein Jahr verheiratet, und er liebte Chamäleon. Er hatte von Anfang an gewußt, daß es sowohl schöne als auch schlimme Zeiten geben würde, und jetzt war eben eine schlimme Zeit. Eine ziemlich schlimme Zeit. »Warum kommst du nicht mit auf den Ball, Liebling?«
Sie explodierte vor zynischem Zorn. »Ich? Während ich so aussehe? Du kannst dir deinen schwachsinnigen Sarkasmus ruhig schenken!«
»Aber du hast mich doch selbst daran erinnert, daß es ein Kostümfest ist. Die Königin kleidet jeden Teilnehmer in ein Kostüm ihrer Wahl. Also wird niemand sehen –«
»Du durchgedrehtes Weichhirn!« schrie sie durch die Wand, und er hörte, wie etwas schepperte. Jetzt war sie so weit, mit Gegenständen zu werfen, in einem echten Wutanfall. »Wie soll ich in irgendeiner Kostümierung zu einer Party gehen – wo ich im neunten Monat schwanger bin?«
Das war es, was ihr wirklich Sorgen machte. Nicht ihre normale klug-häßliche Phase, die sie schon ihr ganzes Leben lang begleitet hatte, sondern die großen Unannehmlichkeiten und Einschränkungen, die ihre Schwangerschaft ihr auferlegte. Bink hatte diesen Zustand in ihrer schön-dummen Phase herbeigeführt und erst später, als sie wieder schlauer geworden war, erfahren, daß sie sich zu dieser Zeit noch nicht derart hatte festlegen wollen. Sie befürchtete, daß das Kind so werden könnte wie sie – oder wie er. Sie hatte erst einen Zauber ausfindig machen wollen, der dafür gesorgt hätte, daß das Kind entweder mit positiven Talenten oder wenigstens normal begabt geboren worden wäre. Doch nun hing alles vom blinden Zufall ab. Sie war nicht gerade begeistert über ihre Lage gewesen und hatte Bink bis heute auch nicht verziehen. Und je intelligenter und schwangerer sie wurde, um so mehr wuchs ihr Zorn.
Nun, bald würde sie über den Berg sein und wieder schöner werden – gerade rechtzeitig für das Baby, das in etwa einer Woche kommen mußte. Vielleicht würde das Kind ja normal, möglicherweise sogar sehr talentiert. Dann würden Chamäleons Ängste sich wieder legen. Dann würde sie auch nicht mehr alles an ihm auslassen.
Wenn das Kind allerdings anormal sein sollte … doch darüber dachte man lieber gar nicht erst nach. »Entschuldige, das hatte ich vergessen«, murmelte er.
»Vergessen!« Wie ein magisches Schwert schnitt ihre Ironie durch den Käse der Hütte. »Schwachkopf! Das würdest du ganz gerne vergessen, was? Warum hast du nicht letztes Jahr daran gedacht, als du –«
»Ich muß gehen, Chamäleon«, murmelte er und schlüpfte hastig durch die Tür. »Die Königin regt sich immer auf, wenn man zu spät kommt.« Überhaupt schien es zum Wesen der Frauen zu gehören, sich über Männer aufzuregen und in Rage zu geraten. Das unterschied sie unter anderem von Nymphen, die zwar genauso aussahen wie Frauen, sich aber jeder männlichen Laune willig fügten. Wahrscheinlich durfte er sich glücklich schätzen, daß seine Frau kein gefährliches Talent besaß, etwa die Fähigkeit, Leute zum Brennen zu bringen oder Gewitter zu erzeugen.
»Warum muß die Königin ihre lächerliche, sinnlose, langweilige Party jetzt geben?« fragte Chamäleon, »wo sie doch genau weiß, daß ich nicht teilnehmen kann.«
Ach, die Logik der Frauen! Warum sich abmühen, sie zu verstehen? Alle Intelligenz im Lande Xanth reichte nicht aus, um dem Unsinnigen einen Sinn abzugewinnen. Bink schloß die Tür hinter sich.
Chamäleons Frage war rein rhetorisch gewesen. Sie kannten beide die Antwort. Königin Iris nahm jede passende und unpassende Gelegenheit wahr, mit ihrem Status zu protzen, und heute war das einjährige Jubiläum dieses Status. Theoretisch wurde der Ball zu Ehren des Königs abgehalten, aber König Trent legte keinen Wert auf solches Theater und würde vermutlich den Feierlichkeiten fernbleiben. In Wirklichkeit war das Fest für die Königin – und da sie den König nicht dazu zwingen konnte, daran teilzunehmen, wehe den untergeordneten Amtsträgern, die heute abend schwänzten! Bink war ein solcher Amtsträger.
Und warum das? fragte er sich, während er mißmutig weiter schritt. Er galt als wichtige Person, als Königlicher Erforscher Xanths, dessen Pflicht es war, die Geheimnisse der Magie zu erkunden und dem König persönlich Bericht zu erstatten. Doch wegen Chamäleons Schwangerschaft und seiner häuslichen Verpflichtungen hatte Bink bisher keine richtigen Forschungen anstellen können. Aber das hatte er sich selbst zuzuschreiben, wenn man es genau nahm. Er hätte sich vorher die Konsequenzen einer Schwängerung seiner Ehefrau überlegen sollen. Aber wenn Chamäleon schön war, konnte sie einem völlig den Verstand rauben und die Sinne – darüber schweigt man lieber.
Ach, die Nostalgie! Damals, als die Liebe noch frisch, sorglos, unkompliziert und verantwortungslos war! Die schöne Chamäleon war wie eine Nymphe –
Nein, es war nicht richtig, so zu empfinden. Bevor er Chamäleon kennengelernt hatte, war sein Leben keineswegs so einfach gewesen, und außerdem war er ihr dreimal begegnet, bevor er sie erkannt hatte. Er hatte befürchtet, kein magisches Talent zu besitzen – Er begann zu flimmern – und im nächsten Augenblick hatte er sich verwandelt. Das Kostüm der Königin war da. Geistig und körperlich war Bink immer noch der alte, doch sah er nun wie ein Zentaur aus. Die Illusion der Königin, die ihn so in die
Lage versetzte, in ihrem Spiel mitzuspielen, das sie mit ihrem unbegrenzten Talent, Leute zu ärgern, entworfen hatte. Jeder mußte die Identität möglichst vieler anderer erraten, bevor er in den Ballsaal gelangte, und es war ein Preis für denjenigen ausgesetzt, der die meisten Treffer aufzuweisen hatte.
Hinzu kam, daß sie um Schloß Roogna die Illusion eines Heckenlabyrinths errichtet hatte. Selbst wenn man nicht am Ratespiel teilnahm, war man dazu gezwungen, sich seinen Weg durch das Riesenpuzzle zu bahnen. Verdammte Königin!
Doch er mußte einfach da durch, genau wie alle anderen auch. Der König war so weise, sich nicht in Hofangelegenheiten einzumischen, und ließ der Königin weitgehend freien Lauf. Resigniert trat Bink ins Labyrinth und schickte sich an, im Gewirr falscher Pfade den richtigen Weg zum Schloß zu suchen.
Der größte Teil der Hecke war reine Illusion, aber es war genug davon in der Wirklichkeit verankert, so daß man besser daran tat, dem Labyrinth die Ehre zu erweisen, anstatt sich einfach seinen Weg mit Gewalt zu bahnen. Die Königin würde schon ihren Spaß haben, besonders bei diesem wichtigen ersten Krönungsjubiläum. Wenn man ihren Launen nicht entgegenkam, konnte sie häßlicher werden als Chamäleon.
Bink lief um eine Ecke – und wäre beinahe mit einem Zombie zusammengeprallt. Das wurmzerfressene Gesicht des Dings verlor bröckelnde Erde und Schleim, und die großen, eckigen Augenhöhlen waren Schaufenster der Verwesung. Der Gestank war fürchterlich.
In morbider Faszination starrte Bink in diese Augen. Tief in ihrem Innern war ein matter Schimmer zu erahnen, wie von einem Spuk im Mondlicht oder von Schimmelpilzen, die sich vom verfaulten Gehirn des Leichnams nährten. Er hatte das Gefühl, durch zwei Schächte hinunterzublicken auf die
Urquelle seiner unheiligen Belebtheit und vielleicht sogar auf die Wurzel aller Magie in Xanth. Doch es war ein Alptraum, denn der Zombie war ein lebender Toter, eine Abscheulichkeit, die man schnellstens hätte begraben und vergessen sollen. Warum hatte dieser sich aus seinem unruhigen Grab losgerissen? In der Regel standen die Zombies nur auf, wenn es galt, Schloß Roogna zu verteidigen, und seit König Trent hier die Leitung übernommen hatte, hatten sie sich nicht mehr gerührt.
Der Zombie trat auf ihn zu und öffnete seinen verwesten Mund: »Wwuumm!« sagte er und gab sich ersichtliche Mühe, aus dem stinkenden Gas, das seine Atemluft darstellte, ein Wort zu bilden.
Bink wich angewidert zurück. Er fürchtete wenig in Xanth, denn seine körperliche Kraft und sein magisches Talent machten ihn auf subtilste Weise zu einem der stärksten Menschen im ganzen Königreich. Doch Zombies ekelten ihn an, und er drehte sich um und rannte eine Seitenallee entlang, so daß das untote Ding hinter ihm zurückblieb. Mit seinen morschen Knochen und seinem verfaulten Fleisch war es ihm unmöglich, Bink einzuholen, und es machte nicht einmal den Versuch.
Plötzlich erhob sich vor ihm ein blitzendes Schwert. Bink blieb erstaunt vor dieser zweiten Erscheinung stehen. Er sah keinen Menschen und keine Verbindungsfäden, sondern nur die Waffe. Was sollte das?
Ach ja, es mußte sich um einen weiteren kleinen Trick der Königin handeln. Sie liebte es, ihre Feste aufregend und herausfordernd zu gestalten. Er brauchte nur durch das Schwert hindurchzugehen und den Bluff zu entlarven.
Und doch zögerte er. Die Klinge sah schrecklich echt aus. Bink erinnerte sich an seine Erlebnisse mit Jama, als er noch ein Junge gewesen war. Jamas Talent bestand darin, daß er fliegende Schwerter manifestieren konnte, die in den wenigen Sekunden, die sie existierten, durchaus hart und scharf waren, und er hatte eine arrogante Art an sich, sein Talent auszuüben. Jama war kein Freund von Bink, und wenn er sich hier irgendwo aufhalten sollte – Bink zog sein eigenes Schwert. »En garde!« rief er und schlug gegen die andere Waffe. Halb erwartete er, daß seine Klinge ohne Widerstand durch das Trugbild schneiden würde. Die Königin hätte zufrieden festgestellt, daß ihr Bluff funktioniert hätte, und er wäre kein Risiko eingegangen, nur für den Fall – Das andere Schwert war echt. Stahl stieß klirrend auf Stahl. Dann wich es mit einer Seitendrehung aus und stieß auf seinen Brustkorb zu.
Bink parierte und machte einen Ausfallschritt. Das war keine illusorische Klinge und auch kein geistlos umherfliegendes Ding! Es wurde von einer unsichtbaren Hand geführt, und das hieß – von einer unsichtbaren Person.
Wieder schlug das Schwert zu, und Bink parierte erneut. Das Ding wollte ihm tatsächlich ans Leder! »Wer bist du?« fragte Bink, doch er bekam keine Antwort.
Bink hatte sich nunmehr ein Jahr im Schwertkampf geübt, und sein Lehrer hatte ihn als einen begabten Schüler angesehen. Bink besaß Mut, Schnelligkeit und Kraft. Er wußte, daß er sich kaum als Experten bezeichnen konnte, aber ein Amateur war er auch nicht mehr. Die Herausforderung machte ihm sogar Spaß, selbst wenn es sich um einen unsichtbaren Gegner handeln mochte.
Doch ein ernst gemeinter Kampf … das war etwas anderes. Warum wurde er bei dieser festlichen Gelegenheit angegriffen? Wer war dieser schweigende, geheimnisvolle
Feind? Bink hatte Glück, daß der Unsichtbarkeitszauber seines Gegners sich nicht auch noch auf dessen Schwert erstreckt hatte, denn dann hätte er wirklich Schwierigkeiten gehabt. Doch die Magie in Xanth bezog sich stets nur auf eine Sache. Ein Schwert konnte nicht seine notwendigen Schärfe- und Härtezauber haben und gleichzeitig unsichtbar sein. Na ja, möglich war es schon, denn in der Magie war eben alles möglich, es war aber höchst unwahrscheinlich. Auf jeden Fall sah er die Waffe, und mehr brauchte er nicht.
»Halt!« rief er. »Laß ab, oder ich muß kontern!«
Wieder schlug das Schwert auf ihn ein. Bink hatte bereits gemerkt, daß er es nicht mit einem Experten zu tun hatte: Der Fechtstil war eher kühn als geschickt. Er blockte die Waffe ab und konterte mit einem halbherzigen Stoß in die Richtung, wo er seinen Gegner vermutete.
Seine Klinge fuhr ohne jeden Widerstand durch den unsichtbaren Oberkörper hindurch. Da war ja gar nichts!
Bink erschrak und verlor Konzentration und Gleichgewicht. Der Gegner zielte nach seinem Gesicht, und er konnte dem Stoß nur mit knapper Mühe ausweichen. Crombie, sein Ausbilder, hatte ihm solche Ausweichmanöver beigebracht, doch diesmal war zum Teil auch eine gehörige Portion Glück im Spiel gewesen. Ohne sein Talent wäre er jetzt tot gewesen. Bink verließ sich nicht gerne auf sein Talent. Das war auch der Grund, warum er Fechten gelernt hatte; er wollte sich selbst auf seine Weise verteidigen, offen, stolz, ohne das heimliche Gekicher der anderen zu fürchten, die, was ja auch ganz natürlich war, glaubten, daß ihm immer nur der Zufall zu Hilfe kam. Seine Magie konnte ihn etwa dadurch schützen, daß sein Angreifer auf einer Obstschale ausrutschte, Binks Stolz war ihr unwichtig. Doch wenn er auf faire Weise mit seinem Schwert siegte, konnte ihn niemand auslachen. Zwar war im Augenblick niemand da, der hätte lachen können, aber dennoch gefiel es ihm nicht, sich hier verteidigen zu müssen gegen – ja, gegen was?
Es mußte sich um eine der magischen Waffen aus dem Privatarsenal des Königs handeln, und sie wurde ganz bewußt geführt. Doch der König hatte damit bestimmt nichts zu tun, denn der neigte weder zu Schabernack noch ließ er es zu, daß man mit seinen Waffen Unfug anstellte. Irgend jemand hatte dieses Schwert aktiviert und ausgeschickt, um Unheil anzurichten, und dieser Jemand würde schon bald den gewaltigen Zorn des Königs zu spüren bekommen.
Doch im Augenblick war ihm das ein schwacher Trost. Er wollte sich nicht hinter dem Schutz des Königs verstecken. Er wollte seinen Kampf selbst führen und auch gewinnen. Nur daß er wohl Schwierigkeiten haben würde, an eine Person ranzukommen, die gar nicht da war.
Als er darüber nachdachte, kam er zu dem Schluß, daß es eigentlich niemanden geben konnte, der dieses Schwert aus der Entfernung lenkte. Magisch gesehen war es zwar möglich, doch soweit er wußte, hatte er keine persönlichen Feinde. Wer würde ihn angreifen wollen, sei es mit magischen oder mit gewöhnlichen Mitteln, und wer würde es wagen, ihn mit einem der königlichen Schwerter im Garten von Schloß Roogna zu überfallen?
Bink wandte sich wieder dem feindlichen Schwert zu und manövrierte es in eine solche Position, daß er mit seiner eigenen Klinge den unsichtbaren Arm durchtrennen konnte. Natürlich war da kein Arm. Kein Zweifel: Das Schwert lenkte sich selbst. Er hatte noch nie mit einer solchen Waffe gekämpft, denn der König traute der Urteilskraft geistloser Waffen nicht.
Doch warum sollte ein Schwert ihm nach dem Leben trachten? Bink respektierte alle Blankwaffen. Er pflegte sein eigenes Schwert sehr sorgfältig und achtete darauf, daß es stets scharf blieb und nicht mißbraucht wurde. Kein Schwert, gleich welchen Typs und welchen Glaubens, konnte etwas gegen ihn haben.
Vielleicht hatte er dieses Schwert ja unbemerkt beleidigt. »Schwert, wenn ich dir Unrecht angetan oder dich beleidigt haben sollte, so bitte ich um Verzeihung und biete dir Wiedergutmachung an«, sagte er. »Ich will nicht ohne guten Grund gegen dich kämpfen müssen.«
Das Schwert hieb wild gegen seine Beine. Kein Pardon!
»Dann sag mir wenigstens, was dich verletzt hat!« rief Bink und hüpfte gerade noch rechtzeitig beiseite.
Das Schwert fuhr unbeirrt mit seinem Kampf fort.
»Dann muß ich dich außer Gefecht setzen«, sagte Bink mit einer Mischung aus Bedauern, Wut und Vorfreude. Das war eine richtige Herausforderung! Zum ersten Mal nahm er eine richtige Fechtposition ein und ging zum Angriff über. Er wußte, daß er besser war.
Aber er konnte den Fechter nicht niederstrecken, weil es keinen gab. Niemand da, den man hätte durchbohren können, keine Hand zum Abhacken. Das Schwert wirkte unermüdlich. Es wurde von Magie getrieben. Wie sollte er es da besiegen?
Die Herausforderung war doch größer, als er gedacht hatte. Bink machte sich zwar keine Sorgen, denn er war wesentlich geschickter. Doch wenn der Gegner unverwundbar war …
Aber sein Talent würde es nicht zulassen, daß das Schwert ihm Schaden zufügte. Ein Schwert, das von einem gewöhnlichen Mann geführt wurde, konnte ihm schaden, denn das war eine mundanische Sache. Doch wenn es um Magie ging, hatte er nichts zu fürchten. In Xanth gab es kaum etwas,
das gänzlich unmagisch gewesen wäre, also war er außerordentlich gut geschützt. Die Frage war jetzt nur, ob er auf ehrliche Weise weitermachen und sich auf seine Geschicklichkeit und seine Tapferkeit verlassen wollte, oder ob er irgendeinem phantastisch anmutenden Zufall vertrauen sollte. Wenn er es mit der ersten Methode nicht schaffte, würde sein Talent es mit der zweiten tun.
Wieder drängte er das Schwert in eine verwundbare Position und schlug voll auf die Klinge ein, in der Hoffnung, sie zu zerbrechen. Doch er hatte keinen Erfolg, das Metall war zu stark. Er hatte eigentlich auch nicht erwartet, daß es klappen würde, denn Stärke gehörte zu den Grundzaubern, die in moderne Schwerter eingebaut wurden. Was nun?
Er hörte, wie sich jemand klappernd näherte. Er mußte die Sache schnell über die Bühne bringen, sonst würde es noch zu der Peinlichkeit kommen, daß man ihn rettete. Sein Talent sorgte sich nicht um seinen Stolz, sondern nur um sein leibliches Wohlergehen.
Bink fand sich mit dem Rücken gegen einen Baum gedrängt – es war ein echter Baum. Das Heckenlabyrinth war unter Einbeziehung existierender Vegetation errichtet worden, so daß alles zu einem Teil des Verwirrspiels geworden war. Es war ein Leimrindenbaum: Alles, was seine Rinde durchdrang, blieb magisch daran haften. Dann wuchs der Baum langsam um den Gegenstand herum und nahm ihn in sich auf. Er war völlig harmlos, solange seine Rinde intakt war. Kinder konnten ohne Gefahr daran hochklettern und in seinen Ästen spielen, wenn sie keine Steigeisen dabei benutzten. Spechte hielten sich von diesen Bäumen fern. Bink konnte sich also getrost gegen ihn lehnen, aber er mußte darauf achten, daß er nicht – Wieder zuckte das feindliche Schwert nach seinem Gesicht. Hinterher wußte Bink nicht mehr genau, ob er seine Eingebung vor oder nach seiner Reaktion gehabt hatte. Wahrscheinlich erst danach, was wiederum bedeutete, daß sein Talent wieder in Aktion getreten war, obwohl er versucht hatte, das zu verhindern. Jedenfalls parierte er nicht, sondern duckte sich.
Das Schwert fuhr über seinen Kopf hinweg tief in den Baum hinein. Sofort wurde die Magie des Baums wachgerufen, und die Klinge war gefangen. Sie bäumte sich auf und versuchte, sich loszureißen, doch ohne Erfolg. Wenn ein Ding in seinem eigenen Spezialbereich tätig wurde, war seine Magie einfach nicht zu schlagen! Bink war der Sieger.
»Tschüß, Schwert«, sagte er und steckte seine eigene Waffe wieder in ihre Scheide. »Tut mir leid, daß es nur so kurz gedauert hat.« Doch hinter seinem lässigen Gehabe verbarg sich ein grimmiges Unbehagen: Wer oder was hatte dieses Schwert dazu bewegt, ihm nach dem Leben zu trachten? Er mußte offenbar doch irgendwo einen Feind haben, und das gefiel ihm gar nicht. Nicht, daß er sich vor einem Angriff fürchtete. Es ging ihm mehr um das unangenehme Gefühl, daß ihn jemand so wenig leiden konnte, wo er sich doch solche Mühe gab, es allen recht zu machen.
Er schritt geduckt um eine weitere Ecke – und lief geradewegs in einen Nadelkaktus hinein. Es war kein echter, sonst wäre er jetzt ein menschliches Nadelkissen gewesen, sondern ein falscher.
Der Kaktus griff mit einem stacheligen Ast nach ihm und packte Bink am Hals. »Tolpatsch!« schnaubte er. »Soll ich dir dein häßliches Gesicht im Schlamm verschönen?«
Bink erkannte die Stimme und den Griff, »Chester!« krächzte er mit Mühe, »Chester Zentaur!«
»Alle Pferdebremsen!« fluchte Chester. »Du hast mich dazu überlistet, meine Identität preiszugeben!« Er lockerte seinen schrecklichen Griff etwas. »Aber jetzt sagst du mir entweder, wer du bist, oder ich drücke dich aus, etwa so.« Er drückte zu, und Bink glaubte, daß sein Kopf vom Körper abplatzen würde. Wo war denn sein Talent jetzt?
»Fink! Fink!« quietschte er und versuchte, seinen Namen auszusprechen, obwohl seine Lippen sich nicht richtig schließen ließen. »Hink!«
»Ich stinke nicht!« sagte Chester und wurde wütend. Das ließ seinen Klammergriff wieder stärker werden. »Du bist nicht nur häßlich wie die Hölle, du bist auch noch unverschämt.« Dann zuckte er erschreckt zusammen. »He – du trägst ja mein Gesicht!«
Bink hatte es ganz vergessen – er war ja kostümiert. Die Verblüffung des Zentauren ließ ihn kurz seinen Griff lockern, und Bink packte die Gelegenheit sofort am Schopf. »Ich bin Bink! Dein Freund! Im Illusionskostüm!«
Chester überlegte. Kein Zentaur war dumm, aber er war einer von denen, die lieber mit den Muskeln nachdachten.
»Wenn du versuchst, mich reinzulegen –«
»Erinnerst du dich noch an Herman den Einsiedler? Wie ich ihn in der Wildnis getroffen habe und wie er Xanth mit seiner Irrlichtermagie vor dem Zapplerschwarm gerettet hat? Das war der beste aller Zentauren!«
Schließlich ließ Chester Bink los. »Onkel Herman«, stimmte er ihm lächelnd zu. Der Effekt auf dem Kaktusgesicht war schauerlich. »Du bist wohl doch in Ordnung. Aber war tust du in meiner Gestalt?«
»Das gleiche, was du in der Kaktusgestalt tust«, sagte. Bink und massierte sich den Hals. »Ich besuche den Maskenball.« Sein Hals schien unverletzt zu sein, deshalb hatte sein Talent den Angriff wohl auch zugelassen.
»Ach ja«, erwiderte Chester und bog redegewandt seine Stacheln. »Der Unfug der Guten Königin Iris, diesem
Zauberinnen-Aas. Hast du den Weg zum Palast schon gefunden?«
»Nein, ich bin einem –« Doch Bink wollte noch nicht über das Schwert reden. »… einem Zombie begegnet.«
»Einem Zombie!« Chester lachte. »Der arme Kerl! Was für ein Kostüm!«
Ein Kostüm! Aber natürlich! Der Zombie war gar nicht echt gewesen, sondern wieder nur eine Illusions-Verkleidung der Königin. Bink hatte ebenso kurzsichtig reagiert wie Chester und war vor dem Ding geflohen. Und dabei war er dem Schwert begegnet, das freilich weder eine Kostümierung noch eine Illusion gewesen war. »Na ja, ich mag dieses Spiel sowieso nicht besonders«, sagte er.
»Ich auch nicht«, meinte Chester. »Aber der Preis – für den würde ich schon ein Jahr meines Lebens geben.«
»Per definitionem«, stimmte Bink düster zu. »Eine Antwort vom Guten Magier Humfrey auf eine beliebige Frage, und zwar kostenlos. Aber jeder will den Preis erringen. Jemand anders wird gewinnen.«
»Nicht, wenn wir jetzt die Hufe schwingen!« sagte Chester. »Komm, wir wollen den Zombie demaskieren, bevor er auf und davon ist.«
»Ja«, willigte Bink ein. Im nachhinein schämte er sich für seine erste Reaktion.
Sie kamen an dem Schwert vorbei, das noch immer im Baum stak. »Wer’s findet, dem gehört’s!« rief Chester fröhlich und packte das Schwert.
»Das ist Leimrinde, das geht nicht ab.«
Doch der Zentaur riß bereits an dem Schwert. Er war so kräftig, daß ein Schauer aus Rinde und Holz herabrieselte. Das
Schwert ließ sich freilich dennoch nicht aus dem Stamm ziehen.
»Hm«, machte Chester. »Hör mal, Baum, wir haben im Zentaurendorf auch eine Leimrinde. Als die große Dürre herrschte, habe ich sie jeden Tag gewässert, damit sie nicht einging. Jetzt bitte ich dich nur darum, daß du mir im Gegenzug dieses Schwert überläßt, das du sowieso nicht gebrauchen kannst.«
Das Schwert glitt mühelos aus dem Holz. Chester steckte es in seinen Pfeilköcher, jedenfalls deutete Bink die Verrenkungen des Kaktus so. Bink hatte vorsichtshalber die Hand auf seinen eigenen Schwertknauf gelegt, doch die Waffe verhielt sich friedlich. Was immer sie auch belebt haben mochte, jetzt war es verschwunden.
Chester merkte, wie Bink ihn anstarrte. »Man muß mit Bäumen eben umgehen können«, sagte er und ging weiter. »Es stimmt natürlich, ein Zentaur lügt niemals. Ich habe den Baum tatsächlich gewässert. Das war bequemer als das stille Örtchen.«
Dieser Leimrindenbaum hatte also seine Beute preisgegeben. Warum eigentlich nicht? Zentauren waren meistens nett zu Bäumen, obwohl Chester keine besondere Vorliebe für Nadelkakteen hegte. Das war zweifellos auch der Grund, weshalb die Königin ihn in ihrem Humor mit diesem Kostüm gestraft hatte.
Sie kamen an den Ort, wo Bink dem Zombie begegnet war, doch das schreckliche Ding war verschwunden. Nur ein schleimiger Dreckklumpen lag am Boden. Chester stieß ihn mit einem Huf an. »Echter Dreck von einem falschen Zombie?« fragte er verwundert. »Die Illusionen der Königin werden ja immer besser.«
Bink nickte. Das war wirklich beunruhigend. Offenbar hatte die Königin ihre Illusion weit ausgedehnt. Doch warum? Ihre Magie war stark und reichte weit über die Leute gewöhnlicher Talente hinaus, denn sie gehörte zu den drei Bürgern von Xanth mit Magierstatus. Doch selbst für sie mußte es eine ziemliche Anstrengung bedeuten, jede Einzelheit der Kostüme der Ballteilnehmer zu beachten und aufrechtzuerhalten. Binks und Chesters Verkleidung war rein optischer Art, sonst wäre es ihnen auch schwergefallen, sich zu unterhalten.
»Hier liegt noch mal ein Dreckhaufen«, bemerkte Chester. »Echter Dreck, kein Zombiedreck.« Er trat mit einem Kakteenfuß darauf, der nichtsdestoweniger einen Hufabdruck hinterließ. »Könnte das Ding hier vielleicht wieder in den Boden zurückgekehrt sein?«
Neugierig geworden, scharrte Bink mit seinem eigenen Fuß über die kleine Aufwerfung. Doch er brachte nichts zutage als weiteres Erdreich. Kein Zombie. »Den haben wir wohl verloren«, sagte Bink und war aus irgendeinem ihm selbst unerklärlichen Grund wütend. Der Zombie hatte so echt ausgesehen! »Suchen wir lieber den Palast, als uns hier draußen lächerlich zu machen.«
Chester nickte, und sein Kaktuskopf wackelte, daß es zum Schieflachen war. »Ich bin noch nie sehr gut darin gewesen, andere Leute zu erraten«, gestand er. »Und auf die einzige Frage, die ich dem Guten Magier stellen könnte, gibt es keine Antwort.«
»Keine Antwort?« fragte Bink, während sie in einen anderen Gang traten.
»Seit Cherie das Fohlen geboren hat – wohlgemerkt, es ist ein prima kleiner Zentaur mit buschigem Schweif –, hat sie kaum noch Zeit für mich. Ich bin so was wie ein fünfter Huf im Stall. Was soll ich also –?«
»Du auch!« rief Bink und erkannte die Ursache seiner eigenen schlechten Laune. »Chamäleon ist zwar noch nicht so weit, aber –« Er zuckte mit den Schultern.
»Mach dir mal keine Sorgen – es wird bestimmt kein Fohlen.«
Bink gluckste, obwohl es eigentlich gar nicht komisch war.
»Stuten – mit ihnen läuft nichts und ohne sie auch nicht«, sagte Chester betrübt.
Plötzlich kam eine Harpyie um die Ecke. Wieder trappelten sie hin und her, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. »Bist du schnabelblind?« fragte Chester. »Zisch ab, Vogelhirn!«
»Hast du wirklich einen Gemüsekopf?« konterte die Harpyie im Flötton. »Geh mir aus dem Weg, bevor ich dich mit deinen eigenen stumpfen Nadeln zu einem Stinkball vernähe.«
»Stumpfe Nadeln!« Chester, der immer zu einem Kampf aufgelegt war, selbst bei bester Laune, plusterte sich empört auf. Wäre er tatsächlich ein Kaktus gewesen, so hätte er auf der Stelle eine Nadelsalve abgeschossen – und seine Nadeln sahen keineswegs stumpf aus. »Soll ich dir deine schmierigen Federn in deinen Rotzschnabel stopfen?«
Jetzt war die Harpyie an der Reihe, sich aufzublähen. Die meisten Harpyien waren weiblichen Geschlechts, diese hier war jedoch männlich. Einmal mehr ein Beweis des ätzenden Humors der Königin. »Natürlich«, flötete der Vogelmann. »Sobald ich dir den Saft aus deiner Maische gepreßt habe, Grüngesicht.«
»Ach ja?« fragte Chester und vergaß mal wieder, daß Zentauren sich sonst nur ungern prügelten. Die Harpyie war offenbar in Wirklichkeit ein erheblich größeres Wesen, das sich von Fremden niemals hatte einschüchtern lassen. Diese seltsame, halb melodische Sprechweise –
»Manticora!« rief Bink.
Die Harpyie hielt inne. »Eins zu null für dich, Zentaur. Deine Stimme kommt mir zwar bekannt vor, aber –« Verblüfft erinnerte sich Bink daran, daß er ja jetzt die Gestalt eines Zentauren besaß, so daß das Wesen mit ihm und nicht mit Chester sprach. »Ich bin Bink. Wir haben uns bei meinem Besuch beim Guten Magier kennengelernt, damals, als –« »Ach ja. Du hast seinen magischen Spiegel zerdeppert. Zum Glück hatte er noch einen. Was ist denn aus dir geworden?«
»Ich bin ziemlich heruntergekommen. Ich habe geheiratet.«
Die Manticora lachte musikalisch. »Doch wohl nicht diesen
Kaktus, hoffe ich?«
»Hör mal –« fing Chester drohend an.
»Das hier ist mein Freund, Chester Zentaur«, sagte Bink hastig. »Er ist der Neffe von Herman dem Einsiedler, der Xanth vor den –«
»Herman kannte ich!« sagte die Manticora. »Der größte aller Zentauren, auch bevor er sein edles Leben für Xanth aufopferte. Der einzige, den ich kannte, der sich seines magischen Talents nicht geschämt hat. Seine Irrlichter haben mich mal aus einem Drachennest herausgeführt. Als ich von seinem Tod hörte, da war ich so traurig, daß ich rausgegangen bin und einen kleinen Gewirrbaum zu Tode gestochen habe. Er war so viel mehr wert als diese hufköpfigen Gäule der großen Herde, die ihn ins Exil verbannt haben –« Er brach ab. »Soll keine Beleidigung sein, Kaktus, wo du doch sein Neffe bist und so. Auch wenn ich das eine oder andere auszustechen hätte, würde ich nichts tun, was die Erinnerung an jenen großen Einsiedler beleidigen könnte.«
Es gab keinen zuverlässigeren Weg, Chesters Sympathie zu erringen, als seinen heldenhaften Onkel zu loben, was die Manticora vielleicht auch wußte. »Keine Ursache!« sagte er sofort. »Alles, was du sagst, stimmt! Mein Volk hat Herman ins Exil geschickt, weil die Leute meinten, daß Magie bei einem Zentaur obszön sei. Das denken die meisten immer noch. Selbst meine eigene Stute, die ja nun wirklich das netteste Stück Pferdefleisch ist, das man sich –« Er schüttelte seinen Kaktuskopf, als er merkte, daß er etwas Unangebrachtes zu sagen im Begriff war. »Es sind wirklich Hufköpfe.«
»Die Zeiten ändern sich«, meinte die Manticora. »Eines Tages werden alle Zentauren mit ihren Talenten prahlen, anstatt sie zu verheimlichen.« Mit einer Flügelbewegung fuhr sie fort: »Na ja, ich muß mal ein paar Leute demaskieren. Nicht, daß ich den Preis nötig hätte, es ist einfach nur eine Herausforderung.«
Das Wesen ging weiter. Bink konnte erneut nur über den Humor der Königin staunen, die es fertigbrachte, ein solch beeindruckendes Wesen wie eine Manticora, die einen Menschenkopf mit dreifachem Kiefer, den Körper eines Löwen, Drachenflügel und den Schwanz eines monströsen Skorpions besaß, als Harpyie zu kostümieren. Das tödlichste Ungeheuer in Xanth – verwandelt in das abscheulichste. Und doch trug die Manticora ihr Los mit Würde und spielte das Kostümspiel mit. Wahrscheinlich fühlte sich das Wesen so sicher in seinem Bewußtsein, eine Seele zu haben, daß es sich nur wenig aus äußerem Schein machte.
»Ich frage mich, ob ich wohl ein magisches Talent besitze«, meinte Chester mit ein wenig schuldbewußter Stimme. Von der Obszönität zum Stolz war es aber auch wirklich kein leichter Schritt!
»Wenn du diesen Preis gewinnen würdest, könntest du das herausfinden«, schlug Bink vor.
Die Miene des Kaktus hellte sich auf. »Stimmt!« Das war offenbar die unbeantwortbare Frage, die Chester nicht auszusprechen gewagt hatte. Doch dann verfinsterte sich der Kaktus wieder. »Aber Cherie würde es nie zulassen, daß ich ein Talent besitze, nicht einmal ein winziges. Da ist sie fürchterlich prüde.«
Bink nickte. Es erinnerte ihn an die Einstellung seiner Mutter zur Sexualität junger Menschen. Für Tiere war das ganz natürlich, aber wenn es sich um Wildhafer-Nymphen handelte – na ja, jedenfalls hatte Chester wirklich ein Problem. Sie schritten um eine Ecke – in diesem schrecklichen Labyrinth gab es anscheinend kaum etwas anderes als Ecken – und erblickten das Palasttor, das am Ende der Zugbrücke auf der anderen Seite des Grabens leuchtete. »Schnell rüber, bevor das Labyrinth sich verändert!« rief Bink. Sie rannten darauf zu, doch schon begann das Heckenmuster zu schimmern und neblig zu werden. Das schlimmste an diesem Gewirrmuster war seine Unbeständigkeit. Es veränderte seine Anordnung in unregelmäßigen Abständen, so daß man es unmöglich auf methodische Weise durchdringen konnte. Für einen Ausbruch war es schon zu spät. »Jetzt reicht’s mir!« rief Chester. Sein Kaktus-Galopp wurde immer lauter. »Steig auf meinen Rücken!« Bink sprang ohne zu zögern auf den stacheligsten Teil des Kaktus hinauf, wobei er fast erwartete, von den Nadeln aufgespießt zu werden. Doch er landete sauber auf Chesters Rücken, der sich recht pferdig anfühlte. Puh! Als er Bink auf sich spürte, beschleunigte Chester. Bink hatte zwar bereits einmal auf einem Zentaurenrücken gesessen, nämlich als Cherie ihn freundlicherweise mitgenommen hatte – doch noch nie auf einem solchen Kraftpaket! Chester, der auch nach Zentaurenmaßstäben stämmig war, hatte es eilig, und so bäumten sich seine Muskeln mit einer solchen Kraft auf, daß Bink schon fürchtete, genauso schnell wieder abgeworfen zu werden, wie er aufgesprungen war. Doch er packte zwei Händevoll Mähnenhaare und hielt sich fest. Sein Talent würde ihn selbst hier beschützen.
Nur wenige Bewohner von Xanth wußten etwas von Binks Talent, und er selbst hatte fünfundzwanzig Jahre lang ebenfalls nichts darüber gewußt. Das lag daran, daß sich das Talent selbst verhüllte, um nicht bekannt zu werden. Es verhinderte, daß ihm durch Magie Schaden zugefügt werden konnte, doch wer davon erfuhr, konnte ihm immer noch mit mundanischen Mitteln zu Leibe rücken. Deshalb verbarg sich Binks Talent hinter scheinbaren Zufällen. Außer Bink wußte davon nur König Trent. Der Gute Magier Humfrey hatte wahrscheinlich so seine Vermutungen, und auch Chamäleon mußte etwas ahnen.
Zwischen ihnen und dem Tor bildete sich eine neue Hecke. Wahrscheinlich war es eine Illusion, da sie das Tor ja gerade gesehen hatten. Chester stürmte hindurch – da flogen die Äste! Also doch keine Illusion: Diesmal mußte das Tor wohl die Illusion gewesen sein. Die Zauberkönigin konnte Dinge verschwinden lassen, indem sie die Illusion offenen Raumes schuf. Daran hätte er früher denken müssen.
Der Zentaur war jetzt richtig in Fahrt. Unsichtbares Blattwerk schlug Bink ins Gesicht wie eine heftige Bö, doch er hielt sich unbeirrt fest. Wieder erschien ein neues Hindernis, Chester bog ein, um einem weiteren Gang zu folgen, der in die richtige Richtung führte, und durchbrach eine weitere Hecke. Wenn sich dieser Zentaur einmal in Bewegung gesetzt hatte, dann wehe dem Menschenwesen, Tier oder Gebüsch, das sich ihm in den Weg stellte!
Plötzlich waren sie aus dem Labyrinth heraus am Schloßgraben. Chesters Schwenk hatte sie jedoch zwanzig Schritte seitlich von der Zugbrücke ins Freie gebracht – und es gab keinen Platz mehr für eine Kurskorrektur. »Halt dich fest!« schrie Chester und sprang.
Diesmal war der Stoß so gewaltig, daß Bink eine doppelte Handvoll Mähnenhaare herausriß und dennoch nach hinten abglitt. Dann rutschte er vollends ab und fiel platschend in den Graben.
Sofort kamen die Grabenungeheuer mit eifrig aufgerissenen Mäulern auf ihn zu geschwommen. Sie waren stets auf der Hut. Das mußten sie auch sein, denn sonst wären sie gefeuert worden. Eine riesige Schlange stürzte sich auf ihn, mit glitzernden Fängen, die so lang waren wie Binks Finger. Auf der anderen Seite riß ein purpurnes Krokodil das riesige Maul auf und zeigte Zähne, die noch länger waren. Und unter Bink erhob sich ein Behemoth aus dem wirbelnden Grabenschlamm. Sein Rücken war so breit, daß er den ganzen Graben auszufüllen schien.
Bink schlug verzweifelt um sich und versuchte, sich schwimmend in Sicherheit zu bringen, doch er wußte genau, daß kein Mensch auch nur einem dieser Ungeheuer entkommen konnte, geschweige denn gleich dreien. Der Behemoth tauchte auf und hob ihn halb aus dem Wasser. Das Krokodil kam mit weit geöffnetem Rachen auf ihn zu, und die Schlange stieß blitzschnell von oben auf ihn herab.
Doch da – stießen Krokodil und Schlange zusammen, und ihre Zähne stoben Funken. Beide Ungeheuer wurden von den Massen des auftauchenden Behemoths beiseitegeschleudert – und Bink rutschte wie geschmiert auf dem schrägliegenden Rücken des Untiers sicher auf die Steinwand der Schloßseite. Wirklich ein erstaunliches Zusammentreffen von Ereignissen!
Chester war ebenfalls sicher auf der Schloßseite aufgekommen und zerrte ihn endgültig aus dem Graben. Es schien ihn nicht im mindesten anzustrengen. Doch als er sprach, bebte seine Stimme. »Ich dachte schon … als du mitten in diese Ungeheuer gestürzt bist … so was habe ich noch nie gesehen, wie du –«
»Ach, die waren nicht wirklich hungrig«, versuchte Bink das Ereignis herunterzuspielen. »Sie haben nur mit ihrem Fressen gespielt und es einfach übertrieben. Gehen wir rein. Inzwischen dürften die Erfrischungen aufgetischt werden.«
»Au ja!« stimmte Chester ihm zu. Wie alle kräftigen Wesen litt er unter einem chronischen Appetit.
Sie schritten auf das Schloß zu – und die Illusionen verschwanden. Der Zauber war gebrochen, sie waren wieder sie selbst, Mensch und Zentaur. »Weißt du, ich wußte ja gar nicht, wie scheußlich mein Gesicht aussieht, bis ich es an dir gesehen habe«, meinte Chester nachdenklich.
»Aber dafür hast du ein extrem gutaussehendes Hinterteil«, erwiderte Bink.
»Das stimmt, das stimmt«, sagte der Zentaur besänftigt. »Ich hab’s ja immer gesagt, daß Cherie mich nicht wegen meiner Visage genommen hat.«
Bink fing an zu lachen, merkte jedoch, daß sein Freund es ernst meinte. Außerdem befanden sie sich nun am Eingang und in Hörweite der anderen.
Der Posten am Tor furchte die Stirn.
»Wie viele hast du erraten? Bink?« fragte er mit gezücktem Notizbuch.
»Einen, Crombie«, sagte Bink und zeigte auf Chester. Dann fiel ihm die Manticora wieder ein. »Nein, zwei.«
»Dann bist du nicht mehr im Rennen«, sagte Crombie. »Der beste Bewerber bisher hat zwölf.« Er blickte Chester an. »Und du?«
»Ich will den Preis sowieso nicht haben«, sagte der Zentaur brummig.
»Ihr Jungs habt euch einfach keine Mühe gegeben«, sagte Crombie. »Wenn ich dort draußen gewesen wäre, anstatt für die Königin den Laufburschen zu spielen –«
»Ich dachte, du magst diesen Palastjob«, sagte Bink.
»Ja, schon, aber Abenteuer gefallen mir besser. Der König ist ja ganz in Ordnung, aber –« Crombie zog eine Grimasse. »Ihr kennt ja die Königin.«
»Alle Stuten sind schwierig«, sagte Chester. »Das liegt in ihrer Natur. Sie können nichts dafür, selbst wenn sie es anders wollten.«
»Da hast du recht!« bekräftigte Crombie Chesters Worte. Er war der typische Frauenhasser. »Und erst mal die mit der stärksten Magie – wer wäre sonst auf diese idiotische Maskerade gekommen? Die will doch nur mit ihrer Zauberei prahlen.«
»Viel mehr hat sie ja auch nicht zum Prahlen«, sagte Chester. »Der König beachtet sie nicht.«
»Der König ist ein kluger Magier!« stimmte Crombie ihm zu. »Wenn sie nicht gerade solchen Unfug veranstaltet, wie jetzt, macht sie mir den Palastdienst zur Hölle. Ach, ich wünschte, ich wäre mal wieder draußen auf einer richtigen Männermission wie damals, als Bink und ich –«
Bink lächelte, als er sich daran erinnerte. »Dieser Technicolor-Hagelsturm war wirklich sagenhaft, nicht wahr? Wir hatten unter dem friedlichen Gewirrbaum gelagert –«
»… und dann ist das Mädchen weggelaufen«, ergänzte Crombie. »Das waren noch Zeiten!«
Überrascht merkte Bink, wie er zustimmte. Damals hatte ihm das Abenteuer überhaupt keinen Spaß gemacht, doch jetzt, so im nachhinein, war es von einer gewissen schimmernden Aura des Glanzes umhüllt.
»Du hast mir gesagt, daß sie eine Gefahr für mich sei.«
»Und das war sie ja auch«, meinte Crombie. »Sie hat dich schließlich geheiratet, nicht wahr?«
Bink lachte, aber es wirkte ein bißchen gequält. »Wir gehen besser hinein, bevor die Erfrischungen alle sind.« Er drehte sich um und stolperte fast über einen weiteren kleinen Erdhaufen. »Habt ihr Maulwürfe im Palast?« fragte er in einem etwas scharfen Ton.
Crombie blinzelte den Erdhaufen an. »Der war eben noch nicht da. Vielleicht hat die Party ja einen magischen Maulwurf angezogen. Ich werde den Hofgärtner benachrichtigen, wenn meine Schicht zu Ende ist.«
Bink und Chester schritten hinein. Der Ballsaal des Palasts war von Königin Iris ausgeschmückt worden – natürlich. Es war eine Untersee-Dekoration: Seetang wogte aus felsigen Tiefen empor, und bunte Fische schwammen umher. An den Wänden hingen Entenmuscheln, und überall waren unterseeische Strände zu sehen, die sich auf magische Weise verschoben, so daß die Szenerie auf einen zukam, wenn man stehenblieb. Eine riesige Seeschlange zog sich um den Saal und schlängelte sich in pulsierenden Windungen durch die Wände.
Chester blickte sich um. »Sie ist zwar ein Aas und eine Angeberin, aber ich muß zugeben, daß ihre Magie beeindruckend ist. Aber ich mache mir Sorgen wegen der Essensmenge. Ob wirklich genug da ist?«
Doch diese Befürchtung erwies sich als unbegründet. Die Happen türmten sich berghoch und wurden von Königin Iris persönlich bewacht. Sie hatte eine Marinadekatze an einer Leine bei sich. Wenn jemand es wagte, sich an einer Delikatesse zu vergreifen, wurde diese von der Marinadekatze sofort mit Essig bespritzt. »Niemand bekommt etwas zu essen, bevor der große Preis vergeben worden ist«, verkündete Iris mit strengem Blick. Da sie sich als kriegerische Meerjungfrau verkleidet hatte, komplett mit spitzer Krone, Dreizack und einem mächtigen Schwanz, und die Spitzen des Dreizacks schleimüberzogen glänzten, was wohl ebenfalls eine Illusion war, aber ebensogut auch echtes Gift hätte sein können, genügte dies, um die Leute auch ohne Marinadekatze abzuschrecken.
Bink und Chester trennten sich und mischten sich unter die anderen Gäste. Fast jedes bemerkenswerte Wesen in Xanth war anwesend bis auf Chesters Stute Cherie, die sich wahrscheinlich noch immer um das Fohlen kümmern mußte, und Binks Chamäleon, die noch immer mit ihrem Unglück beschäftigt war. Auch der Gute Magier Humfrey, der niemals freiwillig unter Leute ging, fehlte.
Bink entdeckte seinen Vater Roland, der vom Norddorf gekommen war. Roland achtete darauf, Bink nicht durch allzu offene Gefühlsbezeugungen in Verlegenheit zu bringen. Sie gaben sich die Hand. »Hübsche Schuhe, mein Sohn.«
Nach der Szene mit Chamäleon war das allerdings nicht die geeignete Ablenkung. »Frisch vom Baum«, sagte Bink verlegen.
»Was hast du denn in den letzten paar Monaten so getrieben?« fragte Roland, wobei ihm Luftblasen aus dem Mund perlten. Wenn die Königin einmal eine Illusion erzeugte, dann aber auch richtig! Gewöhnliche Bürger mit ihren diversen Einzeltalenten, die die Arbeit der Zauberin sahen, konnten nur verzweifeln. Und das war ja wohl auch der Grund, weshalb die Königin diese Schau abzog.
»Och, ein bißchen Schwertkampftraining, den Garten umpflügen und so weiter«, sagte Bink.
»Ich höre, daß Chamäleon jeden Augenblick so weit sein kann.«
»Ja, das auch«, erwiderte Bink und mußte wieder daran denken, wie entnervend doch die Situation war.
»Ein Sohn wird das Haus lebendiger machen.«
Vorausgesetzt, es ist ein normaler, talentierter Sohn. Bink wechselte das Thema. »Wir haben eine zarte junge Damenschuhpflanze, die gerade blüht. Ich denke, daß sie bald ihr erstes Pantoffelpaar tragen wird.«
»Das wird den Damen gefallen«, sagte Roland ernst, als sei dies eine wichtige Nachricht. Plötzlich merkte Bink, daß er für das vergangene Jahr eigentlich kaum etwas vorzuweisen hatte. Was hatte er denn schon erreicht? So gut wie nichts. Kein Wunder, daß er sich unbehaglich fühlte!
Die Beleuchtung wurde matter. Es war, als ob die Dämmerung eingesetzt hätte und das Meer ebenfalls dunkel geworden wäre. Doch dann wurde das Tageszwielicht durch nächtliches Leuchten ersetzt. Die Schwimmkörper der Algen glommen wie kleine Lampen, und die Neon-Korallen leuchteten in verschiedensten Farben. Sogar die flauschigen Schwämme strahlten warmes Licht ab. Die Fauna war schärfer beleuchtet, elektrische Aale strahlten mit ihren Scheinwerfern, und verschiedene Fische glühten durchsichtig. Alles sah betörend schön aus.
»Wenn ihr Charakter doch nur so ausgezeichnet wäre wie ihr Geschmack«, murmelte Roland.
»Wir werden jetzt den Preis für unser Spiel vergeben«, verkündete Königin Iris. Sie leuchtete am kräftigsten von allen: Aus den Spitzen ihrer Krone und ihres Dreizacks strömten Lichtfäden, und ihr schöner Meerjungfraubusen war
deutlich zu erkennen. Sie war eine Meisterin der Illusion. Sie konnte sich so schön machen, wie sie wollte – und sie wußte, was sie wollte.
»Es soll ja eine Zweckheirat gewesen sein«, fuhr Roland fort. Obwohl er selbst kein Magier war, hielt er den Posten eines königlichen Regenten nördlich der Spalte inne und begegnete dem Königtum keineswegs nur voller Ehrfurcht. »Manchmal muß das äußerst zweckmäßig sein.«
Bink nickte. Er war etwas verlegen, als er merkte, wie sehr sein Vater die wohlpräsentierten, wenn auch illusionären Reize der Königin zu schätzen wußte. Der Mann war schließlich schon fast fünfzig! Und doch stimmte es wohl. Der König hatte nie vorgegeben, die Königin zu lieben, und beherrschte die temperamentvolle Frau mit feinfühliger, aber eiserner Hand, was jene verwunderte, die Iris vor ihrer Eheschließung gekannt hatten. Und doch blühte sie unter diesem Regiment auf. Jene, die den König gut kannten, wußten, daß er nicht nur ein stärkerer Magier war als sie, sondern auch eine stärkere Persönlichkeit. Tatsächlich schien das magische Land Xanth seinen fähigsten König seit der Vierten Welle und der Regentschaft von Roogna, dem Erbauer des Palastes, gefunden zu haben. Schon jetzt waren erhebliche Veränderungen zu verzeichnen: Der magische Schild, der Xanth vor Eindringlingen geschützt hatte, war abgeschafft worden, und man gestattete es mundanischen Wesen, über die Grenze zu kommen. Als erste waren die Mitglieder der früheren mundanischen Armee des Königs nach Xanth gekommen. Sie hatten sich in wilden Gegenden angesiedelt und waren dabei, zu produktiven Bürgern Xanths zu werden. Die Vorschrift, daß jeder Bürger ein magisches Talent nachweisen mußte, war ebenfalls außer Kraft gesetzt worden – und zur großen Verwunderung einiger Konservativer war das gefürchtete Chaos ausgeblieben. Jetzt wurden Leute nicht nur wegen ihrer zufälligen Magie bekannt, sondern man respektierte und schätzte sie auch wegen ihrer anderen Charaktereigenschaften. Ausgesuchte Trupps erkundeten das nahe Mundania, wo es keine Magie gab, und vorgeschobene Beobachtungspostensorgten dafür, daß das Land nicht im Überraschungsangriff überrannt werden konnte. Der König hatte den Schildstein nicht vernichtet. Wenn es sein mußte, würde er den Schild sofort wieder errichten.
Bink war jedenfalls überzeugt davon, daß König Trent einen Blick für alles Gute und Nützliche besaß, auch was schöne Frauen betraf. Er brauchte nur ein Wort zu sagen, und die Königin würde genau das sein, was der König sich wünschte – und er wäre kein Mann gewesen, wenn er nicht zumindest gelegentlich davon Gebrauch gemacht hätte. Die Frage war eher, was er sich wohl wünschte. Das war ein im Palast gängiges Spekulationsthema, und die vorherrschende Meinung besagte, daß der König sich Vielfalt wünschte. Die Königin erschien nur selten zweimal in der gleichen Gestalt.
»Palastwache, den Bericht!« verlangte die Königin gebieterisch.
Langsam trat Soldat Crombie vor. Er sah schneidig aus in seiner Palastuniform, jeder Zoll ein Soldat, in einem Königreich, das nur weniger Soldaten bedurfte. Er wußte gut und mörderisch mit dem Schwert oder auch seinen bloßen Händen zu kämpfen, und er haßte es, den Diener einer Frau zu spielen – und machte keinen Hehl daraus. Deshalb gefiel es ihr auch, ihn herumzukommandieren. Doch sie konnte ihn nicht zu weit treiben, denn seine Treue galt dem König; und er stand in der Gunst des Herrschers.
»Der Gewinner –«, fing Crombie an und blickte auf seine Notizen.
»Doch nicht so, du Trottel!« schrie sie ihn an und ließ ihn in einer Wolke undefinierbarer Färbung verschwinden. Natürlich war auch das nur eine Illusion, aber eine recht eindrucksvolle. »Erst gibst du den Zweitbesten bekannt und dann den Sieger! Kannst du denn gar nichts richtig machen?«
Crombies zorniges Gesicht erschien aus der dünner werdenden Wolke. »Frauen!« knurrte er mit ätzendem Ton. Die Königin lächelte. Sie genoß seine Wut. »Zweitbester mit neun richtigen Demaskierungen ist –« Wieder zog er eine Grimasse. »Eine Frau. Bianca vom Norddorf.«
»Mutter!« flüsterte Bink erstaunt.
»Rätsel haben ihr schon immer Spaß gemacht«, sagte Roland stolz. »Ich glaube, du hast ihre Intelligenz und ihr gutes Aussehen mitbekommen.«
»Und meine Tapferkeit und meine Kraft habe ich von dir«, erwiderte Bink, den das Kompliment freute.
Bianca schritt gefaßt zum Podest. Sie war eine gutaussehende Frau, die in ihrer Jugend einmal sehr schön gewesen war, und anders als bei der Königin war es echt. Ihr Talent war nicht die Illusion, sondern die Wiederholung von Ereignissen.
»Die Frauen haben sich also mal wieder behauptet«, sagte die Königin und blickte Crombie, den Frauenhasser, hämisch an. »Der Preis ist –« Sie machte eine Pause. »Türsteher, hole den zweiten Preis. Du hättest ihn schon längst hierhaben sollen.«
Crombies Miene verfinsterte sich unheildrohend, aber er schritt zum Schrank, der halb von Algen überwuchert war, und holte einen bedeckten Behälter hervor.
»Der Preis ist«, wiederholte die Königin und riß den Deckel auf, »ein eingetopftes Löwenmäulchen!«
Als die zahlreichen Mäulchen der Pflanze sich auf ihren Stielen drehten und heimtückisch um sich schnappten, stießen die anwesenden Damen Rufe wohlgemeinter Ehrfurcht und des Neides aus. Löwenmäulchen waren sehr brauchbar, um Insekten und Ungeziefer zu vernichten, und sie waren auch gute Hauswächter. Wehe dem Eindringling, der auf eine solche Pflanze trat oder sich ihr nur näherte! Doch sie ließen sich nicht ohne weiteres eintopfen, so daß sie mit einem besonderen Zauber festgehalten werden mußten. Folglich waren wild wachsende Löwenmäulchen oft zu finden, eingetopfte hingegen stellten eine geschätzte Rarität dar.
Bianca strahlte vor Freude, als sie die Pflanze entgegennahm, und drehte den Kopf mit einem Lächeln zur Seite, als ein kleines Löwenmaul nach ihrer Nase schnappte. Zum Eintopfungsvorgang gehörte es auch, die Pflanze für den Besitzer verträglich zu machen, doch es dauerte immer eine Weile, bis das Gewächs wußte, wer sein Besitzer war. »Sie ist sehr schön«, sagte sie. »Danke, Königin Iris.« Dann fügte sie diplomatisch hinzu: »Ihr seid ebenfalls sehr schön – aber auf andere Weise.«
Die Königin schnappte mit ihren Zähnen wie ein Löwenmäulchen und lächelte huldvoll. Sie sehnte sich nach der Anerkennung und dem Lob solch angesehener und alteingesessener Bürger und Bürgerinnen wie Bianca, weil sie vor der Krönung jahrelang quasi im Exil gelebt hatte. »Und jetzt zum Gewinner, Lakai«, sagte sie zu Crombie. »Und diesmal mit ein bißchen Flair, sofern du welches aufbringen kannst.«
»Der Sieger ist, mit dreizehn Punkten«, sagte Crombie in langgezogenem Tonfall und ohne das geringste Flair, »Millie das Gespenst.« Er zuckte mit den Schultern, wie um seiner Verwirrung Ausdruck zu verleihen, daß schon wieder eine Frau gewonnen hatte. Er hatte die Punkte selbst ausgezählt, so
daß er sicher war, daß niemand geschummelt hatte. Doch es war allgemein bekannt, daß die Männer sich auch nicht sonderlich angestrengt hatten.
Das hübsche, jugendlich wirkende Gespenst schwebte herbei. Sie war sozusagen sowohl die jüngste als auch die älteste Bewohnerin von Schloß Roogna. Sie war noch ein junges Mädchen gewesen, als sie vor achthundert Jahren gestorben war. Als Bink sie zum ersten Mal erblickt hatte, war sie nur ein formloser Nebelfleck gewesen, doch seit das Schloß wieder von Menschen bewohnt wurde, hatte sie ihre Umrisse gefestigt, und nun war sie so ansehnlich und stofflich anzuschauen wie eine lebendige Frau. Sie war ein äußerst liebenswürdiges Gespenst, das alle mochten, und ihr Sieg wurde mit großem Beifall begrüßt.
»Und der große Preis ist –« Die Königin breitete theatralisch die Hände aus, »… dieser Gutschein über eine kostenlose Antwort vom Guten Magier Humfrey!« Im Hintergrund erschollen Fanfaren, deren Klänge vom magisch verstärkten donnernden Applaus übertönt wurden, während Iris dem Gespenst das Papier überreichte.
Millie zögerte. Da sie keine stoffliche Substanz besaß, konnte sie das Zertifikat nicht festhalten.
»Das geht schon in Ordnung«, sagte die Königin. »Ich werde einfach deinen Namen darauf schreiben, dann weiß der Magier Humfrey, daß es dir gehört. Wahrscheinlich beobachtet er uns im Augenblick sowieso in seinem magischen Spiegel. Warum stellst du deine Frage nicht gleich?«
Millies Antwort war nicht zu hören, denn sie konnte nur gespenstisch flüstern.
»Mach dir keine Sorgen, ich bin sicher, daß dir alle gerne helfen werden«, meinte die Königin. »Hier – wir schreiben es auf die magische Tafel, dann kann der Magier Humfrey auf gleiche Weise antworten.« Sie winkte Crombie herbei.
»Los, Drückeberger, die Tafel!«
Crombie zögerte, doch schließlich gewann seine Neugier die Oberhand, und er brachte die Tafel. Die Königin verpflichtete den nächsten Zentauren (das war zufällig Chester, der die ganze Zeit erfolglos versucht hatte, einen Keks vom Büffet zu stibitzen, ohne daß er mariniert wurde), die unhörbaren Worte des Gespensts aufzuschreiben. Zentauren konnten lesen und schreiben, und viele von ihnen waren Lehrer, so daß ihnen stets die Schreibarbeiten übertragen wurden.
Chester mochte die Königin ebensowenig wie Crombie, aber auch er machte gute Miene zum bösen Spiel. Was konnte ein Gespenst einem Magier nur für eine Frage stellen? Er schrieb in großen Schnörkeln: WIE KANN MILLIE WIEDER LEBENDIG WERDEN?
Noch mehr Applaus. Den Gästen gefiel diese Frage. Sie stellte eine Herausforderung dar – und von der öffentlich verkündeten Antwort konnten sie vielleicht selbst neue Einsichten gewinnen. Normalerweise verlangte der Magier Humfrey für die Beantwortung einer Frage einen Jahresdienst, und nur diejenigen erhielten Antworten, die ihre Fragen auch stellten. Das Fest wurde immer interessanter!
Wie von einem unsichtbaren Schwamm fortgewischt, verschwanden die Worte. Dann erschien die Antwort des Magiers: DAFÜR GIBT ES DREI BEDINGUNGEN: ERSTENS – DU MUSST WAHRHAFTIG LEBENDIG WERDEN WOLLEN.
Es war offensichtlich, daß dies der Fall war. Sie bat die Tafel mit einer beschwörenden Geste, weiterzumachen, um zu sehen, ob die anderen Bedingungen ebenso einfach waren – oder auch unmöglich. Rein technisch gesehen, wie man so sagte, war der Magie nichts unmöglich, aber in der Praxis erwiesen sich manche Zauber als geradezu verboten schwierig. Bink fühlte mit ihr: Auch er hatte sich einmal heftig nach etwas gesehnt, nämlich nach magischem Talent, wovon damals sein Bürgerstatus, sein Wohlergehen und seine Selbstachtung abhingen. Was mußte die Sterblichkeit für jemanden, der zwar nicht mehr am Leben, aber auch nicht wirklich tot war, für eine Verheißung sein! Wenn Millie wirklich zum Leben erweckt wurde, würde sie natürlich eines Tages endgültig sterben, aber damit würde sie das Leben beenden, das sie vor vielen Jahrhunderten begonnen hatte. Als Gespenst hing sie in der Schwebe – sie konnte ihr Schicksal nicht erfüllen, da sie unfähig war, Liebe, Furcht und Gefühle zu empfinden.
Nein, das stimmte nicht ganz, berichtigte Bink sich selbst. Es war offensichtlich, daß sie Gefühle hatte, aber auf andere Weise als stoffliche Menschen. Sie konnte weder körperliche Freuden noch Schmerz erfahren.
ZWEITENS, fuhr die Tafel fort, BRAUCHST DU EINEN ZAUBERDOKTOR, DER DEIN TALENT WIEDER VOLL UND GANZ HERSTELLT.
»Haben wir einen Zauberdoktor im Haus?« fragte die Königin und blickte sich mit blitzenden Zacken um. »Nein? Also gut. Dienstbote – zeig uns, wo der nächste Zauberdoktor ist.«
Crombie wollte wütend losknurren, doch wieder behielt seine Neugier die Oberhand. Er schloß die Augen, wirbelte um seine eigene Achse und streckte den rechten Arm aus. Seine Hand zeigte Richtung Nordosten.
»Das kann nur das Spaltendorf sein«, sagte die Königin. Auf der Spalte, jener gewaltigen Schlucht, die das Land Xanth in einen Nord-und einen Südteil unterteilte, ruhte ein Vergessenszauber, doch man hatte einen punktuellen Gegenzauber für das Schloß verhängt, damit seine Bewohner und Besucher sich daran erinnern konnten, denn sonst wäre dem König das Regieren sicherlich sehr schwer gefallen. »Wo ist unser Reisezauberer?«
»Schon unterwegs, Hoheit«, sagte ein Mann. Er richtete sich in die von Crombie angezeigte Richtung aus und konzentrierte sich – da stand plötzlich eine alte Frau vor ihnen. Sie blickte verwirrt um sich, als sie all die Leute und das Wasser sah, denn sie befanden sich immer noch in der Unterseeillusion.
»Du bist eine Zauberdoktorin?« fragte die Königin.
»Ja«, erwiderte die Alte. »Aber ich doktore nicht für komische Leute auf dem Meeresgrund. Erst recht nicht, wenn man mich von der Wäsche wegholt, ohne mich –«
»Du befindest dich auf König Trents Krönungsjubiläumsball«, sagte die Königin kühl. »Und jetzt hast du die Wahl, Alte. Entweder du doktorst uns einen Zauber und darfst dafür an dem Fest teilnehmen, mit soviel Essen und Spaß, wie du nur willst, und in einem solchen Kostüm –« Plötzlich trug die alte Frau die Kleidung einer Hofmatrone – dank der Illusionsmagie der Königin. »Oder du doktorst den Zauber nicht und wirst dafür von diesem Wesen hier mariniert.« Sie hielt ihr die Marinadekatze entgegen, die eifrig zischte.
Die alte Frau machte, wie Crombie und Chester auch, ein unwirsches Gesicht, entschied sich aber fürs Einlenken. »Was für einen Zauber?«
»Millies Zauber«, sagte die Königin und zeigte auf das Gespenst.
Die Zauberdoktorin musterte Millie und fing an zu gackern. »Fertig«, sagte sie und lächelte so breit, daß alle ihre vier Zähne zu sehen waren.
»Was ist daran wohl so komisch?« murmelte Roland. »Weißt du, welches Talent Millie besitzt?«
»Gespenster haben keine Talente«, meinte Bink.
»Ihr Zauber im Leben. Es muß irgend etwas Besonderes sein.«
»Muß wohl. Ich nehme an, wir werden es feststellen, wenn sie die dritte Bedingung erfüllen kann.«
DRITTENS, fuhr die Tafel fort, MUSST DU DEIN SKELETT IN HEILELIXIER TAUCHEN.
»Davon haben wir jede Menge«, sagte die Königin. »Lakai – «
Doch der Soldat war schon unterwegs. Kurz darauf kehrte er mit einem Bottich voll Elixier zurück.
»So – wo ist jetzt dein Skelett?« wollte die Königin wissen.
Doch Millie zögerte. Sie schien reden zu wollen, war aber offenbar unfähig, ein Wort herauszubringen.
»Ein Schweigezauber!« rief die Königin. »Du darfst nicht verraten, wo es ist! Deshalb ist es auch all die Jahrhunderte verborgen geblieben!«
Millie nickte traurig.
»Das wird ja immer besser!« sagte die Königin. »Wir werden eine Schatzsuche veranstalten! In welchem Schrank verbirgt sich Millies Skelett? Einen Sonderpreis für denjenigen, der es findet!« Sie überlegte kurz. »Hm, ich habe keine normalen Preise mehr … Ich weiß! Das erste Rendezvous mit Millie, der Sterblichen!«
»Aber was, wenn eine Frau das Skelett findet?« fragte jemand.
»Dann lasse ich sie von meinem Mann für die Zeit in einen Mann verwandeln«, sagte die Königin.
Unsicheres Lachen – war das ein Scherz, oder meinte sie das etwa ernst? Soweit Bink wußte, konnte der König jedes Lebewesen in ein beliebiges Lebewesen gleichen Geschlechts verwandeln. Im übrigen wandte er sein Talent niemals aus reiner Laune oder frivol an. Also mußte sie doch scherzen. »Aber was ist mit dem Essen?« fragte Chester.
»Jetzt haben wir’s!« entschied sie. »Die Frauen haben bereits ihre Überlegenheit unter Beweis gestellt, also dürfen sie an der Schatzsuche nicht teilnehmen. Sie werden sich schon mal an das Büffet machen, während die Männer auf die Suche gehen – « Doch da sah sie, wie Chester anschwoll, und begriff, daß sie zu weit gegangen war. »Also gut, die Männer dürfen auch etwas essen, selbst die, die einen Appetit haben wie ein Ackergaul. Aber keiner rührt die Jubiläumstorte an! Die wird der König anschneiden – wenn die Schatzsuche vorbei ist.« Einen Augenblick lang wirkte sie nachdenklich, was sehr ungewöhnlich war. War sie sicher, daß der König mitmachen würde?
Die Torte war wunderbar: Schicht auf Schicht köstlichster Zuckergußglasur, mit einer großen 1 und gekrönt mit einer lebensechten Büste von König Trent. Die Königin versuchte stets, den Ruhm und Glanz des Königs zu erhöhen, weil ihr eigener Ruhm ein Abglanz davon war. Irgendein armer Küchenmeister hatte sich sehr viel Mühe mit der Magie für dieses verschnörkelte Backwerk geben müssen!
»Marinadekatze, bewach diese Torte und marinier mir jeden, der es wagt, sie anzurühren«, sagte die Königin und befestigte die Leine der Katze an einem Bein des Tortenständers. »Und nun, Männer – auf Schatzsuche!«
Roland schüttelte den Kopf. »Skelette in Kleiderschränken läßt man lieber in Ruhe«, bemerkte er. »Ich glaube, ich werde mal deiner Mutter gratulieren.« Er blickte Bink an. »Du wirst unsere Familie bei der Schatzsuche vertreten müssen. Aber du brauchst dich bei der Suche nicht übermäßig anzustrengen.« Mit einer Abschiedsgeste verschwand er in den schimmernden Fluten des Meeres.
Bink blieb einen Augenblick nachdenklich stehen. Es war offensichtlich, daß sein Vater wußte, daß etwas mit ihm nicht stimmte, sich aber nicht näher dazu äußern wollte.
Aber was war denn nun nicht in Ordnung? Bink wußte, daß er ein angenehmes Leben führte, mit einer guten, wenn auch etwas wandelbaren Frau, und in der Gunst des Königs stand. Warum träumte er dann von Abenteuern in fernen Gegenden, vom Gebrauch seiner Schwertkunst, von Gefahr und sogar vom Tod, obwohl er wußte, daß sein Talent ihn vor allen echten Bedrohungen schützen würde? Was war nur los mit ihm? Irgendwie schien es, als sei er glücklicher gewesen, als seine Zukunft noch ungewisser gewesen war – und das war doch lächerlich!
Warum war Chamäleon nicht dabei? Sicher, sie stand kurz vor der Niederkunft, aber wenn sie gewollt hätte, hätte sie durchaus am Ball teilnehmen können. Zum Palaststab gehörte auch eine magische Hebamme.
Er faßte seinen Entschluß. Auf zur Schatzsuche! Vielleicht konnte er sich ja selbst beweisen, indem er das Skelett im Wandschrank entdeckte.