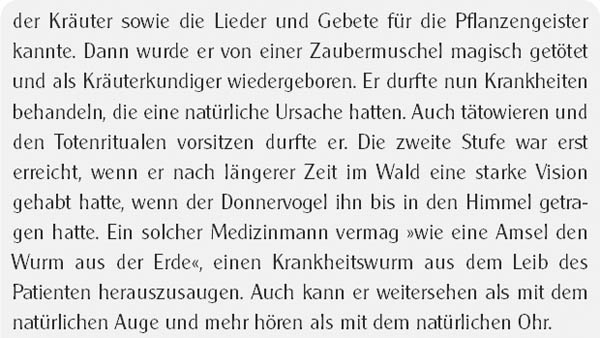
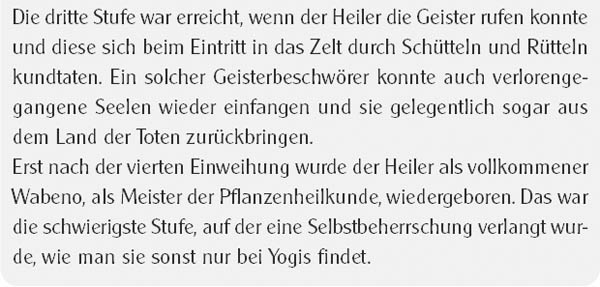
Ähnliche Einweihungsgrade findet man überall, wo es um das Heilen mit Pflanzen geht. Die Kraft des Heilers, des Pflanzenschamanen hängt davon ab, wie offen er für die lebendige Geistigkeit der Natur ist. Um die Hinweise hilfreicher Tiere verstehen und den Pflanzen zuhören zu können, um also empfänglich und fruchtbar zu werden, müssen alte Konditionierungen und Programmierungen abgelegt werden. Das bedeutet, daß die alltägliche egozentrische Persönlichkeit mit ihren festen Vorstellungen davon, wie die Dinge zu sein haben, abdankt. Erst dann kann ein höheres Bewußtsein ihren Platz einnehmen.
Das ist nicht leicht, denn das beschränkte Ego hat Angst um sein Dasein, um seinen Platz am Futtertrog, um sein Ansehen, um seinen Besitz. Damit sich die Tore zu den transpersonellen Dimensionen, in denen die Geister und Devas verkehren, auftun, müssen alle Schlauheiten und Gemeinheiten, mit denen sich das niedere Ego schützt, abgestreift werden. Dies empfindet das defensive Ego als tödliche Bedrohung. Es fürchtet sich davor, wehrt ab und blockiert. Auch die psychoanalytische Couch, der LSD Trip oder ein paar teure esoterische Wochenenden helfen da nicht viel, denn auch mit diesen Dingen versucht sich meist nur das sterbliche Ego zu profilieren.
Was hier geschehen muß, wird von außen, aus höheren Dimensionen an den geeigneten Menschen herangetragen. Deshalb sind es immer die Geister, die Götter, die Ahnen, die Gottesmutter oder Gott, welche durch Krankheit und schwere Schicksalsschläge das Ego töten, damit sich der Mensch der göttlichen Gnade, der Ewigkeit, der transzendenten Dimensionen, seiner wahren Berufung, der Quelle des Heils bewußt werden kann. Dann kann er mit wahrer Autorität, die aus geistigen Quellen gespeist wird, die heilenden Kräfte der Devas vermitteln.
In Indien wird die traditionelle Kräuterheilkunde nicht nur von ayurvedischen Ärzten, sondern vor allem von wandernden Sadhus ausgeübt. Sadhus sind keine Menschen im gewöhnlichen Sinne mehr. Sie haben Beruf, Familie, Kastenzugehörigkeit, sämtlichen Besitz, ja sogar ihren Namen hinter sich gelassen und sich ganz Gott hingegeben. Ihre Weihe findet um Mitternacht auf einem Leichenverbrennungsplatz statt. Einst gingen sie splitternackt, weil sie keinen irdischen Besitz mehr ihr eigen nennen; heute tragen sie ein rotes Gewand, welches das alles verzehrende Feuer des Scheiterhaufens symbolisiert. Die Sadhus weihen sich meistens Shiva (»der Gütige«), dem Zerstörer der Illusionen und Uryogi, aus dessen Meditation das Universum hervorgeht. Shiva wird ausdrücklich als Aushadhishvara, Herr der Kräuter und Pflanzen, verehrt. Weil den Sadhus, die selbst schon wie Geister sind, die jenseitigen Welten offenstehen, können sie mit den Geistern der Pflanzen reden, genau wie sie die parasitischen Entitäten sehen können, die auf dem Nährboden böser Taten und Gedanken entstehen und die Menschen krank machen. Wenn ein wandernder Sadhu in ein Dorf kommt, eilen Junge und Alte herbei, lauschen seinen Geschichten und hoffen auf seinen Segen. Oft gibt er den Kranken die Kräuter, die diese zu ihrer Heilung bedürfen und die damit verbundenen Ratschläge. Weil diese heiligen Männer (es gibt auch Sadhvis, heilige Frauen) keinen Kastenvorschriften unterworfen sind, können sie mit allen ohne Tabu verkehren, auch mit den unberührbaren kräuterkundigen Waldbewohnern (Adavasi) und Hirten. Auf diese Weise vervollständigen sie ihr Heilwissen ständig.
Das alltägliche Ego des Schamanen oder Sadhus stirbt, aber es stirbt auch nicht. Der Mensch braucht es, um im alltäglichen, irdischen Dasein seine Integrität zu bewahren. Es wurde, wie die Inder sagen, in der Schöpfung von Anfang an mitveranlagt. Alle diesseitigen Wesen haben ihr Ahamkara, ihren »Ich-Macher«. Nur wird er nach der Einweihung an seinen rechten Platz verwiesen. Er ist nun der Diener des unsterblichen »höheren Selbst«. Er ist nun der Bhakti, der sich liebevoll dem offenbarten Göttlichen weiht; er ist der treue Heinrich, der fromme Knecht, der Ramdas (Sklave Gottes). So oder ähnlich haben sich viele Schamanen bezeichnet. »Ich kann nicht heilen, es sind die Devas, die Götter«, sagen sie. Kräuterheiler werden immer als sehr einfache, schlichte, unverdorbene Menschen beschrieben.
Flora Jones, die eigentlich Piu-lu-li-Met (die »Östliche Blumenfrau«) heißt, ist die letzte Wintu-Pflanzenschamanin. Auch sie sieht sich vor allem als Werkzeug der Geistwesen. Die Wintu, ein Stamm im nördlichen Kaliforniern, sind im Schmelztiegel Kaliforniens fast aufgegangen. Flora war ein zwischen den Kulturen hin- und hergerissenes Mischlingskind, das von einer Karriere als Hollywood Star träumte. Die Widersprüche ihrer Erziehung machten sie krank und plagten sie mit Selbstzweifeln, bis eines Tages die alten Stammesgeister sie berührten: Als Siebzehnjährige fiel sie beim Kartenspiel in Trance. »Es war wie ein heißes Geschoß, das durch mein Ohr jagte. Der Schmerz ging durch und durch, und ich war vier Tage lang bewußtlos.« (Schenk/Kalweit 1987:251) Die letzten noch lebenden Schamanen der Wintu erkannten, daß die Geister sie als Medizinfrau erwählt hatten. Sie betreuten und besangen sie in dieser schwierigen Phase. Ihr Geist lernte, den Pfad zu wandeln, den die Toten in die andere Welt nehmen, und dabei mit den Kräutern und Blumen am Wegrand zu sprechen. Erst viele Jahre später nahm sie ihre Tätigkeit als Medizinfrau auf.
Ethnologen berichten immer wieder von sogenannten Schamanistischen »Einweihungskrankheiten«, die sich oft tage-, wenn nicht wochen- oder monatelang hinziehen. Der von den Geistern oder Ahnen Berufene leidet alle möglichen Schmerzen und erlebt Ohnmachtsanfälle und dergleichen. Dieses Stadium ist nicht ungefährlich. Gelegentlich findet der Berufene den Weg nicht mehr zurück und stirbt tatsächlich. In traditionellen Kulturen wird der von den Göttern heimgesuchte – wie wir es in Floras Fall gesehen haben – von älteren Schamanen betreut, besungen und beräuchert. Sie prüfen auch, ob es eine echte Berufung ist oder nur eine geistige Verwirrung.
Moderne Kräuterkundige
Nun mag man meinen, in unserer Gesellschaft gebe es so etwas nicht. Oder wenn jemand von den Geistern, den Ahnen, Gott oder der Gottesmutter berufen wird, müsse er sich hüten, nicht zum psychiatrischen Fall zu werden. Aber auch bei uns gibt es, öfter als man meint, echte Berufungen, verbunden mit Einweihungskrankheiten und der weisheitsvollen Führung transpersoneller Mächte. Die meisten bleiben unbekannt und unbesungen. Schauen wir nun die Lebensgeschichten einiger bekannter Pflanzenheiler aus unserem Kulturkreis an.
Sebastian Kneipp (1821-1897)
Sebastian Kneipp war ein wahrer Erneuerer der Pflanzenheilkunde. Viele längst vergessene Heilpflanzen, wie den Schachtelhalm, den Weißdorn, die Heublumen und das Johanniskraut, hat er erneut ins Bewußtsein der Menschen gebracht. Kneipp ist zwar vor allem für seine Wasserkuren bekannt, aber er schreibt selbst: »Ich habe viele Jahre hindurch zum größten Teil mit Kräutern und weniger mit Wasser kuriert und dabei die schönsten Erfolge erzielt.« (Kaiser 1996:259)
Kneipp war der Sohn armer Weber im Allgäu. Schon als Elfjähriger arbeitete er im kalten, zugigen Keller am Webstuhl. Um der bitteren Armut zu entrinnen, arbeitete er, so viel er nur konnte, gönnte sich nichts und versteckte sein mühsam erspartes Geld unter dem Dach. Er wollte Pfarrer werden, um den Armen zu helfen. Doch dann – er war gerade einundzwanzig Jahre alt – brannte das Haus der Weber ab, samt seinen Ersparnissen. Ihm blieb nur das Hemd und die Hose, die er anhatte. Zum Glück nahm ihn ein Kaplan auf, der es ihm ermöglichte, aufs Gymnasium zu gehen. Doch ausgezehrt von all den Entbehrungen bekam er Bluthusten. Er wurde zusehends schwächer, magerte ab und verbrachte die halbe Zeit im Bett. Der Arzt stellte fest, daß beide Lungenflügel von der Lungenschwindsucht angegriffen waren. Diese Diagnose war ein sicheres Todesurteil. Doch durch Zufall stieß Kneipp kurz darauf auf ein, von einem Johann Sigmund Hahn 1737 verfaßtes, Buch mit dem Titel Die wunderbare Heilkraft des frischen Wassers bei dessen innerlichem und äußerlichem Gebrauch, durch die Erfahrung bestätigt. Er sah es als Fingerzeig Gottes und versuchte die darin beschriebene Kur. Nachts, mitten im Winter, ging er dreimal pro Woche zur Donau und tauchte einige Sekunden lang in dem eiskalten Wasser unter. Im Dauerlauf rannte er dann den dreiviertel stündigen Weg zurück in seine Kammer, legte sich in warme Decken gewickelt ins Bett und schwitzte.
Wie ein echter Schamane heilte er sich selbst. Nicht nur das, er gewann auch an Charakterstärke, und die Heilkraft wurde in ihm erweckt.
Später als Kaplan half er den ärmsten Kranken, jenen, die die Ärzte schon aufgegeben oder, weil sie nicht zahlen konnten, abgewiesen hatten. Er traktierte sie mit Wassergüssen und Kräutern. »Wer selbst in Not und Elend saß, weiß Not und Elend des Nächsten zu würdigen«, sagte er dazu. Als die Cholera, von Wanderburschen eingeschleppt, im Dorf ausbrach, ging er mit heißen Essigwickeln und heißer Fenchelmilch ans Werk. Kein einziger seiner zweiundvierzig Pfleglinge starb. Nun war er so bekannt, daß es zu Anfeindungen und Anklagen seitens der etablierten Mediziner kam und er die Rüge seines Bischofs hinnehmen mußte. Erst als Prominente, etwa der Erzherzog Joseph von Österreich, den Weg zu ihm fanden und von ihren Leiden geheilt wurden, konnte er ungehindert praktizieren.
Kneipp legte großen Wert darauf, daß sich die Kranken ihre Heilkräuter selbst sammeln und bereiten. Das Suchen und Sammeln in der Natur, in »des Herrgotts Garten«, und das Zubereiten der Tees, Öle und Kräuterweine wirkt, nach seiner Ansicht, ebenfalls heilend. Er war aus geistiger Einsicht überzeugt, daß »für jede Krankheit ein Kräutlein gewachsen ist!« Heißt es doch in der Heiligen Schrift: »Der Herr läßt die Arznei aus der Erde wachsen, und ein Vernünftiger verachtet sie nicht!« (Sirach 38, Vers 4)
Johann Künzle (1857-1945)
Der Schweizer Kräuterpfarrer Künzle wuchs als jüngster Sohn bitterarmer Kleinbauern im St. Gallener Land auf. Zwei Kühe und fünf Hennen nannten sie ihr eigen. Nur fünf seiner zwölf Geschwister erreichten das reife Alter. Vom Vater, der sich nebenbei als Gärtner verdingte, lernte er viele Pflanzennamen. Als Bauernbub kannte er ohnehin viele alte Kräuterrezepte.
Später, im zweiten Jahr als Student im Benediktinerkollegium zu Einsiedeln, erkrankte er schwer an einer Lungenentzündung. Das Leiden wurde chronisch und ging allmählich in Lungenauszehrung über. Da ihm die Arzte nicht mehr helfen konnten, heilte er sich – ähnlich wie Kneipp – mit Hilfe seiner geliebten Kräuter selbst. (Künzle 1982:16) Um diese Zeit hörte er an einem Ostersonntag im Halbschlaf eine Stimme, die er für die eines Engels hielt: »Zeige den Menschen, was für Wunder gerade die Bergpflanzen in sich tragen!« (Golowin 1993:34)
Künzle, als Vierundzwanzigjähriger zum Priester geweiht, nahm sein Amt ernst. Er stand seiner Gemeinde auch in Krankheitsfällen bei, vor allem dann, wenn die Ärzte keinen Rat mehr wußten. Er vertiefte sein Kräuterwissen durch das Studium des Kneipp-Buches, in dem um die 40 Kräuter angeführt werden, und irgendwann kam ihm bei einer Versteigerung das Kräuterbuch des alten Kräuterarztes Tabernaemontanus (gedruckt 1687) in die Hände. Er vertiefte sich darin und gründete seine Kräutermedizin darauf. Sein Ruf als wundertätiger Kräuterheiler verbreitete sich rasch, nachdem er seine Gemeinde vor der schrecklichen Grippeepidemie bewahrte, die im Jahre 1918 weltweit Millionen Menschen hinweggerafft hatte. Erhandelte aus Nächstenliebe und nahm nie Geld für seine Dienste. Dennoch wurde er von erbosten Ärzten wegen Kurpfuscherei angezeigt. Das Gerichtsverfahren löste eine Sympathiewelle für ihn aus, und es kam sogar zu einem Volksbegehren. Die Untersuchungskommission verblüffte er mit seinem beträchtlichen Wissen. Sie hatte keine Wahl, als ihn weiter praktizieren zu lassen.
Zuletzt ließ er sich von seinem Priesteramt entbinden, um nur noch der wachsenden Zahl der Heilung Suchenden mit Heilkräutern und Gebet beistehen zu können.
Maria Treben (1909-1991)
Die umstrittene »Gottesapothekerin« war bis vor einigen Jahren eine typische Grieskirchener Hausfrau, die sich besonders gut mit Kräutern auskannte. Der Pfarrer des Dorfes veranlaßte sie, einige ihrer Kräutererfahrungen für das örtliche Kirchenblatt aufzuschreiben. Diese Beiträge wurden irgendwann zu einer Broschüre zusammengefaßt, und daraus entstand das Buch Gesundheit aus der Apotheke Gottes, das mit über acht Millionen verkauften Exemplaren zu einem Bestseller des Jahrhunderts geworden ist.
Wie konnte dieses Büchlein ohne glänzende Farbfotos und mit recht dürftigem Text ein solcher Mammuterfolg werden? Es ist eben gerade diese Schlichtheit, die die Menschen anspricht. Man braucht kein Pharmakologe oder Mediziner zu sein, um es zu begreifen. Man braucht auch nicht weit zu suchen: Die Heilmittel wachsen unmittelbar hinter dem Haus, auf der Wiese nebenan, am Feldrand oder im nahegelegenen Wald. Mit nur zweiunddreißig Kräutern, die sie in der »Apotheke Gottes« angibt, lassen sich sämtliche Krankheitsdämonen in die Flucht schlagen. Wir würden auch mit noch weniger auskommen, beteuert Maria Treben. Schon sieben oder acht ganz gemeine Unkräuter, wie etwa Brennessel, Schafgarbe, Kamille, Ehrenpreis, Johanniskraut oder Malve, die ja jeder kennt, würden genügen. Es wäre natürlich eine bittere Pille für die Pharmahersteller, wenn da etwas dran wäre.
Von ihrem Erfolg war Maria Treben selbst überrascht. Vorbei war es mit dem ruhigen Familienleben. Sie wurde zu immer mehr Vorträgen vor immer größerem Publikum geladen. Der Terminkalender bestimmte im zunehmenden Maße das Leben der über achtzigjährigen Frau. Mit dem Ruhm wuchs aber auch die Kritik. Ihr wurde vorgeworfen, den Eindruck zu erwecken, daß man auch ohne Arzt und Pharmazeutika auskommen könne, ja, daß einige ihrer Rezepte sogar gefährlich seien. Man hetzte die Massenmedien auf sie. In der Wochenzeitschrift Stern bezichtigte sie der Chefarzt eines renommierten Krankenhauses des »verbrecherischen Dilettantismus«. Da sie sich der Kritik nicht stelle, hieß es weiter, wolle sie entweder die Wahrheit nicht wissen oder sie habe von Kräutern und Medizin keine Ahnung.
Die rüstige Alte machte indes unbeirrt weiter. Hatte nicht der von ihr verehrte Pfarrer Kneipp ähnliche Anfeindungen erdulden müssen? Sprachen nicht die wunderbaren Heilerfolge, von denen ihr Tausende geschrieben hatten oder bei Veranstaltungen Zeugnis ablegten, von der Gnadenkraft der Gottesapotheke? Die Kräuterfrau verstand sich als gläubige Christin, die von der Gottesmutter berufen war. Daß daraus ein blühendes Geschäft wurde, war Nebensache.
Die in Böhmen geborene Maria Treben hatte schon von Kindheit an eine innige Beziehung zu Pflanzen. Sie erzählt, daß ihre Mutter eine begeisterte Kneipp-Anhängerin war, die selbstverständlich mit Kräutern hantierte, und daß sie oft einen Förster besuchte, der sie mit vielen Pflanzen bekannt machte. Aber das sind normale Begebenheiten, das genügt nicht, um jemanden zum sendungsbewußten Kräuterschamanen zu machen. Es war vor allem die Vertreibung aus ihrer sudetenländischen Heimat nach dem Krieg (1946), die sie dermaßen in ihren Grundfesten erschütterte, daß sich der Riß in ihrer Seele auftat – der Riß, der es den Pflanzenengeln ermöglicht, mit einem Menschen zu kommunizieren. Eine »einjährige Irrfahrt« durch mehrere Flüchtlingslager brachte sie schließlich nach Österreich.
1947 erkrankte die halbverhungerte Flüchtlingsfrau. »Es ging mir jeden Tag schlechter … Ich war kaum mehr ansprechbar … In meinem Dämmerstadium habe ich noch gehört, wie er (der Lagerarzt) sagte: Diese Frau hat Bauchtyphus im letzten Stadium. Damals gab es für die Krankenhäuser keine Medikamente mehr. (Der Arzt) meinte, diese Frau wird uns unter den Händen wegsterben. Es gäbe zwar ein Mittel, den Saft des Schöllkrauts, aber woher man das bekommen solle, wisse er nicht. Doch die Schwestern wußten sich zu helfen, haben in der Natur Schöllkrautblätter gesammelt, den Saft gepreßt …« (Treben 1988:49)
Mehr als ein halbes Jahr lag sie im Krankenhaus. Auch danach litt sie noch immer an krampfartigen Durchfällen, Erbrechen und Schmerzen, die ihren Körper »wie ein Schwert durchbohrten«. Es ging ihr erst richtig besser, als ihr eines Tages eine fremde Frau ein kleines Fläschchen mit einer dunkelbraunen, stark riechenden Flüssigkeit in die Hand drückte. Es waren Schwedenkräuter.
Etwas erwachte damals in ihr, gleichzeitig mit ihrer Genesung: ihre Heilergabe. Ihre schwere Erkrankung war die »Einweihungskrankheit«, die kein Schamane umgehen kann. Dadurch gewann sie ein unerschütterliches Vertrauen in die Gottesapotheke, so daß sie sagen konnte: »Für mich gibt es keine hoffnungslosen Fälle!«
Jahre später, mit dem Tod ihrer Mutter zu Lichtmeß 1961, verstärkte sich ihr Sendungsbewußtsein. »Seither hatte ich das bestimmte Gefühl, in die Heilkräuterkunde hineingedrängt zu werden. Es kamen neue Erfahrungen hinzu, und allmählich wuchs ich mit einem sicheren Gefühl in die Heilkräuter aus der Apotheke Gottes hinein. Es war, als ob mich eine höhere Macht lenken, vor allem die Gottesmutter, die große Helferin aller Kranken, mir den sicheren Weg weisen würde. Das Vertrauen zu Ihr, die Verehrung und das Gebet vor einem alten, wunderbaren Marienbild, das auf seltsame Art in meine Hände und damit in meinen Besitz gelangte, hat in Zweifelsfällen jedesmal geholfen.« (Treben 1980:4)
Es ist bemerkenswert, daß es an Lichtmeß war, dem uralten keltischen Fest der Brigitte, der Göttin der Heiler und Schamanen, als sie die Berufung spürte. Das ist kein bloßer Zufall. Fast immer gibt es im Leben derjenigen, die ihre Seele den Göttern geöffnet haben, solche synchronistische Übereinstimmungen.
Ebenso bemerkenswert ist, daß diese Berufung Anfang der sechziger Jahre stattfindet. Immer wenn die Zeiten besonders böse werden, wenn die Menschen ihren Weg verlieren, werden die Götter, Geister und Ahnen aktiv. Auch in dieser Zeit, in der materialistische Ideologien die Welt in atomwaffenstarrende, feindselige Machtblöcke spaltete und sich zügelloses Konsumverhalten mit einer katastrophalen Umweltzerstörung koppelte, wurden die Pflanzendevas besonders aktiv. Sie inspirierten viele sensitive Menschen: Schamanen wie die mazatekische Maria Sabina offenbarten Geheimnisse; giftfreie Wundergärten wie Findhorn oder Aigues Vertes entstanden; die Blumenkinder sangen von der erlösenden Liebe, und mit ihnen erwachte das Interesse an sanfterer Medizin, an einem freundlicheren Umgang mit unseren Mitgeschöpfen, an natürlicher Geburt, an sanften, bewußtseinserweiternden Pflanzendrogen, an Blütenessenzen und Aromatherapie, an Heilkräutern und Schamanentum.
Nach ihrer Berufung zog Maria Treben immer mehr Menschen in ihren Bann. Sie ging dabei, natürlich unter strenger Wahrung ihres katholischen Glaubens, recht schamanistisch vor. Sie spricht von wunderbaren Eingebungen und übersinnlicher Hilfe: Ein alter Herr schenkte ihr ein schönes, altes Kräuterbuch. Sie ist aber zu beschäftigt, um es sich richtig anzusehen. Sechs Monate verstreichen, doch dann eines Nachts gegen Mitternacht ist ihr, als würde sie sanft an den Schultern wachgerüttelt. Sie denkt an das Kräuterbuch, schlägt es auf und liest: »Wenn bei Glieder und Muskelschwund nichts mehr hilft, so nimm dieses: Hirtentäschel, klein geschnitten, zehn Tage mit Kornschnaps in Herdnähe oder der Sonne ausgesetzt, damit täglich eingerieben, innerlich vier Tassen Frauenmanteltee.« Sie schlägt das Buch zu und schläft fest ein. Ein paar Tage später ruft eine 52jährige Krankenschwester aus Wien an und bittet um Rat: Sie sei völlig hilflos durch Muskelschwund und könne ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. »Als ich ihr das obige Rezept angeraten hatte und sie nach drei Wochen gesund zu mir nach Grieskirchen kam, erfuhr ich, daß sie an diesem Tag, an dem ich gegen Mitternacht aus dem Schlaf geweckt wurde, eine Pilgerfahrt zur Muttergottes nach San Damiano in Italien gemacht hatte. Auf dem Rückweg im Autobus verwies sie ein Herr, der ihre Hilflosigkeit sah, an mich.« (Treben 1980:22)
Selbstverständlich sollte man die Kur nicht verallgemeinern. Es gibt keine Garantie, daß das Hirtentäschel, das sonst vor allem als blutstillendes Mittel in Betracht kommt, auch jeden, der an Muskelschwund leidet, heilen kann. Bei einer Krankheit spielen viele Faktoren – familiäre, karmische, umweltbedingte, altersbedingte – eine Rolle. Deswegen sammeln und bereiten Pflanzenschamanen ihre Heilmittel in der Regel für jeden Patienten individuell. Wo bei einem das Hirtentäschel hilft, hilft bei dem anderen vielleicht die Nachtkerze oder eine andere Pflanze. Zur Heilung ist ja nicht nur die Pflanze, sondern auch noch vieles andere notwendig. Erst durch das Zusammenkommen aller notwendigen Faktoren kann das gewünschte Resultat erzielt werden. Yukti nennen die ayurvedischen Heiler dieses günstige Zusammenspiel des richtigen Heilkrautes, der günstigen astrologischen Konstellation, des inspirierten Heilers und des aufrichtigen Wunsches, geheilt zu werden. Auch Maria Treben sagt, daß es nie das physische Kraut allein ist: »Wo es keinen Glauben an Gott und an die Kraft der Kräuter gibt, da gibt es nur sehr selten Heilung!«
Es war für Maria Treben selbstverständlich, daß die Schutzengel die Leidenden zu ihr führten oder daß die Heilpflanzen die Signatur gnadenreicher Übersinnlicher in sich tragen. Bei ihr erweckte »der rote Saft des würzigen Johanniskrautes den Eindruck, als ob ein Blutstropfen unseres Heilands in dem Farbstoff der goldgelben Blüten verborgen lebe.« Sogar Rundfunkwellen konnten ihr die Stimmen der Pflanzenengel offenbaren. Als sie über die hoffnungslose Situation einer Kranken nachdachte, stellte ihr Mann zufällig ein kleines Kofferradio hin, und sie vernahm die richtige Antwort in der Radiostimme: »Hier spricht der Hausarzt. Mit Kalmuswurzel wird jede Magen und Darmstörung geheilt …« Warum auch nicht, Pflanzengeister sind frei und ungebunden und können sich überall manifestieren.
Wir sehen also, daß die Kräuterkunde Maria Trebens, die vielen Menschen geholfen hat, nicht mit den Maßstäben einer reduktionistisch naturwissenschaftlich orientierten Phytotherapie gemessen werden kann. Es ist eine Kräuterkunde, die metaphysische Parameter mit einbezieht. Sie verstand sich als Vermittlerin dieser übersinnlichen Kräfte: »Bei IHM suchen wir Hilfe und Trost, in schwerer Krankheit demütig und andächtig Kräuter aus seiner Apotheke.«
Edward Bach (1886-1916)
Der Entdecker der Blütenessenzen war alles andere als ein Dilettant. Als Arzt und Forscher war er mit der Arbeit im Labor ebenso vertraut wie mit der ärztlichen Praxis. Seine Nosoden-Therapie (Impfstoffe aus Darmbakterien) gehört bis heute zu den anerkannten Methoden der Medizin. Er hätte sein Lebtag ein gut situierter Mediziner bleiben können, wäre da nicht eine tiefgreifende, seelische Erschütterung über ihn hereingebrochen. Während des Ersten Weltkriegs hatte er ein Lazarett mit 400 Betten zu betreuen. Zu dieser Zeit starb seine Frau an Diphtherie. Zwei Monate später brach er, vollkommen überarbeitet, mit einem Blutsturz zusammen. Nach der sofortigen Operation stellte man ihm die düstere Prognose, er habe nur noch drei Monate zu leben. Er ignorierte diese Prognose und arbeitete weiter in seinem Labor. Doch diese traumatische Erfahrung stieß verschlossene Tore auf. Er sagte sich los von der materialistischen Schulmedizin, wurde Homöopath und präparierte von nun an seine Nosoden nach der Methode Samuel Hahnemanns. Aber dabei blieb es nicht. Seine Intuition sagte ihm, daß es möglich sei, die Nosoden durch Heilkräuter zu ersetzen. Wie aber die richtigen Pflanzen finden, wie sie präparieren und dosieren? Weder die Schulmedizin noch die Schriften Hahnemanns konnten ihm fortan den Weg weisen. Er war über sie hinausgewachsen.
1928 verließ Bach spontan seine Praxis und reiste dorthin, wo er schon als Junge Kraft und Inspiration geschöpft hatte, nach Wales, dem Land seiner Vorfahren. Er verband sich sozusagen mit dem »morphogenetischen Feld« seiner Ahnen, die ihm die richtigen Eingebungen zukommen ließen. Und an einem Gebirgsbach fand er dann auch die ersten seiner Heilblüten: die gelbe Gauklerblume (Mimulus) und das drüsige Springkraut (Impatiens). Diese Blüten spiegeln seine damalige Gemütsverfassung wider: einerseits die unterschwellige Angst vor den Konsequenzen seiner Entscheidung, gesicherte Bahnen zu verlassen, und an derseits seinen ungeduldigen Wunsch, neue Wege zu gehen.
Zwei Jahre später, Anfang Mai – zu der Jahreszeit, in der seine walisischen Vorfahren einst Beltaine, die Hochzeit der Sonne und der Blütengöttin mit Freudenfeuern feierten – schloß er Praxis und Labor, verbrannte im eigenen »Freudenfeuer« sämtliche Vorträge und Aufsätze über seine bisherigen Forschungen und brach abermals ins Land seiner Ahnen auf, um weitere Heilpflanzen zu finden. Er durchwanderte Wales, stimmte sich auf die Pflanzen ein und studierte gleichzeitig systematisch ihre botanischen Eigenschaften. Nach und nach enthüllten ihm die Pflanzendevas ihre Geheimnisse.
Nachdem Edward Bach neunzehn Heilmittel entdeckt hatte, ließ er sich nieder, um sich der wachsenden Zahl der Hilfesuchenden zu widmen. Aber es war ihm nicht vergönnt, ein einfaches Leben als Landarzt zu führen. Zu weit hatte er die Tore zu übersinnlichen Bereichen aufgestoßen. Er war zum Vermittlungskanal der Pflanzendevas geworden, und diese drängten ihn zu weiteren Offenbarungen.
Zu dieser Zeit wurde Bach zunehmend feinfühliger. Er brauchte eine Pflanze nur zu berühren, um ihr Heilpotential zu spüren. Oft spürte er am eigenen Leib die Schmerzen, die seine Patienten plagten, und das manchmal schon Stunden, bevor sie das Ordinationszimmer betraten. Schließlich wandte er sich, ganz in der Tradition der Druiden, den Bäumen zu. Er las, wie er selbst sagt, ihre »Gedanken« und entdeckte dabei neunzehn weitere Heilessenzen. (Bach 1988:44) Er kam zu der Erkenntnis, daß Pflanzen heilen, indem sie uns unserer innewohnenden Göttlichkeit näherbringen.
Im August 1935 - das ist die Zeit um Mariä Himmelfahrt, wenn traditionellerweise die Kräuterbüschel fertiggestellt und geweiht werden – hatte er alle seine 38 Heilmittel beisammen. Zu dieser Zeit schreibt er: »Durch die Gnade Gottes ist offenbart worden, daß es Ihm gefallen hat, allen, die leiden, eine Heilung ihrer Drangsal zu geben. Diese Heilungen sind in gewissen Heilpflanzen, -blumen und -bäumen der Natur zu finden. Darüber hinaus hates Ihm gefallen, diese Heilmittel den Menschen direkt zu geben, denn sie sind so einfach, daß die Menschen ihre eigene Medizin selbst finden und zubereiten und sich damit selbst oder gegenseitig in ihrer Not heilen können.« (Bach 1988:54)
Bach nahm keine Honorare, »da wir nur die Kräuter benutzen, die uns die göttliche Vorsehung geschenkt hat, und da die Kunst des Heilens zu heilig ist, um kommerzialisiert zu werden.« Das war der Hauptgrund dafür, daß die Ärztekammer ihm seine Approbation zu entziehen drohte. Vor allem wollte er den Menschen beibringen, wie sie sich ihre eigenen Heilmittel zubereiten können. Aber dafür blieb ihm nicht viel Zeit. Im folgenden Herbst verließen ihn die Kräfte. Im November – im keltischen Kalender die Zeit des Totengottes, der die Pflanzengöttin raubt – starb Bach friedlich im Schlaf. Den Pflanzendevas ihre Geheimnisse abzuringen ist eben eine Anstrengung, die den Menschen an die Grenze seiner Kräfte bringt. Bach hatte sich vollkommen verausgabt.
Andere Pflanzenschamanen sind vorsichtiger, sie haushalten besser mit ihren Energien. Sie achten auf ihren Körper und vernachlässigen ihn nicht, während sie in jenseitige Bereiche reisen. Sie wissen, wie wertvoll der Körper als Träger des Geistes in diesem Leben ist.
Die Unkonventionalität der Pflanzenschamanen
Wer von den Pflanzendevas berührt wird, ist anschließend nicht mehr derselbe Mensch, der er vorher war. Die Begegnung hat ihn geprägt. Er wurde, ganz wie die kräuterkundigen Midewiwin-Heiler, getötet und mit neuen Kräften wiedergeboren. Er ist wahrlich ein Bürger beider Welten geworden.
Auch wenn er sich Mühe gibt, »normal« zu erscheinen, fällt er dennoch, was sein Aussehen, seine Kleidung, seinen Wohnort und seine Lebensgewohnheiten betrifft, als eigentümlich und unkonventionell auf. Das ist aber keine Masche, kein cleverer Stil, den er annimmt, um seinen »Marktwert« zu erhöhen. Er verhält sich so, weil er nicht anders kann, weil es ihm die Geister so auferlegt haben, weil er sonst entweder die Verbindung zu den Inspirationen der Devas oder die Gesundheit seines Körpers verlieren könnte. Er lebt nach Gesetzen, die nur er kennt und die Außenstehenden als recht willkürlich, wenn nicht gar kauzig vorkommen.
Oft leben solche Menschen an seltsamen, verlassenen Orten, in verfallenen Bauernhäusern - womöglich ohne Strom-, in alten Mühlen oder in einsamen Gegenden, weit vom Dorf entfernt. Diese Orte, die für andere quälende Einsamkeit und Langeweile bedeuten würden, erlauben es ihnen, sich fein auf die Geister einzustimmen, Eingebungen zu empfangen, tief zu meditieren. Moderne Bauten aus Zement und Glas meiden sie meistens, weil diese die Schwingungen der Umwelt blockieren.
Anderseits gibt es aber auch den »Stadtindianer«, der mitten in der Großstadt mit den Pflanzengeistern kommuniziert. Wenn erden Boulevard entlang geht, bleiben seine Augen weniger an den tollen Schaufensterauslagen oder den teuren Autos hängen. Auch die anderen Passanten in ihren feschen Kleidern interessieren ihn wenig. Seine Aufmerksamkeit gilt dem Wegerich, der in einem Spalt auf dem asphaltierten Gehweg wächst, dem rötlichen Ruprechtskraut in der Mauerritze, dem Moos auf einem Stein, den vielen Wildkräutern am Bahndamm oder auf der unbebauten Parzelle. Wie ein Schmetterling flattert sein Geist von einem Kräutlein zum anderen. Sie alle erzählen ihm interessante Geschichten, alle sind Heilkräuter, die sich anbieten, wenn Heilung gefragt ist. Gelegentlich kommt ein bunter Falter, ein Vogel oder eine Schwebfliege und bringt ihm eine Botschaft. Er hat gar kein Verlangen, »hinaus aufs Land« zu ziehen, denn mitten in der City ist er noch in der Natur.
Fast immer kleiden sich diese Menschen in unkonventioneller Weise. Oft nähen und stricken sie ihre eigene Bekleidung. Meistens sind es reine Naturstoffe, grobe Wolle, Baumwolle, Seide und gelegentlich sogar Brennessel- oder Hanfstoffe, die sie tragen. Naturstoffe resonieren mit der Umwelt, sie blockieren die Vibrationen der Tiere, Pflanzen und der Geister nicht so sehr wie Kunstfasern. Manche kleiden sich als Ausdruck ihrer bunten Innenwelt in farbenfrohe Seide und Brokat, so daß sie aussehen wie Paradisvögel oder exotische Schmetterlinge. Andere wiederum sind dermaßen abgehoben, daß sie kaum merken, was sie anhaben. Manchmal sind es praktisch Lumpen. Hauptsache, sie sind gemütlich, damit die Meditation ungehindert »fließen« kann.
Manche würden, wenn das Wetter und die Gesetze es erlaubten, gar nichts anziehen und in »heiliger Nacktheit« durch die Natur gehen, einer Nacktheit, die keine Barrieren zwischen dem eigenen Körper und den Schwingungen der Umwelt duldet. In Indien gibt es noch solche Naga-Babas. Als man die im Dschungel, unter freiem Himmel lebende heilige Mahadeviyakka fragte, warum sie ihre Blöße mit nichts, außer ihren langen Haaren, bedecke, antwortete sie: »Wenn die Frucht voll ausgereift ist, fällt die äußere Schale ab.«
Viele dieser schamanistisch begabten Menschen kleiden sich, um ihre Verbundenheit mit der umliegenden Natur und der Tradition des Stammes zu bekunden, in altertümliche Tracht. Maria Treben zum Beispiel trug das Dirndl, die Tracht der Frauen im bayrisch-österreichischen Raum, wie ein Schamane seine symbolträchtige Schamanenkleidung. Für den Artikel im Stern ließ sie sich in feinster Tracht, sogar mit Goldhaube fotografieren. Goldhauben, glitzernde, mit Edelsteinen besetzte Kappen, Spitzhüte mit Sonne, Mond und Sternen, Kopfbedeckungen mit Hörnern und Federkronen sind und waren schon immer Attribute schamanistischer Heiler und Zauberer. Sie sind Ausdruck der strahlenden Aura oder – wie die Inder sagen würden – des Erwachens der höheren Chakren. Auch der »Doktorhut« war einst eine solche magische Kopfbedeckung.
Mein Nachbar, ein alter Bergbauer, der nie auf der Straße geht, sondern immer feldquerein, der immer genau weiß, wo sich gerade die Hirsche aufhalten und welche Heilpflanze wo blüht, trägt alte abgewetzte Berglerkluft und dazu einen grünen Hut, den er mit Federn, Gamsbart, frischen Blumen und Schnitzereien besteckt. Dieser Hut ist ein Zauberhut. Er ist seine Antenne, die ihn mit den Waldgeistern und Tieren verbindet. Hätte er diesen Hut nicht, müßte er sich Haare und Bart lang wachsen lassen.
Viele Pflanzenschamanen lassen ihre Haare lang. Es kommt nicht von ungefähr, daß viele Botaniker noch immer gern Bärte und längere Haare tragen, ohne zu wissen warum. Für die Schamanen sind die Haare »Antennen, mit denen man die feinsten Schwingungen wahrnimmt«. Es heißt, die Kopfhaare nehmen die Regungen der höheren lichten Regionen auf, die Barthaare dagegen vor allem die aus den tiefen, dunklen unterirdischen Bereichen. Aus diesem Grund tragen die Wurzelgnome und Heinzelmännchen immer volle Rauschebärte. Auch Donar/Thor, der sich mit den chthonischen Reptilien, dem Lindwurm auseinandersetzt, ist vollbärtig. Die Engel dagegen, wie auch die New-Ager, die nichts mit »dunklen Vibrationen« zu tun haben wollen, tragen nur die Kopfhaare lang.
In der Tat absorbieren Haare sämtliche Gerüche und Düfte, so daß sich die Frau, die an ihrem langen Zopf riecht, oder der Mann, der in seinen Bart hineinschnuppert, die Pflanze, mit der sie oder er es zu tun hatte, noch lange vor das geistige Auge zaubern kann.
Haare nehmen Schwingungen, die Botschaften der Umgebung in Form von unter- und oberschwelligen Düften auf. Aus diesem Grund ist es auch verständlich, daß die meisten Pflanzenschamanen Parfüm, Puder, Seifen mit starken künstlichen Düften und Sprays meiden. Diese würden die Botschaften blockieren oder verfälschen. Wie wir gesehen haben, ist die Nase eines der wichtigsten Werkzeuge des Schamanen. Mit ihr erschnuppert er den Krankheitsherd oder die Eigenschaft einer Heilpflanze. Er kann es sich nicht erlauben, diesen feinen Sinn abstumpfen zu lassen.
Pflanzenschamanen scheinen sehr religiös zu sein, und dennoch halten sie sich oft von Kirchen, Tempeln, Moscheen oder Synagogen fern. Sie reden wunderliches Zeug von Gott, den Engeln, Geistern, Totengeistern, Elfen und Wichteln, aber mit Theologie hat das meist wenig zu tun. Weil sie direkt mit den Übersinnlichen verkehren, brauchen sie die vermittelnde Rolle des Priesters nicht. Sie brauchen auch keine konventionellen Rituale. Sie machen ihre eigenen Rituale und Zeremonien, nicht nach einem abstrakten, erlernten Katechismus, sondern auf unmittelbare Anweisung der Devas. »Nicht du erfindest die Rituale, mit denen du die Pflanzengeister ansprichst, sondern sie selbst geben dir ein, wie du mit ihnen verkehren sollst«, erklärte mir mein guter Freund Tallbull, der Botschafter des Stammes der Tsistsistas (Cheyenne).
Das soll jedoch nicht heißen, daß die Schamanen Feinde der etablierten Religionen sind. Ganz im Gegenteil. Wie die beiden Kräuterpfarrer, Kneipp und Künzle, Maria Treben und die Pilzschamanin Maria Sabina sind sie oft sehr fromm. Aber ihre Frömmigkeit geht weit über die konventionelle Frömmigkeit hinaus, sie kommt mehr aus dem Wissen als aus dem Glauben. Schon immer mußten diese »Wissenden« sich hüten, nicht als Hexen verleumdet zu werden. Und da sie wirklich mit den Geistern umzugehen wissen und die Kräfte der Pflanzen kennen, kommt es oft vor, daß die Leute sie fürchten. Denn wie kann man sicher sein, daß sie ihre Kräfte nicht auch einsetzen, um Schaden zu zaubern oder zu töten? Das kommt bei echten Pflanzenschamanen jedoch selten vor. Sie wissen, daß alles, was man tut, auf einen zurückkommt. Es ist vor allem die Liebe zur Natur und zu den Geschöpfen, die sie in ihrem Tun leitet.
Trank und Nahrung
Auch was Essen und Trinken betrifft, geben sich Pflanzen schamanen eher unkonventionell. Manche indischen Sadhus ernähren sich fast ausschließlich von den Wurzeln, Samen, Blättern und Früchten wildwachsender Pflanzen. Sie behaupten, daß sie dadurch die Kraft erhalten, göttliche Visionen (Darshana) zu empfangen. Eine mir persönlich bekannte Frau aus Rajastan, deren Ehe kinderlos geblieben war, suchte ihrem Mann eine andere Gattin und »warf ihr Leben weg«, gab es ganz der Göttin anheim, indem sie in den Dschungel ging und nur noch von Blättern und Wurzeln lebte. Nach einigen Jahren erschien ihr die Göttin in großartiger Vision, und die einfachen Dorfbewohner, die ihr begegneten, sahen die Göttin (Durga) aus ihren Augen schauen. Sie bekam immer mehr Zulauf von Leuten, die ihren Segen empfangen wollten. Man baute ihr einen Ashram und fütterte sie dermaßen (aber nur mit rituell reinem Essen), daß sie nun zu einem Koloß von 200 Kilo wurde. Aber die Göttin strahlt noch immer aus ihren Augen.
Wildpflanzen geben uns in der Tat viel Kraft, sie geben uns die Energie, geistige Bilder zu schauen und mit den Übersinnlichen zu kommunizieren.
Jede Pflanzenart benutzt die einströmenden kosmischen Impulse auf ihre besondere Art und Weise. Indem wir eine Pflanze als Nahrung zu uns nehmen, nehmen auch wir die in ihr enthaltenen kosmischen Energien auf. Die wenigen verbliebenen Naturvölker ernähren sich, ebenso wie es unsere paleolithischen Vorfahren taten, von einem vielfältigen Wildpflanzenangebot. Neueren ethnobotanischen Untersuchungen zufolge werden bei Stammesvölkern, etwa bei den Kung-Buschleuten oder den Schoschonen, zwischen 300 und 2000 verschiedene Arten gesammelt und gegessen. Dadurch nehmen diese Menschen ein weites Spektrum differenzierter Energien, Botschaften aus dem Kosmos, auf. Der moderne Zivilisationsmensch ernährt sich dagegen von durchschnittlich zwanzig verschiedenen Pflanzenarten. (Man achte mal auf den eigenen Speisezettel. Was gibt es da außer Kartoffeln, Getreide, Hülsenfrüchten und den üblichen fad schmeckenden Gemüsesorten?) Im selben Maße, in dem sich die Auswahl an Nahrungsmitteln verringert oder auf überzüchtete, genetisch manipulierte Kultursorten reduziert, vermindert sich auch die Zufuhr fein differenzierter spiritueller Energien. Um ihre geistige Kraft und körperliche Gesundheit zu steigern, nehmen die Schamanen und Medizinleute also zusätzlich Wildpflanzen in ihre Diät.
Der Tsistsistas-Pflanzenschamane erzählte mir folgendes: Jede Pflanze hat, ebenso wie der Mensch, vier »Seelen«. Die aufgedunsenen Gewächse jedoch, die auf den Feldern der weißen Farmer wachsen, haben nur drei, manchmal auch nur zwei »Seelen«. Solche geschwächten Ackerfrüchte, die nur mit Hilfe von Kunstdünger und Insektengiften am Leben bleiben, können nicht alle vier »Seelen« des Menschen ernähren. Derjenige, der sie zur ständigen Diät macht, stumpft unweigerlich ab. Er funktioniert zwar noch, aber seine feinen geistigen Sinne verkümmern. Deshalb – so der Indianer – haben die Weißen keine Visionen; weder die Sprache der Tiere noch die der Geister verstehen sie.
Aber auch wir, die wir mitten im Getriebe der technomanischen Wohlstandsgesellschaft leben, brauchen uns nicht auf das Supermarktangebot zu beschränken. Neben dem Gemüse bietet unser Biogarten eine große Palette unverdorbener eßbarer Gewächse, die meist als »Unkraut« diffamiert werden. Wegerich, Brennessel, Käsemalven, Vogelmire, junge Löwenzahnrosetten, Sauerampfer, Gänseblümchen sind nur einige von vielen, die sich gut als Gemüse, Suppen oder kräftige Salate zubereiten lassen. Und das Nahrungsangebot geht weit über den Zaun des Gartens hinaus, so daß auch wir ein weites Spektrum kosmischer Kräfte in uns aufnehmen können.
Eine Diät aus einheimischen Wildkräutern schenkt nicht nur Gesundheit, sondern bringt uns in Einklang mit den natürlichen Rhythmen des Jahres. Die zur rechten Jahreszeit gesammelten Wildpflanzen ermöglichen das Einstimmen auf die naheliegende Umwelt. Das Hinausgehen, Suchen und Sammeln, das liebevolle Kochen und genußvolle Verspeisen kann die Grundlage bilden, die uns zur liebevollen Zwiesprache mit der uns umgebenden Natur befähigt. Beim Hamburger-Rind-fleisch aus Südamerika und dem pappig weichen Brötchen, dessen Mehl Gott weiß woher stammt, ist das weniger möglich.
Einige Richtlinien
Ißt der Mensch, was in seiner unmittelbaren natürlichen Umgebung wächst, wird es ihm leichter fallen, mit den Naturgeistern zu kommunizieren. Der Gärtner, der sich von den Früchten seines eigenen Gartens ernährt, braucht keine Bücher, Regeln oder Anweisungen des Landwirtschaftsamts. Er wird das Richtige zur richtigen Zeit tun, denn die im Garten lebenden Heinzelmännchen werden es ihm beibringen.
Orientiert man sich an den traditionellen Ernährungsgewohnheiten der Vorfahren, kommt man leichter mit dem morphogenetischen Feld der Ahnen in Verbindung. Man empfängt die Hilfe der Ahnengeister in Form von »Ahnungen«. Die Amerikaner sind verärgert, daß die Japaner nicht den billigen Reis aus Kalifornien importieren, sondern nur ihren eigenen, teuren, hochsubventionierten Reis essen wollen. Die Japaner sind eben Ahnenverehrer, die sich über den täglichen Reis auf ihre verstorbenen Vorfahren einstimmen. Nichts anderes rät der amerikanische Naturarzt D. C. Jarvis seinen Landsleuten in Neuengland: »Wenn ihr weiterhin mit eurem altenglischen Ethos verbunden bleiben wollt, eßt viel Haferbrei und Heringe.« (Jarvis 1958)
Wer hauptsächlich Import- und Kolonialwaren ißt, erweitert sein Bewußtsein horizontal. Er entwickelt weltmännische Weitsicht, aber wenig mystische Tiefe. Bei Handels- und Kolonialvölkern wie den Briten oder Niederländern kommt das als Weltoffenheit und Humanismus zum Ausdruck.
Beschränkt man sich auf die Grundnahrungsmittel, besonders auf Getreide und Brot als »Stab des Lebens«, verspürt man – gemäß der modernen makrobiotischen Lehre – einen zentrierenden Einfluß auf die Persönlichkeit. Ißt man dagegen unausgewogen oder einseitig, fördert das den Hang zu Schrulligkeit und Ausgefallenheit.
Viele Pflanzenschamanen sind Vegetarier, weil eine pflanzliche Diät das Einstimmen auf die vegetative Ebene erleichtert. Andere, etwa die Schamanen der Indianer, essen gern Fleisch. Sie essen es im Bewußtsein der Dankbarkeit. »Heute esse ich dich, ein anderes Mal darfst du mich essen«, sagen sie dem Tierwesen. Ansonsten erschwert Fleisch allzuhohe geistige Ausflüge und dämpft die Schwärmerei.
Wir können also sagen, daß es keine festen Regeln gibt, was die Diät des Pflanzenschamanen betrifft. Er weiß, daß alles, was er zu sich nimmt, Einfluß auf sein Bewußtsein und seine Körperverfassung hat. Also handhabt er diese Dinge, wie er es für nötig hält. Über Speis und Trank und alles, was er sonst noch durch die Leibespforten und die Sinne einläßt, stimmt er seine Schwingungen jeden Tag so ein, wie er sie braucht.
Magische Kräutersammelregeln
Vor jedem Sammelausflug verbindet sich der Pflanzenschamane erneut mit seiner ursprünglichen Vision. Da ich dieses Thema anderswo ausführlich behandelt habe, werde ich es hier nur kurz skizzieren. (Storl 1997) Für den nordamerikanischen Indianer kann das bedeuten, daß er ein Schwitzbad nimmt und seine Medizinlieder singt. Für die europäische Kräuterfrau besteht die Vorbereitung im auf richtigen Gebet und im Beachten von Zeichen und Träumen. Vielerorts, etwa in Ost- und Südasien, bereitet sich der Pflanzenkundige durch Askese auf die Begegnung mit den Pflanzendevas vor – durch längeres Fasten oder wenigstens Verzicht auf Fleisch, durch anhaltendes Wachbleiben oder auch durch sexuelle Enthaltsamkeit.
Oft, aber nicht immer, spielen auch psychotrope Pflanzen eine Rolle bei der Einstimmung auf die übersinnliche Ebene, auf der die Begegnung mit dem Pflanzengeist oder den helfenden Elementarwesen möglich ist. Bei den Amazonasindianern ist es Yahe (Ayahuasca), in Mittelamerika sind es oft Pilze, in Afrika der Iboga-Strauch, in Südasien und anderswo kann es Cannabis sein. Manchmal werden diese Hilfsmittel nur während der Schulung neuer Schamanen genutzt, um dem Neophyten eine neue Sicht der Wirklichkeit zu vermitteln. Später, wenn er die Wege ins Geisterland kennt, kann sich der Schamane auch ohne die Hilfe dieser Zauberpflanzen in die jeweiligen Bereiche begeben.
Hier nun einige uralte Regeln, die beim Sammeln wichtiger Pflanzen beachtet werden. Jeder Kulturkreis, außer unserer heutigen Zivilisation, kennt ähnliche Regeln. Sie sind universal und enthalten ähnliche strukturelle Motive, die den Schluß zulassen, daß es sich dabei um Überlieferungen handelt, die sich bis in die Steinzeit zurückverfolgen lassen. Es sind magische Techniken, die dazu führen, daß der Kontakt mit dem Pflanzengeist hergestellt und der Segen dieses übersinnlichen Wesens erlangt wird. Die Indianer haben diese Techniken vor Zehntausenden von Jahren mit in die Neue Welt gebracht.
1. Überall auf der Welt sucht man sich den richtigen Zeitpunkt aus, um zu den Pflanzen zu gehen. Meistens ist es vor Sonnenaufgang, vor allem bei Neumond. Manchmal wird der Zeitpunkt durch Sterne (wie Sirius oder Aldebaran) bestimmt, die gerade über den Horizont steigen.
2. Man geht »wie ein neugeborenes Kind«, splitternackt, ungewaschen (oder wenigstens barfuß), ohne etwas gegessen zu haben, ohne Ge danken im Kopf. Man darf von niemandem gesehen werden und niemanden grüßen. Anderswo badet man oder reibt sich mit Erde oder Asche ein, bevor man zu der Pflanze geht. Man tut das, um die Verunreinigungen, die sich im täglichen Leben ansammeln, abzustreifen, um wieder rein und unschuldig zu werden.
3. Der Pflanzenschamane geht die Pflanze von Westen heran, mit dem Gesicht nach Osten, der aufgehenden Sonne zugewandt. Das ist die Richtung des aufsteigenden Lichts und Lebens. Zauberpflanzen, wie etwa die Alraune, oder Giftgewächse, die dem Feind Tod und Verderben bringen sollen, wurden dagegen meist vom Osten her angegangen, mit dem Gesicht in Richtung der untergehenden Sonne.
4. Man opfert der Pflanze etwas Wertvolles, Symbolträchtiges, bevor man sie nimmt. Im indogermanisch-sibirischen Raum wares Milch, Honig oder Bier, in Südasien Reis oder Palmwein, in der Neuen Welt waren es Tabak und Maismehl. Oft wird Blut – in Westafrika Hühnerblut – oder Semen vorgeschrieben. Manchmal wird der Pflanze eine Kupfer-, Silber- oder Goldmünze zugesteckt.
5. Die Pflanze wird rituell in den Mittelpunkt gestellt, in dem man sie rechtsläufig (mit der Sonne) umwandelt oder mit einem Stab umschreibt. Zugleich wird sie mit einem Quadrat umgeben, welches die Kräfte der vier Hauptrichtungen ins Bewußtsein ruft. Christliche Kräutersammler assoziieren die Heilpflanze mit dem Kreuz Christi, das die Mitte des Universums ausmacht. Sie erinnern die Pflanze daran, daß sie aus dem Schweiß oder Blut des Heilands entsprungen ist.
6. Die Pflanze wird nun im Zauberton besprochen oder besungen. Man lobt sie und ihre göttlichen Kräfte, erinnert sie an das Versprechen, das sie den Menschen in Urzeiten gemacht hat. Man teilt ihr mit, warum man gekommen ist und wozu man sie nutzen will.
7. Nachdem dieser Kontakt mit dem Pflanzenwesen hergestellt ist, kann man die Pflanze ernten. Dafür darf man aber kein Eisen oder anderes Metall, es sei denn Kupfer oder Gold, benutzen. Sie wird nach uralter Gepflogenheit mit Hirschgeweih, Bärenkrallen oder Wildschweinhauern (das sind alles Tiere, die der Großen Göttin geweiht waren) oder mit Feuersteinklingen geschnitten oder ausgegraben.
Ihr Pflanzen, Behälter des Lichts, entstanden drei Zeitalter vor den Göttern, ehren will ich euch Vielfarbige, euch mit den siebenhundert Eigenschaften. (Rig-Veda X,97,1)