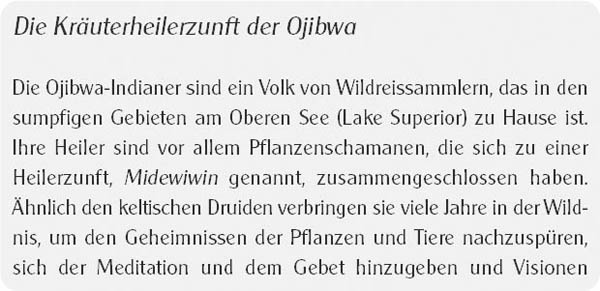Irgendwo in Siebenbürgen lebte einmal ein bettelarmer Schafhirte mit seiner Familie. Oft, während er auf den kargen Weiden seine Schafte hütete, streifte sein Blick wehmütig in die Ferne zu den Schneebergen, die da so erhaben, rein und blau leuchteten. Eines Tages überwältigte ihn das Verlangen, dorthin zu gehen. Er überließ die Herde seinem treuen Hund und machte sich auf den Weg.
Der Pfad führte durch düstere Felsenschluchten und dann immer höher, bis der Schnee das Weiterkommen schwierig machte. Plötzlich stand unmittelbar vor ihm ein Palast aus Eis und Schnee. Verwundert trat er durch das Eisportal. Herrliche Kristalle schimmerten im bläulichen Licht. Gold, Silber und Edelsteine lagen da in großen Haufen. Während er sich staunend umschaute, erschien plötzlich eine wunderschöne Frau, eine Feenkönigin. In ihrer weißen Hand hielt sie eine blaue Blume. Sie grüßte den Hirten freundlich und sagte ihm, er solle auswählen, was er wolle. Er dürfe seinen Rucksack mit soviel Gold und Edelsteinen füllen, wie er nur tragen könne. Er sah die schöne Fee an und sagte, am liebsten hätte er die blaue Blume.
»Du hast gut gewählt! Diese Blume ist das Kostbarste, was ich besitze«, sagte sie und reichte sie ihm.
Da verschwand der prächtige Palast, und er stand allein auf dem schimmernden Schneefeld. Weit unten im Tal sah er sein Heimatdorf. Ich muß mich beeilen, dachte er, sonst wird es noch finster, bevor ich zu meiner Herde zurückkomme. Er lief so schnell er konnte, bis er endlich zur Weide kam, die er am frühen Morgen verlassen hatte. Kein einziges Schaf war mehr zu sehen. Der Hund, über den er sich nun ärgerte, war auch fort. Ob Wölfe die Schafe gerissen hatten? Aber nein, es gab keine Spur, die das andeutete.
Also ging er allein ins Dorf zurück. Auch da schien alles merkwürdig verändert, alles sah anders aus als am Morgen. Als er die Tür aufmachte und in die Hütte trat, erschrak seine Frau heftig. Nachdem sie sich wieder gefaßt hatte, sagte sie: »Ein ganzes Jahr haben wir deinen Tod beweint! Ein Jahr und ein Tag sind vergangen, seit der Hund spät in der Nacht ohne dich heimkehrte!«
Der verwirrte Hirte holte die Blume aus seinem Ranzen. Sie war inzwischen verblüht und versamt. »Wenn ich auch nichts anderes habe, so will ich wenigstens diese Samen aussäen«, dachte er sich und streute sie ins Gartenbeet. Am nächsten Morgen war der Garten voller blauer Blumen. Da erschien die Fee noch einmal und erklärte: »Diese blauen Blumen sind nicht nur schön, sie sind auch nützlich. Es ist Flachs, und er wird Euch und dem ganzen Land Wohlstand bringen.« Sie erklärte ihnen, wie man die Pflanzen im Zeichen des Widders aussät, wie man sie erntet und die ölhaltigen Samen riffelt, wie man die langen Stengel röstet, bricht, schwingt, hechelt, zu Fäden spinnt und schließlich zu feinem Leintuch verwebt. Von nun an spann die Frau nicht nur Wolle, sondern auch Flachs, und ihr Mann machte sich am Webstuhl zu schaffen.
Es gibt viele Märchen wie dieses aus Transsylvanien, die erklären, wie die Menschen zu den Heil- oder Nutzpflanzen gekommen sind. Nicht kühl experimentierende, forschende Wissenschaftler waren es, die den Heil- oder Nährwert der Pflanze entdeckten, sondern Visionäre.
Schauen wir uns das Märchen noch einmal näher an. Der Entdecker der kostbaren Nutzpflanze ist ein Hirte. Hirten waren immer und überall bekannt für ihre ausgeprägten Pflanzenkenntnisse. In ganz Europa hieß es, wenn das Vieh erkrankt und der Tierarzt nicht weiter weiß, soll man den Hirten holen, denn dieser wisse immer das rechte Heilkraut. In einer Zeit, in der es weder die Schulpflicht noch Transistorradios oder Walkmen gab, hatten die Hirten keinen anderen Zeitvertreib als das tiefe Hineinsinnen in das frische Grün der sie umgebenden Landschaft. Sie waren natürliche Mystiker und Meditanten. Keine unnötige Information, keine Überflutung der Unterhaltungs- und Wissensindustrie verbaute ihnen den unmittelbaren Zugang zur Natur. Tagein, tagaus saßen sie bei ihrer Herde, beobachteten die weidenden Tiere, das Wiegen der Bäume im Wind, rochen den Duft der Kräuter und Wiesenblumen, lauschten den Vögeln, nahmen den Wechsel der Jahreszeiten wahr. Mehr noch als die von morgens bis abends schwer arbeitenden Gärtner und Bauern tauchten sie in das Mysterium, in die flutende Geistigkeit der Natur ein. Zuweilen wird der Hirte, auch wenn er sich dessen kaum bewußt ist, so sehr Teil seiner weidenden Tiere, daß seine Seele mit der Herdenseele verschmilzt. Er befindet sich in mystischer Partizipation mit den Rindern und Schafen, so daß sie seinen Geist mitnehmen, wenn sie Berg- oder Heidekräuter erschnuppern, schmecken, genüßlich widerkäuen und beim Verdauen die kosmischen Geheimnisse entschlüsseln, die die Pflanzen von den Sternen und Planeten empfangen haben. Auf diese Weise sammelt der Hirte einen Schatz an intuitivem Wissen über die Kräfte der Kräuter an.
Das Wissen um Pflanzen wird in höheren, geistigen Gefilden erworben. Der wahre Pflanzenkenner muß ein Meditant sein. In Indien ist es selbstverständlich, daß der Kräuterheiler zugleich ein Yogi, ein Meister der Versenkung, ist. Unser Schafhirte steigt hinauf in die blauen, schimmernden Berge – das Bergsteigen ist eine oft benutzte Metapher für die Schamanistische Jenseitsreise. Aber er geht nicht einfach auf »Trip« und vernachlässigt seine alltäglichen Pflichten, vielmehr überläßt er sie seinem treuen, wohldisziplinierten Hund, der sozusagen das niedere, alltägliche Ich darstellt. Oben im blauen Äther – dort, wo die Götter wandeln, in der fernen Saturnsphäre – begegnet er dem Deva der Pflanze. Dieser Pflanzenengel zeigt sich ihm in einer ansprechbaren, wunderschönen Gestalt. Das Gold und die Edelsteine, die ihm der Deva anbietet, stellen eine letzte Versuchung dar. Aber da der Wanderer eine reine Seele hat, verlangt es ihn nicht nach unverdientem Reichtum. Er begnügt sich mit dem Wesentlichen, mit der blauen Blume.
Wie weit sich der Hirte dieses Märchens in die »Anderswelt« hinausgewagt hat, wird deutlich in der Aussage, daß er, ohne es zu merken, ein ganzes Jahr entschwunden war. In der jenseitigen Welt, der Welt der Pflanzendevas, läuft die Zeit anders. Sie grenzt an die Ewigkeit und läßt sich nicht nach irdischen Maßstäben messen.
Ein Märchen der Ojibwa erzählt, wie der Mais zu den Menschen kam. Auch diese Geschichte sagt etwas über den Umgang mit den Pflanzendevas aus. Um Sinn und Aufgabe ihres Lebens zu erfahren, um ihre Kräfte und geistigen Helfer kennenzulernen, gehen die jungen Indianer in die Wildnis auf Visionssuche. Vier, manchmal bis zu sieben Tage verbringen sie allein und nackt tief im Wald oder auf einem Berg. Um sich zu weihen, beräuchern sie ihren Körper mit Süßgras und Beifuß. Manchmal machen sie ein kleines Feuer, um Raubtiere fernzuhalten. Und dann warten sie, ohne zu essen, zu trinken oder zu schlafen, bis sich ein göttliches Wesen ihrer erbarmt, ihnen eine Vision zukommen läßt und ihnen ihre »Medizin« (Kraft) gibt.
Ein junger Indianer namens Wunkh ging auf Visionssuche. Er wollte die Geister nicht bitten, ein großer Krieger, Sprecher oder erfolgreicher Jäger zu werden. Sein Wunsch war es, die Pflanzen kennenzulernen. Er wollte wissen, welche heilen und welche giftig sind. Vor allem aber wünschte er zu erfahren, welche Pflanzen eßbar sind, denn oft, im Spätwinter und im Frühling, waren die Vorräte aufgebraucht, und sein Volk mußte Hunger leiden. In den ersten zwei Tagen des Fastens in der Wildnis wanderte er umher und betrachtete die Gewächse, um sich auf das »grüne Volk« einzustimmen. Am dritten Tag war er jedoch zu schwach und legte sich auf sein Laublager. Plötzlich erschien ein junger Mann an seinem Lager. Er war schlank und kräftig gebaut, ganz in Grün und Gelb gekleidet und hatte eine gelbe Mähne.
»Ich bin Mondamin. Der große Geist hat mich zu dir gesandt. Er hat gesehen, daß dein Herz rein ist und wird dir deinen Wunsch erfüllen. Ich bin dein Lehrmeister. Aber zuerst muß ich prüfen, ob du auch Mut und Ausdauer hast. Du mußt mit mir ringen!«
Wunkh war zwar matt vom strengen Fasten, aber er gab sich einen Ruck und sprang auf, obwohl ihm die Knie zitterten. Stundenlang rangen sie, als ginge es um Leben und Tod. Am Abend verschwand der goldmähnige Fremde, und Wunkh sank erschöpft, zerschunden und an verschiedenen Stellen blutend zu Boden.
Am nächsten Tag kam Mondamin wieder. Wieder mußte Wunkh mit ihm kämpfen, obwohl er todmüde war. Am folgenden Tag war es dasselbe. Bevor er diesmal am Abend verschwand, sagte der Fremde zu Wunkh: »Morgen wird dein Vater kommen und dir eine Suppe zur Stärkung bringen. Nimm sie nicht an. Noch einmal komme ich, dann mußt du mich bezwingen und töten. Du mußt mich entkleiden und in der Erde begraben. Besuche mein Grab des öfteren, singe das Medizinlied, das ich dir gebe, laß kein Gras auf dem Grabhügel wachsen und sieh, wie ich im Herbst wieder auferstehe.«
Wunkh wollte ihn eigentlich nicht töten, aber beim letzten Ringkampf fiel Mondamin tot zu Boden. Aus dem Grab wuchs eine seltsame, noch nie gesehene Pflanze empor. Sie hatte genau die Farbe von Mondamins Kleidern. Als sie mannshoch war, wuchs oben ein Kolben mit einem Büschel darauf, der ganz so aussah wie Mondamins heller Haarschopf. Ein eher mißtrauischer alter Medizinmann untersuchte die seltsame Pflanze, schälte den Kolben und fand große, gelbe Körner darin. Als er diese vorsichtig kostete, merkte er, daß sie süß und bekömmlich waren. So kam der Mais, den die Ojibwa Mondamin (Wunderpflanze) nennen, zu den Menschen.
In dieser Erzählung ist es der Pflanzendeva, der aus Mitleid mit den Menschen dem Sucher entgegenkommt. Dennoch müssen wir zur Kenntnis nehmen, daß das Erlernen der Geheimnisse der Pflanzen kein Sonntagsspaziergang ist. Es ist ein Ringen, das von dem Suchenden viel Kraft und auch moralische Stärke erfordert. Es gleicht dem Ringen Abrahams mit dem Engel. Die Himmlischen geben ihre Geheimnisse nicht ohne weiteres preis.
Die Pflanzendevas opfern sich in die materielle Schöpfung hinein. Auch das kommt in dieser Geschichte zum Ausdruck. Sie geben sich, damit wir Menschen und auch die Tiere leben können. Die Devas existieren leiblich als grüne, wachsende Pflanzen hier auf der Erde, sind aber zugleich physisch ungebundene Geistwesen in der »Anderswelt«, die uns in Trance, in der Vision, im Traum und auf der Schamanistischen Reise begegnen können.
Mit den Devas zu sprechen, wirklich pflanzenkundig zu werden, bedeutet, Zugang zur Jenseitswelt, zur Devawelt zu bekommen. Das ist nicht einfach, denn schließlich liegt diese verborgene Dimension des Seins am anderen Ufer des Totenflusses Styx, hinter den sieben Bergen, jenseits des von schrecklichen Sphinxen behüteten Tores. Auf so eine Reise muß man karmisch vorbereitet worden sein. Es ist ein langer Weg, der sich über mehrere Inkarnationen erstreckt. Es ist eine Begabung, die einem die Götter und Schicksalsmütter in die Wiege gelegt haben. Daß diese Begabung vorhanden ist, zeigt sich zunächst in vagen Ahnungen oder auch in einem unerklärlichen Interesse an Pflanzen und ihren Heilkräften. Diese Ahnungen, unterstützt durch Träume und eigenartige »Zufälle«, gipfeln oft in einem Gefühl des Berufenseins. Meistens widerstreben Schamanen ihrer Berufung, denn Heiler und Botschafter der Jenseitswelt zu sein, ist mühevoll.
Wer dazu berufen ist, den drängen die Ahnen und Götter. Oft schicken sie eine Krankheit, die nur durch das Schamanisieren geheilt werden kann. Schließlich kann der Berufene nicht anders, als dem Ruf zu folgen.
Die ersten Schritte
In jedem, der dieses Buch liest, schlummert vermutlich schon etwas von dieser Begabung, wenn nicht gar Berufung, denn sonst würden diese Zeilen sein Interesse gar nicht wecken. Interesse ist der Schlüssel, der Leitfaden! Interesse bedeutet dem Wortursprung nach, sich ganz im Wesentlichen zu befinden (lat. intra = innerhalb, esse = sein, Wesen). Zweitens muß man die Pflanzen lieben, denn – das sagt eine alte Weisheit – nur was man liebt, kann man wirklich verstehen.
Diese von Interesse und Liebe getragene Begabung muß jedoch erst ausgebildet werden. Einst war es so: Wer sich zur Kräuterkunde berufen fühlte, suchte sich erfahrene Kräuterkenner, Wurzelmütter oder Wurzelseppen, um von ihnen zu lernen. Das Lernen war aber kein Botanikstudium, wie es an den Hochschulen betrieben wird, wo man nur den materiellen Aspekt, das Wäg- und Meßbare der Flora erfahren kann. Nicht nur Kopfdenken, sondern auch Herzenswissen wurde vermittelt. Der Schüler wanderte mit den Kräuterkennern durch die Wiesen und Wälder. Selten wurde dabei gesprochen, denn die Stille des Herzens ist wichtig, um die Sprache der Pflanzen zu verstehen. Der Lernende half mit, die Wurzeln zur rechten Zeit zu graben, die Kräuterbündel zu bereiten, die Heilmittel herzustellen, und wenn etwas zur Sprache kam, dann waren es vor allem die in kurze Reime gefaßten Sammelregeln oder die über lieferten Sprüche, mit denen man die Pflanzen ansprach.
Einbeere, wer hat dich gepflanzt?
Unsere Frau mit ihren fünf Fingern!
Durch alle ihre Macht und Kraft
Hat sie dich hierher gebracht,
Daß ich werde gesund!
Zeig nun, liebes Kräutlein,
die Kraft, die Gott dir gegeben hat!
Viele solche Sprüche und Sammelregeln gab es, in denen ein Wissen um die Geistigkeit der Pflanze und ihr Eingebettetsein im Kosmos zum Ausdruck kommt. Aber wo sind die Wissenden heutzutage? Die Kirche, auf das spirituelle Monopol bedacht, führte einen Vernichtungskampf gegen jene, die noch etwas von der makrokosmischen Spiritualität der Natur wußten. Die eifrigen Schulmeisterlein der Aufklärung taten das Ihrige. Was übrigblieb, ist meist dekadenter Aberglaube, obwohl – von den Gelehrten meist unbemerkt – manch altes Rezept von den Großmüttern an die Enkeltöchter weitergegeben wurde. Aber im Zeitalter der Pharmakologie und Industriemedizin reißt der rote Faden der Überlieferung immer mehr. Also sind nun einzig die indianischen Medizinmänner, die nepalesischen Jhankries und andere endogene Meister der Pflanzenkunde unsere Lehrmeister. Sie können uns helfen, den Faden wieder zu knüpfen. Doch das ist schwierig über die kulturellen Barrieren hinweg. Zudem ist es meistens nicht die Flora unserer heimatlichen Wiesen, Wälder und Felder, mit der sie sich auskennen; ihre Rituale und die Geistwesen, mit denen sie verkehren, sind nicht die, mit denen unsere Ahnen vertraut waren. Dennoch können sie wertvolle Hinweise geben, die wir dankbar annehmen. Leider geraten auch diese Kulturen unter die Räder des Welthandels und Neokolonialismus, und so geht auch ihr Wissen allmählich verloren. In den Stammesgesellschaften finden sich kaum noch junge Leute, die dafür zu haben sind. Das Motorrad, der Kassettenrekorder und andere westliche Zauberinstrumente sind interessanter für sie. Islam, Christentum oder andere weltanschauliche Ideologien ersetzen traditionelle, auf die Natur bezogene geistige Inhalte. Wie also kann man heutzutage wirklich kräuterkundig werden?
Erstens müssen wir wissen, daß die Pflanzengottheiten, die Devas selbst ein Interesse daran haben, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen. Sie suchen sich geeignete Menschen als »Kanal« für ihre Botschaften. Zweitens können auch wir viel tun, um uns auf die Kontaktaufnahme seitens der Devas vorzubereiten.
1. Die wichtigste Vorbedingung ist eine reine Seele, denn nur wer ein reines Seelengewand trägt, wird mit göttlichen Lichtwesen – wie die Pflanzendevas es sind – kommunizieren dürfen. Dazu gehören ein gutes Gewissen, Aufrichtigkeit, Mitgefühl und Geistesgegenwart. Schließlich ist die Kontaktaufnahme mit den Pflanzengeistern eine Begegnung mit dem Jenseits, und wenn man von Selbstsucht, schlechtem Gewissen und bösen Absichten geplagt ist, wird man – fast wie im Spiegel – nur höllische, grauenhafte Erfahrungen machen.
Die Ojibwa-Indianer haben eine berühmte Zunft der Kräuterheilkundigen, die Midewiwin. Die Medizinmänner und -frauen dieser Zunft sind Meister der Kräuterheilkunde. Die von den Midewiwin-Heilern als Voraussetzung gegebenen Leitlinien sind es wert, in diesem Zusammenhang betrachtet zu werden. (Johnson 1992:122)
Danke dem Großen Geist für alle seine Gaben.
Achte die Alten; in ihnen achtest du Leben und Weisheit.
Achte das Leben in all seinen Formen, und dein eigenes Leben wird immer Hilfe finden.
Achte die Frauen; in ihnen achtest du das Geschenk des Lebens und der Liebe.
Achte das Versprechen; halte dein Wort, und du wirst wahr sein.
Achte die Freundlichkeit; freundlich bist du, wenn du deine Gaben teilst.
Sei friedfertig; durch Frieden wirst du den Großen Frieden finden.
Sei mutig, durch Mut wirst du an Kräften wachsen.
Sei maßvoll in allen Dingen; schau hin, höre zu und denke nach, dann werden deine Taten klug sein.
2. Gehe hinaus zu den Pflanzen. Mache jeden Tag, egal wo du wohnst oder wie das Wetter ist, einen Spaziergang und beobachte die werdenden, sich ständig wandelnden Zeitenleiber der Pflanzen. Was du da siehst, ist die Spur, die das Devawesen in der materiellen Welt hinterläßt. Auch die Stadt ist kein Hindernis für die Annäherung an die Pflanzenwelt. Interessante, mutige kleine Kräutlein, voller Heilkräfte und umwoben von interessanten Geschichten, wachsen da am Bordstein, im Schutt oder in den Parks. Seltsame Einwanderer aus fremden Ländern wuchern an stillgelegten Bahndämmen. Da findet man Goldruten aus Kanada, die Kraft haben, kranke Nieren zu heilen. Da stehen Himmelsbäume (Ailanthus), die ursprünglich aus China kommen und in deren Rinde kaum bekannte Heilkräfte schlummern. In der traditionellen chinesischen Heilkunde wird Ailanthus-Rinde in Wasser gekocht (zwei Teelöffel pro Tasse) und löffelweise bei Durchfall, Weißfluß oder Bandwurm eingegeben. In den Gräben findet man das aus Kaschmir eingewanderte saft- und kraftstrotzende drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera), dessen Samen köstlich nußartig schmecken und dessen mauvefarbenen Prachtblüten von den Indern als alkoholische Tinktur bei Hautpilz Anwendung finden. Aus den Blüten stellte Edward Bach übrigens eine Blütenessenz gegen »Ungeduld« her. An den meisten Bahndämmen wächst auch die schöne Nachtkerze (Oenothera), die 1612 aus dem Botanischen Garten in Padua entkam und wegen ihrer gut schmeckenden Wurzel bald darauf als »Schinkenwurzel« in den Gemüsegärten angebaut wurde. Inzwischen hat man in dem Öl der Nachtkerzensamen ein wunderbares Heilmittel bei PMS, endogenen Ekzemen, Alkoholvergiftung, Polyarthritis und anderen modernen Leiden entdeckt. Die Liste der am Bahndamm wachsenden Zauber- und Heilpflanzen könnte bis ins Unendliche weitergeführt werden.
Bei Spaziergängen sollte man unbedingt darauf achten, von welcher Pflanze man besonders stark angezogen wird. Das ist nicht von ungefähr. Diese Pflanze hat dem betreffenden Menschen etwas Wichtiges zu sagen. Sie hat mit ihm zu tun, karmamäßig, schwingungsmäßig. Vielleicht ist sie das Heilmittel, das er gerade braucht. Auf jeden Fall gilt es, auf solche Fingerzeige der Pflanzendevas zu achten.
3. Selbstverständlich darf man nicht nur »Schöngeistern«. Man muß sich auch die Zeit nehmen, die Pflanzen genau zu betrachten. Auch sollte man sie unbedingt genau botanisch bestimmen, ihren offiziellen lateinischen Namen und ihre Familienzugehörigkeit kennen. Dazu braucht man ein gutes Bestimmungsbuch. Ein Buch mit klaren, farbigen Illustrationen ist dabei oft wertvoller als abstrakte Bestimmungstabellen, die allzuoft auf die falsche Fährte führen und zudem vom unmittelbaren Erleben der lebendigen Pflanze ablenken.
Die Familienzugehörigkeit einer Pflanzeart zu kennen ist aufschlußreich. Jede Familie hat ihre ganz besonderen Charakteristika. Wenn man auf ein Wolfsmilchgewächs stößt, kann man erwarten, daß es einen gummihaltigen Milchsaft (Latex) enthält. Der Gummibaum, aus dem wir Autoreifen und Gummistiefel machten, gehört dazu. Bei einem Lippenblütler würde es erstaunen, wenn nicht irgendein ätherisches Öl darin enthalten wäre. Mohngewächse wirken fast alle narkotisch oder wenigstens sedativ auf das Nervensystem. Malvengewächse sind schleimhaltig. Brassicagewächse, die Kohlfamilie, erzeugen nicht nur schwefelige Öle, sie sind auch besonders menschenfreundlich und suchen die Nähe des Menschen. Nachtschattengewächse sind Meister der Synthese von Tropanalkaloiden. Und kaum eine Pflanzenfamilie übertrifft die Enziangewächse, wenn es um die Herstellung von Bitterstoffen geht. Auch wenn man die Pflanzenart nicht sofort bestimmen kann, weiß man bereits viel über sie, wenn man ihre Familie kennt.
4. Die Pflanze, die einen anspricht, soll man nicht nur mit den Augen betrachten, sondern mit allen Sinnen in sich aufnehmen. Wie einer (einem) Geliebten sollte man sich ihr öffnen. Man berühre mit liebender, empfindsamer Hand ihre glatten, wachsigen, lederigen oder haarig-filzigen Stengel und Blätter; man fühle die Zartheit der Blütenblätter und jungen Triebe. Man soll sie beschnuppern, den süßen Duft der Blüte, die würzige Frische der Blätter einatmen und auskosten. Der Riechsinn, verbunden mit unserem archaischen Tierhirn, führt uns in profunde Dimensionen des Pflanzenwesens. Auch schmecken soll man die Pflanze, das Blättchen, die Wurzeloder Zweigspitze behutsam kauen und dabei der Wirkung auf Leib und Seele nachspüren.
Nur bei den Giftpflanzen muß man vorsichtig sein. Giftsumach (Poison Ivy) oder der mächtige Mantegazzi Riesenbärenklau ist nicht zum Kosten oder Liebkosen geeignet. Das würde eine schwere Dermatose nach sich ziehen. Hätte man vom gefleckten Schierling gekostet, würde man sich garantiert in der Luft schwebend wiederfinden, ohne die geringste Ahnung, wie man wieder zurück in den Leib kommen soll. Es ist also – genau wie beim Pilzesammeln – wichtig, die giftigen Arten genau zu kennen und sich ihnen besonders behutsam zu nähern. Zum Glück sind die wenigsten Pflanzen wirklich gefährlich. Die meisten, die in den Büchern als giftig beschrieben werden, sind eher ungenießbar. Außerdem warnen die meisten Giftgewächse – ähnlich einer rasselnden Klapperschlange – mit ungewöhnlichen Signaturen, knalligen, abstoßenden Farben, alarmierenden Gerüchen oder absonderlichen Wuchsformen. Schierling sieht schon aufgrund seiner welken, blaß mehligen Blätter und der, an subkutane Blutungen erinnernden, rötlichpurpurgefleckten Stengel giftig aus; dazu kommt ein abstoßender Geruch, der an Mäuseurin erinnert. Auch der Stechapfel schreckt Neugierige mit seinen stacheligen Früchten, seinem rohen Gestank und den an Fledermausflügel erinnernden Blättern ab.
Es gibt aber auch verführerische, heimtückische Giftgewächse wie die Tollkirsche, deren schwarze Beeren angenehm süß schmecken, so daß man, wenn man nicht um ihre Wirkung weiß, gern mehr davon ißt. Einem mir bekannten Alt-Hippie ist das passiert. Er wollte nur einmal kosten, fand die Beeren aber so schmackhaft, daß er etwa 17 aß und erleben mußte, daß er sich nicht mehr vom Waldboden erheben konnte. Zwei grauenvolle Tage verbrachte er dort und hatte alle Mühe sein Herz am Schlagen und seine Lungen am Atmen zu halten, derweil sein Geist sich immer wieder ruckartig an weit entlegene Orte entfernte. Glücklicherweise hat er überlebt, aber er ist durch dieses Erlebnis ein anderer geworden. Der Deva dieses Nachtschattengewächses, der gern als bezaubernd schöne Frau erscheint, behält immer etwas von der Seele desjenigen zurück, der ihm einmal verfallen war. Die alten Angelsachsen hatten einen Namen für solche Gefangene des Belladonna-Devas. »Dwaler« nannte man sie, vom altgermanischen »*dwal« (= trödeln, zurückbleiben, in Trance verharren).
Oft sind die ausgesprochenen Giftgewächse in ihrem Jugendstadium schwer zu bestimmen. Ihre warnende Signatur ist noch nicht voll ausgeprägt, und sie sind daher leicht zu verwechseln. Es ist also wichtig, nicht nur vorsichtig zu sein, sondern die wenigen Giftpflanzen außerdem durch und durch, in allen Lebensstadien zu kennen. Gegebenenfalls muß man im Botanischen Garten einen Experten fragen. Und falls man sich wirklich mit ihnen anfreunden will, muß man äußerst behutsam vorgehen, lange bei ihnen meditieren und bei Selbstversuchen mit homöopathischen Geringstdosierungen anfangen. Dazu muß noch gesagt werden, daß es in der Natur die Kategorien Giftig/Ungiftig ebensowenig gibt wie die Kategorien Gut/Böse. Diese Begriffe entspringen unseren kulturellen Vorstellungen – sagte doch schon Paracelsus: »Alle Dinge sind Gift. Allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist.«
5. Wie wir schon sagten, ist der Deva nicht auf seine äußere, physische Pflanzengestalt beschränkt. Er befindet sich weniger in der Pflanze selbst, sondern umschwebt, umwirkt sie. Er ist ein freies, ungebundenes Geistwesen, das sich überall hin bewegen und in praktisch jeden Gegenstand und jedes andere Lebewesen hineinschlüpfen kann. Wenn man sich also mit einer Pflanze beschäftigt, die man kennenlernen möchte, muß man auf die Erscheinungszusammenhänge achten. Wer ging da gerade vorbei? Welcher Vogel sang da? Welche Gedanken kamen mir spontan in den Sinn? Man übt sich in Aufmerksamkeit und in Achtsamkeit oder, wie es die Buddhisten nennen, in Satipatthana.
Ein Beispiel: An einem Wanderpfad im Jura fand ich eine Tollkirsche. Da ich genügend Zeit und Muße hatte und sie besser kennenlernen wollte, setzte ich mich zu ihr hin, grüßte sie und betrachtete meditativ jeden Teil, fühlte ihre zarte Haut und sog schnuppernd ihre »roh-giftige« Ausdünstung in die Nase. Dazu kostete ich ein winziges Blattstückchen und meditierte über dessen angenehm bitteren Geschmack. Als ich nach einer Weile wieder zum funktionellen Alltagsbewußtsein zurückkehrte, bedankte ich mich bei der Pflanze, wie es sich gehört, und schenkte ihr, wie ich es bei den Indianern gelernt hatte, etwas Tabak. Plötzlich bemerkte ich in einiger Entfernung ein dunkles Tier. Es war ein Marder, der mich intensiv anschaute. Seine kohlschwarzen, glänzenden Augen waren den Beeren der Tollkirsche zum Verwechseln ähnlich. Als das Tier meine Überraschung gewahrte, spannte es, als wolle es wegspringen. Aber als es spürte, daß ich weiterhin in einem meditativen Zustand verharrte, beruhigte es sich, lief langsam einige Meter den Pfand entlang, drehte sich um und blickte mir noch einmal direkt in die Augen, bevor es im Gebüsch verschwand. Das Tier war Träger des Pflanzengeists gewesen.
Der Belladonna-Deva demonstrierte seine Macht am nächsten Tag, als ich mit einer Gruppe von zwölf Freunden den Hügel erklomm, um ihnen die schöne Pflanze zu zeigen. Es war ein herrlicher sonniger Tag, ein blauer Himmel strahlte, als wir loszogen. Hinter einem der Berge stieg eine weiße Kumuluswolke auf. Sehr schnell quoll sie zu bedrohlicher Größe auf, verdeckte die Sonne und wurde zunehmend dunkler. Als wir ungefähr dreißig Meter von der Pflanze entfernt waren, wurde es finster, ein brausender Sturm hob an. Von Blitz und Donner begleitet brach die Wolke, und es goß in Strömen. Zwanzig Meter von der Tollkirsche entfernt fing es so stark zu hageln an, daß wir, pitschnaß und vor Kälte schlotternd, umkehren mußten. Auf dem Weg ins Tal legte sich der Sturm ebenso schnell, wie er gekommen war. Als wir unten im Dorf ankamen, lachte die Sonne wieder aus einem klaren, blauen Himmel.
Osho (Acharya Rajneesh) sagte einmal: »Rede mit einer Pflanze, und mache dich auf ein Wunder gefaßt!« (Osho 1995) Das kann jeder gute Gärtner bestätigen. Doch leider hat meine Geschichte ein trauriges Ende. Als ich die Belladonna das nächste Mal besuchen wollte, lag sie von einem Stock zerschlagen und von ungnädigen Füßen zertrampelt am Boden. Vielleicht hatte sie durch die freundliche Aufmerksamkeit, die ich ihr geschenkt hatte, so viel Vertrauen gegenüber den Menschen gewonnen, daß sie es nicht mehr für nötig hielt, sich unsichtbar zu machen. Ein »guter« Mensch, der das Böse haßt, auch die bösen Giftpflanzen, hatte sie wie eine giftige Natter niedergestreckt. Schon im Mittelalter hatte Hildegard von Bingen gewarnt, der Teufel sei keiner Pflanze näher als der Tollkirsche. Leider gibt es noch immer Tugendbolde, die nicht wahrhaben wollen, daß alle Kreaturen Kinder Gottes sind, und denen daran gelegen ist, Fliegenpilz, Tollkirsche und Riesenbärenklau auszurotten. Wenn man sie fragt warum, mangelt es selten an guten Motiven: »Damit sich unschuldige Kinder nicht daran vergiften«, heißt es dann meist.
6. Um das Erlebnis der Begegnung mit einer Pflanze zu intensivieren, vergegenwärtige man sie sich im Geist. Eine abendliche Meditation, eine Rückschau, in der man ihre Erscheinung noch einmal vor das innere Auge holt, ist hier hilfreich. Man kann sie auch zeichnen oder mit fließenden Wasserfarben so malen, als porträtiere sie sich selbst. Wer tänzerisch begabt ist, kann die Pflanze eurythmisch nachtanzen – am besten unter freiem Himmel. Selbst zur Pflanze geworden, öffnet sich der Tänzer der Sonne, spürt ihre lebensbringende Wärme; gleichzeitig wurzelt er im kühlen, feuchten Boden; der Wind streicht ihm durchs Laub und wiegt ihn; erwächst, er blüht, wird zu Samen und Frucht. Dieser Pflanzentanz ist die reine Ekstase. Es dauert danach oft eine Weile, bis man wieder in die »Realität« zurückkommt. Die einzige Gefahr bei dieser Übung besteht darin, daß der Nachbar die psychiatrische Notaufnahme alarmiert.
7. Viele Märchen, Sagen, Legenden und Erzählungen umranken die Pflanzen. Da gibt es Geschichten von Jungfrauen, die sich in Bäume verwandeln, von Pflanzen, mit denen sich Zauberer unsichtbar und Krieger unverwundbar machen. Da wird von Naturgeistern, Dryaden, Yakshas und anderen ätherischen Wesenheiten berichtet, die in Bäumen und Kräutern leben. So ist zum Beispiel die hübsche Wegwarte, die an den Wegrändern wächst, eine verwandelte junge Frau, die mit ihren blauen Augen nach Osten blickt; der Ritter, dem sie ihr Herz geschenkt hat, ist im Kreuzzug gen Jerusalem gezogen und nie wiedergekehrt. Da gibt es die Pukwuschen, kleine häßliche Männlein mit drei goldenen Haaren auf dem Kopf, die in den Brennesselhorsten leben und arglosen Bauernfrauen nachstellen. Da sind die Elfen, die sich nur vom Blütenduft ernähren, und die Gnome, die unter den Wurzeln leben.
Pflanzenschamanen und Kräutermütter sind meisterhafte Märchenerzähler. Ihre Erzählungen sind dermaßen lebendig und bildhaft, daß man meinen könnte, sie hielten diese Geschichten für die blanke Wahrheit. Und das tun sie auch augenzwinkernd. Wahre Märchen sind eben nicht nur phantasievolle Erfindungen, sondern vielmehr in bunte, bildhafte Imaginationen gefaßte Erfahrungen der »inneren Welt«. In den Märchen kommt die angesammelte Weisheit eines Stammes, eines Volkes zum Ausdruck.
Pflanzenmärchen sind wahr. Sie erzählen von den transsinnlichen Wesenheiten, den Devas, Natur- und Ahnengeistern und ihrer Beziehung zur Menschenseele.
8. Wer sich von Pflanzen angesprochen fühlt, sollte auf seine Träume achten. Man braucht kein Indianer zu sein, um zu wissen, daß Pflanzen im Traum zu uns sprechen können. Vielen Menschen wurden Heilpflanzen im Traum offenbart: Karl der Große träumte von der Silberdistel, die ihm in der Gestalt eines Engels erschien; Alexander träumte von einem Drachen, der ihm eine Wurzel gab, mit dem er seinen besten Freund Ptolemäus heilte; Melanchthon, der große Humanist, träumte vom Augentrost, der ihn von einem Augenleiden befreite. Die Pflanzendevas schicken den Menschen ständig solche Träume, nur sind wir im Zivilisationsprozeß so stumpf und unbewußt geworden, daß wir sie meistens nicht wahrnehmen. Wenn man sich darin übt, wird es nicht allzulange dauern, bis die Heilpflanzen wieder im Traum erscheinen.
Traum und schamanistische Trance sind nicht allzuweit voneinander entfernt. Im Schlaf werden wir pflanzenähnlicher. Wie eine Pflanze heben wir uns in diesem Zustand über die Bindung an unseren physischen Körper hinaus. Unser Bewußtsein wendet sich von der äußeren Welt ab und der »Innenseite« des Seins zu. Beim Einschlafen geht unsere Seele (Astralleib) auf Astralreise. Wir fahren zum Mond und fliegen noch weiter durch die Planetensphären, um uns schließlich jenseits der Saturnsphäre am Urquell des Lebens zu laben. Dabei durchwandern wir die Regionen, in denen sich die gütigen Pflanzendevas befinden. Dort können wir uns mit ihnen von Geistwesen zu Geistwesen austauschen, sie befragen und ihren Rat entgegen nehmen.
Leider vergessen wir meist alles, was wir so erfahren haben. Was uns bleibt, sind lediglich ein paar verworrene Traumfetzen. Aber manchmal bleibt eine Erinnerung zurück. Da hat man vielleicht von einem Strauch mit gelben, spinnenartigen Blüten geträumt, und wenn man dann am selben Februarmorgen im Park seinen Spaziergang macht, sieht man plötzlich einen im Schnee blühenden Zaubernußstrauch (Hamamelis) und erinnert sich daran, daß das genau das Heilmittel für die Hämorrhoiden oder Krampfadern ist, die einen Freund plagen.
Schamanen und Yogis sind jene wachen Geister, die die Botschaften aus den Devawelten unverfälscht zurückbringen können. Sie sind in der Askese geübt, so daß sie dem dringenden Verlangen widerstehen können, aus dem Fluß des Vergessens, der Grenze zwischen Hier und Dort, zu trinken.
Egotod und Einweihungskrankheit
Schamane ist nicht gleich Schamane. Es sollte klar sein, daß es, je nach Macht und Tiefe der Einsicht, Abstufungen unter ihnen gibt. Einige sind schlicht Sensitive, die die Schwingungen der Pflanzen mit denen der Kranken in Zusammenhang bringen können. Andere gehen in leichte tranceartige Zustände oder empfangen die Devabotschaften im Traum. Viele haben Elementarwesen, Familiare oder auch Totengeister als Helfer beim Heilen und beim Suchen der Heilpflanzen. Andere wiederum wandern weit in die geistige Welt hinaus und kommunizieren unmittelbar mit den Devas.
Diese Abstufungen haben nichts mit den Einweihungsgraden vieler esoterischer Logen zu tun. Sondern der mit karmisch bedingter geistiger Kraft. Es kommt darauf an, wie weit der Schamane ins »Jenseits« eindringen kann, wie hoch er in Vogelgestalt den Weltenbaum hinaufflattern kann. Bei den sibirischen Naturvölkern heißt es, daß ein großer Schamane in einem Nest hoch oben im Wipfel des Weltenbaumes von der Vogelmutter ausgebrütet wird, ein weniger begabter Schamane dagegen nistet in den unteren Zweigen.