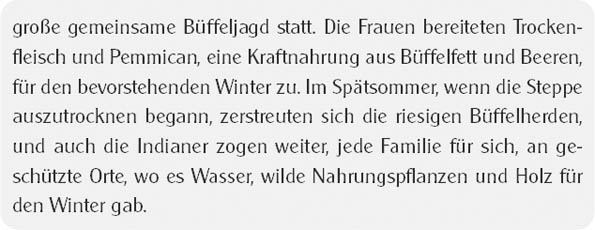
Der Gang durch die vier Elemente
Was poetisch als Wandel der Pflanzengöttin durch die acht Stationen des Jahreskreises beschrieben wird, kann auch ganz anders dargestellt werden, nämlich als Wechsel der Vorherrschaft von einem zum anderen der vier klassischen Elemente.
Im Winter, von Samain bis Lichtmeß, ruht die Vegetation. Sie verharrt in die dunkle Erde gebettet als Samen oder Knolle, klammert sich als Rosette so dicht wie möglich an die Bodenoberfläche oder ballt sich fest zur samenkornähnlichen Knospe zusammen. In diesem Ruhezustand ähneln die Pflanzen den Mineralien. Vor allem Stärke, Salze und Mineralien machen ihre chemische Beschaffenheit in dieser Periode aus. All das entspricht dem Elementarzu stand Erde.
Mit der Schneeschmelze zwischen Imbolc und Beltene saugen sich die Samen mit erquickendem Wasser voll, keimen, sprießen und sprossen. Mit dem Ergrünen beginnen die jungen Triebe sofort wasserlöslichen Zucker (Glukose) zu produzieren. In diesem Zustand des fließenden Wachstums dominiert das Element Wasser.
In den langen lichtgesättigten Tagen des Sommers, zwischen Beltene und Lugnasad, blühen die meisten Gräser und Kräuter. Süßer Nektarduft und – für Heuschupfenleidende weniger erfreulich – ganze Wolken von Blütenstaub schwängern die milde Sommerluft. Die Pflanzenchemie erhält nun einen neuen Impuls. Komplexe Molekularverbindungen, vor allem ätherische Öle und pflanzliche Pheromone werden synthetisiert. Die der Sommerbrise und dem Licht hingegebene Pflanzenwelt wird von den Bildekräften des Luft- und Lichtelements dominiert.
Nach Lugnasad kommt die reifende, dem vegetativen Wachstum ein Ende setzende Kraft des Feuers zum Zuge. Chemisch findet das seinen Niederschlag sowohl in der Bildung von Eiweißen und schwereren, fettigen Ölen in Samen und Nüssen als auch in der Ansammlung von Fruchtzucker im Obst.

Planetenleiter
Pflanzen wie die Herbstzeitlose oder die Nieswurz fallen zwar ganz aus diesem Schema; sie blühen im Winter und geben sich eigenartigen Stoffesverwandlungen hin. Das macht sie besonders giftig oder auch besonders heilkräftig. Auch die Vegetation der Tropen folgt anderen Rhythmen (Regenzeit, Trockenperiode usw.), die aber ebenfalls von kosmischen Periodizitäten vorgegeben werden. Die meisten Pflanzenarten unserer Breiten halten sich jedoch an das hier illustrierte Entwicklungsschema.
Dieser Gang durch die Elemente offenbart sich als ein ständiges Werden und Vergehen, als Prozeß des Aufbaus und des Abbaus. Der Aufbau findet vor allem in der ersten Jahreshälfte statt, der Abbau in der zweiten. Dem Wachstum vom unterirdisch keimenden Samen bis hin zur Blüte steht das Vergehen, das Welken und Versamen gegenüber. Es lohnt sich, diesen Vorgang etwas näher, und zwar aus einer ganzheitlichen Perspektive zu betrachten. Bei diesen Ausführungen stütze ich mich vor allem auf die Vision des Arthur Hermes. (Storl 1990:50)
Es wurde schon erläutert, daß die Pflanzendevas ihre Urbilder in den Fixsternen haben. Um zu inkarnieren, um irdisch zu werden, müssen sie sich mit der Materie verbinden. Mutter Erde ist es, die die geistigen Urbilder in ihrem dunklen Schoß empfängt und ihnen lebendige Verkörperung ermöglicht. Die Devas strahlen ihre unsichtbaren, geistigen Formkräfte von den Sternen auf die Erde hinab. Die Mineralien und Kristalle im Erdboden wirken dabei als Attraktoren. Schon die babylonischen Magier und die jüdischen Kabbalisten wußten um die okkulten Sympathien und Korrespondenzen zwischen den fernen Fixsternen und den Mineralien und Edelsteinen tief in der Erde. Die Mineralien resonieren mit den einströmenden Sternenenergien und leiten diese an die Wurzeln der Keimlinge weiter. Noch im Mittelalter galten die im Winter herabrieselnden Schneekristalle als sichtbares Zeichen der vom Himmel herabströmenden Kräfte, die sich dann im Pflanzenwachstum und in der Ernte des kommenden Jahres offenbaren.
Auf dem Weg vom Sternenzelt hinab zu Mutter Erde durchstrahlen die pflanzlichen Urbilder die sieben Planetensphären. Bildhafter ausgedrückt: Die Pflanzengeister klettern die Himmelsleiter, deren Sprossen die Planeten sind, ins physische Dasein hinab. Oder noch anders gesagt, die Pflanzen durchwandern auf ihren Weg in die Inkarnation die Reiche der Planetengötter. Angefangen mit Saturn, der an der äußersten Grenze der sichtbaren Wandelsterne seine Bahn zieht, führt der Weg über Jupiter, Mars, die Sonnensphäre, Venus, Merkur und den erdnahen Mond, zur Erde hinab.
Jeder Planetengott beschenkt die Pflanzenkinder auf seine Weise mit Farben, Düften, geometrischen Mustern und anderen Eigenschaften. Jeder Planet bündelt und verstärkt bestimmte Energien und blockiert andere. Nach Ansicht der alten Alchimisten und Gelehrten verleiht Saturn ihnen »Milzkräfte«, Jupiter »Leberkräfte«, Mars »Blutkräfte«, die Sonne »Rhythmus und Herzkräfte«, Venus die »Kräfte der Drüsen«, Merkur »Lungenkräfte« und der Mond »Fortpflanzungskräfte«. Auf diese Weise gestaltet sich der astrale und ätherische Körper der Pflanze. Auf diese Weise bekommt die Pflanze auch ihre ganz spezifischen Heilkräfte. Das von Mond und Jupiter besonders geprägte Schöllkraut wird zum Leberheilmittel, die von der Venus geprägte Birke reinigt Nieren und Harnorgane, und die Brennessel erhält vom roten Mars ihre blutbildenden Eigenschaften.
Erst wenn der Pflanzengeist die Mondsphäre verläßt, ist die physisch-materielle Manifestation des Pflanzenwesens möglich. Im feuchten, mondhaften Humus keimt es und beginnt sein irdisches Dasein. Aber dieses In-Erscheinung-Treten stellt zugleich einen Wendepunkt dar. Kaum hat die Pflanze ihre zarten Keimblätter entfaltet, wächst sie schon wieder unerbittlich ihrem Ende entgegen. Sie klettert – diesmal für unsere Augen sichtbar – die Planetenleiter empor und verschwindet, entkörpert, in die Fixsterne.
Wie sieht die Rückkehr zu den geistigen Urbildern aus? Folgen wir der Pflanze Schritt für Schritt die Sprossen der Planetenleiter empor. Im Mond entfalten sich die Keimblätter, und das grüne Chlorophyll, das »Auge« und die »Lunge« der Pflanze, sieht zum ersten Mal das Licht des Diesseits und atmet die diesseitige Luft. Das weitere Wachstum gleicht einem in Zeitlupe gedrehten wirbelnden Tanz. Um den zentralen Sproß kreisend, strebt die Pflanze dem Himmelslicht zu, während ihre Wurzeln saugend und tastend ins Erdreich hinabdringen. Diese von Goethe entdeckte »Spiraltendenz«, die nach oben schraubende Anordnung der Knospen und Seitentriebe um dem Haupttrieb herum, ist das getreue Abbild der Planetenbewegung in bezugauf die Sonnenbahn. (Vom geozentrischen Standpunkt aus gesehen umwirbeln die Planeten die in gerader Linie verlaufende Ekliptik.)
Der Durchgang durch die Merkursphäre offenbart sich im schnellen Emporschießen der Frühlingstriebe und in der rapiden Entfaltung des Laubs. In der Venussphäre – sie entspricht kalendarisch der Maienzeit – sind die Blätter voll entwickelt, und die Pflanze beginnt zu blühen. Blüten und Fruchtblätter sind die Gabe der Venus.
Die wachsende Pflanze wirbelt im abwechselnden Rhythmus von Systole (Zusammenziehen) und Diastole (Ausdehnen) dem Zenit entgegen. Botaniker sprechen vom Heliotropismus. An jedem Knoten verlangsamt sich das Wachstum. Die Pflanze hält momentan inne und konzentriert ihre Kraft erneut. Dann streckt sie sich wieder explosionsartig in die Höhe, bis sie erschöpft am nächsten Knoten wieder eine Pause macht. Dieses rhythmische Stauen und Fließen gleicht unserem Ein- und Ausatmen. Es gleicht aber auch den traditionellen Reigen, die unsere Vorfahren in Einstimmung auf das Pflanzenwachstum um den Maibaum oder um die Dorflinde tanzten. Die Systole gleicht dem Schritt zurück, den die Tänzer machen, um dann zwei oder drei Schritte weiterzuspringen.
In jeder Systole besinnt sich die wachsende Pflanze auf ihre Anfänge, sie rekapituliert das Mondstadium ihrer Entwicklung. An den Knoten bilden sich oft Adventivwurzeln, die, wenn sie den Erdboden berühren, tatsächlich anwurzeln – beim Drüsigen Springkraut kann man das besonders leicht erkennen.
Wenn die Pflanze in ihrem Wachstum die Sonnensphäre erreicht, findet eine wahrlich große Metamorphose statt. Das Längenwachstum staut sich plötzlich. Das rhyhthmische Pulsieren des Zusammenziehens und Ausdehnens bleibt auf horizontaler Ebene bestehen. Die Pflanze blüht. Die Blume ist das von der Sonne bereitete, durchlichtete, duftende Hochzeitsbett des Pflanzenwesens.
Der Venusimpuls öffnet die Blütenknospe. In den bunten Blütenblättern streckt sich das Pflanzenwesen noch einmal diastolisch aus, im Fruchtknoten ballt sie ihre Lebenskraft an einem Punkt konzentriert zusammen. Auf dem Blütenboden neben dem Fruchtknoten strecken sich die Staubblätter unter dem Einfluß des Mars diastolisch aus, um sich dann ebenfalls in den Pollenkörnchen auf radikalste Weise systolisch zu konzentrieren. Ätherische Öle und süßer Nektar bilden sich in der Blüte. Es sind die Hochzeitsgeschenke des Sonnenfeuers und der obersonnigen Planeten.
Mit dem Durchgang durch die Venus/Sonnen/Marssphäre ist der Höhepunkt der pflanzlichen Verkörperung erreicht. Nachdem Wind, Bienen oder Schmetterlinge die Befruchtung besorgt haben, bewegt sich das Pflanzenwesen in die Jupitersphäre hinein. Das Blütenfeuer erlischt. Der reiche Götterkönig Jupiter hüllt die reifende Frucht in saftig süßes Fruchtfleisch. Dem Laub, das allmählich seine grüne Lebenskraft einbüßt, verleiht er ein sattes Gelb, Orange und Rot. Was einst ungestüme Wachstumskraft war, verwandelt Jupiter in Zucker und Eiweiß, die sich in Frucht und Samen konzentrieren. Er salbt das Pflanzenwesen vor der Vollendung seiner Erdenreise mit schweren Ölen (Olive, Nüsse) oder harzigem Balsam. Die Pflanze gleicht nun dem Sannyasin oder dem buddhistischen Mönch im Saffrangewand, der ebenfalls der Welt der äußeren Erscheinung den Rücken kehrt und auf Heimkehr zum geistigen Ursprung bedacht ist.
Nun erreicht das Pflanzenwesen erneut die Schwelle zu den Urbildern, die Saturnsphäre. Saturn befreit die Pflanze von allem, was sie mit dem materiellen Dasein verbindet. Nun erfriert sie im saturnisch kalten Winterwind. Sie wird grau, spröde und zerfällt, von Pilzen und Bakterien verdaut zu Staub und Humus – bis auf die winzigen Samen, die wie altes Karma als Kristallisationspunkte für künftige Inkarnationszyklen im Mutterschoß der Erde oder im Sack des Sämanns Saturn (er ist der Weihnachtsmann mit seinem Sack voll Nüssen, Äpfeln und Getreidekuchen) zu rückbleiben. Der strenge Planet entläßt die Pflanzenwesen aus der Welt der Erscheinungen und weist ihnen den Weg zu den Fixsternen. Im neuen Zyklus wird er der erste sein, der sie wieder begrüßt.
Auch der Mensch wandert diese Planetenleiter vom Jenseits ins physische Dasein herab und wieder hinauf. Auch er durchwandert die makrokosmischen Planetensphären. Er tut dies jede Nacht unbewußt im Traum und unwiderruflich, wenigstens bis zur nächsten Inkarnation, wenn er stirbt. Woher wissen wir das? Schamanen und Visionäre in allen Kulturkreisen haben davon berichtet, denn sie machen diese Reise bei vollem Bewußtsein. Die Bilder, mit denen sie diese Wunder beschreiben, sind allerdings von Kultur zu Kultur verschieden. Einmal ist es der kosmische Baum, auf dessen Ästen sie hinaufklettern oder wie Vögel flattern; mal ist es die Jakobsleiter; heutzutage ist es oft ein UFO, das sie durch die Sphären trägt; mal sind es Engel, mal Götter, mal magische Tierwesen oder »Außerirdische«, die ihnen dort begegnen. Wenn die Sphärenwanderer darauf eingestimmt sind oder demütig darum bitten, können sie auch den Pflanzendevas dort begegnen. Wenn sie wirklich starke Schamanen sind und sehr hoch fliegen können, werden sie mit den Devas reden können wie mit jedem anderen Ich-begabten Wesen. Und wenn sie von Mitleid und Liebe bewegt werden wie Buddha, werden sie Heilwissen von dort mitbringen.
Gattungsseele

Wenn wir vom Geist- oder Seelenwesen der Pflanze sprechen, muß uns klar sein, daß dies nicht individuell wie beim Menschen zu verstehen ist. Schon Aristoteles hatte erkannt: »Jede Pflanze hat nur eine Seele, und dennoch leben Pflanzen fort, wenn man sie teilt. Demnach scheinen die Geteilten dieselbe Seele zu haben.« Der Löwenzahn hier am Zaun hat also keine andere Seele als der Löwenzahn dort auf der Wiese. Alle Löwenzähne haben teil am Löwenzahnurbild, sie alle teilen sich denselben Geist, die selbe Seele. Es handelt sich um eine Art Gattungsgeist, der mit jedem einzelnen Mitglied der Art verbunden ist, der die ganze Art »überstrahlt«. Das göttliche Löwenzahnwesen ist also mit allen Löwenzähnen verbunden, es erfährt alles, was den kleinen Löwenzähnen auf der ganzen Erde passiert. Es freut sich, wenn sich jemand an dem blühenden Goldgelb einer Löwenzahnwiese erfreut, wenn ein Kind Pusteblume spielt und weniger, wenn der Besitzereines manikürten englischen Rasens es als Unkraut verflucht. Es ist froh, wenn sich jemand am vitaminreichen, schmackhaften Löwenzahnsalat ergötzt, die Wurzel als Kaffeezusatz röstet oder mit dem Kraut eine entschlackende, harntreibende Frühjahrskur macht. All das ist Teil des Dialogs. Die Gedanken, die Achtung, die Bewunderung und die Aufmerksamkeit, die wir ihm schenken, sind Nahrung für den Löwenzahngeist.
Am Anfang haben wir die Taittireya-Upanischade zitiert, wo es heißt »alles ist Nahrung«. Pflanzen sind unsere »Nahrung«, indem sie sich uns in der Atemluft und als Lebens- und Heilmittel schenken. Wir entgelten es ihnen, indem wir ihnen unsere Gefühle und Gedanken »zu essen« geben. Davon leben sie, das wirkt als Attraktor und zieht sie in die Verkörperung. Bewunderung und Aufmerksamkeit ist das Geheimnis des »grünen Daumens«, der einen Garten besonders gut gedeihen oder die Blumen auf der Fensterbank freudig blühen läßt. Die besondere Aufmerksamkeit, die der amerikanische Lügendetektorexperte Cleve Backster seinem Drachenbaum schenkte, wurde von der Pflanze reichlich belohnt. Er befestigte die Elektroden seines Polygraphen am Blatt der Zimmerpflanze und entdeckte den »Backster-Effekt«, nämlich, daß Pflanzen Gedanken lesen und Absichten wahrnehmen können! (Tomkins/Bird 1988)
Das Licht des Bewußtseins
Anthropologen mögen den Menschen als einen kybernetisch vernetzten Biocomputer, als Tier beziehungsweise »nackten Affen«, als einen von der Kultur geprägten »sekundären Nesthocker« oder wie auch immer auffassen – das wirklich Magische an ihm ist jedoch sein Bewußtsein. Das Licht unseres Bewußtseins bringt die Geister ins Dasein. Was immer unser Bewußtsein beleuchtet, wird gestärkt und gewinnt an Existenzkraft.
Je mehr uns die Technologie fasziniert, desto stärker manifestieren sich die chthonischen Wesenheiten, die die Griechen einst Titanen nannten, und desto stärker inkarnieren sie sich in der Gestalt von Maschinen und Elektronik. Je mehr wir von den titanischen Kräften des Magnetismus, der Elektrizität und des Atoms in Bann geschlagen werden, je weiter wir in eine »virtuelle Realität« hineinschlittern, desto weniger Energie fließt den anderen Daseinsbereichen zu: den Pflanzen und Tieren, den Elementarwesen, Geistern und Göttern. Der Prozeß ist bereits so weit fortgeschritten, daß die meisten modernen Menschen letztere ganz aus den Augen verloren haben. Weil wir ihr das Licht unseres Bewußtseins immer seltener zuleuchten lassen, kränkelt die ganze belebte Natur. Blumen, schöne Tiere, sogar der gute Ackerboden, die duftenden Wiesen, der Vogelgesang schwinden zunehmend dahin. Immer komplexere Maschinen treten in den Vordergrund und beherrschen unser Leben.
Je mehr wir uns dagegen den Göttern zuwenden, desto klarer kommen diese zum Vorschein, bis man sie – wie es in Indien noch häufig der Fall ist – förmlich auf Erden wandeln sehen kann. Je mehr wir uns unseren göttlichen Freunden, den Pflanzendevas zuwenden, desto mehr wird die Vegetation erstarken und uns Freude bereiten. Als Wanen bezeichneten die alten Germanen die mit den Pflanzen verbundenen Devas. An die Herrschaft der Wanen erinnern sich die Seher als ein goldenes Zeitalter, eine Zeit der Liebe und Eintracht, des Friedens und Wohlstands.
Wenn wir Blumen und Gräser wieder mit Entzücken betrachten und dem Wald aus echter Begeisterung unsere Lieder zusingen können, werden Artenschwund und Waldsterben bald ein Ende nehmen. Früher räumte man den Pflanzen einen großen Bereich im Bewußtsein ein, heute, den neusten Umfragen zufolge, kennt der durchschnittliche Bundesbürger lediglich nur noch sechs Arten–meistens lästige »Unkräuter«.
In allen Kulturen gab es sogenannte »Vermehrungsrituale«, die Pflanzen und Tiere in den Mittelpunkt des Bewußtseins rückten. Nur so konnte man sich versichern, daß die Lebensgrundlagen erhalten blieben. Es gab überall Schamanen, die seltene, scheue Pflanzen kannten und ihnen – sei es auch nur durch flüchtiges Betrachten – einen Platz im menschlichen Bewußtsein und damit im Dasein einräumten. Das heutige, von »Betroffenheit« zeugende, oft zitierte Schlagwort »Wir brauchen die Natur, aber die Natur braucht uns nicht« stimmt nicht ganz. Wir alle brauchen einander.
Die Schamanen, wie ursprünglich auch die Brahmanen, galten als »Weltenschöpfer«. Sie hoben die Dinge, auch die Pflanzen, aus dem amorphen Hintergrund hervor, indem sie sie aufzeigten und benannten. Mit einem »Schau, was da ist!« brachten sie sie ins menschliche Bewußtsein und machten sie zum Teil der Schatzkammer der menschlichen Kultur. Die Pflanzengeister dankten es den Sehern mit wertvollen Einsichten und Inspirationen.
Blumen mögen es, wenn wir sie dankbar pflücken, um unseren Eßtisch mit ihnen zu schmücken. Kräuter mögen es, wenn wir in ihnen einen Gesundheitsborn entdecken. Nicht das Pflücken von Blumensträußen und Sammeln von Heilkräutern hat viele Wildblumen zum Schwinden gebracht, sondern unsere Technologieversessenheit, der massive Einsatz von »Pflanzenschutzmitteln«, von Pestiziden, die die bestäubenden Insekten eliminieren. Auch die Straßenbeleuchtung – ein Ausdruck unserer Entfremdung und Lebensangst – ist für viele nachtschwärmende Insekten tödlich.
Das Sammeln, Graben und Schneiden der pflanzlichen Materie tut den Pflanzen nicht weh. Wenn das so wäre, wären wir alle Sadisten. Es wäre dämonisch, das Radischen zu zerschnipseln, die Kartoffel lebendigen Leibes zu verbrühen, das Johanniskraut abzubrechen und wie eine Mumie verdorren zu lassen. Dem Pflanzenwesen tut dies alles jedoch nichts, es rennt nicht schreiend weg, denn sein Geist und seine Seele sind nicht vollständig an seine Leiblichkeit gebunden. Pflanzengeister inkarnieren nur physisch und ätherisch. Ihr Astralleib und ihr »Ich« bleiben frei und makrokosmisch. Sie bleiben mit den göttlichen Ursprüngen verbunden. Der Mensch hingegen bringt auf dem Weg in die Verkörperung auch seine Seele und seinen Geist mit. Er bringt die Planetensphären ebenso wie den Fixsternhimmel mit in den Mikrokosmos seiner Existenz. Indem er die Pflanzen bewußt durch seine Sinnestore einläßt, werden auch sie Bewohner des Mikrokosmos. Sie wurzeln, wachsen und blühen nun in der inneren Welt des Menschen.
Jeder Mensch als Mikrokosmos ist sozusagen ein Samen des Makrokosmos, des universalen Meganthropos. Dieser Samen wird »eines Tages« zum vollen Kosmos auswachsen. Alles, was der Mensch in seiner mikrokosmischen Phase aufgenommen hat, wird Teil dieses künftigen Universums sein. Im Bewußtsein, daß das so ist, nehme ich das Beste mit, das Interessanteste. Ärger, Haß, Neid und andere Belastungen kommen nicht mit ins Gepäck, dafür aber viele schöne Pflanzen, deren Wesen Wonne und Glückseligkeit ist. So viele wie möglich nehme ich mit meinem Bewußtsein auf – Steine, Tiere und liebe Freunde natürlich auch. Und wenn die äußere Welt dann entfällt, wenn sie am »Weltenende« in Rauch und Asche oder in den wühlenden Gewässern des Chaos versinkt, sind diese Wesen noch in mir.
Holon
Wenn nun das Großmütterchen meint, es rede mit dem Pflanzengeist oder -deva, wenn es mit seiner Geranie redet, stimmt das. Zwar gibt es so etwas wie einen Geranien Deva, der alle Geranien der Welt überstrahlt, aber der ist auch als Holon in der einzelnen Pflanze enthalten, ebenso wie der Mensch in seiner genetischen Vielfalt in jeder individuellen Zelle des Körpers vorhanden ist oder das niederländische Wesen in jedem Holländer.