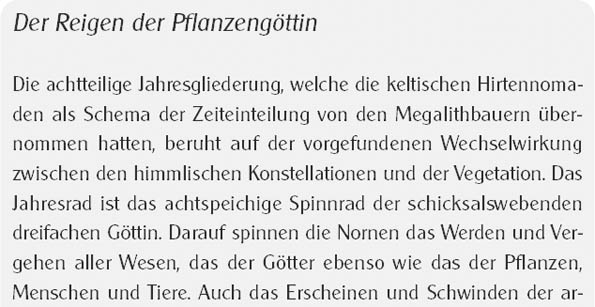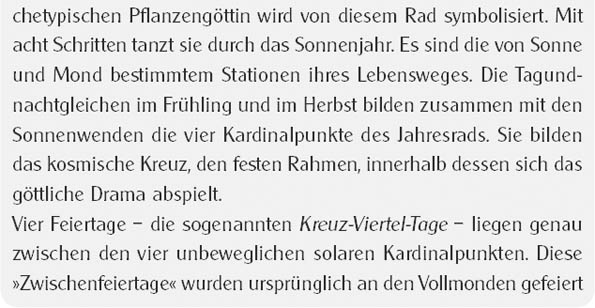Jede Pflanze, egal ob sie eine Nahrungspflanze oder eine Giftpflanze ist, kann als Heilmittel eingesetztwerden. Die Pflanzenschamanen sagen, daß jede Pflanze ihre besondere »Power« hat. Der westliche Phytotherapeut würde sagen, jede Pflanze kann unter Umständen eine mindere oder größere Verschiebung des innerkörperlichen, ökologischen Gleichgewichts bewirken. Die Kunst des Heilers besteht darin, die möglichen Wirkungen genau zu kennen.
Die Frage, warum Pflanzen diese Fähigkeit besitzen, uns heil zu machen, ist eigentlich eine Frage nach dem Wesen der Pflanzen, und der Frage: »Was sind Pflanzen?« wollen wir hier nachgehen.
Daß sie keineswegs die intelligenzlosen, dumpf-vegetativen, protoplasmischen Gebilde sind, die einem in den meisten Botanikbüchern entgegentreten, sollte klar sein. Auch wenn man in der Biaskopie keine eindeutigen Nervengewebe findet, die auf ein bewußtes Innenleben, auf Sinne und Gefühle schließen lassen, verhalten sich Pflanzen recht intelligent ihrer Umwelt gegenüber. Es ist, als ob ein organisierender Geist in ihnen tätig wäre.
Wer oder was ist es also, das den Gewächsen ihre harmonischen, geometrischen Formen verleiht? Wer bestimmt ihre Biorhythmen und steuert ihre immer komplexer erscheinende Kybernetik? Was veranlaßt sie, Mineralien und Spurenelemente in genaustens dosierten Mengen zu selektieren und zu verschiedenartigsten Molekularverbindungen zu synthetisieren?
Sir David Attenborough, dessen BBC-Serie über die Wunder der Vegetation vor kurzem europaweit über die Bildschirme lief, läßt keinen Zweifel am intelligenten Verhalten der Vegetation:
Pflanzen können sehen. Sie können zählen und miteinander kommunizieren. Sie haben die Fähigkeit, auf die leichteste Berührung zu reagieren und die Zeit mit geradezu unglaublicher Präzision zu registrieren... Der Hauptgrund, warum wir diese Fähigkeit nicht wahrnehmen ist, daß Pflanzen sich größtenteils in einer anderen Zeitdimension bewegen als wir.
Der britische Naturforscher gründet seine Aussage auf die Ergebnisse neuster botanischer Forschung und Zeitraffer beobachtungen.
Materialistische Wissenschaftler tun sich schwer, diese Intelligenz zu erklären und den Steuerungsmechanismus zu orten. Weil sie nicht wagen, den vermeintlich festen Boden ihres empirisch-materiellen Weltbildes zu verlassen, suchen sie krampfhaft in mikroskopischen Bereichen, in der DNS und RNS der pflanzlichen Zellkerne, nach des Rätsels Lösung. Dabei verlieren sie sich hoffnungslos in immer kleineren Details. Max Scheler, ein populärer Philosoph der zwanziger Jahre, kommt einem Verständnis schon näher. Er postuliert einen in der Vegetation enthaltenen »ekstatischen Gefühlsdrang«, um dem nicht auffindbaren Bewußtseinszentrum beizukommen. (Scheler 1935) Die Formulierung »ekstatisch« (das griechische Wort Ekstasis bedeutet »aus sich heraustreten«) gibt uns einen brauchbaren Schlüssel. Schelers Anregung folgend könnte man hypothetisch sagen, daß sich der steuernde Geist der Pflanze nicht – wie es bei uns Menschen der Fall ist – vollständig in der Physis inkarniert. Er ist »aus sich herausgetreten«. Der Pflanzengeist bewegt sich außerhalb seines Leibes. Ähnliches deutete auch schon der große Pflanzenliebhaber Johann Wolfgang von Goethe an. Er sprach von der Pflanze als »sinnliches-übersinnliches Wesen«. Nur ein Teil unserer grünen Erdmitbewohner, und zwar der materiell-sinnliche Aspekt, ist der wissenschaftlichen Analyse zugänglich. Der übersinnliche Aspekt – den wir traditionsgemäß Geist und Seele nennen würden – ist nur dem geistigen Auge zugänglich. Es ist dieser Aspekt, dem sich die Schamanen, Medizinleute und Heiler zuwenden.
Überall auf der Welt sprechen diese Grenzgänger mit den »außerhalb stehenden« Pflanzengeistern, Pflanzenseelen und Devas. Um das zu tun, begeben sich die Schamanen selbst in einen »ekstatischen Zustand«. Sie sprengen die Grenzen ihres alltäglichen Egos und begeben sich in Trance oder Tiefenmeditation. Auf diese Weise »fliegen« sie in andere Dimensionen, in denen sie dann den Pflanzenpersönlichkeiten begegnen. (Storl 1997) Dort im »Jenseits«, im »Land der Geister«, in den »Sphären der Harmonie« – wie immer auch man diesen trans-empirischen Zustand nennen möchte – begegnen die Schamanen ihren Verbündeten aus dem grünen Volk. Dabei werden ihnen wertvolle Erkenntnisse zuteil, etwa die Anwendung der Pflanze als Heil-, Zauber- oder Nahrungsmittel. So, und nicht etwa durch stupide Trial and Error-Forschung, durch mühselige Experimente oder gar brutale Tierversuche, wurden die medizinischen Eigenschaften fast aller Heilpflanzen entdeckt. (Storl 1993:19)
Die makrokosmische Offenheit der Pflanzen
Fragt man den normalen Menschen, wo sein »Ich«, sein Wesenskern zu finden ist und wo seine Gefühle lokalisiert sind, dann deutet er wahrscheinlich mit dem Zeigefinger auf die Brust.
Ganz anders die Pflanzen. Wenn man das Gänseblümchen oder das Tannenbäumchen fragen könnte, wo sein »Ich« zu finden, wo seine Seele zu Hause ist, würde es sicherlich hinauf zur Sonne oder zum Sternenhimmel zeigen und gleichzeitig hinab zum Erdboden. Denn – wir werden das gleich näher betrachten – die Vegetation empfängt ihre organisierenden und bewegenden Impulse nicht von einem Inneren aus, sondern vornehmlich aus den fernsten Bereichen unserer sinnlich wahrnehmbaren Welt.
Anders ausgedrückt: Als Menschen sind wir in uns abgeschlossene, geistig-seelisch vollständig inkarnierte Mikrokosmen. Die Pflanzen dagegen bleiben makrokosmisch offen. Sie grenzen sich nicht ab, sie führen kein individualisiertes Innenleben. Wir erleben den Christus oder den Buddha als Archetypus des Menschenwesens im Herzen, in unserem Zentrum. Die Pflanzen, als makrokosmische Wesen, empfinden, daß ihnen ihr Archetypus von den fernen Sternen zustrahlt. Diese Erkenntnis wurde in verschiedenen Kulturen, in der Alten wie in der Neuen Welt, in den Veden ebenso wie bei Platon, in einer bildhaften Imagination veranschaulicht: Die Urpflanze, der Urbaum, läßt sich als ein umgestülptes, von innen nach außen gekehrtes Menschenwesen begreifen. Mensch und Pflanze sind demnach wesensverwandt, sind Modulationen der ungebrochenen Einheit, hier mikrokosmisch »eingefaltet«, da makrokosmisch ausgeweitet. (Storl 1992:137) Zwischen beiden Modi findet ein reger Austausch statt.
Stirbt der Mensch, so wird auch er makrokosmisch; sein Geist weitet sich über die Sphären aus, sein Körper geht an die Erde zurück. Auch der Schamane weitet seinen Geist aus, und dabei können ihm die Pflanzen- und Elementarwesen ebenso begegnen wie die Totengeister. Im Gegensatz zum Verstorbenen bleibt er aber nicht da »draußen«; er findet wieder in den Leib, in den Mikrokosmos zurück.
Nimmt der Mensch eine Pflanze als Nahrung zu sich, dann wird die Pflanze mikrokosmisch. Die ätherische Lebensenergie der verspeisten Pflanze regt nicht nur den Leib an, ihre geistigen und seelischen Aspekte melden sich auch in den Gedanken, Vorstellungen und Gefühlen des Essers. Das macht sich besonders bei den Drogen, etwa Kaffee, Tee oder Opium bemerkbar, ist aber bei allen Pflanzen, auch bei Roggen und Kartoffeln, der Fall. Schamanen sind sich dessen ebenso bewußt wie die indischen Sadhus. Sie steuern ihr Bewußtsein und ihren Seinsmodus, indem sie darauf achten, was sie als Speise in ihren Mikrokosmos aufnehmen.
Diese kühne Vision von der Pflanze als einem Lebewesen, das sowohl dem Himmel als auch der Erde gegenüber offen ist, wurde vielfach im Bild einer Pflanzengöttin dargestellt, die im Lichthimmel und gleichzeitig tief unter der Erde wohnt. Man denke etwa an die antike Persephone/Proserpina: Sie ist Herrin der Toten und Hüterin der Samen in der Unterwelt und gleichzeitig strahlende olympische Göttin. Auch Frau Holle, die alle gestorbenen Lebewesen (Menschen ebenso wie Pflanzen und Tiere) im Schoß der Erde empfängt und sie wieder ins Dasein entläßt, ist gleichzeitig eine Himmelsgöttin. Wenn sie ihre Federbetten ausschüttelt, schneit es auf Erden. Die germanischen Bauern glaubten, daß dieser Schnee die Pflanzen mit Wachstum segne und eine gute Ernte ankünde. Auch die Indianer und andere Völker kennen diese Göttin, die Herrin der Vegetation.
Schon auf der embryonalen Ebene offenbart sich dieses völlige Nach-außen-gerichtet-Sein der Vegetation. Nach der Befruchtung entwickelt sich das Ovum durch wiederholte Zellteilung (Mitose) zum Blasenkeim (Blastula), einer winzigen runden Keimzellkugel. Beim tierischen (menschlichen) Embryo kommt es alsbald zu einer Einstülpung dieses Zellenballes. Es formt sich der sogenannte Becherkeim (Gastrula), der dem Äußeren einen inneren Hohlraum entgegenstellt. Dieser Hohlraum ist der Urdarm, der Entoderm, in dem sich dann ansatzweise die Lunge, Harnorgane, Drüsen und andere innere Organe entwickeln. Der äußere Keimlappen, der Ektoderm, wird später zur Haut, zu den Sinneszellen, zu Nerven, Zähnen und Augen. Bald darauf entwickelt sich zwischen Endo- und Ektoderm der Mesoderm. Aus diesem mittleren Keimblatt des embryonalen Gewebes entwickeln sich die Innenhäute von Brusthöhle, Bauchhöhle und Herzbeutel sowie das Skelett.
Beim Pflanzenembryo verläuft diese Entwicklung anders. Es kommt zu keiner Einstülpung (Gastrulation), zu keiner, auch nur ansatzweisen, Bildung von inneren Organen. Obwohl sie ständig wächst und metamorphosierend verschiedene Stadien durchläuft, bleibt die Pflanze eigentlich eine, wenn auch hochdifferenzierte, Blastula. Sie empfängt ihre Impulse nicht von einem inneren Organkosmos und einem zentralen Nervensystem, welche bei Mensch und Tier die physische Grundlage geistiger und seelischer Regungen bilden, sondern von außen, aus der mittelbaren und unmittelbaren Umwelt.
Nur in der Blüte macht die höhere Pflanze den Ansatz, innere Hohlorgane zu bilden und eine Art Gastrulation nachzuvollziehen. Nur hier wird sie tierähnlich, seelenhaft. Nur in der Blüte entwickelt sie – wir werden später näher darauf eingehen – meßbare Eigenwärme, Eigenbewegung und produziert Molekularverbindungen, die sonst nur dem animalischen Stoffwechsel eigen sind. Aber dieser zaghafte Ansatz einer Beseelung, diese vorübergehende Berührung mit dem tierischen Seinsmodus, ist nur von kurzer Dauer. Bald verblüht sie und fällt, indem sie Samen erzeugt, wieder in die rein vegetabile Daseinssphäre zurück. (Scheffer/Storl 2012)
Nicht die Impulse innerer Organe, sondern Kräftewirkungen, die von den Erdtiefen, vom Boden, der Atmosphäre, der Sonne, den Planeten und den Fixsternen ausgehen, sind die Parameter, welche die Pflanze auf wahrhaft »intelligente« Weise nach bestimmten geometrischen Mustern und zeitlichen Rhythmen keimen, wachsen, blühen und fruchten lassen. Diese Faktoren, die Lebenskräfte des Bodens und die Rhythmen der Planeten, bilden – das wußten schon die alten Alchimisten – die »Organe« der pflanzlichen Organismen. Diese Vektoren, kurz Himmel und Erde genannt, wollen wir nun näher betrachten.
Erdkräfte und Rhizosphäre

Eine klare Trennung zwischen der Pflanze und dem lebendigen Boden, in dem sie wurzelt, ist fast unmöglich. Sie öffnet sich dem Untergrund gegenüber und verschmilzt mit ihm. Die höheren Pflanzen bestehen bis zu fast Dreiviertel aus Wurzelmasse. Einige Arten wurzeln sehr tief: Alfalfa bis zu 10 Meter, die Tamarisken in den Sandwüsten des Nahen Ostens bis zu 50 Meter.
Rege Lebendigkeit charakterisiert den unterirdischen Teil der Vegetation. Die Wurzeln einer einzigen Roggenpflanze wachsen, wenn man die ständig absterbenden und sich neu bildenden, winzigen Wurzelhärchen linear zu sammenaddiert, um die 90 Kilometer pro Tag. Das summiert sich, in der sommerlichen Hauptwachstumsperiode, auf über 10.000 Kilometer (Huxley 1974:44). Diese Angaben scheinen übertrieben, und ich würde ihnen keinen Zoll Glauben schenken, hätte ich sie nicht des öfteren in renommierten botanischen Werken wiedergefunden.
Die Wurzeln und feinen Wurzelhärchen wachsen tastend durch den Boden. Als besäßen sie eine Art übersinnliche Wahrnehmung, spüren sie den Mineralien, Spurenelementen und Wasserquellen nach und nehmen sie sorgfältig selektierend auf.
Eigentlich kann man kaum sagen, wo im Erdboden eine Pflanze aufhört und eine andere beginnt. Es kommt zu Wurzelverwachsungen (Symphysen) mit anderen Pflanzen der gleichen Art oder sogar mit anderen Arten, wie etwa unter Birken, Ahorn und Ulmen. (Schad 1987:85) Auf diese Weise werden »Informationen« in Form chemischer Botenstoffe (Pheromone, Ektohormone) weitergeleitet. So »wissen« benachbarte Tannen, wenn ein Baum von Borkenkäfern befallen ist und stellen ihren Stoffwechsel entsprechend um. Auch werden auf diesem Weg seltene Elemente, etwa Phosphat, an benachbarte Pflanzen weiter gereicht. Das wurde in Versuchen mit radioaktiven Isotopen nachgewiesen.
Noch eindrucksvoller ist die Tatsache, daß nahezu 90 Prozent der höheren Pflanzen in Symbiose mit Pilzen leben. Die schirm-, kugel- oder hutarigen Gebilde, die im Herbst nach einem Regen aus den Boden schießen, die Egerlinge, Fliegenpilze und Boviste, sind nur die Fortpflanzungsorgane der Pilze. Die eigentlichen Pilze bestehen aus einem amorphen Gewebe feinster, weißer Fäden (Hyphen, Myzelen), das sich über viele Kilometer hinweg teppichartig im Boden vernetzt. Nach Ansicht vieler Biologen sind diese Moderbewohner gar keine richtigen Pflanzen, sondern bilden ein Naturreich für sich. Diese Hyphen verquicken sich mit den feinen Wurzelhärchen der höheren, grünen Pflanzen. Sie wachsen regelrecht in die Wurzelzellen hinein und lassen ihnen Wasser, gelöste Mineralien, Vitamine und Wachstumshormone (Auxine) zukommen. Durch diese Verbindung vergrößert sich die aufnehmende und abgebende Kontaktfläche der grünen Pflanze um ein Tausendfaches. Ohne diese Wurzelpilze, auch Mykorrhiza genannt, gäbe es keine Wälder und Wiesen. Ja, es gäbe kaum grüne Vegetation auf der Erde, denn erst die Symbiose mit den Mykorrhizen machte es möglich, daß die ersten Pflanzen, die Abkömmlinge der Meeresalgen, vor 350 Millionen Jahren, im Devon, das feste Land besiedeln konnten.
Die grünen Pflanzen entgelten es den Pilzen mit der Zufuhr von Zucker. Die Pilze sind geradezu süchtig nach dem süßen Stoff: Glukose ist durch Photosynthese verwandelte Sonnenkraft. Nur so können die lichtscheuen Pilzwesen die Sonne vertragen.
Die mykorrhizale Vernetzung über viele Hunderte von Quadratkilometern verbindet Bäume, Gräser, Kräuter und Sträucher mit dem ständigen Fluß von chemischen und energetischen Signalen und Informationen, der das Biotop eines Waldes, einer Wiese oder eines Feldes koordiniert und sinnvoll reguliert. Der Ethnobotaniker und Pilzexperte Terence McKenna spricht diesbezüglich von einer »vegetabilen Intelligenz«. Er vergleicht den Waldboden in seiner kybernetischen Komplexität mit unserem Gehirn. Die weißen Mykorrhizen, die den Boden durchziehen, erinnern schon im Aussehen an Nervengewebe. Unser Gehirn besteht aus rund 10 Milliarden Zellen, und jede Zelle hat Verbindung zu circa 25.000 anderen Zellen. Die möglichen Verbindungen gehen ins Astronomische. Ähnlich der durchpilzte Boden des gesunden Ökotops: Wir haben es da mit einem makrokosmischen »Nervensystem« zu tun.
Terence McKenna macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, daß viele Pilze (Kahlköpfe, Fliegenpilze u. a.) hauptsächlich auf das Nervensystem wirken, wenn man sie ißt oder raucht. Nach dem Prinzip »Gleiches wirkt auf Gleiches« verändern oder erweitern sie das Wahrnehmungsvermögen und Bewußtsein des menschlichen Mikrokosmos. Pilze, so glaubt er, waren die Katalysatoren der menschlichen Intelligenzentwicklung. Frühmenschen (Australopithecinen), die den Wiederkäuerherden nach pirschten, haben sicherlich von den Pilzen, die auf dem Dung dieser Herdentiere wachsen, gekostet. Geringe Dosen schärfen die Sinne für Jäger durchaus ein Überlebensvorteil; höhere Dosierungen regen sexuell an, führen zu erhöhter Koitusbereitschaft und vermehrter Fruchtbarkeit – wiederum eine survival advantage; bei noch höheren Dosierungen kommt es zu Visionen – das führte zu Religion und zu einem von Symbolen getragenen kulturellen Verhalten. Diese Hypothese mag überzogen sein, aber sie enthält möglicherweise ein Körnchen Wahrheit. (McKenna 1992)
In diesem Zusammenhang ist interessant, daß Rudolf Steiner den Erdboden samt seiner Pilzwelt als »Sinnes Nervenpol« des archetypischen Pflanzenwesens beschreibt. Das Wurzelwerk und der lebendige Boden sind also der »Kopf« der Pflanzen. Die Atmosphäre unter dem Einfluß der erdnahen Planeten (Mond, Merkur, Venus) bilden das »rhythmische System« (Atmung, Kreislauf) der Pflanzen. Die Sonne, die den Pflanzen ihren Lebenspuls gibt, ist das Herz. Die Kräfte der erdfernen Planeten (Mars, Jupiter, Saturn) kommen vor allem im »Sexual- und Fortpflanzungsleben« der Pflanzen zum Ausdruck. In diesem Sinne ist die Pflanze dreigegliedert, genau wie ein Mensch. Die Pflanze ist ein umgekehrter, makrokosmischer »Mensch«.
Dieses recht kühne Bild ist eigentlich nichts Neues. Schon Aristoteles erkannte, daß Pflanzen mit dem »Kopf« im Boden verankert sind und ihre Extremitäten und Fortpflanzungsorgane in die Luft strecken. Auch die alten Alchimisten sahen in den Planeten die makrokosmischen »Organe« der Pflanzen. Und in der volkstümlichen Kräuterkunde spielen die planetarischen »Signaturen« noch immer eine große Rolle. Doch schauen wir uns dieses makrokosmische »Sinnes-Nervensystem« der Pflanzen zunächst etwas näher an.
Nach Steiner ernähren sich die Nerven »parasitärisch«. Sie verbrauchen die im Stoffwechsel, in der Verdauung erzeugte Energie. Die Bewußtseinsaktivität des Kopfes wirkt »abbauend«, kräftezehrend. Das gleiche kann man auch von den Pilzen sagen. Als Saprophyten bauen sie die Energie wieder ab, die die grüne Pflanze durch die Photosynthese gewonnen hat. (Pelikan II 1977:15)
Nicht nur Wurzeln und Pilze bilden den lebendigen Humusboden, den »Kopf« des Pflanzenwesens. Dazu gehören auch unzählige atmende, assimilierende, stoffwechselnde, ausscheidende, sich vermehrende und sterbende Bakterien, Fadenwürmer, Regenwürmer, Aktynomyzeten, Algen und andere Organismen, deren Gewicht pro Hektar einer Herde von 25 Kühen entspricht. Eine Tasse Erde enthält zahlenmäßig mehr dieser Organismen, als es Menschen auf der Erde gibt. Dieses unaufhörliche Gären und Brodeln ist den wechselnden makrokosmischen Einflüssen und Zyklen unterworfen, den Tag/Nacht-, Sonnen-, Mond- und Planetenrhythmen sowie den damit verbundenen Wasser- und Luftkreisläufen, dem Wetter und dem Klima. Das alles nimmt die Pflanze mittels ihrer »nervlichen Sensoren«, den Mykorrhizen und den sensiblen, tastenden Würzelchen wahr.
Himmel und Phyllosphäre
Ebensowenig wie sich die Pflanze nach unten hin abkapselt, verschließt sie sich nach oben. Das grüne Blatt – Goethe nennt es das Urorgan des Pflanzlichen – gibt sich ganz dem Licht des Himmels hin. Das Pflanzengrün ist höchst photosensibel. Die Chloroplasten ähneln den Stäbchen der Netzhaut, und die Breite der Wellenlängen (zwischen 300 und 800 Nanometer), die das Blatt absorbiert, deckt sich mit der des menschlichen Auges. Zu Recht hat der Botaniker G. Grohmann die grüne Vegetation als das »Lichtsinnesorgan der Erde« bezeichnet, denn die Pflanzen registrieren und reagieren auf jede extraterrestrische Lichtquelle, auf Sonnen- und Mondschein sowie auf das Leuchten und Funkeln der Planeten und Sterne (Grohmann 1962). Wir sehen diese zwar als gewöhnliche Lichtstrahlen, aber in Wirklichkeit sind sie Energieströme, die ordnend und energetisierend auf die chaotische, amorphe Erdenmaterie einwirken. Das grüne Blatt ist also ein auf den Kosmos gerichteter Empfänger dieser einstrahlenden Gestaltungskräfte.
Was wir Menschen mit unseren Augen aufnehmen, setzen wir in innere Bilder und Gedankenmuster um. Die Pflanze hingegen übersetzt das von ihr »Gesehene« nicht in innere, subjektive Formen und Gedanken (sie hat ja kein Innenleben wie mikrokosmische Geschöpfe), sondern vielmehr in geometrische Blüten- und Blattmuster, in feine ätherische Ole, Düfte, Farben und Wachstumsbewegungen. Die Fähigkeit, »leblose« Elemente – Wasser, Luft und Mineralien – zu beleben und auf ein höheres Schwingungsniveau zu bringen, diese verlebendigende Kraft, gehört auch mit zu dem, was die Pflanzenwelt aus dem Kosmos empfängt.
Dadurch, daß die Pflanzen keine in sich abgekapselten, egozentrischen Mikrokosmen sind, sondern sich bedingungslos dem Makrokosmos gegenüber öffnen, werden sie zu reinen Spiegeln der göttlichen Harmonien. Sie vermitteln die Gedanken der Götter, jede Pflanzenart auf ihre Art. So ist es zu verstehen, daß die indischen Seher, die Rishis, von den Pflanzengeistern als Devas, als »himmlische, leuchtende göttliche Wesenheiten« sprachen.
Die Devas der verschiedenen Pflanzenarten sind Archetypen. Sie »überstrahlen« die irdischen Gewächse und geben ihnen ihren Lebensrhythmus, ihre physiologischen, chemischen und morphischen Eigenschaften. Fromme mittelalterliche Gelehrte identifizierten die Geister der jeweiligen Pflanzenart als Lichtengel der Zweiten Hierarchie. Die irdischen Gewächse sind lediglich die Abbilder, die Schatten, die lebendigen, materialisierten Gedanken dieser Engel.
Es sind vor allem diese Pflanzengeister, an die sich Schamanen und Heiler wenden, wenn sie Kräuter und Wurzeln zum Heilen einsetzen wollen. Immer wieder bekommen verblüffte Völkerkundler zu hören: »Wir machen keine blinden Experimente; es sind die Pflanzen selbst, die uns sagen, welche Kräfte sie haben und wie man mit ihnen heilt.« Diese Kommunikation zwischen Mensch und Pflanzendeva erklärtauch, warum Völker, die in verschiedenen Erdteilen leben und nie Kontakt miteinander hatten, dieselben Heilpflanzen ganz ähnlich anwenden.
Die Pflanzengeister sprechen mit dem sich in Trance oder in tiefer Meditation befindlichen Schamanen. »Nicht wir, sondern die Pflanzengeister bestimmen das Ritual und das Medizinlied, das dem Medizinmann erlaubt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen«, belehrte mich ein alter Tsistsitas-Pflanzenschamane.
Eine große Zahl von feierlichen Sprüchen und Liedern, die diese Verbindung zu den Devas herstellen, ist aus allen Kulturkreisen überliefert. Der Ojibwa-Medizinmann oder die Medizinfrau sprachen, nachdem sie das gehörige Tabakopfer gebracht hatten, die Pflanze, deren Wurzel sie aushoben, mit folgenden Worten an (Johnston 1992:108):
Deine Faser ist weich,
Deine Säfte sind reich;
Laß uns die Schwachen
Wohl und stark machen.
Für jede Pflanze gab es beim Pflücken Gebete und Lieder wie die folgenden:
Dein Geist
Mein Geist,
Mögen sie sich vereinigen und
Einen Geist des Heilens bilden.
Du hast Schönheit geschenkt,
Jetzt schenke Gesundheit!
Aufwendige Anrufungen der Pflanzen werden im altindischen Atharva Veda überliefert. Ihre Kräfte und ihre Schönheit werden besungen, und weil sie so stark sind, werden sie gebeten, den armen, leidenden Menschen zu helfen.
Wir rufen braune, weiße, gesprenkelte, farbige und schwarze Pflanzen an; sie sollen diesen Menschen vor Krankheiten schützen, die von Göttern ausgesandt werden. Ihr Vater ist der Himmel, ihre Mutter die Erde, Wurzel und Ozean. Himmlische Pflanzen vertreiben sündhafte Krankheiten ...
Mit eurer Macht, ihr Mächtigen, mit der Macht und Kraft, die ihr besitzt, damit möget ihr Pflanzen diesen Menschen von seiner Krankheit erretten. Ich stelle nun das Heilmittel her.
...
Die weisen Pflanzen mögen hier erscheinen. Sie verstehen, wovon ich spreche, und wir können gemeinsam diesem Menschen seine Gesundheit wiedergeben.
Sie sind die Güte des Feuers, die Kinder des Wassers, sie wachsen und wachsen wieder nach, starke heilende Pflanzen mit tausend Namen, die alle hier zusammengetragen sind ...
Solche Beschwörungen sind auch unserem Kulturkreis nicht fremd. Zwei Beispiele, eines aus dem Heidentum und eines aus dem christlichen Mittelalter, sollen uns hier genügen.
Erinnere dich, Maythe (Kamille), was du verkündetest,
Was du vollendetest in Alorford:
Daß nimmermehr ein Mensch durch Ansteckung sein
Leben verlor,
Seit man ihm Kamillen zu essen gab.
(Angelsächsischer Neunkräutersegen)

Eberwurz, ich sprech dich an,
Bist du Frau oder Mann.
Behalte deine Kraft und Saft,
Wie die Liebe Frau (Maria)
ihre Jungfernschaft.
Das grüne Blattwerk ist nicht nur das Auge der Pflanze, es fungiert auch als makrokosmische Lunge, wo ein ständiger Austausch mit der unmittelbaren Atmosphäre stattfindet. Riesige Mengen Wasserdampf werden über das Laub verdunstet, steigen zu den Wolken empor und regnen wieder auf die Erde herab, wo sie erneut von den Wurzeln der Pflanzen aufgesogen werden. Eine Birke verdunstet täglich 60 bis 70 Liter Wasser, an heißen Tagen sogar bis zu 400 Liter. (Hensel 1993:255) Ein ähnlicher Kreislauf findet mit anderen Gasen statt. Mit Recht kann man sagen, daß die Pflanzenwelt – die Wälder Sibiriens und des Amazonas, ebenso wie die Algenwälder der Meere – Gaias Lunge ist. Die Vegetation nimmt die riesigen Mengen Kohlendioxid (CO2) auf, die die abbauenden Organismen, die Tiere und Pilze, ständig ausatmen. Daraus bauen sich die Pflanzen mit Hilfe der Sonnenenergie ihre Leiber auf, konstruieren das »Kohlenstoffskelett«, das ihren materiellen Leib ausmacht. Bei diesem Aufbauprozeß geben sie ständig Sauerstoff (O2) ab, den Stoff, von dem unser Leben abhängt.
Auch in diesem Punkt ist die Pflanze ein umgekehrtes Spiegelbild des menschlichen beziehungsweise tierischen Organismus. Was das grüne Blatt als Abfall oder Überschuß ausstößt, saugt das rote Blut begierig auf. Schon auf der molekularen Ebene sind das grüne Chlorophyll und der rote Blutstoff (das Hämoglobin) Spiegelbilder. Beide haben haargenau dieselbe molekulare Struktur. Nur befindet sich in der Mitte der vier Pyrrolringe des Chlorophylls ein Magnesiumatom, während in der Mitte des Hämoglobins ein Eisenatom zu finden ist. Hätte die Pflanze Eisen an dieser Stelle, wäre ihr Saft rot, und sie wäre auf dem besten Weg, ein Mikrokosmos zu werden.
Mit dem Eisen hat es seine Bewandtnis. Der Bauernphilosoph Arthur Hermes formulierte es einmal so: »Eisen zieht unser Ich in den Körper hinein und läßt uns als geistige Wesen voll inkarnieren. Das ist bei uns Menschen ebenso der Fall wie bei unserer Mutter Erde. Ein Eisenkern gliedert ihren Leib in zwei magnetische Pole und durchzieht ihn mit jenen Kraftlinien, die der Kompaß registrieren kann. Damit vergleichbar gibt uns das Eisen im Blut einen Bezug zu den Gesetzen des materiellen Raums und ermöglicht unsere irdische, karmische Betätigung. Ohne Eisen könnte das höhere Selbst gar nicht innerhalb der materiellen Dimensionen agieren!« (Storl 1996:24) Aber genau das wollen die Pflanzendevas nicht, es steht ihnen nicht zu, sich voll zu inkarnieren, sie bleiben offen dem Makrokosmos zugewandt.
Das grüne Chlorophyll fängt die aus dem Kosmos einströmenden Lichtquanten auf und erlangt dadurch einen derart energetisierten Zustand, daß es die Kraft hat, Wassermoleküle (H2O) zu spalten, damit Sauerstoff (O2) in die Atmosphäre gelangt. In einer zweiten Reaktion, ebenfalls im grünen Blatt, wird unter Einbindung des verbliebenen Wasserstoffs (H) das Kohlendioxid (CO2) zu Zucker (C6H12O6) synthetisiert. Dieser Zucker, der aus Lichtenergie, Wasser und Kohlenstoff hervorgeht, ist die Grundlage für die Ernährung aller Lebewesen. Durch diese Photosynthese werden auf diesem Planeten jährlich 100 bis 200 Milliarden Tonnen organischer Materie aufgebaut.
In dieser Photosynthese, von reduktionistischen Wissenschaftlern als rein materielles Geschehen aufgefaßt, sahen die alten Inder ein göttliches Drama. In den verschiedenen Seinsformen erkannten die Weisen der Upanischaden Stationen zur Aufnahme und Weitergabe von Energien (Prana). »Brahman – der göttliche Urgrund – ist Nahrung. Nur jene, die wissen, daß sie Gott essen, essen wirklich.« (Taittireya Upanishad). Jedes Wesen existiert, um ernährt zu werden und um andere zu ernähren. Pflanzen »verspeisen« kosmische und stellare Energien. Mit ihren Blättern saugen sie die im einströmenden Licht verborgenen Lebenskräfte auf und geben sie an andere Geschöpfe weiter. In den Veden werden Pflanzen als Aushadhi bezeichnet; weitläufig übersetzt bedeutet das »Gefäße der brennenden Umwandlung«. (Lad/Frawley 1988:22) Demzufolge sind Pflanzen Gefäße für die Metamorphose des kosmischen Feuers. Dieses Feuer, die Liebesstrahlung der Götter, wird durch die Alchimie des Blattgrüns in Nahrung für menschliche und tierische Mikrokosmen umgewandelt. So wird die äußere kosmische Wärme zur Seelenwärme, das Sonnen- und Sternenlicht zum inneren Licht des Bewußtseins. Auf diese Weise erklärt man im Ayurveda die Wirkung der Heilkräuter: Die jeweilige Heilpflanze bündelt und vermittelt einen ganz besonderen Aspekt des göttlichen Lichtes. Sie läßt dem Kranken die harmonisierende Kraft ihres Devas zukommen. Es ist beispielsweise die Göttin Saraswati selbst, die verjüngend und intelligenzfördernd im Wassernabelkraut (Hydrocotyl asiatica) wirkt. (Storl 1995:267) Im Adlerbaum (Aquilaria malaccensis), aus dessen Holz Räucherduft gewonnen wird so wie ein Öl, mit dem sich Wandermönche einreiben, ist der Göttervogel Garuda anwesend und verleiht dem Suchenden geistige Schwingen. Im indischen Hanf ist es Shiva selbst, der dem Geläuterten die Wahrheit offenbart, den Unreinen aber in den Wahnsinn treibt. Und im allesheilenden Basilikum (Tulsi, Ocumum sanctum) offenbart sich Vishnu, der Erhalter der Schöpfung.
Ähnliches gibt es auch in anderen Kulturen. Im alten Griechenland tat sich der Sonnengott Apollo vor allem im Lorbeer und im Bilsenkraut kund, Zeus im Eisenkraut, Aphrodite in der Myrthe, Athene im Olivenbaum und Artemis im Beifuß. In Ägypten offenbarte sich Osiris im Majoran, Isis im Beifuß, Horus im Andorn und Ra, der Sonnengott, vor allem im Weihrauch und in der Myrrhe.
Mit anderen Worten, Pflanzen sind Vermittler. Sie vermitteln die Kräfte und Gaben der Götter und des Himmels genauso wie die der Erde. Durch die Pflanzen gelangen die Energien des Makrokosmos in uns und werden mikrokosmisch. Mittels Pflanzen – sei es durch die meditative Betrachtung, durch das Einatmen ihrer Düfte oder durch das Essen ihrer Substanz – nehmen Götter Kontakt mit uns auf. Wir essen die Götter, wir atmen sie ein, ganz im Sinne der oben zitierten Upanischade. In uns werden sie mikrokosmisch. In uns erneuern sie sich, geben uns Inspirationen, Einsichten, Lebenskraft – kurz, sie machen uns zu dem, was wir sind.
Rhythmen (Ritam)
Die Weisen und Priester der alten Kulturen beobachteten genaustens die zyklischen Bewegungen der Sterne und Planeten. In ungestörter Mediation, oft auf einsamen Bergen oder auf künstlich errichteten Erhöhungen (Stufenpyramiden, Zikkurats, Mounds), vernahmen sie die göttliche Ordnung, nach der es sich lohnte zu leben. Rita nannten die vedischen Inder diese Ordnung, und als Ritu bezeichneten sie die vom Kosmos vorgezeichneten Jahreszeiten, in denen den Göttern feierliche Opfer gebracht wurden. Auch wir kannten den Ritus, die Rituale, die dem harmonischen Fluß der Jahreszeiten, dem kosmischen Rhythmus, angepaßt sind und der Gemeinschaft Heil und Segen angedeihen lassen. Verachten oder vernachlässigen die Menschen, sei es nun das Individuum oder die Gemeinschaft als ganzes, das göttliche Rita, dann nehmen Chaos, Krankheit und Zerstörung überhand.
Die Pflanzen als Ausdruck der Devas verlassen das Rita nie. Sie spiegeln in ihren vielfältigen Rhythmen den Reigen der Gestirne wider. Ohne Bezug zur Sonne zum Mond und zu den Planeten kann man sich weder die einzelne Pflanze noch die Vegetation als ganzes vorstellen. Zwar spricht die orthodoxe Wissenschaft lieber von »im Erbgut verankerten, endogenen Verhaltensmustern« und ignoriert die Übereinstimmungen zwischen den Rhythmen der Himmelskörper und den Periodizitäten im Pflanzenleben, aber das ist nur so, weil die gängige experimentelle Methode in diesen Bereichen versagt. Die inzwischen klassischen Studien Frank Browns (Northwestern University, Chicago) belegen ohne Zweifel, daß sogar die schrumpelige Kartoffel im Keller die genaue Tages- und Jahreszeit sowie den Stand der Sonne und des Mondes »kennt« und auf diese mit Wachstums- und Stoffwechselschwankungen reagiert. (Brown 1970)
Der tägliche Rhythmus der Pflanze, der Wechsel von Assimilation und Dissimilation, Nachtstellung und Tagstellung der Blätter, Stoffwechselhöhepunkten und vielem mehr ist eindeutig mit der Sonne verbunden. Die Sonne ist das makrokosmische Herz, das den Pflanzen ihren Pulsschlag gibt. Verschiedene Zeiten des Keimens und Blühens (Langtagpflanzen, Kurztagpflanzen usw.), des Öffnens und Schließens der Blütenknospen – so exakt, daß sich Linnaeus eine »Blütenuhr« in den Garten pflanzen konnte, an der er bis auf eine Viertelstunde genau die Tageszeit ablesen konnte – und andere Periodizitäten lassen uns erkennen, daß sich jede Art anders auf Stand und Einstrahlungswinkel, auf Tageszeit und Position der Sonne im Tierkreis einstellt.
Einen größeren Rhythmus ergibt der jährliche Wandel der Sonne durch den Kreis des Zodiak. Das annuelle Werden und Vergehen der Pflanzendecke ist ganz im Einklang mit dem Wandel der Sonne durch die niederen und höheren Tierkreisregionen. Im Winter, wenn die Sonne im Schützen steht und die Tage kurz sind, ruhen die Pflanzen, als Samen oder Knospen fest in sich zusammengeballt, im Schutze des mütterlichen Erdbodens. Wenn zur Tag/Nachtgleiche eine erstarkende Sonne die Tierkreisregion der Fische durchläuft, erstarkt auch die Vegetation. Zur Mittsommerzeit, wenn die Sonne in den Zwillingen ihren Höhepunkt überschreitet, blüht und gedeiht die Pflanzenwelt in üppiger Fülle. Im Herbst, wenn die Tage kürzer und kühler werden und die Sonne durch die Jungfrau zieht, gilbt und welkt das Grün dahin; die Pflanzen versamen und bereiten sich erneut auf den Winter vor.
Das Zusammenspiel der Sonne und der Vegetation ist uns allen bekannt. Wer aber ist sich dessen bewußt, daß dieser Rhythmus auch unsere persönlichen und kulturellen Rhythmen bestimmt: den Pulsschlag des landwirtschaftlichen Jahres, die Zeiten des Säens, Pflanzens und Erntens, die Abfolge unserer großen Feste? Sie bestimmen ebenfalls die richtigen Zeiten des Sammelns und Bereitens der Heilkräuter.
Differenzierter als der Rhythmus der Sonne ist der des Mondes. Mondphasen (synodischer Mond), Stellung des Mondes im Tierkreis (siderischer Mond), Erdnähe und Erdferne (anomalistischer Mond), aufsteigender und absteigender Mond (tropischer Mond), Mondknoten (drakonischer Mond) – all das wirkt auf das Keimen und Sprießen und auf die Substanzbildung der Vegetation ein. Die Planeten modifizieren ihrerseits die Intensität der Sonnen und Mondeinstrahlung und die dadurch bewirkte Veränderung von Aroma, Farbe und anderen qualitativen Eigenschaften.