Gespräch im Cockpit:
Merle. Ja. Mädchen auf schwarzem Pferd bei zwei Uhr.
Judd kommt mit dem
Christmatech-Van. Als er mein Gesicht sieht, zuckt er zusammen. Ach
ja. Ich habe lauter blaue Flecke. Von seiner Treppe. Tut’s weh,
fragt er.
Ja.
Judd bugsiert die
Schnauze seines Vans vor die Schnauze des LeBaron und hantiert mit
den Starterkabeln.
Ich werfe einen Blick
in den Van. Pizzakartons voller Lichterketten. Ein Wollknäuel. Eine
Leiter. He, mein Cowboyhut!
Ist der Cowboyhut für
mich.
Er wendet den Kopf.
Nö.
Ich öffne die Tür und
schnappe ihn mir.
Wolltest du jemanden
abholen, sagt er mit dem Kopf unter der Motorhaube des
LeBaron.
Nein, ich hab
jemanden weggebracht. Meinen Dad. Und meinen Onkel.
Er hält
inne.
Was, sage
ich.
Nichts. Ich musste
nur gerade überlegen. Plus an Plus. Minus an Minus.
Klingt
plausibel.
Wo fliegen sie denn
hin.
England.
Er richtet sich auf.
Sieht mir scharf in die Augen. Was, sage ich noch
einmal.
Nichts. Spring rein.
Warte, bis ich dir ein Zeichen gebe, und dann wirf ihn
an.
Okay.
Und so steige ich mit
dem Cowboyhut auf dem Kopf in meinen LeBaron, und er steigt in
seinen Van. Er startet den Motor und lässt ihn laufen. So sitzen
wir eine Weile da. Und beobachten einander durch die
Windschutzscheiben.
Das mit deinem Vater
und deinem Onkel war gelogen.
Ja.
Warum.
Weil es
wehtut.
Und warum sagst du
mir das nicht.
Hab ich
doch.
Ja. Aber warum
sprichst du nicht mit mir darüber.
Weil ich jemanden im
Ungewissen lassen möchte.
Er nickt. Soll
heißen: Okay. Dieser Jemand bin dann wohl ich. Soll heißen: Okay,
jetzt wirf den Motor an.
Ich werfe den Motor
an. Danke, danke.
Gern
geschehen.
Und wieder fahre ich
langsam, in viel zu kleinem Gang nach Hause.
Ich habe zwei Flugzeugabsturzträume: Der eine spielt
am Boden, der andere in der Luft. Im einen beobachte ich vom Boden
aus ein Flugzeug, und in dem Moment, als ich das Wörtchen
Absturz denke, gerät es auch schon ins
Trudeln. Im anderen sitze ich in einem Flugzeug, und eine Party ist
im Gang – alle amüsieren sich prächtig -, als mir auffällt, dass
die Piloten auch mitfeiern. In der Kabine. Ähm. Und in dem Moment,
als ich das Wörtchen Absturz denke,
geraten wir auch schon ins Trudeln.
Nachdem Onkel Thoby
zu uns gezogen war, hörten diese Träume eine Zeit lang auf. Aber
nachdem ich den Hangar mit den von Gott dort abgelegten
Flugzeugsitzen entdeckt hatte, fingen sie wieder an.
Mein Dad reagierte
auf meine bösen Träume, indem er mir lang und breit erklärte, beim
sogenannten Nachtschreck handele es sich um eine evolutionäre
Anpassung.
Was auch
sonst.
Stell dir vor, zwei
Männer liegen im Wald und schlafen. Als plötzlich irgendwo ein
Zweig bricht, fahren sie erschrocken hoch. Sie setzen sich auf,
schauen sich um, horchen in die Dunkelheit. Doch alles scheint wie
immer. Der eine Mann zuckt die Achseln und schläft weiter. Der
andere liegt wach und fürchtet sich. Warum fürchtet er sich. Er
weiß es nicht. Darum erfindet er einen Grund. Oder zwei. Oder drei.
Er malt sich all die schrecklichen Dinge aus, die ihm am nächsten
Tag zustoßen könnten. Vielleicht lässt sein Gefährte ihn allein
zurück. Oder lernt jemanden kennen, der ihm sympathischer ist. Vor
lauter Sorge ist der Mann hellwach und auf der Hut. Als der Löwe,
der sich durch den brechenden Zweig verraten hat, eine halbe Stunde
später schließlich auf der Lichtung erscheint, springt der Mann,
der sich vor Angst fast in die Hosen macht, blitzschnell auf einen
Baum und überlebt. Der schlafende Mann hingegen wird
gefressen.
Ich habe aber nicht
von einem Löwen geträumt.
Schlaf weiter. Nein –
in deinem eigenen Bett. Morgen früh ist deine Angst
verflogen.
Aber der Mann, der
weitergeschlafen hat, wurde gefressen.
Schon. Aber die Zeit,
in der wir in den Wäldern hausten, ist lange vorbei. Nur dein
Körper erinnert sich noch daran.
Was ich nicht
besonders tröstlich finde.
Mein Körper erinnert
sich daran, dass er in einem Flugzeug saß. Und will mir sagen: Mach
das bloß nie wieder.
Onkel Thoby hatte ein
anderes Rezept gegen böse Träume. Er meinte, ich solle den Traum
verändern. Was ich anfangs für völlig
unmöglich hielt. Dazu war der Traum viel zu realistisch. Er schien
wahr und unumstößlich, und wenn ich daraus erwachte, hatte ich nur
deshalb solche Angst, weil mein Körper insgeheim wusste, dass ich
in Wirklichkeit in einem abstürzenden Flugzeug saß, und träumte,
ich läge wohlbehalten in meinem Bett.
Onkel Thoby sagte:
Denk dran, was ich dir gesagt habe. Eine Montage ist nicht nur
wahr, sondern auch schnell und wild gemischt. Du und nur du
entscheidest, was darin vorkommt und was nicht.
Wie bei einer
Biografie.
So ähnlich. Onkel
Thoby sagte, das Leben bestehe hauptsächlich aus
Nebensächlichkeiten. In einer Montage hingegen sehe man nur das,
was wirklich wichtig sei. Wenn das hier ein Traum wäre, sagte er,
würde ich weder die Pferde auf deiner Bettdecke wahrnehmen noch den
Yoda im Regal. Ich würde auch nicht aus dem Fenster schauen und ein
Auto in der Einfahrt stehen sehen. Es sei
denn, all diese Dinge spielen früher oder später eine Rolle.
Es sei denn, jemand steigt ins Auto und fährt davon. Das ist das
Schöne an einem Traum. Du entscheidest, was wichtig ist. Du
entscheidest, wie er ausgeht. Halt das Flugzeug in der Luft. Flieg
das Flugzeug selbst, während die Piloten in der Ersten Klasse eine
Party feiern. Lenk den Traum in eine andere Richtung.
Okay. Das ging eine
Weile gut. Bis ich den Hangar entdeckte.
Onkel Thoby, sagte
ich in den Heizungsschlitz. Mein Bett stürzt ab.
Zwei Sekunden später
stand er in meinem Zimmer. Was gibt’s.
Ich habe ein Haus mit
einem Flugzeugabsturz drin gefunden.
Was.
Er setzte sich auf
den Sitzwürfel und hörte zu. Dann fragte er, wo sich dieses ominöse
Haus befinde, wie viele Flugzeugsitze dort lägen und was in drei
Teufels Namen ich mit Rambo auf dem Flughafengelände verloren
hätte.
Kein Wort zu meinem
Dad.
Er versprach es mir,
erzählte es ihm aber trotzdem. Nicht, um mich in Schwierigkeiten zu
bringen, sondern weil er eine Idee hatte. Er hatte die Idee zu
einem Flugzeug im Keller.
Meine Flugangst und
meine strikte Weigerung, je wieder einen Fuß in ein Flugzeug zu
setzen, solange wir drei lebten, bereiteten ihm und meinem Dad
anscheinend größere Sorgen, als sie sich hatten anmerken
lassen.
Das ist denn doch
etwas zu viel des Guten, sagte mein Dad.
Onkel Thoby sah das
ähnlich. Damit bleiben ihr unendlich viele wohlbehaltene Abenteuer
versagt.
Und so heckten sie
einen Plan aus, um mich von meiner Flugangst zu
befreien.
Mein Dad hatte den
Keller in eine Wohnung für Onkel Thoby umbauen lassen. Genauer
gesagt, in ein Schlafzimmer mit angeschlossenem Bad. Eigentlich war
der Keller viel zu groß für ihn. Im Grunde war er nichts weiter als
ein langes Rechteck mit einem Bad an einem Ende. Na, woran erinnert
Sie das.
Ach ja. Er war
eisbergsalatfarben gestrichen, und durch das Grün schimmerte die
Sonne.
Sie mieteten einen
Truck und fuhren zum Flughafen. Ich war nicht dabei. Ich wusste
nichts davon. Sie wollten mich zu ihrem gemeinsamen Geburtstag
damit überraschen. Sie hatten Geburtstag, und ich bekam etwas
geschenkt. Ein Flugzeug im Keller.
Sie hatten die Sitze
und einen Getränkewagen aus dem Hangar mitgehen
lassen.
Heiliger, sagte ich,
als ich die Augenbinde abnahm. Ogottogott mit
Fruchtkompott.
Sie sahen sich an.
Der ist neu.
Die Sitze waren
aufgereiht wie im Theater, mit dem Gesicht zur kurzen Seite des
Kellerrechtecks. Sie waren marineblau mit Karomuster und, wo nötig,
mit Isolierband bandagiert.
Ein Flugzeug, ein
Flugzeug!
Ich vollführte ein
kleines Freudentänzchen. Onkel Thoby tanzte mit. Mein Dad schlug
mit dem Fuß den Takt.
Aber das war noch
nicht alles. Vorn befand sich ein »Cockpit«, bestehend aus einem
alten Schreibtisch, an den sie Knöpfe und Schalter geklebt hatten.
An der Vorderseite des Schreibtisches war ein Lenkrad
festgeschraubt. Wo habt ihr denn das Steuer gefunden.
In einem Vorgarten in
der Logy Bay Road.
Großes
Gelächter.
Ich starrte sie an.
Sie waren Einbrecher und Diebe. Sie waren Piraten. Sie waren
fantastisch.
Captain, sagte Onkel
Thoby. Und wies mit ausgestrecktem Arm auf den Pilotensitz. Ich
setzte mich. Mein Dad spielte den Passagier. Onkel Thoby setzte
sich neben mich. Mein Copilot.
Ich wandte den Kopf
und sah zu meinem Dad. Mit dem breitesten Grinsen aller
Zeiten.
Ein Flugzeug. In
unserem Keller.
Willkommen an Bord
von Qantas-Flug 123. Hier spricht Ihr Captain.
Zugegeben, wir
starrten beim Fliegen die ganze Zeit an die hellgrüne Wand, aber
Herrgott, wir flogen. Und wie wir
flogen. Wir flogen um die ganze Welt. Wir flogen nach China und
Frankreich, und ich drehte an den Knöpfen und sagte: Verehrte
Fluggäste, wir durchfliegen gleich einige leichte Turbulenzen. Als
wir die Turbulenzen hinter uns gelassen hatten, stand Onkel Thoby
auf und steuerte auf den Getränkewagen zu. Mein Dad sagte: Alles
außer London. Als Onkel Thoby den Gang entlangging, tat er so, als
würde er das Gleichgewicht verlieren. Immer schön waagerecht
halten, Airbus 320.
Das hier ist eine
747.
Wie bitte. Soll das
heißen, sie hat zwei Decks.
Jawoll!
Wir bauen aber nicht
das ganze Haus zu einem Flugzeug um, sagte mein Dad, der in 1C saß
und den Telegram las.
Onkel Thoby in 1D
nippte an seinem Getränk.
Ich schaltete das
Bitte-anschnallen-Zeichen ein.
Keine
Reaktion.
Ich habe gerade das
Bitte-anschnallen-Zeichen eingeschaltet.
Oh.
Daran müssen wir noch
arbeiten, sagte Onkel Thoby und legte seinen Sicherheitsgurt
an.
Manchmal wollte ich
lieber Passagier sein, und dann übernahmen mein Dad und Onkel Thoby
die Pilotenkanzel. Wenn mein Dad am Steuer saß, flogen wir an Orte
wie Ouagadoudou, Shanghai und Dubai. Wenn Onkel Thoby am Steuer
saß, flogen wir normalerweise nach Corner Brook.
Seit wann fliegt
Qantas nach Corner Brook.
Seit die Australier
massenhaft in dieses wunderhübsche Städtchen
auswandern.
Aha.
Okay.
Nur nach England
flogen wir nie.
Wenn mein Dad und
Onkel Thoby flogen, ging es an Bord zumeist etwas aufregender zu,
weil sie mehr Flugerfahrung hatten und sich allerlei
(Beinahe-)Katastrophen einfallen ließen. Während es bei mir immer
nur zu a) Turbulenzen oder b) Fahrwerksfehlfunktionen
kam.
Wenn mein Dad flog,
verloren wir oft an Höhe. Aus rätselhaften Gründen. Mist, wir
verlieren schon wieder an Höhe.
Was du nur immer mit
der Höhe hast, sagte Onkel Thoby und legte einen Schalter
um.
Ich lasse jetzt
Treibstoff ab.
Von
wegen.
Doch.
Nein.
Ins offene Meer. Es
geht leider nicht anders. Pardon, liebe
Meeresorganismen.
Ach du
Scheiße.
An nur drei Plätzen
waren die Klapptische intakt. Ich saß grundsätzlich auf einem Platz
mit Klapptisch. Damit ich ihn immer wieder hoch- und runterklappen
konnte. Bis zum Erbrechen. Apropos: Manchmal aßen wir auch im
Keller. Dann saßen wir zu dritt in der Kabine, und das Cockpit
blieb leer.
Was für ein
widerlicher Flugzeugfraß. Darf ich um die Kotztüte
bitten.
He.
Wer fliegt diese
Maschine eigentlich!, fragte mein Dad mit einem Mal und sprang auf.
Mein Gott, wer fliegt diese Maschine.
Großes
Gelächter.
Die
Flugzeugabsturzträume hörten auf.
Vor jedem Flug verlud
Onkel Thoby unser Gepäck. Der Frachtraum befand sich unter seinem
Bett. Jeder durfte nur ein Gepäckstück mitnehmen. Ich brachte
normalerweise Wedge in seiner Kugel mit, der unweigerlich aus dem
Frachtraum kullerte, wobei er mit den Händchen fuchtelte, als seien
wir in höchster Not. Alles raus hier!
Mein Gepäck ist
verloren gegangen, sagte ich und wandte den Kopf.
Wenn wir ihm doch nur
beibringen könnten, den Getränkewagen zu schieben, sagte Onkel
Thoby.
Wenn Onkel Thoby
flog, herrschte meistens dichter Nebel. Die Sicht ist schlecht,
sagte er dann. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Ich warte auf
die Landegenehmigung vom Tower. Der Boden könnte sonstwo sein.
Womöglich müssen wir umkehren und nach St. John’s zurückfliegen.
Ja, ich glaube, wir müssen nach St. John’s zurück. Aus Corner Brook
wird heute nichts. Aber ein Rundflug ist zur Abwechslung ja auch
ganz schön.
Lass mich fliegen,
sagte mein Dad dann.
Nein.
Doch.
Nein.
Ein Knuff gegen die
Schulter.
Rauch im Cockpit,
sagte mein Dad. Riecht ihr das auch. Schnupper. Ja. Das hat nichts
Gutes zu bedeuten. Wir müssen landen. Auf der Stelle.
Hast du das Pferd auf
der Rollbahn gesehen, fragte ich meinen Copiloten
Thoby.
Nein. Ich war gerade
mit den Instrumenten beschäftigt.
Auf der Rollbahn
stand ein schwarzes Pferd.
Er warf mir einen
skeptischen Blick zu. Das hört sich aber gar nicht gut an, Captain
Oddly.
Ich zwinkerte ihm zu.
Halbsowild.
Mit der Zeit bauten
wir das Flugzeug immer weiter aus. Das Cockpit bekam eine neue
Beleuchtung. Ich flog gern im Dunkeln. Ovale Fenster mit einem
Sonnenuntergang dahinter säumten die Wände. Das Cockpit bekam eine
Windschutzscheibe. Wenn man genau hinsah, konnte man in der Ferne
andere Flugzeuge am Himmel sehen.
Und das alles nur
dank Onkel Thobys langem Arm und einem Pinsel.
Aber was ich mir am
sehnlichsten wünschte, konnte er nicht malen, nämlich eine
glitzernde Stadt, ein funkelndes Lichtermeer, in dem man versinken
konnte. Wie New York. Oder Las Vegas. Captain Oddly flog gern und
oft nach Las Vegas, das sie aus dem Fernsehen kannte. Die Lichter
schillerten und flirrten. Wie die glühende Asche eines
heruntergebrannten Lagerfeuers. Langsam, aber sicher fand sie
Geschmack an großen, wohlbehaltenen Abenteuern.
Sehr geehrte Damen
und Herren, in Kürze beginnen wir mit dem Landeanflug auf Las Vegas
International Airport. Ich möchte Sie bitten, Ihre Sitzlehnen in
eine senkrechte Position zu bringen und die Sicherheitsgurte
…
Hier gibt es keine
Damen, sagte Copilot Thoby und stärkte sich mit einem kräftigen
Schluck.
Es war so eine Art
Training. Damit ich Mut zur Neugier entwickelte. Und umgekehrt.
Damit ich ein Flugzeug besteigen und zu neuen Ufern aufbrechen
konnte. Und wenn ich dann eines Tages tatsächlich in der Lage wäre,
ein Flugzeug zu besteigen, würde ich seelenruhig, aber mit
hellwachen Sinnen Platz 12A, 14A oder 21F einnehmen. Ich würde
vielleicht einen eigenen Klapptisch haben. Oder ein Geheimfach in
meiner Armlehne. Vielleicht aber auch nicht. Auf keinen Fall jedoch
würde ich ohne Not oder gegebenen Anlass Crashhaltung einnehmen
oder gar eine Schwimmweste anlegen. Und wenn es zum Schlimmsten
käme, würde ich nicht untätig dasitzen wie die Zuschauer im
Theater.
Und im Falle einer
echten Katastrophe – und mit Katastrophe meine ich nicht etwa einen
Flugzeugabsturz, sondern, nun ja, sagen wir, ich fände mich allein,
ganz allein auf einer einsamen Insel wieder – tja, dann würde ich
mir wohl einfach ein eigenes Flugzeug bauen müssen. Und ich würde
Starten und Landen üben. Genau wie im Keller. Und ich würde in
einem weiten Kreis nach Corner Brook und wieder zurück fliegen.
Denn ein Rundflug ist ja auch ganz schön. Und dann würde ich diesen
Kreis erweitern. Immer weiter und weiter, bis ich den Ozean
überquert habe. Denn vielleicht sitzt auf der anderen Seite des
Ozeans ja noch jemand auf einer einsamen Insel fest. Und denkt, er
sei allein. Aber sieh mal einer an. Da kommt sie geflogen, meine
Boeing 747 mit einem großen Ahornblatt am Heck, wie eine offene
Hand. Bonjour, bonjour. Und dieser
Jemand hebt den Blick, beschirmt die Augen mit den Händen und sagt:
Ogottogott mit Fruchtkompott. Ich bin gar nicht allein. Nein, du
bist nicht allein. Und ich lege eine spiegelglatte Landung hin mit
meinem Flugzeug Marke Eigenbau, steige ab, pardon, aus, und da
steht er auf der Rollbahn und wartet.
ANTONIO.Fürwahr1, ich weiß nicht, was mich traurig macht;
Ich bin es satt; ihr sagt, das seid ihr auch.
Doch wie ich dran kam, wie mir’s angeweht,
Von was für Stoff es ist, woraus erzeugt,
Das soll ich erst erfahren.
Und solchen Dummkopf2 macht aus mir die Schwermut,
Ich kenne mit genauer Not mich selbst.3
Ich finde Shakespeares Einsatz von Exponenten,
gelinde gesagt, kurios.
Ich verrichte meinen
Dienst als Lesezeichen, während Chuck beharrlich aus dem Fenster
starrt. Er trägt seit drei Tagen dieselben Boxershorts. Wieder
murmelt er etwas von wegen wie einladend der Willamette doch sei.
Ach, Chuck. Leg doch mal’ne andere Platte auf. Fürwahr hoch eins.
Was, bitte, soll das heißen.
Beim Proben spricht
Chuck die Exponenten weder mit. Noch sagt er: Ich kenne mit genauer
Not mich selbst mal selbst mal selbst. Im Grunde sagt er heute
eigentlich so gut wie gar nichts. Er sieht erbärmlich aus, von
hinten, wie er da so am Fenster steht. Von hinten sehen eigentlich
alle Menschen erbärmlich aus, aber Chuck ganz
besonders.
Man kann nicht jeden
Tag den Hamlet spielen. Oder vielleicht doch. Vielleicht spielt man
den Hamlet gerade dann besonders gut, wenn man nicht weiß, dass man
ihn spielt. Oder wenn man den Antonio spielt. An manchen Tagen
jedenfalls.
Heute spielt er den
Antonio. Aber er legt die Latte nicht so tief, dass er einen
Salarino, Solario oder Salerio spielen würde. Es hat schließlich
alles seine Grenzen. Als er mich eben auf die Antonio-Passage
setzte, sagte er: Du bist so traurig, weil du ein Trottel
bist.
Wer,
ich.
Wie Chuck dort am
Fenster steht, als ob er nur darauf warten würde, dass ihn jemand
hochhebt und ihn sich unter die Achsel klemmt – das ist tatsächlich
furchtbar traurig. Er wartet darauf, dass ihm jemand sagt, er sei
kein Trottel. Dass ihm jemand sagt, er stelle etwas dar. Und habe
auch noch andere Rollen im Repertoire als diesen Armleuchter
Antonio, der nicht weiß, wer er ist, weil er gleich drei Dramatis
Personae in sich vereint (sich selbst hoch drei). Und wenn er denn
eines Tages sterben muss – heute, morgen, irgendwann -, so lasst
uns hoffen, dass ihm sein Tod nicht gar zu dumm geraten
wird.
Wenn man Chuck
glauben darf, gab Shakespeare sämtlichen Figuren, die ihn nicht
weiter interessierten, ähnlich klingende Namen. Aber Hamlet. Wenn
das kein ausgefallener Name ist. Und hieß so ähnlich nicht auch
Shakespeares abgöttisch geliebter Sohn, dessen allzu früher Tod den
Schwan von Stratford zeit seines – selbst recht kurzen – Lebens
grämte. Wie ich Im Bett mit Macbeth
entnommen habe.
Draußen regnet es,
und was denkt Chuck. Dass er über Bend und Boring, ja über Oregon
wohl nie hinauskommen wird. Er öffnet das Fenster. Klettert auf die
Heizung und lehnt sich hinaus. He. Leider habe ich gerade kein
Salatblatt zur, äh, Hand, das ich fallen lassen könnte. He. Sei
doch kein Dummkopf hoch zwei. Komm wieder rein.
Ach. Er raucht bloß.
Er verstößt wissentlich gegen Lindas Regel und raucht, indem er
sich, wie üblich, recht weit aus dem Fenster hängt.
Meinetwegen.
Trotzdem. Wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt, nicht gerade
wie eine Schildkröte gebaut ist (sodass auch der Rest des Körpers
mühelos durchs Fenster passen würde) und sich noch dazu drei oder
vier Stockwerke über dem Erdboden befindet, kann es meiner Meinung
nach nicht schaden, ein Klettergeschirr anzulegen. Und fest
angeseilt zu sein. Selbst Cliff, für den die Sicherheit sicherlich
nicht an erster Stelle stand, war der Rolle, die er im richtigen
Leben zu spielen hatte, nie auch nur annähernd so überdrüssig, dass
er darauf verzichtet hätte, sich ordentlich anzuseilen, bevor er
sich von der Feuerleiter abseilte. Aber Cliff war natürlich auch
ein Equipmentfreak. Sprich jemand, den eine innige Liebe mit seiner
Ausrüstung verband. Oft schlief er sogar in seinem
Klettergeschirr.
Manchmal muss man
natürlich in seinem Klettergeschirr schlafen, zum Beispiel wenn man
in Begleitung eines zweiten Kletterers mit Gewalt eine mächtige
Felswand bezwingen will. Wenn die mächtige Felswand so gewaltig
ist, dass sie an einem Tag nicht zu bezwingen ist, muss man eine
spezielle Hängematte im Fels verankern, damit man auch in circa 37
000 Fuß Höhe bequem übernachten kann, und Unmengen von Power Bars
verdrücken, bis die Sonne morgens auf die Hängematte fällt und
einen weckt. Was Cliff gleich mehrmals tat.
Nicht dass ich Cliff
bei einem seiner Kletterabenteuer je begleitet hätte. Aber einmal
habe ich einen Kletterausflug
mitgemacht. Wir quetschten uns zu fünft in Cliffs Wagen (Cliff und
Audrey vorn, Chuck und Linda hinten, ich auf dem AB) und
verbrachten einen Tag am Lake Soupçon, dessen Name aus Audreys Mund
reichlich suspekt klang, während die anderen in einem fort von
einem leckeren Süppchen zu schwärmen schienen.
Zweck der Übung war
es, Chuck die Grundlagen des Kletterns beizubringen. Obwohl ich
davon überzeugt bin, dass Chuck eigentlich nur lernen wollte, wie
man sich abseilt. Weil er insgeheim davon träumte, sich auf Bühnen
abzuseilen, auf denen er nichts verloren hatte, weil er in dem
Stück, das dort gegeben wurde, im wahrsten Sinne des Wortes keine
Rolle spielte.
Lake Soupçon ist ein
flacher Kratersee, der an eine Suppenschüssel erinnert, mit Wänden,
die selbst ein Neuling leicht zu bewältigen vermag. Sie sind nicht
so hoch, dass man in ihnen übernachten müsste. Im Gegenteil. Wenn
man oben ein Seil verankert hat, kann man daran Klettern und
Abseilen üben bis zum Überdruss. Cliff hätte die Wände von Lake
Soupçon im Schlaf erklimmen können. Was war diese Suppenschüssel
schon gegen die Jalpen. Chuck, mit seinen dürren Ärmchen, hatte es
da schon etwas schwerer. Denn obwohl Cliff oft und gern das
Gegenteil behauptete, sind die Arme beim Klettern durchaus von
Bedeutung. Will sagen, ohne raffinierte Prothesen könnte ein
Armloser schwerlich einen Berg besteigen. Cliff wollte natürlich
zum Ausdruck bringen, dass es beim Klettern vor allem auf die Beine
ankommt. Man muss die Felswand hinaufgehen, selbst wenn sie senkrecht aufragt, statt
sich mit den Händen hochzuziehen. Comprenez.
Unterdessen
schaukelten Audrey, Linda und ich in einem gemieteten Ruderboot
mitten auf dem Lake Soupçon. Linda legte den Kopf in den Nacken,
damit sie Sommersprossen bekam. Audrey hatte Sommersprossen genug.
Sie hielt die Riemen. Ich saß auf dem Armaturenbrett, das zwar
nicht so hieß, aber was soll’s. Ich saß auf dem Armaturenbrett,
streckte den Kopf über die Kante und bewunderte mein Spiegelbild im
stillen braunen Wasser.
Vorsicht, Iris.
Nimmst du sie mal da weg.
Linda packte mich mit
beiden Händen und ließ mich in Audreys Schoß plumpsen. Ich drehte
mich langsam um. Cliff war nur sehr schwer zu erkennen, er trug
nämlich sein beigefarbenes
ES-GEHT-DOCH-NICHTS-ÜBER-EIN-FUNDIER-TES-VORURTEIL-T-Shirt – was
selbstredend ein Witz ist, den ich allerdings nicht besonders
witzig finde -, das sich perfekt in die steinige Umgebung fügte.
Man sah eigentlich nur das pinkfarbene Seil und Chuck am Fuß der
Felswand, neben der Kühlbox.
Cliff wollte, glaube
ich, eine sogenannte Traverse demonstrieren. Bei einer Traverse
bewegt man sich seitlich die X-Achse entlang.
Chuck sicherte ihn.
Sprich er hielt das Seil, das über eine Rolle an Cliffs Geschirr
befestigt war. Kurz: Chuck hielt gleichsam Cliffs Leben in Händen,
ein Umstand, der Audrey, ihren verkrampften Oberschenkeln nach zu
urteilen, gar nicht behagte.
Cliff machte sich an
den Aufstieg entlang der Y-Achse.
Plötzlich fiel Chuck
ein, dass er Durst hatte. Was sich unschwer daran erkennen ließ,
dass er plötzlich nur noch Augen für die Kühlbox hatte. Audreys
Beine verkrampften sich so sehr, dass ich ihr beinahe vom Schoß
gekippt wäre. Warum. Weil Chuck gegen die Regel Nummer Eins der
Klettersicherung verstieß, welche da lautet: Lass die Person, deren
Leben du in Händen hältst, unter keinen Umständen aus den
Augen.
Und dann verstieß er
auch noch gegen Regel Nummer Zwei, welche da lautet: Lass unter
keinen Umständen das Seil los, wenn du das Leben eines anderen in
Händen hältst.
Gefolgt von einem
eklatanten Verstoß gegen Regel Nummer Drei, welche da lautet:
Zische unter keinen Umständen ein kühles Blondes, während du das
Leben eines anderen in Händen hältst.
Audrey legte sich in
die Riemen und ruderte eilends ans Ufer.
Linda sagte: Das kann
doch wohl nicht …
Aber seien wir
ehrlich: Wozu war die Kühlbox da, wenn nicht, um Chuck in feinherbe
Versuchung zu führen. Und hätte Cliff es nicht eigentlich besser
wissen müssen. Aber, wie gesagt, stand Sicherheit für ihn nicht
unbedingt an erster Stelle. Für Audrey hingegen schon. Obwohl die
Chance, dass Cliff in den wenigen Sekunden, als Chuck nicht hinsah
und sich anschickte, das Menschenleben, das er in Händen hielt,
gegen ein Bierchen einzutauschen – nun ja, die Chance abzustürzen
war nicht allzu groß, da die Kraterwände des Lake Soupçon, wie
gesagt, nicht so rutschig waren, dass sich ein geübter Kletterer
wie Cliff davon ernstlich aus der Ruhe hätte bringen
lassen.
Audrey legte sich
noch immer mächtig ins Zeug und in die Riemen. Wobei starke Arme
durchaus von Vorteil sind.
Als wir das Ufer
schließlich erreicht hatten oder uns selbigem so weit genähert
hatten, dass Audrey ins Wasser hüpfen konnte, deponierte sie mich
auf dem Armaturenbrett und stürzte auf den Fuß der Felswand
zu.
Was macht sie denn
da, fragte die ebenso ahnungs- wie sommersprossenlose
Linda.
Audrey krabbelte
bergauf. Sie stieß Chuck mit einem gezielten Hüftschwung beiseite
und packte das Seil. Sie rief Cliff etwas zu, der daraufhin den
Kopf wandte und die Felswand hinabstarrte. Jetzt hielten vier Hände
das Seil, und aller Augen ruhten auf Cliff. Unten angekommen,
drehte Cliff sich um – das T-Shirt ließ seinen albernen Spruch vom
sprichwörtlichen Stapel, und Audrey ließ das Seil fallen und ging
davon. Stampf, stampf, krabbel, platsch, kam sie zum Boot zurück,
sammelte mich ein und marschierte zum Wagen. Im ersten Moment
dachte ich, wir würden gemeinsam in den Sonnenuntergang fahren und
die anderen zurücklassen. Aber nein. Das war nicht Audreys Stil.
Stattdessen setzten wir uns auf die Kühlerhaube, richteten den
Blick gen Himmel und warteten, bis die anderen die Ausrüstung
zusammengepackt hatten. Was ewig dauerte. Der Himmel wurde dunkler,
die Kühlerhaube kühler. Sie schob mich unter ihr T-Shirt. Warm
genug, fragte sie.
Vierzehn Tage später
kam sie mit sechs Schachteln Klettergriffen nach Hause und
verwandelte unsere Wohnung in eine kleine Kletterhalle. Und unsere
heimischen vier Wände in künstliche Klippen. Cliff zuliebe. Damit
er, wenn er denn fiel, nicht tiefer fiel als maximal ein Meter
achtzig.
Seit meinem Treppensturz habe ich Zahnprobleme. Was
heißt eigentlich impaktiert, ich bin
nämlich ziemlich sicher, dass meine Zähne genau das sind.
Impaktiert, erkläre ich der Sprechstundenhilfe in Dr. Overli-Domes’
Praxis.
Sie hört auf zu
tippen. Alle, fragt sie.
Ja.
Bitte nehmen Sie
Platz.
Ich setze mich. Im
Reader’s Digest steht ein Artikel über
Introvertierte. Sie werden interviewt und gezwungen, ihre größten
Geheimnisse preiszugeben. Ich wollte, ich wäre introvertiert. Und
hätte einen Extrovertierten, der mir diesen Zahn samt Wurzel zieht.
Wo ist mein Extrovertierter.
Da tritt Dr.
Overli-Domes auch schon kahlköpfig und weißgewandet hinter einer
geschlossenen Tür hervor.
Audrey
Flowers!
Ich stehe
auf.
Ogottogott mit
Fruchtkompott. Du bist ja richtig groß geworden. Oder muss ich Sie
sagen.
Nein, nein. Ich
versuche, mich etwas kleiner zu machen.
Komm.
Ich folge ihm zu dem
orangenen Stuhl. Ah, der gute alte orangene Stuhl. Das
Behandlungszimmer ist unverändert, bis auf den in die Decke
eingelassenen Fernseher, in dem Zeichentrickfilme laufen. Sieh
einfach ein wenig fern und entspann dich, sagt er und
verschwindet.
Frohe Weihnachten, Charlie Brown! Ich
gähne.
Ich setze mich auf.
Hoffentlich ist er nicht hinausgegangen, um das Röntgengerät
anzuwerfen. Das haben Zahnärzte nämlich so an sich. Einfach aus dem
Zimmer zu gehen und einen zu röntgen. Jetzt bitte nicht bewegen –
ich bin gleich wieder da.
Nein, nix Röntgen. Er
hat sich von Ingrid nur meine Akte geben lassen.
Wo brennt’s denn,
sagt er. Man sieht dich ja nur alle Jubeljahre einmal.
Ich war
verreist.
Das sagen
alle.
Ich erkläre ihm, ich
sei gestürzt, und jetzt seien meine Zähne impaktiert.
Gestürzt. Vom Pferd,
fragt er, ohne aus meiner Akte aufzublicken.
Nein.
Letztes Mal war es
ein Pferd.
Ja. Aber kein
Sturz.
Hier steht:
Huftiertritt ins Gesicht.
Er sieht mir in den
Mund. Schnappt nach Luft. Greift sich ans Herz. Ah ja, die
Schweizer Brücke. Die Schweizer Brücke hatte ich ganz vergessen.
Was für ein Prachtstück. Wenn ich mich recht entsinne, hat dein Dad
für das Ersatzteil seinerzeit eine hübsche Stange Geld springen
lassen. Das war weiß Gott kein Pappenstiel.
Schnipp schnapp,
machen seine Handschuhe.
Ich starre in seine
Brille. Das Schöne ist: Wenn man auf einem Zahnarztstuhl sitzt und
sich nicht gerade von den Zeichentrickfilmen in der Decke ablenken
lässt, hat man die seltene Gelegenheit, seinem Gegenüber lange und
tief in die Augen zu schauen, ohne dass es sich dem entziehen kann.
Fast scheinen seine Augen den Blick zu erwidern. Aber eben nur
fast. Denn in Wirklichkeit blicken sie einem natürlich in den Mund.
Sie sind ganz hingerissen von der Schweizer Brücke. Sie sind in die
Schweizer Brücke regelrecht vernarrt. Und merken nicht, dass man
das merkt.
Impaktiert. Wo, fragt
er.
Dr. Overli-Domes
flickte mich zusammen, nachdem Rambo mich getreten hatte. Dabei
summte er die ganze Zeit »All I Want for Christmas Is My Two Front
Teeth« und zwinkerte mir heimlich zu. Hinterher dankte ihm mein
Dad, weil er die Praxis extra für mich an den Feiertagen geöffnet
hatte. Und Dr. Overli-Domes sagte: Warum, in drei Teufels Namen,
muss sich die Kleine auch ausgerechnet an Weihnachten von einem
Gaul ins Gesicht treten lassen.
Dr. Overli-Domes
gehört zu jenen Ärzten, die zu Kindern ausgesprochen nett sind,
deren Eltern aber auf den Tod nicht ausstehen können.
Mein Dad ließ den
Kopf hängen.
Er, Onkel Thoby und
Verlaine saßen im Wartezimmer und ließen den Kopf
hängen.
Ich habe Rambos
Hinterhuf ausgekratzt, erklärte ich. Und »O Tannenbaum« gesungen.
Dabei bin ich seinem Hinterhuf wohl etwas zu nahe
gekommen.
Dr. Overli-Domes sah
lächelnd zu mir herab.
Es war bestimmt keine
Absicht, setzte ich hinzu.
Die provisorische
Brücke fühlte sich an wie eine Highway-Überführung. Riesengroß und
aus Beton. Keine Sorge, sagte er. Wir bestellen dir in der Schweiz
schöne neue Zähne, nicht wahr, Dad.
Mein Dad
nickte.
Verlaine horchte auf.
Es ging doch nichts über echte Schweizer Wertarbeit.
Als ich die neue
Brücke schließlich im Mund hatte, fand ich die Vorstellung, dass
meine Zähne aus einem Land kamen, in dem ich nie gewesen war,
plötzlich sehr, sehr komisch. Worauf ich mit dem Flugzeug im Keller
das erste Mal nach Zürich flog.
Jetzt sagt Dr.
Overli-Domes: Ist das ein Gerstenkorn.
Hat er mir also doch
heimlich in die Augen geschaut.
Ja.
Er rollt mit seinem
Stuhl zum Waschbecken und wäscht sich die Hände. Mit einem
Antibiotikum ist das ein Klacks.
Zu einem Antibiotikum
würde ich nicht Nein sagen, wenn Sie mir eins verschreiben
würden.
Ich bin Zahnarzt. Und
kein Augenarzt.
Na und.
Das wäre
unethisch.
Ach.
Ich kann dir
höchstens raten, die Finger davon zu lassen. Und drück nicht daran
herum.
Ich habe aber schon
daran herumgedrückt. Ich drücke gern daran herum.
Gerstenkörner gehen
oft mit Depressionen einher, sagt er. Bist du deprimiert. Fühlst du
dich manchmal wie erschlagen.
Mein Dad ist von
einem Weihnachtsbaum erschlagen worden.
Er wendet den
Kopf.
Ein Maschendrahtzaun hält die GOLEM gefangen. Falls
sie sich heimlich aus dem Staub machen will, bevor sie abgerissen
werden kann. Sie sieht aus, als hätte man ihr die Augen verbunden
und sie geschlagen. Sie sieht klein aus. Jenseits des Zauns
fletschen Neubauten die Zähne. Du bist die Nächste, höhnen sie. Du
bist die Nächste.
An den Wänden der
Schule steht GANGSTA LIFE, in Großbuchstaben. Ein paar
selbsternannte Gangster, die es vermutlich nicht ganz leicht haben
im Leben, sind mit Sprühfarbe über den Zaun
geklettert.
Mein Auge
tränt.
Stämmig steht Judd
neben mir. Wir halten uns am Zaun fest und verschränken die
Ellenbogen gegen den Wind, der uns ein Maschendrahtmuster ins
Gesicht beizen möchte. Die einzigen Farbtupfer sind Judds rote
Haare. Und sein Van. Und die Synkopen der
Warnblinkanlage.
He. Jesus steckt noch
immer wie ein Korkenzieher im Dach.
Seit wann ist die
Schule eigentlich keine katholische mehr. Darauf wurde früher so
viel Wert gelegt.
Judd und ich
schwelgen in gemeinsamen Erinnerungen an unsere GOLEM-Zeit. Wir
erinnern uns an die Cafeteria im Heizungskeller. (Er zeigt mir
seine Narbe, die von der schmerzhaften Begegnung mit einem Rohr
herrührt.) Wir erinnern uns an Direktor Pouvoir, der in
Wirklichkeit Dave Power hieß. Wir erinnern uns an Miss Daken und
ihre Mathe-Biografien. Wir erinnern uns an das Lied »Gott ist ein
Wunder!« (Wunder o Wunder! Gott ist ein Wunder! Er zeigt sich in
allen Dingen! Drum woll’n wir ihm ein Loblied singen!)
Und an den roten
Fallschirm.
Ach ja, der rote
Fallschirm. Der rote Fallschirm war das Größte. Wie er sich
bauschte und die gesamte Turnhalle ausfüllte. Und wie man sich
darunterstellen und sich einbilden konnte, die rote Decke nehme und
nehme kein Ende. Judd sagt, er habe einmal versucht, ihn zu
stehlen. Leider habe man ihn auf frischer Tat ertappt. Er habe
damit auf den Signal Hill steigen und ihn fliegen lassen
wollen.
Heiliger. Er hätte
dich aufs offene Meer hinausgetragen.
Und da wäre ich wohl
heute noch.
Ich sehe ihn von der
Seite an. Weihnachten steht vor der Tür. Ob er denn keine
Verpflichtungen habe.
Meine Familie ist in
Florida, sagt er.
Sie haben dich über
Weihnachten alleingelassen.
Wir feiern kein
Weihnachten, sagt er.
Wieso.
Wir sind
Juden.
Seit
wann.
Immer
schon.
Und trotzdem warst du
auf der GOLEM.
Du doch
auch.
Ich dachte, ich wäre
die einzige Nicht-Katholikin.
Nö.
Eigentlich bin ich
Atheistin, sage ich. Eine Atheistin mit
Französisch-Crashkurs.
Ich auch. Ein
atheistischer Jude mit Französisch-Crashkurs.
Und mit einer Firma
namens Christmatech. Interessant.
Er lächelt.
Stimmt.
Das Möbelhaus, das
den einen magisch und wundersam vorkommen mag, ist für andere die
Hölle auf Erden. Insbesondere wenn diese anderen Oberlicht nicht
ausstehen können. Und Judd kann Oberlicht auf den Tod nicht
ausstehen. Ja, es sind lauter verschiedene Zimmer unter einem Dach,
aber das Licht ist in allen Zimmern gleich.
Stellen Sie sich vor,
Sie leben unter einem Dach mit vielen Einzelzimmern, wo es ständig
zwölf Uhr mittags ist und alle naselang jemand zur Tür
hereinspaziert kommt, den Sie am liebsten niederschießen würden,
was selbstverständlich streng verboten ist. Ebenso verboten wie das
Essen von den ausgestellten Möbeln.
Judd hat schon früh
eine Vorliebe für die Dunkelheit, für Schokolade, für
Verkehrsampeln entwickelt.
Er weiß noch, wie er
eines Tages im Auto saß, genüsslich ein Milky Way verdrückte und
sich am Grün der Ampel erfreute. Und am Rot. Das Gelb war zu
schwach, es hatte zu wenig Pixel. Und noch während er dasaß, erfand
er eine neue Ampel, die das gesamte Farbspektrum umfasste. Ein Rot,
das sich erst lila, dann blau und schließlich grün verfärbte. Damit
man wusste, wann es grün wird. Und ein Grün, das über blasses Gelb
und tiefes Orange langsam in ein sattes Rot überging.
Von da an sagte er an
jeder roten Ampel: Die Ampel ist blau. Gleich wird es
grün.
Er sagt, Vögel und
manche Reptilienarten haben vier verschiedene Zapfen zur
Farbwahrnehmung in den Augen. Wir hingegen haben nur drei. Das
heißt, sie können Farben sehen, die wir nicht sehen
können.
Kannst du dir
vorstellen, wie ein Pfau für einen Pfau aussieht.
Wenn er ein Superheld
wäre und sich eine Superkraft aussuchen könnte, dann die. Den
zusätzlichen Zapfen.
Selbst seine
Warnblinkanlage macht ihn glücklich.
Oder Verkehrsstaus
bei Sonnenuntergang.
Und natürlich
Weihnachtslichterketten.
Oben in seinem Zimmer
über dem Schauraum arbeitet er so lange wie möglich ohne
Kunstlicht, bis das Blau der Dämmerung das Zimmer erfüllt. Nur so
kann man Weihnachtslichterketten erfinden.
Gut, er hat eine
Halogenschreibtischlampe. Aber die steht immer auf dem
Boden.
Was er gegen
Oberlicht habe. Ich weiß auch nicht. Aber es ist so seelenlos. Denk
an die Innenraumbeleuchtung eines Autos. Denk an die Mittagssonne
an einem Sommertag. Seelenlos.
Ich nicke. Das finde
ich auch.
Obwohl es dunkel ist,
scheint die GOLEM in weißes Licht getaucht. Gestrecktes
Baseballstadionlicht. Das unsere Gesichter hell und unsere Augen
dunkel werden lässt.
Der Van, der denkt,
mein Dad sei noch am Leben, blinkt immer noch im Rhythmus seines
Herzens.
Judd sagt, jetzt
könne er sich an meinen Dad erinnern. Er, Judd, stand mit seinem
Van vor Canadian Tire und hatte seine Lichterketten (Modell D-434)
an den Zigarettenanzünder angeschlossen. Mein Dad kam mit einem
tanzenden Schneemann, der die Hüften schwingt, wenn man ihn
einschaltet, aus dem Laden. Der Schneemann tanzte in der
Tüte.
Manche Leute scheint
der Van geradezu magisch anzuziehen.
Mein Dad blieb
stehen, stellte sich vor und bestaunte die Lichterketten. Er
fragte, ob das LED-Leuchten seien, und Judd sagte: Licht
emittierende Dioden sind das Ding vom letzten Jahr.
Was meinem Dad ein
Lächeln entlockte. Christmatech, las er den Schriftzug auf Judds
Van. Er kaufte drei Stück.
Ist dir kalt, fragt
Judd. Viens ici.
Ich lasse meine Hände
seitwärts den Zaun hochklettern (Cliff nannte das eine Traverse),
bis Judds rechter Arm mich von hinten umschließt wie eine Mauer.
Der Wind lässt nach.
Warum wir hier sind.
Weil es die Schule bald nicht mehr geben wird. Und wir unsere
Erinnerungen auffrischen müssen.
Als ich den Kopf in
den Nacken lege, landet mein Pferdeschwanz auf seiner Schulter, und
seine Wange berührt meine Wange. Unsere Wangen sind eiskalt. Er
flüstert mir ins Ohr, will wissen, wie es meinem Kinn, meiner
Stirn, meinen Zähnen, meinem Auge geht. Es tue ihm ja so leid, dass
ich die Treppe hinuntergefallen bin.
Mein Zahnarzt hat mir
ein Antibiotikum verschrieben.
Ich brauche mich nur
umzudrehen, und schon beginnt ein neues Kapitel. Kennen Sie dieses
Gefühl. Wenn man nur loszulassen und sich umzudrehen
braucht.
Meine Schildkröte ist
noch in Oregon, sage ich.
Das lässt sich
ändern, oder.
Heiligabend, und Onkel Thoby hat noch immer nicht
angerufen. Dafür rufen andere Leute an und imitieren ihn. Wenn auch
unfreiwillig. Aber der Hear Ye 3000 klingelt nun einmal mit seiner
Stimme: Bist du da. Ja! Willst du nicht drangehen. Doch! Und ob ich
drangehen will!
Im Laufschritt zum
Telefon. Und dann der Stich ins Herz, als er es doch nicht ist. Es
ist Murph, der wissen will, wie mir mein neues Schloss gefällt.
Also wirklich, man kann es mit dem Dienst am Kunden auch
übertreiben.
Immer wenn ich es
anfasse, bekomme ich einen Schlag, sage ich.
Dann ist ja alles in
bester Ordnung.
Soso. Danke der
Nachfrage.
Man muss diesen
Klingelton doch irgendwie abschalten können.
Verlaine ruft an, um
sich zu entschuldigen – oder was sie dafür hält. Sie sagt, da Onkel
Thoby es vorgezogen habe, de foutre le
camp, sei ich ja nun allein, und bei diesem Gedanken sei ihr
gar nicht wohl.
Foutre le camp. Das verwechsele ich immer mit
coup de foudre. Foutre le camp ist das, was Cliff getan hat. Einen
coup de foudre hingegen verspüre ich,
wenn ich Judds rote Haare sehe.
Onkel Thoby hat das
Camp keineswegs Hals über Kopf verlassen, sage ich. Außerdem campe
ich nicht allein.
Ich trage das
CRYNOT-Armband von meinem Dad und klimpere damit, laut, während
Verlaine mir klarzumachen versucht, dass sie mich mitnichten habe
kränken wollen, als ich samt meinem Cluedo-Punktezettel mit der
Liste der Verdächtigen im Fall Wedge bei ihr aufgekreuzt sei, aber
… was ist denn das für ein Geräusch, Audrey.
Nichts.
Klingt wie
Glöckchen.
Ich stecke mitten in
den Ermittlungen. Ich muss Schluss machen.
Aber es ist
Heiligabend.
Je. Nun.
Und sie beschwört den
Geist der vergangenen Weihnacht und die damit verbundene Tradition:
Am ersten Weihnachtsfeiertag (nachdem die Flowers ihre Strümpfe
geplündert und die Fernsehansprache der Queen verfolgt und
veralbert hatten) holte sie mich immer ab, und dann fuhren wir
gemeinsam erst ins Obacht-Gebäude, um die Versuchstiere zu füttern,
und dann zum Stall hinaus, um Rambo zu striegeln. Und wenn ich nach
Hause kam und meine Zähne noch intakt waren, saßen Onkel Thoby und
mein Dad schlafend auf dem Sofa, weil ich seit sechs Uhr früh ein
solches Energiebündel gewesen war, dass sie dringend Erholung
brauchten. Wacht auf! Wacht auf!
Ich falle ihr ins
Wort. Ich hätte keine Lust, diese Weihnachtstradition zu pflegen.
Nicht heute. Und nicht mit ihr. Ich trüge mich sogar mit dem
Gedanken, Weihnachten künftig ganz ausfallen zu lassen. So tief
sitzt der Schmerz. Darum wäre es mir lieb, wenn wir das
Obacht-Gebäude auf den zweiten Feiertag verschieben
könnten.
Aber
Audray.
Ich muss Schluss
machen.
Ich lege
auf.
Ich lese noch einmal,
was auf dem Armband steht. Was ist Heparin. Hier steht, wir hätten
meinem Dad eine Heparinspritze geben sollen.
Ich setze mich an den
Tisch. Mir tun die Beine weh. Das kommt vom Warten. Und davon, dass
ich am liebsten weglaufen würde.
Wieder klingelt das
Telefon, und da es vermutlich Verlaine ist, gehe ich nicht dran.
Aber es nicht Verlaine. Es ist Patience. Sie hinterlässt eine
Nachricht. Es würde mich nicht wundern, wenn sie sagen würde: Ich
habe deine Maus. Wie viel ist sie dir wert. Aber nein. Sie sagt:
Hat dir die Trauerseife geholfen.
Ach. Die Trauerseife
hatte ich ganz vergessen. Ich gehe nach oben. Und lege sie zu den
anderen Sachen, die ich mit ins Civil Manor nehme. Wo ich
Weihnachten verbringen werde.
Ich bin der einzige
Gast. Quelle surprise. Doreen sitzt
noch immer vor dem Fernseher, demselben alten Fernseher wie damals,
so tief wie breit. Als ich einchecke, läuft Eine Weihnachtsgeschichte. Das Original. Mit
Alastair Sim und Byrne Doyle. Als ich Doreen auf die Ähnlichkeit
zwischen Jacob Marley und unserem konservativen Kandidaten
hinweise, wendet sie den Kopf und sagt: Gütiger Jesus, du hast
recht.
Wir befinden uns am
Anfang des Films, in der vergangenen Weihnacht, wo Scrooge und
Marley über die Hälfte der Anteile von Fezziwigs Firma erwerben,
und Marley sagt: Stets zu Diensten, Mr. Scrooge, und deutet eine
Verbeugung an.
Er ist Byrne Doyle
wie aus dem Gesicht geschnitten.
Welches Zimmer
hättest du denn gern.
Kann ich 205
haben.
Aber ja,
Schätzchen.
Nr. 203.
Ihre Hand wandert
nach links.
Wie hat Doreen nur
all die Jahre durchgehalten. Es ist alles noch genau wie früher.
Der orangene Teppich mit dem Mittelscheitel. Ich schleife meine
Reisetasche den Gang entlang.
Ich habe versucht,
Toff auf seinem Handy zu erreichen, ohne Erfolg. Nichts. Nicht
einmal eine Bandansage. Nichts als Rauschen und ein leiser
Sirenenton. Jetzt probiere ich es noch einmal. Und noch einmal. Ich
lasse mich aufs Bett fallen. Die Decke erinnert mich noch immer an
Toffs Bart.
Ich stelle mir vor,
wie Toff und Onkel Thoby sich einen endlosen Faustkampf liefern.
Der am Flughafen Montreal begonnen hat und nun in London
fortgesetzt wird. Ein Faustkampf wie im Zeichentrickfilm: ein wild
wirbelnder Zyklon, aus dem hier und da eine Faust oder ein Bein
hervorschnellt. Darum geht Toff nicht ans Telefon. Er hat sein
Handy im Zyklon verloren.
Derweil Großmutter
gesund und munter in ihrem Krankenzimmer sitzt und sich Patiencen
legt.
Ich schlafe ein und
habe eine kurze Montage von Onkel Thoby, über dessen Schulter eine
Drosophila melanogaster schwebt. Er
wendet den Kopf und betrachtet sie mit liebevoller Resignation. Du
schon wieder.
Das Schrillen des
Telefons reißt mich aus dem Schlaf. Es ist Doreen. Hier ist ein
junger Mann für dich.
Hat er rote
Haare.
Und wie.
Knutschen auf dem
Bett und so.
Pullover
aus.
Judds weißes T-Shirt
leuchtet im Schein des PIETY-Schriftzugs und der Lichterketten
(Modell D-634), die sich auf dem Tisch türmen und aussehen wie
Zürich aus der Ferne.
Seine Hand an meinem
Pferdeschwanz. Seine Lippen an meiner Wange. Sein
Weihnachtsgeschenk, der rote Fallschirm. Wie er da rangekommen ist.
Er hat ein Loch in den Zaun geschnitten und ist in die GOLEM
eingestiegen. Der kleine Gangster.
Meine Finger krümmen
sich um sein Schulterblatt.
Ich küsse jemanden,
der glaubt, dass mein Dad noch am Leben ist. Oder auch nicht. Judd
musste Clints Taxizentrale nämlich mit den neuen Lichterketten
ausstatten, und da hat Clint es ihm gesagt. Clint hat ihm gesagt,
dass mein Dad tot ist, und jetzt gibt es niemanden mehr, der mir
etwas bedeutet und es nicht weiß.
T-Shirts
aus.
Er fragt nicht, warum
ich gelogen habe.
Auf meiner Schulter
Kassiopeia. Er kartografiert die Sternbilder auf meiner Haut.
Kassiopeia hat die Form eines W. Da, da, da, da, da. Er verbindet
die Sommersprossen. Er wolle meine Schultern in seine Sternenkarte
eintragen, sagt er.
Sag was
Astronomisches.
Gelber Zwerg der
Spektralklasse G2V.
Was ist
das.
Die
Sonne.
Komm
her.
Ich bin
hier.
Komm
näher.
Wenn ich mit dir
zusammen bin, habe ich ein starkes Déjà-vu-Gefühl, sage
ich.
Wenn das
Déjà-vu-Gefühl anhalten soll, musst du einfach ganz still
liegen.
Ach ja. Im
Ernst.
Unter der Dusche
bemerkt Judd die Trauerseife. Ich will sie vor ihm verstecken, aber
sie flutscht mir aus den Händen und bleibt zwischen seinen Füßen
liegen. Bei dem Versuch, sie wieder aufzuheben, rutsche ich aus und
falle hin. Wenn auch in zwei Etappen. Ich schlage um mich. Judd
versucht, mich aufzufangen. Aber ich bin zu glitschig. Und lande
krachend auf dem Wannenboden.
Ich schäme mich ja
so, sage ich.
Ach was. Judd geht in
die Knie.
Aber nicht lesen, was
auf der Seife steht.
Baby, ich weiß längst
Bescheid.
Ist es sehr
merkwürdig, einen Mann dafür zu lieben, dass er meinem Vater
Lichterketten verkauft hat.
Nicht komischer, als
eine Frau dafür zu lieben, dass sie die Treppe hinuntergefallen ist
und ihren Cowboyhut wieder aufgesetzt hat, obwohl ihr das Blut
übers Kinn lief und sie Tränen in den Augen hatte.
Wir holen uns im
Swiss Chalet etwas zu essen. Er fragt, wie ich mit meinen
Ermittlungen vorankäme. Ich erzähle ihm von Humouse House und
Leonel de Tigrel, dem Erzfeind von meinem Dad. Ich habe auch ein
paar Leute aus St. John’s unter Verdacht. Verlaine denkt, ich sei
nicht ganz dicht. Sie meint, ich hätte kein Motiv.
Eine Maus, die zwei
Millionen wert ist, sagt Judd und leckt sich die Finger ab. Und
eine Reise nach Stockholm. Wenn das kein Motiv ist.
Es tut so gut, das zu
hören!
Wir trinken aus
blauen Pappbechern.
Prost.
Hast du auch deine
GOLEM-Akte mit der Post bekommen, frage ich.
Ja.
Mein IQ war
enttäuschend.
Meiner
auch.
Aber du bist
Lichterkettenerfinder.
Ich weiß. Denen hab
ich’s echt gezeigt.
Zwinker
zwinker.
Ehrlich gesagt,
meiner war mehr als enttäuschend.
Das liegt daran, dass
man Menschen wie dich nicht messen kann.
Ich höre auf zu
kauen. Ach ja. Was bin ich denn für ein Mensch.
Ich weiß auch nicht.
Aber ich wünschte, es gäbe mehr von deiner Sorte.
Judd legt seine
starken Arme auf den Tisch. Und wenn ich möchte, darf ich sie
berühren. Und er meine. Und ich darf ihn an diesen Armen aufs Bett
ziehen.
Ich rufe zu Hause an
und höre den Anruf beantworter ab. Vielleicht hat Onkel Thoby ja
eine Nachricht hinterlassen. Nichts. Der Strom schwankt. Der Wind
singt sein b. Judd sagt: Der Wind zerrt an dem Kabel auf dem
Isthmus.
Dem was.
Dem
Isthmus.
Du meinst, à la was
gut ist, muss nicht teuer sein.
Nein, ich meine den
schmalen Streifen Land, der uns mit dem Rest der Insel verbindet.
Auf dem Isthmus ist es immer windig. Und über diese Landenge kommt
unser gesamter Strom. In einem Kabel.
In einem
Kabel!
Darum spürst du einen
Windstoß erst ein paar Minuten nach der Stromschwankung. So lange
braucht der Wind vom Isthmus hierher.
Wir liegen still und
horchen.
Judd sagt, das
Geräusch des Windes sei das Geräusch der Erde, die durchs All
rast.
Ich glaube, heute
Nacht werde ich schlafen. Mein Kopf auf Judds Bauch. Meine Haare
noch feucht. Er strickt etwas Blaues. Ich betrachte die ferne Stadt
auf dem Tisch und sage: Für deine Lichterketten verdienst du eine
Reise nach Stockholm.
Die Stricknadeln
hören auf zu klappern. Eine Hand auf meiner Schulter.
Danke für meinen
Fallschirm, sage ich.
Eine Kette winziger, batteriebetriebener
Weihnachtslichter schmückt meine Schlossmauer. Hübsche Idee. Ich
inspiziere die Neun-Volt-Batterie in einer Ecke meiner
unbescheidenen Behausung, und als gerade niemand hinsieht, versuche
ich sie zu fressen. Nein. Daraus wird wohl nichts
werden.
Chuck und Linda
schmeißen eine Weihnachtsparty. Lucius, Dick & Co. sind
eingeladen, samt ihrer holden Dämlichkeit. Linda hat sich in Schale
geworfen und klimpert mit ihren Klunkern. Bald werden die Schritte
der Schauspieler im Treppenhaus zu hören sein. Chuck Blut-Stiller,
ruft sie. Bist du so weit.
Gleich, gute
Amme.
Sie verdreht die
Augen und gießt sich einen kleinen Baileys ein. Was soll’s, sagt
sie und genehmigt mir auch einen. Frohe Weihnachten,
Winnifred.
Wenn das so
weitergeht, kann ich mich am Ende vielleicht doch noch für sie
erwärmen. Als Chuck vorhin die Mauer dekorierte, sagte er: Du hast
ein wunderschönes Schloss, Winnifred.
Ich ließ ein
Salatblatt fallen. Das Schloss hat einen Namen.
Pappmaché.
Und es ist in der Tat
wunderschön, auch wenn ich die Artikel, die durch den lila Anstrich
schimmern, längst in- und auswendig kenne. Zum Beispiel den Artikel
über die hündischen Heldentaten an der Nordwand.
Seufz.
Ich nippe an meinem
Getränk und sinniere über vergangene Weihnachtsfeste.
Apropos Hunde: Einmal
haben wir über Weihnachten Cliffs Eltern besucht, die in Boring
eine Blindenhundschule betreiben. Cliffs Eltern besitzen acht
Hektar Land in Boring und über hundert Golden Retriever. Auf dem
Weg nach Boring äußerte Audrey einige Bedenken hinsichtlich des
bevorstehenden Zusammentreffens mit Cliffs Eltern und ihren vielen
Hunden.
Ich, auf dem
Armaturenbrett, teilte diese Bedenken.
Cliff sagte: Im
Grunde sind sie sterbenslangweilig. Wart’s ab. Spätestens wenn wir
uns Lawrence von Arabien anschauen
müssen, möchtest du dich am liebsten erschießen.
Audrey sagte, es gebe
eine Regel, die da lautet: Wer einen Hund hat, der ist traurig. Was
also ist jemand, der hundert Hunde hat?
Lebensmüde, schlug
ich vor.
Cliff sagte: Meine
Eltern sind alles andere als traurig. Das Einzige, was sie ein
wenig traurig stimmt, ist die Tatsache, dass ihr älterer Sohn auf
jeden verfügbaren Felsen klettert und unbedingt Stuntman werden
will.
Audrey tätschelte ihm
den Schenkel und sah aus dem Fenster. Sie machte eine Bemerkung
über die Unmengen von Efeu.
Cliff sagte: Wenn du
in Oregon vorsätzlich Efeu ziehst, wanderst du umgehend in den
Knast.
Ach, geh, sagte
sie.
Im Ernst, sagte
er.
Also, wenn ich einen
Efeuableger in ein Glas Wasser stellen würde …
Müsste ich dich
anzeigen.
Was ihr ein Lächeln
entlockte. Alles war in bester Ordnung. Sie entspannte
sich.
Wir kamen zur Ranch,
und die Blindenhunde waren überall und golden. Heilige Mutter
Gottes, lass die Tür zu. Sie öffnete die Tür. Die Hunde
schnupperten und schlugen Purzelbäume, was mich in dem Verdacht
bestärkte, dass meine Gegenwart sie regelrecht berauschte und ich
ihnen einen langgehegten Hundetraum erfüllen würde, wenn sie mich
schnappen und mit mir im Garten herumtollen dürften. Zögernd zog
ich mich in mein Privatgemach zurück.
Sie sprangen um uns
herum. Sie versuchten, uns zu Fall zu bringen. Welcher aufrechte
Blindenhund würde versuchen, einen Menschen zu Fall zu
bringen.
Auf der Veranda
standen Cliffs Mutter, Cliffs Vater und Cliffs Bruder Ridge, die
allesamt hervorragend sehen konnten. Ich hatte eigentlich erwartet,
wenigstens einer von ihnen sei blind. Audrey balancierte mich auf
Schulterhöhe wie eine Schüssel auf einem Tablett.
Cliffs Vater machte
einen Witz: Ist das der Nachtisch.
Die Schauspieler
haben eine Tomatenpf lanze mitgebracht. (Was Chuck aus irgendeinem
Grunde komisch findet. Er keckert keck.) Und ihre Freundinnen. Sind
die Freundinnen echt, oder sind auch sie Schauspieler. Zumindest
eine ist auf keinen Fall Schauspielerin, weil sie Krankenschwester
ist, eben vom Dienst kommt und noch ihre Tracht anhat, die für
meinen Geschmack wie ein Schlafanzug aussieht. Die Comicstrips auf
ihrem Schlafanzug erinnern mich stark an die auf meinem
Schlossfußboden. Ich würde ihr meinen Schlossfußboden ja gern
zeigen, wenn sie nur einmal in meine Richtung sehen würde. Sie
heißt ebenfalls Linda (verwirrend) und arbeitet auf der
Entbindungsstation. Sie hat heute ein Weihnachtsbaby zur Welt
gebracht. Die Eltern haben es Lametta genannt. Soll das ein Witz
sein, fragt Linda. Nein, sagt Linda.
Im Wohnzimmer lässt
Chuck sich über Kenneth Branagh aus, der nicht unbedingt zu seinen
Favoriten gehört.
Scheiße, wer hat bloß
wieder mit Kenneth Branagh angefangen, sagt meine Linda und
deponiert die Tomatenpflanze auf der Anrichte.
Prost, sage ich
fröhlich in die Runde.
Zwei Lindas und eine
Twyla beugen sich über mein Schloss.
Der Baileys scheint
ihr zu schmecken, sagt Linda.
Du hast einer
Schildkröte Baileys gegeben.
Ich deute auf den
Fußboden. Ja, sie nicken. Sie haben die Comicstrips bemerkt, und
sie sehen in der Tat genau so aus wie die auf Lindas Schlafanzug.
Charlie Brown bleibt ewig jung, meint Twyla.
Bei Charlie Brown
kamen auch nie Erwachsene vor, sagt Entbindungslinda.
Gab es da nicht eine
Lehrerin, sagt Twyla.
Die war nur eine
Quäkstimme, sagt meine Linda.
Fernunterricht, sagt
Twyla.
Ich fand Charlie
Brown immer irgendwie gruselig, sagt Entbindungslinda.
Ich trete den Rückzug
in meinen Panzer an, der involutiert ist wie eine Galaxie.
Involutiert heißt spiralförmig, aber auch potenziert mit X. X wie
Exponent. Wie: Ich kenne mit genauer Not mich selbst mal selbst mal
selbst. Kurz, die Innenseite meines Panzers ist so unendlich wie
gemütlich. Wie kann etwas Unendliches gemütlich sein, fragen Sie.
Dann sind Sie garantiert keine Schildkröte.
Im Wohnzimmer sagt
Chuck: Was ist dir denn angeweht.
Über mir wabert das
All.
Knutschen auf der
Veranda und so.
Ich saß auf dem
Geländer. Die Hunde hatten die Augen zugemacht. Drinnen lief
Lawrence von Arabien. Es war warm. Kein
Wind. Sie fand den Anfang des Films unerträglich. Wie lange braucht
der Kerl auf seinem blöden Kamel eigentlich noch.
Das ist in Echtzeit
gedreht, sagte Cliff.
Knutschen auf der
Veranda.
Der Himmel war klar
und voller Sterne.
Cliff sprach von der
Schweiz, er wolle unbedingt noch einmal in die Jalpen. Hatte sich
Madame Mourou am Ende nicht doch für ihn erwärmt. Immerhin hatte
sie aufgehört, ihn Hollywood zu nennen. Vielleicht könnten sie ja
bei ihr wohnen.
Ich ließ die
Schultern hängen. Drohte mir ein zweites Dubai. Würde ich wieder
dem Nachmieter überlassen. Wieder verlassen.
Sie hat dich nur
deshalb nicht mehr Hollywood genannt, weil sie ein schlimmeres Wort
gefunden hatte, sagte Audrey.
Ach, sagte er. Stimmt
ja. Wie hat sie mich noch genannt.
Ivrogne.
Cliff, der zwar die
Französische Skala geklettert war, aber nur ein paar Brocken
Französisch sprach, sagte: Und das heißt.
Sie zögerte.
Stuntman.
Cliffs Eltern
wollten, dass er ins Blindenhundgeschäft einstieg. Sie waren es
leid, seine Stuntman-Eskapaden zu finanzieren. Weshalb Cliff ihnen
einen Kompromiss vorschlug: Er würde in den Jalpen Spürhunde zur
Bergung von Verschütteten ausbilden. Und Lawinenexperte
werden.
Audrey sagte: Aber
muss ein Lawinenexperte denn nicht auch, wie sagt man noch gleich,
hors piste gehen.
Äh, ja.
Also, dazu würde ich,
glaube ich, eher Nein sagen.
Das Schöne am Leben
in den Jalpen ist: Es ist alles andere als langweilig. Weißt du
noch, sagte Cliff, wie ich dir auf dem Gipfel des Mont Dieu zu
Hilfe gekommen bin. Du hattest dich auf den Arsch gesetzt und beide
Ski verloren, weißt du noch. Und …
Und du hast dich zu
mir gesetzt und dein Studentenfutter mit mir geteilt.
Ja. Das waren
Zeiten.
Diese Geschichte
kannte ich. Wie er ihr zu Hilfe kam, ihre Ski zurückholte und
sagte, er sei aus Boring, Oregon. Aber keine Angst, so langweilig
bin ich gar nicht, sagte er.
Wohl
wahr.
Und als sie wieder im
Tal waren, hatte sie ihn Madame Mourou vorgestellt, die sich über
den Namen Cliff wunderte. Ein Name wie aus Reich und schön, hatte sie gesagt, wobei es sich um
eine Seifenoper handelte, die sie mit höchster Inbrunst und
tiefster Verachtung verfolgte.
Worauf Audrey
erwidert hatte: Er ist vielleicht nicht reich, aber schön. Und sie
hatte Cliff in ihr Zimmer geschmuggelt, das direkt über einer
Kneipe lag, die sich Pauvre Jean-Jacques! nannte, nach einem
berühmten französischen Philosophen, der als Sensibelchen galt und
zum Jammern neigte. Sie schmuggelte ihn in ihr Zimmer, die Musik
aus dem Pauvre Jean-Jacques! drang durch den Fußboden herauf, und
sie tanzten, bis ihnen die Kleider vom Leibe fielen, und sie sagte
Sachen wie: Mann, bist du gut gebaut.
Außerdem konnte Cliff
die Treppe hinunterfallen, ohne sich wehzutun. Er nannte das den
Wasserfall. Das sei ein klassischer Stunt, erklärte er ihr. Ein
Stuntman müsse fallen können, ohne sich wehzutun.
Ja, aber wenn man auf
einen Berg steigt und herunterfällt, dann ist der Ofen aus. Und
wenn man von einer Lawine verschüttet wird, ist der Ofen auch aus,
Stuntman hin oder her.
Jetzt küsste er sie.
Und ich hätte mich am liebsten verdrückt, damit sie ungestört sein
konnten, aber das ging leider nicht. Ich hockte rittlings auf dem
Handlauf. Mein Brustpanzer schmiegte sich an das Holz, und meine
Füße hingen in der Luft.
Cliffs Bruder Ridge
hatte mich mit Hallo, Kröte begrüßt, worauf Audrey einwand, ich sei
erstens kein Frosch und lebe zweitens nicht im Wasser, was sich
schon daran erkennen ließe, dass ich keine Flossen hätte, sondern
Füße. Und ihn folgendermaßen korrigierte: Eine Kröte verhält sich
zu einer Schildkröte wie eine Meerjungfrau zu mir.
Das schmerzte. Ein
wenig.
Mir blieb nichts
anderes übrig, als diskret wegzusehen und den Mond mit seinen
verfluchten Skihügeln anzustarren.
Cliffs Bruder Ridge
steckte den Kopf durch die Tür und sagte: Die Anfangsszene ist
vorbei. Das Kamel ist angekommen.
Erster Weihnachtsfeiertag, und ich sitze mit
geballten Fäusten auf der Vortreppe des Obacht-Gebäudes. Der Wind
schlägt mir buchstäblich ins Gesicht. Herrgott, ich könnte ihn nach
Strich und Faden vermöbeln, den Trottel, der den Campus
ausgerechnet so gestaltet hat, dass der Wind mühelos
Orkangeschwindigkeit erreicht. Meine Augen tränen, und mein
Gerstenkorn juckt.
Da kommt der
Lada.
Verlaine bleibt noch
einen Moment sitzen und starrt mich durch die Windschutzscheibe an.
Ich winke.
Sie hat natürlich
keine Jacke an.
Guten Morgen, sage ich, als sie die Treppe
heraufkommt.
Sie wirft mir einen
finsteren Blick zu. Non.
Bitte. Ich rappele
mich hoch.
Sie schließt die Tür
auf. Ich bin doch kein Museumsführer.
Und was war
vergangene Weihnacht. Von der vorvergangenen ganz zu schweigen.
Bist du sauer, weil ich einfach aufgelegt habe.
Non.
Ich möchte doch nur
rasch einen Blick in Dr. O’Leerys Folterkammer werfen, damit ich
ihn von meiner Liste streichen kann.
Ich folge ihr hinein.
Sie wendet den Kopf und schaut mich an. Du siehst besser aus, sagt
sie.
Wirklich. Ich
streiche mir durch den Pony.
Aber du klingst genau
so détraquée wie immer.
Détraquée.
Neben der
Spur.
Ja, ich weiß. Ich
folge ihr einen Gang entlang. Ich brauche bloß dreißig
Sekunden.
Wenn Wedge in
O’Leerys Labor wäre, hätte ich das längst gemerkt.
Hast du denn
nachgesehen.
Bien sûr habe ich nachgesehen.
Vielleicht nicht
gründlich genug.
Wie ich aus eigener
Anschauung weiß, schenkt Verlaine den Tieren in ihrer Obhut keine
allzu große Beachtung. Sie achtet lediglich darauf, dass sie
ausreichend Trinkwasser, Trockenfutter und Sägespäne
bekommen.
Wir kommen zu einer
Tür, die Verlaines Fingerabdruck scannt. Hoi, das ist neu. Aber
sind diese Sicherheitsvorkehrungen nicht ein klein bisschen
übertrieben.
Mit Sicherheit
nicht.
Hm. Sie hat nicht
gesagt, dass ich hier draußen stehen bleiben soll. Also folge ich
ihr. Wir kommen am Labor von meinem Dad vorbei. Sein Name steht
noch an der Tür.
Dreißig Sekunden,
sagt Verlaine und schließt Dr. O’Leerys Labor auf.
Die Mäuse in Dr.
O’Leerys Labor haben ein gebrochenes Rückgrat. Ich gehe an den
Käfigen entlang. Trotz ihres gebrochenen Rückgrats sind die Mäuse
lebendig. Sie ziehen ihren gelähmten Unterkörper nach.
Ein leises
Mäuseschluchzen steigt mir in die Kehle. Was wird denn hier
erforscht.
Ich habe dir doch
gleich gesagt, dass das keine gute Idee ist.
Ich dachte, Dr.
O’Leery ist Psychologe.
Keine Ahnung, was der
Kerl hier treibt. Pass auf, Audray. Wenn du tatsächlich davon
überzeugt wärst, dass Wedge hier ist, hättest du schon vor fünf
Tagen die Tür eingetreten. Er ist aber nicht hier. Also gehen
wir.
Die Mäuse haben
alphanumerische Codes an den Ohren, wie Autokennzeichen. Keine
einfachen Nummern.
Wie wird ihnen das
Rückgrat gebrochen.
Keine Antwort. Sie
hält die Tür auf. Und ihre dicken Arme fest verschränkt. Okay.
Weiter im Text. Wer tätowiert ihnen die Ohren. Du, nicht
wahr.
Wie
bitte.
Wie viele Mäuseohren
hast du tätowiert.
Tätowieren kann man
das nicht unbedingt nennen.
Wie
viele.
Sie macht das Licht
aus. Über die Jahre, keine Ahnung. Unendlich viele.
Was habe ich da
drinnen eigentlich erwartet. Ich weiß auch nicht. Wenn schon nicht
Wedge, dann vielleicht ein Bild von meinem Dad, das als Dartscheibe
herhalten muss. Irgendetwas. Vor der Tür des Labors von meinem Dad
bleibe ich stehen. Darf ich.
Verlaine zögert einen
Augenblick. Dann zieht sie den Schlüssel aus der
Tasche.
Es ist leer, aber es
riecht regelrecht nach Hirnschmalz. He. Das Blumenkohlgehirn! Es
ist ein Mensch, dieses Gehirn. Mein Gehirn kann diesen Gedanken
immer noch nicht fassen. Was wird eigentlich aus Mr. Blumenkohl.
Wird er ein neues Zuhause finden. Ich nehme ihn aus dem
Regal.
Nicht, Audray. Das
ist giftig.
Ich würde es gern
mitnehmen.
Sie setzt sich auf
den Stuhl von meinem Dad. Also darum das ganze
Theater.
Welches
Theater.
Warum hast du nicht
gleich gesagt, dass du dir das Labor deines Vaters ansehen
willst.
Weil ich gar nicht
wusste, dass ich es mir ansehen will.
Du kannst das Gehirn
nicht mitnehmen. Geschweige denn behalten. Aber du kannst es
besuchen.
Die Vorstellung, ein
Gehirn zu besuchen, bringt mich zum Lachen.
Sie mustert
mich.
Was ist.
Wie sagt ihr noch
gleich für œillères, sagt sie. Wenn man
… Sie wölbt die Hände um die Augen.
Scheuklappen.
Ja.
Scheuklappen.
Ich wende mich von
ihr ab.
Ich habe mit meiner
Tante gesprochen, sagt sie. Sie hat mir Vorwürfe gemacht, weil ich
dich über Weihnachten alleingelassen habe.
Ich war nicht
allein.
Non.
Non. Erinnerst du dich an den
Weihnachtslichterkettenerfinder.
Der junge Mann, der
deinen Vater sprechen wollte. Bitte stell das Gehirn zurück,
Audray.
Gleich.
Du hast Weihnachten
mit einem Weihnachtslichterkettenerfinder verbracht.
Mit wem könnte man
Weihnachten besser verbringen.
In der
Tat.
Ich betrachte das
Gehirn von allen Seiten. Wo ist die Medulla oblongata.
Wo.
Verlaine klopft sich
auf die Schenkel. Na schön, sagt sie. Allons-y.
Ich hätte da noch
eine Frage.
Sie steht in der Tür
und hat die Hand schon am Lichtschalter.
Onkel Thoby hat
gesagt, du warst im Krankenhaus.
Sie lässt die Hand
sinken. Am besten gar nicht hinsehen.
Meine Frage lautet:
Hast du eine bewegende Rede gehalten. Am Bett von meinem
Dad.
Eine bewegende
Rede.
Hast du mit ihm
gesprochen.
Schon
möglich.
Über
mich.
Non.
Hast du insgeheim
über mich gesprochen.
Wie soll ich das
verstehen.
Hast du insgeheim
über mich gesprochen und nur so getan, als ob nicht.
Non.
Insgeheim. Ich werfe
ihr einen verstohlenen Blick zu.
Keine
Antwort.
Ich meine ja nur.
Vielleicht hätte er die Augen geöffnet, wenn du über mich
gesprochen hättest.
Er hat sie aber nicht
geöffnet.
Aber du hast es
versucht.
Ich habe es
versucht.
Ich nicke. Ich stelle
das Gehirn ins Regal zurück. Auf dem Weg nach draußen sehe ich,
dass die Stoppuhr von meinem Dad am Kleiderständer hängt. Sie ist
bei 10:02:48 stehengeblieben. Mein Dad hat bei 10:02:48 die
Stopptaste gedrückt. Kann ich die mitnehmen. Und behalten, frage
ich.
Die kannst du
behalten, ja.
Im Civil Manor liegt
Judd mit den Armen über der Decke im Bett und schläft. Ich lege
mich auf ihn. Seine Arme umschließen mich wie eine Mauer. Draußen
lässt der Wind nach.
Hast du ihn
gefunden.
Nein.
Das lässt doch
hoffen.
Ich nicke an seinem
Hals.
Die Stoppuhr piekst.
Was ist denn das, fragt er.
Ich ziehe sie heraus.
Die Uhr läuft wieder. Ein Verdächtiger weniger, sage
ich.
Ich treffe mich im
Snark, der Cafeteria des Fachbereichs, mit Patience zum Mittagessen
und frage sie nach dem Humouse House und Leonel de Tigrel. Ob sie
je davon gehört habe.
Sie verdreht die
Augen. Hör mir bloß auf.
Also ja.
Nein. Aber die Namen
sind schon schlimm genug.
Ich teile ihr mit,
dass Wedge, die kostbare Hausmaus meiner Kindheit, verschwunden
ist. Und wenn ich kostbar sage, meine ich kostbar. Zwei Millionen Dollar, wenn nicht mehr.
Ich hebe die Augenbraue, als ob ich sagen wollte: Bist du sicher,
dass du mir nichts zu beichten hast.
Sie sitzt mir im
Schneidersitz gegenüber und hört mich an. Die Sessel sind riesig
und aus Leder. Sie will wissen, ob ich schon einmal vom Victim
Impact Statement gehört hätte.
Nein. Was ist
das.
Eine Stellungnahme
vor Gericht, bei der das Opfer einer Straftat Gelegenheit erhält,
die Konsequenzen sozusagen aus erster Hand zu
schildern.
Ich bin noch immer so
sehr auf Wedge fixiert, dass ich denke, es gehe um
ihn.
Es kann vielleicht
nicht schaden, wenn du ein solches Statement aufsetzt.
Da wird mir klar,
dass sie von meinem Dad spricht. Und den Leuten, die ihn
niedergemäht haben. Und von mir.
Letzten Endes musst
du irgendwie damit fertigwerden.
Ich nicke. Ich
überfliege meine Liste von Verdächtigen. Letzten Endes, sage ich,
brauche ich die E-Mail-Adressen der Studenten von meinem
Dad.

Mein Dad sagte immer,
ich sei chalant. Ein verlorengegangener Positiv. Nonchalance, sagte
er, sei die Gleichgültigkeit gegenüber dem Rätselhaften und
Geheimnisvollen. Und damit eine der schlimmsten Eigenschaften, die
ein Mensch überhaupt haben könne. Also lass dir deine Chalance
nicht nehmen.
Je nun. Patience ist
reichlich nonchalant. Aber davon lasse ich mich nicht beirren.
Gleichgültig gegenüber dem Rätselhaften und Geheimnisvollen ist so
ziemlich das Letzte, was ich bin.
Noch am selben Nachmittag schicke ich
sämtlichen Studenten auf der Liste eine E-Mail. Betreff:
C’est-difficile-Epidemie
Hiermit möchte ich Euch darauf aufmerksam ma-
chen, dass das antibiotikaresistente Superbakte-
rium C’est difficile derzeit unter den Versuchsna-
getieren im Raum St. John’s zirkuliert. Falls Ihr in
den vergangenen sieben Tagen mit einem Versuchs-
tier (Haustiere inbegriffen) in Kontakt gekommen
seid, möchte ich Euch bitten, morgen früh um 10
zur ambulanten Behandlung beim Studentischen
Gesundheitsdienst vorstellig zu werden.
Schönen Gruß,
Denise Cavalier-Smith
Beauftragte für Studentengesundheit
Ich reibe mir die
Hände. Was für eine clevere kleine Mausefalle. Mon Dieu, que c’est facile!
Bis die erste Antwort
eintrudelt. Und dann noch eine. Und noch eine.
Es heißt C. difficile, du Schwachkopf.
So kann es kommen,
wenn die Verdächtigen einen höheren IQ haben als man
selbst.
Dessen ungeachtet
warte ich am nächsten Morgen vor dem Studentischen
Gesundheitsdienst, in der Hoffnung, dass vielleicht doch jemand
aufkreuzt, der das Handtuch wirft und ein Geständnis ablegt: Ich
war’s. Ich habe deinen Dad geliebt und wollte seine Maus haben. Ich
kümmere mich liebevoll um sie.
Das glaube ich dir.
Trotzdem kannst du sie nicht behalten.
Ich warte und warte,
aber niemand kommt.
Mon Dieu, que c’est
facile, die Namen der Leute zu ermitteln, die meinen Dad auf
dem Gewissen haben. Ich frage Jim Ryan, und er verrät sie mir. Er
wusste von Anfang an Bescheid. Er hat diese Information seit der
Kollision für sich behalten. Als er von der Sache mit meinem Dad
erfuhr, rief er als Erstes einen seiner alten Kollegen von der Stab
an.
Die Namen: Gill und
Tina Tilley.
Ich brauche sie für
das Victim Impact Statement, erkläre ich. Betonung auf Impact. Impakt. Aufprall. Kollision. Mit allen
Konsequenzen.
Hältst du das für
eine gute Idee.
Keine
Sorge.
Und so finden Judd
und ich uns bald darauf im Garten der Tilleys in Mount Paler
wieder. Wir schaukeln auf ihrer Schaukel und warten darauf, dass
sie nach Hause kommen.
Ich bin einfach davon
ausgegangen, dass sie zu Hause sind.
Während wir warten,
lese ich Judd mein Victim Impact Statement vor. Er
weint.
Ich springe auf und
halte seine Schaukel an. O nein. Das wollte ich nicht.
Das wird sie
umbringen, sagt Judd, und wischt sich mit seinem blauen Fäustling
die Tränen aus den Augen.
Genau das soll es
auch. Nur zum Weinen bringen sollte es dich nicht. Ich schlinge die
Arme um seinen Kopf. Er wehrt sich nicht.
In meinem VIS steht,
dass mein Dad Weihnachten und Wahlen liebte. Und dass die Tilleys
nicht nur meinem Dad das Leben und sein demokratisch verbrieftes
Wahlrecht genommen, sondern die gesamte Menschheit ihrer
potenziellen Unsterblichkeit beraubt
haben, weil Walter Flowers ein bahnbrechender
Wissenschaftler war, der so kurz
(was ich an dieser Stelle mit Daumen und Zeigefinger zu
veranschaulichen gedenke) davorstand, uns allen ewiges Leben zu
schenken, abgesehen von Unfällen und Mord (anklagender Blick zu
Gill Tilley, der am Steuer saß).
Das mit der
Unsterblichkeit ist vielleicht ein bisschen übertrieben, sage ich
zu Judd und falte das Statement zusammen.
Es wird langsam
dunkel. Wir stapfen durch den Schnee zu einem Hinterfenster ohne
Gardinen. Judd hebt mich hoch. Durch eine offene Tür kann ich den
Baum sehen.
Hat er eine
Delle.
Das ganze Lametta an
seiner Mordwaffe würde meinem Dad bestimmt nicht gefallen. Heiliger
Strohsack. Ich muss lachen.
Judd lässt mich
herunter.
Ich drehe mich um und
lehne mich gegen die Hauswand. Ich lache mich fast kaputt. Judd
hält mir mit einem Fäustling den Mund zu. In der Einfahrt hält ein
Auto.
Eine Frau ruft:
Reenie, bring deine Dora rein.
Ein kleines Mädchen
mit baumelnden Fäustlingen und Korkenzieherlocken kommt um die
Ecke. Zuerst sieht sie die Fußspuren im Schnee. Die schnurstracks
zu ihrer Schaukel führen. Eigentlich hatte sie vor dem Abendessen
noch rasch ein wenig schaukeln wollen. Jetzt wendet sie den Kopf.
Langsam. Judd winkt ihr mit der Hand, die nicht auf meinem Mund
liegt. Reenie (kurz für was, Sabrina, Marina, Irena) Tilleys Augen
werden immer größer, und ich weiß, dass ich ein VIS, das aus ihrem
lamettageschmückten Weihnachtsbaum einen Totschläger macht, an dem
Haare, Hirn und Knochensplitter kleben, nicht werde verlesen
können. So weit reicht mein Mut denn doch nicht.
Sie
schreit.
Mir sinkt das Herz in
die Kniekehlen. Judd lässt die Hand sinken. Gill Tilley kommt um
die Ecke gerannt.
Er sieht nicht wie
ein Mörder aus. Kein bisschen.
Hallo, sage
ich.
Hallo.
Sein Blick verrät
keinerlei Misstrauen. Er verzieht den Mund zu einem konfusen
Grinsen, das eher Willkommen in meinem Garten zu bedeuten scheint
als Wer, zum Teufel, seid ihr, potenzielle Einbrecher.
Wir haben nur Ihre
rosa Außenwandverkleidung bewundert, sagt Judd.
Gill sieht an seinem
Haus empor.
Ich wollte, ich hätte
nicht an das Wort Hirn gedacht. Denn in
meiner Fantasie ist der Baum jetzt über und über damit behängt. Was
natürlich gar nicht sein kann. Der Baum hat meinem Dad nicht den
Schädel gespalten. Oder doch. Und will ich das überhaupt
wissen.
Nein.
Es ist vermutlich
nicht einmal derselbe Baum. Die Tilleys würden einen Baum, der
einen Menschen erschlagen hat, niemals behalten oder gar schmücken.
Sie würde die neue Dora-Puppe ihrer Tochter niemals unter einen
solchen Baum legen. So pervers sind sie nicht. Herrgott, das sieht
man doch schon an der Frisur des Mädchens.
Wir steigen in den
Van.
Das war komplette
Zeitverschwendung, sage ich.
Nein, das finde ich
nicht.
Ich knülle mein
Victim Impact Statement zusammen.
Das Dumme ist: Wenn
man einmal angefangen hat, Detektiv zu spielen, kann man nur schwer
wieder damit aufhören. Ich sehe aus dem Fenster, und da, in der
Einfahrt der Tilleys, steht der Pick-up Truck. Ich bin an ihm
vorbeigelaufen, ohne ihn zu bemerken. Moment mal, sage ich zu
Judd.
Der Truck ist ein
alter Ford. Marineblau mit rechteckigen Scheinwerfern. Ich umrunde
ihn einmal und gehe dann zum Van zurück.
Okay, fragt
Judd.
Okay.
Wir sind gerade auf
der Harbour Arterial, als ich sage: Müsste er nicht eigentlich zwei
Außenspiegel haben. Du hast schließlich auch zwei
Außenspiegel.
Judd sieht mich
fragend an.
In die Fahrbahn der
Harbour Arterial sind schmale Metallstreifen eingelassen, und wenn
man darüberfährt, pumpern die Reifen wie ein Herz. Ba-bam.
Ba-bam.
Und wäre ein Baum,
der von der Ladefläche dieses Trucks hängt, tatsächlich auf einer
Höhe mit der Medulla oblongata. Ba-bam. Ich frage nur.
Kommt auf die Höhe
der Medulla oblongata an, meint Judd.
Ich nicke.
Ba-bam.
Soll ich umdrehen,
fragt er.
Ich
nicke.
Eigentlich habe ich
etwas gegen Leute, die gleich nach Weihnachten ihre Tannenbäume
entsorgen. Aber heute will ich eine Ausnahme machen. Wir fahren
noch einmal durch Mount Paler, und es dauert keine Viertelstunde,
bis wir einen Weihnachtsbaum gefunden haben, der bäuchlings in der
Gosse liegt.
Hältst du das für
eine gute Idee, sagt Judd, als wir ihn in den Van hieven.
Vielleicht sollten wir erst mal darüber nachdenken, ob das wirklich
eine gute Idee ist.
Ich sehe ihn an.
Okay.
Und so machen wir es
uns mit dem Baum im Laderaum des Vans gemütlich und denken scharf
nach. Warum soll das keine gute Idee sein.
Zum Beispiel weil du
damit die Grenze zwischen Ermittlung und Nachstellung des
Tathergangs überschreitest.
Ich nicke. Ich
überfliege meine Liste. Gestern noch lag die Zahl meiner hiesigen
Verdächtigen bei null. Aber mit Gill Tilley ist sie auf eins
gestiegen. Zugegeben, er ist in einem anderen Fall verdächtig. Oder
doch nicht. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht.
Ich falte meine Liste
zusammen.
Warm
genug.
Ja. Ich hole tief
Luft. Riechst du den Baum.
Er riecht
fantastisch.
Judd erzählt mir,
dass er als kleiner Junge einmal einen Tannenbaum gerettet habe,
der einen Tag nach Weihachten die Straße entlangwehte. Er wollte
ihn behalten. Seine Eltern hatten nichts dagegen. Dabei sind
Weihnachtsbäume, äh, eigentlich nicht koscher.
Du hast einen
Tannenbaum gerettet.
Er war noch grün und
lebendig, sagt er. Er hatte bloß Durst.
Hast du ihn mit
Lichterketten geschmückt.
Und ob.
Ich starre zur
Ladeklappe hinaus. Es ist dunkel. Das Problem ist: Ich weiß nicht,
wie es weitergehen soll. Wir können natürlich noch einmal zu den
Tilleys fahren, den Baum auf die Ladefläche ihres Trucks legen und
uns ausmalen, wie er sich heimlich, still und leise von hinten
angeschlichen hat an den Kopf von meinem Dad. Und ich kann mir den
fehlenden Spiegel aus der Nähe ansehen. Und vielleicht kann Judd
sich neben den Truck stellen. Seine Medulla oblongata müsste mit
der von meinem Dad ungefähr auf einer Höhe liegen. Und vielleicht
kommt Gill Tilley sogar aus seinem rosa Haus und muss erkennen,
dass wir keine bloßen Bewunderer seiner Außenwandverkleidung sind.
Ihm wird klar, was wir im Schilde führen. Und selbst wenn er dann
sagt: Ja, Ihr Dad wurde nicht von einem Weihnachtsbaum, sondern von
einem Außenspiegel erschlagen, oder: Er wurde von beidem
erschlagen, oder: Ja, der Weihnachtsbaum lag ein wenig höher als
eine Medulla oblongata, aber Ihr Dad befand sich gerade auf einer
Schneewehe. Und ich hatte keine Ahnung, dass der Baum in
Mordwaffenstellung von meinem Truck hing. Ich hatte keinen blassen
Schimmer. Es war ein Unfall. Ein dummer Zufall. So was kommt
vor.
Ich
weiß.
Trotzdem komme ich
der Lösung damit keinen Schritt näher.
Fahren wir nach
Hause, sagt Judd.
Würdest du mir
freundlicherweise erklären, was du mit »nach Hause«
meinst.
Zimmer
203.
Und was ist mit dem
Tannenbaum.
Den bringe ich in den
Laden.
Wir können ihn ja
wohl schlecht wieder auf die Straße werfen.

Alle übrigen Verdächtigen sind nicht von hier. Noch
immer keine Nachricht von Onkel Thoby. Ich hole tief Luft und
beschließe, Großmutter anzurufen. Was kann es schon schaden. Ich
tippe die Nummer ein. Kein Klingelzeichen. Nichts. Genau wie bei
Toff.
Ich lasse den Kopf
hängen.
Haben Sie die
Landesvorwahl gewählt, sagt eine matte Stimme.
Ich hebe den Kopf.
Hallo.
Hier ist die
Vermittlung.
Vermittlung. So was
gibt’s noch.
Die Landesvorwahl,
sagt sie. Und sie klingt entnervt, als habe sie all meine
fehlgeschlagenen Versuche, in England anzurufen, mitverfolgt und zu
guter Letzt das Handtuch geworfen und eingegriffen, wenn auch nicht
allzu beherzt.
Ähm. Die
Landesvorwahl. Eine Landesvorwahl habe ich, glaube ich, noch nie
gewählt.
Das ist Ihr
Problem.
Ich habe einen
niedrigen IQ, sage ich.
Das tut mir
leid.
Ich rechne eigentlich
nicht damit, dass sie da ist. Uneigentlich schon. Und sie ist da.
Sie klingt außer Atem, als sei sie gerade eine Treppe
heraufgekommen, aber sonst scheint sie gesund und
munter.
Hallo. Wer ist da.
Sprechen Sie.
Was sagt man in so
einem Moment. Ach, ich dachte, du stehst an der Schwelle des Todes,
liegst im Koma oder doch wenigstens im Krankenhaus und legst
Patiencen. Dabei bist du zu Hause. Steigst Treppen. Welch ein
Glück. Ich bin ja so froh. Übrigens, wo steckt eigentlich dein
ungeliebter Sohn. Der Sohn, der noch am Leben ist. Hast du ihn
gesehen. Hast du Weihnachten mit ihm gefeiert.
Was hast du mit ihm
gemacht.
Sie wohnt jetzt in
London. Sie sieht schlecht. Und hat eine Pflegerin, die anscheinend
nicht ans Telefon geht. Mein Dad hat mir irgendwann erzählt, sie
habe das Cluedospielbretthaus verkaufen müssen, weil es ihr zu viel
geworden sei. Wann habe ich das letzte Mal mit ihr gesprochen. Ich
habe nicht die leiseste Ahnung. St. John’s und London haben nur
selten miteinander telefoniert. Ich wollte, ich hätte mir einen
Notizzettel zurechtgelegt. Damit ich mich nicht verzettele. Zu
spät.
Hier ist Audrey,
Großmutter.
Schweigen.
Hol erst mal tief
Luft, sage ich aufmunternd.
Ich brauche nicht
tief Luft zu holen.
Du klingst völlig
…
Ich habe gerade einen
Tisch umgeworfen.
… aus der Puste. Wie
geht’s dir.
Ich lebe
noch.
Ach.
Schön.
Wen möchtest du
sprechen. Mich ja wohl kaum.
Meine
Güte.
Onkel Thoby, sage ich
stockend. Ist er da. Hast du ihn gesehen.
Wen.
Oje, das hört sich
gar nicht gut an.
Onkel Thoby,
wiederhole ich.
Lange
Pause.
Pass auf, wer auch
immer du bist. Ich bin verwirrt. Ich bin alt. Ich bin zu alt, um
mich daran zu erinnern, was du nicht wissen darfst.
Ähm, ja. Also, wenn
du Onkel Thoby siehst, würdest du ihm dann bitte ausrichten, dass
er mich anrufen soll.
Gern. Ich schreib’s
mir auf.
Das Bett ist
ungemacht. Ich krieche unter die Decke. Das muss eins der
schlimmsten Gefühle aller Zeiten sein: In Jeans unter der Bettdecke
zu liegen. Dann steh auf und zieh die Jeans aus. Nein.
Okay, ein noch
schlimmeres Gefühl: dass mir von meiner Familie nur noch Großmutter
und Toff geblieben sind. Dass die Menschen, auf die es ankommt, die
ich liebe, verschwunden worden und meine einzigen Verwandten
Menschen sind, die ich hasse und die mich hassen.
Ich habe das
untrügliche Gefühl, dass ich mir den Kampf zwischen Toff und Onkel
Thoby nicht nur eingebildet habe, sondern dass dieser Kampf
tatsächlich stattgefunden und Onkel Thoby ihn verloren hat. Und
dass ich das falsche Rätsel lösen wollte, das eigentliche oder die
eigentlichen Rätsel meine deduktiven Detektivfähigkeiten jedoch so
sehr übersteigen, dass ich sie nicht nur niemals lösen, sondern sie
noch nicht einmal als Rätsel erkennen werde, die es zu lösen
gilt.
Ich bin zu alt, um mich daran zu erinnern, was du nicht
wissen darfst. Ich glaub, ich spinne.
Ich weiß noch, wie
ich eines Nachts, als Toff und Großmutter zu Besuch waren, wach
wurde, und außer ihnen war niemand im Haus. Onkel Thoby war im
Civil Manor. Das wusste ich. Toff lag im Keller und schlief.
Großmutter schnaufte im Gästezimmer. Aber wo war mein Dad. Mein Dad
war nicht in seinem Zimmer.
Ich ging nach
unten.
Ich fragte Wedge:
Hast du ihn gesehen.
Wedge kaute an seinen
Nägeln.
Ich holte eine
Taschenlampe aus dem Küchenschrank und schlich die Kellertreppe
hinunter. Ich hörte Toffs albernes Geschnarche. Ich ließ den Strahl
der Taschenlampe durchs Zimmer wandern. An den Wänden hingen gleich
fünf RAUCHEN-VERBOTEN-Schilder. Meiner Wenigkeit sei
Dank.
Damals war der Keller
noch kein Flugzeug. Höchstens ein Flugzeugembryo.
Ich leuchtete Toff
ins Gesicht. Er schlief auf dem Rücken, und sein Bart lag über der
Decke. Igitt.
Keine Spur von meinem
Dad.
Ich ging in sein
Zimmer. Ich sah unter dem Bett nach. Allmählich kriegte ich es mit
der Angst. Ich weinte in den Heizungsschlitz. Wo war
er.
Wo bist du.
Ich ging wieder in
mein Zimmer und kroch ins Bett. Es roch immer noch nach dem Lysol,
mit dem ich den Toffgestank beseitigt hatte. Ich zog mir die Decke
mit den galoppierenden Pferden über den Kopf und versuchte, ans
Galoppieren zu denken. Wie ich eines Tages auf Rambo dahinjagen und
keiner seiner vier Hufe den Boden berühren würde. Schließlich
schlief ich ein.
Am nächsten Morgen
war mein Dad in der Küche und kämpfte wie üblich erfolglos mit den
Kaffeefiltern.
Kannst du mal. Er
zeigte auf die Packung.
Nein.
Am liebsten hätte ich
ihn getreten. Stattdessen rammte ich ihm den Kopf in den
Magen.
Was soll denn
das.
Ich trat ihm auf den
bestrumpften Fuß, und zwar fest.
Au.
Ich hatte eine
Montage, in der ich ein armes Waisenkind war.
Er legte mir behutsam
die Hände auf den Kopf. Ach, Schätzchen.
Ich rufe Verlaine an.
Ich sage, ich sei bei den Leuten gewesen, die meinen Dad auf dem
Gewissen haben, aber sie seien keine Mörder.
Schweigen.
Ich sage, ich sei der
Lösung des Rätsels keinen Schritt näher.
Welches Rätsel,
Audray.
Eben. Welches Rätsel.
Der Rätsel sind so viele. Ich erzähle ihr, was Großmutter gesagt
hat.
Darf ich dir einen
Vorschlag machen.
Okay.
Mach dich auf die
Suche.
Nach
Wedge.
Nach deinem
Onkel.
Du meinst, ich soll
in ein Flugzeug steigen.
Ich meine, du sollst
in ein Flugzeug steigen.
Abnach unten. Auf halber Treppe bleibe ich stehen und
setze mich auf eine Stufe. Zurre meinen Pferdeschwanz ein wenig
fester. Gürte meine Lenden. Und besteige tapfer das Flugzeug im
Keller.
Es sieht unverändert
aus. Leere Sitze. Gemalte ovale Fenster. Der Getränkewagen steht im
Mittelgang. Die einzige Neuerung ist der Pilotensessel. Der neue
Sessel dreht sich. Ich starre in die Ferne, wie Onkel Thoby sie
sah. So viele Flugzeuge, so weit weg und doch so nah. Noli me tangere.
Ich wirbele herum und
lasse den Blick über die leeren Sitzreihen schweifen. Wedge, rufe
ich. Vielleicht geschieht ein Wunder, und er erscheint und kommt
mit offenen Armen angerannt.
Hier spricht Ihr
Pilot. Äh. Wo sind meine Passagiere. Wo seid ihr. Wedge. Onkel
Thoby. Dad. Wo.
Man löst ein Rätsel
nicht, indem man zu den gewonnenen Erkenntnissen immer neue
hinzuaddiert. Man löst ein Rätsel, indem man das subtrahiert, was
man bereits zu wissen glaubt. Man zieht eine Vermutung nach der
anderen ab, bis die Wahrheit und nichts als die Wahrheit übrig
bleibt. Dann stellt man noch einmal die Frage: Wo seid
ihr.
Und von irgendwo
kommt unverhofft ein Stimmlein her. Da drüben.
Ich öffne die Tür des
Getränkewagens. Flaschen, Flaschen, überall. In jeder Schublade.
Leer, kreuz und quer. Wie Kraut und Rüben durcheinander. Schenkt
ein den Piratensherry.
Ach, armer, armer
Onkel Thoby.
Irgendwo hier muss
sie sein. Onkel Thoby hat gesagt, die Tasche mit den »Effekten« von
meinem Dad sei hier im Keller. Ich verstand nicht, was er damit
meinte. Dabei sind die »Effekten« offenbar weiter nichts als das,
was mein Dad zum Zeitpunkt der Kollision an- beziehungsweise bei
sich hatte. Das CRYNOT-Armband war in der Tasche. In der Nacht, als
ich ankam, musste Onkel Thoby das Armband aus der Tasche kramen.
Warum. Damit ich Darren Lipseed anrufen und mich von ihm darüber
belehren lassen konnte, dass es verschiedene Stufen des Totseins
gibt.
Die Tasche mit den
Effekten ist unter einem Flugzeugsitz versteckt. Verstaut.
Handgebäck.
Nicht hineinschauen.
Nur hineingreifen. Feucht. Die Kleider sind noch feucht. Wie kann
das sein.
So lange ist es doch
noch gar nicht her.
Doch.
Nein.
Ich greife ein
zweites Mal hinein. Taste nach dem Portemonnaie von meinem Dad. Ist
es da. Ja. Eigentlich wollten wir das längst ins Reine bringen,
haben es aber nicht getan. Die Effekten sind bis heute nicht im
Reinen.
Ich nehme das
Portemonnaie, verstaue die Tasche und laufe durch den Mittelgang
ins Bad. Ich muss mich erbrechen. Ich muss den Kopf in die
Toilettenschüssel stecken und mich erbrechen. Die Stoppuhr um
meinen Hals ist mir im Weg. Aus dem Weg. Ich will mich erbrechen.
Oh, pardon. Endlich, nachdem ich Seife, WD-40, hektoliterweise
Kaffee und Gottweißwas zu mir genommen habe, kann ich mich
erbrechen.
Oder auch nicht.
Wahrscheinlich würden sich die meisten Leute erbrechen, wenn sie
auf eine Tasche mit den Effekten von ihrem Dad gestoßen wären. Die
meisten Leute würden sich erbrechen, wenn sie das letzte noch
verbliebene Stockwerk des Hauses betreten und ihren Dad darin
endgültig tot gemacht hätten. Aber was ich auch zu mir genommen
habe, es ist nicht erbrechbar. Vielleicht bin aber auch einfach
nicht der klassische Erbrecher.
Ich setze mich auf
den Badezimmerfußboden. Die Stoppuhr läuft vorwärts, wird aber
früher oder später zwangsläufig wieder bei null landen und von vorn
beginnen. Immer und immer wieder. Vorwärts und doch im Kreis. Jetzt
habe ich die Uhr, das Armband und das Portemonnaie von meinem Dad.
Ich fliege nach England. Schenk mir Mut, Flugzeug im Keller. Mut
und Neugier.
Durch die offene Tür
kann ich Onkel Thobys Bett sehen und darunter, unter anderem, drei
Pizzakartons. Die Lichterketten Modell D-434. Wieder ein Rätsel
gelöst.
Das Bett sieht aus
wie ein Bett, in dem schon lange niemand mehr geschlafen hat. Und
ich frage mich, ob er vielleicht hier unten im Flugzeug saß und
nicht geschlafen hat, während ich am Küchentisch saß und nicht
geschlafen habe.
Ach, armer, armer
Onkel Thoby.
Subtrahiere, was du
zu wissen glaubst.
Ich rappele mich
hoch. Neben dem Bett steht ein gerahmtes Foto von meinem Dad. Die
Qualität ist nicht besonders gut. Es ist ein Polaroid. In dem
Rahmen steckt ein ovales Passepartout, aus dem sein Gesicht
hervorschaut wie aus einem Flugzeugfenster. Das Oval scheint meinem
Dad ganz und gar nicht zu behagen. Trotzdem sieht er mich liebevoll
an. Weil ich das Foto gemacht habe. Das weiß ich genau. Er liest.
Am unteren Rand des Ovals schimmert das Weiß der
Seiten.
Wann habe ich dieses
Bild geknipst.
Mit der Kamera habe
ich unendlich viele Fotos geschossen. Eine Zeit lang gab es für
mich nichts Schöneres als Polaroids.
Wo ist er. Ich
versuche, über die Grenzen des Ovals hinauszublicken. Das Foto
steht seit Jahren hier, und ich habe noch nie über die Grenzen des
Ovals hinausgeblickt.
Eins ist mir
inzwischen klar: Man kann ein Bild aus
einem Rahmen nehmen. Als Kind hätte ich das nicht gewagt. Befand
sich ein Bild einmal hinter Glas, war es dort zu Hause. Um es
herauszuholen, musste man dem Foto in den Rücken fallen. Und das
war nicht ganz einfach. Denn am Rücken des Fotos gab es einen
Mechanismus, und wie funktionierte der. Dazu war ich nicht
intelligent genug. Ich hätte natürlich, wie beim Zauberwürfel, eine
Waffe zu Hilfe nehmen und das Ding aufstemmen können. Aber während
ich dem Zauberwürfel ohne Zögern mit einer Waffe zu Leibe rückte,
mochte ich meinem Dad oder Onkel Thoby das nicht
antun.
Wie albern. Eine
Waffe ist doch gar nicht nötig. Ja, jeder Rahmen ist anders. Manche
sind mit Samt überzogen und haben drehbare Verschlussclips. Andere
wieder sind aus Pappe, mit kleinen Nägeln, die man aufbiegen muss.
Aber das ist eigentlich alles kein Problem. So difficile ist ein Rahmen nun auch wieder
nicht.
Wenn Sie die
Rückseite entfernt haben, werden Sie vermutlich eine Schicht aus
anderem Material vorfinden, bevor Sie an das Bild gelangen.
Wellpappe, zum Beispiel, oder hauchdünnen Schaumstoff. Das
Hochglanzfoto eines gelben Labradors, das ab Werk im Rahmen
steckte. Oder ein zusammengefaltetes Stück Papier, das auf einer
Seite bedruckt und auf der anderen mit einer groben Lageskizze des
Wednesday Pond versehen ist, mit einem Pfeil, der auf Ihr Haus
zeigt. Und einer Notiz in Ihrer krakeligen Kinderschrift. Bitte
nicht abstürzen. Bitte schreib zurück. Weil Sie wussten: Wenn
jemand diese Botschaft fand, dann waren Sie noch am Leben. Waren
wir noch am Leben.
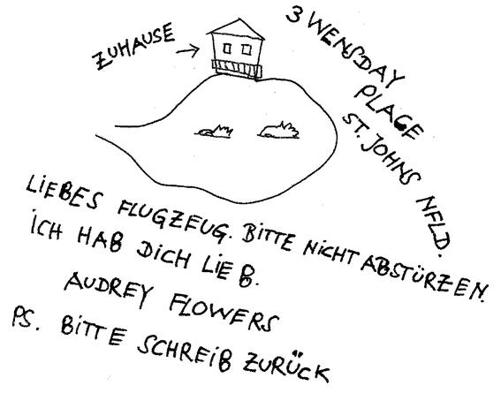
Auf der Rückseite
steht der Anfang eines Artikels. »Anstieg der Mortalitätsrate bei
alternden Mus musculus ähnlich langsam wie beim Menschen.« Autor:
Leonel de Tigrel. Nun ja, er ist einer der kleineren Autoren. Aber
er ist vermutlich immer einer der Autoren, egal welchen Artikel man
sich anschaut.
Weiter im Text. Ich
löse das Foto vorsichtig von dem Oval. Mein Dad sitzt in einem
Flugzeug.
Was mich, ehrlich
gesagt, nicht weiter wundert.
Aber er sitzt nicht
im Flugzeug im Keller. Die Sitze sehen anders aus. Die Sitze im
Keller sind blau mit schwarzen Karos. Der Sitz auf dem Foto hat
keine Karos.
Er sitzt in einem
richtigen Flugzeug. Ich habe dieses Foto gemacht. Ich erinnere mich
genau. Aber wie kommt es hierher. Ich habe es doch an Bord
gelassen. Ich habe diesen Brief und zwei Fotos in meiner Armlehne
versteckt.
Wo ist das andere
Foto.
Ich gehe im
Mittelgang auf und ab. Rüttele an sämtlichen Armlehnen. Nein, nein,
nein. Erste Reihe, Fensterplatz. Links. Und tatsächlich. Die
Armlehne lässt sich öffnen!
Wenn auch erst nach
zwanzig Minuten und unter Zuhilfenahme eines
Schraubenziehers.
Und siehe da, ein
Geheimfach. Und es ist nicht leer. Nein, es ist etwas darin. Das
andere Foto, auf dem mein Dad sich in die Kotztüte erbricht. Und
Briefe. Etwa fünfzig Briefe mit einem Gummiband darum. Ich setze
mich. Schnalle mich an. Und ziehe den ersten Brief
heraus.
Wilfred Moss
138 Welkin Way Road
London W12 2RU
United KingdomSehr geehrter Mr. Moss, Sie haben hoffentlich Verständnis dafür, dass ich Ihren mit »Das Flugzeug« unterzeichneten Brief an meine Tochter abgefangen habe. Welche »Botschaft« meinen Sie. Ihre Absichten sind zweifelsohne löblich. Ihre Situation hingegen scheint mir höchst bedauerlich. Soweit das Ihren Zeilen zu entnehmen ist. Wie habe ich mir Ihre Situation denn vorzustellen. Was für ein sonderbares Schreiben. Was Sie da schildern, scheint mir eine Form der Hemihypertrophie zu sein.Verzeihen Sie einem fürsorglichen Vater, der hiermit um Erklärung bittet.Walter Flowers
Ich sitze eine Zeit
lang still. Dann falte ich den Brief zusammen und stecke ihn in die
Armlehne zurück. Klappe sie zu. Öffne meinen Sicherheitsgurt.
Schraube die Armlehne wieder fest. Das ist nicht mein
Geheimfach.
Ach komm,
Audrey.
Kommen.
Wohin.
Hoch mit dir. Und
los.