
Teil eins
ODDLY FLOWERS
Das Flugzeug besteht aus einer Reihe goldener Kreise
und dem Cockpit. Einer dieser Kreise wird meinen Kopf gleich
heimwärts tragen. Ich zähle vierzehn Kreise ab. Der da. Die Piloten
vorne im Cockpit sind ziemlich gut drauf. Sie lachen sich fast
kaputt. Meine Herren, sie müssen sogar ihre Kaffeetassen abstellen.
Der eine legt dem anderen die Hand auf die Schulter. Dann drückt er
ihm einen Kuss auf die Wange. Einen flüchtigen, spontanen
Schmatz.
Eine Mitreisende
tritt neben mich ans Fenster des Terminals. He, sage ich. Unsere
Piloten haben sich gerade geküsst.
Keine
Reaktion.
Ich glaube, dieser
Kuss ist ein gutes Omen für unseren Flug.
Sie tut so, als
müsste sie dringend einen Pappbecher entsorgen.
Das ist mein
Flugzeug. Die Buchstaben am Heck bilden das Wörtchen NAP.
Nickerchen. Wie finde ich denn das. Gar
nicht gut.
Mein Handy klingelt.
Es ist Linda.
Was
gibt’s.
Winnifred rührt sich
nicht.
Halte eine
Schildkröte niemals für tot. Regel Nummer Eins für
Schildkrötenbesitzer. Wie warm ist es in eurer Wohnung. Denk dran,
es ist Winter. Und noch dunkel. Sie ist nicht nachtaktiv. Das und
andere Umweltfaktoren haben sie vermutlich bewogen, sich in ihren
Panzer zurückzuziehen. Ihr Herz schlägt etwa einmal stündlich. Hab
Geduld. Warte einfach eine Stunde.
Trotzdem kauere ich
mich am Fenster zusammen. Spüre die Hitze, die aus dem
Heizungsschlitz aufsteigt. Ist meine Schildkröte tot. Soll ich
umkehren.
Mir selber klopft das
Herz wie wild. Pulsierendes Leben. Kennen Sie dieses Gefühl auch.
Die Angst des Körpers vor dem nächsten Schlag. Nein. Ich schon. Ist
der Nächste vielleicht der Letzte. Nein. Ist der Nächste der
Letzte. Nein.
Soll ich
umkehren.
Ich sehe zu den
vermutlich verliebten Piloten hinüber und will dieses und nur
dieses Flugzeug nehmen. Es ist mein Flugzeug.
Gestern spähte ich in
ihr Schloss, und sie saß neben dem Pool und hatte das Ziel, das sie
seit zwei Tagen ansteuerte, noch immer nicht erreicht. Ich klopfte
auf ihren Panzer. Hallo, Winnifred.
Nichts zu sehen.
Weder die Beine. Noch ihr kleiner alter Kopf.
Ich hob sie hoch und
klemmte sie mir unter die Achsel. Normalerweise genügt das. Ich
habe zwar auch eine Wärmelampe, aber Schlösser aus Papier sind nun
einmal leicht entflammbar.
Schließlich wachte
sie auf.
Na also, sagte ich
und setzte sie in den Pool.
Ich kniete mich neben
das Schloss mit den Fenstern, aus denen man in meine Küche schaut.
Ich habe schon oft gesehen, wie Winnifred den Kopf wehmütig aus
einem dieser Fenster streckt. Und wie eine Andeutung ein Salatblatt
fallen lässt.
Sie kletterte aus dem
Pool und kroch schwerfällig zum Fenster.
Ich muss für ein paar
Tage nach Hause, sagte ich.

Winnifred ist alt.
Dreihundert, wenn nicht älter. Sie war schon da, als ich einzog.
Mein Vormieter, ein Kletterer namens Cliff, wollte zu einer
Klettertour aufbrechen, die Winnifred wahrscheinlich wenig Freude
bereitet hätte. Damals hieß sie noch Iris. Cliff hatte Iris von
seinem Vormieter geerbt. Niemand wusste, wie viele Jahre Iris auf
dem Panzer hatte oder wer ihr ursprünglicher Besitzer war. Jetzt
zog Cliff aus. Möchtest du eine Schildkröte, fragte
er.
Zu einer Schildkröte
würde ich nicht Nein sagen, sagte ich.
Ich war allein in
Portland, und die Bäume waren riesig. Ich hob sie hoch, und sie
blinzelte mich mit ihren schweren Lidern an. Sofort wurde ich
seelenruhig. Ihre Augen waren zartbraun. Ihre Haut fühlte sich wie
ein alter Ellenbogen an. Ich bau dir ein Schloss, flüsterte ich.
Mit Pool. Und ich hielt Wort.
Klemm sie dir unter die Achsel, sage ich zu Linda.
Igitt.
Nur keine
Hemmungen.
Ich lege
auf.
Das war unhöflich,
aber es geht mir nicht besonders. Ich bin unausgeschlafen. Ich bin
auf Autopilot. Wobei mir die beiden Piloten einfallen, bei denen
das eindeutig anders ist. Was heißt eigentlich Autopilot. Ich
stelle mir einen aufblasbaren Piloten vor, aber das habe ich aus
einem Film. Ein Autopilot ist nichts weiter als ein Computer. Er
fliegt die Maschine, wenn die Piloten ein Nickerchen machen oder
knutschen. Er springt sozusagen automatisch an, wenn der eigene Dad
im Komma, pardon, Koma liegt, man nach Hause gerufen wird und für
die Unterbringung seiner Schildkröte sorgen muss.
Als ich gestern Abend
mit Winnifred in ihrem Schloss aus dem Haus kam, hing der Himmel
voller Sterne.
Guck mal, Win, sagte
ich. Die Vergangenheit. Denn wenn man die Sterne betrachtet, blickt
man in die Vergangenheit.
Winnifred hob den
Kopf.
Da fliege ich morgen
hin, sagte ich.
Wir fuhren nach
Oregon City, wo alle Straßen nach Präsidenten benannt sind, in der
Reihenfolge ihrer Amtszeit, damit man sich nicht verläuft,
vorausgesetzt man ist Amerikaner und kennt sich mit Präsidenten
aus. Linda und Chuck wohnen in der Taft Street. Als ich vor dem
Haus hielt, stand Chuck mit seinen Schauspielerfreunden auf dem
Gehsteig und rauchte.
’n Abend,
Chuck.
Hallo.
Als ich die Treppe
hochging, sagte einer seiner Schauspielerfreunde: Habe ich
Halluzinationen, oder hatte die gerade ein Schloss auf dem
Arm.
Jawohl, ein
Schloss.
Gleich vier Leute an
meinem Flugsteig stricken. Man darf jetzt wieder Stricknadeln mit
an Bord nehmen. Bei der Sicherheitskontrolle hing eine neue,
unmissverständliche Liste der Verbotenen Gegenstände im
Hand gepäck.
Darunter sämtliche Waffen aus dem Spiel Cluedo, minus Stricknadeln,
plus Schneekugeln.
gepäck.
Darunter sämtliche Waffen aus dem Spiel Cluedo, minus Stricknadeln,
plus Schneekugeln.
 gepäck.
Darunter sämtliche Waffen aus dem Spiel Cluedo, minus Stricknadeln,
plus Schneekugeln.
gepäck.
Darunter sämtliche Waffen aus dem Spiel Cluedo, minus Stricknadeln,
plus Schneekugeln.Ich tastete meine
Taschen ab und sagte: Wo habe ich nur meine Schneekugel
gelassen.
Die
Sicherheitsbeamtin in Blau kniff sich ins Nasenbein, als würde ich
ihr dort Schmerzen verursachen.
Gehen Sie bitte
weiter.
Gleich nach der
Sicherheitskontrolle konnte man an einem kleinen Kiosk Stricknadeln
und Wolle kaufen. Weihnachtsfarben. Stricken feiert also ein
Comeback.
Ich humpelte zu
meinem Flugsteig.
Zu Hause war ich im
Dunkeln über mein Handgepäck gestolpert. Ich lag im Dunkeln und
dachte: Ich kann nicht fliegen, ich bin verletzt. Ich lag da und
sah an die schräge Zimmerdecke, an der Cliffs Klettergriffe
unschöne Beulen hinterlassen haben. Cliff nannte die Decke nur den
Überhang.
Ich hatte ihm eine
E-Mail geschrieben: Mein Dad liegt im Komma und wartet darauf, dass
ich ihm die Augen öffne. Muss nach Hause. Wohnung steht Dir solange
zur Verfügung. Schildkröte bei Linda und Chuck.
Keine
Antwort.
Ich schrieb ihm eine
zweite Mail: Ich meinte Koma.
Ich lag auf dem
Boden. Mein Taxi mit dem kleinen Napoleonhut stand schnaufend auf
der Straße.
Hoch mit dir. Und
los.
Wenn der oder die
Richtige ans Bett des Komapatienten tritt, öffnet der Komapatient
die Augen. Weiß doch jeder. Regel Nummer Eins für
Komasituationen.
Gestern rief Onkel
Thoby an und sagte: Oddly. Es ist etwas Schlimmes passiert. Dein
Vater hatte einen Unfall.
Bei diesem Wort
musste ich mich erst mal auf den Küchenboden setzen. Einen Unfall,
sagte ich.
Ja. Er hat einen
heftigen Schlag auf die Medulla oblongata bekommen. Auf dem
Heimweg. Von, du wirst es kaum glauben, einem Weihnachtsbaum. Der
seitlich von einem Pick-up hing.
Bis zu dem Wort
Pick-up war Onkel Thobys Stimme felsenfest. Dann versagte sie. Ich
verstand nur Bahnhof. War er nun von einem Weihnachtsbaum
erschlagen worden. Oder war er auf dem Heimweg von einem
Weihnachtsbaum. Oder was.
Erschlagen. Von einem
Baum. Auf dem Heimweg.
Ich dachte eine Weile
nach. Schließlich sagte ich: Ich hätte da noch eine Frage. Bist du
bereit.
Ich bin ganz
Ohr.
Okay, los geht’s. Was
ist eine Medulla oblongata.
Der
Hirnstamm.
Aha. Ach so. Dann war
der Stamm eines Weihnachtsbaums also mit dem Hirnstamm von meinem
Dad kollidiert. Und jetzt lag er im Koma. Ich legte mir die Hand in
den Nacken. Ich hatte ganz vergessen, dass das Gehirn eine
Geografie besitzt. Das menschliche Gehirn besteht aus 1400
Kubikzentimetern Geografie. Herrgott, unser Kopf passt in ein
Flugzeugfenster. Wir sind winzig klein und können jederzeit aus
unserer Geografie gerissen werden.
Ich komm nach Hause,
sagte ich.
Der Mann in 14B liest Eine
unsterbliche Liebe von Shirley MacLaine und hat schon seit
einer Viertelstunde nicht mehr umgeblättert. Ich beobachte sein
Spiegelbild im Fenster. Shirley MacLaine schreibt blendend, warum
also blättert er nicht um. Es fällt mir schwer, den Sonnenaufgang
zu genießen, wenn ich ständig sein Buch vor Augen habe und er über
Seite 59 nicht hinauskommt.
Ich drehe mich um und
werfe einen vielsagenden Blick auf das Buch.
Er
lächelt.
Er trägt ein
Tweedjackett, einen Rollkragenpulli und ein Amulett um den Hals.
Das Amulett sieht irgendwie nach einem keltischen Symbol
aus.
Ich drehe mich wieder
zum Fenster. Ich kann Leute, die lesen, auf den Tod nicht
ausstehen.
Wir haben unsere
Reiseflughöhe erreicht. Die Sonne ist ein rotes EXIT-Zeichen. Im
Cockpit muss es sehr romantisch sein.
Ich bleibe auf der
Hut und konzentriere mich auf meine Zukunft. Wenn man sich im
Flugzeug nicht auf seine Zukunft konzentriert, hat man im
Allgemeinen keine. Weshalb ich, entgegen der ausdrücklichen
Anweisung von North America Pacific, auf ein Nickerchen im Flugzeug
grundsätzlich verzichte.
Ich habe mal ein
Interview mit einem Mann gesehen, der zwischen zwei Päpsten partout
nicht fliegen wollte. Seine Regel Nummer Eins für Flugreisen:
Fliege nie ohne einen Papst in Amt und Würden. In der Zeit zwischen
dem Tod Johannes Pauls II. und der Wahl Benedikts wollte er sich
unter keinen Umständen in einen Flieger setzen. Darum verpasste er
das große Begräbnis in Rom, bei dem er gern dabei gewesen wäre, und
damit die Gelegenheit, Johannes Pauls braunen Lederslipper mit
dessen totem Fuß darin zu berühren. Nicht zu fassen.
Ich bin nicht ganz so
abergläubisch. Aber seit meiner Kindheit (als ich oft stundenlang
Pilotin spielte und kritische Situationen wie
Fahrwerksfehlfunktionen mit Geduld und Spucke meisterte) weiß ich,
dass Flugzeuge magische Objekte sind und sie einerseits von dem
Glauben an diese Magie und andererseits von der Zuversicht der
Passagiere in der Luft gehalten werden. Ein Flugzeug, dessen
Passagiere sich entzweien, stürzt todsicher ab. Darum zügle ich
meine Wut auf meinen keltischen Sitznachbarn. Am liebsten würde ich
beherzt eingreifen und für ihn umblättern, verkneife es mir aber.
Denn das könnte mir als Feindseligkeit ausgelegt werden, und die
Zuversicht der Passagiere an Bord von Flug 880 wäre
dahin.
Komma gefällt mir
besser als Koma. Wenn ich da bin, wird mein Dad die Augen öffnen
und das Bewusstsein wiedererlangen. Ich stelle mir die Szene
bildlich vor. Ich komme herein. Das Krankenzimmer leuchtet wie ein
Cockpit. Lauter bunte Lämpchen an medizinischen Geräten. Die ihn am
Leben erhalten. Damit er uns erhalten bleibt. Sein Herz piepst. Ich
setze mich auf einen Stuhl mit Rollen untendran.
Dad.
Keine
Reaktion.
Hm. Ich muss wohl
erst mal eine Rede halten. Ja, eine bewegende Rede am Krankenbett.
Dann öffnet er bestimmt die Augen.
Ich sollte versuchen,
meine Zeit sinnvoll zu nutzen. Und mich am besten gleich an meine
Rede machen. Hier im Flugzeug.
Aber statt meine Zeit
sinnvoll zu nutzen, mustere ich meinen Sitznachbarn in 14B. Er
erinnert mich an einen Verdächtigen aus Cluedo, der betont
unschuldig im Billardzimmer herumlungert.
Er ist immer noch auf
Seite 59.
Ich glaube, es wird
langsam Zeit, ihn zur Auseinandersetzung mit Shirley MacLaine zu
zwingen. Verzeihung, darf ich mal. Aber sicher. Er steht auf. Und
lässt das Buch ohne Lesezeichen auf den Sitz fallen.
Der nicht lesende Mr.
Tweed in 14B wird mir immer suspekter.
Ich stolpere in den
Mittelgang. Im Flugzeug werden die Füße größer. Meine
jedenfalls.
Immer schön senkrecht
halten, sagt Tweed.
Geht schon.
Merci.
Ist es nicht ein
Wunder, dass ich hier herumtrampeln kann, ohne größeren Schaden
anzurichten. Dass ein Flugzeug ein richtiger Saal ist, mit Decke, Fußboden und mehreren
Toiletten. In dem wir sitzen wie ein Theaterpublikum. Ein
Theaterpublikum mit 37 000 Fuß Nichts unter den Füßen.
Mangels gangbarer
Alternativen gehe ich zur Toilette und stelle mich in die Schlange.
Ein Getränkewagen ist im Anrollen. Ein Wollknäuel kreuzt meinen
Weg. Ich gebe es seiner Besitzerin zurück. Danke. Gern geschehen.
Ich wippe auf den Fersen und lasse den Blick über die zerzausten
Köpfe schweifen. Ich habe mich schon oft gefragt, warum die ersten
Passagiere von Linienflügen sich diese Sitzordnung anstandslos
haben gefallen lassen. Warum sie nicht mit der Faust auf den Tisch
gehauen und gesagt haben: Wir wollen nicht dasitzen wie im Theater,
das sieht völlig bescheuert aus. Andererseits, welche Sitzordnung
sähe nicht bescheuert aus.
Jemand stellt sich
hinter mir in die Schlange. Tweed fühlt sich anscheinend zu mir
hingezogen.
Er nickt,
14A.
14B, sage
ich.
Das keltische Amulett
ist aus Draht und sieht aus, als ließen sich daraus auch andere
keltische Symbole formen. Vielleicht sagen diese Symbole die
Zukunft voraus oder spiegeln das wahre Ich des Trägers wider. Im
Moment hat es die Form eines knotigen Ovals. Ich sehe in das
Gesicht darüber. Ja, ein knotiges Oval. Ich werde aus dieser Miene
nicht schlau. Mr. Tweed lächelt vage, aber seine Augen starren
finster über meinen Kopf hinweg in die Kabine.
Ich folge seinem
Blick. Wen oder was hat er im Visier.
Soso. Eine unsterbliche Liebe, sage ich. Spannende
Lektüre.
Er senkt den Blick.
Wie bitte.
Als ich ein kleines
Mädchen war, hat mein Dad mir Zwischenleben vorgelesen. Eins von Shirleys ersten
Büchern. Aber wird Eine unsterbliche
Liebe nicht von ihrem Hund erzählt. Das würde meinem Dad
nämlich gar nicht gefallen. Zu disneymäßig. Stimmt doch,
oder.
Was.
Dass es von ihrem
Hund erzählt wird.
Tweed hat
Blickkontakt mit der Lenkerin des nahenden Getränkewagens
aufgenommen. Sie ist groß, mit langem Hals und dem Wort NAP quer
über der Brust.
Keine Ahnung, sagt
er.
Interessant, sage
ich. Dabei sind Sie doch schon auf Seite 59.
Shirley MacLaine hat
mit Sicherheit schon viele Reden an den Betten von Komapatienten
gehalten, und sie sind alle aufgewacht. Ja, sie alle haben die
Augen geöffnet und Shirley und ihren Hund an ihrem Bett stehen
sehen, denn wer würde dazu schon Nein sagen.
Je nun, mein Dad, zum
Beispiel. Aber sonst.
Auf dem Cover von
Eine unsterbliche Liebe knuddelt
Shirley ihren Hund, und sie haben beide genau denselben
Gesichtsausdruck.
Wenn ich mich recht
erinnere, hatte Zwischenleben ein ganz
anderes Cover. Eine deutlich jüngere Shirley am Strand. Im
Sweatshirt. Die Hände in die Hüften gestemmt. Damals hatte sie kein
knuddeliges Hündchen auf dem Arm.
Kann sein, dass
irgendwo im Hintergrund ein Hund herumsprang.
Wir haben das Buch
nicht zu Ende gelesen.
Zu einer ordentlichen Rede am Bett eines
Komapatienten gehören vermutlich:
• eine Entschuldigung für das verspätete Erscheinen am Krankenbett
• aufmunternde Worte
• eine Frage, die der Komapatient unbedingt beantworten möchte, oder
• eine unwahre Behauptung, die der Komapatient unbedingt richtigstellen möchte
• Händchenhalten
• Tränen
• das Schwelgen in Erinnerungen
• Lachen und Weinen beim Schwelgen in Erinnerungen
• ein langer Blick aus dem Fenster
• ein kurzer Moment, in dem man vergisst, dass der Komapatient im Koma liegt, gefolgt von
• verdutztem Blinzeln und Kopfschütteln
• ein erbauliches Zitat
• ein ausführlicher Bericht über die auf dem Weg ans Krankenbett vollbrachten Heldentaten
• die Lösung eines großen Rätsels
Ich bin als Nächste
an der Reihe. Da kommt der Getränkewagen. Ich drücke mich rücklings
gegen die Toilettentür. Tweed quetscht sich in eine Sitzreihe.
Mann, ist der groß, Mann. Er sieht aus wie Atlas, der die Welt auf
seinen Schultern trägt, nur dass er nicht die Welt, sondern ein
Gepäckfach schultert. Dank dieser Verrenkungen öffnet sich sein
Jackett, und das keltische Amulett schwingt wie ein Pendel hin und
her. Ziemlich hypnotisch, dieses Pendel. Es scheint mich auf etwas
hinweisen zu wollen. Guck mal, sagt es. Guck mal da. Unter dem
Jackett. Eine Waffe.
Eine
Waffe.
Ein Gegenstand, der,
wie ich mich deutlich zu erinnern glaube, nicht von der Liste der Verbotenen Gegenstände im
Hand gepäck
gestrichen wurde.
gepäck
gestrichen wurde.
 gepäck
gestrichen wurde.
gepäck
gestrichen wurde.Der Getränkewagen
rollt vorbei. Tweed tritt in den Mittelgang. Die Toilettentür geht
auf. Ich bin an der Reihe. Und muss mich entscheiden. Entwaffne ich
den Hijacker. Oder gehe ich pinkeln. Beten Sie, dass Sie so eine
Entscheidung niemals treffen müssen.
Ich zeige mit dem
Finger über Tweeds Schulter. He, da kommt der Pilot.
Dreht sich der
Trottel doch tatsächlich um. Es geht alles sehr schnell. Weil ich
blitzschnell reagiere. Der Verschluss des Holsters (ein Druckknopf,
weiter nichts!) ist offen.
Es ist erstaunlich
leicht, einen Flugzeugentführer zu entwaffnen.
Ich. Mit dem Revolver
– so es denn ein Revolver ist – auf die Toilette. Es ist kein
Revolver. Es sieht ganz anders aus als die winzige
Cluedo-Spielzeugwaffe, die ich auf meinen Dad richtete, wenn er
sagte: Zurück in den Wintergarten mit
dir.
Tweeds Waffe ist
geladen. Mit großem G. Schwer, bedrohlich. Sie hat keine Trommel.
Nein, die Kugeln schießen buchstäblich in rascher und endloser
Folge aus ihrem dunklen, geheimnisvollen Innern. So etwas nennt man
eine Knarre. Eine Kanone.
Plötzlich fühle ich
mich wie erschossen. Mir wird heiß und kalt zugleich. Ich lege die
Waffe ins Waschbecken. Und stelle mir vor, wie mir in diesem
winzigen Metallkabuff die Kugeln um die Ohren pfeifen. Meine
Herren.
Jemand hämmert gegen
die Tür. Dreimal dürfen Sie raten, wer.
Ich denke an die
beiden turtelnden Piloten und möchte am liebsten weinen vor Freude:
Sie sind in Sicherheit. Aber sind sie das wirklich. Es könnten
schließlich noch weitere Hijacker an Bord sein. Tweed ist
garantiert nicht allein. Oder wem galt dieser stählerne Blick.
Womöglich muss ich mich auf eine Schießerei einlassen, um die
Piloten zu beschützen. Bin ich dazu bereit. Und ob.
Die Sicherheit der
beiden Piloten geht mir über alles.
Draußen ist wer weiß
was los. Eine Flugbegleiterin stellt sich als Tuesday Miller vor
und sagt: Ma’am.
Ich setze mich auf
den Toilettendeckel. Tuesday Miller klingt erstaunlich gelassen. Ob
Tweed ihr ein Plastikmesser an die Kehle hält.
Die Waffe, die Sie
sich angeeignet haben, gehört einem Air Marshal.
Ich finde meine
Stimme wieder. Soso. Hat er Ihnen das erzählt.
Ma’am. Er würde es
sehr begrüßen, wenn Sie den Waschraum jetzt verlassen
könnten.
Das glaube ich
gern.
Jetzt Tweeds Stimme:
Mein Name ist Caesar Marshall. Und ich versichere Ihnen, ich
bin ein Air Marshal der Bundespolizei.
Bitte verlassen Sie den Waschraum, und händigen Sie mir meine Waffe
aus, dann haben Sie keine strafrechtlichen Konsequenzen zu
befürchten.
Ich verhandele nicht
mit Terroristen!
Gelächter. Jetzt ist
sein Mund ganz nah an der Tür. Seine Lippen berühren womöglich das
BESETZT-Zeichen. Sehe ich aus wie ein Terrorist.
Meine anfängliche
Abneigung war also durchaus berechtigt.
Gut. Sagen wir, er
ist ein Air Marshal, dessen Nachname
zufällig Marshall lautet. Trotzdem ist er insofern ein Terrorist,
als er nicht nur mich, sondern auch alle anderen Passagiere an Bord
von Flug 880 terrorisiert hat. Mit seinem grässlichen Gehämmere und
Gebrüll. Er hat unsere Zuversicht zerstört!
Außerdem fällt es mir
schwer, jetzt noch an meine Zukunft zu glauben.
Er erhebt die Stimme
und erklärt mir noch einmal, er sei wirklich und wahrhaftig ein Air
Marshal der Bundespolizei, und wenn ich die Freundlichkeit besäße,
den Waschraum zu verlassen, würde er mir seine Marke
zeigen.
Schieben Sie sie
unter der Tür durch.
Zu groß.
Wie
praktisch.
Tuesday Miller
versichert mir, sie habe Caesar Marshalls Dienstmarke soeben mit
eigenen Augen gesehen, und sie sei hundertprozentig
echt.
Expertin,
was.
Allerdings. Das habe
sie in ihrer Ausbildung gelernt. Außerdem kenne sie Caesar Marshall
schon seit zwei Jahren persönlich. Sie seien bereits mehrmals
miteinander geflogen …
Tuesday, wäre es
eventuell möglich, dass Ihnen jemand ein Plastikmesser an die
Halsschlagader hält.
Pause.
Natürlich
nicht.
Hören Sie, und wenn
Air Marshal Marshall der Direktor des Heimatschutzministeriums
höchstpersönlich wäre. Waffen sind an Bord eines Flugzeugs nicht
erlaubt. Regel Nummer Eins. Ich glaube, ich habe soeben anschaulich
demonstriert, warum es diese Regel gibt.
Vor der Tür herrscht
Schweigen. Wahrscheinlich nicken sie, weil sie sich meinem
schlagkräftigen Argument nur schwer verschließen
können.
Aber ich bin ein Air Marshal der Bundespolizei, wiederholt
Tweed.
Und wenn, dann sicher
nicht mehr lange.
Wieder Schweigen.
Wieder nicken sie, weil sie sich meinem schlagkräftigen Argument
nur schwer verschließen können.
Nicht zu fassen.
Nimmt der doch tatsächlich etwas mit an Bord, das ein Loch in
unsere Schneekugel reißen könnte. Nicht zu fassen. Am liebsten
würde ich ihn erschießen, diesen Air Marshal Marshall.
Seit einiger Zeit ist
es vor der Tür mucksmäuschenstill. Ich sehe auf meine Uhr – volle
fünf Minuten. Es kommt mir länger vor. Die Zeit schleicht dahin,
wenn man allein mit einer Waffe im Waschbecken in einem winzigen
Metallkabuff sitzt. Ich betrachte mich im Spiegel, zurre meinen
Pferdeschwanz ein wenig fester. Nein, ich spüre nichts von einer
Zukunft.
Konzentriere dich auf
deine Bestimmung. Dein Dad wartet darauf, dass du ihm die Augen
öffnest. Du hast ein Ziel, eine Zukunft. Streng dich an, und
versuche, sie dir vorzustellen.
Nichts zu machen. Wir
sind ein entzweites Flugzeug. Wir sind ein Flugzeug mit einem Air
Marshal an Bord.
Die Maschine sackt in
ein Luftloch.
Es klopft an der Tür.
Audrey.
Eine neue Stimme
dringt durch das BESETZT-Zeichen an mein Ohr. Ms.
Flowers.
Was.
Ich bin Copilot Keith
Gordon.
Ach ja.
Ja. Und Caesar
Marshall ist in der Tat ein Air Marshal. Und wir sind nicht
entführt worden. Ich gebe Ihnen mein Wort, alles ist in bester
Ordnung. Sie haben sich tapfer geschlagen. Um nicht zu sagen
heldenhaft. Aber Sie müssen jetzt herauskommen und die Waffe
zurückgeben. Sonst müssen wir unverzüglich landen. So lauten die
Vorschriften. Wenn es an Bord zu einer Situation wie dieser kommt,
müssen wir die Maschine landen.
Wo.
Cincinnatti wäre
naheliegend.
Aber ich muss nach
Hause, Copilot.
Und wo sind Sie zu
Hause. In Toronto.
Nein. Das kennen Sie
sowieso nicht.
Wo denn.
St.
John’s.
Und ob ich das
kenne.
Ach.
Bitte,
Audrey.
Ja, gut. Aber woher
weiß ich, dass er Ihnen keine Waffe an den Kopf hält oder ein sehr
scharfes weißes Plastikmesser.
Sie können mir ruhig
glauben. Es ist alles in bester Ordnung.
Aber wenn wirklich
alles in bester Ordnung ist …
Ich gebe Ihnen mein
Wort.
Und Sie sind Pilot
…
Ja.
Vor dem Start haben
Sie im Cockpit etwas gemacht. Ich habe es durchs Fenster
gesehen.
Aha.
Was habe ich da
gesehen. Sagen Sie es mir, dann komme ich heraus.
Sie haben gesehen,
wie ich den Piloten geküsst habe.
Dachte ich’s mir
doch.
Klemm du sie dir unter die Achsel. Nein,
du.
Du.
Jemand klopft auf
meinen Panzer. Winnifred.
Was.
Hallo da
drinnen.
Aber ich kann mich
nicht rühren. Wann hat mein Herz zuletzt geschlagen. Wenn ich mich
zwischen zwei Achselhöhlen entscheiden muss, nehme ich
Lindas.
Ich glaube, sie ist
traumatisiert, sagt Linda.
Sie hat
wahrscheinlich einen Schock, sagt Chuck.
Ja, einen
Kälteschock. Warum mussten sie mich auch gleich neben dem
Kühlschrank unterbringen. Immer wenn Chuck die Tür aufmacht und den
Inhalt inspiziert, weht ein eiskalter Windhauch durch mein Schloss.
Warum. Irgendjemand hat einmal gesagt, es gebe eigentlich gar keine
Kälte, nur verschiedene Wärmegrade. Was für ein Unsinn. Ein
Kühlschrank ist der beste Beweis dafür, dass Kälte etwas
Konkretes ist. Ein Kühlschrank ist ein
Rechteck aus Kälte.
Ich träume von einem
warmen Armaturenbrett.
Die Fahrt gestern
Abend war schon komisch, normalerweise fahre ich nämlich auf dem
Armaturenbrett mit (ich kralle einfach die Klauen in die
Lüftungsschlitze und klammere mich fest!), aber da ich gestern
Abend mit meinem Schloss und sämtlichem Komfort, wie sie das nennt,
umsiedeln musste, quetschte sie mich der Einfachheit halber samt
Schloss auf den wenig komfortablen Rücksitz. Ganz schön kalt da
hinten. Und ziemlich steil. Sodass ich für den Weg zum Fenster noch
länger brauchte als sonst. Als ich es schließlich geschafft hatte,
steckte ich den Kopf hindurch. Der Tacho zeigte 20 Meilen pro
Stunde. Zwanzig! Da bin ich ja schneller. Sie sagte: Welcher
Präsident kommt noch nach Harrison. Lincoln. Nein.
Ich sah mich nach
einem Salatblatt um, das ich hätte fallen lassen können. Kommt
drauf an, welcher Harrison.
Über dem
Armaturenbrett lockte flirrende Hitze. Komm herbei,
Schildkröte.
Da ist es, sagte sie.
Taft Street.
Worauf ich treppauf
befördert und in Lindas Obhut übergeben wurde. Als sie ging,
steckte ich den Kopf durchs Fenster und sah ihr nach. Haben
Flugzeuge denn keine Armaturenbretter. Warum nimmst du mich nicht
mit. Warum.
Jetzt streiten sie,
wer sich meine Wenigkeit unter die Achsel klemmen darf. Danke,
verzichte.
Linda sagt: Dreh die
Heizung auf volle Pulle.
Im Schutz meines
Panzers rufe ich mir die alte Wohnung ins Gedächtnis, denn ich habe
sie, wie sagt man noch so schön, verinnerlicht. Zum Beispiel die
rote Leuchte des Feuermelders. Ich sehe sie förmlich vor mir. Die
Feuertreppe. Den Herd. Die Zimmerdecke, die unter Cliff zum
Überhang mutierte. Die Wand, der Zähne wuchsen, damit man daran
klettern konnte. Ja, wenn die neuen Stimmen und das Kälterechteck
nicht wären, könnte es glatt die alte Wohnung sein.
Chuck sagt:
Übertragen Schildkröten nicht Salmonellen.
Soso. Mit Chuck werde
ich so schnell wohl nicht warm werden.
Wann hat mein Herz
zuletzt geschlagen. Gestern, glaube ich. Wenn mein Herz tatsächlich
einmal schlägt, ist es überwältigend. Auch wenn danach zwangsläufig
Ebbe ist.
Oder besser: EBBE.
Die EBBE ist eigentlich eher deprimierend. Denn wenn das Herz so
selten schlägt, will die EBBE schier kein Ende nehmen. Die EBBE ist
wie ein Pfad, der mit jedem Schritt schmaler wird. Bis man
schließlich umkehren muss, weil der Pfad sich irgendwo im Nirgendwo
verliert und sich das Weitergehen erübrigt.
In der zugigen
Präsidentenküche wird es langsam warm. Ich komme aus meinem Panzer.
Und schleppe mich zum Fenster. Linda telefoniert.
Wahnsinn, sagt sie.
Sie streckt den Kopf aus dem Fenster. Wie goldig.
Pause.
Ja, wirklich. Sie
lebt. Sie beobachtet mich.
Ich breche den
Blickkontakt mit Linda ab und mache mich zum Pool auf. Sie haben
mich also für tot gehalten. Das schmerzt. Ein wenig.
Wasser. Ich tauche
den Kopf hinein und trinke. Auf dem Grund meines Pools steht ein
Rezept für Zitronentorte.
An der Poolkante
schwebe ich immer einen Moment lang mit allen vieren in der Luft
und balanciere auf dem Bauch. Ich stelle mir vor, dass ich zur
Landung ansetze. Dann lasse ich die Vorderbeine sinken und gleite
hinein. Platsch.
Die Wassertemperatur
beträgt 18 Grad, Tendenz steigend.
Einmal, in grauer
Vorzeit, als ich noch kein Schloss und keine Wärmelampe hatte,
hielt Cliff mich für tot. Ich hörte, wie er nach ihr rief. In der
Küche waren es gerade mal 15 Grad. Was dachten sich die beiden
bloß.
Mit Iris stimmt was
nicht, sagte er. Ich glaube, sie ist tot.
Ich spürte, wie er
mich hochhob und zum Futon trug. Sie tappte uns tapsig hinterdrein.
Dann lag ich auf Cliffs breiter, warmer Brust. Ich erkannte seinen
raschen Herzschlag mit dem zischenden Geräusch.
Ich hörte sie sagen:
Regel Nummer Eins.
Ich sah nach
draußen.
Sie waren beide ganz
nah. Ihre blauen Augen. Seine grauen. Ihre Lider blinzelten von
oben nach unten. Ich blinzelte von unten nach oben. Ihr zwei seht
glücklich und zufrieden aus, sagte ich. Kauft mir eine
Wärmelampe.
Sie vergrub ihr
Gesicht an seinem Hals und schloss die Augen. Er tat es ihr nach.
Ihre Hände fanden sich über meinem Panzer. Ein schöner Moment. Mir
wurde warm ums Herz. Und ich spürte, wie es zu einem spektakulären
Schlag ausholte.
Leider gab es immer
öfter hässliche Momente. Zum Beispiel als er sich den Kopf am
Überhang stieß und benommen auf dem Futon saß. Sie sah aus dem
Fenster und sagte: Die Bäume treiben das erste Mal und reichen
trotzdem schon bis in den dritten Stock.
Tja, wir sind eben in
Oregon, sagte Cliff.
Da, wo ich herkomme,
übertreiben es die Bäume nicht.
Ich weiß, aber wir
sind eben in Oregon, sagte er.
Das hast du schon mal
gesagt. Kann es sein, dass du dir eine, wie heißt das noch gleich,
Gehirnerschütterung zugezogen hast.
Möglich.
Es war Cliffs
Heimatland, Cliffs Heimatstaat, und den fand er ganz und gar nicht
übertrieben. Er wurde nicht müde, die Vorzüge Oregons aufzuzählen.
Wo andere erzählten, zählte er auf. Berge, Wüste, Ozean, Flüsse,
die riesigen Bäume nicht zu vergessen.
Gut. Ja.
Sie mähte anderen
Leuten schwarz den Rasen. Manchmal sagte sie zu Cliff: Ich könnte
mich schwarzärgern über dich. Und er kletterte die Wände hoch und
sagte: Du treibst mich die Wände hoch. All das verfolgte ich durch
das Dach meines Panasonic-Druckerkartons, denn damals hatte ich,
wie gesagt, noch kein Schloss.
Cliff hatte stets ein
Seil über der Schulter hängen. Er seilte sich gern von der
Feuerleiter ab. Er seilte sich überhaupt gern ab. Und kam folglich
eines Tages nicht mehr wieder.
Bevor er verschwand,
sorgten sie für meine Unterbringung. Sie schaute mir ganz tief in
die Augen und versprach mir ein Schloss.
Das Schloss war aus
Zeitungspapier, stattlich und stolz. Sie gab ihm einen
französischen Namen: Pappmaché. Und malte es lila an. Sie füllte
die Zitronentortenform mit Wasser und der einen oder anderen Träne.
Dann kam die Wärmelampe. Fortan war jeder Tag hell und zitronig.
Ich hatte es warm.
Sie sagte: Ab sofort
heißt du Winnifred, okay.
Okay.
Wir warteten auf
Cliffs Rückkehr. Wir rechneten jeden Augenblick damit, dass er auf
der Feuerleiter auftauchte. Erst die Hände. Dann der Kopf. Dann der
Oberkörper. Dann das Geschirr. Kurz und knapp: Wir warteten. Aber
er kam nicht wieder.
Er wurde zum
Vormieter.
Sie hingegen wurde
mir von Tag zu Tag sympathischer. Wenn die Sonne auf den Herd
schien, wusste ich, dass sie bald nach Hause kommen würde. Ich
wartete am Fenster auf sie. Als es kälter wurde, kam sie etwas
früher. Zwar schien immer noch die Sonne auf den Herd, doch
spiegelte sie sich nun im Griff der Ofenklappe. Sie roch immer
seltener nach frisch geschnittenem Gras und immer öfter nach Diesel
und Feuer. Sie aß Müsli zum Frühstück. Manchmal brachte sie sich
von Taco Bell etwas zu essen mit und fütterte mich mit dem
geschredderten Salat.
Sie meinte, die
Wärmelampe sei gefährlich. Die Türmchen meines Schlosses waren
angesengt.
Mein Herz schlug
immer langsamer. Und auch die Sonne stand nicht mehr so hoch. Der
Winter kam. Ich prägte mir das Rezept für Zitronentorte ein und
träumte, es sei ein Rezept für mich. Ich musste meine Ausflüge an
den Pool tagelang im Voraus planen, denn ich brauchte eine halbe
Ewigkeit dafür. Ich musste meine Schritte auf meinen Herzschlag
abstimmen.
Dann kam der Anruf.
Im ersten Moment dachte ich, sie fährt nicht. Nach Hause. Dann
dachte ich über die Frage nach, wo eigentlich mein Zuhause ist. Ist
es mein Panzer oder mein Schloss oder die alte Wohnung, oder ist es
vielleicht doch etwas sehr viel Größeres oder Kleineres. Es ist der
Ort, den ich die EBBE nenne.
Die letzte Etappe meines Sprungs über den Kontinent:
Air Canada Flug 696. Die Spätmaschine nach St. John’s. Keine
Waffen. Kein Nickerchen. Reichlich Gelächter. Beim Start hielt
meine Sitznachbarin mir ihren Katalog unter die Nase und zeigte mir
eine digitale Gürtelschnalle, die man mit Laufschriften wie HALLO
ICH HEISSE ADAM oder HAPPY BIRTHDAY programmieren kann. Sie wischte
sich die Tränen aus den Augen. Du liebe Güte. Nicht zu fassen, dass
es Leute gibt, die so was tragen.
Nicht zu fassen. Ich
okkupierte unauffällig ihre Armlehne.
Hinter mir immer
wieder Heiterkeitsausbrüche. Ich wandte den Kopf. Im Gang war eine
rauschende Party im Gang. Es wurden erhebliche Mengen von eindeutig
nicht an Bord erstandenen Chips verzehrt.
Wie klingt ein
Flugzeug voller Neufundländer: Sarkastisch wäre eine freundliche
Umschreibung.
Als M. Latourelle,
der Flugbegleiter, mit dem Getränkewagen kam, bot der Mann in 23D
ihm, M. Latourelle, Chips und etwas zu trinken an. Ziemlich witzig.
Und sehr nett.
Leider fand M.
Latourelle das Angebot weder witzig noch nett.
Er bat mich dreimal,
mit der Hand auf meiner Schulter, meine pieds
magnifiques nicht in den Mittelgang zu
strecken.
Was heißt hier
magnifiques.
Die Katalogfrau bot
mir ihren Fensterplatz an.
Zu einem Fensterplatz
würde ich nicht Nein sagen.
M. Latourelle legte
ein Nachrichtenvideo ein und bat uns – insbesondere die Fluggäste
ab Reihe 21 aufwärts – um unsere Aufmerksamkeit.
Ich kippte meinen
Fensterplatzsitz nach hinten.
Im Flugzeug werden
grundsätzlich nur positive Nachrichten gezeigt. Achten Sie mal
darauf. Flugzeugabstürze bekommt man dort jedenfalls nicht zu
sehen. Wenn man ewig fliegen könnte, gäbe es auch keine
Flugzeugabstürze.
In der heutigen
Sendung geht es vor allem um die kurzfristig nach Weihnachten
angesetzte Wahl in Kanada. Und ach. Um die Geiselnahme. Ja, sie ist
noch immer nicht beendet, aber die Geiseln, zumindest die
kanadischen, bekamen Süßigkeiten zu essen.
Was für Süßigkeiten,
überlegte ich.
Wahrscheinlich
Türkischen Honig, meinte die Katalogfrau.
Ah.
Lecker.
Die nicht-kanadischen
Geiseln bekamen keine Süßigkeiten.
In der Spätmaschine
sitze ich wegen der endlosen Befragung in Toronto, wo ich gleich
nach der Landung von zwei Wachleuten der Greater Toronto Airport
Authority (GTAA) zu einem Raum in Terminal 1 eskortiert wurde, den
man lieber nicht von innen sehen möchte. Amerikanisches
Hoheitsgebiet, mit eigener Flagge. Als ich die Flagge sah, wusste
ich, dass ich meinen Anschlussflug verpassen würde.
Der Raum war oval,
mit einem ovalen Tisch und einem Fenster zum Flur. Tweed war schon
da, als ich hereinkam, und lehnte am Fenster, komischerweise ohne
sein Amulett. Ebenfalls anwesend waren die beiden Piloten und
Tuesday Miller. Ihr langer Hals war unversehrt.
Dann traten auf: der
Chef der Flughafensicherheit sowie mehrere Männer mit Dienstmarken
der US-Einwanderungsbehörde INS, die keinen Hehl daraus machten,
dass sie Kanonen unter ihren Jacketts
trugen.
Setzen Sie sich,
sagte der Chef.
Wir setzten
uns.
Keith Gordon und der
andere Pilot setzten sich nebeneinander. Ich ließ absichtlich
meinen Pass fallen, um zu sehen, ob sie unter dem Tisch Händchen
hielten.
Sie
hielten.
Die Fragen
beschränkten sich keineswegs nur auf den Diebstahl von Tweeds
Kanone: Wie lange waren Sie in Amerika. Warum. Bei wem. Wo haben
Sie gewohnt. Wo sind Sie überall gewesen. Wann und wo sind Sie
eingereist. Haben Sie gearbeitet.
Ich zeichnete das
gestochen scharfe Bild einer langjährigen Romanze mit Amerika, in
deren Verlauf ich mein Geld mit vollen Händen ausgegeben, aber
keine Arbeit angenommen hatte. Dann lenkte ich das Gespräch zurück
auf Tweed, der mürrisch auf den Flur hinausstarrte, als winke dort
der weite Horizont samt Sonnenuntergang. Ich erklärte, er sei mir
sofort suspekt gewesen, weil er trotz seiner spannenden Lektüre
völlig entspannt geblieben sei und nicht ein einziges Mal
umgeblättert habe. Dass ich durch sein Amulett auf seine Waffe
aufmerksam geworden und er kurioserweise sofort auf meinen
Da-kommt-der-Pilot-Trick hereingefallen sei. Dass er gegen die Tür
gehämmert und die Zuversicht der Passagiere von Flug 880 dadurch
mutwillig zerstört habe. Von seinem Geschrei ganz zu schweigen, das
im Übrigen vollkommen unnötig gewesen sei, schließlich hätte ich
Keith Gordon und Tuesday Miller sehr gut verstanden, als sie mit
ruhiger Stimme direkt in das BESETZT-Zeichen sprachen.
Wann mir klar
geworden sei, dass es sich bei Caesar Marshall nicht um einen
Terroristen handelt.
Bei dem Gespräch mit
Copilot Gordon.
Sie glaubten also
wirklich, dass Air Marshal Marshall das Flugzeug entführen
wollte.
Was hätte ich denn
sonst annehmen sollen. Ich konnte mir beim besten Willen keinen
guten Grund vorstellen, eine Waffe zu tragen.
Schweigen.
Noch dazu an Bord
eines Flugzeugs, ergänzte ich. Und seine heftige Reaktion, nachdem
ich ihn entwaffnet hatte, war kaum geeignet, mich vom Gegenteil zu
überzeugen.
Nachdem Sie ihn
entwaffnet hatten, wiederholte der Chef der
Flughafensicherheit.
Alle starrten den Air
Marshal an. Mann, war der groß, Mann.
Ich bin bisweilen
recht entwaffnend.
Sie scheinen mir so
allerhand zu sein, sagte der Chef und notierte sich so
allerhand.
Hören Sie. Ich habe
getan, was ich tun musste. Ich war auf der Hut. Ich habe Gefahr
gewittert und entsprechend gehandelt.
Keith Gordon legte
beide Hände auf den Tisch und sagte: Man muss ihr zugutehalten,
dass sie die Bordtoilette sofort verlassen und die Waffe
zurückgegeben hat, nachdem ich ihr versichert hatte, dass wir nicht
entführt werden.
Warum glaubten Sie
Copilot Gordon und nicht Ms. Miller oder Air Marshal
Marshall.
Weil Copilot Gordon
überzeugend war.
Inwiefern.
Ich zögerte. Er
kannte meinen Namen.
Den kannte auch Ms.
Miller.
Mag sein, aber sie
hat mich nicht mit Namen angeredet. Außerdem wusste Copilot Gordon,
wo St. John’s war. Ist.
Und das fanden Sie
überzeugend.
Ich fand es in erster
Linie selten.
Wieso selten. Ich
nehme doch an, auch Ms. Miller weiß, wo St. John’s liegt. Ebenso
Air Marshal Marshall.
Antigua, meldete
Tuesday sich zu Wort.
Dann wären wir ja
durch, sagte Keith Gordon. Wir sind doch durch, oder.
Mit mir waren der
Chef und seine Helfershelfer leider noch nicht »durch«. Ich sollte
aufgehalten und in die letzte Maschine nach St. John’s verfrachtet
werden. Wie sich das wohl bewerkstelligen ließe. Sie berieten sich
flüsternd in der Ecke. Schließlich drehte sich einer der
INS-Beamten um und sagte: Händigen Sie uns Ihr Handy und alle
anderen elektronischen Geräte aus, die Sie bei sich
haben.
Kein Problem, sagte
ich. Ich habe nur ein Handy. Aber das brauche ich, denn
sowohl meine Schildkröte als auch mein
Dad liegen im Koma.
Ich wartete, aber
niemand sagte: Das ist ja furchtbar. Wie ist denn das
passiert.
Sie sagten nur: Geben
Sie her.
Ich gab.
Dann durchwühlten
zwei INS-Beamten mit OP-Handschuhen auf dem ovalen Tisch mein
Handgebäck. Entwürdigend.
Passt Ihnen mein
Passbild nicht. Oder was.
Keine
Antwort.
Die Zeit
verging.
Der Chef verschwand
und kam mit einer Bordkarte in der Hand zurück. Flug 696, Ms.
Flowers.
Flug 696. Ist das
der, der erst morgens um 3:35 ankommt.
Genau der, sagte er.
Dann überreichte er mir einen Gutschein für die Skyway Bar und
entließ mich mit den Worten, ich solle auf seine Kosten etwas
trinken, feierlich ins Terminal 1. Ohne Kaution. Und ohne
Handy.
Terminal 1 war
renoviert worden. Und wie. Die Decke nahm kein Ende, und überall
sang Céline Dion leise »O Tannenbaum«. Außerdem gab es Rollbänder,
die ich in Kürze zu benutzen gedachte.
Ich schleppte mein
Handgebäck, aus dem ein Nachthemdzipfel hing, zu einem Münztelefon.
Ich rief erst bei Onkel Thoby an, der nicht zu Hause war, und dann
bei Linda, die zu Hause war und mir versicherte, dass meine
quicklebendige Schildkröte bei molligen 26 Grad Raumtemperatur die
Wärme genieße.
Dann geht’s ihr also
wirklich gut, sagte ich. Wirklich. Indianerehrenwort.
Ja, wirklich, sagte
Linda. Sie lebt. Sie beobachtet mich.
Tja. Da kannst du mal
sehen, wie wichtig Regel Nummer Eins ist.
Erleichtert hängte
ich ein und hüpfte auf ein Rollband.
In der Skyway Bar
bestellte ich mir eine Tasse Kaffee und blieb auf der Hut. Drei
Männer vom Bodenpersonal machten gerade Pause. Sie trugen
grellorangene Westen und ignorierten ihre Walkie-Talkies. Leute,
die ihre Walkie-Talkies ignorieren, muss man einfach gernhaben. Auf
der Weste eines der Männer stand EIN WEISER. Doch nicht etwa aus
dem Morgenland, fragte ich. Nein, erklärte er, er sei Einweiser von
Beruf und habe die Aufgabe, auf der Rollbahn mit dem Piloten in
Blickkontakt zu treten und ihn mit aufreizendem Augenaufschlag an
seinen Platz zu lotsen.
Ach, Sie sind das,
sagte ich. Mit den rosa Lichtschwertern und dem aufreizenden
Augenaufschlag!
Jawoll.
Die anderen beiden
Männer waren für das Enteisen der Flugzeuge zuständig. Man nennt
uns die Eiseiligen.
Darüber musste ich
lachen. Ich wandte mich an Mr. Weiser. Aber Ihr Vorname ist nicht
zufällig Bud.
Nein.
Ich nickte. Wir
tranken unseren Kaffee. Dann fragte ich aufmunternd, damit das
Gespräch nicht einschlief, wer für das Betanken der Flugzeuge
zuständig sei.
Sie sahen sich an,
als ob sie sagen wollten: Gute Frage.
Außenfirma, sagte ein
Eiseiliger.
Ach. Und diese
Außenfirma unterliegt doch bestimmt ziemlich strengen internen
Sicherheitskontrollen. Hoffe ich zumindest.
Das kann ich Ihnen
leider nicht sagen.
Können Sie nicht oder
dürfen Sie nicht.
Der Einweiser leerte
seine Kaffeetasse. Na, dann wollen wir mal wieder.
Weiser Mann, geh du
voran, sagte ein Eiseiliger.
Wie schade, sagte
ich.
Ja. Aber es war sehr
nett, Sie kennenzulernen.
Gleichfalls.
Und so schlichen sie
von dannen, um eine Maschine in Gate 137 zu lotsen und die Tragf
lächen mit pinkfarbenem Schaum zu besprühen.
Alles in Terminal 1
scheint einzig und allein dem Zweck zu dienen, einen von der
eigentlichen Bedeutung des Wortes terminal abzulenken. Schluss.
Aus. Ende. Zum Beispiel der Laden voller Seifenstücke, die
so sehr nach Süßigkeiten duften, dass man sofort über die »Straße«
rennen und sich eine Riesenpackung Toffee besorgen
muss.
Während ich versonnen
auf dem Rollband stand und besagte Toffeetüte leerte, näherte sich
mir eilends ein Mann im blauen Anzug mit einem GTAA-Ausweis am
Revers, den ich ohne Weiteres auf meinem Drucker hätte herstellen
können. Ich trat beiseite, um ihn vorbeizulassen, aber er blieb
stehen, stützte sich auf den Gummihandlauf und wollte wissen, aus
welchem Grund ich die drei Männer vom Bodenpersonal in der Skyway
Bar ausgefragt hätte. Wie bitte, sagte ich. Warum ich mich so sehr
für das Betanken der Flugzeuge et cetera interessieren würde. Hört
das denn nie auf. Habe ich noch nicht genug gelitten, sagte ich.
Gnade. Nichts. Er wollte wissen, warum ich mich anschließend zum
Flugsteig 137 begeben und fraglichen Arbeitern durch das Fenster
zugewinkt hätte. Und welche Informationen dabei zum Austausch
gelangt seien.
Gar keine. Ich habe
ihnen lediglich freundlich auf Wiedersehen gewinkt.
Gemeinsam verließen
wir das Rollband, und er fasste mich am Ellenbogen. Meine Herren.
Noli me tangere, sagte
ich.
Was.
Kommen Sie mir bloß
nicht zu nahe, Freundchen. Sonst.
Wollen Sie mir
drohen.
Und ob. Lassen Sie
sofort meinen Ellenbogen los.
Kommen Sie bitte
mit.
Ich war mir relativ
sicher, dass meine drei Freunde mich nicht gemeldet hatten, denn
sie waren erstens überaus sympathisch und zweitens ziemlich
mitteilsam gewesen. Entweder war die Skyway Bar verwanzt, oder eins
der Walkie-Talkies hatte unser Gespräch direkt in die Chefetage
übertragen.
Wieder wurde ich in
Gewahrsam genommen. Der GTAA-Angestellte eskortierte mich durch
eine Tür, die sich ansonsten nahtlos in die Nordwand gegenüber von
Gate 122 fügte. Wir gingen eine Treppe hinunter. Wenn Sie glauben,
die Decke in Terminal 1 nähme kein Ende, sollten Sie mal die im
Keller sehen. Wir marschierten eine halbe Ewigkeit durch ein
unterirdisches Labyrinth von Gängen. Zu seinem Glück ließ er die
Finger von mir. Dann betraten wir einen Raum. In dem diesmal keine
Flagge hing.
Kurz darauf kam auch
der Chef der Flughafensicherheit.
Er flatterte mit den
Armen und sagte: Nicht schon wieder,
Ms. Flowers.
Chief Dweck, wie ist
das werte Befinden.
Er drückte mir einen
zweiten Gutschein in die Hand und bat mich inständig, auf seine
Kosten endlich etwas zu trinken.
Merci.
Worauf ich in die
Skyway Bar zurückkehrte, mir noch einen Kaffee bestellte und
bemerkte, dass die meisten Kinder am Flughafen Rollen unter ihren
Turnschuhen hatten.
An Bord von Flug 696
ist es dunkel. Nach Mitternacht Toronto-Zeit gehen die Lichter aus.
Was das Gemüt der Passagiere beruhigen und sie zu einem Nickerchen
animieren soll. Viel Glück. Jemand ruft den Mittelgang entlang:
Mister Naturell, wie wär’s, wenn Sie Reihe 21 aufwärts noch mal mit
Ihrem Getränkewagen beehren.
M. Latourelle, über
die Sprechanlage: Non.
Wo hat sich das
Kerlchen bloß verkrochen.
In Kürze beginnen wir
mit dem Landeanflug auf St. John’s International Airport. Die
Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt. Leichter Regen.
Ortszeit … Die Maschine geht in eine steile Rechtskurve … 3 Uhr
25.
Die Katalogfrau
tätschelt mir das Knie. Der Pilot hat nur auf die Uhr geschaut.
Keine Bange.
Ich blicke aus dem
Fenster. Ich sehe Meer. Ich sehe Stadt. Ist das Fahrwerk
ausgefahren, ich habe es nämlich nicht ausfahren
hören.
Wegen des Fahrwerks
würde ich mir keine Sorgen machen. Die Katalogfrau befeuchtet ihren
Daumen und blättert um. Würden Sie so etwas kaufen, fragt sie und
zeigt auf eine Gartenfigur in Form eines Sumoringers.
Nein. Ich schaue
wieder aus dem Fenster. He. Ich sehe den Wednesday Pond, eine
riesige Pfanne, in der sich das Gelb des Mondes spiegelt wie das
gleichnamige Ei. Und die Piety-Pie-Kuchenfabrik, deren Schriftzug
rosa leuchtet.
Ist das die normale
Einflugschneise. Als ich den Wednesday Pond das letzte Mal aus der
Luft gesehen habe …
Wegen der Einf
lugschneise würde ich mir keine Sorgen machen, sagt die
Katalogfrau.
Ich presse die Stirn
an die Scheibe. Ich drücke den Knopf an meiner Armlehne. Aufrechter
geht’s nicht. Recht so.
Wir fliegen eine
Schleife über dem Meer, und jemand in Reihe 21 aufwärts sagt:
Treibstoff ablassen.
Die Katalogfrau
zwinkert mir zu. Am besten gar nicht hinhören. Sie sind schon so
gut wie zu Hause.
Onkel Thoby holt mich
ab. Ich erkenne ihn schon von Weitem an seinen grellorangenen
Handschuhen. Der Flughafen hat sich verändert. Er hat
spitzgekriegt, wie andere Flughäfen aussehen. Wer ihm das wohl
verraten hat. Die Rolltreppe braucht ewig. Der alte Flughafen hatte
niedrige Decken und war ständig überheizt.
Wir haben Zeit, uns
ausgiebig zu mustern, Onkel Thoby und ich, während ich langsam zum
Landeanflug auf St. John’s International Airport ansetze. Seine
Hände leuchten einweiserorange. Als ich seinen Gesichtsausdruck
sehe, muss ich mich erst mal setzen. Normalerweise bin ich auf
Rolltreppen immer auf der Hut. Ich halte mich aufrecht,
kerzengerade, und das ohne zu tropfen. Aber als ich Onkel Thobys
Miene sehe, werde ich plötzlich ganz wacklig auf den
Beinen.
Jemand schiebt mir
von hinten die Hände unter die Achseln. Hoppla, junge
Frau.
Bitte
nicht.
Onkel Thoby erklimmt
die versinkende Treppe. Oddly. Er hüllt mich in seinen lauten
Mantel.
Du hast gesagt, er
liegt im Komma.
Ich weiß, aber es ist
vorbei.
Punktum.
Das ist der falsche Flughafen. Auf dem alten
Flughafen gab es keine Rolltreppen, und wir waren alle noch am
Leben. Das Gepäck klapperte laut über den ziegelrot gefliesten
Boden. Wir kamen immer ein wenig früher und nahmen im IM BISS noch
einen Imbiss zu uns. Der IM BISS war dunkel und hatte keine
Fenster. An der Wand hingen Holzschnitte, die man aber kaum
erkennen konnte. Dazu musste man sich schon auf seinen Stuhl
stellen. Auf einem Holzschnitt wand ein Fischer sich in
Todesqualen. Er sah aus wie Han Solo in Das
Imperium schlägt zurück, wenn er von Darth Vader eingefroren
wird.
Vor dem IM BISS stand
ein Rechteck aus Meer. Die Scheren der Hummer darin sahen aus wie
mit Gummibändern gebändigte Pferdeschwänze. Sie waren harmlos. Man
konnte die Hand ins Wasser tauchen und die Pferdeschwänze berühren.
Man konnte erst den Meeresgrund berühren und dann in den Himmel
fliegen, alles an ein und demselben Tag.
Oder wenn man
jemanden zum Flughafen brachte, konnte man sich draußen an den
Maschendrahtzaun stellen und ihm zum Abschied winken. Wenn der
Abreisende einen Fensterplatz hatte, konnte er einen am
Maschendrahtzaun stehen sehen und mit einem hellen, fröhlichen
Gegenstand zurückwinken, zum Beispiel mit der Safety Card oder der
Kotztüte. Damit man wusste, welches sein Fenster war.
Als ich abflog,
winkte ich von Sitz 21F mit der Kotztüte. Onkel Thoby beschrieb mit
dem linken Arm einen riesigen Bogen, wie ein Scheibenwischer. Mein
Dad winkte klitzeklein, nur mit den Fingern. Sie waren doch dafür,
dass ich mich wohlbehalten in dieses große Abenteuer stürzte, warum
also machten sie so traurige Gesichter.
Ich schaute ihnen vom
Himmel aus zu. Ich schaute auch noch, als sie glaubten, ich sei
längst verschwunden. Ich sah sie über den Parkplatz zum Wagen
schlurfen. Ich sah, wie mein Dad sich erst mal aufs Pflaster
setzte. Das tut er nämlich immer, wenn etwas Schlimmes passiert. Er
ist nämlich genau so wacklig auf den Beinen wie ich.
Onkel Thoby wartet
schon seit drei Uhr am Flughafen auf mich.
Morgens.
Nein.
Du bist seit zwölf
Stunden hier.
Stellen Sie ihn sich
lieber nicht vor. Wie er da am Fuß der Rolltreppe steht. Unrasiert.
Allein. Ich halte mich an seinem Mantel fest.
Macht nichts, sagt
er.
Er nimmt meine
Tasche, und wir gehen zum Ausgang.
Die Drehtür ist neu.
Man darf sie nicht anschieben. Sie dreht sich von allein. Wenn man
sie anfasst, bleibt sie stehen. Man kommt sich vor wie eine Torte
auf einem Kuchenkarussell. In der Mitte, in Glas gefasst, steht ein
kleiner Plastikweihnachtsbaum.
Onkel Thoby geht
hinein. Wendet den Kopf. Kommst du.
Ja.
Ich stürze mich in
den offenen Schlund der Tür. Dabei habe ich anscheinend das Glas
berührt, denn der ganze Mechanismus kommt knirschend zum Stehen.
Ich sitze fest, in einer Drehtür, die sich nicht mehr dreht. Mit
einem Plastiktannenbaum. Am besten gar nicht hinsehen. Ich drücke
gegen das Glas. Onkel Thoby hebt einen orangenen Handschuh. Ich
sehe an ihm vorbei zur Taxischlange. An der Taxischlange vorbei zum
Parkplatz. Am Parkplatz vorbei zu den kleinen schwarzen Bäumen,
kaum größer als ich, die wie Kraut und Rüben durcheinanderstehen.
Vielleicht bin ich ja doch in Antigua gelandet. In St. John’s,
Antigua. Und mein Dad liegt immer noch im Komma, im anderen St.
John’s. Dem richtigen St. John’s.
Nur ist der Onkel
Thoby hinter der Scheibe eindeutig er selbst. Asymmetrisch. Mit
Haaren wie eine Piratenaugenklappe.
Die Tür setzt sich
wieder in Bewegung. Spuckt mich aus. Onkel Thoby schließt mich in
die Arme, als ob ich jahrelang da drin gewesen wäre.
Wie gehen an der
Taxischlange vorbei. Ein Clint’s Cab hält neben uns. Ich sehe nach,
ob Clint am Steuer sitzt. Leider nicht. Clint kandidiert für die
Wahl, sagt Onkel Thoby.
Ach ja. Die Wahl.
Hatte ich ganz vergessen.
Als wir die Schlange
entlangmarschieren, sehe ich M. Latourelle, den Flugbegleiter. Er
kommt mir vor wie ein alter Freund.
Bonsoir, mademoi-
Da bemerkt er Onkel
Thobys Arm.
Bei dieser
Gelegenheit sollte ich vielleicht erwähnen, das Onkel Thobys linker
Arm sehr lang ist. Fast dreißig Zentimeter länger als der rechte.
Die orangenen Handschuhe sind kaum geeignet, über diesen
Unterschied hinwegzutäuschen. Normalerweise tut er so, als würde er
etwas unglaublich Schweres schleppen. Aber heute Morgen denkt er
nicht daran. Darum deute ich auf meine Tasche und sage: ein knapper
Zentner. Mit einer Geste, als würde ich mir den Schweiß von der
Stirn wischen.
Niemand lacht.
Normalerweise lachen alle.
An der Spitze der
Schlange steht ein Pärchen mit Kinderwagen, an den sie einen
Rückspiegel montiert haben, damit das Baby seine Eltern sehen kann.
Und umgekehrt. Prima Idee. Ich gehe in die Hocke. Ich prophezeie
Ihnen, dieses Baby wird einmal ein exzellenter Autofahrer, sage
ich.
Das wollen wir doch
stark hoffen, sagt der Vater.
Wie ich da so in der
Hocke sitze, habe ich plötzlich einen Rolltreppen-Flashback. Sprich
der Körper erinnert sich daran, dass er vor nicht allzu langer Zeit
auf einer Rolltreppe gestanden hat. Mir sinkt das Herz in die
Kniekehlen, und ein flaues Gefühl macht sich im Magen breit. Ich
stütze mich mit den Fingerspitzen auf dem nassen Pflaster ab. Immer
schön senkrecht halten.
Der Kurzzeitparkplatz
ist eine einzige Winterlandschaft. Winterlandschaft bin ich nicht
mehr gewohnt. Onkel Thoby mahnt mich zur Vorsicht. Ich atme tief
durch. Es riecht nach Heimat. Es riecht nach Atlantik und nach
Kerosin.
Warum hast du kein
Taxi genommen, frage ich. Oder mich eins nehmen
lassen.
Weil es ein Notfall
ist.
Hm.
Die Landschaft
schmilzt. Gestern hat es geregnet, sagt er.
Komische Vorstellung,
dass die Regentropfen auf dem Auto eher gelandet sind als
ich.
Er fragt, ob ich
fahren möchte.
Und ob ich fahren
möchte.
Sind wir wirklich nur
zu zweit. Ich schaue immer wieder hinter mich.
Onkel Thoby hat es
sich zur Regel gemacht, niemanden zu chauffieren, den er liebt.
Seit er bei uns wohnt, ist das seine Regel Nummer Eins. Er meinte,
irgendwann werde er bestimmt vergessen, auf welcher Seite des
Ozeans er sich befindet, und dann wolle er kein Kind (mich) bei
sich im Wagen haben. Er werde nur noch allein fahren, sagte er. Im
Notfall. Gut, im dringendsten aller dringenden Notfälle werde er
vielleicht einen Erwachsenen fahren, den er nicht liebt. Aber da
beides (Notfälle und Erwachsene, die er nicht liebt) spärlich gesät
war, fuhr er eben nicht mehr selbst.
Mein Dad, der nie
vergaß, auf welcher Seite des Ozeans er sich befand, dagegen fuhr.
Und später fuhr ich. Und dann gab es ja auch noch
Clint.
Clint’s ist so etwas
wie das Qantas unter den Taxis, sagt Onkel Thoby immer. Wegen der
makellosen Sicherheitsbilanz fraglicher
Fluggesellschaft.
Onkel Thoby hat
einmal miterlebt, wie Clint den Frontalzusammenstoß mit einem
Minivan, der auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten war,
dadurch vermied, dass er sein Taxi blitzschnell und -gescheit eine
Treppe hinauflenkte. Die Fahrerin des Minivans war auf die Bremse
gestiegen und steuerte zielsicher auf das Hindernis zu, weil das
ABS-System, so Clint, den Bremsvorgang lediglich verzögerte. Da
könne man sich auch gleich den Tod ins Bremssystem einbauen lassen,
meinte er.
Onkel Thoby, der
damals mit im Taxi saß, wäre fast an seinem Gratispfefferminz
erstickt. Später sagte er, solch fahrtechnisches Können habe er
noch nie erlebt.
Fahrtechnisches
Können, sagte mein Dad. Habe ich so etwas auch.
Aber ja, sagte Onkel
Thoby und klopfte ihm auf die Schulter. Aber Clint hat
fahrtechnisches Können en masse.
Clint’s Cabs bauen
grundsätzlich keine Unfälle. Und haben auch noch nie einen gehabt.
In über drei Jahrzehnten ist nicht ein einziges Taxi aus Clints
gesamter Flotte je in einen Unfall verwickelt gewesen. Pardon, in
eine Kollision. Was umso bemerkenswerter ist, als Clints Flotte aus
fünfundsechzig Fahrzeugen besteht.
Clint’s Cabs sind
dunkelgrau, und an den Türen steht MIT PFEFFERMINZ IST CLINT’S DEIN
PRINZ. Sämtliche Taxifahrer werden in einem geheimen Trainingslager
in unserer Partnerstadt Mount Paler ausgebildet. Das ich übrigens
besucht habe, auch wenn ich eigentlich nicht die Absicht hatte,
Taxifahrerin zu werden. In meinem Fall machte Clint eine Ausnahme,
weil ich Onkel Thobys Nichte bin und Onkel Thoby Clints treuester
Kunde ist.
Was an dem
Trainingslager so geheim ist. Es hat eine Eisbahn. Ich habe auf
einer Eisbahn Autofahren gelernt. In Clints Trainingslager habe ich
gelernt, mit den Reifen meinen Namen zu schreiben. Außerdem habe
ich gelernt, die Bremse federn zu lassen, statt sie bis zum
Anschlag durchzutreten, was sich allerdings nicht ganz leicht
erklären und folglich nur schwer verständlich machen lässt, das
muss man im Gefühl haben, sonst muss man am Ende unter Umständen
gehörig Federn lassen.
Nicht bremsen, sagte
Clint immer. Federn lassen. Was sich zu einer Wendung gemausert
hat, die ich in allerlei gefährlichen oder schlüpfrigen Situationen
vor mich hin sage, auch wenn diese nicht unbedingt
automobilistischer Natur sind.
Womit ich nichts
gegen Young Drivers of Canada gesagt haben möchte. Unsere
staatliche Fahrschule, die ich ebenfalls besucht habe. Mein Dad
meinte, ich solle zu den YDOC gehen, schließlich sei ich erstens
jung und zweitens Kanadierin. Onkel Thoby hingegen war für das
Trainingslager. Und so absolvierte ich beides.
Ergo lautet die
Geheimformel meiner Kindheit: Mein Dad plus Onkel Thoby gleich
Qantas. Was in unserer Familie so viel bedeutet wie: Sei
vorsichtig. Geh auf Nummer sicher. Flieg Qantas.
Bei den YDOC lernte
ich vor allem, niemals Unfall zu sagen. Sagen Sie Kollision. Sehen
Sie alle zehn Sekunden in den Rückspiegel. Versuchen Sie, jegliche
Form extravehikulärer Ablenkung (EVA) auszublenden. Gehen Sie davon
aus, dass alle anderen Verkehrsteilnehmer entweder betrunken sind
oder sich gerade schminken oder beides. Kommen Sie niemandem zu
nahe. Machen Sie Noli me tangere zu
Ihrem Motto.
Der Parkplatzwächter
bekommt sein Schiebefenster nicht auf. Also warten wir, während der
Wagen im Leerlauf vor sich hin tuckert und der Wächter sich ein
heißes Duell mit der vereisten Scheibe liefert. Das grelle Licht im
Kassenhäuschen und der Mann in seiner lieben Not machen mich
traurig. Ich schaue weg.
Onkel Thoby drückt
mir eine zweifarbige Zwei-DollarMünze, einen Toonie, in die
Hand.
Ach, Toonies hatte
ich ganz vergessen. Sie sind wunderschön. Ob sie irgendwann
vielleicht eine dreifarbige Münze herstellen. Oder gar eine
vierfarbige. Die kanadische Münzanstalt dürfte für meinen Geschmack
durchaus eine etwas prägnantere Prägung an den Tag
legen.
Onkel Thoby sagt: Der
arme Mann.
Er sieht aus wie ein
Insekt, sage ich. Glotz doch nicht so.
Onkel Thobys Beine
zittern in seinen braunen Cordhosen.
Ich habe einen
zweiten Rolltreppen-Flashback.
Onkel Thoby legt sich
die Hände auf die Knie, um das Zittern abzustellen.
Schließlich gibt sich
der Insektenmann geschlagen. Ich zeige ihm meinen Toonie. Er winkt
uns durch. Schon gut, sagt er stumm. Fahren Sie.
Jetzt haben wir
gratis kurzgeparkt.
Das Armaturenbrett
des kleinen LeBaron leuchtet hellbraun. Der Wagen ist uralt. Was
sich unschwer daran erkennen lässt, dass er sowohl außen als auch
innen braun ist. Die meisten neuen Autos haben innen eine andere,
zum Lack passende Farbe. Zum Beispiel außen weinrot, innen grau.
Außen grau, innen schwarz. Außen blau, innen creme. Wobei mir
einfällt, dass auch meine Lieblingsfrüchte innen und außen
verschiedene, aber zueinanderpassende Farben haben. Ich denke da an
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Orangen und Zitronen. Ja, selbst Orangen
und Zitronen. Denn ihr Äußeres verspricht mehr, als ihr Inneres
hält.
Clint’s Cabs sind
außen schwarz und innen schwarz, aber damit fahren sie prima, denn
ihr Armaturenbrett ist eine Augenweide, und das Schwarz ist aus
Leder.
Du fährst aber
ziemlich langsam. Ach ja. Fahre ich wenigstens in die richtige
Richtung. Nicht direkt, sagt Onkel Thoby, aber auch Umwege führen
ans Ziel. Der Tacho zeigt Stundenkilometer an. Das ist das
Problem.
Irrtum.
Ich schalte in den
Vierten. Und mir fällt ein, wie mein Dad und ich Onkel Thoby vor
vielen Jahren einmal vom Flughafen abholen wollten, und er saß
nicht in der Maschine. Dad fuhr fast den ganzen Heimweg im
Dritten.
Hier sieht’s aus wie
in Mount Paler, sage ich.
Irrtum. Das ist eine
neue Siedlung.
Ach.
Dieses Teilstück des
Trans-Canada kenne ich noch gar nicht. Es ist breit und macht ein
schmatzendes Geräusch. Links und rechts stehen pastellfarbene
Häuser, mit der Rückseite zur Straße. Sie wirken irgendwie pikiert,
als ob sie sagen wollten: Igitt, ist das etwa ein Highway hinter
uns. Und ob das ein Highway ist. Auf dem ich im Übrigen gut
unterwegs bin. Warum musstet ihr eure teuren Hütten und billigen
Paläste auch ausgerechnet hier bauen. Wie soll man sich behaglich
fühlen, wenn einem die Umgebung nicht behagt.
Sämtliche Häuser
haben winzige Fenster, die zur Seite aufgehen. Ich stelle mir vor,
wie ich versuche, eines dieser Fenster zu öffnen, ohne
Erfolg.
Wie frustrierend es
doch sein muss, hier zu wohnen. Stellen Sie sich vor, Sie sehen das
eigene Haus vom Highway aus und wissen, dass Sie in frühestens
zwanzig Minuten da sind, obwohl es keine zwei Minuten Luftlinie
entfernt liegt. Weil Sie erst bis zur nächsten Ausfahrt fahren und
sich dann mühsam durch das verschlungene Straßendickicht schlagen
müssen. Und obwohl die Person, die an einem der besagten Fenster
steht und Sie sehnsüchtig erwartet, Sie längst hat kommen sehen,
bleibt ihr noch ausreichend Zeit, sich eine Sitcom anzuschauen, bis
Sie endlich da sind.
Hoppla. Was ist denn
mit den blauen Leuchten los.
Was.
Ich zeige mit dem
Finger auf die Lichterkette, die eines der Fenster umrahmt. Guck
mal, wie groß das Blau im Vergleich zu den anderen Farben
ist.
Guck lieber auf die
Straße, Oddly.
Es ist so geräumig,
dieses Blau. Ich spüre den genialen Geist, der es erfunden
hat.
Es ist unmöglich,
denke ich, als wir endlich in der Stadt ankommen, dass mein Dad
dieses glückliche Zusammentreffen von Wahl und Weihnachten nicht
mehr erleben kann, hatte er doch für beides eine Menge übrig. Die
Stadt ist mit Wahlplakaten und Lichterketten geschmückt, eine
Kombination, die reichlich extravehikuläre Ablenkung schafft. Ein
Beispiel: Da vorne steht ein riesiges Wahlplakat für Noel Horne.
Jemand hat seinen Namen in Noel Hörner
abgeändert und ihm passend dazu ein Paar aufgesetzt. Ziemlich
witzig.
Alle Jahre
wieder.
Wir kommen an einem
Byrne-Doyle-Plakat vorbei. Byrne Doyle! Er hat eine verblüffende
Ähnlichkeit mit Jacob Marley.
Der arme Byrne Doyle,
sagt Onkel Thoby, sein üblicher Kommentar.
Wo bleibt Clint. Ich
will endlich ein Clint-Plakat sehen.
Da vorn.
Wir nähern uns der
Taxizentrale. Die eigentlich nichts weiter ist als eine Bretterbude
mit einem Auto auf dem Dach. Aber meine Herren, das Auto haut einen
immer wieder um. Ein echtes Clint’s Cab! Auf dem Dach! Da fragt man
sich doch, warum man nicht doch Taxifahrer geworden ist, als man
die Gelegenheit dazu hatte.
Der Schuppen strahlt
hell wie ein Raumschiff. Die Weihnachtsbeleuchtung ist umwerfend.
Das Blau des einsamen Erfinders ist nichts im Vergleich zu diesem
Grün. Es geht einem wie Superman im Angesicht von Kryptonit. Man
wird schwach. Man schaltet einen Gang herunter. Und noch einen. Als
würde das Grün vor Leben buchstäblich pulsieren, und alle anderen
Farbe wären tot.
Wir biegen um die
Ecke und stehen vor einem riesigen Foto von Clint. Er hat sich
einen orangenen Schal Bob-Cratchit-mäßig zweimal um den Hals
gewickelt. Darunter steht: ORANGE WÄHLEN STATT SCHWARZ ÄRGERN –
CLINT FÜR ST. JOHN’S-MITTE.
Und noch ein Schild:
FAHRER GESUCHT.
Reichlich
EVA.
Als wir den Schuppen
hinter uns lassen, wird es auf der Straße mit einem Mal
stockdunkel. Ich glaube, meine Netzhaut hat was abgekriegt. Ist das
da vorne eine rote Ampel.
Das ist der
Teich.
Gut. Also, ich sehe
nur noch rot.
Hast du etwa direkt
in das grüne Licht geschaut.
Hätte ich vielleicht
indirekt in das grüne Licht schauen sollen.
Hm.
Der Wagen gerät ins
Rutschen. Nicht bremsen. Federn lassen. Ist das der
Teich.
Ja. Ich an deiner
Stelle würde anhalten.
Ich bin
blind.
Lass ihnen einen
Augenblick Zeit, sagt er und meint meine Pupillen.

Wir wohnen auf der
anderen Seite des Wednesday Pond. Wir sind fast da. Aber weil ich
nichts sehen kann, müssen wir warten. Wir könnten natürlich auch
aussteigen und zu Fuß gehen. Onkel Thoby könnte mich führen. Wir
könnten wie zwei arme Waisenkinder durch die Winterlandschaft
stolpern. Heute ist auf dem Trottoir so viel Platz, dass ein
vorbeifahrender Weihnachtsbaum die Medulla oblongata wahrscheinlich
kurz und knapp verfehlen würde.
An dem Tag, als mein
Dad erschlagen wurde, lag jede Menge Schnee auf dem
Trottoir.
Ich reibe mir die
Augen. Wir sind doch über den Teich geflogen.
Mundy
Pond.
Nein, Wednesday. Und
die Flugbegleiterin hieß Tuesday.
Onkel Thoby beugt
sich vor und wischt mit seinem langen Arm über die
Windschutzscheibe.
Ist das Haus mit
Lichterketten geschmückt, frage ich.
Nein.
Du hast sie alle
wieder abgenommen.
Er
nickt.
Das möchte man sich
lieber nicht vorstellen.
Es gibt da ein Gerücht (nein, mehr als ein Gerücht,
eine Theorie), wonach der Wednesday Pond keinen Grund hat. Mein Dad
fand diese Theorie lächerlich. Blödsinn, sagte er immer. Natürlich
hat der Teich einen Grund. Onkel Thoby, der die Theorie keineswegs
lächerlich fand, sagte: Also, Clint hat gesagt. Meine Herren, sagte
mein Dad. Was. Nichts. Sprich ruhig weiter. Clint hat gesagt,
einmal ist ein Mann im Teich verschüttgegangen, und die Polizei
wollte den Grund absuchen, aber siehe da, es gab nicht den
geringsten Grund, den sie hätte absuchen können.
Das Gespräch hatte
verblüffende Ähnlichkeit mit einem Tennismatch.
Nur weil die Polizei
nicht über die erforderliche Technik verfügt beziehungsweise
verfügte, um den Teich abzusuchen …
Und wie erklärst du
dir dann, dass er nie zufriert, Walter.
Er war durchaus schon
einmal zugefroren, sagte mein Dad.
Wann.
Vor deiner
Zeit.
Das ist zwar sehr
lieb von dir, aber …
Was soll das heißen.
Lieb von mir.
… aber weder ich noch
Clint noch Oddly können sich entsinnen, dass er jemals zugefroren
gewesen wäre, sagte Onkel Thoby.
Wohl wahr, sagte
ich.
Er war ein Mal
zugefroren, als du noch ganz klein warst, sagte mein Dad. Wir sind
sogar Schlittschuh darauf gelaufen.
Onkel Thoby und ich
wechseln skeptische Blicke.
Ich habe meine
Schlittschuhe angezogen, dich in deinen Kinderwagen gesetzt, und
dann habe ich dich über das Eis sausen lassen.
O Gott!
Es hat dir einen
Riesenspaß gemacht.
Wir wohnen am
Wednesday Place, und das schon, seit ich denken kann. Der Teich
liegt gleich hinter dem Haus. Wir wohnen in Nummer 3. Alle Häuser
am Wednesday Place haben ungerade Hausnummern, und die besten
Häuser haben Primzahlen.
Die Veranda zieht
sich um das ganze Haus. Einmal ganz drumherum. Wenn man nicht
aufpasst, wird man in die Erdumlaufbahn katapultiert. Die Dielen
federn nämlich beim Gehen. Und dabei wackelt das ganze Haus, wenn
nicht sogar alle Häuser am Wednesday Place. Aber nicht nur das. Zu
Weihnachten hängen dort Lichterketten mit einer Leistung von über
5000 Watt. Wer nie gesehen hat, wie sich all die Lichter im Teich
spiegeln, hat etwas verpasst. Aber heute ist alles dunkel. Nur der
Vollmond leuchtet, als wir auf das Haus zugehen. Wie viel Watt der
wohl hat. Höchstens 25.
Unsere Haustür ist
zwar nicht abgeschlossen, lässt sich aber beileibe nicht von jedem
öffnen. Dazu muss man schon ein besonderes Verhältnis zu ihr haben.
Und den Nordwestschubs beherrschen.
Ich lasse die Haustür
links liegen und gehe die Veranda entlang.
Oddly, ruft Onkel
Thoby. Trotzdem folgt er mir und schleift meine Tasche über die
federnden Dielen.
Auf dem Wednesday
Pond leben siebenundvierzig Enten (einheimisch) und zwei Schwäne
(zugewandert). Wenn die Schwäne den Kopf unter Wasser stecken,
sehen sie aus wie winzige Eisberge. Wenn sie wieder auftauchen,
schauen sie verwundert drein. Kannst du bis auf den Grund sehen.
Nein. Du. Nein. Schauen wir am besten gleich noch mal nach. Und so
schauen sie seit Jahren und wundern sich doch jedes Mal aufs
Neue.
Komm
rein.
Gleich.
Er parkt meine
Tasche.
Ich hätte da noch
eine Frage. Bist du bereit.
Ich bin ganz
Ohr.
Erinnerst du dich an
das Armband.
Ich erinnere mich
nämlich an ein Armband, das mein Dad am Handgelenk trug, so ähnlich
wie ein Notfallarmband, nur dass es Anweisungen für einen
eventuellen Unfalltod enthielt. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN
EINBALSAMIEREN stand darauf und eine kostenlose Telefonnummer. Im
Falle eines Falles sollte ein Sondereinsatzkommando per
Hubschrauber einfliegen und meinen Dad in eine Einrichtung in
Arizona bringen, wo sein Gehirn auf Eis gelegt wurde, bis die
entsprechende Technik zur, sagen wir, Instandsetzung einer Medulla
oblongata zur Verfügung stand.
Das Armband war ein
Witz, sagt Onkel Thoby.
Woher willst du das
wissen.
Ich habe es ihm
geschenkt.
Ach ja.
Wann.
Zu einem unserer
Geburtstage. Dein Vater hielt die Kryonik für eine Erfindung von
Walt Disney.
Soso. Egal. Ist es zu
spät, das SEK zu rufen. Sonst sollten wir das schleunigst
tun.
Lieber nicht, sagt
er.
Doch. Aber erst
verpasse ich der Tür einen ordentlichen
Nordwestschubs.
Fünf Minuten später
habe ich Phoenix an der Strippe und das Armband von meinem Dad in
der Hand. Der CRYNOT-Angestellte, Darren Lipseed oder Lipsey, sagt,
die Mitgliedschaft von meinem Dad sei bereits 1996
ausgelaufen.
Na und. Dann erneuern
wir sie eben.
Da kommt aber einiges
an Papierkram auf Sie zu, Ms. Flowers. Jede Menge Papierkram
sogar.
Bitte nennen Sie mich
Audrey.
Gut, Audrey. Ihr
Vater muss diverse Formulare unterzeichnen.
Tja, das könnte ein
Problem werden.
Warum.
Und ich setze Darren
Lipseed den Unfall, pardon, die Kollision von meinem Dad in allen
Einzelheiten auseinander.
Wollen Sie mich auf
den Arm nehmen, sagt er.
Äh, Darren
Lipseed.
Ja.
Ich will Sie nicht
auf den Arm nehmen. Aber. Mein Dad hat schon beim letzten Mal keine
Formulare ausgefüllt. Ich sehe zu Onkel Thoby.
Onkel Thoby tippt
sich auf die Brust.
Wie es scheint, hat
mein Onkel damals seine Unterschrift gefälscht.
Tja, dann wäre der
Vertrag ohnehin null und nichtig, sagt Darren.
Hören Sie. Schicken
Sie uns einfach Ihr Sondereinsatzkommando, und wir regeln die
Einzelheiten später.
Onkel Thoby schenkt
sich ein Glas Sherry ein.
Wir können leider
kein SEK nach Kanada schicken.
Aber Sie haben doch
Mitglieder in Kanada.
Ja. Ich muss Sie
bitten, einen Augenblick zu warten, Ms. Flowers.
Warum.
Darum.
Das darf ja wohl
nicht wahr sein, sage ich zu Onkel Thoby. Nicht zu
fassen.
Er legt seine Hand
mitsamt dem Glas auf der Anrichte ab. Bist du nicht müde,
Liebes.
Nein.
Ich glaube
doch.
Ich kehre ihm den
Rücken zu. Und lese noch einmal, was auf dem Silberarmband
steht.
50 000 E Heparin IV.
HLW unter Eiskühlung auf 4°C. pH konstant 7,5. Sofortruf 800 544
7700. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN EINBALSAMIEREN.
Ich schüttele den
Kopf. Was für ein simples Rezept. Und wir haben es nicht geschafft,
uns daran zu halten. Jedenfalls einer von uns. Wenigstens haben wir
ihn nicht einbalsamiert.
Wir haben ihn doch
nicht einbalsamiert, oder, frage ich.
Nein.
Was heißt
einbalsamiert.
Darren ist wieder in
der Leitung. Er erklärt mir, weshalb er beziehungsweise das
CRYNOT-SEK eine Leiche nicht über die Grenze transportieren kann.
Sie können sich nicht vorstellen, was der Zoll für einen Zirkus
…
Doch, Darren. Den
Zirkus kann ich mir sogar sehr gut vorstellen.
Zumal die Leiche
bereits tot ist.
Ich würde es sehr
begrüßen, wenn Sie meinen Dad nicht dauernd als die Leiche
bezeichnen würden.
Tut mir
leid.
Schon
gut.
Es gibt natürlich
verschiedene Stufen des Totseins, sagt Darren.
Darüber muss ich
nachdenken. Ich höre ein klickendes Geräusch. Sie stricken doch
nicht etwa, Darren.
Darren sagt: Eine
Babydecke. Wenn ich Sie noch einmal bitten dürfte, einen Augenblick
zu warten, Ms. Flowers.
Warum.
Totenstille.
Ich hänge schon
wieder in der Warteschleife.
Onkel Thoby nimmt mir
den Hörer aus der Hand. Legt auf. Wir brauchen Schlaf, sagt
er.
Aber ich bin noch in
einer anderen Zeitzone.
Trotzdem. Er stellt
sein Glas ins Spülbecken.
Ich klimpere mit dem
Armband. Und denke an die Szene in Das
Imperium schlägt zurück, in der Darth Vader Han Solo
einfriert. In der Fortsetzung ist er wieder aufgetaut. Da kommt man
doch ins Grübeln.
Aber mit Kryonik
hatte das nichts zu tun. Keine Ahnung, was das war.
Es war George Lucas.
Nicht Walt Disney. Und darum durchaus möglich.
Wenn Sie an Schlafmangel leiden und zufällig einen
Pferdeschwanz zur Hand haben, empfiehlt sich Folgendes: Klemmen Sie
sich den Pferdeschwanz unter die Nase wie einen Schnurrbart. Das
beruhigt und macht müde. Außerdem zwingt es einen, den Tisch
loszulassen. An dem ich sitze, seit Onkel Thoby nach unten und ins
Bett gegangen ist.
Servus, sagte
er.
Servus. Das Wort hatte ich ganz
vergessen.
Und wenn das SEK doch
noch kommt, sagte ich.
Er schlich die
knarrende Kellertreppe hinunter. Geh zu Bett, Liebes.
Ich nickte. Und
setzte mich stattdessen an den Tisch. Trommelte mit den Fingern.
Hörte nach einer Weile auf zu trommeln und fing an, mich
festzuhalten. Zwang mich, wieder loszulassen.
He. Mein
Pferdeschwanz riecht nach Air Canada.
Wobei mir einfällt.
In den Nachrichten im Flugzeug wurde das Wort verschwunden auf eine Art und Weise gebraucht, die
mir neu war. Wie ging das noch gleich. Mehrere Personen seien
verschwunden worden, sagte ein Reporter. Nicht verschwunden.
Verschwunden worden.
Und urplötzlich ist
dieses Wort, das seit grauer Vorzeit wie ein Möbelstück in einer
dunklen Ecke stand, zum Leben erwacht und
aufgesprungen.
Ich greife zum
Telefon. Wähle Lindas Nummer. Chuck nimmt ab. Ich habe sie geweckt.
Tut mir leid. Ich wollte mich nur rasch erkundigen, wie es
Winnifred geht …
Wem.
Kann ich mal Linda
sprechen.
Ach, der Schildkröte.
Der geht’s prima. Nur wir kommen bei der Bullenhitze fast um. Hier
drin sind achtunddreißig Grad.
Kann ich mal Linda
sprechen.
Bettzeug
raschelt.
Hallo Audrey. Es geht
ihr bestens.
Könntest du
vielleicht kurz nach ihr sehen.
Morgens um halb
drei.
Bitte.
Seufz.
Warte.
Und ich höre Chuck
sagen: Was. Als ob das mit der Achselhöhle noch nicht gereicht
hätte. Jetzt sollen wir das Mistvieh wohl auch noch mit ins Bett
nehmen.
Linda, im
Hintergrund: Halt die Klappe.
Eine Minute vergeht.
Noch eine. Schließlich kommt sie wieder. Schildkröte gesund und
munter. Sie ist aufgewacht, als ich das Licht angemacht und auf
ihren Panzer geklopft habe.
Dann ist sie also
wohlauf.
Sie ist vor allem
stocksauer.
Oh. Gut.
Okay.
Ich trommle mit den
Fingern.
Audrey.
Ja.
Ah. Ich dachte schon,
du hättest aufgelegt.
Nein.
Wie geht’s, fragt
sie. Wie ist es bei dir.
Ähm. Kleiner. Alles
ist kleiner. Besonders die Bäume.
Aber sonst
…
Alles bestens.
Entschuldige, dass ich euch geweckt habe.
Kein Problem. Mich
bringt so leicht nichts ins Schwitzen.
Du hast gut reden,
höre ich Chuck sagen. Mir quillt die Suppe aus allen …
Tschüs.
Tschüs.
Ich bleibe noch ein
wenig sitzen und denke darüber nach, dass es Winnifred prima,
einfach prima geht. Und wie heiß, wie unglaublich heiß es in dieser
Wohnung ist. Dann greife ich zum Telefon. Chuck nimmt ab.
Entschuldige, dass ich noch mal störe, sage ich.
Herrgott, das hält ja
kein Mensch aus.
Ich habe nur gerade
überlegt, ob ihr einen Feuermelder habt. Und womit ihr heizt. Und
ob Winnifreds Schloss vielleicht in der Nähe eines Heizkörpers
steht.
Klick.
Aufgelegt.
Je nun.
Ich lese das
CRYNOT-Armband, das ich mir ums Handgelenk gebunden habe. Warum man
das Unfallopfer kühlen soll, ist mir ein Rätsel. Sollte man es
nicht eher wärmen.
Der Teich ist wie aus
Silber. Bald wird es hell. Die Ganzjahresschwäne schaukeln vorbei.
Die Bäume am anderen Ufer sehen klein und freundlich aus. Oder
vielmehr klein und grimmig. Wo führt der Teich eigentlich hin. Wo.
Immer wenn ich in Portland den Rasen rings um den Stausee mähte,
musste ich an den Wednesday Pond denken. Rings um den Stausee stand
ein hoher, spitzer Zaun, damit den Wasservorrat der Stadt niemand
vergiften konnte. Nehme ich jedenfalls an. Ich mähte den Rasen, sah
durch die Gitterstäbe und dachte darüber nach, dass ein Stausee
eigentlich keinen richtigen Grund hat. Und dass man, wenn man ganz
tief, bis ins Rohrsystem hinabtaucht und nicht aus Versehen falsch
abbiegt, an einem völlig unerwarteten Ort wieder auftaucht, zum
Beispiel im Wednesday Pond.
Ich fragte mich, ob
es zwischen den beiden Gewässern vielleicht eine Verbindung
gab.
Es tut mir leid, dass
ich nicht über den Zaun geklettert und durch das Labyrinth von
Rohren nach Hause geschwommen bin, Dad. Es tut mir leid, dass mein
großes, wohlbehaltenes Abenteuer kein Ende nehmen wollte. Ich hatte
jegliches Zeitgefühl verloren. Ich hatte Angst. Ich weiß auch
nicht, warum ich den Sprung über den Kontinent nicht schon viel
früher gewagt habe.
Hinter mir ertönt ein
Geräusch, das mir in etwa so vertraut ist wie das Anspringen der
Heizung, weshalb ich es zunächst überhört habe. Ein Quieken und
Surren aus dem Wohnzimmer.
Wedge!
Ich überlasse meinen
Pferdeschwanz wieder der Schwerkraft.
Ich wusste natürlich,
dass er da ist. Ich hatte ihn lediglich vergessen. Ich schlittere
über den Küchenboden. Bleibe im Türbogen stehen. Im trüben Licht
der hereinbrechenden Dämmerung sehe ich Wedge weiß schimmernd auf
dem Kaminsims stehen. Sein Laufrad blitzt.
Mr. Sam, flüstere
ich. Mr. Wedge Man.
Er hält
inne.
Ich nähere mich dem
Käfig, pardon, Terrarium.
He, du.
Er sträubt das Fell
auf seiner Stirn. Wie sehe ich aus.
Gut.
Vorsichtig steigt er
aus seinem Laufrad. In seinem Napf, zwischen dem Trockenfutter,
liegt ein angefressenes Lakritz.
Und vor wem läufst du
heute davon, frage ich. Oder verfolgst du jemanden.
Wedge hat eine
blühende Fantasie, also ist es wahrscheinlich entweder ein Berglöwe
oder die Russenmafia.
Ich öffne das
Gitterdach und hole ihn heraus.
Er ist ganz warm und
zittert. Sein kleines Herz pumpert so wild, dass ich die Luft
anhalten muss. Ich bin keine Säugetiere mehr gewohnt.
Er reibt seine Nase
an meiner. Mein Laufrad könnte ein Tröpfchen WD-40
vertragen.
Gut.
Ich nehme ihn mit in
die Küche. Er erkundet den Tisch. Wenn er der Kante zu nahe kommt,
halte ich seinen Schwanz mit der Fingerspitze fest. Er dreht sich
um. Jemand tritt mir auf den Schwanz.
Ich lasse los. Er flitzt in eine andere Richtung davon. Dieses
Spielchen spielen wir eine Weile. Schließlich, als der Himmel
langsam heller wird, beruhigt er sich. Wie nachtaktive Tiere es so
an sich haben. Er sitzt im Gehege meiner Arme und putzt sich. Ich
senke den Kopf und beobachte, wie zwischen seinen Ohren die Sonne
aufgeht. Wenn das Licht von hinten durch sein Ohr scheint, kann man
seine Tätowierung sehen. 81.
Angenommen, sagt mein Dad, das Leben würde ewig
währen.
Wir sind in seinem
Labor und schauen den Mäusen beim Schwimmen zu. Ich bin noch klein.
Mein Laborkittel schleift über den Boden. Er legt mir die Hand auf
den Kopf. Von Unfällen einmal abgesehen, sagt er.
Aha.
Ewig heißt für
immer.
Ich
weiß.
Er trägt die Stoppuhr
wie eine Kette um den Hals.
Die Mäuse machen
Ferien. Jede hat ihren eigenen Pool. Es sind fünf Pools. Zwanzig
Mäuse. An der Wand sind Käfige wie Hotelzimmer
übereinandergestapelt. Jedes Hotelzimmer hat eine Zimmernummer.
Jede Maus hat ihre Zimmernummer auf das linke Ohr
tätowiert.
Auf das linke Ohr
kommt es an.
Fünf Mäuse gehen zehn
Minuten schwimmen. Dann die nächsten fünf. Und die
übernächsten.
Im Wasser sträubt
sich ihr Fell vor lauter Angst. Schwimmen sie, oder wollen sie nur
herausklettern. Sie wollen herausklettern. Weit und breit keine
Maus, die kraulen oder gemütlich auf dem Rücken treiben würde. Sie
schwimmen im Kreis und scharren an den Wänden des
Pools.
Die Mäuse machen gar
keine Ferien. Das ist so eine Art unfreiwillige
Freischwimmerprüfung. Die Pools sind Mülltonnen von Canadian Tire.
Aber wehe, Sie verraten das den Mäusen.
Mein Dad sagt, wir
bestehen aus kleinen Kreisen, die man Zellen nennt. Mit der Zeit
werden diese Zellen schmutzig und geraten aus der Form. Dann
sterben wir. Aber selbst die ältesten und runzligsten Zellen wissen
noch, wie es war, als sie jung waren. Sie tragen die Erinnerung an ihre Jugend in sich. Also braucht man
ihr Gedächtnis bloß ein wenig auf Trab zu bringen. Trab, trab.
Weißt du noch, wie es war, als du jung warst. Na los, erinnere
dich. Es hört sich einfach an, aber bisher ist noch niemand darauf
gekommen, wie man das Gedächtnis einer Zelle ordentlich auf Trab
bringt.
Obwohl, das stimmt
nicht ganz. Ein Mann an der Universität von Cambridge hat einen
Frosch dazu gebracht, sich an sein Leben als Kaulquappe zu
erinnern.
Auch Licht, das aus
kleinen Kreisen besteht, die man Photonen nennt, hat ein
Gedächtnis. Niemand weiß genau, wie dieses Gedächtnis funktioniert,
aber manchmal trifft das Licht eine Entscheidung, die auf Erfahrung
beruht. Das gilt übrigens auch für Wasser. Wenn man Wasser kocht,
erinnert sich das Wasser, dass es schon einmal gekocht hat, und
kocht beim zweiten Mal ein wenig schneller. Ich meine, nachdem es sich auf Zimmertemperatur abgekühlt hat.
He, ich weiß, wie man kocht. Während es
beim ersten Mal noch fragen musste: Was, bitte
schön, ist Kochen?
Und wie bringt die
unfreiwillige Freischwimmerprüfung das Mäusegedächtnis nun auf
Trab. Gar nicht. Das gehört eigentlich auch gar nicht hierher. Wir
plaudern doch nur. Das eine hat mit dem anderen nicht das Geringste
zu tun. Aha.
Im Labor gibt es ein
Gehirn. Ein menschliches Gehirn. Es steht in einem Regal in einem
Tupperware-Behälter mit Formaldehyd. Nicht auszudenken: Da steht
ein Mensch im Regal!
Wer ist das. Wie
heißt er.
Ich habe nicht den
leisesten Schimmer.
Könntest du es
rausfinden.
Mein Dad macht keinen
besonders begeisterten Eindruck.
Kann ich ihm einen
Namen geben.
Nein.
Kann ich es auf den
Schoß nehmen, ich lasse auch den Deckel zu.
Na
schön.
Hallo, da drinnen,
Blumenkohlgehirn. Mr. Blumenkohl. Du bist so klein und kompakt. Und
trotzdem ein Mensch. Ich weiß nicht, ob ich dich lieb haben kann,
hässlich, wie du bist. Obwohl. Doch, ich glaube schon
…
Wie ein Gehirn so
klein sein kann, ist mir ein Rätsel.
Im Gehirn von meinem
Dad liegen Mäuse und Menschen weit auseinander. Ziemlich weit
sogar. Und dazwischen liegen meilenweise Wörter. Dazu braucht man
sich nur mal einen seiner Artikel anzuschauen. Das Wort
Maus werden Sie darin vergeblich
suchen. Trotzdem kommen die Mäuse darin vor. Genau wie die
Menschen. Und das Wort Maus führt, gut
getarnt, früher oder später zu dem ebenfalls gut getarnten Wörtchen
Mensch. Trotzdem sind Mäuse und
Menschen niemals gleich. Mein Dad würde niemals schreiben: Die Maus
konnte Schwimmen auf den Tod nicht ausstehen und sehnte sich nach
ihrem Hotelzimmer.
Er würde schreiben …
Ich weiß auch nicht, was er schreiben würde. Wahrscheinlich, wie
viel das Versuchstier hinterher getrunken hat. In
Gramm.
Mein Dad kann es
nicht leiden, wenn ich so tue, als ob Mäuse und Menschen gleich
wären. Oder wenn in einer Geschichte so getan wird. Wie zum
Beispiel in den Beatrix-Potter-Büchern, die meine Großmutter mir
geschickt hatte und die ich wegwerfen musste, weil mein Dad seine
Stimme nicht leiden konnte, wenn er mir daraus vorlas. Bei Beatrix
Potter sind Mäuse und Menschen nämlich immer gleich. Beatrix
Potters Gehirn ist wahrscheinlich klein und dumm.
Jetzt lesen wir nur
noch Bücher mit echten Menschen. Richtige Bücher, bei denen mein
Dad seine Stimme nicht verstellen und lügen muss.
Ich verrate Ihnen mal
ein Geheimnis über das Gehirn von meinem Dad. Sagen wir, Sie gehen
den ganzen Weg von dem Wort Maus zu dem
Wort Mensch. Der ist ziemlich weit.
Sagen wir, Sie sind schon seit Tagen unterwegs. Schließlich kommen
Sie bei Mensch an, und Sie sehen, dass
der Weg hier nicht zu Ende ist, sondern noch weitergeht. Er wird
schmaler und schmaler, bis er so schmal ist wie ein Mäuseschwanz.
Sie gehen weiter, bis ganz ans Ende, und was finden Sie da. Sie
finden das Wort Audrey.
Angenommen, das Leben
würde ewig währen. Will sagen: dein Leben.
Das Buch, das am Tag
der unfreiwilligen Freischwimmerprüfung zu Hause auf uns wartet,
ist eine Biografie von Andrew Toti, dem Erfinder der Schwimmweste.
Er hat auch die Hühnerrupfmaschine erfunden. Mein Dad sagt, die
Hühnerrupfmaschine sei eine genauso bedeutende Erfindung wie die
Schwimmweste und werde viel zu wenig gewürdigt. Weshalb wir die HRM
jetzt immer, wenn wir Hühnchen essen, gebührend würdigen müssen.
Was ich ziemlich eklig finde.
Jedenfalls denke ich
mir während der UFSP eine Schwimmweste für Mäuse aus. Mit kleinen
Haken vor jeder Hotelzimmertür, wo sie die Schwimmweste zum
Trocknen aufhängen können. Man könnte den Mäusen beibringen, die
Westen selber anzuziehen. Sie haben so geschickte Finger. Stellen
Sie sich vor, wie die Mäuse nach unten gucken, wenn sie die
Schwimmwesten anlegen. Stellen Sie sich vor, wie goldig sie von
hinten aussehen würden.
Obacht,
Audrey.
’tschuldigung.
Mein Dad trocknet die
Mäuse ab. Und wenn er damit fertig ist, trage ich sie in ihre
Hotelzimmer zurück. Sie sind feucht und zittern am ganzen Körper,
aber ich kreische nicht, und ich lasse sie auch nicht fallen. Ich
setze sie hinein und mache die kleinen Gittertüren zu. Ihre
rosafarbenen Händchen drücken sich gegen das Glas. Ihre kleinen
Lungen rasseln.
Trockne mich noch ein
bisschen ab.
Sie werden für ihr
Leben gern abgetrocknet. Mein Dad hat ein superweiches,
supersaugfähiges Handtuch, davon werden sie ganz verträumt und
schließen die Augen.
Jetzt ist die letzte
Runde dran, Nummer 16 bis 20. Die Stoppuhr läuft. Und rein mit
ihnen, im Minutenabstand. Sie müssen möglichst schnell ins Wasser,
sonst laufen sie meinem Dad am Arm hoch. Einmal hat es eine Maus
bis auf seine Schulter geschafft.
Im Wasser sieht es
aus, als ob ihr Fell explodieren würde. Puff. Mein Gewissen regt
sich. Dabei sind es doch bloß zehn Minuten. Kopf hoch, Jungs. Und
sie halten den Kopf hoch. Ich habe noch nie einen Kopf untertauchen
sehen. Bis heute.
Dad.
Was ist.
Ich zeige auf den
dritten Pool.
Das ist aber komisch,
sagt er.
Überhaupt nicht. Sie
ertrinkt!
Noch ein
Sekündchen.
Eins, zwei, drei
vier, fünf Sekunden. Sie landet auf dem Grund des Pools. Und rührt
sich nicht. Zu einer Schwimmweste würde ich nicht Nein sagen.
Luftblasen steigen auf.
Sie kann nicht
schwimmen.
Alle Mäuse können
schwimmen.
Ich tauche meinen Arm
ins Wasser, bin aber noch nicht groß genug. Dad!
Na schön. Er steckt
seinen Arm ins Wasser.
Ich drehe mich weg.
Ist sie noch am Leben. Am besten gar nicht hinsehen.
Alles bestens,
Audrey. Ihr geht’s prima. Schau doch.
Ich schaue. Und sehe
eine hechelnde Maus. Mit weit aufgerissenen
Mäuseaugen.
Kleiner Scheißer,
sagt mein Dad. Sein Ärmel ist bis zur Schulter nass.
Und so wird Nummer 18
abgetrocknet, wenn auch nicht ganz so behutsam wie die anderen, und
nicht ganz so lange.
Ich glaube, sie mag
keinen Freischwimmer machen, sage ich und trage sie zu ihrem
Zimmer.
Nein. Jedenfalls
nicht freiwillig.
Das Labor von meinem
Dad ist in Gebäude OB-8, das ich nur das Obacht-Gebäude nenne. Die
Tierpflegestation liegt im Keller des Obacht-Gebäudes. Wir gehen
auf dem Heimweg dort vorbei. Verlaine hat die Füße auf den
Schreibtisch gelegt. Sie ist die Tierpflegerin. Sie kommt aus der
Schweiz und trägt immer kurze Ärmel, egal wie kalt es im Keller
ist.
Mein Dad klopft auf
ihren Schreibtisch.
Ihre dicken Arme sind
am Ellenbogen geknickt, als ob sie Zügel in der Hand halten würde,
dabei hält sie in Wahrheit eine Zeitschrift in der Hand, mit einem
Pferd und einem Reiter mit Zylinder vorne drauf.
Bonsoir, sagt sie und lüftet einen imaginären
Zylinder.
Haben wir denn schon
soir, sagt mein Dad und sieht auf seine
Stoppuhr.
Im Bauch der Erde ist
immer soir, sagt sie.
Verlaine versorgt die
Mäuse von meinem Dad, Dr. O’Leerys Katzen und etliche Tauben,
Hühner und Ratten. Sie sagt, die Tauben trifft es am härtesten,
weil sie tatenlos zusehen müssen, wie ihre in Freiheit lebenden
confrères auf den Fensterbänken im
zweiten Stock auf und ab stolzieren.
An allen vier Wänden
der Tierpflegestation hängen Bilder von Pferden. Aber keine Bilder
von Mäusen, Katzen, Tauben, Hühnern oder Ratten.
Nummer 18 macht
Schwierigkeiten, sagt mein Dad. Sie will partout nicht
schwimmen.
Aber natürlich
schwimmt sie.
Mein Dad zeigt ihr
seinen nassen Ärmel.
Sie schüttelt den
Kopf. Frechdachse, diese souris. Sie
nimmt die Füße vom Tisch und rollt mit ihrem Stuhl quer durch den
Raum. Notiert sich etwas. TantaMouse, sagt sie. Bei denen bestelle
ich nicht noch mal.
Beim Schreiben zuckt
ein Muskel an ihrem Oberarm.
Was wird denn jetzt
aus Nummer 18, frage ich.
Mir ist nach einem
leckeren Mäusesandwich, sagt sie und schreibt weiter. Das wird aus
Nummer 18.
Ich lache. Menschen
essen doch keine Mäuse. Dann höre ich auf zu lachen. Was essen
eigentlich so dicke Menschen aus der Schweiz. Verlaine tätschelt
sich den Bauch. Kein Lächeln weit und breit.
Sie will dich doch
nur ärgern, sagt mein Dad. Nummer 18 wird
eingeschläfert.
Ich nicke. Dachte
ich’s mir doch.
Verlaine macht ein
verdutztes Gesicht. Sie neigt den Kopf in meine Richtung und sagt:
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, non.
Draußen bläst der
Wind mich fast davon. Das ist beileibe nicht das erste Mal, dass
ich auf dem Campus umgepustet werde. Aber das ist kein Wunder, denn
die Universität wurde in Windeseile aus dem Boden
gestampft.
Hoppla, sagt mein Dad
und hilft mir wieder auf die Beine. Wo ist denn dein
Stein.
Ich soll immer einen
Stein in der Tasche haben, wenn es windig ist. Hab ich vergessen,
sage ich und zurre meinen Pferdeschwanz ein wenig fester.
Dad.
Er hüpft die Treppe
hinunter. Ich halte mich an der Tür des Obacht-Gebäudes
fest.
Dad!
Er dreht sich um. Der
Wind ist laut.
Ich traue Verlaine
nicht weiter, als ich spucken kann, brülle ich.
Was, brüllt er
zurück.
Seine Haare wehen im
Wind. Sein Ärmel ist sofort trocken. Er hält ihn hoch, guck mal,
trocken, irre, was. Dann, da ich mich nicht von der Stelle rühre,
kommt er die Treppe wieder hoch.
Was.
Ich traue Verlaine
nicht weiter, als ich spucken kann.
Er lächelt. Das ist
aber nicht sehr weit.
Ich möchte ein
Experiment mit Nummer 18 machen. Mein eigenes Experiment. Ich
möchte sie selbst einschläfern. Hypnotisieren. Vielleicht erinnert
sie sich dann an ihre Jugend. Wie der Frosch, der sich in eine
Kaulquappe zurückverwandelt hat.
Mein Dad schweigt
einen Augenblick. Dann hebt er den Kopf. Ach, Audrey …
Warum denn nicht.
Warum denn nicht.
Du verstehst das
nicht.
Doch.
Wir können doch nicht
jedes Mal ein Versuchstier mit nach Hause nehmen, wenn
…
Aber sonst macht sich
Verlaine daraus ein Mäusesandwich!
Wir können keine
Versuchstiere mit nach Hause nehmen. Punktum.
Ich gebe keine
Antwort. Und halte mich stattdessen an der Tür fest.
Mein Dad tut so, als
ob er ohne mich nach Hause gehen wollte. Dann wendet er den Kopf.
Kommt zurück. Na schön. Erklär mir dein Experiment.
Ich habe nicht geschlafen. Ich habe mein Gesicht
ausgeruht. Auf dem Tisch. Wie im Kindergarten, wenn die Erzieherin
sagte: Ruhig jetzt, enfants maudits.
Kopf auf den Tisch.
Mein Kopf liegt da,
wo eigentlich Wedge sein müsste. Ich habe Wedge doch nicht etwa
zerquetscht. Ich richte mich auf und taste meinen Kopf
ab.
Er klebt nicht in
deinen Haaren. Er ist wieder in seinem Terrarium. Onkel Thoby
stellt mir eine Tasse Kaffee hin. Der arme kleine Kerl wollte sich
schon vom Tisch abseilen.
Ich wische Sabber
weg. Habe ich geschlafen, äh, mein Gesicht ausgeruht, brülle ich
gegen die Kaffeemaschine an.
Ja.
Meine Herren. Die
Kaffeemaschine ist aber ganz schön laut.
Onkel Thoby trägt
normalerweise knallige Pullover mit einem langgezogenen Ärmel.
Heute ist sein Pulli schwarz. Ohne langgezogenen Ärmel. Er hat
meinem Dad gehört.
Wann hast du zuletzt
etwas gegessen, fragt er.
Ich überlege. Hm. Ein
Stück Toffee in Terminal 1, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war
es Seife.
Er öffnet den
Kühlschrank.
Du brauchst mir
nichts zu machen.
Wie wär’s mit einer
Orange im Schloss, sagt er.
Und dazu ein Stück
Kuchen von Piety Pie, ergänze ich.
Draußen ist es dunkel
und windig. Seit wann denn das. Ich schaue auf die Uhr.
Mittag.
Wenn ich den Kopf
wieder auf den Tisch lege, in derselben enfant-maudit-Stellung, fällt mir meine Montage
bestimmt wieder ein. Montage ist ein Codewort für Traum. Mein Dad
war gegen Träume. Genauer gesagt, gegen ihre ausführliche
Erörterung am Frühstückstisch. Träume sind nur für den Träumenden
von Interesse, sagte er. Also verschone uns damit.
Und das von einem
früheren Psychotherapeuten.
Dabei war ich im
Wesentlichen seiner Meinung. Ich hörte mir auch nicht gern die
Träume anderer Leute an. Es sei denn, ich kam darin vor. Aber meine
eigenen Träume lang und breit beim Frühstück zu erörtern – gibt es
etwas Schöneres im Leben.
Onkel Thoby sah das
ganz genauso. Er schlug vor, unsere Träume künftig Montagen zu
nennen.
Was ist eine
Montage.
Eine Montage ist eine
Bildfolge: schnell und wahr und wild gemischt.
Ich nickte. Auf den
Trick fällt er bestimmt herein.
Mein Dad durchschaute
ihn nach circa zwei Sekunden.
Ich habe eine Montage
gesehen.
Wo.
Ich blickte Hilfe
suchend zu Onkel Thoby. In den Nachrichten, schlug er
vor.
Genau, in den
Nachrichten. Über ein Mädchen, das in ihrem Arm ein Geheimfach
entdeckte. Und in diesem Geheimfach lag ein Zettel. Und jetzt rate
mal, was auf dem Zettel stand.
Na sag
schon.
DNA.
Als ich den Kopf
wieder auf den Tisch lege, fällt mir ein, dass meine Montage in
Oregon spielt und zwar viereinhalb Tage früher. Oregon liegt noch
im Komma. Und mein Dad schreibt mit beiden Händen ein W in die
Luft.
Obacht. Kopf hoch.
Onkel Thoby stellt eine Orange im Schloss auf den Tisch. Und eine
zweite Tasse Kaffee.
Zu einer zweiten
Tasse Kaffee würde ich nicht Nein sagen.
Eine Orange im
Schloss ist das Schönste, was es gibt. Eine Orange, die in einem
Schloss aus ihrer eigenen Schale liegt.
In den Nachrichten
hatte ich eine Montage gesehen, in der mein Dad gesund und munter
war und mir von der Westküste zuwinkte.
Ich auch, sagt Onkel
Thoby.
Du hattest dieselbe
Montage.
So
ähnlich.
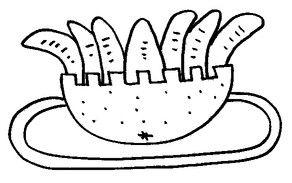
Wie ich sehe, hast du
meine Bitte um ein Stück Kuchen ignoriert. Aber das macht
nichts.
Er setzt sich mir
gegenüber. Wirft zwei Alka-Seltzer-Tabletten in ein Glas. Guck mal,
der Tycho-Krater. Unsere alte Nummer. Irgendwann sieht jedes Alka
Seltzer genau aus wie der Mond.
Danke für den Kaffee
und das Schloss.
Nichts zu
danken.
Die Orange hebt sich
grell gegen seinen Pulli ab. Ich pule ein Stück heraus. Ich hätte
da eine Frage, sage ich. Bist du bereit.
Ich bin ganz
Ohr.
Hast du eine
bewegende Rede am Krankenbett gehalten.
Er blickt von seinem
Glas auf.
Wusste mein Dad, dass
ich nach Hause komme. Hast du es ihm gesagt.
Ich habe es ihm
gesagt.
Und ist er
aufgewacht.
Nein,
Liebes.
Verstehe. Ich kaue.
Die ganze Sache schlägt mir ziemlich auf den Magen. Aber jetzt bloß
nicht übergeben. Wenn ich mich übergebe, muss sich auch Onkel Thoby
übergeben. Er muss ja schon würgen, wenn man nur darüber spricht.
In dieser Hinsicht ist er sehr sensibel.
Ich kaue
vorsichtig.
Was das sympathische
Erbrechen angeht, habe ich eine Theorie. Es ist ein natürlich
selektiertes Merkmal. Wenn ein Angehöriger einer Gruppe sich
erbricht, ist es sehr wahrscheinlich (oder doch zumindest denkbar),
dass andere Gruppenmitglieder dieselbe giftige Substanz zu sich
genommen haben wie der Erbrecher. Daher erbrechen sich die anderen
prophylaktisch auch. Je schneller man das eingenommene Gift
erbricht, desto größer ist die Überlebenschance.
Ich schaue über seine
Schultern auf den Teich. Denn genau das soll man tun, wenn einem
übel wird. In die Ferne schauen. Die Schwäne schaukeln. Und wie sie
schaukeln. Meine Herren.
Mir geht’s nicht
besonders.
Willst du dich
hinlegen.
Ich schüttele den
Kopf. Aber die ganze Schlossmauer krieg ich nicht
runter.
Dann lass sie
stehen.
Ich stütze die Wange
in die Hand.
Er bemerkt das
CRYNOT-Armband. Ich habe dich telefonieren hören, sagt
er.
Ja.
Doch nicht etwa schon
wieder mit diesem Darren Lippfisch.
Lipseed. Nein. Ich
habe Winnifred angerufen.
Winnifred. Onkel
Thobys Augenbrauen schnellen himmelwärts. Winnifred hatte er ganz
vergessen. Der hauchzarte Anflug eines Lächelns spielt um seine
Lippen. Sie hat selbstredend ein eigenes Telefon, sagt
er.
Handy.
Ah.
Und einen Moment lang
scheint es, als ob alles wieder lustig wird und gut. Aber dann
macht er plötzlich ein langes Gesicht und sagt: Ach, Odd, ich kann
mir lebhaft vorstellen, wie schwer es dir gefallen ist, alles
stehen und liegen zu lassen und…
Nein, es war nicht
schwer. Im Gegenteil. Es war kinderleicht. Ein Klacks.
Habe ich dir
eigentlich schon gesagt, wie sehr es mich freut, dass du gekommen
bist. Heute Morgen.
Ich glaube
schon.
Ich kann mich nicht
entsinnen. Ich kann nicht klar denken.
Macht
nichts.
Wir waren bei
Winnifred, sagt er nach einer Weile.
Ich erzähle ihm, dass
ich sie bei Linda und Chuck untergebracht habe. Und dass auch sie
im Komma lag. Nur ist sie wieder aufgewacht.
Dunkle Wolken ballen
sich wie Fäuste über dem Teich. Guck mal, sage ich.
Wir kriegen eine
Wetterbombe, sagt er und dreht sich um.
Eine
was.
Das ist ein neuer
meteorologischer Begriff, erklärt er. Was er bedeutet, kannst du
dir ja denken.
Eine Wetterbombe.
Hier bei uns. Das Wort hätte meinem Dad bestimmt
gefallen.
Oh ja. Er hat es
ständig benutzt, bis zum Erbrechen.
Ich nicke. Gleich
kommt’s mir hoch.
Pardon, sagt Onkel
Thoby und schlägt sich die Hand vor den Mund.
Macht
nichts.
Immer wenn der Wind
hindurchpfiff, stellte mein Dad sich unter die Abzugshaube und
sagte: Irre ich mich, oder ist das vielleicht ein b.
Denn wenn der Wind
ein b pfiff, kriegten wir schlechtes Wetter.
Für mich klingt das
eher nach einem ais, sagte Onkel Thoby dann.
Worauf mein Dad
sagte: You say potayto. I say
potahto.
Let’s call the whole thing off.
Worauf ich sagte: Wie
bitte.
Psst, Audrey, sperr
den Mund zu und die Ohren auf. Der Wind macht Musik.
Onkel Thoby steht auf
und räumt den Tisch ab. Apropos Wetter, sagt er. Ich hoffe, Toffs
Flug hat keine Verspätung.
Toff. Na, wenn
das kein Schlag ins Schlosskontor ist.
Was.
Er sieht mich mit
Unschuldsmiene an. Ich dachte, das hätte ich dir heute Morgen schon
gesagt.
Da muss ich kurz
überlegen. Ähm, nein.
Ich hatte
wahrscheinlich eine Montage, in der du die Mitteilung wohlwollend
aufgenommen hast.
Nein.
In meiner Montage
habe ich dir mitgeteilt, dass Toff auf dem besten Weg aus London
ist, und du hattest nichts dagegen.
Du hast mir kein Wort
davon gesagt!
Schrei nicht
so.
Habe ich geschrien.
Glaubt Onkel Thoby allen Ernstes, er könne mir Toff wie Falschgeld
unterjubeln. Du kannst mich doch nicht einfach vor vollendete
Tatsachen stellen.
Von einfach kann
überhaupt nicht die Rede sein. Ich habe mir immerhin die Mühe
gemacht, mir eine Montage auszudenken.
Scheiße.
Er kommt in ein paar
Stunden an.
Warum. Warum.
Weil ich ihn
angerufen habe.
Wann.
Nach dem
Unfall.
Kollision, verbessere
ich.
Auf dem Weg zur
Anrichte bleibt er stehen. Er ist unrasiert und sieht erbärmlich
aus in seinem viel zu kleinen Pulli. Der einmal meinem Dad gehört
hat. Am besten gar nicht hinsehen.
Und keinen Gedanken
an die Kollision verschwenden. Sonst garniere ich sie nämlich nur
mit allerlei Details. Wie zum Beispiel: Der Baum ist jetzt
geschmückt. Was er natürlich gar nicht gewesen sein kann. Der Baum,
der meinen Dad erschlagen hat, war zwar auf dem besten Wege,
geschmückt zu werden. Aber noch längst nicht am Ziel. Genau
genommen war er also gar kein Weihnachtsbaum. Noch nicht. Aber in
der neuen Version ist der Baum über und über mit Lichtern behängt,
die im Blau des einsamen Erfinders erstrahlen.
Oddly.
Ich schiebe meinen
Stuhl nach hinten. Dann ruf ihn an und lad ihn wieder
aus.
Er ist mitten über
dem Ozean.
Und plötzlich wünsche
ich mir, dass das Flugzeug abstürzt. Hoppla. Das ist ja
kinderleicht. Ein Klacks. Ich stelle mir vor, wie die Maschine im
Sturzflug in den Atlantik kracht. Toff ist in den unverständlichen
Teil der Zeitung mit der klitzekleinen Schrift vertieft und hat
darüber vergessen, sich mit der Funktionsweise seiner Schwimmweste
vertraut zu machen. O Gott. O Graus.
Toff ist
beziehungsweise war in Cambridge der »beste Kumpel« von meinem Dad.
Außerdem ist er Großmutters Prügelknabe und was noch. Richtig,
Anwalt. Und, wie Onkel Thoby mir soeben mitteilt, der
Testamentsvollstrecker von meinem Dad.
Oje oje oje, hat er
dir das erzählt.
Bitte setz dich. Ja,
das hat er mir erzählt, und ob du es glaubst oder nicht, es
stimmt.
Mein Dad würde nie im
Leben einen Vollstrecker engagieren.
Testamentsvollstrecker.
Toff, der
Oberhofscharfrichter Seiner Majestät!
Versteh doch, sagt
Onkel Thoby leise, dass ich nicht alles Nötige allein regeln kann.
Ich kann einfach nicht.
Ich bin doch da.
Es gibt Dinge, die
nur Toff ins Reine bringen kann.
Dann soll er das doch
bitte schön aus sicherer Entfernung tun. Bei uns wohnt er
jedenfalls nicht.
Onkel Thoby macht ein
enttäuschtes Gesicht, nicht etwa weil Toff nicht bei uns wohnen
wird, sondern weil ich so abweisend bin. Darum hat er auch nicht
gebeten, Oddly.
Dann wird Toffs
Maschine also (wahrscheinlich, leider, wohlbehalten) landen. Und er
wird auf der Stelle das Kommando übernehmen. Toff, der
heuchlerische Meuchelmörder. Der kommt, um meinen toten Dad
endgültig zu töten.
Aber als du Toff
angerufen hast, war mein Dad doch noch am Leben. Warum braucht ein
lebender Mensch einen Testamentsvollstrecker.
Weil keine Hoffnung
mehr bestand.
Ich starre ihn an. Du
hast mir aber nicht gesagt, dass keine Hoffnung mehr
bestand.
Doch, Liebes, das
habe ich dir gesagt. Aber du wolltest es nicht hören.
Chuck hat ein Buch aufgeschlagen auf der nackten
Brust liegen und probt. Das Buch heißt Im Bett
mit Macbeth: Shakespeare für
Einsteiger. Er trägt Boxershorts, sonst nichts.
Pool: circa 23
Grad.
Chuck schlägt
Im Bett mit Macbeth wahllos irgendwo
auf und tippt mit dem Finger auf die Seite. Dann probt er fragliche
Passage. Meistens stammt sie von einem gewissen Antonio. In diesem
Fall gleitet er mit dem Finger so lange seitab, bis er auf eine
bedeutendere Figur trifft.
Linda ist in aller
Herrgottsfrühe zur Arbeit gegangen. Sie mäht denselben Berg wie
Audrey. Also bin ich mit Chuck allein. So geht das jetzt jeden
Tag.
Eins von Lindas
langen blonden Haaren treibt wie eine goldene Brücke in meinem
Zitronentortenpool. Eine Brücke für eine Termite. Linda könnte in
Sachen Haarpflege ruhig etwas mehr Sorgfalt walten lassen. Heute
Morgen habe ich geschlagene drei Stunden gebraucht, um ein einziges
Haar aus meiner Kehle zu entfernen. Drei Stunden. Danach war ich so
erschöpft, dass ich erst einmal ein Nickerchen einlegen
musste.
Und wie ist es zu
diesem haarigen Missgeschick gekommen. Ganz einfach: Gestern Nacht
beugte Linda sich über mein Schloss und sagte: Alles klar,
Winnifred. Dabei hängte sie ihre Haare in den Pool. Schon mal was
von einem Pferdeschwanz gehört. Dann klopfte sie zu allem Überf
luss auch noch auf meinen Panzer, obwohl ich eindeutig wach war.
Sicher ist sicher, sagte sie.
Wehe, das geht jetzt
jede Nacht so.
Später trank ich aus
meinem Pool. Schwerer Fehler.
Wenigstens ist es
warm. Die Heizung klappert pausenlos im Morsecode vor sich hin. Als
Chuck vorhin an meinem Schloss vorbeikam, sagte er: Ich hoffe, du
bist zufrieden. Die Wohnung ist der reinste Backofen.
Tja. Das ist der
Preis dafür, dass ihr euch die Schildkröte nicht unter die Achsel
klemmen wolltet. Dabei kostet es euch eigentlich keinen Cent, denn
ich habe Linda sagen hören, dass die Heizkosten im Mietpreis
inbegriffen sind. Also was soll das Gejammer. Warum macht ihr es
nicht einfach wie ich und freut euch über die Luft, die über der
Heizung flirrt wie die Hitze über dem Asphalt. Freut euch des
Lebens.
Wird Audrey
wiederkommen. Das ist hier die Frage. Oder steht mir ein
Halterwechsel und damit ein Wechsel der Bezugsperson ins Haus. Und
liegt ein solcher Halter- beziehungsweise Bezugspersonenwechsel
überhaupt im Bereich des Möglichen oder gar Machbaren. Die
Alternative ist nicht eben verlockend. Linda die Ungepflegte oder
Chuck Stiller. So heißt Chuck nämlich mit Nachnamen. Das weiß ich,
weil gestern Abend ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes an der
Wohnungstür geklingelt und ihn mit Mr. Stiller angeredet
hat.
Was Linda aus
irgendeinem Grund urkomisch fand. Möchten Sie vielleicht ein wenig
Blut spenden, Mr. Stiller.
Halt die Klappe.
Nicht mehr lange, und du bist Mrs. Stiller.
Nur über meine
Leiche.
Später warf er sein
Buch auf den Boden mit den Worten, in jedem Stück käme irgendein
Antonio vor, und immer müsse er dafür herhalten.
Kleinvieh macht auch
Mist.
Was soll denn das nun
wieder heißen.
Es kann schließlich
nicht jeder das große Los ziehen.
Schwachsinn, sagte
er.
Chuck möchte Prospero
sein und nicht dessen Bruder. Er möchte alles beherrschen und sich
am Ende in sein Schwert stürzen. Oder in seinen Stab. Oder was weiß
ich. Er habe diese Nebenrollen satt, hat er gesagt. Am liebsten
würde er jemandem die Fresse polieren.
Auf dem Boden klappte
Im Bett mit Macbeth langsam, aber
sicher zu.
Chuck ist nämlich ein
passionierter Faustkämpfer.
Linda hat Audrey das
einmal wie folgt erklärt: Du kennst doch diese Schauspieler, die im
Park Shakespeare aufführen. Ja. Tja, Chuck gehört leider nicht zu
ihnen. Wenn Chuck einen Park entdeckt, in dem ein Shakespeare-Stück
gegeben wird, bringt er seine eigene Inszenierung mit seinen
eigenen Schauspielern auf die Bühne. Sprich an ein und demselben
Abend wird in ein und demselben Park womöglich zweimal ein und
dasselbe Stück gespielt. Oft liefern sich die beiden Ensembles
hinterher eine wüste Schlägerei. Diese Schlägereien ziehen ein ganz
anderes Publikum an. Und damit lässt sich richtig Geld
verdienen.
Das ist allerdings
nicht ganz ungefährlich. Letzten Sommer hat Chuck sich dabei eine
Rippe gebrochen. Wenn man sich seinen Oberkörper genau anschaut,
kann man die Delle sehen.
Es ist ja nicht so,
dass sie nichts Liebenswertes hätten, Linda und Chuck. Obwohl.
Nein, eigentlich haben sie ganz und gar nichts
Liebenswertes.
Ich habe schon häufig
– sehr häufig – die Bezugsperson gewechselt beziehungsweise
wechseln müssen, aber es ist mir niemals leichtgefallen, und ich
denke immer wieder: Diesmal schaffe ich es nicht.
Zum Beispiel der
Panasonic-Vertreter. Er war der Vormieter von Audrey und Cliff. Wie
habe ich den Panasonic-Vertreter geliebt. Er war nur selten zu
Hause, aber wenn, war es das Paradies auf Erden. Er kam mit
schiefer Krawatte zur Tür herein und sagte: Puh, hab ich eine
beschissene Woche hinter mir. Er hatte einen eigenen Bezirk. Einen
sehr großen Bezirk. Damals wohnte ich noch in einem
Panasonic-Druckerkarton, ohne Wärmelampe. Ich schlief
viel.
Er nannte mich Iris,
nach dem Panasonic-Irisscanner, einem der neuen biometrischen
Geräte in seinem Vertriebsportfolio. Eigentlich haben Schildkröten
keine Iris. Wir haben sogenannte Nickhäute. Aber was soll’s. Wie er
mir (beziehungsweise dem Badezimmerspiegel) erklärte, überprüfte
der Panasonic-Irisscanner die Identität (hoffentlich) befugter
Personen, bevor er ihnen Zutritt zu einem, sagen wir,
Forschungslabor für hochansteckende Krankheiten gewährte, indem er,
wie der Name schon sagt, ihre Iris scannte. Jede Iris habe ein
individuelles Muster, sagte er. Die Iris sei noch einzigartiger als
ein Fingerabdruck. Kann man »einzigartig« steigern, wollte ich
wissen. Hoffentlich sagst du nicht auch »noch einzigartiger«, wenn
du mit deinen Kunden sprichst, Mitt. So hieß er nämlich. Jedenfalls
wurde er ein sehr erfolgreicher Vertreter. So erfolgreich, dass
seine eigene Iris von den ganzen ungemein erfolgreichen
PIS-Demonstrationen allmählich verblasste.
Eines Tages dann
verkündete er aus heiterem Himmel, er sei nach Dubai versetzt
worden. Die Leute dort hätten Geld wie Heu und eine bunt
schillernde, wunderschöne Iris, die nur darauf warte, ihrer Farbe
beraubt zu werden. Dubai, sagte ich. Wahnsinn! Ich packe schon mal
meine Siebensachen.
Ähm, sagte
Mitt.
Ich hob den
Blick.
Mit einer Schildkröte
in die Vereinigten Arabischen Emirate, sagte Mitt. Daraus wird wohl
nichts werden.
Ach.
Die neuen Mieter
brauchen dich, sagte Mitt.
Ach.
Er sollte recht
behalten. Auch wenn ich sie anfangs nicht besonders mochte. Aber
mit der Zeit gewann ich Cliff recht lieb. Und dann schließlich auch
sie. Sie schwelgten oft und gerne in Erinnerungen an das Land, in
dem sie sich kennengelernt hatten und zusammen glücklich gewesen
waren. In diesem anderen Land gab es einen See, eine Straßenbahn,
Berge, die sich die Jalpen nannten, und hohe Decken. Sie erinnerten
sich mit Vorliebe an die Straßenbahn und dass Cliff sich nie eine
Fahrkarte kaufte und trotzdem nicht erwischt wurde.
Sie hatten heimlich
miteinander geschlafen, im Haus einer Frau, die Cliff nicht
sonderlich sympa fand. Aber das spielte
keine Rolle. Sie standen kurz vor einer Beziehung. Und Vorfreude
ist bekanntlich die schönste Freude. Das Schlafzimmer hatte hohe
Decken, Holzbalken und ein Oberlicht. Cliff kletterte auf einen
Stuhl und ritzte ihre Namen in einen Balken. Und das, ohne sich den
Kopf zu stoßen.