Kapitelelf
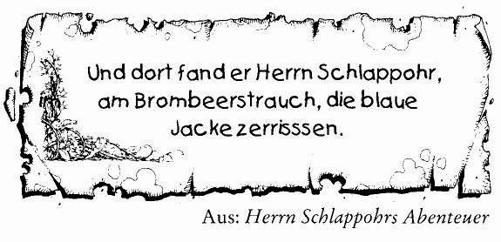 Der Rattenkönig tobte.
Der Rattenkönig tobte.
Die Ratten pressten sich die Pfoten an den Kopf. Pfirsiche schrie
und taumelte zurück, ließ das letzte brennende Streichholz
fallen.
Doch etwas in Maurice überlebte das Donnern, den Sturm aus Gedanken. Ein kleiner Teil von ihm verbarg sich hinter irgendeiner Gehirnzelle und duckte sich, als der Rest von Maurice weggeblasen wurde. Gedanken zerrissen und verschwanden im geistigen Orkan. Keine Sprache mehr, keine Fragen, keine Welt dort draußen mehr… Die mentalen Böen schälten einzelne Schichten des Selbst ab und rissen sie mit sich, all die Dinge, die Maurice mit Ich verband. Übrig blieb das Gehirn einer Katze. Es war eine clevere Katze, ja, aber… nur eine Katze.
Nichts weiter als eine Katze. Und ihr Wesen
reichte zurück in den Wald und zur Höhle, zu Fangzähnen und
Krallen…
Nur eine Katze.
Und man kann immer darauf vertrauen, dass eine
Katze eine Katze ist. Die Katze blinzelte. Sie war verwirrt und
zornig. Sie legte die Ohren an. In ihren grünen Augen blitzte
es.
Sie konnte nicht denken. Sie dachte nicht. Sie folgte allem dem
Instinkt, einer wortlosen Stimme auf dem Niveau von heißem
Blut.
Maurice war eine Katze, und vor ihm befand sich ein zuckendes,
quiekendes Etwas. Und wenn Katzen ein zuckendes, quiekendes Etwas
sehen, so springen sie…
Der Rattenkönig setzte sich zur Wehr. Zähne schnappten nach der Katze. Sie geriet in ein Knäuel aus kämpfenden Ratten und fauchte, als sie über den Boden rollte. Weitere Ratten eilten herbei, Ratten, die einen Hund töten konnten… Aber sie bekamen es mit einer Katze zu tun, die während dieser Sekunden einen Wolf hätte überwältigen können.
Sie bemerkte nicht, wie das Streichholz zu Boden fiel, wie eine flackernde Flamme nach Stroh tastete. Sie achtete nicht auf die anderen Ratten, die sich zur Flucht wandten. Sie ignorierte den dichter werdenden Rauch.
Sie wollte nur noch töten.
Ein dunkler Fluss hatte sich während der vergangenen Monate in Maurice gestaut. Er hatte zu viel Zeit damit verbracht, hilflos zu schäumen, während kleine quiekende Leute vor ihm hin und her liefen. Er hatte sich danach gesehnt zu springen, zu beißen und zu töten. Er hatte sich gewünscht, eine richtige Katze zu sein. Und jetzt war die Katze aus dem Sack, und so viel angestammter Kampfgeist, Bosheit und Gemeinheit durchströmten ihn, dass seine Krallen zu glühen schienen.
Als die Katze rollte, kratzte und biss, ertönte ganz hinten in ihrem kleinen Gehirn eine leise Stimme, eine Stimme, die in einer Ecke kauerte und versuchte, nicht im Weg zu sein, der letzte, winzige Teil, der noch immer Maurice war und kein blutrünstiger Irrer. Und diese Stimme sagte: »Jetzt! Beiß hier zu!«
Zähne und Krallen schlossen sich um einen Klumpen aus acht verknoteten Schwänzen und zerrissen ihn.
Der winzige Teil, der einst das Ich von Maurice gewesen war, hörte einen
vorbeistreichenden Gedanken.
Neeeiii… eeii… einnn…
Und dann verklang der Gedanke, und der Raum war voller Ratten, voller ganz gewöhnlicher Ratten, die versuchten, einer wütenden, fauchenden, knurrenden und blutrünstigen Katze zu entkommen, die es jetzt nachholte, eine richtige Katze zu sein. Sie kratzte und biss und zerfetzte und drehte sich um und sah eine kleine weiße Ratte, die sich während des ganzen Kampfes nicht bewegt hatte. Sie streckte die Krallen nach ihr aus…
Gefährliche Bohnen schrie. »Maurice!«
Die Tür erbebte, als Keiths Stiefel das Schloss zum zweiten Mal
traf. Beim dritten Tritt gab das Holz nach und brach.
Am anderen Ende des Kellers ragte eine Wand aus Feuer auf. Die dunklen, unheilvollen Flammen verschwanden immer wieder in dichtem Rauch. Der Clan strömte durchs Gitter, breitete sich auf beiden Seiten aus und starrte zum Feuer.
»O nein!«, rief Keith. »Komm, es stehen Eimer
neben der nächsten Tür!«
»Aber…«, begann Malizia.
»Wir müssen das erledigen! Schnell! Dies ist eine Aufgabe für große
Leute!«
Die Flammen zischten und knackten. Überall lagen tote Ratten, im Feuer und jenseits davon. Manchmal lagen nur Teile von Ratten auf dem Boden.
»Was ist hier passiert?«, fragte
Sonnenbraun.
»Anscheinend ein Krieg, Chef«, sagte Sardinen und beschnüffelte
die
Toten.
»Können wir an dem Feuer vorbei?«
»Zu heiß, Boss. Tut mir Leid, aber wir… Ist das Pfirsiche?« Sie lag
unweit der Flammen, mit schlammverkrustetem Fell und
murmelte leise vor sich hin. Sonnenbraun duckte
sich neben sie, daraufhin öffnete sie die Augen.
»Ist alles in Ordnung mit dir, Pfirsiche? Was ist mit Gefährliche
Bohnen geschehen?«
Sardinen klopfte ihm wortlos auf die Schulter und streckte die
Pfote aus.
Ein Schemen erschien im Feuer…
Das Geschöpf wankte durch eine Lücke zwischen den Flammen, und für
einen Moment ließ die wabernde Luft es riesig aussehen, wie ein
Ungeheuer, das aus einer Höhle kam. Dann wurde es zu einer… Katze. Rauch stieg von ihrem Fell auf. Was nicht dampfte, war voller Schlamm. Ein Auge war geschlossen. Die Katze hinterließ eine Spur aus Blut und sackte immer wieder in sich zusammen.
Sie trug ein kleines Bündel aus weißem Pelz im
Maul.
Die Katze erreichte Sonnenbraun und ging an ihm vorbei, ohne ihn
anzusehen. Die ganze Zeit über knurrte sie leise.
»Ist das Maurice?«, fragte
Sardinen.
»Er trägt Gefährliche Bohnen!«, rief Sonnenbraun. »Haltet die Katze auf!« Aber Maurice war von ganz allein stehen geblieben, drehte sich um, sank auf den Boden, die vorderen Beine nach vorn gestreckt, und sah die Ratten aus einem trüben Auge an.
Ganz vorsichtig setzte er das weiße Bündel ab. Er stieß es ein- oder zweimal an, um festzustellen, ob es sich bewegte. Er blinzelte, als es reglos blieb, und Verwirrung schien ihn wie in Zeitlupe zu erfassen. Als er den Mund öffnete, um zu gähnen, kam Rauch heraus. Dann ließ er den Kopf sinken und rührte sich nicht mehr.
Für Maurice war die Welt voll von jenem geisterhaften Licht kurz vor dem Morgengrauen, wenn es hell genug ist, um Dinge zu erkennen, aber noch nicht hell genug, um Farben zu sehen.
Er setzte sich auf und begann, sich zu putzen. Ratten und Menschen liefen um ihn herum, aber sehr, sehr langsam. Maurice schenkte ihnen keine Beachtung. Womit auch immer sie beschäftigt waren – es betraf ihn nicht. Andere Leute hasteten umher, auf stille, geisterhafte Weise, und ihre Eile ging ihn nichts an. Das schien eine ganz gute Regelung zu sein. Und sein Auge schmerzte nicht, und die Haut tat ihm nicht weh, und seine Pfoten waren nicht aufgerissen – das kurze Nickerchen schien Wunder gewirkt zu haben.
Er erinnerte sich nicht mehr daran, was vor dem Nickerchen geschehen war. Etwas Schreckliches, so viel stand fest. Neben ihm lag etwas Mauriceförmiges, wie ein dreidimensionaler Schatten. Er starrte darauf hinab und drehte den Kopf, als er in dieser geräuschlosen Geisterwelt ein Geräusch hörte.
Neben der Wand bewegte sich etwas. Eine kleine Gestalt schritt über den Boden und näherte sich dem kleinen Haufen, der Gefährliche Bohnen war. Ihre Größe entsprach der einer Ratte, und sie schien mehr Substanz zu haben, als die anderen Ratten. Im Gegensatz zu allen anderen Ratten, die Maurice jemals gesehen hatte, trug sie einen schwarzen Kapuzenmantel.
Eine Ratte, die Kleidung trägt, dachte er. Aber diese stammte nicht aus dem Buch Herrn Schlappohrs Abenteuer. Unter der Kapuze ragte die Knochennase eines Rattenschädels hervor. Außerdem trug die Gestalt eine Sense über der Schulter.
Die anderen Ratten und die Menschen, die noch immer hin und her eilten, schenkten ihr keine Beachtung. Einige von ihnen gingen direkt durch sie hindurch. Die kleine Gestalt und Maurice schienen sich in einer eigenen, separaten Welt zu befinden.
Es ist die Knochenratte, dachte Maurice. Der Grimmige Quieker. Und er will Gefährliche Bohnen holen. Nach all dem, was ich durchgemacht habe? Das lasse ich nicht zu!
Er sprang und landete auf der Knochenratte. Die kleine Sense rutschte über den Boden.
»So, mein Lieber, lass hören, was du zu sagen
hast«, knurrte Maurice. QUIEK!
»Äh…«, sagte Maurice, als ihm schrecklich klar wurde, was er
getan
hatte.
Eine Hand packte ihn am Nacken und hob ihn hoch, immer höher und
drehte ihn dann um.
Eine zweite Gestalt hielt ihn, viel größer als die erste, so groß wie ein Mensch. Aber der Look war der gleiche: schwarzer Kapuzenmantel, Sense, keine Haut im Gesicht. Eigentlich war das Gesicht auch gar kein Gesicht – es bestand nur aus Knochen.
HÖR AUF, MEINEN MITARBEITER ANZUGREIFEN,
MAURICE, sagte Tod.
»Ja, Herr, Herr Tod, Herr!«, erwiderte Maurice hastig. »Keine
weiteren Angriffe, Herr. Verstanden, Herr. Kein Problem,
Herr.«
ICH HABE DICH IN LETZTER ZEIT NICHT GESEHEN, MAURICE.
»Nein, Herr«, sagte Maurice und entspannte sich ein wenig. »Bin sehr vorsichtig gewesen, Herr. Sehe immer in beide Richtungen, bevor ich eine Straße überquere, Herr.«
UND WIE VIELE LEBEN HAST DU ÜBRIG?
»Sechs, Herr. Sechs. Zweifellos. Ganz genau sechs Leben, Herr.«
Tod wirkte überrascht. ABER SEIT VERGANGENEM
MONAT BIST DU UNTER EINEN KARREN GERATEN.
»Ach, du meinst den kleinen Unfall, Herr. Der Karren hat mich nur
gestreift, Herr, ganz leicht. Bin mit einigen Kratzern
davongekommen.«
EINER VON IHNEN WAR TÖDLICH, WENN ICH MICH
RECHT ENTSINNE.
»Äh…«
SOMIT SIND FÜNF LEBEN ÜBRIG, MAURICE. BIS ZUM
HEUTIGEN ZWISCHENFALL.
»Na schön, Herr. Na schön.« Maurice schluckte. Ein Versuch kann
nicht schaden, dachte er. »Sagen wir, mir bleiben drei,
einverstanden?«
DREI? ICH WOLLTE DIR NUR EINS NEHMEN. DU KANNST NUR JEWEILS EIN LEBEN VERLIEREN, SELBST WENN DU EINE KATZE BIST. DAMIT BLEIBEN DIR VIER, MAURICE.
»Ich schlage trotzdem vor, dass du zwei nimmst, Herr«, sagte Maurice. »Zwei Leben, und wir sind quitt?«
Tod und Maurice sahen auf die schattenhafte Silhouette von Gefährliche Bohnen. Einige andere Ratten umringten ihn und hoben ihn hoch.
BIST DU SICHER?, fragte Tod. IMMERHIN IST ER
EINE RATTE. »Ja, Herr. Genau an der Stelle wird alles kompliziert,
Herr.« DU KANNST ES NICHT ERKLÄREN?
»Nein, Herr. Weiß auch nicht, warum, Herr. In letzter Zeit ist
alles so
seltsam, Herr.«
DAS IST GANZ UND GAR NICHT KATZENHAFT VON DIR, MAURICE. ICH BIN
ERSTAUNT.
»Ich bin selbst ziemlich schockiert, Herr. Ich hoffe, niemand
findet es heraus, Herr.«
Tod setzte Maurice auf den Boden, direkt neben seinen Körper. DU LÄSST MIR KAUM EINE WAHL. DIE SUMME IST KORREKT, AUCH WENN MIR DIES ALLES SEHR SELTSAM ERSCHEINT. WIR SIND GEKOMMEN, UM ZWEI LEBEN ZU HOLEN, UND MIT ZWEI LEBEN GEHEN WIR… DAS GLEICHGEWICHT BLEIBT ERHALTEN.
»Darf ich etwas fragen, Herr?«, fragte Maurice,
als sich Tod zum Gehen wandte.
VIELLEICHT BEKOMMST DU KEINE ANTWORT.
»Es gibt keine Große Katze im Himmel, oder?«
DU ÜBERRASCHST MICH, MAURICE. NATÜRLICH GIBT ES KEINE KATZENGÖTTER. DAS LIEFE AUF ZU VIEL… ARBEIT HINAUS.
Maurice nickte. Es hatte auch Vorteile, eine Katze zu sein: Man verfügt über einige zusätzliche Leben, und die Theologie war viel einfacher. »Ich werde mich doch an nichts hiervon erinnern?«, fragte Maurice. »Es wäre mir zu peinlich.«
NATÜRLICH NICHT, MAURICE… »Maurice?«
Farben kehrten in die Welt zurück, und Keith streichelte ihn. Jeder noch so kleine Teil von Maurice stach oder schmerzte. Wie konnte ein Fell wehtun? Und seine Pfoten schrien ihn an, und ein Auge schien sich in einen Klumpen Eis verwandelt zu haben, und seine Lungen standen in Flammen.
»Wir haben dich für tot gehalten!«, sagte Keith. »Malizia wollte dich in ihrem Garten vergraben! Sie meint, sie hätte bereits einen schwarzen Schleier.«
»In ihrer Abenteuertasche?«
»Natürlich«, bestätigte Malizia. »Angenommen, wir hätten uns auf einem Floß wiedergefunden, mitten auf einem Fluss mit Fleisch fressenden…«
»Ja, ja, schon gut«, knurrte Maurice. Es roch
nach verbranntem Holz und schmutzigem Dampf.
»Ist alles in Ordnung mit dir?«, fragte Keith noch immer besorgt.
»Jetzt bist du wirklich eine schwarze Katze!«
»Ha ha, ja, ha ha«, erwiderte Maurice trübsinnig. Er stand mühsam
auf. »Ist die kleine Ratte wohlauf?«, fragte er und versuchte, sich
umzusehen.
»Gefährliche Bohnen war ebenso hinüber wie du, aber als sie ihn bewegten, hustete er viel Schlamm aus. Es geht ihm nicht gut, doch er erholt sich langsam.«
»Ende gut, alles…« Maurice schnitt eine
Grimasse. »Es tut weh, wenn ich den Kopf bewege.«
»Das liegt an Dutzenden von Rattenbissen.«
»Wie sieht mein Schwanz aus?«
»Oh, gut. Er ist noch fast ganz dran.«
»Das erleichtert mich. Na schön: Ende gut, alles gut. Das Abenteuer
ist
vorbei, Zeit für Tee und Kekse…«
»Nein«, sagte Keith. »Da wäre noch das Problem des Pfeifers.«
»Können sie ihm nicht einfach einen Dollar für seine Mühe geben und ihn fortschicken?«
»Bei einem Rattenpfeifer ist das nicht
möglich«, sagte Keith. »So etwas sagt man einem Rattenpfeifer
nicht.«
»Übler Bursche?«
»Keine Ahnung. Könnte sein. Aber wir haben einen Plan.«
Maurice knurrte. » Du hast einen Plan?«, erwiderte er. »Hast du ihn
selbst entwickelt?«
»Zusammen mit Sonnenbraun und Malizia.«
»Erzähl mir von einem wundervollen Plan«, seufzte Maurice.
»Wir lassen die Kiekies in den Käfigen, und keine Ratte wird sich zeigen, um dem Pfeifer zu folgen«, erklärte Malizia. »Dann steht er ziemlich dumm da.«
»Das ist alles? Das ist euer Plan?«
»Glaubst du nicht, dass es funktionieren könnte?«, fragte Keith.
»Malizia meint, die ganze Sache wäre dem Pfeifer so peinlich, dass
er geht.«
»Ihr wisst nicht viel über Leute, wie?«,
seufzte Maurice.
»Was? Ich bin eine Person!«, stieß Malizia hervor.
»Und? Katzen wissen über Leute
Bescheid. Das müssen wir. Niemand
sonst kann Speiseschränke öffnen. Meine Güte, selbst der Rattenkönig hatte bessere Pläne. Ein guter Plan sieht nicht vor, dass jemand gewinnt. Ein guter Plan bewirkt, dass niemand glaubt, verloren zu haben. Versteht ihr? Ihr müsst folgendermaßen vorgehen… Nein, das klappt nicht, dazu brauchen wir viel Watte…«
Malizia griff triumphierend nach ihrer Tasche. »Ich habe an die Möglichkeit gedacht, an Bord eines großen mechanischen Tintenfisches gefangen zu sein«, sagte sie. »Und bei der Flucht…«
»Soll das etwa heißen, dass du viel Watte dabei
hast?«, fragte Maurice. »Ja!«
»Wie konnte ich nur daran zweifeln.«
Sonnenbraun stieß sein Schwert in den Schlamm. Die ranghohen Ratten versammelten sich um ihn herum, aber inzwischen war das Rangsystem durcheinander geraten. Die Gruppe der Ranghohen bestand nicht nur aus alten Ratten, sondern auch aus jungen, und jede von ihnen hatte einen roten Fleck über den Augen.
Sie alle schnatterten. Sonnenbraun roch ihre Erleichterung darüber, dass die Knochenratte vorbeigegangen war, ohne sich ihnen zuzuwenden…
»Ruhe!«, rief er.
Seine Stimme war so laut wie ein Gongschlag. Sofort verstummten
die
Ratten, und die Blicke aller roten Augen richteten sich auf ihn. Er war müde und konnte kaum richtig atmen. Ruß und Blut klebten an seinem Pelz. Ein Teil des Blutes stammte nicht von ihm.
»Es ist noch nicht vorbei«, sagte er.
»Aber wir haben gerade…«
»Es ist noch nicht vorbei!« Sonnenbraun
sah sich in dem Kreis um. »Einige der großen Ratten, der richtigen
Kämpfer, sind entkommen«, schnaufte er. »In Salzlake, du kehrst mit
zwanzig Ratten zurück und beschützt die Nester. Gut Gespart und die
alten Weibchen sind dort, bereit dazu, jeden Angreifer in Stücke zu
reißen, aber ich möchte sichergehen.«
Im Gesicht von In Salzlake zeigte sich Trotz.
»Ich sehe nicht ein, warum ich …«
»Tu, was ich dir sage!«
In Salzlake duckte sich, winkte den Ratten weiter hinten zu und
eilte davon.
Sonnenbraun sah die anderen an. Als sein Blick über sie hinwegstrich, wichen einige zurück, als wäre er eine Flamme. »Wir bilden einzelne Trupps«, sagte er. »Der Teil des Clans, der nicht zur Bewachung gebraucht wird, bildet Trupps! Nehmt Feuer mit! Und einige der jungen Ratten halten als Melder die Verbindung aufrecht! Geht nicht in die Nähe der Käfige – die armen Geschöpfe darin können warten! Nehmt euch alle Tunnel, Keller, Löcher und Ecken vor! Und wenn ihr einer fremden Ratte begegnet, die sich duckt, so nehmt sie gefangen! Aber wenn sie zu kämpfen versucht – und die großen werden kämpfen, denn sie kennen nichts anderes –, tötet sie! Verbrennt oder beißt sie! Wer gegen euch kämpfen will, muss sterben! Habt ihr verstanden?«
Die Ratten murmelten zustimmend.
»Ich will wissen, ob ihr mich verstanden
habt!«
Die Stimmen der Ratten donnerten.
»Gut! Wir machen weiter, bis die Tunnel sicher sind, vom einen
Ende
bis zum anderen! Und dann kontrollieren wir sie
noch einmal! Bis die Tunnel uns
gehören! Denn…« Sonnenbraun griff nach seinem Schwert und lehnte
sich kurz darauf, um wieder zu Atem zu kommen. Seine Stimme war
kaum mehr als ein Flüstern, als er hinzufügte: »Denn wir sind jetzt
im Herzen des Dunklen Walds, und wir haben den Dunklen Wald in
unserem Herzen gefunden, und in dieser Nacht sind wir etwas…
Schreckliches.« Er schnappte erneut nach Luft, und seine nächsten
Worte hörten nur die Ratten, die in unmittelbarer Nähe standen.
»Und es gibt keinen anderen Ort für uns.«
Der Morgen dämmerte. Feldwebel Doppelpunkt, der die eine Hälfte der
offiziellen Stadtwache von Bad Blintz bildete (und zwar die größere
Hälfte), erwachte mit einem Schnauben im kleinen Büro am
Haupttor.
Er zog sich an, wobei er gelegentlich wankte, wusch sich das Gesicht im steinernen Becken und blickte dann in die Spiegelscherbe an der Wand.
Er verharrte, als er ein leises, aber recht deutliches Quieken hörte. Das kleine Gitter über dem Abfluss wurde beiseite geschoben, und eine Ratte sauste aus der Öffnung. Sie war groß und grau, lief über den Arm des Wächters und sprang zu Boden.
Wasser tropfte von Doppelpunkts Gesicht, als er mit verschlafenem Erstaunen beobachtete, wie drei kleinere Ratten aus dem Abfluss kamen und die große verfolgten. Sie drehte sich auf dem Boden, um zu kämpfen, aber die anderen Ratten stürzten sich gleichzeitig und aus drei verschiedenen Richtungen auf sie. Es sah eigentlich nicht nach einem Kampf aus, fand der Feldwebel, eher nach einer Hinrichtung…
In der Wand gab es ein altes Rattenloch. Zwei der Ratten griffen nach dem Schwanz der großen und zogen sie hindurch. Die dritte Ratte blieb dort kurz stehen, und zwar auf den Hinterbeinen.
Doppelpunkt glaubte, ihren Blick zu spüren. Sie sah nicht aus wie ein Tier, das einen Menschen beobachtete, um festzustellen, ob Gefahr von ihm drohte. Sie wirkte nicht ängstlich, eher neugierig. Über ihren Augen erkannte er einen roten Fleck.
Die Ratte salutierte. Es dauerte nur eine Sekunde, aber sie
salutierte zweifellos. Dann waren alle Ratten
verschwunden.
Der Feldwebel starrte eine Zeit lang zum Loch, während ihm weiter
Wasser vom Kinn tropfte.
Und er hörte den Gesang. Er tönte aus dem Abfluss und hallte wider, schien aus weiter Ferne zu kommen. Eine Stimme sang etwas vor, und viele andere Stimmen antworteten:
»Wir kämpfen gegen Hunde, und Katzen jagen wir…« »…keine Falle kann den Ratten trotzen hier!« »Wir haben keine Flöhe und auch nicht die Pest…« »…wir trinken Gift und stehlen Käse fürs Fest!« »Und wehe euch, wenn ihr uns nicht in Ruhe lasst…« »…dann tun wir Gift in euren Tee, aufgepasst!« »Wir kämpfen hier und bleiben an diesem Ort…« »…WIR GEHEN NIE MEHR FORT!«
Der Gesang verklang. Feldwebel Doppelpunkt blinzelte und sah zu der Flasche Bier, die er am vergangenen Abend getrunken hatte. Beim Nachtdienst konnte man sich sehr einsam fühlen. Außerdem bestand kaum die Gefahr, dass jemand in Bad Blintz einfiel. Hier gab es gar nichts zu holen.
Vermutlich war es eine gute Idee, niemandem von dieser Sache zu erzählen, dachte
Doppelpunkt.
Wahrscheinlich war gar nichts passiert. Das Bier musste schlecht
gewesen sein…
Die Tür des Wachhauses öffnete sich, und
Korporal Knopf kam herein.
»Morgen, Feldwebel«, sagte er. »Ich… Was ist mit dir los?«
»Nichts, Korporal!«, erwiderte Doppelpunkt rasch und trocknete sich das Gesicht ab. »Ich habe eindeutig nichts Sonderbares gesehen! Was stehst du da herum? Es wird Zeit, das Tor zu öffnen, Korporal!«
Die Wächter traten nach draußen und öffneten
das Stadttor. Sonnenschein glänzte ihnen entgegen.
Und mit dem Sonnenschein kam ein langer, langer Schatten.
Meine Güte, dachte Feldwebel Doppelpunkt. Dieser Tag hat schlecht begonnen, und es wird nicht besser werden…
Der Mann auf dem Pferd ritt vorbei, ohne auf die beiden Wächter zu achten. Sie folgten ihm hastig zum Stadtplatz. Eigentlich sollte man von Leuten erwarten, dass sie Bewaffneten Beachtung schenkten.
»Halt, was führt dich hierher?«, fragte Korporal Knopf. Er musste seitwärts laufen, um mit dem Pferd Schritt zu halten. Die Kleidung des Reiters war schwarz und weiß; er sah aus wie eine menschliche Elster. Er antwortete nicht, lächelte nur vor sich hin.
»Na schön, vielleicht hat dich nichts hierher geführt, aber du könntest uns ruhig sagen, wer du bist«, sagte Korporal Knopf, der keinen Ärger wollte.
Der Reiter blickte auf ihn hinab und sah dann wieder nach vorn.
Feldwebel Doppelpunkt sah einen kleinen Planwagen durchs Tor rollen, gezogen von einem Esel. Ein Alter saß auf dem Kutschbock. Doppelpunkt erinnerte sich daran, dass er Feldwebel war. Das bedeutete, dass er mehr Sold bekam als der Korporal, was wiederum bedeutete, dass er teurere Gedanken dachte. Und der momentane Gedanke lautete: Sie mussten doch nicht jeden kontrollieren, der durchs Tor kam. Insbesondere dann, wenn es viel zu tun gab. Es ging darum, zufällig Leute auszuwählen, um sie zu kontrollieren. Und wenn man jemanden zufällig auswählte, so war es eine gute Idee, sich für einen kleinen Alten zu entscheiden, der klein und alt genug wirkte, um sich von einer schmuddeligen Uniform und einem rostigen Kettenhemd beeindrucken zu lassen.
»Halt!«
»He, he, von wegen«, erwiderte der Alte. »Hüte dich vor dem Esel.
Er beißt gern zu, wenn er sich ärgert. Mich schert’s
nicht.«
»Zeigst du etwa Verachtung vor dem Gesetz?«, fragte Feldwebel
Doppelpunkt.
»Ich versuche nicht, sie zu verbergen. Du solltest besser mit meinem Boss reden. Damit meine ich den Mann auf dem Pferd. Auf dem großen Pferd.«
Der schwarz und weiß gekleidete Fremde war beim
Brunnen in der Mitte des Platzes abgestiegen und öffnete die
Satteltaschen.
»Na schön, ich gehe zu ihm«, brummte der Feldwebel.
Er ging so langsam wie möglich, und als er den Fremden erreichte, hatte der Mann einen kleinen Spiegel an den Brunnen gelehnt und rasierte sich. Korporal Knopf stand in der Nähe und hielt die Zügel des Pferdes.
»Warum hast du ihn nicht verhaftet?«, flüsterte
der Feldwebel dem Korporal zu.
»Was, für illegales Rasieren? Verhafte du ihn, wenn du unbedingt willst.«
Feldwebel Doppelpunkt räusperte sich. Einige Frühaufsteher unter den Bewohnern von Bad Blintz beobachteten ihn bereits. »Äh … hör mal, Freund, bin sicher, du wolltest nicht…«, begann er.
Der Mann richtete sich auf und bedachte die beiden Wächter mit einem Blick, der sie einen Schritt zurücktreten ließ. Er streckte die Hand aus und löste einen Riemen, der ein dickes Lederbündel hinter dem Sattel zusammenhielt.
Das Bündel öffnete sich. Korporal Knopf riss die Augen auf. An dem breiten Lederband steckten Dutzende von Flöten in Schlaufen. Sie glänzten im Schein der aufgehenden Sonne.
»Oh, du bist der Pfei…«, begann Doppelpunkt, doch der Mann wandte sich wieder dem Spiegel zu und sprach wie zu seinem Spiegelbild: »Wo kann man hier ein Frühstück bekommen?«
»Oh, wenn du ein Frühstück möchtest, so kann
dir Frau Schieber vom Blauen Kohl…«
»Würstchen«, sagte der Pfeifer und rasierte sich weiter. »Auf einer
Seite gebraten. Drei. Hier. In zehn Minuten. Wo ist der
Bürgermeister?«
»Wenn du dort über die Straße gehst und die
erste Abzweigung auf der linken Seite nimmst…«
»Hol ihn.«
»He, du kannst doch nicht…«, begann Feldwebel Doppelpunkt, aber Korporal Knopf griff nach seinem Arm und zog ihn fort.
»Er ist der Pfeifer!«, flüsterte er. »Man verärgert keinen Pfeifer! Weißt du denn nicht Bescheid? Wenn er mit seinen Flöten bestimmte Töne spielt, fallen einem die Beine ab!«
»Was, wie bei der Pest?«
»Es heißt, der Stadtrat von Schweinebacke wollte ihn nicht bezahlen, deshalb spielte er auf einer besonderen Flöte und führte alle Kinder in die Berge, und man sah sie nie wieder!«
»Glaubst du, dazu ließe er sich auch hier überreden? Dann wäre es viel ruhiger in Bad Blintz.«
»Ha! Hast du jemals von dem Ort in Klatsch gehört? Dort griff man bei einer Pantomimenplage auf die Dienste eines Pfeifers zurück, und als man ihn nicht bezahlte, ließ er die Wächter in den Fluss tanzen und ertrinken!«
»Nein!«, entfuhr es Feldwebel Doppelpunkt. »Tat er das wirklich? Welch ein Teufel!«
»Er verlangt dreihundert Dollar, wusstest du
das?«
»Dreihundert Dollar!«
»Deshalb bezahlen die Leute nicht gern«, sagte Korporal Knopf.
»Warte mal… Wie kann es zu einer Pantomimenplage kommen?« »Oh, es
soll schrecklich gewesen sein. Die Leute wagten sich nicht
mehr auf die Straße.«
»Du meinst, all die weißen Gesichter und die seltsamen, lautlosen
Bewegungen…«
»Genau. Schrecklich. Wie dem auch sei: Als ich erwachte,
tanzte eine Ratte auf meiner
Frisierkommode. Tippeti, tippeti, tipp.«
»Wie seltsam«, sagte Feldwebel Doppelpunkt und maß den Korporal mit
einem sonderbaren Blick.
»Und sie summte There’s no Business
like Show Business. Das nenne ich mehr als nur
›seltsam‹.«
»Nein, ich finde es seltsam, dass du eine Frisierkommode hast. Ich
meine, du bist nicht einmal verheiratet.«
»Hör auf damit, Feldwebel.«
»Hat die Kommode einen Spiegel?«
»Ich bitte dich, Feldwebel. Du holst die Würstchen und ich den
Bürgermeister.«
»Nein, Knopf. Du holst die Würstchen,
und ich hole den Bürgermeister,
denn der Bürgermeister ist gratis, aber Frau
Schieber will bestimmt bezahlt werden.«
Der Bürgermeister war bereits auf, als der Feldwebel eintraf. Mit
besorgter Miene wanderte er durchs Haus.
Seine Besorgnis wuchs, als er den Feldwebel sah. »Was hat sie
diesmal angestellt?«, fragte er.
»Herr?«, erwiderte Doppelpunkt. Er sprach dieses Wort im Sinne von
»Wovon redest du da?« aus.
»Malizia war die ganze Nacht über draußen«, sagte der Bürgermeister. »Befürchtest du, ihr könnte etwas zugestoßen sein, Herr?« »Nein, ich befürchte, dass sie jemandem zugestoßen ist, Mann! Weißt
du noch letzten Monat? Als sie dem
Geheimnisvollen Kopflosen Reiter auflauerte?«
»Nun, du musst zugeben, dass er ein Reiter war, Herr.«
»Stimmt. Aber er war ein kleiner Mann mit einem sehr hohen
Kragen.
Und er war der Chefsteuereintreiber aus Hinterhalb. Ich bekomme deshalb noch immer offizielle Briefe! Steuereintreiber mögen es prinzipiell nicht, wenn junge Damen aus Bäumen auf sie springen! Und dann im September die Sache mit, mit…«
»Das Geheimnis der Schmuggler-Windmühle, Herr«, sagte der Feldwebel und rollte mit den Augen.
»Das Geheimnis bestand aus Herrn Vogel, dem Stadtdirektor, und Frau Schuhmann, der Ehefrau des Schuhmachers, die sich zufällig in der Mühle trafen, weil sie sich beide für Schleiereulen interessieren…«
»… und Herr Vogel trug deshalb keine Hose, weil er sie sich an einem Nagel aufgerissen hatte…«, sagte der Feldwebel, ohne den Bürgermeister anzusehen.
»…und Frau Schuhmann flickte sie
freundlicherweise für ihn«, erwiderte der Bürgermeister.
»Im Mondschein«, fügte Doppelpunkt hinzu.
»Sie hat eben gute Augen!«, sagte der
Bürgermeister scharf. »Und sie verdiente es keineswegs, gefesselt
und geknebelt zu werden, zusammen mit Herrn Vogel, der sich
deswegen erkältete! Ich bekam Beschwerden von ihm und von ihr,
und von Frau Vogel und von Herrn Schuhmann, und von Herrn Vogel, nachdem Herr Schuhmann zu ihm
gekommen war, um ihm einen Leisten auf den Kopf zu schlagen,
und von Frau Schuhmann, weil Frau Vogel
ihr gegenüber hässliche Worte gebrauchte…«
»Das hat er sich geleistet, Herr?«
»Was?«
»Ich meine, Herr Schuhmann hat es sich geleistet, Herrn Vogel
mit
einem Leisten auf den Kopf zu schlagen, Herr?« Doppelpunkt zwinkerte, um auf das Wortspiel hinzuweisen.
»Ein Leisten, Mann! Das ist ein hölzerner Fuß, den Schuhmacher für die Herstellung von Schuhen verwenden! Der Himmel weiß, was Malizia diesmal macht!«
»Wahrscheinlich finden wir es heraus, wenn wir den Knall hören, Herr.«
»Und aus welchem Grund bist du zu mir gekommen, Feldwebel?« »Der
Rattenpfeifer ist hier, Herr.«
Der Bürgermeister erblasste. »Schon?«,
ächzte er.
»Ja, Herr. Er rasiert sich am Brunnen.«
»Wo ist meine Amtskette? Wo ist mein Amtsmantel? Wo ist mein
Amtshut? Na los, Mann, hilf mir!«
»Er scheint ein sehr langsamer Reiter zu sein, Herr«, sagte der
Feldwebel und folgte dem Bürgermeister im Laufschritt hinaus.
»Der Bürgermeister von Vorderrücken ließ den Pfeifer zu lange warten, deshalb spielte er auf seiner Flöte und verwandelte ihn in einen Dachs!«, brachte der Bürgermeister hervor und öffnete einen Schrank. »Ah, hier sind die Sachen ja… Bitte hilf mir dabei.«
Als sie außer Atem den Platz erreichten, saß der Pfeifer auf der Bank, in sicherer Entfernung umgeben von einer großen Menge. Er untersuchte ein halbes Würstchen am Ende einer Gabel. Korporal Knopf stand wie ein Schüler neben ihm, der gerade eine schlechte Arbeit abgeliefert hat und darauf wartet zu erfahren, wie schlecht sie ist.
»Und dies nennt man ein…?«, fragte der
Pfeifer.
»Ein Würstchen, Herr«, sage Korporal Knopf kleinlaut.
»So etwas hält man hier für ein Würstchen?« Den Zuschauern stockte der Atem. Bad Blintz war sehr stolz auf seine traditionellen Wühlmaus-und-Schweinefleisch-Würstchen.
»Ja, Herr«, bestätigte Korporal
Knopf.
»Erstaunlich«, sagte der Pfeifer. Er sah zum Bürgermeister auf.
»Und du bist…?«
»Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt und…«
Der Pfeifer hob die Hand und nickte in Richtung des Alten, der auf dem Kutschbock des Planwagens saß und breit grinste. »Mein Agent wird mit dir verhandeln«, sagte er, warf das Würstchen weg, legte die Füße aufs andere Ende der Bank, schob den Hut vor die Augen und legte sich hin.
Der Bürgermeister lief rot an. Feldwebel
Doppelpunkt beugte sich zu ihm.
»Denk an den Dachs, Herr!«, flüsterte er.
»Äh… ja…« Mit dem Rest Würde, der ihm noch geblieben war, ging der Bürgermeister zum Wagen. »Ich glaube, die Gebühr für die Befreiung einer Stadt von ihren Ratten beträgt dreihundert Dollar«, sagte er.
»Dann nehme ich an, dass du alles glaubst«, erwiderte der Alte. Ein offenes Notizbuch lag auf seinem Knie. »Mal sehen… Bereitschaftsgebühr… plus Sonderzuschlag, weil heute der Tag des heiligen Humpel ist… außerdem Flötensteuer… diese Stadt scheint mittelgroß zu sein, und das kostet extra… Abnutzung des Wagens… Reisespesen ein Dollar pro Meile… verschiedene Kosten, Steuern und Zuschläge…« Er sah auf. »Sagen wir tausend Dollar, einverstanden?«
»Tausend Dollar? So viel Geld haben wir nicht!
Es ist unverschämt, tausend Dollar von
uns zu ver…«
»Dachs, Herr!«, flüsterte Feldwebel Doppelpunkt.
»Ihr könnt nicht bezahlen?«, fragte der
Alte.
»Wir haben keine tausend Dollar! Wir mussten viel Geld für
Lebensmittel ausgeben!«
»Ihr habt überhaupt kein Geld?«, fragte
der Alte.
»Nicht so viel, nein!«
Der Alte kratzte sich am Kinn. »Hmm«, sagte er. »Ich fürchte,
daraus
könnte sich ein Problem ergeben, denn… mal sehen…« Er kritzelte in seinem Notizbuch, sah dann wieder auf. »Ihr schuldet uns bereits vierhundertsiebenundsechzig Dollar und neunzehn Cent für Bereitschaft,
Reise und diverse Unkosten.«
»Was? Aber er hat noch nicht einmal auf der Flöte gespielt!« »Aber
er ist dazu bereit«, erwiderte der
Alte. »Wir sind den ganzen
weiten Weg gekommen. Ihr könnt nicht bezahlen? Tja, üble Sache. Er muss irgendetwas aus der Stadt führen, verstehst du? Sonst spricht es sich herum, und dann hat niemand mehr Respekt, und ein Pfeifer ohne Respekt ist…«
»…eine Null«, ertönte eine Stimme. »Ich halte
ihn für eine Null.« Der Pfeifer hob die Krempe des Huts.
Die Leute vor Keith wichen hastig beiseite.
»Ach?«, erwiderte der Pfeifer.
»Ich glaube, er kann nicht einmal eine Ratte hervorlocken«, sagte Keith. »Er ist nur ein Schwindler und Angeber. Ha, ich wette, ich kann mehr Ratten herbeipfeifen als er.«
Einige Leute schlichen möglichst unauffällig
fort. Niemand wollte in der Nähe sein, wenn der Rattenpfeifer die
Geduld verlor.
Der Pfeifer stellte die Füße auf den Boden und schob den Hut nach
oben. »Bist du ein Rattenpfeifer, Junge?«, fragte er
sanft.
Keith schob trotzig das Kinn vor. »Ja. Und nenn mich nicht Junge…
Alter.«
Der Pfeifer lächelte. »Ah«, sagte er. »Ich wusste, dass mir diese Stadt gefallen würde. Und du
kannst eine Ratte tanzen lassen, Junge?«
»Mehr als du, Pfeifer.«
»Klingt wie eine Herausforderung«, meinte der Pfeifer.
»Der Pfeifer nimmt keine Herausforderungen von…«, begann der
Alte
auf dem Kutschbock des Wagens, aber der Rattenpfeifer brachte ihn mit einem Wink zum Schweigen.
»Weißt du, Junge, es geschieht nicht zum ersten Mal, dass ein Junge so etwas versucht«, sagte er. »Ich gehe über die Straße, und jemand ruft: ›Lass mal deine Pikkoloflöte hören‹, und dann drehe ich mich um, und immer stammen diese Worte von einem dumm aussehenden Jungen. Aber ich möchte nicht, dass man mir nachsagt, unfair zu sein. Wenn du dich entschuldigst, kannst du diesen Ort vielleicht mit der gleichen
Anzahl von Beinen verlassen, mit der du hierher
gekommen bist…« »Du hast Angst.«
Malizia trat aus der Menge.
Der Pfeifer sah sie an und lächelte. »Glaubst du?«
»Ja, denn jeder weiß, was in einer solchen Situation geschieht.
Lass
mich diesen dumm aussehenden Jungen, dem ich nie zuvor begegnet bin, fragen: Bist du ein Waisenkind?«
»Ja«, sagte Keith.
»Weißt du überhaupt nichts von deiner Herkunft?«
»Nein.«
»Aha!«, sagte Malizia. »Das ist der Beweis. Wir alle wissen, was passiert,
wenn ein geheimnisvolles Waisenkind erscheint und etwas Großes und Mächtiges herausfordert. Es ist so ähnlich wie mit dem dritten und jüngsten Sohn eines Königs. Er kann gar nicht anders als gewinnen!«
Sie wandte sich triumphierend an die Menge. Doch die Menge wirkte skeptisch. Die Leute hatten nicht so viele Geschichten gelesen wie Malizia und fühlten sich sehr mit den Erfahrungen des wahren Lebens verbunden, die lehrten: Wenn etwas Kleines und Gerechtes gegen etwas Großes und Scheußliches antritt, so ist ihm eine ordentliche Abreibung gewiss.
Doch weiter hinten rief jemand: »Gebt dem dumm aussehenden Jungen eine Chance! Bestimmt kostet er nicht so viel!« Und jemand anders rief: »Ja, das stimmt!« Und noch jemand rief: »Ich stimme den anderen beiden zu!« Und niemand schien zu bemerken, dass die Stimmen vom Boden kamen und von einer verdreckten Katze ausgingen, die einen großen Teil ihres Fells eingebüßt hatte. Ein Murmeln breitete sich aus, ohne Worte, die jemand in Schwierigkeiten bringen konnten, wenn der Pfeifer böse wurde. Das Murmeln wies auf eine sehr allgemeine Weise darauf hin, dass niemand Ärger machen wollte, und wenn man alle Dinge berücksichtigte und alles sorgfältig gegeneinander abwog, so würden die Leute dem Jungen ganz gern eine Chance geben, wenn du damit einverstanden bist, nichts für ungut.
Der Pfeifer zuckte mit den Schultern. »Na schön«, sagte er. »Es dürfte für Gesprächsstoff sorgen. Und was bekomme ich, wenn ich gewinne?«
Der Bürgermeister hüstelte. »Ist die Hand meiner Tochter unter solchen Umständen angemessen?«, fragte er. »Sie hat gute Zähne und wäre eine gu… eine Ehefrau für jemanden mit genug Regalen…«
»Vater!«, rief Malizia.
»Später, natürlich, später. Er ist unangenehm, aber reich.« »Nein,
ich nehme nur meine Bezahlung«, erwiderte der Pfeifer. »So
oder so.«
»Ich habe doch gesagt, dass wir nicht so viel Geld haben!«,
entgegnete der Bürgermeister.
»Und ich habe gesagt, so oder so«, wiederholte der Pfeifer. »Und
du, Junge?«
»Deine Rattenflöte«, sagte Keith.
»Nein. Sie ist magisch, Junge.«
»Warum hast du dann Angst, um sie zu wetten?«
Der Pfeifer kniff ein Auge zusammen. »Na schön«, sagte er. »Und die
Stadt soll mich ihr Rattenproblem lösen lassen«, fügte Keith
hinzu.
»Und wie viel verlangst du?«, fragte
der Bürgermeister.
»Dreißig Goldstücke! Dreißig Goldstücke, na los, sag es!«, ertönte eine
Stimme hinten in der Menge.
»Es kostet überhaupt nichts«, sagte Keith.
»Idiot!«, rief die Stimme in der Menge. Die Leute sahen sich
verwirrt
um.
»Überhaupt nichts?«, fragte der Bürgermeister.
»Nein, nichts.«
»Äh… die Hand der Tochter ist noch im Angebot…«
»Vater!«
»Nein, so etwas geschieht nur in Geschichten«, sagte Keith. »Und
ich
werde auch viele der von den Ratten gestohlenen
Lebensmittel zurückbringen.«
»Sie haben sie gefressen!«, erwiderte
der Bürgermeister. »Was willst du machen? Ihnen den Finger in den
Hals stecken?«
»Ich habe gesagt, dass ich das Rattenproblem lösen werde«,
betonte
Keith. »Einverstanden,
Bürgermeister?«
»Nun, wenn du nichts verlangst…«
»Aber zuerst muss ich mir eine Flöte leihen«, sagte Keith. »Du hast
keine?«, fragte der Bürgermeister.
»Sie ist zerbrochen.«
Korporal Knopf stieß den Bürgermeister an. »Ich habe eine
Posaune
aus meiner Zeit beim Militär«, sagte er. »Ich
könnte sie schnell holen.« Der Pfeifer lachte.
»Zählt das nicht?«, fragte der Bürgermeister, als Korporal
Knopf
forteilte.
»Was? Eine Posaune, um Ratten zu rufen? Nein, nein, soll er es
ruhig
versuchen. Das kann man einem Kind nicht vorwerfen. Bist du gut mit der Posaune?«
»Ich weiß es nicht.«
»Was soll das heißen, du weißt es nicht?«
»Ich habe noch nie die Posaune gespielt. Eine Flöte, Trompete oder ein Dudelsack von Lancre wären mir lieber, aber ich habe beobachtet, wie Leute die Posaune gespielt haben, und es sah nicht sehr schwierig aus. Eigentlich ist sie nur eine zu groß geratene Trompete.«
»Ha!«, sagte der Pfeifer.
Korporal Knopf kehrte zurück und putzte eine verbeulte Posaune mit dem Ärmel ab, wodurch sie noch ein wenig schmutziger wurde. Keith nahm sie, wischte das Mundstück ab, setzte es an die Lippen und blies einen langen Ton.
»Scheint zu funktionieren«, sagte er. »Ich schätze, ich kann es lernen, während ich spiele.« Er sah den Rattenpfeifer an und lächelte kurz. »Möchtest du den Anfang machen?«
»Mit dem Ding wird es dir nicht gelingen, auch nur eine Ratte zu rufen, Junge«, erwiderte der Pfeifer. »Aber ich gebe dir gern Gelegenheit, es zu versuchen.«
Keith lächelte erneut, holte Luft und
spielte.
Eine Melodie erklang. Die Posaune quiekte und schnaufte, denn
Korporal Knopf hatte sie manchmal als Hammer benutzt, aber es
erklang eine recht schnelle, fast muntere
Melodie. Man konnte mit dem Fuß danach tappen.
Jemand tappte mit dem Fuß danach.
Sardinen kam mit einem leisen »Undeins zweidreivier« aus dem Riss in einer nahen Wand. Die Menge beobachtete, wie er flink übers Kopfsteinpflaster tanzte und in einem Abflussrohr verschwand.
Die Leute applaudierten.
Der Pfeifer sah Keith an. »Hatte die Ratte einen Hut auf?«, fragte er. »Ich habe nichts bemerkt«,
antwortete Keith. »Jetzt bist du dran.« Der Pfeifer zog ein
Flötenstück aus der Innentasche seiner Jacke. Einer
anderen Tasche entnahm er ein zweites Stück und befestigte es am ersten. Es machte Klick, auf militärische Art und Weise.
Der Blick des Pfeifers galt weiterhin Keith, und er lächelte, als er ein Mundstück aus seiner obersten Tasche nahm und es an die Flöte schraubte. Wieder klickte es.
Dann setzte er die Flöte an den Mund und
spielte.
Gut Gespart hielt auf dem Dach Ausschau und rief in ein
Abflussrohr: »Jetzt!« Dann schob sie sich zwei Wattebäusche in die
Ohren.
Am Ende des Abflussrohrs rief In Salzlake in
ein anderes Rohr: »Jetzt!« Dann griff er nach seinen eigenen
Ohrstöpseln.
Jetzt, jetzt, jetzt, hallte es durch
die Rohre…
»Jetzt!«, rief Sonnenbraun und stopfte Stroh ins Abflussrohr. »Alle halten sich die Ohren zu!«
Bei den Rattenkäfigen hatten sie sich alle Mühe gegeben. Malizia hatte Decken gebracht, und eine Stunde lang waren die Ratten damit beschäftigt gewesen, Löcher mit Schlamm zuzustopfen. Außerdem hatten sie den Gefangenen Futter gebracht. Zwar waren es nur Kiekies, aber es brach den Ratten fast das Herz zu sehen, wie sie sich voller Verzweiflung duckten.
Sonnenbraun wandte sich an Nahrhaft. »Hörst du
was?«, fragte er. »Wie bitte?«
»Gut!« Sonnenbraun nahm zwei große Wattebäusche. »Hoffentlich hat
das dumm klingende Mädchen hiermit Recht. Ich glaube, kaum jemand
von uns hat genug Kraft, um zu fliehen.«
Der Pfeifer spielte erneut und starrte dann auf seine Flöte. »Nur eine Ratte«, sagte Keith. »Irgendeine Ratte.«
Der Pfeifer sah ihn groß an und blies erneut
ins Mundstück seiner Flöte.
»Ich höre nichts«, sagte der Bürgermeister.
»Menschen können auch nichts hören«, murmelte der Pfeifer. »Vielleicht funktioniert die Flöte nicht«, spekulierte Keith. Der Pfeifer versuchte es erneut. Ein Murmeln kam von der Menge.
»Du hast irgendetwas angestellt«, zischte
er.
»Ach, ja?«, fragte Malizia laut. »Was könnte er denn angestellt
haben?
Hat er die Ratten vielleicht aufgefordert, in
ihren unterirdischen Tunneln zu bleiben und sich die Ohren
zuzustopfen?«
Aus dem Murmeln wurde gedämpftes Gelächter.
Der Pfeifer versuchte es noch einmal. Keith spürte, wie sich ihm
die Nackenhaare aufrichteten.
Eine Ratte erschien. Langsam kroch sie übers Kopfsteinpflaster und wackelte von einer Seite zur anderen, bis sie die Füße des Pfeifers erreichte. Dort fiel sie mit einem surrenden Geräusch um.
Die Leute starrten.
Es war ein Herr Klicki.
Der Pfeifer stieß ihn mit dem Fuß an. Die mechanische Ratte drehte sich mehrmals, und dann gab die Feder nach, die über Monate hinweg eine Falle nach der anderen ausgehalten hatte. Es machte Poijoinnngggg, und es folgte ein kurzer Regen aus Zahnrädern.
Die Zuschauer lachten.
»Hmm«, sagte der Pfeifer, und der Blick, den er
diesmal auf Keith richtete, zeigte widerstrebende Bewunderung. »Na
schön, Junge. Was hältst du davon, wenn wir miteinander reden? Von
Pfeifer zu Pfeifer? Drüben beim Brunnen?«
»Vorausgesetzt, die Leute können uns sehen«, sagte Keith.
»Vertraust du mir nicht, Junge?«
»Natürlich nicht.«
Der Pfeifer lächelte. »Gut. Du hast das Zeug zu einem Pfeifer, das
sehe
ich.«
Am Brunnen nahm er Platz, streckte die Beine und reichte Keith die Flöte. Sie bestand aus Bronze, hatte eine Gravur aus Ratten und glänzte im Sonnenschein.
»Hier«, sagte der Pfeifer. »Nimm. Es ist eine gute Flöte, und ich habe noch viele andere. Nur zu, nimm sie. Ich würde gern hören, wie du auf ihr spielst.«
Keith blickte unsicher darauf hinab.
»Es ist alles Schwindel, Junge«, fuhr der Pfeifer fort. Die Flöte funkelte wie ein Sonnenstrahl. »Siehst du den kleinen Schieber hier? Wenn du ihn nach unten schiebst, erzeugt die Flöte einen Ton, den das menschliche Ohr nicht hören kann. Aber Ratten hören ihn sehr wohl. Der Ton lässt sie verrückt werden. Sie kommen aus dem Boden, und anschließend treibt man sie in den Fluss, wie ein Schäferhund.«
»Mehr steckt nicht dahinter?«, fragte
Keith.
»Hast du mehr erwartet?«
»Nun, ja. Es heißt, du kannst Menschen in Dachse verwandeln und
führst Kinder in magische Höhlen und…«
Der Pfeifer beugte sich verschwörerisch vor. »Werbung zahlt sich immer aus, Junge. Manchmal fällt es kleinen Städten wie dieser sehr schwer, sich von ihrem Geld zu trennen. Und die Verwandlung von Menschen in Dachse und der ganze Rest: Es passiert nie hier. Die meisten Bewohner dieser Orte entfernen sich in ihrem ganzen Leben nie weiter als zehn Meilen davon. Sie glauben, dass fünfzig Meilen entfernt praktisch alles passieren kann. Wenn sich die Geschichte herumspricht, hilft sie einem bei der Arbeit. Die Hälfte der Dinge, die man mir nachsagt, habe ich nicht einmal selbst erfunden.«
»Bist du jemals jemandem namens Maurice begegnet?«, fragte Keith. »Maurice? Ich glaube nicht.«
»Erstaunlich.« Keith nahm die Flöte entgegen und bedachte den Pfeifer mit einem langen Blick. »Und nun, Pfeifer… Ich glaube, du wirst die Ratten jetzt aus der Stadt führen. Du leistest hier besonders beeindruckende Arbeit.«
»Wie bitte? Aber du hast gewonnen,
Junge.«
»Du führst die Ratten fort, weil es sich so gehört«, sagte Keith
und putzte die Flöte an seinem Ärmel ab. »Warum verlangst du so
viel Geld?«
»Weil ich für die Leute eine Schau abziehe«, antwortete der Pfeifer. »Die seltsame Kleidung, das hochmütige Gebaren… Es gehört einfach dazu, viel Geld zu verlangen. Man muss den Leuten ein wenig Magie bieten, Junge. Wenn sie glauben, dass man nur ein einfacher Rattenfänger ist, kann man von Glück sagen, wenn man ein Mittagessen und einen warmen Händedruck bekommt.«
»Wir führen die Ratten gemeinsam fort, und sie werden uns folgen, bis zum Fluss. Du brauchst gar keine besondere Melodie oder dergleichen zu spielen – wir bieten den Leuten eine noch bessere Schau. Es wird eine… großartige… Geschichte sein. Und du bekommst dein Geld. Dreihundert Dollar, nicht wahr?«
»Worauf willst du hinaus, Junge? Wie ich schon sagte: Du hast gewonnen.«
»Alle gewinnen. Glaub mir. Die Leute haben dich gerufen. Sie sollten den Pfeifer bezahlen. Außerdem…« Keith lächelte. »Die Leute sollen doch nicht glauben, dass man Rattenpfeifer nicht bezahlen muss, oder?«
»Und ich habe dich für einen dumm aussehenden Jungen gehalten«, sagte der Pfeifer. »Welche Vereinbarung hast du mit den Ratten getroffen?«
»Du würdest es nicht glauben, Pfeifer. Du würdest es nicht glauben.«
In Salzlake hastete durch die Tunnel, krabbelte durch den Schlamm und das Stroh, mit dem der letzte Gang blockiert worden war, und sprang in den Käfigraum. Die Ratten des Clans zogen sich die Wattebäusche aus den Ohren, als sie ihn sahen.
»Macht er’s?«, fragte Sonnenbraun.
»Ja, Chef! Jetzt sofort!«
Sonnenbraun sah zu den Käfigen. Nach dem Tod des Rattenkönigs und der Fütterung waren die Kiekies ruhiger, aber nach ihrem Geruch zu urteilen, drängte alles in ihnen danach, diesen Ort zu verlassen. Und Ratten in Panik folgen anderen Ratten…
»Na schön«, sagte Sonnenbraun. »Läufer, macht euch bereit! Öffnet die Käfige! Vergewissert euch, dass sie auch folgen! Los! Los! Los!« Und das war fast das Ende der Geschichte.
Wie die Zuschauer schrien, als überall Ratten aus Löchern und Abflussrohren kamen. Wie sie jubelten, als beide Rattenpfeifer aus der Stadt tanzten, gefolgt von den Ratten. Wie sie pfiffen, als die Ratten von der Brücke in den Fluss sprangen.
Sie bemerkten nicht, dass einige Ratten auf der Brücke blieben und den anderen zuriefen: »Denkt daran, gleichmäßige Schwimmzüge!« Und: »Weiter stromabwärts ist ein hübsches flaches Ufer!« Und: »Springt mit den Füßen voran ins Wasser, dann tut es nicht sehr weh!«
Selbst wenn die Leute diese Stimmen gehört hätten – sie wären kaum bereit gewesen, ihnen Beachtung zu schenken. Details, die nicht zum allgemeinen Geschehen passten, wurden leicht überhört und übersehen.
Und der Pfeifer tanzte über die Hügel davon und kehrte nie zurück.
Die Bewohner von Bad Blintz klatschten Beifall. Sie hatten eine gute Schau gesehen, auch wenn sie ein wenig teuer war. Das war zweifellos etwas, von dem man den Kindern erzählen konnte.
Der dumm aussehende Junge – der Junge, der mit dem Pfeifer gewettet hatte – kehrte auf den Platz zurück. Auch er bekam Applaus. Es war ein guter Tag, fanden die Leute, und sie fragten sich, ob sie für all die Geschichten zusätzliche Kinder brauchten.
Dann begriffen sie, dass sie selbst für die Enkel genug Geschichten hatten, als die anderen Ratten kamen.
Sie sprangen aus Abflussrohren, Dachrinnen und Mauerrissen, waren ganz plötzlich da. Sie quiekten nicht, und sie liefen auch nicht weg. Sie saßen einfach da und beobachteten die Menschen.
»He, Pfeifer!«, rief der Bürgermeister. »Du
hast einige übersehen!« »Nein«, ertönte eine Stimme. »Wir sind
keine Ratten, die Pfeifern folgen. Wir sind die Ratten, mit denen
ihr verhandeln müsst.« Der
Bürgermeister senkte den Blick. Eine Ratte stand vor seinen
Stiefeln und sah zu ihm auf. Sie schien ein Schwert in der Pfote zu
halten. »Vater«, sagte Malizia hinter ihm, »es wäre eine gute Idee,
dieser Ratte zuzuhören.«
»Aber es ist eine Ratte!«
»Das weiß ich, Vater. Und sie weiß auch, wie ihr das Geld und einen großen Teil der Lebensmittel zurückbekommt. Und sie weiß, wo sich zwei der Personen befinden, die sie uns gestohlen haben.«
»Aber es ist eine Ratte!«
»Ja, Vater. Und wenn du mit ihr
sprichst, kann sie uns helfen.« Der Bürgermeister starrte zu dem
versammelten Clan. »Wir sollen mit
Ratten reden?«,
fragte er.
»Das wäre wirklich eine gute Idee, Vater.«
»Aber es sind Ratten!« Der Bürgermeister schien an diesem Gedanken so festzuhalten wie an einem Rettungsring im stürmischen Meer – offenbar befürchtete er zu ertrinken, wenn er ihn losließ.
»Entschuldigung«, erklang eine andere Stimme. Der Blick des Bürgermeisters glitt ein wenig zur Seite und richtete sich auf eine schmutzige, halb verbrannte Katze, die lächelnd zu ihm aufsah.
»Hat die Katze
gerade gesprochen?«, fragte der
Bürgermeister. Maurice sah sich um. »Welche meinst du?«
»Ich meine dich! Hast du gerade gesprochen?«
»Würdest du dich besser fühlen, wenn ich ›Nein‹
sage?«, erwiderte Maurice.
»Aber Katzen können nicht sprechen!«
»Ich kann nicht versprechen, nach dem Essen eine lange Rede zu halten, und bitte mich nicht um einen komischen Monolog«, sagte Maurice. »Außerdem fällt es mir nicht leicht, schwierige Wörter wie ›Marmelade‹ und ›Lumbago‹ auszusprechen. Aber in elementarer Schlagfertigkeit und allgemeiner Konversation bin ich ganz gut. Als Katze möchte ich darauf hinweisen, dass es mich interessiert, was die Ratte zu sagen hat.«
»Herr Bürgermeister?« Keith näherte sich und drehte seine neue Flöte hin und her. »Glaubst du nicht, dass es Zeit wird, euer Rattenproblem ein für alle Mal zu lösen?«
»Zu lösen? Aber…«
»Du brauchst nur mit ihnen zu sprechen. Versammle den Stadtrat und sprich mit ihnen. Es liegt bei dir, Herr Bürgermeister. Du kannst herumschreien und befehlen, die Hunde zu holen, und die Leute können herumlaufen und mit Besen nach den Ratten schlagen, und ja, dann laufen sie davon. Aber sie werden nicht sehr weit laufen und zurückkehren.« Neben dem verwirrten Bürgermeister blieb Keith stehen, beugte sich zu ihm vor und flüsterte: »Und sie leben unter deinen Dielen, Herr. Sie können mit Feuer umgehen und kennen sich bestens mit Gift aus. O ja. Und deshalb… hör der Ratte zu.«
»Droht sie uns?«,
fragte der Bürgermeister und blickte auf Sonnenbraun
hinab.
»Nein, Herr Bürgermeister«, sagte Sonnenbraun. »Ich biete dir etwas
an…« Er sah zu Maurice, der nickte. »Eine wundervolle Gelegenheit.«
»Du kannst wirklich sprechen und
denken?«, fragte der Bürgermeister.
Sonnenbraun sah zu ihm auf. Eine lange Nacht lag hinter ihm. Er wollte sich nicht an sie erinnern. Und jetzt stand ein noch längerer und anstrengenderer Tag bevor. Er atmete tief durch. »Ich schlage Folgendes vor«, sagte er. »Du tust so, als könnten Ratten denken, und ich verspreche, dass ich so tun werde, als könnten Menschen ebenfalls denken.«