Ein Darkover-Roman
»Weit entfernt in der Galaxis
ungefähr 4000 Jahre in der Zukunft
gibt es einen Planeten
mit einer großen roten Sonne
und vier Monden.
Willst Du nicht mitkommen
und ihn mit mir erforschen?«
Marion Zimmer Bradley
Von der Autorin sind außerdem erschienen:
Excalibur - Das Schwert von Avalon
Jenseits von Avalon
Eine Komplettübersicht
aller Darkover-Romane finden Sie am Ende dieses Buches!
Über die Autorin:
Marion Zimmer Bradley, 1930 in den USA geboren, publizierte anfangs vor allem in Zeitschriften und Anthologien. Der Durchbruch gelang ihr 1962 mit The Planet Savers - Retter des Planeten. Mit dieser Geschichte war der Grundstein für die Romane um den Planeten Darkover gelegt, die innerhalb weniger Jahre zu einem der beliebtesten Fantasy-Zyklen einer riesigen Fangemeinde avancieren sollten. Seit 1962 hat Marion Zimmer Bradley über zwanzig Darkover-Romane und unzählige Kurzgeschichten geschrieben sowie eine Reihe Anthologien herausgegeben. 1983
wurde Marion Zimmer Bradley mit ihrem Roman Die Nebel von Avalon schließlich weltberühmt.
Sie starb im September 1999 in ihrer Heimatstadt Berkeley, Kalifornien.
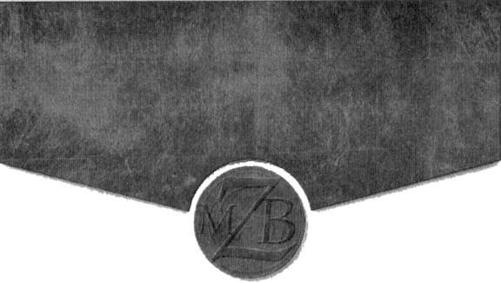
Marion Zimmer Bradley
Die Schwesternschaft
des Schwertes
Ein Darkover-Lesebuch
Aus dem Amerikanischen von
Ronald M. Hahn
Knaur
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1991 unter dem Titel Renunciates of Darkover bei DAW Books, New York.
Der Verlag dankt Olaf Keith
für die Unterstützung bei der Vorbereitung dieses Buches.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.knaur.de
Vollständige Taschenbuchausgabe 2001
Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München Copyright © 1991 by Marion Zimmer Bradley
Copyright © 2001 der deutschsprachigen Ausgabe bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf - auch teilweise -
nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Angela Troni
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Umschlagabbildung: © Attila Boros,
via Agentur Schlück, Garbsen
Satz: Ventura Publisher im Verlag
Druck und Bindung: Norhaven ASS
Printed in Denmark
ISBN 3-426-60.979-7
2 4 5 3 1
Inhalt
Marion Zimmer Bradley - Einleitung
Chel Avery - Zwist
Annette Rodriguez - Gebrochene Schwüre
Janet R. Rhodes - Wenn Banshees sehen könnten Deborah Wheeler - Ein Mittsommernachtsgeschenk Joan Marie Verba - Die Ehre der Gilde
Diana L. Paxson - Die Zeit der Schmetterlinge Kelly B. Jaggers - Missverstandene Situationen Mary Fenoglio - Erwachen
Patricia D. Novak - Carlinas Berufung
Judith Kobylecky - Ein Anfang
Mercedes Lackey - Um einem Dieb eine Falle zu stellen Jean Lamb - Eingesperrt
Vera Nazarian - Danilas Lied
Elisabeth Waters - Passende Begleitung
Lynne Armstrong-Jones - Lektion im Vorgebirge Emily Alward - Sommermarkt
Diann S. Partridge - Varzils Rächer
Andrew Rey - Comyn berührt man nicht
Patricia B. Cirone - Höchste Zeit
Margaret L. Carter - Zu Besuch bei der Familie Priscilla W. Armstrong - Das Gildenhaus von Dalereuth Einleitung
Jede meiner Anthologien erhält je nach den mir zugeschickten Geschichten, aus denen ich auswähle, sofort einen eigenen Charakter. In diesem Jahr hat sie eine Form angenommen, mit der ich nie gerechnet hätte. Fast alle Erzählungen, die mich erreichten, behandelten ein Thema, das mir selbst nie eingefallen war: Entsagende, die über Laran verfügen.
Wie gesagt, mir ist diese Idee nie gekommen. Als ich die Entsagenden zum Leben erweckte, habe ich sie nach dem Entweder-Oder-Prinzip aufgebaut. Für Frauen sah ich im Grunde drei Möglichkeiten. Nach meiner Ansicht hätte eine normale Darkovanerin folgende Wahl: Sie kann heiraten und Kinder bekommen, sich (falls sie über Laran verfügt) einem Turm anschließen oder, falls ihr keine dieser Möglichkeiten offen steht, Entsagende werden.
Warum mich diese Entwicklung so überrascht?
Wahrscheinlich deswegen, weil ich Darkover so aufgebaut hatte, dass sich beides zugleich gegenseitig ausschloss. Spiele haben Regeln. Man spielt Schach nicht nach Dame-Regeln. Heute jedoch halten sich die Menschen nicht mehr an Regeln. In der Society for Creative Anachronism (SCA) beharren Frauen (trotz der Tatsache, dass es in dem von ihnen nachgelebten Mittelalter keine weiblichen Ritter gab) darauf, zu kämpfen und zum Ritter geschlagen zu werden! Als Historikerin schüttelt es mich bei diesem Gedanken.
Jedoch muss ich flink hinzufügen, dass mir als Ex-Wildfang der Wunsch eines kleinen Mädchens verständlich ist, Ritter zu spielen.
In einer rein imaginären Welt wäre dies auch schön, aber nicht im Mittelalter.
Noch etwas. Als Heranwachsende habe ich die Erfahrung gemacht, dass Mädchen allgemein nur zu glücklich darüber waren, wenn ihnen Beschränkungen auferlegt wurden. Die meisten Mädchen, die ich in der Schule kannte, waren mit ihrem Los absolut einverstanden … Während ich Science Fiction las, schmökerten sie zufrieden in ihren Kitschromanen. Ich schwöre, dass die meisten Mädchen, die ich in der Schule kannte, sich für nichts anderes interessierten als modische Kleidung, Make-up und - klar - Jungs.
Auch ich freute mich, wenn ich hübsche Kleider hatte - oder hätte mich gefreut -, aber mit Make-up hatte ich nie etwas am Hut. Die schlimmste Aussage, die meine Mutter über ein Mädchen treffen konnte, lautete (ohne dass sie es obszön meinte): »Sie ist verrückt nach Jungs.« So kam es, dass ich, obwohl ich Männer mochte, meine Klassenkameraden nie ausstehen konnte. Diejenigen, die ich in der High School traf, begeisterten sich, abgesehen von einigen angehenden Science-Fiction-Fans, nur für Football. Da Football (und Autos) mich schon immer gelangweilt haben (und es, selbst wenn es blasphemisch klingt, auch noch heute tun), hatte ich nie Interesse an männlichen Heranwachsenden der menschlichen Rasse. Als ich unterrichtete, habe ich jedoch gelernt, sie anders zu sehen. Die Mädchen haben eigentlich nur ihren Schmuck verglichen und sich über Jungs unterhalten. (Von den Jungs hatten zumindest einige das geringe Bedürfnis, etwas über Musik und die englische Sprache zu erfahren, die ich ihnen beizubringen versuchte.) Ich kann die Mädchen und Lehrerinnen nicht mehr zählen, die mich beiseite nahmen und mir nahe legten, ich solle mir doch mehr Mühe geben, mich anzupassen, Tänze lernen und so tun, als sei ich an Sport und Tanzmusik interessiert. Kurz gesagt, ich sollte mir einen Jungen schnappen und mich so aufführen wie sie. Es hat ihnen Angst gemacht, dass ich es nicht tat. Ein Mädchen war für mich damals ein Lebewesen, das ausschließlich auf der Welt war, um sich einen Freund anzulachen. Bevor ich erwachsen wurde, habe ich nur selten Ausnahmen kennen gelernt.
Sollte ich verbittert klingen, liegt es daran, dass ich es bin.
Erst als ich die Welt der Science Fiction für mich entdeckte, begegnete ich Männern - oder Jungs -, denen es ehrlich egal war, dass sie es bei mir mit einer Frau zu tun hatten.
Dies müsste Ihnen verdeutlichen, dass ich nicht gerade eine große Hilfe für jene Leute bin, die das Inbild einer perfekten Feministin aus mir machen wollen. Es gefällt mir, prinzipientreuen Feministinnen zu sagen, dass die Welt der Science Fiction der einzige Ort ist, an dem ich nicht dem geringsten Hauch von Diskriminierung begegnet bin. Wer versucht, mich für Kreuzzüge geschundener Autorinnen zu rekrutieren (meine Manuskripte werden von Lektorinnen bearbeitet), kommt nicht sehr weit. Ich bin
- gelinde ausgedrückt - in Feministinnenkreisen nicht sehr beliebt, was mir aber ganz gut gefällt. (Wo waren denn all diese angeblichen Feministinnen, als ich sie brauchte?)
Aber die Frauen von heute wollen alles haben. Vielleicht ist das der Grund, warum nach meiner Ankündigung, dass ich dieses Buch herausgebe, eine Story nach der anderen bei mir eintraf, in denen Freien Amazonen neben allem anderen auch Laran haben.
Ich halte es trotzdem nicht für sehr realistisch. Für völlig unrealistisch halte ich sogar die Vorstellung einer Bewahrerin, die sich zur Freien Amazone wandelt. Das Dasein einer Bewahrerin ist so anstrengend, dass eine Frau, welche die damit verbundene Disziplin nicht mitbringt, nie in eine solche Position gelangen würde. Und gefiele ihr dieses Dasein nicht, würde sie es bereits während der langen und schwierigen Ausbildung merken.
Trotz alledem bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Flut von Erzählungen über Laran-begabte Freie Amazonen für die imaginäre ›Bevölkerung‹ Darkovers offenbar eine tiefere Bedeutung hat. Deswegen stelle ich Ihnen in diesem Band eine Auswahl von Erzählungen über darkovanische Entsagende mit Laran vor. Was meinen Sie dazu? Stehen Sie auf Seiten der Autoren?
Jedenfalls hoffe ich, dass Ihnen die Geschichte ebenso gut gefallen wie mir. Neulich hörte ich von einem meiner Fans, ich hätte mir durch meine Schriften über die Freien Amazonen einige alte Leser entfremdet. Die Vorstellung behagt mir wenig. Wirklich, Leute, es ist doch alles nur ein Spiel. Wir vergnügen uns doch nur.
Über Chel Avery und ›Zwist‹
Anfangs wusste ich nicht mal, ob ›Chel‹ ein Männer- oder ein Frauenname ist. Es ist eine Abkürzung für Michel, »aber ich stelle mich selten so vor, weil alle den Namen zu Michelle oder Michael verändern möchten. Und ich kämpfe schon genug an anderen Fronten.«
Meine Autoren betätigen sich in den ungewöhnlichsten Berufen.
Chel ist Konfliktberaterin im Dienste des Friends Conflict Resolution Program, einer Quäker-Organisation. Ich gestehe, dass eine Geschichte mit dem Titel ›Zwist‹ genau das Richtige für dieses Buch ist. Chel hat bisher eine Unzahl von Artikeln veröffentlicht, doch dies ist ihr erster Prosatext. - MZB
Zwist
von Chel Avery
Shaya n’ha Margali entließ ihre Schwestern nacheinander vorsichtig aus der Fünffachverbindung, um sie möglichst sanft voneinander zu trennen. Die psychische Separation war jedoch schmerzhaft, so dass sie beim Ausstieg jeder Einzelnen zusammenzuckte. Während des plötzlichen und schroffen Übergangs kam sie sich geistig abgekapselt vor. Sie saß in einer Runde von Frauen, die sich über einen leuchtenden blauen Stein und einen jungen Hirtenhund beugten. Sie neigte den Kopf, bis er auf ihren Knien ruhte.
»Schaut mal, Minka steht auf der Pfote, als wäre sie nie verletzt gewesen«, sagte Caitha stolz. Sie entnahm der Obstschale gierig eine Hand voll Schneebeeren. »Wir haben großartige Arbeit geleistet.«
»Shaya ist wieder mal enttäuscht«, bemerkte die aufmerksamere Mellina und streckte den Arm aus, um Shayas Hand zu ergreifen.
»Was ist denn, Liebling? Wir freuen uns über das, was wir dank deiner Lehre zusammen bewirken können. Warum kannst du dich nicht auch darüber freuen?«
»Ihr habt keine Vergleichsmöglichkeit«, fauchte Shaya. »Ihr wisst doch gar nicht, wie ein echter Matrixkreis sich anfühlt.« Dann seufzte sie. »Tut mir Leid. Ich bin müde, hungrig und … Ja, auch enttäuscht. Aber ich dürfte es euch nicht spüren lassen. Kannst du mir bitte ein paar Beeren reichen, Caitha?«
Caitha schob ihr die Schale hin. Dorelle stellte einen Teller mit Nüssen und Brot neben Shaya ab und setzte sich dicht neben sie hin.
Auch Lista eilte herbei, so dass die vier Frauen Shaya eng umgaben und liebevoll umarmten. Mellina drückte ihre Hand. »Rede mit uns, Shaya. Damit wir verstehen, was schief gegangen ist.«
Shaya wartete, bis sie die Tränen beherrschte, die über ihre Wangen zu laufen drohten. »Damon Ridenow, mein Pflegevater, hat mir einst erzählt, dass einem keine Art von Intimität je wieder genug ist, wenn man jemals einem telepathischen Kreis angehört hat. Verliert man ihn, sucht man entweder nach einer Möglichkeit, ihn wieder zu beleben, oder man trauert für den Rest seines Lebens um ihn. Wenn man es nicht selbst erlebt hat, kann man es auch nicht verstehen.«
»Wieso haben wir es nicht erlebt?«, fragte Lista. »Was haben wir denn gerade gemacht? Was die Intimität angeht, hast du Recht. Es ist, als …«
»… als säße man ohne Haut da«, warf Dorelle ein.
Shaya lachte traurig. »Genau das sind die Worte, die man immer zu hören bekommt. Aber es steckt viel mehr dahinter. Es geht nicht nur darum, dass man sich im Bewusstsein eines anderen befindet und jeden seiner Gedanken kennt. Wenn es echt ist, empfindet man ein wohliges Gefühl von Nähe, Vertrauen und Liebe …« Sie stolperte über ihre eigenen Worte und hielt einen Moment verlegen inne. »Mir fehlen einfach die passenden Worte. Also, ich liebe euch alle … Ich würde euch sogar mein Leben anvertrauen. Das wisst ihr.
Aber irgendetwas fehlt.«
Sie fuhr fort. »Als ich in dem Verbotenen Turm aufwuchs, hatte ich den Eindruck, Tag für Tag von einem Dutzend Menschen umarmt zu werden, die mich liebten. Selbst wenn es zu Auseinandersetzungen kam, selbst wenn ich unartig war und bestraft wurde, habe ich mich stets umhegt gefühlt. Ich habe gedacht, ich könnte all dies mit euch noch einmal erleben.«
Dorelle sprach so leise, dass die anderen die Luft anhalten mussten, um sie zu verstehen. Doch auf der Psi-Ebene waren ihre Gedanken überdeutlich. »Das Zusammenleben mit euch vieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich hätte mir in meinen Träumen nichts Schöneres vorstellen können.«
Shaya drückte sie an sich. »Ach, glaub bitte nicht, dass unser kleines Gildenhaus in den Bergen mir nicht der liebste Ort auf der ganzen Welt ist. Auch ich bin überglücklich … was den normalen Verlauf der Dinge anbetrifft. Ich meine jedoch etwas, das mehr ist als normal. Ich meine den Zauber.«
Caitha reckte sich und gähnte. »Wir brauchen nur eins - den Schlaf einer Nacht und eines Vormittags. Ist euch eigentlich klar, wie spät es ist? Ich glaube, Shayas Problem ist ihre Übermüdung. Und das Gleiche gilt auch für uns. Gute Nacht, meine Lieben.« Sie küsste die vier Frauen schnell auf die Wange und ging hinaus.
Als Shaya sich in Mellinas Arme kuschelte, machte sie sich Sorgen.
»Es muss an mir liegen. Ich bin keine Bewahrerin, sondern nur Junior-Technikerin. Wäre meine Breda Cleindori bei uns statt in der Isolation des Turms von Arilinn, wäre es vielleicht …«
»Mach dir keine Vorwürfe.« Mellina drückte sie an sich. »Wenn überhaupt jemand Schuld hat, dann wir. Außer dir sind doch alle reine Bürgerliche. Vielleicht ist unser Laran nicht stark genug.«
»Lass dich nicht von den Comyn-Mythen aufs Glatteis führen. In Mariposa waren viele Bürgerliche in unserem Kreis tätig. Deswegen war ich mir ja auch so sicher, dass wir es ebenfalls schaffen können.«
Der Traum war so lebendig. Als sie im Gildenhaus von Thendara gelebt hatte, war ihr eine unangemessen große Anzahl Entsagender mit Laran aufgefallen. Es war logisch. Frauen aus den niederen Klassen, die über psychische Fähigkeiten verfügten, waren Glücksfälle. Ihnen fehlten die Anerkennung und Ausbildung, die dem Adel zur Verfügung stand. Als Außenseiter ihrer eigenen Welt suchten sie regelmäßig Zuflucht bei den Schwestern, einer Gemeinschaft, die ihnen wenigstens erlaubte, sie selbst zu sein.
Außerdem war Shaya aufgefallen, dass die Neuzugänge oft emotionaler und manchmal körperlicher Heilung bedurften. Viele waren aus einer verzweifelten Lage in die Gildenhäuser geflohen.
Dank der Dringlichkeit ihrer Erkenntnis hatte Shaya die Gildenmütter überreden können, mit einer Hand voll ausgewählter Frauen fern von der Stadt ein kleines Gildenhaus zu gründen. Hier sollte ein Kreis von Telepathinnen seine Fähigkeiten entwickeln, um später jenen unausgebildeten Telepathinnen in den Reihen der Schwesternschaft eine Ausbildungsmöglichkeit anzubieten, die ihr Laran nicht steuern konnten. Weiterhin wollten sie ein Rückzugs-und Heilungszentrum für Neuzugänge schaffen, deren emotionale Wunden zu tief waren, um die strenge Ausbildung durchzustehen, die man ihnen angedeihen ließ.
Mellina las ihre Gedanken. »Und es klappt. Wir haben wunderbare Erfolge. Wir lernen wirklich, wie man heilt.«
»Du hast natürlich Recht. Tut mir Leid, dass ich so meckere. Wir hatten in allen Dingen Erfolg, die wir mit Zustimmung der Gildenmütter angegangen sind. Mir war nicht klar, dass ich noch viel mehr wollte. Ich wollte die tiefe Zugehörigkeit, die ich beim Verlassen von Mariposa aufgegeben habe.«
»Du hast doch ein Zuhause. Wir haben alle eins, Liebling.«
»Ja, aber es ist irgendwie seicht. Ich kann zwar nicht genau beschreiben, was ihm fehlt, aber wenn du wüsstest, was es war, würdest du sagen: Die Gemeinschaft, die wir nun empfinden, ist im Vergleich zu einem Schneesturm in den Hellers nur wie ein paar vereinzelte Flocken in der Ebene.«
»Tja, vielleicht wenn wir uns mehr an unser Zusammenleben gewöhnt haben. Wenn wir uns besser kennen …«
»Das glaube ich nicht. Ich habe die Leute in unserer Gruppe sorgfältig ausgewählt. Nicht nur deswegen, weil wir alle Laran haben, sondern auch, weil wir so gut zueinander passen. Ich sorge mich um jeden von euch. Ich habe mich vergewissert, dass jeder sich auch um die anderen sorgt. Was die Harmonie angeht, wurde seit dem Zeitalter des Chaos kein Turmkreis mehr so sorgfältig aufeinander abgestimmt.«
Sie führte einen mentalen Zählappell durch. Während der Matrixverbindung hatte sie jede einzelne Frau als Wetterbild erlebt.
Caitha war die Frühlingsbrise, stark, überschwänglich, manchmal unberechenbar. Lista war der sonnige Himmel, offen, friedlich.
Dorelle war ein Sommerschnee, der alles so sanft berührte, dass er beim Aufprall schmolz.
»Und ich?« Mellina las noch immer ihre Gedanken.
Shaya stellte sich an ihrer Stelle einen Nachthimmel vor, den sie in ihrer Kindheit nur selten gesehen hatte: klar, ohne dass auch nur ein Mond in Sicht war. Die Sterne glitzerten vor einem geheimnisvollen, finsteren Hintergrund.
»Du Schmeichlerin.« Mellina küsste sie. »Wenn ich nicht so müde wäre … Ach, ich bin wirklich müde. Lass uns schlafen. Morgen sieht vielleicht alles ganz anders aus.«
Inmitten des Durcheinanders, zu dem es am nächsten Tag kam, fielen Shaya ihre Worte ein. Sie schleppte gerade heißes Waschwasser, als jemand an die Tür klopfte. Sie glaubte, es sei der Gerber mit den Fellen, die Caitha auf dem Markt bestellt hatte.
»Mellina, machst du bitte mal auf? Ich habe beide Hände voll.«
Kurz darauf, als sie bis zu den Ellbogen im Seifenschaum steckte, kam Mellina in den Raum zurück. »Shaya, ich glaube, du solltest mal rauskommen. Wir haben ein interessantes Problem.«
Im Empfangsraum saß eine ältere Frau vor dem Feuer. Sie trug ein fein besticktes Gewand mit Pelzbesatz. Ihr Rücken war zwar durchgestreckt, doch sie saß auf dem primitiven Holzstuhl, als sei sie bereit, jederzeit aufzuspringen. Als Shaya eintrat, erhob sie sich.
»Ihr seid sicher Shaya n’ha Margali. Es ist mir eine Ehre, Euch kennen zu lernen, Mestra. Ich bin Magwyn Delleray.«
Die Frau war zwar freundlich und sprach sie mit der gebührenden Höflichkeit an, doch Shaya war bei Frauen, die außerhalb der Gilde standen, an derartige vertrauliche Direktheit nicht gewöhnt. »Woher kennt Ihr denn meinen Namen, Domna?«
»Mein Sohn, Regald Delleray, hat euch dieses Jagdhaus verpachtet. Er wollte zwar anfangs keine Geschäfte mit allein stehenden Frauen machen, aber ich habe ihm verdeutlicht, dass die Entsagenden einen ehrlichen Ruf haben und redliche Geschäfte machen und dass ihr gewiss gute Pächter abgeben würdet.«
Shaya war der Ansicht, dass Regald Delleray seiner Mutter keine Ehre antat. Er hatte versucht, sie bei der Pacht zu übervorteilen.
Aber natürlich durfte man eine Frau nicht nach ihrer männlichen Verwandtschaft beurteilen. Domna Magwyn schien aus anderem Holz geschnitzt zu sein.
»Dann stehen wir in Eurer Schuld, Domna. Wie können wir Euch zu Diensten sein?«
»Nicht ich brauche Hilfe, sondern mein Enkel Dennor. Können wir uns hinsetzen, solange wir uns unterhalten? Die Situation bedarf einiger Erklärungen, und ich fürchte, wenn ich stehe, wird es Euch leichter fallen, mich dorthin zurückzuschicken, wo ich hergekommen bin. Und zwar, bevor ich Gelegenheit hatte, Euch zu bitten, Euch meiner Sache anzunehmen.«
Shaya lächelte. Die Offenheit der Frau gefiel ihr. »Ich verspreche Euch, Domna, weder Ihr noch eine andere Frau wird aus diesem Raum geschickt, bevor wir sie zu Ende angehört haben. Bitte, nehmt doch Platz. Eure Geschichte muss lang sein, denn ich kann mir einfach nicht vorstellen, was wir mit einem kleinen Jungen zu tun haben könnten.«
»So klein ist er nun auch nicht mehr. Er ist fast elf Jahre alt. Und obwohl er früher immer besonders klein und niedlich war, konnte man ihn in letzter Zeit kaum noch zähmen. Ich glaube, er leidet an den ersten Symptomen der Schwellenkrankheit. Seine Mutter hatte Laran, und ich vermute, dass diese Gabe sich natürlich auch auf Dennor auswirkt.«
»Dann solltet Ihr nicht mit uns sprechen, sondern mit einer Leronis aus einem Turm.«
»Natürlich, das ist das Offensichtliche«, sagte Magwyn ungeduldig. »Aber Regald will nichts damit zu tun haben. Er hat selbst kein Laran. Er tut die Ungebärdigkeit seines Sohnes als schlechtes Benehmen ab. Seine Lösung besteht darin, dass er den Jungen verprügelt und ihm Strafarbeiten aufgibt. Er misstraut den Türmen. Er will nicht, dass eine Leronis sein Haus betritt.«
»Ach, der arme Junge!«, warf Mellina ein. Shaya hatte vergessen, dass sie zuhörte und ergriff schnell das Wort, um zu verhindern, dass Mellinas Mitgefühl sie überwältigte und sie mehr als nötig in diese Geschichte einbezog.
»Ja, es ist eine traurige Angelegenheit, aber ich verstehe nicht, wie wir Euch dabei helfen können.«
»Der Junge ist möglicherweise gefährdet«, sagte Magwyn. »Er braucht Schutz und Unterweisung. Ich möchte ihn der Obhut seines Vaters entziehen. Ich werde sagen, er sei mit seinen Vettern auf die Jagd gegangen. Aber ich bringe ihn zu Euch, damit Ihr ihm helft.«
»Domna«, stammelte Shaya. »Es tut mir Leid … Das können wir nicht tun … Ich weiß nicht, wie … Erstens sind Jungen über fünf Jahre in den Gildenhäusern nicht zugelassen. Und selbst wenn wir es täten … Wie kommt Ihr darauf, dass wir ihm helfen können?«
Mellina schaute sie fragend an. Shaya wünschte sich, dass sie damit aufhörte.
»Zunächst einmal«, erwiderte Magwyn, »könnt ihr tun und lassen, was ihr für richtig haltet. Ich kenne den Eid der Entsagenden und weiß, dass er das, worum ich euch bitte, nicht verbietet. Er lässt euch viele Freiheiten. Und was eure Hilfe für den Jungen betrifft … Ich wurde zwar nicht in einem Turm ausgebildet, aber meine telepathischen Fähigkeiten reichen aus, um Euer Laran zu spüren.
Ich habe Euch auf dem Markt beobachtet. Jede von euch verfügt über Donas. Ihr solltet nicht versuchen, mich glauben zu machen, dass ihr nur hier seid, um in diesem Dörfchen euren Lebensunterhalt als Hebammen zu verdienen. In der Zeit, in der Kyrrdis voll am Himmel steht, wird hier gerade mal ein Kind geboren. Ich weiß, dass ihr weder einen Handwerksbetrieb noch ein sonstiges Unternehmen gegründet habt. Ihr bietet eure Dienste auch nicht als Führer oder Söldner an. Dieses Haus ist ein Laran-Kreis. Ich weiß es.«
Shaya verbarg das Gesicht in den Händen. In ihrem Geist tauchten Bilder von Flüchen und Drohungen gegen den Verbotenen Turm auf. In einem provinziellen und abergläubischen Ort wie diesem bedurfte es nur weniger Gerüchte, und schon würde man sie wie kranke Chervines davonjagen.
»Habt keine Angst«, sagte Magwyn leise. »Ich werde keine Geschichten in Umlauf bringen. Ich glaube, den meisten Menschen in dieser Gegend fehlt die Phantasie, um das zu erraten, was ich erraten habe. Bisher war es auch nur eine Vermutung - aber Euer Verhalten hat sie nun bestätigt.«
Magwyn nahm Shayas und Mellinas Hände in die ihren. »Wie ihr euch auch entscheidet … Ich verspreche, dass ich nichts Schlechtes über euch sage. Aber ich verspreche euch auch, dass ihr eine starke Verbündete in mir habt, wenn ihr mir helft. Solltet ihr je Unterstützung brauchen, werde ich für euch eintreten. Ich gehe jetzt. Morgen bin ich mit Dennor auf dem Markt - am Stand des Pferdehändlers. Er verbringt Stunden dort, ohne zu bemerken, wie die Zeit vergeht. Wenn ihr mir helfen wollt, kommt vorbei, dann schicke ich ihn mit euch fort.«
Sie stand auf. »Danke, dass ihr euch meine Bitte angehört habt. Ihr habt jetzt sicher viel zu besprechen. Ich finde schon allein hinaus.«
Als Magwyns Rücken durch die Haustür verschwand, unterdrückte Shaya einen Seufzer. Dann warf sie einen Blick auf Mellinas schmerzlich verzogenes Gesicht. Sie standen vor einem Problem.
»Wir können das unmöglich tun, Liebling«, sagte Shaya mit fester Stimme. »Ich weiß, dass die Geschichte dieser Frau dein weiches Herz bricht, aber es ist unmöglich.«
Doch wenn Mellinas Schutzinstinkt angesprochen wurde, konnte sich die sonst so Sanfte in eine kämpferische Katze mit noch nicht entwöhnten Jungen verwandeln. »Natürlich ist es möglich. Wir müssen es mit den anderen besprechen.«
Bis zum Abendessen hatte Mellina mit allen gesprochen, und Shaya stellte fest, dass sie überstimmt worden war. »Warum denn nicht?«, fragte Lista. »Es ist doch nicht so, dass wir keine Zeit hätten. Lass es uns doch versuchen.«
»Na und?«, sagte Caitha. »Dann verstößt es eben gegen die Gildenhausregel, Jungen dieses Alters bei uns aufzunehmen. Ich glaube, wir kriegen es schon hin. Dann habe ich wenigstens jemanden, dem es Vergnügen bereitet, mit mir fechten zu üben.« Sie warf den anderen einen gespielt finsteren Blick zu.
Dorelle war, wie Shaya vorausgesehen hatte, empört darüber, dass Regald so grob mit seinem Sohn umsprang. »Er ist doch erst elf Jahre alt! Die Hälfte aller Probleme mit den Männern in den Domänen haben damit zu tun, dass man sie zwingt, Männer und Soldaten zu sein, bevor sie erwachsen sind. Wir könnten das Leben des Jungen wirklich anders aussehen lassen.«
Shaya stöhnte auf. »Habt ihr überhaupt zugehört? Sein Vater verprügelt ihn, weil er angeblich schwer erziehbar ist. Anders ausgedrückt: Er ist undiszipliniert und ungebärdig. Er wird alles ruinieren. Er hat es jetzt schon getan. Habt ihr gemerkt, dass wir uns zum ersten Mal in die Haare kriegen?«
Aber die Schlacht war verloren. Am nächsten Tag ritten drei Amazonen zu den Pferdeboxen auf dem Markt. Shaya bemühte sich von Anfang an, Autorität und Disziplin auszustrahlen. Caitha konnte es kaum erwarten, den Schwertarm des Bürschleins zu sehen, und Dorelle war begierig darauf, den armen Kleinen in ihr Herz zu schließen und vor den Grobheiten der beiden anderen zu beschützen.
Keine hatte daran gedacht, dass Dennor vielleicht gar nicht mitgehen wollte. Magwyn musste ihn beiseite ziehen und ernst auf ihn einreden. Das Gespräch fand zwar außer Hörweite statt, aber so wie die beiden wirkten und anhand ihres psychischen Widerhalls war offensichtlich, dass der Knabe jede Menge Einwände hatte und Flüche ausstieß, denen Magwyn mit ernsten Warnungen begegnete.
Wie Shaya schon wusste, konnte die alte Frau bedrohlich sein, und über welche Macht sie auch gebot: Am Ende war sie erfolgreich.
Doch Dennor, der sich schließlich zu ihnen gesellte, war extrem mürrisch. »Sie schickt mich einfach mit ‘ner Horde Damen weg, die nicht mal hübsch sind.« Er schob Dorelles zaghaft auf seiner Schulter liegenden Arm beiseite. »Eins sag ich euch gleich: Aus mir macht keine alte Hexe einen Sandalenträger!«
Dorelle war eindeutig verwirrt. Shaya dachte ergrimmt, wenigstens könnte sie bei diesem Tempo die anderen bald davon überzeugen, dass es besser war, dieses idiotische Experiment zu beenden und den Knaben nach Hause zu schicken. »Wir bringen schon in Erfahrung, welche Art Sandalenträger du bist. Sobald wir zu Hause sind, erhältst du Fechtunterricht. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob du den männlichen Stolz, den du vor dir her trägst, überhaupt wert bist.«
Zum Glück konnte Caitha ihn beim Fechtunterricht erschöpfen, sonst wäre vielleicht alles noch schlimmer geworden. Bis zum Abendessen war es Dennor gelungen, die Hündin Minka so sehr zu terrorisieren, dass sie sich sofort hinter dem Pferdestall verkroch, wenn sie ihn sah. Er hatte versehentlich einen Becher zerbrochen und einen zweiten absichtlich bei einem Wutanfall, als Mellina ihn ermahnt hatte, er solle vorsichtiger sein. Außerdem hatte er sich ständig beschwert und so viel Lärm gemacht, dass außer Caitha alle Kopfschmerzen hatten.
»So was essen die Damen am Abend?«, schnaubte Dennor, als sie sich um den Tisch versammelten. »Ich bin ein Mann. Ich brauche Fleisch. Ich brauche Bier. Von diesem Zeug hier werde ich krepieren.«
Shaya, die längst die Geduld verloren hatte, packte Dennor an der Schulter und schüttelte ihn. »Hör zu, du Balg eines verzogenen Cralmac! Wenn Nevarsin unter einer dicken Schneedecke liegt und die Leute das Haus monatelang nicht verlassen können, würden sie sich um frisches Gemüse und Milch auf dem Tisch reißen! Wenn die Rote Flut in Temora ist und man keinen Fisch essen kann …« Sie schnappte aufgebracht nach Luft.
Caitha hingegen sprach ganz ruhig an ihrer Stelle weiter. »Wenn dir unser Essen nicht gut genug ist, Dennor, lass es einfach stehen.
Aber sei bitte still und lass uns unsere Mahlzeit genießen.«
Daraufhin hielt er den Mund und aß.
Nachdem die Frauen abgeräumt und den Knaben in sein Zimmer geschickt hatten, waren sie drauf und dran, für heute keinen Matrixkreis zu bilden. Shaya war schlecht aufgelegt, Caitha war ausgelaugt, die anderen waren in Gedanken versunken und zunehmend unglücklich. Die Irritation, die Dennor in ihnen hervorgerufen hatte, drohte auszubrechen und sich gegen sie selbst zu richten. Trotzdem schlug Shaya vor, sie sollten üben. »Wir brauchen die Disziplin. Wir können nicht immer mit idealen Bedingungen rechnen.«
Also bauten sie die Verbindung auf, machten ein paar einfache Psi-Übungen und schlossen sie mit einem Besänftigungsbann ab, der den Nerven der armen und völlig gebeutelten Minka galt.
Überraschenderweise ging alles viel glatter als erwartet, wenngleich sie anschließend zu erschöpft waren, um sich noch zu unterhalten.
Als Lista zu Bett wankte, murmelte sie: »Bei diesem Tempo ist Minka bestimmt bald der gesündeste Hund in sämtlichen Domänen.«
Mehrere Stunden später zuckte Shaya aus dem Schlaf hoch. Ein wütender Schrei hatte sie geweckt. Er hielt noch immer an und schien nicht enden zu wollen.
Als sie barfuß und mit zerzaustem Haar in Dennors Zimmer stolperte, aus dem die Schreie kamen, waren Lista und Caitha bereits dort. Dennor krümmte sich auf dem Bett, der Schweiß floss in Strömen über seinen zitternden Körper.
»Haut ab!«, schrie er. »Ich hab gesagt, haut ab!« Dann verbarg er das Gesicht in den Händen und weinte. »Die Wände! Die Wände bewegen sich! Sie kommen näher und wollen mich zermalmen!«
»Gütige Göttin, was ist das?«, sagte Lista. »Er will sich nicht anfassen lassen.«
»Es ist die Schwellenkrankheit«, erwiderte Shaya. »Du kannst dich glücklich schätzen, wenn du nicht weißt, was es ist. Geh, hol einen Krug Wasser und einen Becher. Er hat seinen zerschlagen. Caitha, wirf bitte einen Blick in den Kräuterschrank. Wir müssten noch ein Fläschchen Kirian haben. Es riecht wie … Nein, riech nicht dran.
Bring mir einfach alle kleinen Flaschen.«
Dann setzte sie sich auf die Bettkante und redete mit fester Stimme auf den Knaben ein. »Dennor, hör zu. Ich weiß, was mit dir los ist.
Ich habe es selbst gehabt. Es tut schrecklich weh, aber wenn wir es richtig behandeln, geht es vorbei. Jetzt sieht es so aus, als wärst du verrückt, aber du bist es nicht. Hast du mich verstanden?« Sie wusste nicht genau, ob sie zu ihm durchdrang. »Du bist nicht verrückt.«
Als Mellina einige Minuten später in den Raum stolperte, gelang es Shaya, Dennor auf die Beine zu stellen. Sie nahmen ihn zwischen sich und führten ihn in seinem Zimmer herum.
Es war eine lange Nacht. Als der Morgen graute, saß Shaya erschöpft neben dem völlig ausgelaugten, langsam einschlafenden Knaben. Er war zwar noch desorientiert, aber ruhig. »Wenn ich so bin, bestraft mein Vater mich immer. Er sagt, ich bin weich und hysterisch und würde noch als Sandalenträger enden.«
Shaya hätte gern geantwortet, dass es Schlimmeres gab, doch stattdessen sagte sie: »Nein, du hast Laran, und das ist gewiss keine Schwäche. Dein Körper muss sich nur daran gewöhnen. Man muss sehr stark sein, um es zu ertragen. Morgen bringe ich dir bei, wie man es beherrscht. Wenn du einschlafen willst, erzähle ich dir von Dom Esteban Alton, der früher Hauptmann der Garde war und noch heute der beste Fechter aller Zeiten ist. Aber die größte Schlacht, die er je geschlagen hat, um seine Tochter vor den Katzenmenschen zu retten, hat er vom Bett aus geführt - mit Geisteskraft.«
Am nächsten Tag sah Dennor bleich und elend aus. Mellinda und Dorelle hätten ihn, wenn er sie gelassen hätte, gern verhätschelt, aber er führte sich rüde und verdrießlich auf und nutzte jede Gelegenheit, die Methoden der ›Frauen‹ (das Wort war eindeutig mit Abscheu beladen) zu verhöhnen, die offenbar ihren Platz in der Welt nicht kannten.
Am Nachmittag rief Shaya ihn zu sich. »Ich weiß, dass du nicht hier sein willst, Dennor, aber mir wird nun klar, dass es richtig von Magwyn war, dich uns anzuvertrauen. Was letzte Nacht mit dir passiert ist, kann einen Menschen umbringen, wenn er nicht richtig behandelt wird. Dein Vater hat eindeutig keine Ahnung, was die Schwellenkrankheit ist. Oder er respektiert sie nicht. Wir geleiten dich sicher hindurch, und ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst, um dein Laran einzusetzen, ohne dir und anderen dabei zu schaden. Man sollte dich am besten in einen Turm schicken, aber dazu haben wir nicht die Macht.«
»Ich soll in einen Turm gehen? Die Leute da sind doch die Geißel der Domänen! Sie verwandeln gesunde junge Männer und Frauen in …«
Shaya unterbrach ihn. »Wie ich sehe, zitierst du deinen Vater. Tja, selbst ich habe meine Schwierigkeiten mit den Türmen, wenn auch aus anderen Gründen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass jemand dich lehren muss, dein Laran zu beherrschen, damit es nicht dich beherrscht. Und ich schätze, ich werde dieser Jemand sein. Verstehst du?«
Es war das richtige Argument. Dennor nickte.
»In Ordnung. Wir sollten deine Ausbildung verschieben, bis die Schwellenkrankheit hinter dir liegt, aber ich fürchte, dazu fehlt uns die Zeit. Siehst du den Stein hier? Schau bitte in ihn hinein. Es wird dir zwar nicht gefallen, aber ich bin sicher, du bist stark genug, mit dem Gefühl umzugehen, das er in dir erzeugt.«
Mit schamlosen Appellen an die Vorstellung, die der Junge von Männlichkeit hatte, lockte sie ihn durch die erste Lektion. Die mentale Verbindung, die sie mit ihm einging, traf sie wie ein Schlag.
Das Erlebnis, Dennor in ihrem Geist zu spüren, war für sie, als stünde sie am Rand eines Wirbelsturms, der rücksichtslos mit unerhörten Emotionen und stürmischem, unkonzentriertem Willen um sich schlug.
An diesem Abend wurden keine Beschwerden über das Essen laut. Dennor stopfte den Gemüseeintopf und das Nussbrot in sich hinein, als sei es die beste Mahlzeit, die er je gegessen hatte. Shaya erging es nicht anders.
In den folgenden beiden Dekaden kam es zu weiteren Attacken der Schwellenkrankheit. Normalerweise stellten sie sich nach besonders heftigen Wutanfällen und ungebärdigem Benehmen Dennors ein, aber sie wurden seltener und weniger regelmäßig. Shaya war zwar nicht glücklicher darüber, dass er sich bei ihnen aufhielt, aber sie hatte seinen Schutz und seine Ausbildung als grimmige Pflicht akzeptiert und musste zugeben, dass der Knabe bei der Arbeit mit der Matrix wahre Begabung zeigte. Caitha unterrichtete ihn jeden Morgen im Fechten. Sie hatte nicht nur Spaß daran, sondern es freute sie auch, dass Dennors herablassende Haltung gegenüber kämpfenden Frauen nachließ. Wahrscheinlich war seine Geringschätzung nur der Versuch, seine Scham zu übertünchen, da es ihm wiederholt versagt blieb, seine Lehrerin zu besiegen.
Allmählich nahm alles eine gewisse Regelmäßigkeit an. Dennor absolvierte seine Morgen- und Abendlektionen, ging nach dem Abendessen in sein Zimmer, und die Frauen versammelten sich verstohlen zu einem Matrixkreis. Der Knabe passte sich der unerwünschten Vormundschaft zwar an, doch sein Verhalten blieb gereizt und rebellisch, so dass er die Geduld der Entsagenden auf eine harte Probe stellte. Bei Dorelle und Mellina, die glaubten, man müsse Kindern gegenüber sanft sein, äußerte sich die Anspannung dadurch, dass sie ihren Unmut an ihren Mitschwestern ausließen. In Shaya kulminierten Frustration und Verletzung an dem Tag, an dem die ansonsten kritiklose Mellina sie wütend ›unerträglicher Herrscherallüren‹ bezichtigte.
An diesem Abend gelang es den Angehörigen des Matrixkreises, ihren Geist fester zusammenzuschließen als je zuvor: Sie brachten ein Zwergchervinekalb dazu, von seinem Muttertier Nahrung anzunehmen, womit sie mehr oder weniger dazu beitrugen, es vor dem sicheren Tod zu bewahren. Dennoch empfand Shaya keinen Grund zu übermäßiger Freude. Sie nahm die anderen nur bedingt wahr, als höre sie hinter den Bergen das schwache Tosen eines nahenden Tornados.
Am nächsten Tag schimpfte Lista Dennor aus, weil er gedankenlos durch den Gemüsegarten gerannt war und mehrere fast reife Melonen zertrampelt hatte. Der über den Tadel wütende Knabe drehte sich zu ihr um und schrie: »Lass mich in Ruhe, du böse Zauberin! Ich könnte euch alle fortjagen lassen!« Seine Stimme wurde schrill vor Wut. »Es ist schon schlimm genug, dass ihr widernatürlich seid und anständige Menschen euch nicht dulden!
Aber ich weiß auch, dass ihr Hexen seid. Ihr seid ein Hexenkreis! Ich sehe euch nachts in meinem Kopf! Da hockt ihr alle um einen Sternenstein herum und tut böse und ungesetzliche Dinge. Wenn ich es erzähle, könnt ihr euch freuen, dass man euch nicht verbrennt!«
Lista kam in Tränen aufgelöst zu Shaya. Sie war wirklich verängstigt. »Die Dörfler da draußen sind konservativ und abergläubisch. Was ist, wenn er so was tatsächlich herumerzählt?«
Shaya beruhigte sie. »Ich werde mal mit ihm reden und ihn davon überzeugen, dass er alles nur während der Schwellenkrankheit geträumt hat. Aber wir müssen vorsichtiger sein. Wir versammeln uns erst wieder, wenn er fort ist. Bitte, Avarra, lass es bald sein.«
Shaya war nicht überrascht, als sie in der Nacht von einem durchdringenden Schrei aus Dennors Zimmer geweckt wurde. Nach solch schwierigen Tagen brach die Schwellenkrankheit häufiger aus.
Während die Frau aus dem Bett schlüpfte und ein Gewand anzog, lauschte sie nach weiteren Schreien oder dem hysterischen Schluchzen, das manchmal darauf folgte. Doch diesmal war alles still. Dann rief plötzlich eine erschreckte Stimme: »Shaya! Shaya!
Wach auf!«
Sie erwischte den Knaben, als er ihr im Korridor entgegenstolperte.
»Bleib ruhig, Chiyu, es ist alles in Ordnung. Komm, ich bring dich wieder ins Bett.«
»Nein!« Er wehrte sich und riss sich los. »Meine Großmutter!
Irgendetwas Schreckliches ist passiert. Sie ist verletzt. Sie stirbt. Wir müssen zu ihr. Wir müssen schnellstens zu ihr.« Seine Augen waren geweitet; panisch riss er an Shayas Arm.
Die Frau bemühte sich, ihre Müdigkeit abzuschütteln. »Du hast nur geträumt, Dennor. Es war nur ein Alptraum. Beruhige dich doch.«
»Nein, es ist kein Traum. Du musst mir glauben. Ich habe es gespürt. Ich habe sie in meinem Geist gesehen, mit meinem Laran.
So, wie ich dich und die anderen im Matrixkreis gesehen habe.«
Shaya zuckte zusammen. Sie musste ihn ernst nehmen, auch wenn sie sich nicht eingestehen wollte, dass seine Visionen zutrafen.
»Trotzdem«, sagte sie scharf, »musst du dich beruhigen.
Selbstbeherrschung ist die oberste Regel all dessen, was ich dich gelehrt habe. Wenn es stimmt, was du sagst, musst du dich beherrschen, um deiner Großmutter zu helfen. Kontrolliere nun deine Gedanken. Zeig mir, was du gesehen hast.«
Sie stand im dunklen Korridor, nahm Dennors Hände in die ihren und verband ihren Geist mit dem seinen. Wie immer ließ die Sturmhaftigkeit seiner Gedanken sie wanken. Sie bekämpfte die Übelkeit und brachte ihn und sich zur Ruhe. Schließlich erlebte sie seinen Traum oder seine Erinnerung nach: Domna Delleray kippte hilflos nach hinten, dann folgte ein stechender Schmerz an der Schläfe. Sie ließ ihren Geist in die Ferne greifen, tastete um sich, sandte einen Hilfeschrei an jenen, der ihr am nächsten war, ihren einzigen Enkel. Dann fiel sie der Bewusstlosigkeit anheim … oder dem Tod.
»Nein«, beharrte Dennor, der Shayas Gedanken auffing. »Sie ist nicht tot. Ich würde es wissen. Aber wir müssen schnell zu ihr.«
Lista, die plötzlich neben der Wortführerin stand, sagte mit ruhiger Stimme: »Ich hole die Pferde.« Shaya glitt aus der Verbindung und erblickte die um sie versammelten Gildenschwestern. Auch sie hatten die Lage sofort erfasst.
»Zieh dich schnell an«, sagte sie zu Dennor. »Du brauchst Schuhe und einen warmen Umhang. Beeilt euch, alle.« Niemand wäre auf die Idee gekommen, zurückzubleiben.
Nach endlos langer Zeit, die jedoch viel kürzer war, als sie glaubten, trotteten sechs Pferde den schmalen Weg hinunter, der zum Fuß des Berges führte. Glücklicherweise war der Mond Liriel aufgegangen, und zwei andere schickten sich gerade dazu an. »Wir müssen gleich hinter der Brücke auf den kleinen Pfad abbiegen!«, rief Dennor von vorn. »Seit dem Tod meiner Mutter lebt Großmutter auf dem Besitz meines Vaters allein in einem Landhaus! Bei ihr ist nur eine Zofe, und Iniya ist taub.«
Vor der Tür des Landhauses sprangen sie von den Pferden. Caitha lief voraus, klopfte und rief: »Domna Magwyn! Domna! Iniya! Ist niemand hier?« Dennor war nur wenige Schritte hinter ihr und vergeudete mit Klopfen keine Zeit. Er zog einen langen Holzschlüssel aus einem hohlen Baum und hatte die Tür im Nu geöffnet. Da stolperte ihnen auch schon im Hausflur die mit einem zerknitterten Nachthemd bekleidete Zofe entgegen und schwenkte ein Schüreisen. Als die arme benommene Frau Dennor erkannte, ließ sie die Waffe fallen und starrte die Entsagenden an.
»Iniya!«, schrie Dennor. »Wo ist Großmutter?«
Ein leises Stöhnen antwortete ihm, dem sie in den nächsten Raum folgten. Magwyn lag am Fuß der Treppe, eine Gesichtshälfte war voller Blut. Iniya stieß einen kurzen Schrei aus und eilte an die Seite ihrer Herrin. Shaya bückte sich daneben und zog sie zurück. »Meine Schwester Lista soll sie untersuchen, Mestra«, sagte sie. »Sie ist Hebamme und Heilerin.« Dies war natürlich eine Lüge, aber so konnte sie am besten vertuschen, dass Lista die beste Überwacherin der Gruppe war. Iniya wurde hinausgeschickt, damit sie in kochendem Wasser einige belebende Kräuter einweichte. So hatte Lista Gelegenheit, Magwyns Verletzung zu untersuchen.
Mit der pragmatischen, leidenschaftslosen Disziplin, die sie erlernt hatte, meldete sie: »Lady Magwyn ist übel gestürzt, doch ihr Rückgrat ist unverletzt. Sie hat keine inneren Verletzungen, nur einige Hautabschürfungen. Das Schlimme ist, dass sie sich den Kopf gestoßen hat und an einer inneren Blutung leidet. Wenn sie nicht bald aufhört zu bluten - und ich glaube nicht, dass es von selbst geschieht -, trägt sie einen irreparablen Hirnschaden davon. Dann wird sie in zwei oder drei Stunden sterben.«
Dennor fing an zu weinen. »Sie darf nicht sterben. Sie ist die Einzige, die mich je geliebt hat. An meine Mutter kann ich mich nicht erinnern. Ich kann sie nicht auch noch verlieren.«
Dorelle nahm ihn in die Arme. Zum ersten Mal wehrte er sich nicht. »Chiyu, für jeden von uns ist irgendwann die Zeit gekommen.
Deine Großmutter hat viele gute Jahre erlebt, nun wird sie sanft und ohne Schmerzen von uns gehen. Und du wirst dich immer an ihre Liebe erinnern.«
Dennor befreite sich von ihr und schaute Shaya an. »Ihr könnt ihr helfen. Ich weiß, dass ihr es könnt. Benutzt eure Zauberkräfte - oder beherrscht ihr nur Tricks, die man bei Festlichkeiten vorführt?«
Seine Worte und sein provozierender Ton tarnten einen gequälten Appell.
»Es ist viel mehr, als wir je versucht haben«, sagte Shaya voller Zweifel. »Ich weiß nicht mal, ob ein geschickter Turmkreis sie retten könnte.«
»Was haben wir zu verlieren?«, fragte Lista.
»Eigentlich nichts.« Shaya legte eine Hand auf Dennors Schulter.
»Wir werden es versuchen … Aber alles hängt von Avarras Willen und Gnade ab.« Sie musterte das schmerzerfüllte, blutige Gesicht, das so stolz und ehrlich gewesen war. »Auch ich möchte, dass sie weiterlebt. Das musst du verstehen, Dennor. Aber manchmal reicht es nicht aus, wenn man nur etwas will und sich bemüht.«
Sie trugen Domna Magwyn in ihr Bett und gaben Iniya zu verstehen, dass sie nicht gestört werden wollten. »Das gilt auch für dich«, sagte Caitha und schob Dennor zur Tür. »Wenn wir alles getan haben, was wir können, schicken wir nach dir.«
Der Knabe sträubte sich. »Ich möchte euch helfen. Ich möchte beim Kreis dabei sein.«
Caitha schaute Shaya stirnrunzelnd an.
»Ich fürchte, es würde nicht klappen«, sagte Shaya sanft. »Wir fünf haben zusammen geübt und wissen, wie wir unser Laran vereinigen müssen. Du bist nicht ausgebildet genug und würdest uns nur stören.«
»Aber du hast gesagt, ich war sehr gut mit dem Sternenstein. Bitte, lass mich mithelfen. Braucht ihr nicht alle Kraft, die ihr kriegen könnt? Ich bin stark. Ich tue auch alles, was du sagst.«
»Dennor«, erwiderte Shaya ernst, »selbst wenn du fest zu unserem Kreis gehören würdest, müsstest du diesmal draußen bleiben. Deine emotionale Verbindung zu deiner Großmutter könnte unsere Arbeit stören. Und wenn sie stirbt, während du mit uns verbunden bist, ist es vielleicht mehr, als du ertragen kannst.«
»Nein, nein, ich muss.« Dennor war den Tränen nahe.
»Wenn sie stirbt, ohne dass ich mit versucht habe, sie zu retten, werde ich immer glauben, es wäre meine Schuld gewesen, weil ihr mich nicht habt helfen lassen. Wenn ich zum Kreis gehöre und wir versagen, weiß ich, dass Avarra es so gewollt hat.«
Seine Worte waren nicht ganz falsch. Shaya erkannte es und spürte, dass die anderen es bestätigten. Außerdem konnten sie seine Kraft brauchen. Andererseits war die Verbindung mit dem Jungen eine stürmische Angelegenheit. Konnte er die heikle Aufgabe stören, die ihnen bevorstand?
Mellina zog sie beiseite. »Bitte, Shaya … Frag dich, ob du nur deswegen Nein sagst, weil du nicht gern mit ihm zusammenarbeitest. Wenn dies der Grund ist, überlege es dir noch mal.«
Shaya seufzte. »Ich fürchte, du hast Recht. Wir werden unser Bestes geben - alle sechs zusammen.«
Shaya holte Dennor als Letzten in den Kreis. Sie wollte die Kraft der ihr vertrauten Fünferverbindung spüren, bevor der Knabe sie wie ein Tornado durcheinander wirbelte. Zuerst Listas Sonne, dann Dorelles Schnee, schließlich Caithas Brise und das Sternenlicht und die Rätselhaftigkeit Mellinas - alles zusammen verwoben, fest, stark, unverwüstlich. Nun griff ihr Geist ganz sanft zu Dennor hinaus und holte ihn hinzu …
Der Schlag riss alle auseinander. Dorelle fiel sogar keuchend zu Boden. Die anderen schauten, als hätten sie eine Ohrfeige bekommen.
»Was ist passiert?«, fragte Dennor verwirrt. »Hab ich was falsch gemacht?«
»Es liegt nicht an dem, was du getan hast«, erläuterte Shaya. Die Bestürzung in der Stimme des Knaben rührte sie. »Du hast eben eine Natur, an die wir nicht gewöhnt sind. Na schön, Leute …« Sie tastete die Gruppe konzentriert mit Blicken ab. »Bevor wir aufgeben, versuchen wir es noch einmal. Ich kenne ihn besser. Das macht es vielleicht einfacher für euch.«
Sie schaute erneut in ihren Matrixstein, dann griff sie zu Dennor hinaus. Er bemühte sich, seine psychische Energie zurückzuhalten.
Shaya freute sich zwar über sein Tun, aber sie wusste, dass genau diese Zurückhaltung zugleich auch die Kraft minderte, die er ihnen geben konnte; dass sie mit allen sechsen so arbeiten musste, wie sie wirklich waren. Sie musste auf die Verbindung vertrauen oder es ganz sein lassen. Also verband sie sämtliche Geister mit dem seinen und öffnete sich wie nie zuvor den Turbulenzen, die durch seine Präsenz entstanden. Sie versuchte, sein Chaos irgendwie zu absorbieren. Sie fragte sich einen Augenblick und zum ersten Mal, welche Art Himmel oder Wetter sie wohl selbst darstellte. Dann vergaß sie die unwichtige Frage und fügte die vier anderen nacheinander hinzu. Die Verbindung war ihr unvertraut, wie eine raue See, aber sie hielt. Lista überwachte den Kreis und verkündete, dass sie weitermachen konnten.
Shaya lauschte Listas Angaben über Magwyns Verletzung und ließ das Bewusstsein der gesamten Gruppe in das beschädigte Hirngefäß eindringen. Langsam und so vorsichtig, dass ein willkürlicher Gedanke sie vom Kurs hätte abbringen können, lokalisierten sie die Wunde, bis sie schließlich die als verletzt ausgemachte Schwachstelle und das unter dem Druck entweichenden Blutes schmerzende Gewebe fanden. Sofort machten sie sich an die Arbeit.
Wer machte sich an die Arbeit? Als Shaya sich später an das Geschehene zu erinnern versuchte, war ihr, als hätte es nur Substanz und Bewegung gegeben. Die Substanz waren Zellkörper, Zellwände, die Kohäsion zwischen Gewebe und sich sammelnden Flüssigkeiten. Die Bewegung war die von Wind, Schnee, Sternen und Sonnenschein und einer Wildheit, die alles zusammen zu einem wunderschönen und zielgerichteten Durcheinander vermischte.
Das Ganze war schwer zu handhaben und verlangte die größten Anstrengungen, die Shaya als Kreiszentrum je erlebt hatte. Dennors Turbulenzen waren kurz davor, außer Kontrolle zu geraten und die sie verbindende Kohäsion zu zerreißen, außerdem drohte das pumpende Blut in Magwyns Gehirn die neuen, von der Kraft und der Führung der vereinten Geister sorgfältig verbundenen Zellwände zu zerreißen. Gegen diese Zerschlagung sammelten sie sich und schoben ihren Geist noch tiefer ineinander, bis Shaya den Eindruck hatte, sie selbst sei Sonnenschein, Sterne, Frühlingsbrise, Schneefall - und Tornado. Denn Dennor griff in den Kampf um den Bestand der Einheit ein und richtete all seine Kraft darauf, den Mittelpunkt zu stabilisieren. Er wollte die Verbindung der anderen ebenso erhalten, wie er das pulsierende Blut in Magwyns Gehirn vernichten wollte.
Es hätte ein paar Minuten oder die ganze Nacht dauern können.
Zu den Elementen und Gefühlsausbrüchen, die mal stärker und mal schwächer wurden und sich schließlich verbanden, gehörte die Zeit nicht. Doch schließlich war es vorbei, und Magwyn lag friedlich schlafend da. Sie atmete tief und regelmäßig. Als Shaya den Kreis liebevoll auflöste und die anderen aus der persönlichsten vorstellbaren Intimität entließ, liefen Tränen über ihr Gesicht.
Es dauerte ziemlich lange, bis jemand das Wort ergriff oder ein Bedürfnis dazu verspürte.
Dann sagte eine der Anwesenden, indem sie die Hand einer anderen - ja, es war Shayas Hand - berührte: »Davon hast du uns erzählt, nicht wahr? So fühlt sich ein echter Matrixkreis in.«
Shaya nickte. Dann lachte sie leise. »Jetzt weiß ich, warum es so lange gedauert hat. Ich habe die Angehörigen unserer Truppe zu sorgfältig ausgewählt. Wir haben uns so sehr bemüht, liebevoll miteinander umzugehen. Wir haben zu gut zusammengepasst. Was uns gefehlt hat, war ein solcher …
… Zwist.«
Dennor grinste nur.
Über Annette Rodriguez und ›Gebrochene
Schwüre‹
Annette sagt, sie lebe mit einem ›lebhaften kleinen Engelfisch‹
zusammen, der (da er zumindest keinen Lärm macht) ein idealer Zimmergenosse sei. Ihre Reaktion auf die Nachricht, dass ihre Erzählung angenommen wurde, lautete ›WOW!‹ Sie hat noch nie zuvor etwas veröffentlicht und einen Abschluss in Biologie, weswegen ich mich ihr sehr unterlegen fühle, da ich es nur geschafft habe, an einem kleinen College in Texas einen Bachelor-Abschluss zu ergattern. Ich bin der einzige mir bekannte Mensch ohne Magistertitel; sie hingegen plant eine Laufbahn in den Fächern Molekularbiologie und Genetik. Annette ist in Kuba zur Welt gekommen und hat keine Kinder, was für unverheiratete Frauen wohl natürlich ist - oder etwa nicht? Es sei denn, man ist Filmstar.
Diese Geschichte beschäftigt sich mit einem Problem der Entsagenden, das von Anfang an zu sehr beunruhigenden Fragen geführt haben muss. Es gibt immer einige Entsagende, die sich verlieben. Seit ich dies zum ersten Mal erwähnte, wurde ich immer wieder in Briefen gefragt, was anschließend aus ihnen werde. Nicht alle können den gleichen Weg beschreiten wie Jaelle n’ha Melora. -
MZB
Gebrochene Schwüre
von Annette Rodriguez
Erschöpft von dem eisigen Wind, der aus den Hellern herüberwehte, völlig durchgefroren und vor Schmerz nach einem Hundebiss auf einem Bein hinkend, schleppte Aleta sich dem fernen Licht des Gildenhauses entgegen. Der Abend war gnadenlos gewesen und ließ sie nur noch an ein Obdach denken. Sie hob die schweren Röcke hoch, dankbar für die Wärme, die sie ihr spendeten, und stolperte erneut. Es war vergebens; sie würde es nicht schaffen.
Doch der heulende Wind brachte Geräusche mit sich, und da ein leises Rascheln, das ihre Furcht noch steigerte, da sie nicht wusste, woher es stammte.
Banditen? Sie rappelte sich auf. Es war besser, tot umzufallen, als in den Händen solcher Männer zu enden.
Die Lichter des Gildenhauses von Neskaya flackerten zaghaft.
Würde man ihr Klopfen überhaupt hören, wenn sie zu dieser späten Stunde kam? Die Leute dort schliefen sicher schon. Ob Zelda noch Wache an der Tür hielt, oder hatte sie ihre Gewohnheiten nach all den Jahren geändert?
Doch die Frage ließ sie nur in kalter innerer Angst frösteln. Würde man sie überhaupt hineinlassen? Ihre Finger waren taub, als sie die Faust ballte, um an die Tür zu klopfen. Niemand öffnete. Die Sekunden schienen sich zu Stunden auszudehnen.
Dann ging die Tür mit einem lauten Klicken langsam auf. Ein warmer Luftzug fegte über die Schwelle. Aleta schaute aus tränenden Augen auf und erblickte den korpulenten Umriss der Türwächterin Zelda. »Ich brauche Obdach«, murmelte sie.
Doch das breite, lächelnde Gesicht, das sofort Mitgefühl gezeigt hatte, war hart und wütend, als es Aleta erkannte. »Du!« Aus Zeldas Mund klang es wie ein Vorwurf.
»Bitte«, flehte Aleta. »Ich kann nirgendwo anders hin.«
Ich weiß, ich hätte nicht kommen sollen. Es war falsch. Ich hätte eine Gefangene bleiben sollen - dort, wohin meine törichte Verliebtheit mich geführt hat. Doch es war zu spät. Die Nacht um sie herum brach allmählich herein und griff noch fester nach ihrem Bewusstsein. Sie wankte und streckte vergeblich die Hände aus, damit sie nicht allzu hart aufschlug.
Vor ihr schwankte eine zweite Gestalt. Kräftige Arme fingen Aleta auf, und bevor sie umfiel, wurde sie hineingetragen. Die Tür schlug mit einem festen Knall zu. Im gleichen Moment strömten vertraute Gerüche von Gewürzen, Leder und die Erinnerung an Sicherheit auf ihre Sinne ein.
Jemand drückte ihr eine Tasse an die Lippen, und Aleta trank.
Herber Wein brannte in ihrer Kehle. Sie spuckte und hustete, dann klärte sich ihr Blick. Dann nahm sie die Tasse zwischen die zitternden Hände und leerte sie mit mehreren Schlucken. Doch als sie zu Zelda aufschaute, um ihr zu danken, erblickte sie das angespannte, hagere Gesicht einer Frau in den mittleren Jahren mit kurz geschnittenem Haar.
»Dann hast du also endlich den Mut zur Rückkehr gefunden«, sagte die Frau so zynisch, dass Aletas Ohren schmerzten. »Das hätte ich dir gar nicht zugetraut.«
Aleta stellte die Tasse wortlos ab. Die Frau trat hinter sie, zog die dünne Kapuze zurück, die Aletas Kopf bedeckte, und enthüllte eine glänzende Schicht kastanienbraunen Haars, das eine edelsteinverzierte Kupferklammer zusammenhielt. »Dann hast du also nicht nur unserem Eid entsagt, sondern auch dein Haar wachsen lassen und seine Geschenke ebenso angenommen wie seinen Schutz.«
»Ich hatte doch keine Ahnung«, erwiderte Aleta. Sie zwang sich, angesichts der groben Worte nicht zurückzuschrecken.
Die Frau packte Aleta an der Schulter und zog sie herum, damit die Heimkehrerin sie ansah. »Das wagst du mir zu erzählen?«, sagte sie. »Ich habe dich in diesem Gildenhaus zur Welt gebracht. Du bist bei uns aufgewachsen. Du hast den Eid der Entsagenden abgelegt.
Du kennst uns und unsere Geheimnisse. All das hast du für einen Mann weggeworfen - und unser höchstes Vertrauen verraten!«
»Ich habe ihn geliebt!«, schrie Aleta und löste sich aus dem schmerzhaften Griff ihrer Mutter. »Er wollte mich als Aleta n’ha Kira nicht haben. Er konnte mich als Freipartnerin nicht akzeptieren.
Er ist der Sohn eines Comyn-Fürsten. Für uns gab es keine andere Möglichkeit als di Catenas.«
»Es gibt immer eine andere Möglichkeit«, sagte Kira. Sie ging nun auf und ab. »Hättest du uns vor dem Ablegen des Eides verlassen und dich an einen Mann gebunden, wäre es zwar enttäuschend gewesen, aber ich hätte es hingenommen. Doch dein Handeln muss bestraft werden, Aleta. Du hast unseren Eid gebrochen. Wärst du zurückgekommen, hättest deine Strafe angenommen und dich uns wieder angeschlossen - ich hätte dir verzeihen können. Aber du bist bei ihm geblieben und hast unseren Regeln getrotzt. Jetzt kannst du von uns nur noch eins erwarten.«
»Ich weiß«, erwiderte Aleta so leise, dass man es kaum hörte. Die letzten Worte des Eides der Entsagenden hallten in ihrem Gedächtnis wider: Mögen sie mich schlagen wie ein Tier und meinen Körper unbestattet liegen lassen zur Verwesung … Trotzdem speiste die Ungerechtigkeit der ganzen Angelegenheit ihre Antwort.
»Verstehst du denn nicht? Als ich den Eid sprach, war ich noch ein Kind. Ein Kind von fünfzehn Jahren, das von euren mutigen Taten geblendet und in Ehrfurcht erstarrt war. Ich wollte so sein wie du und Dana, meine Eidmutter, die immer mit ihren Kampfnarben geprahlt hat. Aber ich konnte es nicht. Ich habe mich fremd gefühlt.
Bei Alan war es anders. Zu ihm gehörte ich wirklich. Er hat gesagt, ich sei hübsch. Er hat gesagt, er liebe mich.«
Als Aleta fertig war, starrte Kira die leere Wand an.
»Doch am Ende war er eigentlich nicht anders als ihr. Das, was er wollte, war nicht das, was ich bin. Ich habe versucht, mich anzupassen, aber irgendwann war ich dann nur noch eine unwillkommene Fremde in seinem Haus.«
»Dann bist du also noch nicht di Catenas an ihn gebunden?«
Aleta schüttelte den Kopf. »Wir wollten uns beim letzten Mittwinterfest in Thendara verbinden, aber …«
»Aber jetzt bist du hier«, beendete Kira den Satz mit einem dumpfen Seufzer. »Also gut. Es ist eine ernsthafte Angelegenheit, die man nicht mitten in der Nacht zwischen Tür und Angel entscheiden darf. Ich sollte dich den Hunden vorwerfen und sie an deinen Knochen nagen lassen, aber du kannst über Nacht bleiben.
Zelda wird dir ein leeres Zimmer zuweisen und dir das besorgen, was du für den Moment brauchst. Es reicht, wenn wir das Für und Wider deiner Taten morgen früh abwägen.«
Aleta stand auf, tat einen Schritt und zuckte zusammen, denn der Schmerz in ihrem verletzten Fuß machte sich erneut bemerkbar. Sie sah das Aufblitzen von Besorgnis in den Augen ihrer Mutter, das jedoch schnell wieder erlosch. Dennoch zwang Kira sie, sich wieder hinzusetzen, damit sie den Fuß untersuchen konnte.
»Ein Hund hat schon einen Vorgeschmack von mir bekommen«, sagte Aleta. Sie versuchte ein ironisches Grinsen, als ihre Mutter den verschmutzten Verband abnahm.
Kira sagte nichts. Sie rief nur nach Wasser, Salben und einem frischen Verband, um die gezackte Wunde mit schnellen, tüchtigen und dennoch sanften Griffen zu versorgen. Das scharfe, akute Stechen, das Aletas ständiger Begleiter gewesen war, verblasste zu einem dumpfen Schmerz. Doch als sie aufstand, um ihrer Mutter zu danken, schubste Kira sie grob beiseite. »Du brauchst mir nicht zu danken. Ich hätte das Gleiche für jedes Tier getan, das in Schwierigkeiten ist.«
Darauf konnte man nichts erwidern. Aleta schaute zu, als Kira hinausging. Obwohl sie am liebsten hinter ihr hergeeilt wäre, um sie so fest zu umarmen, bis der Schmerz und der sie trennende Kummer vergingen, hielt sie sich zurück. Kiras Körperhaltung ließ die Frau abweisend und unnachgiebig wirken.
Plötzlich stand Zelda neben ihr, deren Miene ebenso kalt und ernst war wie die Kiras. »Hier entlang«, sagte sie und deutete mit der Hand durch einen langen Korridor, der zu einem Treppenhaus führte. Aleta folgte ihr widerstandslos und versuchte in heiteren Erinnerungen an längst vergangene Zeiten Trost zu finden. Als sie vor der Treppe stand, fielen ihr die halsbrecherischen Wettrennen mit ihrer damaligen Freundin Melinda ein. Sie waren die Treppe hinabgerannt und hatten jeweils zwei oder drei Stufen auf einmal genommen.
Melinda! Breda, ich hätte dich fast vergessen.
Obwohl Zelda ungeduldig am oberen Ende der Treppe wartete, musste Aleta es wissen. »Ist Melinda noch hier? Oder ist sie in ein anderes Gildenhaus gegangen?«
»Es wäre besser für sie gewesen, wenn sie es getan hätte«, erwiderte Zelda mit einem Anflug von Bedauern. »Sie ist auch dann noch geblieben, als wir genau wussten, dass du nicht zurückkehren würdest. Momentan begleitet sie als Führerin eine Reisegruppe durch die Berge. Es wäre unnötig grausam gewesen, wenn sie jetzt hier wäre und Zeugin deiner Rückkehr würde.«
Aleta nahm die grobe Rede hin, weil sie es nicht besser verdient hatte, aber sie fühlte sich nun noch deprimierter. Dass sie ihre Pflegeschwester Melinda allein gelassen hatte, bedauerte sie wirklich.
Zelda zeigte ihr das Zimmer, schloss die Tür und ließ Aleta mit ihren Gedanken allein. Hatte sie ein Recht zu hoffen, dass Melinda sie mit offenen Armen erwartete und aufnahm, als wäre nichts geschehen? Sie musterte die kargen Wände des Zimmers. Hatte sie überhaupt ein Recht, von ihrer Mutter und ihren Gildenschwestern Mitgefühl zu erwarten?
Die Wände gaben keine Antwort. Aleta sank auf das Bett, und die Erschöpfung des viertägigen Marsches durch das freie Gelände verlangte ihren Tribut. Schlaf war der einzige Trost, den das Gildenhaus ihr in dieser Nacht spendete.
Als sie glaubte, ihr Kopf sei gerade erst auf das Kissen gesunken, rissen die Geräusche hektischer, sich an ihrer Tür vorbeibewegender Schritte sie aus ihren Träumen. Blasser Sonnenschein drang durch die Fenster. Aleta rieb sich den Schlaf aus den Augen und erkannte, dass es früher Morgen war.
Sie stand auf, schüttelte die Falten aus dem weiten Rock und stellte fest, dass sie vollständig angezogen eingeschlafen war. Die Tür war unverschlossen. Die junge Frau öffnete sie, warf einen Blick in den leeren Korridor und begab sich zu der nach unten führenden Treppe.
Im Parterre herrschte Durcheinander. Aleta hörte Stimmen. Der angespannte Tonfall sagte ihr, dass irgendetwas Ungewöhnliches passiert war. Mehrere Frauen näherten sich der Treppe. In ihrer Mitte befand sich eine große junge Frau mit kurzen blonden Locken.
Sie schritt mit der Eleganz einer Damgeiß einher. Ihre weiten Amazonenhosen waren verstaubt und fleckig, und unter der zerrissenen Jacke, die in Fetzen um ihre Schultern hing, waren lange rote Kratzer zu sehen.
Aleta drückte sich alarmiert an die Wand, als wolle sie sich verstecken. Doch die Gruppe kam zu ihr hinauf, und nun konnte sie hören, was sie miteinander sprachen.
»Ein Wunder, dass dir nichts passiert ist. Ein Erdrutsch ist eine Todesfalle.«
»Ich habe auch gedacht, nun ist alles aus. Aber offenbar hat die Göttin andere Pläne mit mir. Wir wurden nicht allzu übel zugerichtet. Wir hatten wirklich großes Glück.«
»Nun ja, wenn man den größten Teil seines Proviants verliert, kann man eigentlich nicht von großem Glück reden. Es war schlau, dass ihr zurückgekommen seid, Melinda.«
»Leider war mein Auftraggeber ganz anderer Meinung. Er hat geschäumt und während der ganzen Rückreise herumgebrüllt …«
Die sich nun ausbreitende Stille war tiefer als die dunkelste Nacht.
Melindas Worte verstummten, als sie sah, dass Aleta den Blick rasch abwendete. Sie erbleichte, als sie ihre einstige Gefährtin erkannte.
Aleta drehte sich um und kehrte in ihr Zimmer zurück. Durch den Tränenschleier, der ihren Blick trübte, war sie fast blind. Melinda hatte sie gesehen und erkannt. Im ersten Augenblick hatte ihr Gesichtsausdruck Aleta wirklich willkommen geheißen, doch dann hatte sie die Zurückgekehrte mit der gleichen kalten Uninteressiertheit gemustert, die Aleta von ihrer Mutter kannte.
Melinda hatte sie verbittert zurückgewiesen.
Aleta hinkte zum Bett. Mit Kiras Grobheit hatte sie gerechnet. Die Feindseligkeit der anderen Entsagenden war nur eine natürliche Konsequenz. Auch diese hatte sie hingenommen. Sie konnte die Frauen sogar verstehen. Doch auf Melindas Feindschaft war sie nicht vorbereitet gewesen. Das war zu grausam und erfüllte sie mit tiefem Schmerz.
Ein Klopfen an der Tür versetzte sie in Panik. War es Melinda? Sie zuckte zusammen. Sie konnte sich einer solchen Tortur jetzt nicht stellen. Zum Glück trat nur Zelda mit einem Frühstückstablett ein.
»Kira lässt dir ausrichten, du sollst runterkommen, wenn du gebadet und gegessen hast«, sagte sie forsch. »Man hat einen Beschluss gefasst.«
Aleta warf einen Blick auf das Frühstück. Der Knoten in ihrem Magen hatte das Hungergefühl längst vertrieben. »Ich bin in ein paar Minuten fertig«, sagte sie. Doch Zelda war schon gegangen, ohne ihre Antwort abzuwarten.
Aleta sackte erneut auf dem Bett zusammen. Ich muss den Mut aufbringen, mich ihnen zu stellen - was sie sich auch ausgedacht haben, um mich zu strafen. Je eher, desto besser. Wenn doch bloß Melinda nicht hier wäre … Dann könnte ich die Schande leichter ertragen. Sie konnte klagen, so viel sie wollte - ihr blieb nichts anderes übrig als aufzustehen und in den Versammlungsraum des Gildenhauses zu gehen.
Korridor und Treppenhaus waren leer. Alle Beweise von Melindas stürmischer Ankunft waren wie ausradiert. Aleta holte tief Luft, um ihre Nerven zu beruhigen. Als sie weggegangen war, war sie doch auch nicht so ängstlich gewesen. Die zwei unter den Domänenfrauen verbrachten Jahre hatten sie verweichlicht. Doch nun, da sie den Gildenschwestern gegenübertreten musste, würde sie nicht beben, damit alle ihre Furcht sahen. Irgendwie würde sie sich dem stellen, was sie erwartete. Sie wusste allerdings, dass ihr Mut wie Glas und damit leicht zerbrechlich war.
Jemand kam auf sie zu. Es war Zelda. »Sie warten auf dich.«
Aleta nickte. Sie wusste es ohnehin. Sie ging durch die Tür in den Versammlungsraum hinein, in dem bereits alle Gildenschwestern anwesend waren. Als sie eintrat, stand Kira auf und gab Dana mit einer Handbewegung zu verstehen, sie solle vortreten. Aleta tauschte einen Blick mit ihrer Eidmutter und konnte auch in deren Augen nichts als unverhohlen feindselige Zurückweisung erkennen.
»Ein Kurier deines Liebhabers ist gekommen«, sagte Kira und verwendete unverblümt den vulgären Ausdruck. »Er ist hier, um dich zurückzugeleiten. Es sieht ganz so aus, als würdest du Alan fehlen.«
Aleta wagte nicht einmal, den Blick zu heben, geschweige denn, ein Wort zu sagen.
»Immerhin ist er zivilisiert genug, kein Heer zu schicken, um seine künftige Braut zurückzuholen«, fuhr Kira im gleichen milden Tonfall fort. »Das ist natürlich inkonsequent. Seine Forderungen stehen nicht über unseren Rechten. Unsere Gesetze besagen eindeutig, dass jemand, der den Eid erwiesenermaßen gebrochen hat, sich unserer Gerichtsbarkeit stellen muss. Wer es nicht tut, dem droht die Todesstrafe.«
»In diesem Fall ist die Sachlage nicht ganz eindeutig«, warf Dana ein.
Aleta schaute schnell auf. Wie kam es, dass jemand zu ihren Gunsten sprach? Doch sie war noch überraschter, als sie ihre Mutter zustimmen hörte.
»So ist es, Dana. Es war möglicherweise ein Irrtum, dass wir eine Person den Eid haben ablegen lassen, die noch nicht reif genug war, alles zu verstehen, was er beinhaltet. Doch nun ist es zu spät, den Schaden rückgängig zu machen. Die Todesstrafe ist zu hart, aber wir dürfen nicht zulassen, dass man den Eid auf die leichte Schulter nimmt. Wir sprechen daher eine andere Strafe aus.«
So schnell Aletas Hoffnung gewachsen war, so schnell nahm sie bei Kiras nächsten Worten wieder ab. »Aleta, du wirst hiermit für tot erklärt. Keine Entsagende darf sich dir nähern, mit dir sprechen, dir helfen oder dir Trost spenden. Du erhältst Hausverbot für alle Gildenhäuser und darfst mit keiner der Unseren Kontakt aufnehmen. Der Name Aleta n’ha Kira wird aus all unseren Unterlagen und Herzen gestrichen. Kehre zurück zu dem Mann, dessen Haushalt du dem unseren vorgezogen hast und setzte nie wieder einen Fuß auf den Grund und Boden dieses Hauses.«
Auf eine Geste Kiras hin wandten alle Entsagenden Aleta den Rücken zu. »Nun geh«, sagte sie zu der benommenen jungen Frau.
»Mögest du Trost in der Liebe finden, die dazu geführt hat, dass du die unsere verloren hast.«
Aleta schluckte. Sie konnte die Strenge des Urteils nicht verstehen.
Steif ging sie hinaus und wollte kaum glauben, was passiert war.
Die Haustür stand offen und schloss sich langsam hinter ihr. Nein, es kann nicht wahr sein. Gab es denn kein Vergeben mehr, kein Verständnis?
Auf dem Hof hielten sich mehrere Entsagende auf, doch auch sie wandten Aleta den Rücken zu, als diese in ihre Richtung schaute.
Sie war eine Ausgestoßene, ungeliebt und nutzlos; man versagte ihr sogar, sich zu wehren.
Dann näherten sich ihr Schritte. Als sie aufschaute, sah sie einen Mann, Alans Kurier, mit einem Pferd auf sie zugehen. »Ihr sollt mit mir zurückkehren, meine Dame«, sagte er.
Aleta nickte. Hatte sie eine andere Wahl? Was war ihr noch geblieben? Sie ließ zu, dass der Mann ihr beim Aufsitzen half, und fühlte sich zur Unterwerfung gezwungen. Der Kurier stieg auf sein Pferd und geleitete Aleta zwischen den Bäumen hindurch fort vom Heim ihrer Kindheit. Sie hatte es für immer verloren.
Irgendwie vergingen die Stunden, bis die rote Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand. Der Wind fing heftig an zu wehen, doch Aleta empfand kein Interesse an all diesen Dingen. Sie war wie eine Marionette, deren Fäden man zerschnitten hatte. Sie spürte keinen Schmerz mehr.
Der Ritt durch den nebelverhangenen Wald wurde von Geräuschen begleitet. Geräusche, die sie, wäre sie wachsam gewesen, geängstigt hätten. Ihr Pferd stieß ein warnendes Wiehern aus, seine Nüstern zuckten, als es die Gefahr witterte. Doch erst als das Pferd des Kuriers sich auf die Hinterläufe stellte und den Mann wie einen leblosen Sack aus dem Sattel und zu Boden schleuderte, erwachte Aleta aus ihrer Lethargie.
Schatten lösten sich von den Bäumen. Hässliche Männer, die sie in der Finsternis begierig anstarrten, kamen auf sie zu. Die Messer in ihren Händen blitzten wie spitze Fänge. Aleta wollte schreien, aber das Entsetzen schnürte ihre Kehle zu. Sie konnte nur um sich treten und zuschauen, wie der Mann, der sich auf sie stürzte, plötzlich nach hinten fiel.
Sie rammte die Fersen in die Seiten ihres Pferdes und spürte, dass es einen Satz nach vorn machte. Doch irgendjemand griff nach ihrem Reitumhang und zog sie aus dem Sattel. Als sie auf dem harten Boden aufschlug, stockte ihr der Atem. Eine heiße, schwere Hand legte sich auf ihr Gesicht, und Aleta erschlaffte. Es waren zu viele. Sie konnte nicht gegen alle kämpfen.
Jemand drückte sie nieder und zerrte an ihren Kleidern. Sie war hilflos, eine Figur, mit der man spielte. Nun war es ihr egal. Doch als sich der widerwärtig riechende Atem eines Mannes ihrem Mund näherte, rebellierte sie. Es war ihr nicht egal! Sie würde sich nicht unterwerfen. Heißer Zorn blitzte in ihr auf. Die Bewegungen wurden langsamer. Die Gesichter der Männer wurden zu verwaschenen Flecken. Nun steuerte die Ausbildung ihrer frühen Jugend Aletas Bewegungen. Sie war keine schwache, weiche Domänenfrau und auch kein Kind mit großen Augen, das sich wünschte, heldenhaft zu sein und trotzdem bei jedem Versuch versagte. Sie war Aleta. Nicht mehr und nicht weniger. Sie wollte sich nicht länger von allen Leuten herumschubsen und manipulieren lassen.
Der Angreifer schrie in plötzlichem Schmerz auf, als Aleta ein Knie in seinen Schritt rammte. Er rollte sich auf die Seite und stöhnte wie ein Säugling. Die Frau sprang wie eine vorschnellende Feder auf die Beine und rannte los. Sie lief wie der Wind; wenigstens war sie nun frei von dem Gewicht, dass sie zu Boden gedrückt hatte. Die anderen Männer waren nirgendwo zu sehen.
Wenn sie eins der Pferd fand, konnte sie fortreiten und …
Zwischen den Bäumen kam eine Gestalt auf sie zu. Bevor Aleta sich verteidigen konnte, wurde sie mit dem Gesicht nach vorn zu Boden geschlagen. Ihre Hände griffen in die Erde, und sie wand sich unter der Kraft des neuerlichen Angriffs.
Dann schwang sie wild die Beine hoch und bemühte sich verzweifelt, ihren Häscher abzuschütteln. Doch in ihren Ohren ertönte ein helles, melodiöses Lachen. »He, Aleta. Bei Zandrus Höllen! Hör auf, sonst schlägst du mich noch bewusstlos!«
»Was?« Aleta spuckte aus, setzte sich hin und wurde auf der Stelle losgelassen. »Wer bist du? Was geht hier vor?«
»Wer ich bin? Hast du mich etwa schon vergessen? Ich bin’s, Breda! Melinda!«
Aleta keuchte auf, als sie hörte, dass ihre alte Freundin sie so persönlich ansprach. »Aber wieso? Ich meine, was machst du hier?
Ich bin ausgestoßen! Niemand darf mit mir sprechen.«
»Der Befehl wurde widerrufen«, verkündete eine andere Stimme, die ihr ebenfalls sehr bekannt vorkam.
»Mutter!« Aleta rappelte sich mit einem Schrei auf. »Ich verstehe nicht. Was macht ihr hier?«
Kira schlang die Arme um die bebenden Schultern ihrer Tochter.
»Sachte, Chiya. In ein paar Minuten wirst du alles wissen. Doch sag mir: Bist du verletzt?«
»Nein, aber …«
»Pssst«, machte Kira. »Ich hab doch gesagt, dass ich es erkläre. Wir haben bereits vor einigen Tagen erfahren, dass du das Haus des Comyn-Fürsten verlassen hast. Du hattest schon eine beträchtliche Wegstrecke hinter dich gebracht, als zwei Entsagende dich entdeckten und dir folgten, damit dir nichts zustößt. Dann standen wir vor einer sehr schwierigen Entscheidung. Wir haben zwar beschlossen, dich wieder aufzunehmen, aber einer Strafe solltest du nicht entgehen. Immerhin hast du unsere Gesetze gebrochen. Glaub mir, als ich dich so einsam und verloren vor der Tür stehen sah, musste ich mich zusammenreißen, um dich nicht wie ein kleines Kind in die Arme zu nehmen.«
Aleta war sprachlos. Konnte sie den Worten ihrer Mutter trauen?
Hatte man ihr nur etwas vorgespielt, um sie zu bestrafen? Wenn es wirklich so war, hatte man ihr Leben und damit sie schon wieder manipuliert. Die Ungerechtigkeit ließ sie schlagartig zornig werden.
»Genau deswegen kehre ich nicht zu euch zurück«, schimpfte sie.
»Ihr hättet mich wählen lassen sollen, ob ich die Strafe annehme. Ich hatte das Recht dazu. Ihr habt mir die freie Wahl versagt. Ihr seid davon ausgegangen, ich würde mich widerstandslos mit euren Plänen einverstanden erklären und müsse überglücklich sein, wieder zu euch kommen zu dürfen.«
Kira schaute sie an, ohne eine Gefühlsregung zu zeigen. »Wenn du nicht wieder ins Gildenhaus kommen willst … Was hast du vor?
Willst du zu Alan zurückkehren?«
»Nein«, erwiderte Aleta und drehte das Gesicht in die finstere Nacht hinein. Sie wusste, dass dieser Teil ihres Lebens vorbei war.
»Er ist wie ihr. Ständig will er etwas aus mir machen, das ich nicht bin. Ich lasse mich nicht zwingen oder überreden, die Entscheidungen anderer gutzuheißen. Ich entscheide selbst, was für mich das Beste ist. Ich wähle die Freiheit.«
Als Aleta die beiden Frauen anschaute, erwartete sie natürlich, Verärgerung und Groll in ihren Gesichtern zu sehen. Doch auch davon wollte sie sich nicht beeinflussen lassen. Zu ihrer Überraschung lächelte Melinda jedoch, und im glücklichen Gesicht ihrer Mutter glitzerten Freudentränen.
»Ich bin so stolz auf dich, meine Tochter«, sagte Kira leise. »Jetzt verstehst du endlich, was es bedeutet, Entsagende zu sein. Damit hast du den Eid erfüllt, den du abgelegt hast, als du noch zu jung warst, um ihn zu verstehen.«
Melinda trat auf Aleta zu. »Verstehst du denn nicht, Breda? Du hast stets andere dein Leben bestimmen lassen. Aber dies ist nicht die Art der Freien Amazonen. Wir wählen unser Schicksal selbst, so wie du es gerade getan hast. Wir verlassen uns auch nur auf uns selbst, wenn wir Schutz brauchen. Niemand hat Anspruch auf uns.
Nur dann ist man wirklich frei.«
Aleta verstand. Ihre Wut verrauchte. Ihr war, als hätte sie endlich zu sich selbst gefunden. Nun wusste sie, wohin sie gehörte. Doch plötzlich schienen die Jahre und die Trennung Spuren in Melindas Gesicht hinterlassen zu haben. Aleta hatte das Gefühl, als würde ihr Herz brechen. »Kannst du mir den Schmerz vergeben, den ich hervorgerufen habe, als ich fortging, Breda?«
Melinda lächelte. »Nimm meine Hand«, sagte sie, »dann siehst du, dass alles vergessen ist.«
Als Aleta die Hand ergriff, war der warme, freundschaftliche Druck für ihre strapazierten Gefühle wie eine lebensspendende Salbe. Sie drehte sich zu ihrer Mutter um, die nun erneut einen Arm um ihre Schulter legte. »Wo stecken eigentlich diese Kerle?« Sie schaute sich um. »Und der, der mich angegriffen hat?«
Kira tauschte einen Blick mit Melinda und lachte. »Ich fürchte, Chiya, du warst ein wenig zu streng mit ihnen. Als wir sie für dieses kleine Abenteuer engagierten, haben wir ihnen erzählt, du seist ein zartes Persönchen und nicht besonders kräftig. Und als dann ein Berglöwe über sie herfiel, sind sie ins Dorf geflohen. Ich nehme an, sie werden in Bälde wieder Gerüchte darüber verbreiten, wie schrecklich die Freien Amazonen sind.«
»Nein«, sagte Aleta und kicherte. »Amazonen sind überhaupt nicht schrecklich. Sie sind wahrscheinlich nur etwas abartig; besonders gewisse Gildenmütter und ihre Jünger. Aber mir fällt trotzdem keine Gesellschaft ein, in der ich mich lieber bewegen würde.«
An Stelle einer Antwort zeigte Kira ein breites Lächeln. »Dann gehen wir also heim, meine Töchter. Und möge uns nie wieder etwas trennen.«
Dem konnte Aleta aus vollstem Herzen zustimmen.
Über Janet R. Rhodes und ›Wenn Banshees sehen
könnten‹
Immer wieder haben Leser mich gefragt, ob es eine Fortsetzung zu Die schwarze Schwesternschaft geben wird. Meine Antwort lautete stets: »Nein. In dieser Geschichte wird etwas gesucht, nicht gefunden, und die uralte Geschichte von der Suche nach dem Paradies verläuft traditionell so, dass seine Entdeckung entweder offensichtlich oder unmöglich ist.« Janet Rhodes hat diese Antwort jedoch nicht gefallen, weswegen sie ihre eigene eingesandt hat. Und hier ist sie.
Janet Rhodes’ erste Erzählung erschien in Die Domänen, und die Autorin ist kürzlich der Vereinigung der Science-Fiction-Autoren Amerikas, der SFWA, beigetreten. Sie lebt in Olympia, Washington, ist im Staatsdienst tätig und arbeitet derzeit an einem Roman, der in ihrem eigenen Universum spielt. - MZB
Wenn Banshees sehen könnten
von Janet R. Rhodes
Tief in Gedanken versunken und schwermütig ging Margali n’ha Ysabet durch die Gänge der Stadt der Weisen Schwesternschaft. Alle paar Schritte ballte sie die Hände zu Fäusten und entkrampfte sie wieder. Die dunkelroten Strahlen der Sonne drangen an diesem Spätnachmittag durch die Oberlichter, ließen den Steinboden fleckig wirken und schienen sie zu verfolgen.
Was bedrückt dich so, Bredhyia?, rief eine vertraute Stimme in ihrem Geist. Die Frage ließ Margali stehen bleiben. Sie drehte sich um und ging dorthin zurück, wo ihre Freundin und Breda Camilla vor der Tür des schlichten Raumes stand, der ihr Zuhause war. Camilla war groß und hager und wirkte eher wie ein Mann. Sie war eine Emmasca; sie hatte sich der illegalen Neutralisierung unterzogen, die nur die Leroni in den Türmen beherrschten. Margali und sie hatten den Eid der Freipartner jedoch nicht abgelegt. Margali war diese Bindung, in der zwei Frauen so fest wie Mann und Frau zusammengehörten, erst einmal eingegangen. Aber die beiden waren einander in Liebe und Freundschaft verbunden.
»Wir können später darüber reden, wenn du mit deinen Studien fertig bist«, erwiderte Margali. »Ich möchte dich nicht stören.«
Camilla riss überrascht die Augen auf und klappte das uralte Buch zu, das sie in ihren großen Händen hielt. »Aber ich bin fast fertig.
Und du bist mir wichtiger als Dinge, die ich jederzeit erledigen kann.« Sie legte das in Leder gebundene Buch auf einem Steintischchen ab. Margali betrat das Zimmer und ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen.
Während Camilla sie verwundert beobachtete, ging Margali im Zimmer auf und ab. Nach einigen Minuten sagte sie, wobei sie sich zwingen musste, die Worte auszusprechen, die schwer auf ihrer Seele lasteten: »Man will, dass ich zu meinen und Jaelles Töchtern gehe … Man … Ich meine Kyntha sagt … ich müsse es tun, um Jaelles Tochter beizustehen …« Margali hielt inne. Endlich sah sie Camilla an und fuhr dann mit flacher Stimme fort: »Ich kann nicht wieder in die Welt hinausgehen. Als wir nach Jaelles Tod in die Stadt kamen, hatte ich gehofft, ich könnte für immer hier bleiben.
Ich kann mich ihrem Kind nicht stellen.«
»Hat unsere Eidmutter dich darum gebeten?«, fragte Camilla.
Margali nickte.
»Was auch geschieht«, fuhr Camilla fort. »Ich werde das alles gemeinsam mit dir durchstehen. Du bist nicht allein.« Sie zog Margali aufs Bett und ihren Schoß und wiegte die Geliebte wie eine Mutter ihr Kind, das aus einem schrecklichen Traum erwacht war.
Camilla drückte Margali an sich und streichelte ihre Schultern und ihren Rücken.
»Bredhyia, die Mädchen sind Symbole jener Liebe, die Jaelle und du für einander empfunden habt, auch wenn sie von einem Domänenfürst gezeugt wurden.«
»Aber ich habe sie umgebracht!«, rief Margali wütend und schlug mit den Fäusten auf das Bett ein. »Ich habe sie auf dem Gewissen, als hätte ich höchstselbst ihr ein Messer ins Herz gestoßen!« Sie stöhnte auf und rieb ihr vor Angst feuchtes Gesicht an Camillas Schulter. »Dabei war ich ihr so nahe … Wenn sich doch nur der Boden an dem Abhang nicht gelöst hätte …«
»Wenn Banshees Augen hätten und fliegen könnten, hätten sie vielleicht die Auswahl unter den Herdentieren und bräuchten nicht die ganze Nacht hungrig im verschneiten Ödland herumzukreischen«, erwiderte Camilla ruhig. »Gnädige Avarra! Es verübelt dir doch niemand, dass du an Höhenangst leidest.«
»Aber Jaelle war mein Leben. Sie war so stark, so vielversprechend. Wenn an diesem Tag überhaupt jemand hätte sterben sollen, dann ich!«
»Es waren auch andere dabei. Keine von uns hätte sie retten können. Bei Zandrus Höllen! Nicht mal ich habe versucht, sie zu retten!« Camillas Stimme wurde gefährlich leise. »Man kann nichts anderes sagen, als dass ihre Zeit gekommen war. Vielleicht hätte die gesegnete Avarra sie auch zu sich genommen, wenn wir uns nicht in das kalte Land hinter den Domänen vorgewagt hätten.«
Margali versteifte sich. Sie hätte am liebsten bestritten, dass der Göttin der Geburt und des Todes das Recht zustand, Jaelles Leben zu verkürzen.
»Nein«, fuhr Camilla fort. »Jaelle hätte nicht gewollt, dass du dich für ihren Tod schuldig fühlst. Sie würde es nicht gern sehen, dass du ihretwegen leidest. Sie hätte gewollt, dass du zu Dorilys gehst …«
»Cleindori«, hauchte Margali. »Als Dorilys klein war, sah sie mit ihrem blonden Haar und dem blauen Kittel, den die Kinderfrau ihr immer anzog, wie eine mit blauen Glöckchen und Pollen bedeckte Kireseth-Blüte aus. Deswegen haben wir sie Cleindori genannt, das Goldglöckchen.« Sie lachte traurig. »Manche hielten es für lästerlich, ein Kind nach einem Kraut zu benennen, das man verwendet, um die Kräfte eines Laran-Begabten zu katalysieren.«
»Jaelle würde wollen, dass du zu ihr gehst. Jetzt, da sie nicht mehr ist, bist du ihre Mutter. Der Eid der Freipartner macht dich dazu.«
Camilla strich eine widerspenstige dunkle Haarsträhne aus Margalis klammer Stirn. »Und deine Tochter Shaya … Trägt sie nicht Jaelles Spitznamen? Sie hat dich seit ihrem zweiten Lebensjahr nicht mehr gesehen. Ich kann verstehen, wenn die Schwesternschaft möchte, dass du …«
Margali fuhr zurück. »Wenn das alles wäre, was sie wollen …
Wenn ich nur nach ihnen sehen und mich Jaelles Tod stellen sollte
… Aber nein, sie möchten, dass ich … Ich kann es kaum aussprechen … Sie rechnen damit, dass Cleindori die Turmregeln bricht und die Domänen vom Recht Arilinns befreit, über die Matrixarbeit zu bestimmen. Camilla, sie behaupten, sie wird die Matrixarbeit aus den Türmen in die Domänen verlagern. Wenn es dazu kommt … Schon der Versuch beinhaltet ein enormes Risiko für Cleindori, Shaya und alle, die wir je in Armida und dem Verbotenen Turm waren. Schon die Stadt zu verlassen und Cleindori zu treffen, ist riskant. Wer weiß, was die Leroni in den Türmen nun in mir sehen … Ich wurde im Verbotenen Turm von der Schwesternschaft ausgebildet. Doch in ihrem Hochmut glauben die Türme vielleicht gar nicht an die Legenden von den Kräften der Schwesternschaft.«
Margali hob beide Hände in die Luft. »Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann Cleindori nicht in die Augen schauen. Sie muss mich wegen des Todes ihrer Mutter hassen. Und Shaya wird sich über eine Mutter wundern, die zwar nicht tot ist, sich aber so verhält.«
»Glaubst du wirklich, dass sie dich nicht mit offenen Armen willkommen heißen? Margali! Sie werden sich freuen, wieder eine Mutter zu haben … Ich glaube, Kyntha hat Recht.«
»Was?«
»Kyntha verlangt doch nichts Neues von dir. Sie hat es nicht zum ersten Mal gesagt. Die Schwesternschaft lehrt, dass wir uns von unseren Ängsten befreien müssen, damit sie nicht unser Leben beherrschen. Im Moment ist Jaelles Tod für dich realer als die Stadt oder gar …« Camilla hielt inne. Sie musste mehrmals schlucken, bevor sie weitersprechen konnte. »Ich liebe dich. Es tut mir weh, dich so sehr leiden zu sehen und zu wissen, dass du lieber an Jaelles Stelle gestorben wärst. Ja …« Sie brachte Margali, die ihr widersprechen wollte, mit einer Handbewegung zum Schweigen.
»Auch ich wünsche mir, Jaelle wäre noch unter uns. Aber ich habe diesem Wunsch nicht mein Leben untergeordnet. Ich bin deswegen nicht voller Selbsthass. Ich habe mich nicht - zehn Jahre lang -
geweigert, meine und Jaelles Tochter zu besuchen. Ich möchte, dass es dir gut geht, Margali. Der Hass frisst dich von innen auf. Es gibt keine Kräuter, die ihn austreiben können. Nur du kannst ihn kurieren. Aber ich werde bei dir sein. Ich werde dir Kraft geben. Ich würde sogar für dich zu ihnen gehen, wirklich. Bitte, lass mich dir helfen.« Camilla verfiel in Schweigen.
Margali hatte ihre Worte kaum gehört. Doch Camillas Liebe und tiefe Sehnsucht, dass ihre Freundin zu sich zurückfand, durchdrang schließlich ihre schlechte Laune. Margali erlaubte ihren vor Angst angespannten Muskeln, sich zu entspannen, und sank in Camillas Arme zurück.
»Man sollte eigentlich annehmen«, murmelte sie, »dass ich all dies nach dem jahrelangen Studium und der Ausübung der Künste der Schwesternschaft …« Sie zog die Nase hoch. »… längst wissen müsste. Als wir damals hierher kamen, glaubte ich, wir würden sämtliche Antworten finden!«
»Die Reise des Herzens muss Schritt für Schritt erfolgen, man muss die Strecke auf eigenen Beinen und mit dem eigenen Verstand zurücklegen«, zitierte Camilla einen Gesang, der die Lehrlinge der Schwesternschaft täglich bei der Routinearbeit begleitete. »Keine Schwester kann die Reise für eine andere machen. Sie kann auch nicht vorauseilen und den Weg glätten.«
»Denn ich bin unabhängig«, fiel Margali ein. »Mein Herz, mein Verstand und mein Geist gehören mir, nur ich allein im ganzen Universum kenne den Verlauf meines Weges. Er ist unauslöschlich in den Kern meiner Existenz geprägt.«
Camilla küsste Margalis dunklen Haarschopf und drückte sie fest an sich.
Ein Kratzen an der Tür unterbrach ihre Träumerei. »Margali!«
Talethas Stimme drang deutlich in den Raum hinein. »Du bist jetzt mit der Beobachtung dran!«
»Oje«, stöhnte Margali und fuhr sich mit der Hand durch ihr zerzaustes Haar.
»Pssst«, sagte Camilla. »Ich übernehme deinen Dienst. Du ruhst dich aus.«
»Nein.« Margali stützte sich auf ihre wackligen Anne. »Ich übernehme ihn. Es ist meine Pflicht.«
»Aber du bist übermüdet. Und du hast noch nichts gegessen.
Übernimm morgen meine Wache, wenn du dich erholt hast.« Die Besorgnis zeichnete Linien in Camillas Gesicht, als sie sich der Tür zuwandte. »Taletha, ich komme. Margali fühlt sich nicht wohl.«
»Nein.« Margalis belegte Stimme trug nicht weiter als zu der Emmasca. »Ich übernehme meine Schicht. Es hilft mir, mich vor einer
… Entscheidung zu drücken.«
»Ich würde dir eine Last abnehmen«, sagte Camilla leise.
»Nein, Liebste. Ich muss es tun.« Margali rieb sich die Augen, fuhr erneut mit den Fingern durch ihr zerzaustes Haar, erhob sich vom Bett und strich ihre Jacke glatt. »Sehe ich so schrecklich unpassend aus? Nein?« Und bevor Camilla sie aufhalten konnte, war sie schon zur Tür hinaus.
Als Margali am großen Versammlungssaal vorbeikam, der den Schwestern als Besucherraum diente und in dem sie Hausarbeiten und dergleichen verrichteten, strömte ihr der Duft nach warmem, frischem Brot aus der Gemeinschaftsküche entgegen. Sie ging hinein, um sich ein Stück abzubrechen.
Einige Minuten später bog sie um eine Ecke und trat an einen kleinen Tisch, der vor dem Beobachtungsraum stand. Darauf befand sich eine kupferne Wasserschüssel. Margali schluckte die letzten Brotkrumen herunter, wischte sich die Hände an der Jacke ab und befreite sich dann vom Schmutz der Welt und den sie beunruhigenden Gedanken. Die rituelle Waschung diente dazu, sich von den Anhängseln der Furcht, des Kummers oder des täglichen Einerleis zu befreien, bevor man den Beobachtungsraum betrat, denn es war unklug, seine Probleme mit in die Überwelt zu nehmen, in der Gedanken und Gefühle Substanz hatten. Margali hoffte, dass sie ihren Geist von der Entscheidung befreien konnte, die ihre Eidmutter Kyntha und der Kreis der Zwanzig ihr auferlegt hatten.
Wenigstens für die Dauer der Schicht. Solange sie sich in einer weltlichen Ebene aufhielt, konnte sie die kalte, an ihrem Herzen reißende Furcht verdrängen, aber in der Überwelt … Sie hatte den finsteren, düsteren, ihre Seele mit Kälte erfüllenden Ort seit Jahren gemieden. Natürlich waren ihr die Ursachen bekannt. Einst war sie ihr zu nahe gekommen. Die Finsternis hatte zu ihr hinausgegriffen und ihr Herz mit einer kalten Faust umschlossen. Der Schreck hatte sie sofort aus der Überwelt geworfen, und sie war erst Stunden später in einem schmerzgeplagten Körper aus der Besinnungslosigkeit erwacht.
Leise betrat Margali den sanft beleuchteten Beobachtungsraum.
Adela saß reglos und mit geschlossenen Augen auf den Kissen. Ihr Geist war weit fort. Taletha hockte links von dem mit einem Vorhang verhängten Eingang. Sie atmete tief und ruhig und sprach die rituellen Worte, die Adela zurückriefen. Margali ließ sich in ihrer Nähe auf dem Boden nieder. Die junge Frau würde nicht lange brauchen, um von ihrem Beobachtungsposten zurückzukehren.
Obwohl Margali bis dahin nur noch wenig Zeit verblieb, ging ihr Geist auf Wanderschaft. Sie dachte über den Beobachtungsraum nach, in dem die Weisen Schwestern die Aktivitäten der darkovanischen Bevölkerung beobachteten und die Schemata der Klugheit, der Irrtümer, des Fortschritts und des Niedergangs aufzeichneten. Die Schwestern nahmen nur selten Einfluss auf den Geist und veränderten die Vorgehensweise der Darkovaner nur nach reiflicher Überlegung, damit der Planet überleben konnte.
So hatte die Schwesternschaft auch Jaelles und Margalis Leben gerettet, als sie noch zur Gilde der Entsagenden gehört und nichts von der Schwesternschaft gewusst hatten. Vor etwa achtzehn Jahren
- Ist es wirklich schon so lange her?, dachte Margali - hatte eine schreckliche Flut sie in einer Höhle festgehalten. Jaelle war auf Grund einer Fehlgeburt todkrank gewesen. Die sich dieser Notlage bewusste Schwesternschaft hatte in Jaelle irgendetwas Besonderes gesehen. Ihr innerer Rat, der Kreis der Zwanzig, hatte prophezeit, dass eine noch nicht geborene Tochter jene Türme mit neuem Leben erfüllen konnte, in denen ständig kleiner werdende Kreise ausgebildeter Telepathen lebten. Diese Tochter war zur Bewahrerin ausersehen, zu einer besonders ausgebildeten Frau, welche die psychischen Kräfte der Turmkreise zum Preis lebenslanger Keuschheit dirigierte. Doch war sie auch vom Schicksal ausersehen, das heiligste aller Tabus zu brechen und den Türmen - sowie Darkover! - neues Leben und neue Methoden zu bringen. Diese Tochter sollte die Wissenschaft der Matrixarbeit aus den Türmen holen und in die Domänenstädte verlegen.
Als direktes Ergebnis dieses Eingriffs waren Jaelle und Margali für eine Weile nach Armida gegangen, um bei Callista und Ellemir Lanart sowie ihren Männern und Kindern zu leben. Wie sie waren die beiden Mitglieder des Verbotenen Turms geworden - dem einzigen Telepathenkreis, der außerhalb der offiziellen Türme funktionierte. Der Kreis von Armida hatte mit Methoden gearbeitet, die für die offiziellen Türme unannehmbar gewesen waren. Er hatte nur überlebt, weil er ihren Turm in einer erfolgreichen Laran-
Schlacht gegen den Turm von Arilinn hatte verteidigen können, dessen Bewahrerin dem Verbotenen Turm jegliches Existenzrecht abgesprochen hatte.
Als Adela von der Reise in die Überwelt zurückkehrte, schüttelte sie sich, warf ihr dunkelblondes Haar zurück und entspannte ihre kalten, steifen Muskeln. Taletha saß neben ihr und hatte, während ihre Schwester die Astralebenen beobachtete, dafür gesorgt, dass sie automatisch weiteratmete und ihr schlagendes Herz problemlos den Blutkreislauf aufrechterhielt. Margali würde für Taletha das Gleiche tun, und später wieder eine andere für sie selbst. Im Beobachtungsraum wachten ständig zwei Schwestern: Die eine beobachtete Darkover, die andere beobachtete die Wachende.
»Wie ist die Lage, Adela?« Talethas Stimme klang für Margalis Laune viel zu fröhlich.
Adela begann gerade ihren Bericht, als neben ihr auf einem kleinen Tisch eine Kerze zu flackern begann - eine Kerze, eine Schicht, eine Beobachterin, so lautete der Lehrgesang. »Die Überwelt ist ziemlich ruhig«, sagte sie. »Es gibt einige Aktivitäten in der Turmübertragung. Von Turm zu Turm gibt es nicht viel Verständigung. Aber ich habe in der Gegend des Arilinn-Turms etwas Eigentümliches aufgefangen.«
Margali erhöhte ihre Aufmerksamkeit, ohne sich durch eine körperliche Bewegung zu verraten.
»Dorilys Aillard, die Bewahrerin des Turms, befindet sich in einer Notlage.«
Margali zitterte, doch nicht etwa, weil die Schwesternschaft darauf bestand, den Familiennamen einer Bewahrerin auszusprechen, statt jenen zu benutzen, den der Turm ihr gegeben hatte.
»Ich glaube nicht, dass ihr Kreis es schon weiß; sie ist stark abgeschirmt. Aber sie ist in die Überwelt eingetreten und eine Weile um die Turmmarkierung geschritten. Der Kreis hat uns aufgetragen, besonders auf sie zu achten.«
Bei Zandrus neun Höllen, wütete Margali stumm. Sie hatten Cleindori schon im Blickfeld, bevor Damon und Jaelle sie gezeugt haben! Es reicht wohl nicht, dass der Kreis der Zwanzig sie von uns bespitzeln lässt. Nein!
Jetzt wollen sie auch noch, dass ich in die Domänen gehe und sie persönlich ausspioniere! Ah! Kyntha hat das Ganze nur in Plattitüden und Gerede über Abschlussprüfungen gekleidet, damit ich mir beweise, dass Jaelles Tod mich nicht mehr schmerzt. Jaelle, meine Shaya, meine Freipartnerin, meine Seelenverwandte …
Margali hielt ihre galoppierenden Gedanken mit grimmiger Entschlossenheit in Schach und hörte zu, als Adela sagte, sie wolle den Kreis über Dorilys Aillards Aktivitäten in Kenntnis setzen, nachdem sie die Ereignisse dieser Schicht protokolliert hatte. Das Wachbuch befand sich gegenüber im Entspannungsraum, in den die Schwestern sich nach der Arbeit zurückzogen, um klebrige Süßigkeiten, Trockenobst und Nüsse zu verzehren. Dies ersetzte die Energie, welche sie während ihrer Vorstöße in die Überwelt einbüßten.
Nachdem Adela gegangen war, entzündete Taletha an der verlöschenden Kerze eine neue und machte es sich auf dem niedrigen Sofa und den Kissen bequem, die ihre Vorgängerin verlassen hatte. Sobald sie sich auf ihre langen Beine gehockt und für die Schicht gesammelt hatte, richtete sie den Blick, wie viele von der Schwesternschaft Ausgebildete, auf die Flamme. Margali leerte ihren Geist, nahm auf den abgewetzten Kissen Platz und trat mit ihrem Matrixkristall in Kontakt. Dann nahm sie die leichte Verbindung auf, die es ihr erlaubte, Talethas Körper zu überwachen und ihn richtig funktionieren zu lassen, solange dessen Besitzerin sich in der Überwelt bewegte.
Talethas Kerze warf tanzende Schatten auf die Wand und verbreitete ein behagliches Licht. Bald wirkte sie nur noch wie ein Stumpf, und Margali sandte der Beobachterin das Gefühl einer beruhigenden mentalen Berührung, während sie einen sich verkrampfenden Muskel regulierte. Dann ging sie hinaus und benachrichtigte die nächste Beobachterin. Nachdem sie mit der erst kürzlich ausgebildeten Meloran zurückgekehrt war, sprach sie die rituellen Worte, die Taletha in ihren Körper zurückriefen. Die junge Frau zuckte zusammen, reckte und streckte sich ausgiebig wie eine Katze und kehrte ins Hier und Jetzt zurück. Ihre Meldung war kurz und beinhaltete keine besonderen Vorkommnisse.
Margali steckte ihre Kerze an Talethas Stummel an und nahm auf dem Sofa eine bequeme Haltung ein. Sie konzentrierte sich auf die Flamme, atmete mehrmals tief ein, spürte die Reaktion ihrer Matrix und sprang, nachdem Meloran mit ihr Verbindung aufgenommen hatte, in die Überwelt. Es erstaunte sie immer wieder, wenn sie sah, wie die beiden Gestalten unter ihr klein und unscharf wurden.
Schließlich verschwanden sie ganz, und Margali trat in die graue Stille der Überwelt ein.
Sie ging in jeder Schicht nach dem gleichen Schema vor - zuerst die Türme und die Übertragung, dann alle ungewöhnlichen Aktivitäten oder der Einsatz von Laran unter besonderer Berücksichtigung der ›Außergewöhnlichen‹ des Kreises.
Normalerweise genoss Margali die Freiheit einer solchen Schicht. Sie schenkte ihr Zeit, die sie allein verbringen konnte, und erlaubte ihr zu verfolgen, was Darkover außerhalb der isolierten Stadt der Schwesternschaft widerfuhr. Sie betrachtete die Ausdehnung des terranischen Hauptquartiers in Thendara, in dem sie einst als terranische Geheimagentin Magda Lorne gelebt und gearbeitet hatte. Oder sie konnte das Aufwachsen der Kleinen in Armida miterleben, dem Heim der Leroni des Verbotenen Turms. Außer Cleindori und Shaya. Diese beiden konnte sie in Arilinn finden, wo sie im dortigen Turmkreis lebten. So viele Dinge hatten sich seit …
Jaelle … verändert. Ach, Jaelle!, dachte Margali. Meine geliebte Jaelle.
In der Überwelt regte sich als Antwort auf ihre Trauer eine finstere Schwärze, an diesem Ort fühlbar und real, die ihre eisige Hand ausstreckte und nach Margalis Seele griff. Langsam und unerbittlich zog sie die Frau in ihren riesigen Schlund hinein.
Die Qual, die Margali einhüllte, warf Echos in ihren wirklichen Körper, und ein stechender Schmerz ließ ihren Brustkorb verkrampfen. Im Beobachtungsraum tat Meloran was sie konnte, um die zuckenden Muskeln der Beobachterin zu beruhigen und ihren schweren Atem zu entspannen. Schließlich sandte sie einen hektischen telepathischen Hilferuf aus.
Margali, in der Überwelt und dem lähmenden Griff gänzlich gefangen, wäre am liebsten schreiend losgerannt. Doch nun berührte das Ding tief in ihr eine Stelle, die sie bisher völlig verleugnet hatte. Sie wehrte sich. Doch je mehr sie sich wehrte, desto heftiger wurde das Zerren, das sie immer näher heranzog. Margali unternahm den Versuch, zwischen sich und dem Ort des Bösen eine Wand zu errichten. Sie verschmolz geistige Materie zu einer hohen Steinmauer - Stein auf Stein, höher, als sie blicken konnte. Das Gebilde erstreckte sich von einem Horizont zum anderen und war mit einer Tür, einer Kette sowie Schloss und Riegel verziert. Fest.
Doch als Margalis Geist hinausgriff, um die Mauer zu berühren, da sie sich versichern wollte, dass sie ihr auch wirklich Schutz bot, löste sie sich auf: Stein, Mauer, Kette, Schloss - alles verschwand in der Finsternis. Margali wankte dem Scheitelpunkt entgegen, der das Dunkel vom grauen Zwielicht der Überwelt trennte, eine Messerschneide zwischen geistiger Unversehrtheit und Entsetzen.
Sie stürzte in das Entsetzen, in die Trauer, ihre Freipartnerin verloren zu haben: Jaelle, die so sehr Teil von ihr war. Der Schmerz war so stark, als würde ihr bei lebendigem Leib ein Glied ausgerissen. Wenn sie nicht bald etwas unternahm, würde sie in Trauer und Schmerz ertrinken.
Das Entsetzen wich schließlich der Gewissheit, dass sie sterben würde. Als die Finsternis sie verschlang, dehnte sich der dünne Draht des mit ihrem Körper verbundenen Bewusstseins im Beobachtungsraum und drohte zu zerreißen. Margali wusste dank eines schwatzhaften Teils ihres Geistes, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis sie die Verbindung zu ihrem körperlichen Ich verlor. Bald würde sie bei ihrer geliebten Jaelle sein.
»Jaelle!«, rief sie. »Shaya, Geliebte!« Der Ruf echote durch die Überwelt und erreichte zwei Menschen, die ihr lieb und teuer waren.
Der Schmerz in Margalis Herzen schmolz, als sie ihre Freipartnerin erspähte - Jaelle mit dem wogenden, rotgoldenen Haar, das gar nicht zu ihrem fließenden scharlachroten Gewand passen wollten. Wie komisch, dachte sie, dass Jaelle die Farben einer Bewahrerin trägt. Da durchzuckte sie die Erkenntnis, dass der hoffnungsvolle Anblick gar nicht Jaelle darstellte. Es konnte nur eine Bewahrerin sein!
Als Margali Kontakt zu ihr aufnahm, schob Dorilys, genannt Cleindori, die Bewahrerin von Arilinn, die Hand über die Kluft der sie trennenden Finsternis. In Sekundenschnelle riss Margali sich zusammen und überwand ihre von Entsetzen gelähmten Muskeln.
Sie streckte die Finger aus und erfasste Cleindoris dargebotene Hand.
»Wer bist … ?« Margali keuchte. Dann flüsterte sie »Cleindori«
und zitterte erneut. Eine Woge von Schwindel erfasste sie, und sie sah eine dritte Gestalt. Sie war dunkelhaarig und schlank und gesellte sich in einer Insel aus Licht zu Cleindori und ihr …
»Shaya!«
»Mutter!«, rief Shaya und schlang die Arme fest um Margalis Hals.
Und obwohl Margali wusste, dass Shaya sich körperlich im fernen Arilinn aufhielt, hatte sie das Gefühl, als hielte sie ihre Tochter wirklich in den Armen. »Mutter! Es ist so lange her, und wir haben uns solche Sorgen gemacht! Seit Tante Jaelle gestorben ist, haben wir nur etwas von Ferrika gehört.«
Margali schüttelte sich, und Cleindori formte mit der Kraft ihrer Gedanken aus dem Stoff der grauen Welt eine Bank. »Komm«, sagte sie und zog Margali heran, damit sie sich neben sie setzte.
»Tante …« Cleindori verwendete das Wort, das einst ›Mutters Schwester‹ ›Geehrte Frau der Generation meiner Mutter‹ und
›Freipartnerin meiner Mutter‹ bedeutet hatte. »Was ist passiert, dass du dich in diese Gefahr begeben hast? Warum hast du nach deinem Ruf nicht gewartet?«
Erst jetzt wich Margali zurück, um das Gesicht der Bewahrerin besser sehen zu können. »Ich habe euch nicht gerufen!«
Verbitterung verhärtete ihre Stimme. »Ich habe … Jaelle gerufen.«
Margali konnte Cleindori und Shaya, die zu ihren Füßen saß, nicht anschauen.
»Hast du etwa vergessen, dass deine Tochter, meine Schwester, Shaya heißt? Du hast gerufen. Wir haben es gehört und geantwortet.« Als Cleindori Margalis Blick auffing, wich sie zurück.
In den Augen ihrer Tante sah sie viel älter aus als siebzehn Jahre.
Aber schließlich war sie eine Frau, eine Bewahrerin und in Arilinn ausgebildet worden.
»Tante Margali … warum hast du keinen Kontakt mit uns aufgenommen? Warum bist du fortgeblieben? Ich weiß, dass die Schwesternschaft dich nicht daran gehindert hat.« Als Cleindori Margalis entsetzten Blick bemerkte, fuhr sie fort: »Mach dir keine Sorgen, dein Geheimnis ist sicher. Wir wissen nur wenig. Aber Ferrika hat uns etwas über die Schwesternschaft erzählt.« Und als fiele es ihr erst jetzt ein, fügte sie hinzu: »Es ist nicht genug, um es an jene weiterzugeben, die dir schaden könnten.«
Nun kam Margalis Prüfung. Nicht erst in zehn Tagen oder in Monaten. Nein, jetzt! Ihr Mund öffnete und schloss sich lautlos. Sie legte die Hände auf ihre Oberarme. Es wäre ihr fast lieber gewesen, die Finsternis hätte sie erstickt. Und doch war Cleindori hier, voller Liebe, Respekt und Stärke. Und … ja, sie musste es zugeben, sie hatte auch viel von Jaelle.
Margali sackte nach vorn und hauchte: »Ich hatte Angst.« Sie streckte die Arme aus, drückte Cleindori fest an sich, warf Shaya einen verlegenen Blick zu und sprach weiter. »Ich war so wütend, weil Jaelle nicht mehr da ist. Es hat mir so weh getan. Wäre doch nur ich an ihrer Stelle gestorben. Ich hätte ihren Tod verhindern müssen. Wenn die Klippe nicht gewesen wäre … die große Höhe …
hätte ich sie retten können. Sie war mein Leben. Ohne sie war mir, als sei ich verstümmelt.«
Sie saßen eine ganze Weile schweigend da und weinten erleichtert vor sich hin.
Schließlich sagte Cleindori leise: »Auch ich habe geweint, als ich vom Tod meiner Mutter erfuhr. Ich habe vor Schmerz und Enttäuschung geweint und war zugleich verärgert, weil sie mich verlassen hatte. Dann haben Vater, Ellemir und die anderen mich an ihre Talente erinnert, an ihr Lachen und ihre Fröhlichkeit, an ihre Sturheit, an ihre Liebe für dich und mich und daran, dass sie mir das Leben geschenkt hat. Sie ist nun fort, aber wir sind da, um weiterzumachen.«
Margali schaute die Kindfrau verwundert an.
»Seit zehn Jahren schmerzt mich ihr Tod nicht mehr, Margali. Sie hätte es so gewollt. Das weißt du doch. Ich muss arbeiten. Du musst arbeiten. Lass Jaelle ihren eigenen Weg nehmen.«
Margalis Geist echote: »Keine Schwester kann einer anderen den Weg abnehmen …«
Cleindori wich ein Stück von Margali zurück, um zu sehen, welche Wirkung ihre Worte hatten. Und in die herrschende Stille hinein bat Shaya mit dunklen, von Tränen erfüllten Augen: »Mutter, komm bitte nach Hause.«
»Ja, Shaya, meine Kleine«, sagte Margali zurückhaltend.
»Ja, es ist Zeit.« Sie stand auf und schaute in die Ferne, als dächte sie nach, als suche sie nach etwas.
Das Zittern begann mit einer winzigen Gänsehaut und einem Kitzeln, das die Haare auf ihren Armen und Beinen aufrichtete.
Dann schlotterten ihre Glieder und sie erbleichte.
»Tante Margali!«, rief Cleindori. »Was ist? Was ist los mit dir?«
»… so kalt. Es war schwierig … so viele …« Margali machte eine hilflose Geste.
Die besorgte Cleindori nahm eine rasche Bewegung vor und ließ ihre geschickten Hände über Margalis Astralleib wandern.
»Gnädige Avarra, Margali! Du bist in einer Krise! Was hast du …
Ach, es ist unwichtig. Wir bringen dich zurück in die Stadt. Du musst zurückkehren. Ich helfe dir …« Sie stützte die Tante von links, und Shaya gesellte sich zu ihnen. In Gedankenschnelle erreichten sie ein eigentümliches Gebilde im Überweltgefüge.
»Wir können dich nicht weiter begleiten«, sagte Cleindori. »Aber du kennst nun den Weg. Ich hoffe, du kommst sicher zurück.
Besuch uns in Arilinn, sobald du kannst. Ich habe wunderbare Neuigkeiten.« Cleindori übersandte Margali schnelle Bilder von ihr und Lewis-Arnad Lanart-Alton. Die beiden waren auf eine Weise zusammen, auf die eine Bewahrerin nicht mit einem Mann zusammen sein durfte. Als Cleindori und Shaya Margalis erschreckten Blick sahen, kicherten sie. »Schau nicht so überrascht!«, sagte Cleindori tadelnd. »Du warst doch lange genug im Verbotenen Turm, um zu wissen, dass Liebe nicht verboten sein darf
- nicht einmal für die Bewahrerin von Arilinn!«
Sie und Shaya schoben Margali auf eine verschwommene Tür zu, die sich in der grauen Landschaft bildete. »Geh jetzt - deine Schwestern rufen dich.«
Margali hörte das Krächzen der Krähen wie aus weiter Ferne und erkannte, dass die ungestümen Vorboten des Kreises der Zwanzig seit geraumer Zeit an ihren Gedanken nagten.
»Komm zurück, Margali«, rief Kynthas Stimme. Dann stimmten die Anwesenden den Gesang an, der eine Beobachterin aus der Überwelt zurückrief. Unter ihnen erkannte Margali auch Meloran und Camilla. Aber warum?, fragte sie sich, als sie durch den Türrahmen stolperte und in ihren Körper krachte. In einem Moment der Klarheit begriff sie, dass der halbe Kreis der Zwanzig sich in den Raum gequetscht hatte und Meloran mit großen, erschreckten Augen in der fernsten Ecke hockte. Dann zuckte ihr Körper heftig hin und her, warf sie zu Boden und ließ sie die Besinnung verlieren.
Nach einer Weile vernahm Margali das gedämpfte Summen der ängstlichen Stimmen der anderen. Wie durch eine Nebelwand wurde ihr bewusst, dass ihr schwindelig war und ihre Schläfen pulsierten. Der Rest ihres Körpers erschien erstarrt und taub zu sein.
Irgendjemand - sie nahm an, ihre Eidmutter - untersuchte sie sanft.
»Hier, Kyntha.« Sie war es also wirklich! »Das bringt sie wieder auf die Beine.«
»Trink das, Margali«, befahl Kyntha. Dann zog sie Margali auf ihre verschränkten Beine und nahm ihren Kopf in die Armbeuge.
Margali schluckte. Bahhh, das Zeug brannte in der Kehle! Sie stöhnte auf, schob das ekelhafte Fläschchen schwach von sich und rutschte von Kynthas Schoß.
»Margali!«, rief Camilla. »Breda!« Camillas starke, knotige Hände hoben Margali auf ihren Schoß. Die Zurückgekehrte schaute in das tränennasse Gesicht der Emmasca und kuschelte sich in die Arme ihrer Freundin.
»Ich muss sie jetzt sondieren, Camilla. Ich muss sehen, wie die Droge wirkt. Wenn sie sich so an dich klammert, beeinflusst du meine Fähigkeiten. Ich muss sie berühren.«
Margali spürte die geistige Berührung ihrer Eidmutter. Dann zog Kyntha Hände und Geist zurück und hockte sich mit einem zufriedenen Seufzer auf die Fersen. »Sie hat die Krise jetzt überstanden. Wir können sie in den Heilungsraum bringen.
Allerdings muss sie in den nächsten Tagen genau beobachtet werden.«
Camilla hob schützend die Hände, und als Kyntha es bemerkte, klopfte sie ihr ungelenk auf die Schulter. »Du kannst so lange bei Margali bleiben, wie du möchtest. Ich schicke Llewellyn mit Suppe und Brot vorbei; das Abendessen ist längst kalt.«
Kyntha ließ den Blick durch den Raum schweifen und schaute sämtliche Anwesenden an. »Wird Zeit, dass wir zu dem zurückkehren, was noch übrig ist. Wenn du nichts dagegen hast, Mutter«, sie nickte Mutter Judyth zu, »erstatte ich dem Kreis morgen Bericht, nachdem ich mich noch mal mit Margali unterhalten habe.«
Als Mutter Judyth nickte, stand Kyntha auf und gab Camilla ein Zeichen, ihr mit Margali zu folgen.
Sie betraten den Heilungsraum. Camilla bugsierte Margali zum nächsten Sofa, half ihr aus einigen Kleidungsstücken, die sie achtlos fallen ließ. Schließlich war sie mehr an Margalis Wohlergehen interessiert als daran, wo deren Stiefel oder Strümpfe landeten.
Margali ließ sich aufs Sofa fallen und bereute ihr Tun. Die plötzliche Bewegung ließ den Raum wanken und sich heben.
»Margali!«, rief Camilla angesichts ihrer erblassten Freundin besorgt. »Bist du in Ordnung?«
»Ja«, sagte Margali leise, während sie die Zähne zusammenbiss und hoffte, dass ihr Magen sich wieder beruhigte. »Mir ist nur von dem Trank schwindelig, den man mir gegeben hat. Igitt!«
»Was ist passiert?«, sagte Camilla, als sie die Decken um Margali richtete. Dann wandte sie den Kopf, um nachzuschauen, ob Kyntha schon eingetroffen war. Schließlich sagte sie, nun leiser: »Es heißt, du hättest in der Überwelt Schwierigkeiten gehabt. Man hat mich gerufen.« Sie spitzte die Lippen und schnaubte. »Natürlich konnte ich nur besorgt herumstehen, denn um dich schwirrten schon die Hohen und Mächtigen herum. Sie haben auch nicht gerade den Eindruck gemacht, als wüssten sie mehr als ich. Was ist mit dir passiert?«
»Das wüsste ich allerdings auch gerne«, ertönte es von der Tür.
Die beiden Frauen zuckten beim Klang von Kynthas Stimme zusammen. Margali bedauerte die Bewegung sofort, und Camilla tarnte ihr plötzlich schlechtes Gewissen, indem sie an den Decken zupfte.
»Ich weiß nicht, ob sie schon mit dir reden kann«, sagte Camilla kehlig, denn sie war unsicher, ob Kyntha etwas mit Margalis Notlage in der Überwelt zu tun gehabt hatte.
»Ach«, sagte Kyntha nur, und der etwas schrille Ton ihrer Worte deutete an, dass sie überrascht und irritiert war. »Sie hat sich also nur so weit erholt, dass sie dir erzählen kann, was passiert ist, nicht aber ihrer Eidmutter?«
Camilla runzelte die Stirn. Margali ächzte. »Ist schon in Ordnung, Camilla. Ich rede mit ihr. Vorausgesetzt, ich brauche mich dabei nicht zu bewegen.«
Llewellyn trat mit Knollensuppe und Brot ein. Also rückten sie Stühle, Decken, Kissen, Hocker und Nahrung umher, bis Camilla aufgerichtet am Ende des Sofas hockte und Margali sich mit einer händewärmenden Suppenschale wieder darauf niederließ. Kyntha saß auf einem Lehnstuhl am Kopfende des Sofas. Nachdem Llewellyn ihre Arbeit getan hatte, ging sie leise hinaus.
Während des Essens berichtete Margali, woran sie sich erinnerte.
Als sie fertig war, wusste sie allerdings nicht genau, was Kyntha dachte.
Camilla hingegen war bestürzt. »Margali! Du wärst beinahe gestorben!«, stieß sie hervor. »Und Cleindori. Eine Bewahrerin von Arilinn mit einem Alton!«
»Das reicht, Camilla. Margali, das hast du gut gemacht.«
Die Breda tauschten überraschte Blicke. »Ruh dich jetzt aus. Ich habe dich für die nächsten Tage vom Dienstplan gestrichen. Schon dich und sammle neue Kräfte.« Und als fiele es ihr erst jetzt ein, fügte Kyntha hinzu: »Der Kreis der Zwanzig möchte dich vielleicht noch sehen, bevor du nach Thendara aufbrichst. Sprich mit niemandem über das, was geschehen ist.«
Plötzlich erfüllte der Alarmruf der Krähen den Raum. Kyntha stand sofort auf und richtete ihre Aufmerksamkeit nach innen, um eine Eilmeldung des Kreises zu empfangen. Sie öffnete die Augen, runzelte besorgt die Stirn und setzte sich gleichzeitig in Bewegung.
Dann sagte sie mit einer Schärfe und Dringlichkeit, die Margali von ihr nicht kannte: »Die Namenlosen nähern sich der Stadt. Wir müssen die Mauern bemannen. Wir brauchen jede Hilfe. Kannst du gehen, Margali?« Ohne auf eine Antwort zu warten, eilte sie aus dem Raum und schritt kerzengerade durch den Korridor, während Camilla ihre Einwände hervorstotterte.
Margali schob schon die Decken zurück.
»Du kannst nicht gehen«, sagte Camilla und drückte sie auf ihr Lager zurück.
»Ich muss. Wir alle müssen!«
»Nein, es geht dir nicht gut. Du musst dich ausruhen und wieder zu Kräften kommen.«
Margalis Verärgerung nahm zu. Sie ballte die Fäuste, bis sich die Fingernägel in ihre Handflächen bohrten. »Die Namenlosen haben Jaelle umgebracht! Verstehst du denn nicht? Es ist Zeit, ihren Tod zu rächen! Ich muss kämpfen!«
Camilla gab erschrocken ihren Widerstand auf und half Margali in die Kleider. Als sie langsam durch die leeren Korridore gingen, um die Kräfte der Geschwächten nicht zu vergeuden, nahmen sie ihre Waffen an sich und schritten zur Stadtmauer.
Die Schwestern standen ruhig vor den Mauern, welche die Stadt der Weisheit umgaben. Aus dem Süden, über Eis und Schnee, näherte sich ein Heer schwarz gekleideter Frauen. Sie waren bewaffnet, denn die Namenlosen setzen ihren Willen nur mit körperlicher und geistiger Gewalt durch. Sie hatten nie gelernt, sich auf der psychischen Ebene zu bewegen.
Camilla und Margali zogen ihre Kurzschwerter. Es war Jahre her, seit die beiden sie zuletzt in einer Schlacht eingesetzt hatten. Doch noch ehe die Schwerter aus der Scheide glitten, ließ ein drängender Schrei sie innehalten. Mutter Judyth eilte rasch an ihre Seite. »Wir müssen Hass und Furcht vergessen, Kinder. Auch die Waffen der Angst. Einzig der Hass führt diese Bösen zu uns. Liebe und Solidarität werden unsere Stadt sichern und erhalten.«
»Aber sie haben Waffen und werden sie auch einsetzen!«
»Sie sollen erfahren, wie wenig ihre Waffen ihnen gegen die Schwesternschaft nützen.« Mutter Judyth stand hoch aufgerichtet vor den Bredhyia. »Margali, du musst jeden noch verbliebenen Hass in dir freigeben. Du musst dich von dem Fluch befreien, der dich in all den Jahren verzehrt hat. Beende das, was du heute in der Überwelt begonnen hast.«
Camillas Kinnlade sackte herunter. Margali schaute die gewählte Führerin der Schwesternschaft verdutzt und verzweifelt an. »Dazu fehlt mir die Kraft, Mutter.«
»Dann musst du sie finden, oder wir gehen unter. Der Hass in dir hat dieses Übel angezogen.«
Margali holte tief Luft. Nun verstand sie allmählich das Unrecht, das sie sich, Camilla und den Kindern angetan hatte. Als sie sich Cleindori, Shaya und ihren Ängsten in der Überwelt gestellt hatte, hatten Letztere angefangen, sich zu zersetzen. Doch der Hass auf die Namenlosen, die direkte Ursache für Jaelles Tod, war noch in ihr.
War sie stark genug, um das Böse mit Liebe zu vergelten?
»Ich werde mich bemühen zu tun, was Ihr sagt, Mutter«, erwiderte sie.
»Mehr erbitte ich nicht. Möge die gesegnete Avarra dir die Gabe verleihen, die du ersehnst.« Judyth legte die Hände auf Margalis dunkle Locken, drehte sich um und kehrte zu den restlichen Angehörigen des Kreises der Zwanzig zurück.
Camilla und Margali schauten sich an. Mit heftig klopfendem Herzen lehnten sie ihre Klingen an die Stadtmauer und gesellten sich schweigend zu den Schwestern.
Die Horde der Namenlosen kam näher und reckte Keulen, Schwerter und Messer in die Luft. Bei ihrem Anblick juckte es Camilla, das Schwert wieder an sich zu nehmen, was sie sogleich Margali anvertraute.
»Ich weiß«, sagte Margali. »Mir geht es nicht anders. Trotzdem möchte ich meinen Hass überwinden. Warum ist es nur so schwierig?«
Die ernsten Blicke aus den Reihen der Schwestern in ihrer Umgebung brachten Camilla und Margali zum Schweigen. Sie wandten sich den Angreiferinnen zu.
Die Nähe des Bösen erinnerte Margali an die Schlacht, in der Jaelle umgekommen war. Sie machte einen halbherzigen Versuch, das Ereignis aus ihrer Erinnerung zu streichen. Je mehr sie sich bemühte, die Vision zurückzudrängen und ihren Geist von Hass und Furcht zu befreien, desto schlimmer wurde alles. Obwohl es schon Jahre zurück lag, sah Margali Jaelle vor ihrem geistigen Auge mit Aquilara ringen. Margalis Hand umklammerte das Schwert, das nicht mehr an ihrer Seite hing. Hätte sie ihre Freipartnerin doch nur retten können! Die Verzweiflung stieg wie Gallenflüssigkeit in ihr hoch. Sie musste die Frauen des Bösen bezwingen!
Plötzlich ertönte ein Schrei und riss Margali aus der schrecklichen Erinnerung. Mehrere schwarz gekleidete Gestalten näherten sich der Ostmauer. Die Front der Schwestern wankte, als der Angriff des Bösen begann. Eine, nein, zwei Schwestern fielen unter den Hieben der Angreifenden leblos zu Boden.
Nein!, schrie es stumm in Margali auf. Avarra, gesegnete Mutter, lass nicht zu, dass dies passiert! Ihr Magen stülpte sich um. Sie durchforschte ihren Geist schnell nach einer Lösung, nach irgendetwas, das ihr half, das Böse zu bekämpfen. Eigenartigerweise fielen ihr Kynthas Worte ein: »Der Hass, der noch in dir ist, wird dir und uns das Böse bringen. Du musst dich Jaelles Tochter stellen, die nun die deine ist …« Und was hatte Cleindori sinngemäß gesagt?
»Ich empfinde seit Jahren keinen Schmerz mehr … Man muss sein Leben leben. Jaelle hätte es so gewollt.«
Indem Jaelle Aquilara mit in den Todes gerissen hatte, hatte sie ihren Freundinnen die Freiheit gesichert. Andere hatten auf Grund ihres selbstlosen Handelns weiterleben dürfen. Doch Margali hatte mit Hass und Furcht auf das ihr geschenkte Leben reagiert. Ein ungleicher Tausch. Der Gedanke ließ sie unweigerlich aufstöhnen.
Irgendwo tief in sich verspürte Margali plötzlich ein Reißen und einen sengenden Schmerz.
Der Schmerz zerrte immer wieder an ihrem Leib und zwang sie in die Knie. Je mehr sie ihm widerstand, desto heftigere Wellen der Pein hüllten sie ein. Es tat so weh, dass sie keine Luft mehr bekam.
Sie befürchtete, an diesem Schmerz zu sterben. Dann wünschte sie es sich sogar, denn ihr Magen setzte dazu an, in ihre Kehle zu drängen. Der Schmerz! Es war schrecklich! Margali versuchte, ihn abzuschneiden, zurückzudrängen. Sie suchte hektisch nach einer Lösung. »Gütige Avarra, lass eine Lösung existieren!«, schrie sie. Sie wurde mit einem Bild der mit Aquilara ringenden Jaelle belohnt.
Margali erlebte erneut das Grauen - Jaelle, die sich auf Aquilara stürzte. Margali tat es ihr gleich. »Nein, nein!«, rief Jaelle. »Ich halte sie auf. Bring die anderen weg!« Dennoch war Margali zu ihrer Freipartnerin gelaufen und vor dem Klippenrand stehen geblieben.
Jaelle und Aquilara schlugen sich, dann stürzten sie aneinander geklammert in die Tiefe …
Inmitten des alten Grauens kam Margali der Funke einer Idee.
Diesmal wehrte sie sich nicht mehr gegen den Schmerz. Sie ergab sich ihm, wie Jaelle sich Aquilara ergeben hatte.
Der Schmerz wich jäh zurück, und an irgendeiner unbekannten Stelle ihres Inneren spürte Margali, wie plötzlich eine ansteigende Kraft und segensreiche Erleichterung aufwallte. Als die Kraft sie durchströmte, verdrängte sie die letzten Ausläufer des Schmerzes und floss mächtig durch ihren Körper, der nun keinen Widerstand mehr leistete. Der plötzliche Ausbruch warf Camilla zurück, die sich besorgt über die gequälte Margali beugte. Von der Lähmung befreit, richtete Margali sich auf und reckte sich. Jegliche Unschlüssigkeit, alle Fragen, die mit ›Was wäre, wenn …‹ begannen, verstreuten sich und lösten sich auf. Gelassen musterte sie die Angreifer. Dann streckte sie eine Hand nach Camilla aus, die links von ihr stand, und fasste auch die Schwester zu ihrer Rechten an. Die drei hielten sich fest und dann auch alle anderen, bis die Schwesternschaft einen Kreis bildete, der die ganze Stadt umgab. Energie strömte ungehindert durch die miteinander verbundenen Hände und bildete schließlich einen leuchtenden Schutzschild um sie.
Die erste Angreiferin, die den Schild berührte, zuckte zurück, als hätte sie sich verbrannt. Jene, die versuchten, sich mit Gewalt einen Weg durch die schillernde Mauer zu bahnen, wurden heftig zu Boden geschleudert. Andere reagierten verwirrt und fahrig oder behaupteten, die Stadt der Zauberei sei in einem Feuerball explodiert.
Die Anführerinnen sammelten die Reste ihrer Truppen und rückten noch einmal vor - diesmal kamen sie genau auf Margali zu!
Der schützende Kreis der Schwesternschaft wankte kurz, als Margali spürte, dass sich die Hauptlast der Wut der Angreiferinnen gegen sie richtete. Tapfer dachte sie an Jaelle, an das Leben und die Liebe und richtete ihre Gedanken nach innen, bis auch das letzte schwarze Samenkorn des Hasses aufgelöst war. Die freigesetzte Energie strömte aus den verbundenen Händen der Schwestern nach oben und formte die Illusion einer Flammenwand, die sie einhüllte, ohne sie zu verzehren. Die Namenlosen wichen vor dem Feuer zurück, das ihnen nur allzu echt erschien. Dann richtete sich in den wirbelnden Tiefen des Feuers die Gestalt einer Frau in Ketten auf -
die Göttin. Die Angreifer schrien entsetzt auf und zerstreuten sich wie trockenes Herbstlaub im Wind.
Mit einem kollektiven Seufzer trennten sich die Schwestern voneinander. Als die Kraft des Kreises nachließ, brach Margali zusammen.
Camilla saß seit Stunden reglos da. Als sie über Margali wachte, zeichnete Furcht ihr Gesicht. Schließlich stöhnte ihr Schützling auf und schlug um sich. »Camilla. Camilla?«
»Ich bin hier, Bredhyia«, sagte die Gerufene leise.
Margali nahm ihre Hand, drückte sie, murmelte ein paar Worte und fiel in einen nervösen Schlaf.
Camilla schob mit ihrer großen, sanften Hand eine Strähne aus Margalis Gesicht und sprach ein leises Gebet.
Als Margali zum zweiten Mal aus den Wolken der Ahnungslosigkeit in die Besinnung zurückkehrte, lag sie eine Weile mit geschlossenen Augen da und sammelte ihre Gedanken, die wie Insekten durch den zu kurzen darkovanischen Sommer surrten.
Dann machte sie die Augen wegen des Lichts der Kerzen und Lampen einen Spalt breit auf und suchte den Raum ab. Als sie Camilla neben dem Sofa in einem Sessel zusammengesunken liegen sah, musste sie lächeln, und etwas Farbe kehrte in ihr Gesicht zurück.
»Ach, Camilla«, sagte sie leise. »Ich war … in all den Jahren nicht aufrichtig zu dir … Ich habe mich selbst gehasst. Ich habe das Leben ohne Jaelle gehasst. Ich habe so wenig Leben mit dir geteilt, wo du mich doch so sehr geliebt hast …«
Camilla, deren Schlaf so leicht war, dass ihr nicht das geringste Geräusch entging, war plötzlich hellwach und stand eine Sekunde später am Fußende des Bettes. »Margali?«, sagte sie. »Breda! Bin ich froh, dass du endlich wach bist! Wie geht es dir?«
»Ach, Camilla«, sagte Margali mit vor Verlegenheit belegter Stimme. »Kima«, fügte sie hinzu und stolperte über den liebevollen Namen, den sie nur selten aussprach. Camilla wirkte, als sei sie erfreut und besorgt zugleich.
»Was ist denn?«
»Sind wir … Ist die Stadt sicher? Sind sie wirklich weg?«
»Ja«, sagte Camilla lächelnd. »Wie geht es dir?«
»Ich bin müde«, sagte Margali leise. »Müde und … und leer. Es tut so weh … Jaelles Tod. Er hat irgendwas mit mir angerichtet.« Sie schaute zu Camilla auf. »Aber jetzt ist der Schmerz weg. Er ist weg, und ich bin leer.«
»Pssst«, machte Camilla. Sie versuchte, Margali mit erhobener Hand am Sprechen zu hindern.
»Nein, Camilla, lass es mich sagen. Ich muss es aussprechen.«
Margali versuchte sich aufzusetzen. »Ich habe den Schmerz hinter eine Wand gedrängt und … und ebenso einen Teil meines Ichs. Es war ungerecht, denn es hat auch dir wehgetan!«
Camilla sagte überrascht: »Wie kommst du denn darauf, Margali?«
»Aber, Kima … Wenn du … Selbst wenn wir zusammen waren, wünschte sich ein Teil von mir Jaelle zurück, weil sie …« Margali schluckte. »Geh mit mir nach Thendara, Camilla.« Sie senkte den Blick. »Ich weiß, wir haben oft darüber gesprochen, aber ich wollte nie. Doch diesmal lass uns als Freipartner gehen.«
»Margali!« In Camillas Augen tanzten kleine Funken.
»Ja, Camilla. Falls du mich nach allem, was war, noch haben willst.
Zieh mit mir in die Welt hinaus, lass uns Cleindori und Shaya besuchen. Es ist nicht gut, wenn man weiser ist als alle anderen in der Stadt, aber kein Umfeld und keine Familie hat, mit der man das teilen kann.«
Margali ließ Camillas Hand erschöpft sinken und legte sich aufs Kissen zurück. »Ich bin so müde. Und doch fühle ich mich, als wäre eine riesige Last von meinen Schultern genommen.«
»Ruh dich jetzt aus, Margali«, sagte Camilla. »Ich passe auf dich auf. Ruh dich aus. Schlaf.« Sie tastete Margali mit ihren geistigen Kräften ab, bis sie entspannt eingeschlafen war, dann ließ sie sich mit einem Seufzer wieder in den Sessel fallen und machte es sich bequem.
Als sie sich zehn Tage später in der Kälte des Morgengrauens am Stadttor befanden, atmete Margali kleine Eiswolken aus. Camilla ritt vorn, neben dem Packtier, das in prallen Bündeln ihre Vorräte schleppte.
Die blutrote Sonne Darkovers ging über dem Horizont auf, während Margali und Camilla sich von den anderen verabschiedeten. Dann machten sie sich auf den Weg, der von der Stadt der Weisen Schwesternschaft fortführte. Es war eine lange Reise nach Thendara. Aber sie war nicht annähernd so lang wie die, die Margali bereits hinter sich hatte.
Über Deborah Wheeler und ›Ein
Mittsommernachtsgeschenk‹
Wenn ich die Einsendungen für meine Anthologien lese, gehört es zu meinen größten Freuden, eine Geschichte zu entdecken, von der ich sofort weiß, dass sie brauchbar ist. Ich entdecke gern neue Schreibtalente, aber bis ich zu ihnen durchdringe, muss ich mich durch Unmengen von amateurhaften, unbrauchbaren Seiten lesen.
(Ich könnte auch ein viel gemeineres Wort verwenden, aber bis ich über die nächste Kurzgeschichte über einen Vampir mit AIDS
stolpere, bleibe ich mal freundlich.) Man weiß von mir, dass ich die Lektüre unaufgeforderter Manuskripteinsendungen mit dem Tauchen nach Perlen vergleiche. Man sichtet Berge von Unrat und stößt manchmal auf eine Perle. Doch meist findet man nur kalte, nasse, glitschige Austern, die nicht mal schmecken.
Doch zu den Belohnungen des redaktionellen Lesens gehören immer wieder vereinzelte Manuskripte, von denen man im Voraus weiß, dass sie druckreif sind. Wären es doch nur alle; aber dies ist wohl ein vergeblicher Wunsch.
Deborah Wheelers Geschichten sind seit Die freien Amazonen in sämtlichen Darkover-Anthologien und ebenso in meinen Schwestern-Büchern, Spells of Wonder und der vierten Ausgabe von Marion Zimmer Bradley’s Fantasy Magazine erschienen. Sie hat einen Abschluss am Reed College gemacht, besitzt auf wahre Amazonenart einen Schwarzen Kung-Fu-Gürtel, ist Chiropraktikerin und Mutter zweier Töchter. - MZB
Ein Mittsommernachtsgeschenk
von Deborah Wheeler
Nach Gavriela n’ha Alys’ Meinung war der Abend vor der Mittsommernacht nicht die beste Zeit, um den dichten Wald zu durchqueren, der an den Venza-Fluss grenzte. Es war warm und mehr oder weniger still unter dem grünen Baldachin und sogar auf den gelegentlich von Wildblumen gesprenkelten Lichtungen, wo die massiven Harzbäume wie Fackeln gebrannt hatten und ihre Nachfolger noch nicht ausgewachsen waren. Die drei Entsagenden waren offenbar die einzigen Lebewesen in jenem Wald, wenn man von einem hier und da in der Ferne auftauchenden Vogel absah. Es gab auch keine Spuren von Banditen, die einer kleinen Gruppe wie dieser gefährlich werden konnten. Um zufällige Begegnungen zu vermeiden, hatte Fiona, die Führerin, eine Route gewählt, die fernab von ihrem Territorium lag.
Hätte Gavi bestimmen dürfen, hätte sie noch einige Tage gewartet, doch auf Fiona und Maire wartete Arbeit in Hali, und sie wusste aus schmerzlicher Erfahrung, dass sie besser nicht allein reiste. Sie hatte Fiona im Gildenhaus von Thendara, wo sie das Hebammenhandwerk erlernte, nicht sehr gut gekannt, doch inzwischen wünschte sie sich, sie wäre ihr nie begegnet. Seit Rosario hinter ihnen lag, zogen Maire und sie Gavi ständig damit auf, dass sie das Mittsommerfest verpassen würden. Manchmal stichelten sie im herablassenden Tonfall von Erwachsenen, die ein Kind schalten, das nur an ungesunde Süßigkeiten dachte. Manchmal aber verletzte sie ihr Gelächter mehr, als die beiden sich vorstellten.
Gavi presste die Lippen aufeinander und wischte die Schweißtropfen ab, die sich auf ihrem glatten, rotbraunen Haar sammelten. Dass sie Männer mochte, stand nicht in Widerspruch zu ihrem Eid. Sie hatte nur geschworen, niemals das Eigentum eines Mannes zu werden. Wenn sie wollte, konnte sie sogar eine Freipartnerehe eingehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kam, war ebenso gering wie die, dass man sie zur Bewahrerin von Arilinn ernannte. Wenn man den Eid der Entsagenden und die Hebammenethik bedachte - den Gatten einer Gebärenden mit übertrieben gewissenhafter Redlichkeit zu behandeln -, war die Chance denkbar gering, einem Mann zu begegnen, der ihr Herz rührte. So blieben ihr nur Träume und die Hoffnung auf die Mittsommernacht.
Ich habe meinen Eid nie bereut. Auch wenn ich im Haus meines Vaters geblieben wäre und seinen Wünschen gemäß geheiratet hätte, wäre nichts anders gewesen. Sie wischte sich erneut das Gesicht ab und bemerkte eine einsame Träne unter den Schweißtropfen.
»Lasst uns das Lager heute früher aufschlagen und ein eigenes Fest feiern«, sagte Maire lachend. Sie trat zur Seite, um Gavi vorbeizulassen. Dann hakte sie sich bei Fiona ein.
»Tolle Idee«, sagte Fiona. »In meiner Flasche ist noch etwas Wein.«
Gavi seufzte, ignorierte Maires Kichern und ging allein über den schmalen Pfad weiter. Vorsichtig stieg sie über einen umgestürzten Schößling, blieb stehen und lauschte. Das vor ihnen liegende Gehölz war so dicht, dass der Pfad in einer dichten grünen Wand zu verschwinden schien. Ihr fragmentarisch ausgeprägtes Laran, das ihr als Hebamme besondere Empfindsamkeit verlieh, stieß eine schrille Warnung aus.
Maire knallte gegen ihren Rücken und stolperte lachend, doch Fiona wurde auf der Stelle wachsam. »Was ist denn, Gavi?«
»Vor uns ist etwas … Aber ich kann nichts hören.«
Lautlos zog Fiona das lange Messer aus der Scheide und baute sich vor den anderen Frauen auf. Ihre spröden Gesichtszüge zeigten nun nicht mehr die geringste Spur von Erheiterung. Als Gavi und Maire ihre Messer zogen, betete Gavi darum, dass sie das ihre nicht einzusetzen brauchte. Sie war nie eine geübte Kämpferin gewesen, und ihr Hebammeneid verpflichtete sie, Leben zu erhalten und zu hegen.
Fiona glitt wie ein dahinfließender Schatten auf dem Pfad voran.
Die Zweige teilten sich so elegant vor ihr, als würden sie vom Wind bewegt. Gavi und Maire folgten so leise wie möglich. Kurz darauf hörte Gavi, dass in den Büschen etwas raschelte.
An dieser Stelle verlief der Pfad gerade und war auf eine kurze Distanz deutlich zu überblicken. Fiona blieb stehen und duckte sich kampfbereit.
Ein warnendes Unbehagen baute sich wie ein Druck hinter Gavis Herz auf und alarmierte sie, bis es so wehtat, dass sie am liebsten um Hilfe geschrien hätte. Sie trat vor. »Fiona …«
Fionas Kopf zuckte herum. Sie befahl ihr zurückzutreten, und im gleichen Moment kam ein junger, dem Knabenalter gerade entwachsener Mann über den Pfad gelaufen. Er war wie ein typischer Waldbewohner gekleidet - Stiefel, eine Lederweste, ein offenes Hemd und weite Hosen -, doch passten ihm die Kleider nicht richtig. Er hielt rutschend an, richtete den Blick auf Fionas Klinge und zog das an seiner Seite hängende Schwert. Dann erblickte er ihr Gesicht, warf das Schwert hin und hob bittend die Hände.
»Ich will euch nichts Böses tun, gute Frauen. Ich bin unterwegs nach Rosario, um Hilfe zu holen. Die Gattin meines Herrn … Ist eine von euch vielleicht in der Heilkunst bewandert?«
Gavi trat vor. »Ich bin Hebamme.«
»Dann sind die Götter uns eindeutig wohlgesonnen!« Der junge Mann katzbuckelte fast vor ihr. Nur Fionas erhobene Klinge hinderte ihn daran, sich vor Gavi auf den Boden zu werfen.
»Fiona, eine Frau braucht meine Hilfe …«, sagte Gavi.
»Maire, heb das Schwert auf. Und du, Junge, zeigst uns den Weg.
Und keine Tricks - sonst kriegst du dein eigenes Schwert in den Rücken.«
Als sie den Pfad entlangeilten, erzählte der junge Mann in atemlosen Schüben seine Geschichte. Er hieß Felix und war der Friedensmann Valdrins, des leiblichen Sohnes des alten Fürsten Caradoc of Sweetwater in den Venza-Bergen. Doch dessen Nedestro-
Onkel hatte das Herrenhaus an sich gerissen und den jungen Fürsten gezwungen, um sein Leben zu laufen …
An dieser Stelle warf Fiona unhöflich ein: »Die örtliche Politik interessiert mich so wenig wie der Fingernagel eines Cralmac. Du hast gesagt, dass eine Frau unsere Hilfe benötigt.« Sie versetzte Felix einen Stoß in den Rücken, um ihm zu verdeutlichen, worum es ihr ging.
»Ja, ich verstehe.« Felix hob beide Hände und machte einen Satz.
»Seine Freipartnerin … sie heißt Nyssa … kommt aus der Gegend oben am Kadarin-Fluss. Sie ist schwanger … Sie ist nicht sehr kräftig
… Man hat sie aus ihrer Heimat in die Wälder verjagt …«
Hinter Gavis Augen tauchte ein Bild auf. Das Licht eines Feuers, das den gerundeten, schweißüberströmten Bauch einer Frau vergoldete. Ihr strohblondes Haar flog hin und her, ihre Augen waren vor Schmerz weit aufgerissen.
»Ihre Wehen haben zu früh eingesetzt.«
»Ja, woher wisst Ihr das?«, fragte der junge Felix, der noch immer eine respektvolle Entfernung zu Fionas Messer einhielt.
»Sie weiß solche Dinge, weil es ihr Beruf ist«, sagte Maire grimmig. »Was glaubst du denn?«
Sie hatten das Lager ein Stück vom Pfad entfernt aufgeschlagen.
Hinter den Büschen standen drei stämmige Chervines. Die hereinbrechende Nacht hatte das Unterholz in Finsternis versinken lassen. Als Felix sich mit einem Ruf meldete, bemerkte Gavi ein primitives Zelt neben dem Feuer aus ihrer Vision. Daneben lagen mehrere Gestalten. Jemand stand auf und kam ihnen entgegen. Ein Mann, der wie Felix die Kleidung der Waldbewohner trug.
Gavis Knie wurden weich. Nicht mal Aldones persönlich könnte solche Eleganz aufweisen, dachte sie.
Im schwindenden Tageslicht waren seine Augen grau, aber klar und leuchtend wie ein reinigendes Gewitter, und sein langes, kastanienbraunes Haar lag wie ein Umhang um seine adeligen Züge. Seine Schultern waren zwar breit, aber er hatte schmale Hüften wie ein Tänzer und war nicht im Geringsten beleibt. Als er lächelte und sprach, erfüllten seine Worte sie mit Feuer.
»Evanda möge Euch segnen, Mestra. Meine Gattin …«
Gavi löste ihren Blick mit Gewalt vom Gesicht des Mannes und eilte zu der freien Stelle am Feuer. Auf einem Deckenstapel lag eine Frau, deren Kopf auf einer Rolle gepolsterter Kleider ruhte. Sie trug nur ein schweißnasses Unterkleid, das sich über ihren aufgeblähten Bauch spannte. Gavi kniete sich neben sie und nahm ihre Hand.
»Ich bin Gavriela n’ha Alys, Hebamme aus Thendara. Wie lange liegt Ihr schon in den Wehen?«
Die Frau leckte sich die Lippen und verzog keuchend das Gesicht.
Ihr ganzer Körper verrenkte sich plötzlich, ihre Bauchmuskeln traten hervor. Der junge Fürst - wie hatte Felix ihn genannt?
Valdrin? - zog ihren Oberkörper hoch, damit sie sich an seiner Brust abstützen konnte, und legte die Hände schützend auf ihre Schultern.
Obwohl die Kontraktionen den Körper der Frau noch immer schüttelten, wurde ihr Gesicht weicher, als sie zu ihm aufschaute. Er blickte mit solch unverhüllter Zärtlichkeit auf sie hinab, dass Gavi den Blick abwenden musste.
»Seit gestern Abend«, sagte die Frau mit leiser, doch deutlicher Stimme. Ihre blassen Augen schauten erneut ihren Gatten an, während sich ihre dünnen, sechsfingrigen Hände an seinen Arm klammerten.
»Aber es ist zu früh«, sagte er. »Das Kind sollte erst in zwei Monaten geboren werden.«
»Trotzdem kann es überleben«, erwiderte Gavi so entschieden wie möglich. »Manchmal verrechnen sich die Frauen, wenn es um ihren Zyklus geht. Lasst mich …« Vorsichtig legte sie eine Hand auf den Bauch der Frau, um die Größe des Fötus abzuschätzen.
Sie wurde von Empfindungen durchströmt, die sie für kurze Zeit blendeten. Die erste, überwältigende, war die Stärke und fremdartige Schönheit des Geistes der Frau. Sie ist eine Chieri, mindestens zur Hälfte, sonst will ich Durramans Esel sein! Aber sie wirkt so weiblich … Vielleicht deswegen, weil er so männlich ist.
Die zweite Empfindung war eine stehende schwarze Präsenz an der Stelle, an der die Lebensenergie des ungeborenen Kindes hätte sein sollen.
Gavi hockte sich benommen auf die Fersen. Jetzt war nicht die Zeit, um sich in sentimentalem Geschwafel zu ergehen. Womöglich stand das Leben der Frau auf dem Spiel. Sie zwang sich, Valdrins anziehende Schönheit gänzlich aus ihrem Geist zu verbannen und ergriff Nyssas Hände. Mit ihren blassen Augen schaute sie die Hebamme an, ohne mit der Wimper zu zucken.
»Ihr wisst es also?«
Nyssa nickte. »Ich habe gehofft, ich hätte mich geirrt.«
»Deshalb sind die Wehen so stark«, folgerte Gavi. »Das Kind kann nicht mithelfen.«
»Nyssa«, sagte Valdrin mit leiser, erschreckter Stimme. »Du hast mir nicht erzählt …«
»Wie hätte ich es tun können? Du wolltest doch so sehr ein Kind.
Ah …« Nyssa schrie auf, als eine erneute Kontraktion sie packte und wie ein Rabbithorn in den Fängen eines Wolfes schüttelte.
Gavi hielt sie fest. »Schaut mich an, Nyssa, schaut mir in die Augen. So ist es richtig; ignoriert alles andere. Schaut nur in meine Augen. Lasst den Schmerz wie ein Sturm sein; seid ein Falke, der sich von ihm tragen lässt. Spürt, wie Ihr auf seiner Kraft dahinschwebt … Und atmet mit mir zusammen …«
Die Kontraktionen hörten auf. Gavi rief Fiona, und Maire zu, sie sollten Wasser kochen und saubere Tücher suchen. Sie spürte die Umrisse des toten Kindes durch Nyssas dünne Bauchdecke. Es lag nicht mit dem Kopf nach unten, sondern quer. Daher war es unmöglich, das Kind so durch den Geburtskanal zu holen. Falls es doch klappte, würde Nyssa bestimmt sterben.
So ruhig wie nur möglich, erläuterte die Hebamme, was sie tun musste. »Die Muskeln der Gebärmutter halten das Kind in einer ungünstigen Position, also müsst Ihr Euch entspannen, damit ich es drehen kann.«
»Entspannen?«, sagte Valdrin. »Bei diesen Schmerzen?«
»Ihr müsst mir vertrauen, Nyssa, wie schon bei der ersten Kontraktion. Hier, haltet Valdrins Hände und tut, was ich sage.«
Gavi redete weiter in dem sanften, murmelnden Tonfall, den sie in den Jahren ihrer Ausbildung erlernt hatte. Sie legte die Hände auf Nyssas Bauch und spürte, wie sich der Gebärmuttermuskel bei der nächsten gewaltigen Kontraktion spannte. Im gleichen Moment, in dem das Zucken durch Nyssas Körper tobte, tauchte Gavi in die strahlenden Energiefelder ein und linderte den Schmerz von innen.
Sie spürte, dass Nyssa sich der mentalen Berührung wie eine edelsteinverzierte Blüte öffnete …
Dann gesellte sich ein weiterer Geist zu ihnen. Er war wie dunkle Seide, glatt und subtil, zwar nicht so strahlend wie der Nyssas, aber er blendete sie beide.
Mit geschlossenen Augen drückte Gavi tiefer in die Gebärmutterwand hinein und spürte, dass die Muskeln nachgaben.
Das tote Kind, steif und schwach, widersetzte sich ihr. Nyssa stieß einen hohen, keuchenden Schrei aus, der Gavi für einen Moment ablenkte. Als sie ihre Konzentration wieder auf die Totgeburt richtete, spürte sie ein zweites Händepaar über dem ihren; nicht körperlich, sondern geistig. Es erfüllte die Hebamme mit großer Lebenskraft. Gavi spürte das Schlagen seines Herzens und die aus seinen Lenden von seinem in ihren Körper strömende Kraft, die sich bis in ihre Fingerspitzen und Nyssas Schoß hinein ausbreitete.
Als das Kind in die richtige Lage rutschte, war Gavi tief genug, um das Schema der abgestorbenen Zellen zu lesen und sich zu verdeutlichen, dass keine Vereinigung zwischen diesem menschlichen Mann und seiner Halbchieri-Frau je Leben hervorbringen konnte. Ihre Ausbilderinnen hatten letale Rezessivität als Problem inzüchtiger Comyn erwähnt, aber sie hatte nie geglaubt, dem je zu begegnen.
Einige Minuten später, ihre Hände waren vom heißen Seifenwasser halb verbrüht, griff sie in die sich quälende Frau hinein und dirigierte den winzigen Kopf langsam nach außen. Das tote Kind war sogar für sein Alter sehr klein. Nyssa schrie, als es herauskam. Sie fing heftig an zu bluten.
Gavi hatte keine Zeit zum Trauern. Sie musste schnell handeln, damit es nicht zwei Tote gab. Normalerweise hätte das Stillen des Säuglings die Blutung gestoppt, doch nun strömte Nyssas Lebenssaft in einem heftigen Schwall heraus. Da Gavi nun erneut um das Leben der Frau fürchtete, fing sie intensiv an, ihren Uterus von außen zu kneten. Es bedurfte all ihres Geschicks, die Muskeln so zu stimulieren, dass sie sich nur die zerrissenen Blutgefäße vornahmen, ohne weitere Verletzungen zu erzeugen. Gavi bemerkte kaum, dass Maire das Kind in einen Deckenfetzen schlug und Valdrin reichte.
Es war eine langwierige und vertrackte Angelegenheit, die Blutung unter Kontrolle zu bekommen. Als Gavi es geschafft hatte, war ihr Hemd von getrocknetem Blut und Schweiß bedeckt und ihre Schenkel und Unterarme bebten vor Erschöpfung. Bleich und ausgelaugt lag Nyssa da. Die Frauen hatten sie in die Umhänge aus ihren Beuteln gepackt. Gavi setzte sich zurück und atmete tief ein.
Das Lager war bis auf Fiona und Maire leer. Sie saßen zusammen hinter dem Zelt. Die beiden Männer waren verschwunden.
Möglicherweise begruben sie den Säugling.
»Gavi Gavriela.«
Die Hebamme trat neben Nyssa und nahm ihre Hand. Die Finger der Frau fühlten sich kalt an. »Ihr solltet jetzt schlafen. Euer Körper braucht Ruhe, damit er heilt.«
»Ich werde nicht sterben?«
»Ich glaube nicht. Das Schlimmste ist vorbei.«
»Aber ich darf nicht mehr schwanger werden?«
Gavi holte tief Luft. Sie hätte lieber gewartet, bis Nyssa stärker war, aber sie konnte ihr Gegenüber jetzt nicht belügen. Sie schaute in ihre blassen, unerschrockenen Augen. »Nein. Nicht von Valdrin.
Wahrscheinlich von keinem Mann, der über Laran verfügt.«
»Es gibt keinen anderen, von dem ich ein Kind haben möchte«, sagte Nyssa leidenschaftlich. »Und er … er liebt mich, aber es ist ihm so wichtig, einen Erben zu haben, der Sweetwater nach ihm regiert.«
Gavis Gedanken rasten zu ihrem Amazoneneid. »… werde ich kein Kind von einem Manne austragen, es sei denn zu meinem Vergnügen … kein Kind für eines Mannes Haus oder Erbnachfolger
…« Doch Nyssa hatte keinen solchen Eid geschworen, und mit ihrer Chieri-Empfindsamkeit war sie für die tiefen Sehnsüchte ihres Gatten ganz und gar anfällig.
»Ich habe bemerkt, wie Ihr ihn angeschaut habt«, fuhr Nyssa fort.
»Und als wir zusammen waren, habe ich gespürt, dass Eure Lebensenergie mit der seinen getanzt hat. Als wir in meinem Körper waren, habe ich den Euren gespürt. Ich weiß, dass Ihr jetzt fruchtbar seid.«
Gavi zuckte zurück. Sie wäre fast umgefallen. Ihre Stimme war plötzlich so heiser wie die einer Kyorebni. »Was wollt Ihr damit sagen?«
»Dass Ihr sein Kind für mich austragen könnt.«
Gavi konnte weder geradeaus sehen, noch geradeaus denken, da ein ohrenbetäubendes Brüllen in ihrem Kopf widerhallte. Nyssa richtete sich plötzlich mit verzweifelter Heftigkeit auf und umklammerte Gavis Hände mit eisernen Fingern. »Auf Euren Amazoneneid: Keine Frau soll je vergeblich an mich appellieren. Habt Ihr es geschworen oder nicht?«
Der Eid bezog sich auf andere Entsagende. Aber wie konnte sie Nyssa beibringen, dass sie ihr keine Loyalität schuldete? Als Hebamme hatte sie geschworen, jede Frau, die sie pflegte, mit aller Kraft aufzupäppeln, zu verteidigen und zu beschützen. Wenn sie schon kein Kind nach eines Mannes Willen gebären konnte, warum nicht das einer anderen Frau? Rettete sie damit nicht Nyssas Leben?
Es würde ein kurzes und süßes Erlebnis sein, ein Traum, an den sie sich ein Leben lang erinnern konnte. Mit ihm zusammen unter dem mondhellen Himmel liegen. In der Nacht des Mittsommerfestes, mit einem Gott in den Armen. Sie stellte sich seine Lippen auf den ihren vor, wie seine geschmeidigen Finger ihre Brüste umfassten. Ihr Herz schlug schneller, ihre Brustwarzen juckten und schickten winzige Lustwellen durch ihren Leib.
Nyssas Finger zitterten, als sie Gavis Hände festhielt. Sie atmete schnell und leicht, als sei sie schon am Ende ihrer Kräfte.
»Legt Euch hin«, sagte Gavi sanft. »Ihr müsst jetzt ruhen.«
»Nicht, bevor Ihr zugestimmt habt.«
»Ich …« Die Hebamme wusste nicht mehr, was richtig war. Hier wurde ein Eid gegen den anderen ausgespielt, und ihr sprunghaft zunehmendes Verlangen umwölkte beide. Sie konnte Fiona oder Maire nicht um Rat fragen. Sie kannte die Antwort der beiden genau.
»Valdrin …«, sagte Nyssa leise. »Wie lange hörst du uns schon zu?«
Gavi zuckte zusammen und schaute sich um. Valdrin stand ein paar Schritte hinter ihr, im Schatten eines niedrig hängenden Astes.
Er kam näher, und das Feuer beleuchtete seine Züge. »Lange genug«, sagte er gepresst. »Bist du verrückt geworden, Nyssa? Oder glaubst du, weil ich dich liebe, bin ich dein Spielzeug, das man an jede Frau ausleihen kann, die du aussuchst, ohne an meine Gefühle zu denken?«
Nyssa wimmerte. Ihr Kopf sank auf die Kleiderrolle zurück.
Valdrin drehte sich um, als wolle er davonlaufen.
»Hört zu!«, schrie Gavi plötzlich aufgebracht. »Was sie gewollt hat, hat sie nur für Euch gewollt, Ihr Holzkopf! Für Euch und den Erben, den Ihr Euch so sehr wünscht. Sie ist bei seiner Geburt fast gestorben. Ist Euch das klar? Und nun zeigt Ihr Eurer Liebsten die kalte Schulter …«
Valdrin kniete sich wie ein Tänzer neben Nyssa hin. »Verzeih mir, meine Liebe, ich habe es nicht verstanden. Aber …«
»Aber wenn ich schwanger oder krank wäre und dir nun mal danach zu Mute wäre, würde ich dich zu der Frau schicken, die mir die liebste ist«, murmelte sie und hob die Hand, um sein Gesicht zu streicheln. »Du hast mir selbst erzählt, dass es bei deinem Volk so üblich ist.«
Er drückte ihre Hand an seine Lippen und küsste ihre Finger.
Seine glänzenden Augen wandten sich keine Sekunde von ihr ab.
»Das war … eher geprahlt.«
»Aber wahr.« Nyssa schaute Gavi an. »Diese Frau kann dir geben, was ich dir nicht zu geben vermag. Ein schwesterliches Geschenk, mit meinem Segen.«
Zuerst konnte Gavi ihm nicht in die Augen schauen. Es wurde erst anders, als er eine Hand unter ihr Kinn legte und sie in die Anne nahm. Seine Berührung war wie Seide, wie Feuer. Seine Finger streichelten ihre Wange und tasteten über ihre Unterlippe. Selbst im matten Licht des Feuers waren seine Augen so tief, wie sie es nie zuvor gesehen hatte. »Und Ihr? Seid Ihr dazu bereit?«
»Ich weiß nicht.« Gavi rappelte sich auf. Die Steifheit ihrer Knie überraschte sie. Ich werde alt. Vielleicht ist es meine letzte Chance …
Die letzte Chance - in welcher Hinsicht?, fragte sie sich. Für eine Nacht mit dem Mann einer anderen Frau? Für ein ihrem Vater schon versprochenes Kind, um das Leben zu leben, das er für sie bestimmt?
Warum habe ich das Haus meines Vaters verlassen, wenn nicht, um das Recht zu erringen, mein eigenes Leben zu gestalten?
Er nahm ihre Hand und führte sie in den Wald. »Lasst uns eine Weile gehen und reden. Wir brauchen nichts übereilt zu entscheiden.«
Die vier Monde standen am Himmel und tauchten die Baumstämme in silbernes Licht. Der Wald erschien ihr unnatürlich still. Eine Märchenwelt. Dann sang irgendein Vogel, als glaube er, der Tag sei angebrochen, plötzlich ein Lied.
»Ich kann mir die Schwierigkeit Eurer Lage vorstellen«, sagte er.
»Könnt Ihr es wirklich? Was wisst Ihr schon über meinen Eid und mein Leben?«
»Ich weiß, dass Ihr eine integre Frau seid. Wenn Nyssa … Wenn die Dinge sich anders ergeben hätten … Wären wir beide ungebunden gewesen und hätten uns bei irgendeinem Mittsommerfest getroffen, hätten wir uns bestimmt miteinander vergnügt.«
Gavis Herz tat einen Sprung. Er hielt inne, als wäge er ihre Antwort ab. Sie drehte sich um und biss sich in den Handknöchel.
Ich muss einen Abend der Lust gegen einen Eid abwägen, der ein Leben lang gültig ist. Kann ich mich einfach darüber hinwegsetzen, weil ich den Wunsch dazu verspüre? Bin ich auf dem Weg, meinen Eid zu brechen, weil eine Frau im Namen der Schwesternschaft es von mir verlangt? Und wenn der Eid der Entsagenden mir nicht die Freiheit gibt, meinem eigenen Verlangen nachzugeben, wozu ist er dann gut?
Valdrin schien ihr Schweigen für Zustimmung zu halten, denn er legte die Hände auf ihre Schultern und zog sie an sich. Sofort reagierte ihr Körper auf seine überwältigende männliche Kraft. Ihr Herz schlug wie ein gefangener Vogel, ihre Lenden schmolzen wie Butter dahin. Er beugte sich vor und küsste sie.
Gavi hätte beinahe die Arme gehoben, um ihn zu umschlingen, doch sie konnte sich nicht rühren. Zuerst musste sie wissen, was sie wirklich wollte.
»Gefalle ich Euch nicht?«, murmelte er. Sein Atem blies ihr Haar beiseite.
»O doch«, sagte sie leise und wiederholte es lauter. »O doch. Ich habe Euch seit dem Augenblick begehrt, als ich Euch sah. Aber dies ist kein simples Mittsommernachtsgeschenk, sondern es geht um vier Leben. Um Eures, meines, Nyssas und das des Kindes. Ich habe keine Macht über das, was Nyssa und Ihr mit dem euren anfangt.«
Sie löste sich von ihm, und an der Stelle, wo er sie angefasst hatte, zitterte ihr Leib noch immer. »Aber ich habe zwei Eide abgelegt, die ich ehren muss - einen Eid, mein Leben nach meinem eigenen Geschmack zu leben und nicht nach dem eines anderen, so sehr ich ihn auch liebe. Und einen Eid, meine Schwestern zu respektieren, ob sie nun Amazonen sind oder nicht. Nyssa hat mir etwas Unteilbares angeboten. Es würde mir gefallen, wenn Ihr mich so anschauen würdet wie sie, und das ist etwas, das weder sie, noch Ihr, noch Aldones persönlich mir geben kann.«
»Aber …«, sagte er protestierend. Doch sie unterbrach ihn, da sie halb befürchtete, sie würde alles, was ihr nun klar war, vergessen, wenn er sie noch mal berührte.
»Aber ich könnte das, was Ihr - und sie - mir anbietet, annehmen, wenn es nicht um ein viertes Leben ginge. Ein Leben, das zu verteidigen ich zwei Eide ablegen müsste. Nicht nur, um es vor körperlicher Gefahr zu bewahren, sondern auch vor der Versklavung, der ich entflohen bin. Wenn ich ein Kind bekäme, und es wäre ein Mädchen, könnte es dann sein Leben selbst bestimmen, auch wenn es so aussähe wie das, das ich führe? Oder würde man es mit jenem Mann verkuppeln, von dem Ihr glaubt, er sei der beste, um Sweetwater weiterzuführen?«
»Nein. Wofür haltet Ihr mich?«
»Und wenn es ein Junge wäre, wäre er dann freier oder müsste er auch dann Euer Erbe sein, wenn ihm das Herz nach etwas anderem stünde - nach einem Turm vielleicht, nach Nevarsin?«
Valdrin ließ den Kopf hängen. Trotz des Lichtes der vier Monde wirkte seine Miene finster. »Das könnte ich Euch nicht versprechen.«
»Ich weiß«, sagte sie sanft. »Und wärt Ihr nicht der, Mann, der Ihr seid, wäre ich auch nicht so verlockt.« Sie küsste ihn sanft, wie eine Schwester.
»Eure Frau wartet auf Euch. Geht zurück und betet zu Aldones, dass er Euch ihrer würdig macht.«
Nachdem er gegangen war, stand sie zwischen den Bäumen und fragte sich, auf welche Weise sie sich an diese Nacht erinnern würde. Und was aus dieser Nacht hätte werden können. So viel zum Thema sentimentales Geschwafel!
Zwischen den Bäumen bewegten sich Schatten. Fiona und Maire traten mit gezückten Messern ins Mondlicht. »Ich sehe, du brauchst doch keine Hilfe«, sagte Fiona.
Gavi runzelte die Stirn. »Fiona, hast du den Wein noch? Dann hol ihn her, und wir feiern zusammen die Mittsommernacht.«
Als sie zum Lager zurückkehrten, stieß Fiona einen Jubelschrei aus, und sie umarmten sich.
Über Joan Marie Verba und ›Die Ehre der Gilde‹
Joan Marie Verba veröffentlicht seit geraumer Zeit in meinen Anthologien. Ihre erste professionell publizierte Erzählung wurde in Die Freien Amazonen abgedruckt. Ihr diesjähriger Beitrag fängt wie eine klassische Mordgeschichte an …
Joan Marie Verba wurde in Massachusetts geboren, lebt aber seit ihrem vierten Lebensjahr in Minnesota. Über Minnesota weiß ich nur, dass das dortige Klima dem von Darkover ähnlich ist. - MZB
Die Ehre der Gilde
von Joan Marie Verba
Janna n’ha Cassilde begutachtete sorgfältig die vor ihr liegende Leiche. Der Mann hätte nicht tot sein dürfen. Es gab weder Anzeichen von Gewalteinwirkung noch solche einer Krankheit. Sie nahm die an ihrem Hals hängende Matrix aus der Hülle und hoffte, dass ihr Laran etwas aufdeckte. Fehlanzeige. Sie packte den Stein wieder ein, schob ihn in die Jacke und drehte sich um, denn sie wollte mit der Gattin des Verstorbenen sprechen. Hinter ihr in der alten, von Zwielicht erfüllten Hütte, in welcher der Tote lag, hatte sich eine schweigende Menge versammelt.
Janna ignorierte die starrenden Blicke. »Ihr behauptet, eine Entsagende hätte es getan, Mestra?«, fragte sie die Frau.
»Ganz genau, Irrtum ausgeschlossen. Sie hatte kurzes Haar, trug Hosen und hatte ein Schwert, wie Ihr.« Die Frau zog ihr Kopftuch enger um sich, so dass ihre Züge kaum noch zu erkennen waren.
Janna kratzte sich am Ohr. Die Frau sprach mit einem ländlichen Akzent, nicht das gebildete Casta oder den städtischen Cahuenga-
Dialekt, den sie gewöhnt war, aber sie konnte die Worte verstehen.
Die Entsagende wandte sich wieder der Leiche zu. Sie hatte fast erwartet, dass der Tote sich hinter ihr aufrichten würde, aber er lag noch immer so reglos und kalt da wie zuvor. »Sie hat ihn also nur angeschaut, und er ist tot umgefallen?«
»Ja, genau.« Die Worte kamen diesmal langsamer und unsicherer.