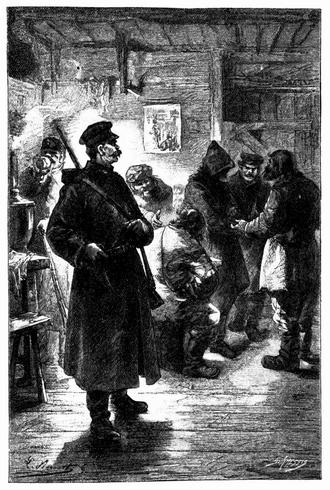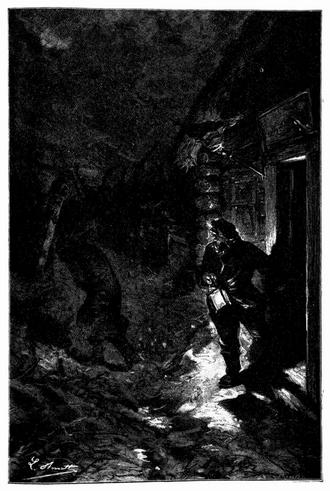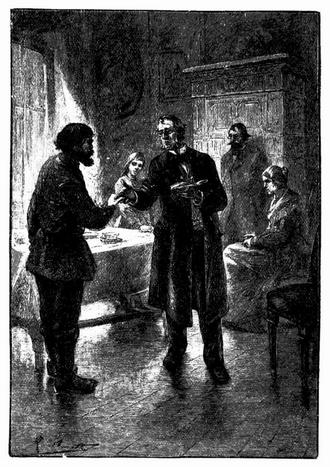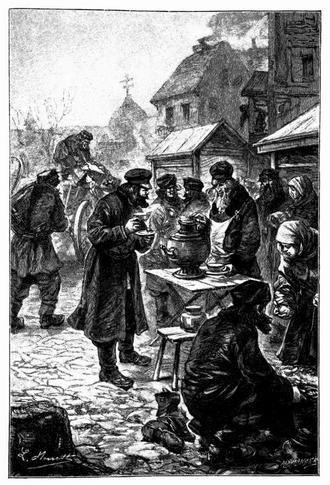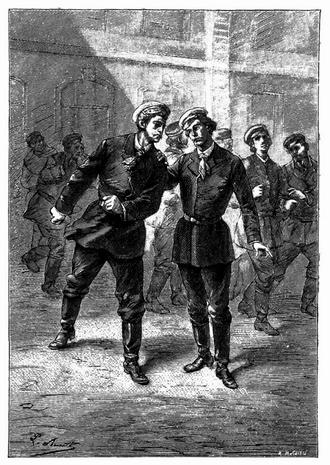Fünftes Kapitel.
Der Kabak »Zum umgebrochenen Kreuze«.
Die Schenke »Zum umgebrochenen Kreuze« rechtfertigte diese Bezeichnung durch eine braunrote Zeichnung an einer der Giebelwände des Hauses: durch das Bild eines russischen Doppelkreuzes, das am Fuße umgebrochen war und auf der Erde lag… jedenfalls eine Legende, die mit irgend einer kirchen-schänderischen Untat aus längstvergangener Zeit in Verbindung stand.
Ein gewisser Kroff, ein Slawe von Geburt und Witwer im Alter von vierzig bis fünfundvierzig Jahren, bewirtschaftete die einsam an der Landstraße von Riga und am Rande eines Waldes gelegene Schenke, die schon sein Vater besessen hatte. Im Umkreise von zwei bis drei Werst hätte man nirgends ein näher gelegenes Haus oder einen Weiler angetroffen… die Einsamkeit im vollsten Sinne des Wortes.
Als gelegentliche Kunden empfing Kroff nur die wenigen Reisenden, die hier einmal Halt machen mußten, als eine Art Stammgäste aber verkehrten bei ihm etwa ein Dutzend Bauern, die auf nahe gelegenen Feldern arbeiteten, und einige Holzfäller und Kohlenbrenner aus dem benachbarten Walde.
Ob der Gastwirt ein gutes Geschäft machte, hätte niemand sagen können; jedenfalls ließ er keine Klagen hören und war überhaupt nicht angelegt, über etwas zu sprechen, was ihn selbst betraf. Der Kabak war schon seit etwa dreißig Jahren im Betrieb, erst unter Leitung des Vaters – der als Schmuggler und Wilddieb sein Schäfchen ins Trockene gebracht hatte – und dann unter der des Sohnes. Die Leute in der weiteren Umgebung mutmaßten auch, daß es im »Umgebrochenen Kreuze« an Geld nicht fehle… es bekümmerte sich darum aber niemand näher.
Von Natur wenig mitteilsam, lebte Kroff sehr zurückgezogen und verließ seine Schenke nur in den seltenen Fällen, wo er einmal in Pernau zu tun hatte. Im übrigen arbeitete er in seinem Garten, solange ihn keine Gäste davon abriefen, denn er hatte weder eine Magd noch einen Burschen zur Hilfe. Von Person recht kräftig, hatte er ein rötliches Gesicht, starken Vollbart, üppiges Kopfhaar und einen freien, offenen Blick. Er richtete nie an jemand eine Frage und antwortete stets kurz und bündig, wenn jemand zu ihm sprach.
Das Haus, hinter dem der Garten lag, bestand nur aus einem Erdgeschoß mit einer einflügeligen Haupttür, durch die man sofort in die Gaststube eintrat, welche von einem Fenster im Hintergrunde erhellt wurde. Rechts und links schloß sich daran noch je ein nach der Straße hinaus gelegenes Zimmer. Die Wohnstube Kroffs befand sich in einem Anbau nach dem Gemüsegarten zu.
Tür und Fensterläden des Kabak waren sehr fest und mit tüchtigen Haken und schweren Eisenriegeln versehen. Der Wirt schloß sie stets schon mit Anbruch der Dämmerung ab, denn allzu sicher war es im Lande hier gerade nicht. Die Schenke blieb aber trotzdem bis abends zehn Uhr zugänglich. Augenblicklich saßen darin ein halbes Dutzend Gäste, die Wodka und Schnaps in lustige Stimmung versetzt hatten.
Der einen halben Morgen große Garten, der nur von einer lebenden Hecke umschlossen war, stieß an den sich längs der Straße hinziehenden Wald. Kroff baute darin die beliebtesten Gemüsearten, was ihm noch einen recht netten Gewinn einbrachte. Von Obstbäumen, die sich freilich keiner besonderen Pflege erfreuten, befanden sich darin einige dürftig entwickelte Kirschbäume neben Apfelbäumen, die recht gute Früchte lieferten, und außerdem dicht bestandene Beete voll Himbeersträuchern mit duftigen, glänzendroten Früchten, die in Livland überhaupt gut gedeihen.
Am heutigen Tage schwatzten und tranken an den Tischen der Gaststube drei oder vier Bauern und ebensoviele Holzfäller aus Weilern der Umgebung. Der Schnaps. das Spitzgläschen zu zwei Kopeken, lockte sie Tag für Tag hierher ehe sie nach ihren Gehöften oder Hütten heimkehrten, die drei bis vier Werst entfernt lagen. Die Nacht über blieb keiner im »Umgebrochenen Kreuze«; hier kehrten auch nur selten Reisende ein, um eine Nacht zu schlafen. Die Postillone und die Schaffner der Telegen und der Postwagen machten aber gern an der alten Schenke Halt, ehe sie zur letzten Strecke nach Pernau aufbrachen.
Außer den gewohnten Gästen saßen heute etwas abgesondert zwei Männer an einem Tische, die nur mit gedämpfter Stimme miteinander sprachen und die anderen Personen immer scharf im Auge behielten; das waren der Brigadier Eck und einer seiner Unterbeamten. Nach der Verfolgung längs der Pernova hatten sie ihre Nachsuchungen in der Umgegend fortgesetzt, wo sich verdächtiges Gesindel umhertreiben sollte, waren dabei aber immer in Verbindung mit den Patrouillen geblieben, denen die Überwachung der Dörfer und Weiler des Nordens der Provinz oblag.
Eck war von seinem letzten Zuge recht unbefriedigt zurückgekommen. Von dem Flüchtling, den er lebendig zu fangen und dem Major Verder einzuliefern gehofft hatte, war nicht einmal der Leichnam im Schollengewirr der Pernova gefunden worden… eine arge Verletzung seiner Eigenliebe.
Der Brigadier äußerte eben gegen seinen Begleiter:
»Wir können wohl annehmen, daß der Spitzbube ertrunken ist.
– Ohne Zweifel, bestätigte der Polizist.
– Nun, so ganz ‘ohne Zweifel’ ist das leider nicht, wenigstens haben wir dafür keine greifbaren Beweise. Doch selbst wenn es uns gelungen wäre, den Mann als Leiche aufzufischen, hätte er dann doch nicht nach Sibirien zurückgeschickt werden können. Nein… lebend mußten wir den Burschen in die Hand bekommen… wahrlich, eine dumme Geschichte, die der Polizei nicht viel Ehre macht!
– O, Herr Eck, ein andermal werden wir mehr Glück haben,« antwortete der Polizist, der sich mit den Fehlschlägen in seinem Berufe ruhiger abfand…
Der Brigadier schüttelte den Kopf, ohne seinen Mißmut zu verhehlen.
Draußen wütete der Sturm jetzt mit einer Heftigkeit ohnegleichen. Die Eingangstür knarrte in ihren Angeln, als wollte sie diese herausreißen. Der große Ofen hörte wie erstickt manchmal zu knattern auf und dröhnte dann wieder wie ein Hochofen. Man hörte in der Tannenwaldung die Äste knicken und brechen, die dann zum Teil auf das Dach des Kabaks geschleudert wurden, als sollten sie es einschlagen.
»He, da macht sich ja die Arbeit der Holzfäller ganz allein, sagte einer der Bauern, die brauchen ja ihre Ladung nur zusammenzulesen!
– Es ist auch das richtige Wetter für Verbrecher und Schmuggler, setzte der Polizist hinzu.
Der Brigadier konnte etwas von seinem Gesicht sehen. (S. 69.)
– Ja, wie für solche Burschen geschaffen, antwortete Eck, doch deshalb braucht man sie nicht nach Belieben schalten und walten zu lassen!… Es steht fest, daß hier eine schlimme Bande ihr Wesen treibt; aus Tarvart wird ein Einbruch und aus Karkus ein Mordversuch gemeldet. Ja, die zwischen Riga und Pernau ist jetzt höchst unsicher. Die Verbrechen vermehren sich, und den Verbrechern gelingt es in den meisten Fällen zu entwischen. Und doch, was wagen sie denn, wenn sie sich abfangen lassen?… In Sibirien Salz zu fördern, und das ängstigt sie nicht. Früher, wo es ein Tänzchen in der Hanfschlinge galt, da mußte sich einer die Sache überlegen. Die Galgen sind jetzt aber zusammengebrochen, wie das Kreuz des Kabaks Meister Kroffs…
– Man wird sie schon wieder aufrichten, meinte der Polizist.
– Die höchste Zeit dazu wär’ es wirklich,« versicherte Eck.
Wie hätte ein Polizeibrigadier auch beistimmen können, daß die für politische Verbrechen beibehaltene Todesstrafe für Vergehen gegen das gemeine Recht abgeschafft worden war!… Das ging über seinen Verstand und geht ja ebenso über den Verstand vieler guten Leute, die nicht zur Polizei gehören.
»Nun aber vorwärts, mahnte Eck, indem er sich schon zum Aufbruch fertig machte. Ich muß mit dem Brigadier der fünften Abteilung in Pernau zusammentreffen, da ist keine Zeit mehr zu verlieren!«
Bevor er aufstand, klopfte er erst noch auf den Tisch.
Kroff kam sofort herbeigelaufen.
»Wieviel, Kroff? fragte er und holte einiges Kleingeld aus der Tasche.
– Das wissen Sie ja selbst, Brigadier, erwiderte der Schenkwirt. Bei mir gilt für alle nur der gleiche Preis.
– Auch für die, die in deinen Kabak kommen, wo sie wissen, daß du sie weder nach Papieren noch nach ihrem Namen fragst?
– Ich gehöre nicht zur Polizei, antwortete Kroff ziemlich kurz.
– O alle Gastwirte sollten dazu gehören, dann wäre wohl mehr Ruhe und Frieden im Lande! entgegnete der Brigadier. Nimm dich in Acht, Kroff, daß man dir nicht eines schönen Tages die Bude zumacht, wenn du sie nicht von Schmugglern und vielleicht noch schlimmeren Gesellen rein hältst!
– Ich gebe dem zu trinken, der mich bezahlt, antwortete der Gastwirt, und ich weiß ebensowenig, wohin meine Gäste gehen, wie ich von ihnen wußte, woher sie kamen.
– Gleichviel, Kroff! Stelle dich nur nicht taub, wenn ich mit dir rede, du könntest’s sonst noch einmal an den Ohren fühlen. Nun, gute Nacht… auf Wiedersehen!«
Der Brigadier Eck erhob sich, bezahlte die Zeche und ging, der Polizist hinter ihm, auf den Ausgang zu. Die anderen Gäste folgten seinem Beispiele, denn das schlechte Wetter verlockte sie nicht, noch länger im Kabak »Zum umgebrochenen Kreuze« sitzen zu bleiben.
In diesem Augenblick öffnete sich aber die Tür, die vom Sturme dann heftig wieder zugeschlagen wurde.
Herein traten zwei Männer, deren einer den anderen, welcher hinkte, am Arme führte.
Das waren Poch und sein Reisegefährte, die auf der Landstraße mit der Post verunglückt waren.
Der unbekannte Reisende erschien wie immer mit seinem Mantel verhüllt und mit über den Kopf gezogener Kapuze, so daß man sein Gesicht nicht sehen konnte.
Dieser richtete zuerst das Wort an den Schenkwirt.
»Unser Postwagen ist zweihundert Schritt von hier zerbrochen, begann er. Der Postillon und der Schaffner haben sich nach Pernau auf den Weg gemacht und wollen uns morgen beizeiten hier abholen. Können Sie uns für die Nacht wohl zwei Zimmer geben?
– Gewiß, antwortete Kroff.
– Eines brauch’ ich für mich, setzte Poch hinzu, und womöglich mit gutem Bette.
– Das sollen Sie haben, versprach Kroff. Sind Sie etwa verletzt?
– Eine Hautabschürfung am Beine, erwiderte Poch. Eine Sache ohne Bedeutung.
– Das zweite Zimmer nehme ich in Beschlag,« ließ sich der Reisende hören.
Als er sprach, erschien es Eck immer, als ob ihm diese Stimme bekannt wäre.
»Sapperment, sagte er für sich, ich möchte gleich darauf schwören… das ist doch…«
Seiner Sache zwar nicht ganz sicher, trieb ihn doch ein polizeilicher Instinkt, sich über seine Vermutung näher zu unterrichten.
Inzwischen hatte sich Poch an einem der Tische niedergesetzt und darauf seine noch immer an der Kette hängende Mappe gelegt.
»Ein Zimmer, wendete er sich an Kroff, nun ja, das ist ganz schön; solch eine Hautwunde hindert mich aber nicht, zu essen, und ich habe tüchtigen Hunger.
– Sofort sollen Sie ein Abendbrot erhalten, antwortete der Wirt.
– Bitte, so schnell wie möglich!« rief Poch ihm nach.
Da trat der Polizeibrigadier an ihn heran.
»Nun wahrlich, Herr Poch, sagte er, das ist ja ein Glück, daß Sie nicht ernster verletzt worden sind!
– Ah, rief der Bankbeamte, da ist ja der Herr Eck. Guten Tag, Herr Eck, oder vielmehr Guten Abend!
– Guten Abend, Herr Poch!
– Sie sind wohl auf einem Streifzuge hier?
– Wie Sie sehen. Ihre Verletzung ist also wirklich unbedeutend?
– Morgen wird kaum noch etwas davon zu sehen sein.«
Kroff hatte schon Brot, kalten Speck und die Teetasse auf den Tisch gesetzt. Hierauf wandte er sich an den anderen Reisenden.
»Und Sie mein Herr?…
– Ich bin nicht hungrig. Weisen Sie mir mein Zimmer an, denn ich möchte bald schlafen. Wahrscheinlich warte ich die Rückkehr des Postschaffners gar nicht ab und mache mich schon früh vier Uhr auf den Weg.
– Wie es Ihnen beliebt,« antwortete der Schenkwirt.
Er führte den Reisenden hierauf in das links neben der Gaststube liegende Zimmer, das rechts gelegene hatte er für den Bankbeamten bestimmt.
Während der Unbekannte aber sprach, hatte sich seine Kapuze etwas nach rückwärts verschoben, so daß der ihn beobachtende Brigadier etwas von seinem Gesicht sehen konnte. Das genügte ihm.
»Ja, ja, murmelte er für sich, er ist es. Warum will er denn so frühzeitig aufbrechen und nicht einmal die Post abwarten, um damit weiter zu fahren?«
Man weiß ja, auch die harmlosesten Umstände erscheinen den Leuten von der Polizei allemal etwas auffallend.
»Und wohin will er zu Fuß?« fragte sich Eck, zwei Fragen, auf die der Reisende gewiß nicht geantwortet hätte, wenn sie ihm vorgelegt worden wären.
Dieser schien übrigens nicht bemerkt zu haben, daß der Brigadier ihn scharf angesehen und ihn zu erkennen geglaubt hatte. Er begab sich also in das ihm von Kroff angewiesene Zimmer.
Eck trat wieder an Poch heran, der mit gutem Appetit speiste.
»Jener Reisende war mit Ihnen im Postwagen? fragte er.
– Jawohl, Herr Eck, ich habe aber keine vier Worte aus ihm herausholen können.
– Sie wissen auch nicht, wohin er sich begibt?
– Nein, er ist in Riga eingestiegen, und ich glaube, er wollte nach Reval. Wenn Broks hier wäre, könnte er uns darüber Aufschluß geben.
– O, das wäre wohl nicht der Mühe wert«, meinte der Brigadier.
Kroff hörte von diesem Zwiegespräch gerade soviel wie jeder uninteressierte Gastwirt, der sich nicht darum bekümmert, wer seine Gäste sind. Er ging in der Schenkstube hier und dort hin, während die Bauern und Holzfäller sich verabschiedeten und ihm Gute Nacht wünschten.
Der Brigadier, der es mit dem Fortgehen jetzt gar nicht mehr so eilig zu haben schien, zog den plauderlustigen Poch, dem das sehr gelegen kam, nochmals ins Gespräch.
»Und Sie, Sie gehen nach Pernau? fragte er.
– Nein, nach Reval, Herr Eck.
– Im Auftrage des Herrn Johausen?
– Ja, in dessen Auftrage,« antwortete Poch.
Mit einer unwillkürlichen Bewegung zog er die auf dem Tische liegende Mappe mit den Wertpapieren näher an sich heran…
»Das ist ja ein Wagenunfall, der Ihnen mindestens zwölf Stunden Verspätung kosten wird.
– Nur zwölf Stunden dann, wenn Broks seinem Versprechen gemäß morgen frühzeitig wiederkommt, und dann könnt’ ich immer noch binnen vier Tagen in Riga zurück sein… zur Feier meiner Hochzeit…
– Mit der hübschen Zenaïde Parenzof… ja ja… weiß schon…
– Das glaub’ ich gern… Sie wissen eben alles!
– Na, das denn doch nicht, so weiß ich zum Beispiel schon nicht, wohin sich Ihr Reisegefährte begeben wird; danach, daß er morgen so früh fortgehen will, ohne auf Sie zu warten, scheint es allerdings, daß er in Pernau zu bleiben gedenkt.
– Das wäre wohl möglich, meinte Poch, und wenn ich den Mann nicht wiedersehen sollte, so wünsch’ ich ihm glückliche Reise. Doch sagen Sie, Herr Eck, übernachten Sie heute auch hier im Wirtshause?
– Nein, Poch, uns ruft eine Zusammenkunft nach Pernau, und wir werden sehr bald aufbrechen. Sie werden ja, das wünsch’ ich Ihnen, nach einem tüchtigen Abendessen gut schlafen… lassen Sie nur Ihre Mappe nicht abhanden kommen.
– Die hängt an mir so fest wie die Ohren am Kopfe! erwiderte der Bankbeamte mit hellem Lachen.
– Vorwärts nun, rief der Brigadier seinem Untergebenen zu. Wir wollen uns aber bis ans Kinn fest einhüllen, sonst dringt uns der Sturm bis zu den Knochen hindurch. Gute Nacht, Poch!
– Gute Nacht, Herr Eck.«
Die beiden Polizeiagenten öffneten die Tür, die Kroff erst durch eine Querstange an der Innenseite und dann noch durch zweimaliges Umdrehen eines großen Schlüssels verschloß, den er sofort wieder abzog.
Um diese Stunde war kaum noch zu erwarten, daß jemand im »Umgebrochenen Kreuze« wegen Nachtquartiers vorsprechen würde, war es doch schon eine Seltenheit, daß zwei Reisende bis zum nächsten Morgen zwei Zimmer in Anspruch genommen hatten, und ohne diesen Unfall der Post wäre der Schenkwirt in seinem vereinsamten Kabak wie gewöhnlich allein gewesen.
Inzwischen hatte Poch seine Mahlzeit mit großem Appetit verzehrt. Speise und Trank, mehr brauchte es kaum, seinen Kräften wieder aufzuhelfen, und das Bett würde nun vollenden, was der Tisch so gut begonnen hatte.
Ehe Kroff sich in sein Zimmer zurückzog, wartete er, bis Poch dasseinige eingenommen hatte. Er hielt sich nahe dem Ofen, aus dem zuweilen infolge des Sturmes dicker Rauch hervorquoll, der das ganze Gastzimmer mit warmen Schwaden erfüllte.
Kroff bemühte sich dann, den Rauch mit einer hin-und hergeschwenkten Serviette zu vertreiben, deren Falten dabei wie eine Peitsche klatschten.
Das auf dem Tische stehende Talglicht flackerte dazu hoch auf und ließ die Schatten aller Gegenstände in seinem Scheinfelde tanzen.
Draußen schlugen so ungestüme Windstöße an die Fensterläden, daß man glauben konnte, es poche einer kräftig dagegen.
»Hörten Sie nicht eben… sagte Poch lauschend, als die Tür unter einem so gewaltsamen Stoße zitterte und knarrte, daß man sich über die Ursache wohl täuschen konnte.
– Das ist niemand, versicherte der Gastwirt, draußen ist bestimmt kein Mensch. An dergleichen bin ich gewöhnt. Im tiefen Winter haben wir oft noch weit schlimmeres Wetter.
– Ja freilich, meinte Poch, wer sollte sich auch diese Nacht noch auf der Landstraße befinden, außer verdächtigem Gesindel und Polizisten.
– Gewiß… Sie haben damit völlig recht.«
Es war jetzt bald neun Uhr. Der Bankbeamte erhob sich, nahm seine Mappe sorgsam unter den Arm, ergriff dann das angezündete Licht, das Kroff ihm hinhielt. und begab sich nach seinem Zimmer.
Der Gastwirt hielt noch eine alte Laterne mit großen Scheiben in der Hand, die ihm als Leuchte dienen sollte, wenn sich die Tür hinter Poch geschlossen hatte.
»Wollen Sie sich denn nicht niederlegen? fragte dieser noch vor dem Betreten seines Zimmers.
– O doch, antwortete Kroff, ich muß nur erst noch meinen allabendlichen Rundgang machen.
– Durch Ihr ganzes Anwesen?
– Jawohl, überallhin; ich muß da nachsehen, ob die Hühner im Stalle auf den Stangen sitzen und in Sicherheit sind, denn zuweilen fehlen mir am Morgen eines oder zwei.
– Aha, bemerkte Poch, die Füchse.
– Die Füchse und auch die Wölfe. Diesen verwünschten Burschen macht es keine Schwierigkeit, über die Hecke zu springen. Da das Fenster meiner Stube nach dem Garten hinausgeht, brenne ich ihnen wohl manchmal eine Portion Blei aufs Fell. Wenn Sie also einen Schuß hören sollten, so beunruhigen Sie sich deswegen nicht.
– O, versicherte Poch, wenn ich so schlafe, wie ich hoffe, wird mich auch kein Kanonendonner wecken. Was ich noch sagen wollte, ich habe keine so große Eile, weiter zu kommen. Kann mein Reisegefährte nicht zeitig genug aufstehen, so ist das seine Sache. Mich lassen Sie ruhig bis in den hellen Tag hinein schlafen.
Nach wenigen Schritten war er in der Finsternis der Nacht verschwunden. (S. 76.)
Das Bett zu verlassen wird es noch Zeit genug sein, wenn erst Broks von Pernau zurückgekehrt und der Wagen wieder in stand gesetzt ist.
– Wie Sie wünschen, antwortete der Gastwirt. Es wird Sie niemand eher wecken, und wenn der andere Reisende weggehen will, werde ich schon dafür sorgen, daß Sie durch kein Geräusch gestört werden.«
Vor Ermüdung herzhaft gähnend, begab sich Poch nun in sein Zimmer, dessen Tür er von innen sorgfältig abschloß.
Kroff befand sich in der von seiner Laterne kaum erhellten Gaststube. Hier ging er an den Tisch, woran der Bankbeamte gesessen hatte, und schaffte Teller, Tasse und Teemaschine bei Seite. Als ordnungsliebender Mann verschob er nicht auf morgen, was er noch heute tun konnte.
Hierauf begab sich Kroff nach der Gittertür der Umzäunung und öffnete sie.
An dieser – der nordöstlichen – Seite hatte der Sturm etwas weniger Gewalt; der Anbau an der Rückwand des Hauses lag einigermaßen geschützt. Darüber hinaus aber fegte der Wind so heftig einher, daß der Gastwirt es für ratsamer fand, sich ihm gar nicht erst auszusetzen. Heute mußte ihm ein Blick nach dem Geflügelhof hin genügen.
Innerhalb der Umzäunung war nichts Verdächtiges zu bemerken, vor allem keiner der beweglichen Schatten, die die Anwesenheit eines Wolfes oder Fuchses verraten hätten.
Kroff leuchtete mit seiner Laterne nach allen Richtungen hinaus, und da er nichts Auffallendes wahrnahm, ging er wieder nach der Gaststube zurück.
Gewohnt, das Feuer im Ofen nicht erst verlöschen zu lassen, legte er noch mehrere Stücke Torf darauf, blickte noch einmal überall umher und zog sich dann endlich in sein Zimmer zurück.
Die Tür, die dicht neben der zum Garten führenden lag, bildete den Eingang zu dem Anbau, der das Privatzimmer des Gastwirtes enthielt, und dieses grenzte wieder an das, worin Poch jetzt schon in tiefem Schlummer lag.
Kroff ging, die Laterne in der Hand, hinein, und in der Gaststube herrschte nun völlige Finsternis.
Zwei bis drei Minuten hörte man noch die Schritte des Mannes, während er sich auskleidete, und dann zeigte ein dumpfes Geräusch an, daß er sich aufs Bett geworfen hatte.
Wenige Augenblicke später schlief in der Schenke alles, trotz des Aufruhrs der Elemente. des Windes, des Regens, trotz des lauten Seufzens des Sturmes, der durch die ihrer oberen Äste beraubten Tannen des Waldes fegte.
– – – – – – – – – – – – – -– – – – – – – Kurz vor vier Uhr morgens stand Kroff wieder auf und ging mit der Laterne in der Hand in die Gaststube.
Fast im gleichen Augenblicke öffnete sich die Zimmertür des zweiten Reisenden.
Dieser erschien in der Kleidung wie gestern, eingehüllt in seinen weiten Mantel und die Kapuze über den Kopf gezogen.
»Schon fertig, mein Herr? fragte Kroff.
– Wie Sie sehen, antwortete der Fremde, der zwei oder drei Papierrubel in der Hand hielt. Wieviel bin ich für die Nacht schuldig?
– Einen Rubel, antwortete der Gastwirt.
– Hier ist ein Rubel… nun, bitte öffnen Sie mir die Tür.
– Sogleich«, sagte Kroff, nachdem er sich beim Schein der Laterne überzeugt hatte, einen richtigen Rubelschein erhalten zu haben.
Den aus der Tasche hervorgeholten großen Schlüssel in der Hand, ging der Schenkwirt schon nach der Haustür, blieb aber noch einmal stehen und sagte zu dem Reisenden:
»Wollen Sie denn vor dem Weggehen gar nichts genießen?
– Nein, ich danke.
– Auch nicht ein Gläschen Wodka oder einen Schluck Schnaps?
– Gar nichts, sag’ ich Ihnen. Öffnen Sie mir nur schnell… ich habe Eile.
Kroff entfernte von der Tür die starken Holzstangen, die diese von innen mit zuhielten, dann steckte er den Schlüssel in das Schloß, dessen Riegel laut knarrte.
Noch war es draußen tief dunkel. Nur der Regen hatte aufgehört, der Wind pfiff aber noch mit Sturmesgewalt. Der Weg war mit abgebrochenen Zweigen bedeckt und zahllose Blätter flatterten in der Luft.
Der Reisende zog die Kapuze des Mantels fester über den Kopf und trat ohne ein weiteres Wort zu äußern hinaus. Schon nach wenigen Schritten war er in der Finsternis der Nacht verschwunden. Während er sich dann auf der Straße nach Pernau entfernte, legte Kroff die inneren Querstangen wieder vor und verschloß die Eingangstür des Kabaks »Zum umgebrochenen Kreuze«.
Sechstes Kapitel.
Slawen und Germanen.
Der erste Tee mit Butterbroten wurde im Speisezimmer der Gebrüder Johausen vorschriftsmäßig genau um neun Uhr morgens aufgetragen. Die – wie sie selbst sagten – »bis zur zehnten Dezimale getriebene« Pünktlichkeit war eine der hervortretendsten Eigenschaften der reichen Bankiers, und zwar im gewöhnlichen Leben nicht minder wie in der Geschäftsführung, gleichgültig ob es sich dabei darum handelte, Geld einzunehmen oder etwas zu bezahlen. Frank Johausen, der ältere der beiden Brüder, hielt vor allem darauf, daß Mahlzeiten, Besuche, das Aufstehen des Morgens und das Niederlegen des Abends mit militärischer Strenge geregelt blieben… das waren einmal die leitenden Grundsätze des Bankhauses, eines der bedeutendsten von Riga.
Am heutigen Morgen war der Samowar zur genannten Stunde nicht in Ordnung. Was war die Ursache? Nichts als ein bißchen Trägheit Trankels, des Hausdieners, dem ausschließlich die Bedienung seines Herrn oblag und der sich auch ohne Winkelzüge schuldig bekannte.
Als Herr Frank Johausen und sein Bruder, Frau Johausen und die kleine Margarete Johausen eintraten, war der Tee also noch nicht so weit fertig, daß man die auf dem Tisch bereit stehenden Tassen damit hätte füllen können.
Bekanntlich rühmen sich – wenn auch mit wenig Berechtigung – die reichen Deutschen der baltischen Provinzen, daß sie ihr Hausgesinde recht »väterlich« behandeln. Die Familie ist bei ihnen noch patriarchalisch geblieben und die Diener werden mehr als Kinder des Hauses betrachtet, gerade deshalb aber sind sie, das darf man ruhig glauben, auch gewissen väterlichen Bestrafungen fast schutzlos ausgesetzt.
»Trankel, warum ist der Tee noch nicht trinkfertig? fragte Frank Johausen.
– Ach, daß mir mein Herr und Gebieter verzeihe, antwortete Trankel kläglichen Tones, ich hatte nur vergessen…
– Das ist ja nicht das erste Mal, Trankel, fiel ihm der Bankier ins Wort, und ich habe Grund genug zu glauben, es werde auch nicht das letzte Mal gewesen sein.«
Als Zeichen ihrer Zustimmung die Achseln zuckend, hatten sich Frau Johausen und ihr Schwager dem aus hübsch verzierter Fayence errichteten Ofen genähert, worin zum Glück das Feuer nicht, wie die Flamme des Samowars, erloschen war.
Trankel schlug die Augen nieder, ohne ein weiteres Wort zur Entschuldigung zu wagen. Mußte er sich doch eingestehen, daß es nicht sein erster Verstoß gegen die von den Johausens so hoch gehaltene Pünktlichkeit war.
Der Bankier entnahm der Seitentasche seines Rockes jetzt ein Notizbuch mit losen Blättern, schrieb einige Zeilen auf eine Seite und übergab das Blatt dem Diener.
»Besorge das an seine Adresse, sagte er, und warte da auf Antwort.«
Trankel wußte offenbar schon, wohin er geschickt und welcher Art die Antwort des Empfängers sein würde. Er sagte auch kein Wort, sondern beugte nur den Kopf, küßte seinem Herrn die Hand und schritt auf die Tür zu, um sich nach dem Polizeibureau zu begeben.
Auf dem Blatte aus dem Notizbuche standen nur die Worte:
»Gut für fünfundzwanzig, meinem Diener Trankel aufzuzählende Stockhiebe.
Frank Johausen.«
Als der Diener hinausgehen wollte, rief ihm der Bankier nach:
»Du wirst nicht vergessen, die Empfangsbescheinigung mit zurückzubringen!«
Trankel wollte das gewiß nicht vergessen. Der Bankier hatte für jede von ihm verlangte Züchtigung entsprechend dem vom Polizeihauptmann aufgestellten Satz zu zahlen.
So ging es jener Zeit und geht es vielleicht noch heute in solchen Dingen her, in Kurland und Esthland übrigens ebenso wie in Livland und ohne Zweifel auch in manchen anderen Provinzen des Moskowiterlandes.
Beiläufig noch ein Wort über die Familie Johausen.
Die Bedeutung eines Beamten in Rußland ist ja wohl allgemein bekannt. Er ist dem strengen Reglement des Tchin unterworfen… jener Leiter mit vierzehn Sprossen, die alle Staatsbeamten vom untersten Range bis zu dem eines Geheimrates mühevoll erklimmen müssen.
Es gibt aber auch andere hohe Gesellschaftsklassen, die mit der Beamtenwelt nichts gemein haben, darunter in erster Reihe den Adel der baltischen Provinzen, der sich eines großen, durch wirkliche Machtmittel noch vermehrten Ansehens erfreut. Durchweg germanischen Ursprungs, ist er älter als der russische Adel und hat sich sehr wichtige Vorrechte zu sichern verstanden, darunter das, eigene Diplome auszustellen, die selbst die Mitglieder der kaiserlichen Familie anzunehmen sich nicht weigern.
Neben diesem Adel gibt es eine bürgerliche Klasse, die ihm zum Teil gleich, zum Teil sogar noch höher als jener dasteht, und zwar infolge ihres Einflusses auf die Provinz-und die Stadtverwaltung, und wie diese– wie erwähnt – fast ausschließlich von deutscher Abstammung. Sie umfaßt die Kaufleute und die Ehrenbürger, doch auch die etwas tiefer stehenden einfachen Bürger, die eine Art gesellschaftlicher Mittelklasse bilden. Zu den oberen Schichten gehören die Bankiers, die Reeder, die Künstler und die Kaufleute, die je nach der »Gilde«, in der sie eingetragen sind, eine gewisse Steuer dafür entrichten, daß sie mit dem Auslande Handel treiben dürfen. Unter der gesamten Bürgerschaft ist vor allem die obere Klasse gut gebildet, arbeitsam und gastfreundlich, und es läßt sich auch an ihrer Moralität und Rechtschaffenheit nicht im geringsten mäkeln. Zu denen, die von diesen obenan standen, gesellte die öffentliche Meinung mit vollem Rechte auch die Familie Johausen und das Bankgeschäft, dessen Kredit in Rußland wie im Ausland unerschütterlich fest stand.
Weit unter den privilegierten Klassen, die in allen baltischen Provinzen gewissermaßen die Herren spielen, führen die Landleute, die Ackerbauer und auch die ansässigen Hofeigentümer – an Zahl etwa eine Million – ein ärmliches Leben, obwohl sie die eigentlich eingeborenen Bewohner sind, im Grunde Letten, die ihre uralte slawische Sprache beibehalten haben, während das Deutsche die Umgangs-und Verkehrssprache der Stadtbevölkerung geblieben ist. Die Leute sind ja nicht mehr Leibeigene, sie werden aber noch häufig gleich solchen behandelt, zuweilen sogar gegen ihren Willen verheiratet, wenn es sich darum handelt, die Zahl der Familien zu vermehren, von denen die großen Herren das Recht haben, einen gewissen Zins einzuziehen.
Hieraus erklärt es sich wohl, daß der Beherrscher aller Reußen auf den Gedanken kam, diesen beklagenswerten Zustand der Dinge zu ändern, und daß seine Regierung sich bemühte, das slawische Element in die Ratskollegien und in die Verwaltung der Städte einzuführen. Das entfachte freilich einen Streit, dessen schreckliche Folgen wir im Laufe dieser Erzählung kennen lernen werden.
Der Hauptleiter des Bankhauses war der ältere der beiden Brüder, Frank Johausen. Der jüngere war unverheiratet. Der jetzt fünfundvierzig Jahre zählende Frank hatte eine Deutsche aus Frankfurt a. M. zur Gattin. Er war Vater zweier Kinder, eines Sohnes, Karl mit Namen, der eben ins neunzehnte Jahr eingetreten war, und eines zwölfjährigen Töchterchens. Karl vollendete jetzt seine Studien an der Universität in Dorpat, wo Jean, der Sohn Dimitri Nicolefs, gerade auch am Ende der seinigen stand.
Riga, dessen Gründung bis zum dreizehnten Jahrhundert zurückliegt, ist – es sei das hier wiederholt – weit mehr eine deutsche als slawische Stadt. Man erkennt ihren Ursprung schon an den Häusern mit ihrem nach der Straße liegenden hohen Treppengiebel, der das Dach abschließt, obwohl einige Bauwerke durch ihre merkwürdige Anordnung und ihre hohen, goldfarbigen Kuppeln eine Andeutung von byzantinischer Architektur aufweisen.
Riga ist jetzt (seit 1863) eine offene Stadt. Ihr wichtigster Platz ist der des Rathauses, das die eine Seite davon einnimmt und einen hohen Glockenturm mit dicken Zwiebelknaufen trägt, während man an der anderen Seite das »Schwarzhäupterhaus« bewundern kann, über dem sich spitze Glockentürmchen erheben, deren Wetterfahnen recht kläglich knarren, und das im Beschauer mehr einen wunderlichen als einen künstlerischen Eindruck hervorbringt.
An diesem Platze steht auch das Johausensche Bankgebäude, ein sehr schönes Bauwerk moderner Art. Die Geschäftsräume liegen darin im Erdgeschoß, die Empfangszimmer nehmen das erste Stockwerk ein. Das Haus liegt also im verkehrsreichsten Stadtteile, und dank dem Umfange seines Umsatzes und der Ausdehnung seiner Geschäftsverbindungen erfreut es sich in der Stadt eines beträchtlichen, ja eines ganz hervorragenden Einflusses.
Sehr enge Bande vereinigen die Familie Johausen. Die beiden Brüder verstehen einander in allen Dingen. Der ältere hat die Hauptleitung des Geschäftes, der jüngere hat besonders die Buchführung und das Rechnungswesen in der Hand…
»Besorge das an seine Adresse.« (S 78.)
Frau Johausen ist eine Natur, die sich so deutsch wie möglich gibt. Dabei bewahrt sie denn auch den Slawen gegenüber einen ungemeinen Stolz, und da die vornehme Welt in Riga sie stets mit hoher Achtung und unverkennbarer Freude empfängt, trägt das nur dazu bei, ihre nationale Eitelkeit noch weiter anzuregen.
Es ergibt sich hieraus, daß die Johausensche Familie in den vornehmen Bürgerkreisen der Stadt den ersten Rang einnahm, den ersten Rang aber auch in der finanziellen Welt der baltischen Provinzen. Nach außen genoß sie einen fast unbegrenzten Kredit bei der Russischen Staatsbank wegen ihres auswärtige Handels, ebenso bei der Bank von Volka-Kama, der Diskontobank und bei der internationalen Bank in Petersburg. Eine freiwillige Auflösung ihres Geschäftes hätte den Gebrüdern Johausen gewiß eines der größten Vermögen in den Ostseeprovinzen in den Schoß geworfen.
Frank Johausen war Mitglied des Stadtrates, und zwar eines der einflußreichsten Mitglieder, denn er verteidigte immer mit größter Zähigkeit seine Kaste. Man bewunderte oder pries ihn als den Vertreter der Ideen, die seit der Eroberung in den Köpfen der oberen Schichten tief Wurzel geschlagen hatten.
Gerade er mußte also von den Bestrebungen der Regierung, die starrsinnigen Rassen germanischen Blutes zu russifizieren, um so tiefer getroffen werden.
Die baltischen Provinzen wurden jener Zeit von dem Gouverneur Gorko verwaltet. Dieser, eine Persönlichkeit von hoher Intelligenz und sich der Schwierigkeiten seiner Aufgabe bewußt, unterhielt seine Beziehungen zur deutschen Bevölkerung mit vieler Klugheit, während er immer für den Sieg des slawischen Elementes tätig war. So suchte er eine Umänderung der öffentlichen Gewohnheiten herbeizuführen, ohne sich jemals roher, gewaltsamer Mittel zu bedienen. Streng, doch gerecht, sah er vorsichtig von allen Maßregeln ab, die einen Konflikt hätten herbeiführen können.
An der Spitze der Polizei stand der Oberst Raguenof, ein waschechter Russe. Weniger geschmeidig als sein Vorgesetzter, sah dieser hohe Beamte schon einen Feind in jedem Livländer, Esthen oder Kurländer, der nicht mit slawischer Muttermilch auferzogen worden war. Gegen fünfzig Jahre alt, war er ein kühner, schnell entschlossener Mann, ein überaus scharfer Polizist, der vor nichts zurückschreckte und den der Gouverneur nur mühsam in den gebotenen Schranken halten konnte. Er hätte, wenn das ausführbar war, lieber jedes Hindernis zertrümmert, statt es mit sanftem Griffe aus dem Wege zu räumen.
Es mag ein wenig auffallen, die bisher genannten Personen so eingehend geschildert zu sehen; aber wenn sie auch nicht sogleich besonders hervortreten, spielen sie doch eine wichtige Rolle in diesem gerichtlichen Drama, das infolge politischer Leidenschaften und Nationalitätenhaders in den baltischen Provinzen zu einem wahrhaft erschreckenden Ausbruch kommen sollte.
Nach dem Oberst Raguenof und im Gegensatz zu ihm sei der Leser auf den Major Verder hingewiesen, der in der Polizeiverwaltung dem vorigen zunächst untergeordnet war. Der Major ist germanischer Abstammung und zeigt bei der Ausübung seines Amtes oft die übermäßig strenge Pflichterfüllung seiner Rasse. Dabei hält er es freilich mehr mit den Deutschen, wie der Oberst mit den Slawen. Er verfolgt die einen mit Feuereifer und zeigt sich gegen die anderen milder. So wäre es trotz ihres Rangunterschiedes zwischen den beiden hohen Beamten schon häufig zu harten Zusammenstößen gekommen, wenn der General Gorko nicht rechtzeitig ausgleichend eingegriffen hätte.
Hierzu sei noch bemerkt, daß der Major Verder einen eifrigen Verbündeten in dem Brigadier Eck hatte, den wir schon im Anfange dieser Geschichte bei seiner Nachforschung nach dem Flüchtling aus den sibirischen Bergwerken kennen gelernt haben. Dieser bedurfte keiner besonderen Anregung, bei den ihm anvertrauten Aufträgen seine Pflicht zu erfüllen, er tat eher noch mehr, vorzüglich wenn es galt, die Fährte eines Slawen aufzuspüren. Von den beiden Herren Johausen wurde er besonders hoch geschätzt, denn er hatte diesen schon mehrfach persönlich gute Dienste erweisen können, die übrigens am Kassenschalter des Bankgeschäftes stets eine reichliche klingende Anerkennung gefunden hatten.
Unseren Lesern ist nun die Sachlage bekannt, ebenso das Gebiet, auf dem die Gegner zusammenprallen sollten: das der städtischen Wahlen. Hier war Frank Johausen entschlossen, seinen Platz zu behaupten, während Dimitri Nicolef ihm, gegen seinen Willen, gegenüberstand, auf den Schild gehoben von der russischen Beamtenschaft und von der niederen Volksklasse, deren Wahlberechtigung ein neuer Zensus nicht unbeträchtlich erweitert hatte.
Daß der einfache Privatlehrer, der vermögenslose und keinerlei wichtige Stellung einnehmende Mann, zu einem Wettkampfe mit dem mächtigen Bankier, dem Vertreter der höheren Bürgerschaft und des Adels, aufgefordert wurde, bildete ein Wahrzeichen, dessen Bedeutung alle weiterblickenden Leute nicht verkennen konnten: wies es doch darauf hin, daß die politischen Verhältnisse der Provinzen vielleicht schon in naher Zukunft zum Nachteile der gegenwärtigen Machthaber in städtischen und Verwaltungsangelegenheiten eine Veränderung erfahren könnten.
Die Gebrüder Johausen zweifelten jedoch gar nicht daran, im bevorstehenden Wahlkampfe wenigstens den ihnen entgegengestellten Wettbewerber glatt zu besiegen. Die zunehmende Volkstümlichkeit Dimitri Nicolefs hofften sie schon im Keime zu ersticken. Vor Ablauf von sechs Wochen würde es sich ja zeigen, ob man ein Ehrenamt einem elenden Schuldner anvertrauen könnte, der im Zivilprozeß verurteilt und dessen Besitztum infolgedessen beschlagnahmt war, so daß er sich, zugrunde gerichtet und wohnungslos, auf die Straße gesetzt sah.
Binnen kaum zwei Monaten, am 15. Juni, verfiel bekanntlich der von Dimitri Nicolef in Anerkennung der Schulden seines Vaters zugunsten der Firma Johausen unterschriebene Schuldschein. Es handelte sich dabei um achtzehntausend Rubel. für einen bescheidenen Privatgelehrten um eine ungeheure Summe, die dieser schwerlich abzutragen in der Lage sein würde. Die Gebrüder Johausen glaubten behaupten zu dürfen, daß die Zahlung, die jenen aus ihrer Gewalt erlösen könnte, bis zum Verfallstage nicht geleistet sein werde. Schon bei den letzten Abzahlungen hatten sich ernste Schwierigkeiten gezeigt und nachher schienen sich die Geldverhältnisse Nicolefs keineswegs gebessert zu haben. Nein, es mußte ihm unmöglich sein, seinen Verpflichtungen gegen das Bankhaus nachzukommen. Verlangte er Aufschub. so würde man unerbittlich bleiben. Das sollte weniger den Schuldner als solchen treffen, als den politischen Gegner, der dadurch mit einem Schlage abgetan würde.
Die Gebrüder Johausen ahnten dabei noch gar nicht, daß ein unvorhergesehenes und ganz unerwartetes Ereignis ihren Plänen noch weiter zu Hilfe kommen sollte. Sie bekamen damit den Blitz des Himmels in die Hand, den sie kaum zu gelegenerer Zeit und vernichtender auf das Haupt ihres volkstümlichen Rivalen schleudern konnten.
Trankel hatte sich auf das Geheiß seines Herrn beeilt – vielleicht ist das letzte Wort aber nicht ganz zutreffend – diesem Folge zu leisten. Mit beschämter Miene und zögernden Schrittes, doch als ein Mann, der den Weg zum Polizeiamte aus mehrfacher Erfahrung kannte, verließ er das Bankhaus, ließ das schloßartige Gebäude mit gelben Mauern, den Amtssitz des Gouverneurs, zur Linken, wand sich durch die Buden und Stände des Marktplatzes, wo alles zu verkaufen war, was irgend verkäuflich schien, wie Trödelkram aller Art, Kleinigkeiten von zweifelhaftem Werte, abgelegte und stark abgenutzte Kleidungsstücke, religiöse Sachen, Küchengeräte usw. Um sich Mut zu machen, leistete sich der vergeßliche Hausdiener noch eine Tasse heißen Tee mit einer Zugabe von Wodka, womit die wandernden Händler stets ein gutes Geschäft machen, dann warf er noch einen flüchtigen Blick auf die netten Bleicherinnen am Waschplatze, durchschritt mehrere Straßen, wo karrenziehende Sträflinge unter Führung eines grimmigen Aufsehers dahintrabten, aber voller Achtung gegen die Leute, die eine Verurteilung zum Bagno wegen eines Vergehens gegen die Disziplin doch noch nicht ehrlos macht, und endlich traf er ruhig im Polizeiamte ein.
Hier wurde der Hausdiener von den Polizisten wie ein alter Bekannter empfangen. Mehrere streckten ihm die Hand entgegen, die er als Antwort herzhaft drückte.
»Na, da bist du ja einmal wieder, Trankel, sagte einer der Polizisten. Wir haben dich doch recht lange nicht gesehen, Väterchen, das mag wenigstens sechs Monate her sein.
– Nun, so lange ist es nicht, erwiderte Trankel.
– Wer schickt dich denn heute?
– Mein Hausherr, Herr Frank Johausen.
– Aha, und da möchtest du wohl mit dem Major Verder sprechen?
– Ja, wenn das möglich ist.
– Er ist soeben in sein Bureau gekommen, Trankel, und wenn du dir die Mühe geben willst, ihn da aufzusuchen, wird er gewiß erfreut sein, dich zu empfangen.«
Sich geschmeichelt fühlend, begab sich Trankel nach dem Zimmer des Majors und klopfte bescheiden an die Tür. Auf ein kurzes von innen heraustönendes »Herein!« trat er ein.
Der Major saß vor seinem Schreibtische und blätterte in einem Aktenbündel. Er wendete sofort die Augen dem Eingetretenen zu und sagte:
– Ich selbst, Herr Major.
– Und du kommst von…
– Von Herrn Johausen.
– Ist’s denn etwas Schlimmes?
– Ach, nur der Samowar, der heute Morgen mit aller Gewalt nicht in Gang kommen wollte…
– Weil du jedenfalls vergessen hattest ihn anzuzünden, nicht wahr? bemerkte der Major lächelnd.
– Das wäre wohl möglich.
– Na… wie viele denn?
– Hier ist der Bestellschein.«
Trankel übergab damit dem Major den Zettel, den sein Herr ihm ausgehändigt hatte.
Der Major las die wenigen Worte.
»Oh… eine Kleinigkeit, sagte er.
– Hm! brummte Trankel.
– Nur fünfundzwanzig!«
Offenbar hätte Trankel es vorgezogen, mit einem Dutzend davonzukommen.
»Nun sagte der Major, du sollst bedient werden, ohne lange warten zu müssen.«
Er klingelte nach einem diensttuenden Polizisten.
Dieser trat ein und blieb in stramm militärischer Haltung stehen.
»Fünfundzwanzig Stockhiebe, befahl der Major, doch nicht zu stark, so wie für einen Freund. – Ah, wenn sich’s um einen Slawen handelte! Geh, Trankel, entkleide dich, und wenn die Sache vorüber ist, kommst du wieder und holst dir bei mir den Empfangschein.
Trankel verließ das Amtszimmer und folgte dem Polizisten nach dem Raum, wo die Bestrafung erfolgen sollte.
Man würde ihn ja als Freund, als treuen Kunden behandeln, so daß er nicht gar so schwer zu leiden hätte. Trankel legte Jacke und Hemd ab, um den Rücken zu entblößen, und beugte sich dann nieder, während der Polizist mit einem Bambusstocke in der Hand sich schon vorbereitete, loszuschlagen.
In dem Augenblicke aber, wo der erste Hieb fallen sollte, entstand vor der Tür des Polizeiamtes ein gewaltiger Lärm. Schwer keuchend kam ein Mann hereingestürzt und rief:
»Der Major Verder!… Der Major Verder!«
Der schon über Trankels Rücken schwebende Stock hatte sich wieder gesenkt, und der Polizist hatte die Tür aufgerissen, um zu sehen, was draußen vorging.
Trankel, der sich dafür nicht weniger interessierte, hatte nichts besseres zu tun, als ebenfalls hinauszulugen.
Auf den Lärm war auch schon der Major Verder aus seinem Bureau gekommen.
»Was ist denn los?« fragte er.
Der keuchende Mann trat, die Mütze in der Hand, an ihn heran und überreichte ihm ein Telegramm mit den Worten:
»Es ist ein Verbrechen begangen worden…
– Wann?..
– In vergangener Nacht.
– Was für ein Verbrechen?
– Ein Mord.
– Wo?
– Auf der Landstraße von Pernau in der Schenke ‘Zum umgebrochenen Kreuze’.
– Und wer ist das Opfer?
– Der Bankbote des Hauses Johausen.
– Wie… Der arme Poch! rief Trankel. Mein Freund Poch?
– Kennt man einen Beweggrund zu der Schandtat?
– Es liegt ein Raub vor, denn die Brieftasche Pochs ist leer in dem Zimmer gefunden worden, worin er ermordet worden ist.
– Weiß man, was diese enthalten hatte?
– Noch nicht, Herr Major; das Bankhaus wird darüber aber Auskunft geben können.«
Die aus Pernau eingetroffene Depesche enthielt alles das, was der Überbringer schon im Telegraphenamte erfahren hatte.
Der Major wendete sich an die Unterbeamten und sagte:
»Du… du machst dem Richter Kerstorf dienstliche Meldung.
– Sofort, Herr Major.
– Du, du läufst zum Doktor Hamine…
– Zu Befehl, Herr Major.
– Und ihr sagt beiden, unverzüglich nach der Johausenschen Bank zu kommen, wo ich die Herren erwarten würde.«
Die Polizisten eilten aus dem Polizeiamte davon, und wenige Minuten später machte sich der Major Verder auf den Weg nach dem Bankhause.
So kam es, daß Trankel bei der Unruhe, die die Nachricht von jenem Verbrechen verursacht hatte, heute die fünfundzwanzig Stockschläge nicht bekam, zu denen er wegen Versehens in seinem Dienste verurteilt worden war.
Siebentes Kapitel.
Polizeiliche Besichtigung.
Kaum zwei Stunden später rollte ein Wagen mit größter Schnelligkeit auf der Straße nach Pernau hin. Es war das weder eine Telega noch eine Postkutsche, sondern der Reisewagen des Herrn Frank Johausen, doch bespannt mit Postpferden, die an den gewöhnlichen Stellen gewechselt werden sollten. So schnell die Fahrt auch ging, konnte man doch nicht darauf rechnen, den Kabak »Zum umgebrochenen Kreuze« vor Anbruch der Nacht zu erreichen. Der Wagen sollte deshalb an der letzten Pferdewechselstelle Halt machen und beizeiten am nächsten Tage an der Schenke eintreffen.
In dem Landauer saßen der Bankier, der Major Verder, der Doktor Hamine, der den Tatbestand aufnehmen sollte, ferner der mit der Untersuchung des Falles betraute Richter Kerstorf und ein Aktuar. Den hinteren Sitz nahmen zwei Polizisten ein.
Hier noch ein Wort über den Richter Kerstorf, da die anderen Personen in unserer Erzählung schon vorgekommen und wohl hinreichend bekannt sind.
Dieser Beamte, ein Slawe von Geburt und ungefähr fünfzig Jahre alt, erfreute sich bei seinen Kollegen und auch beim Publikum der größten Hochachtung. Jedermann mußte den Scharfsinn, die Findigkeit bewundern, die er bei der Klarstellung aller ihm anvertrauten Kriminalfälle entwickelte. Selbst von zweifelloser Ehrenhaftigkeit, unterlag er niemals einer Beeinflussung irgend welcher Art und blieb jedem Drucke, woher er auch kommen mochte, unzugänglich; auch die Politik war seinen Entschließungen gegenüber ganz ohne Einfluß. Man konnte den Mann mit Recht das verkörperte Gesetz nennen. Wenig mitteilsam und sehr zurückhaltend, sprach er kaum, gab sich dafür aber um so mehr seinen Gedanken hin.
In dieser Angelegenheit herrschten also, wie man in der Physik sagt, zwei einander entgegengesetzte Strömungen, die zu vereinigen gewiß viele Mühe kosten mußte, wenn die Politik mit ins Spiel kam: einerseits der Bankier Johausen und der Major Verder, beide von germanischer Abkunft, anderseits der Doktor Hamine, ein geborener Slawe. Nur der Richter Kerstorf stand erhaben über den Rassenleidenschaften, die jetzt in den baltischen Provinzen gärten.
Während der Fahrt wurde die Unterhaltung – doch mit häufigen Unterbrechungen – nur von dem Bankier und dem Major geführt.
Frank Johausen verhehlte nicht das tiefe Mitleid, das der Tod des unglücklichen Poch in ihm erweckt hatte. Er hegte eine ganz besondere Achtung für diesen Angestellten der Firma, der ihr schon dreißig Jahre mit vollster Ehrlichkeit und einem Pflichteifer ohne gleichen gedient hatte.
Trankel nahm eine Tasse heißen Tee mit einer Zugabe von Wodka zu sich. (S. 84.)
»Und die arme Zenaïde, setzte er noch hinzu, wie herzbrechend wird ihr Schmerz sein, wenn sie die ruchlose Ermordung dessen erfährt, dem sie jetzt die Hand zum Bunde reichen sollte!«
In der Tat war ja die Hochzeit in Riga auf die nächsten Tage festgesetzt gewesen, und jetzt sollte der Bankbeamte statt nach der Kirche, nach dem Friedhofe geleitet werden!
Beklagte der Major auch das traurige Schicksal des Opfers, so beschäftigte ihn doch noch weit mehr die Festnahme des Mörders. Darüber ließ sich freilich nichts sagen, bevor der Schauplatz des Verbrechens besucht, und bevor man wußte, unter welchen Verhältnissen dieses begangen worden war. Vielleicht fand sich am Tatorte ein Hinweis, eine Fährte, die man verfolgen könnte. Der Major Verder war übrigens geneigt, in dieser Mordtat die Hand eines der Landstreicher zu erblicken, von denen gerade dieser Teil Livlands jener Zeit schwer heimgesucht wurde. Er hoffte jedoch, daß der Mörder aus dem »Umgebrochenen Kreuze«, dank den Polizistenabteilungen, die im Lande verteilt waren, der Hand der strafenden Gerechtigkeit nicht entgehen würde.
Die Aufgabe des Doktor Hamine sollte sich auf die gerichtsärztliche Besichtigung und Untersuchung des Leichnams beschränken. Diese wollte und mußte er abwarten, ehe er sich über den Fall aussprechen konnte. Augenblicklich beschäftigte, ja beunruhigte ihn sogar eine ganz andere Angelegenheit. Als er am vorigen Abend wie gewöhnlich nach der Vorstadt hinausgegangen war, um den Privatlehrer aufzusuchen, hatte er diesen nicht mehr in seinem Hause angetroffen, dagegen von Ilka erfahren, daß ihr Vater verreist wäre. Am nämlichen Tage hatte ihr Nicolef, der ihr vor seinem Fortgange überhaupt nicht zu Gesicht gekommen war, einfach mitgeteilt, daß er Riga für zwei bis drei Tage verlasse. Wohin er gehen wollte, darüber fehlte jede Andeutung, ebenso, ob die Reise schon am Tage vorher geplant gewesen war. Das ließ sich aber annehmen, da Nicolef seit gestern, wo er nach Hause gekommen war, keinen Brief erhalten hatte, der ihn vielleicht hätte abrufen können. Und doch hatte er davon an jenem Abend weder seiner Tochter, noch dem Doktor oder dem Konsul auch nur ein Wort gesagt.
War er ihnen da etwas nachdenklicher oder sorgenvoller erschienen? Vielleicht; doch einen so verschlossenen Mann fragt man ja nicht gern nach der Ursache seiner Sorgen. Gewiß war nur das eine, daß er am nächsten Morgen in früher Stunde Ilka mit wenigen Zeilen von seiner Abreise Mitteilung gemacht hatte. Dann war er fortgegangen, ohne das Ziel seiner Reise anzugeben. Der Doktor Hamine hatte Ilka also sehr beunruhigt verlassen, in einer Unruhe, die er auch selbst teilte.
Der Landauer rollte in schneller Fahrt dahin. Ein vorausgeschickter Berittener sorgte an den Wechselstellen dafür, daß das neue Gespann stets sofort zur Hand war. So ging keine Minute verloren, und hätte der Wagen Riga heute drei Stunden früher verlassen, so hätte die Untersuchung des Falles noch an demselben Tage beginnen können.
Die Luft war trocken und etwas kalt. Der Sturm des vorigen Tages war zu einer leichten nordöstlichen Brise abgeflaut. Nur die Landstraße, die unter dem Unwetter arg gelitten hatte, zwang die Pferde zu besonderer Anstrengung.
In der Mitte des Weges wurde den Reisenden eine halbe Stunde zur Einnahme einer Mahlzeit zugestanden. Sie begaben sich dazu in das mehr als bescheidene Gasthaus des betreffenden Dorfes und fuhren dann sogleich weiter.
Ihren Gedanken nachhängend, verhielten sich alle still. Bis auf wenige, dann und wann zwischen Frank Johausen und dem Major Verder gewechselte Worte herrschte im Wagen tiefes Schweigen. So schnell die Fahrt auf der Straße auch dahinging, meinte man doch, daß die Postillone sich zu viel Zeit nähmen. Der ungeduldigste der Reisegesellschaft, der Major Verder, trieb sie zuweilen zur Eile an, sparte wohl auch einen Fluch nicht und verstieg sich sogar zu Drohungen, wenn der Wagen bei stärkerem Aufstieg oder Fall der Straße langsamer vorwärts kam.
So kam es, daß es schon fünf schlug, als die letzte Wechselstelle vor Pernau erreicht wurde. Die tief am Horizonte stehende Sonne mußte bald verschwinden, und das »Umgebrochene Kreuz« war jetzt wohl noch ein Dutzend Werft entfernt.
»Meine Herren, begann da der Richter Kerstorf, ehe wir nach der Schenke kämen, würde es vollkommen dunkel sein, und das wäre ein ungünstiger Umstand, eine Untersuchung zu beginnen. Ich schlage Ihnen also vor, das bis morgen früh zu verschieben. Da wir in jener Schenke auch keine uns zusagenden Zimmer erhalten können, erscheint es mir ratsamer, die Nacht hier im Gasthause der Wechselstelle zu verbringen.
– Der Vorschlag läßt sich hören, meinte der Doktor Hamine, und wenn wir recht frühzeitig aufbrechen…
– Nun gut, bleiben wir also hier, sagte Frank Johausen, wenigstens wenn der Major Verder dagegen nichts einzuwenden hat.
- O… höchstens, daß meine Nachforschungen dadurch etwas verzögert werden, antwortete der Major, den es drängte, den Schauplatz des Verbrechens zu betreten.
– Der Kabak wird doch wohl seit heute Morgen überwacht? fragte der Richter.
– Jawohl, antwortete der Major Verder. Eine von Pernau eingegangen Depesche meldet mir, daß unverzüglich Polizisten dahin geschickt worden sind mit dem Auftrage, niemand ins Haus und den Schenkwirt mit keiner Person in Verbindung treten zu lassen.
– Unter diesen Umständen, bemerkte dazu der Richter, wird die Verzögerung um eine Nacht der Untersuchung keinen Eintrag tun.
– Nein, das zwar nicht, stimmte der Major ihm bei, doch gewährt sie dem Urheber des Verbrechens Zeit, vielleicht mehrere hundert Werst zwischen sich und das ‘Umgebrochene Kreuz’ zu bringen.«
Der Major sprach hier als Polizeibeamter, der mit der Ausübung seiner Funktionen eng verwachsen ist. Da der Abend aber näher kam und das Tageslicht in den Schatten der Dämmerung unterging, blieb es das Klügste, den nächsten Tag abzuwarten.
Der Bankier und seine Begleiter richteten sich also im Gasthaus der Wechselstelle so gut es anging ein, verzehrten ein Abendessen und verbrachten die Nacht mehr oder weniger bequem in den ihnen überlassenen Zimmern.
Am nächsten Tage, am 15. April, fuhr der Landauer schon beim Morgenrote weiter und langte um sieben Uhr vor dem Kabak an.
Die nach der Schenke abgesandten Polizisten aus Pernau empfingen die Angekommenen auf der Schwelle des Hauses. Kroff ging in der Gaststube hin und her; er hatte sich ohne Anwendung von Gewalt zurückhalten lassen. Warum sollte er auch seine Schenke verlassen?… Im Gegenteil: seine Anwesenheit war ja schon notwendig, die Polizisten mit allem zu versorgen, was sie bedurften. Er mußte doch auch den Vertretern der Behörde zur Verfügung bleiben, da ihn diese gewiß nach vielem zu fragen haben würden. Und welche Zeugenaussage war zur Einleitung der bevorstehenden Untersuchung denn wertvoller als die seinige?
Die Polizisten hatten obendrein darüber gewacht, daß im Innern wie außerhalb des Kabaks an der Lage der Dinge nichts verändert wurde, weder in den Zimmern des Hauses, noch auf der Landstraße in der nächsten Umgebung der Schenke. Den Bauern aus der Nachbarschaft war strengstens untersagt worden, nahe an diese heranzukommen, und eben jetzt hatten sich wohl ein halbes Hundert Neugierige in gemessener Entfernung versammelt.
Wie er versprochen hatte, war der Schaffner Broks, begleitet von dem Jemschik mit den Spannpferden und einem Stellmacher, früh sieben Uhr wieder am Kabak eingetroffen, wo er Poch und den anderen Reisenden zu finden hoffte und sie, nachdem der Wagen wieder in stand gebracht war, weiterbefördern wollte.
Welchen Schreck mußte nun Broks empfinden, als der Schenkwirt ihn zur Leiche Pochs führte, des unglücklichen Poch, der es so eilig gehabt hatte, nach Riga zurückzukommen, um hier seine Hochzeit zu feiern. Sofort sprang er auf eines der Postpferde, ließ den Postillon und den Stellmacher in der Schenke zurück, und ritt eiligst nach Pernau, um der Polizei von dem Vorgefallenen Meldung zu machen. Von hier ging dann ein Telegramm an den Major Verder in Riga, und auf dessen Anordnung hin begaben sich sofort mehrere Beamte der Kriminalpolizei nach dem »Umgebrochenen Kreuze«.
Broks selbst wollte auch nach dem Kabak zurückkehren, um sich den höheren Beamten, die von ihm jedenfalls eine Zeugenaussage verlangen würden, an Ort und Stelle zur Verfügung zu halten.
Der Richter Kerstorf und der Major Verder begannen inzwischen gleich nach ihrem Eintreffen die erste Untersuchung des Tatbestandes. Die Polizisten, die teils vor dem Hause auf der Landstraße, teils hinter diesem längs des Küchengartens standen oder am Saume des Tannengehölzes patrouillierten, erhielten Befehl, die Neugierigen in gebührender Entfernung zu halten.
Als der Richter, der Major, der Arzt und Herr Johausen die Gaststube betraten, fanden sie hier den Schenkwirt Kroff, der sie in das Zimmer führte, worin die Leiche des Bankbeamten lag.
Angesichts des unglücklichen Poch konnte Herr Johausen den Ausbruch seines Schmerzes nicht mehr bemeistern. Da lag er vor ihm, der langjährige Diener seines Hauses… blutlosen Hauptes, der Körper erstarrt nach dem Tode, der schon vor reichlich vierundzwanzig Stunden eingetreten war, ausgestreckt auf.. dem Bette und in der Lage, wie er während des Schlummers den Todesstoß erhalten hatte. Als Kroff am gestrigen Morgen gegen sieben Uhr keinerlei Geräusch in der Stube des Gastes gehört hatte, hütete er sich, dessen Wunsche entsprechend, ihn zu wecken; als dann aber eine Stunde später der Schaffner wiedergekommen war, hatten beide an die von innen verschlossene Tür geklopft. Keine Antwort. Voller Unruhe hatten sie hierauf die Tür mit Gewalt geöffnet und fanden sich nun hier einem noch nicht ganz erkalteten Leichnam gegenüber.
Auf einem Tische nahe beim Bette lag die Mappe mit den Anfangsbuchstaben der Firmenbezeichnung Johausens, deren Kette hing herunter, die fünfzehntausend Papierrubel aber, die Poch in Reval hatte abliefern wollen, waren – vorderhand spurlos – verschwunden.
Zunächst unterzog der Doktor Hamine die Leiche der gebräuchlichen Besichtigung. Der Tote hatte sehr viel Blut verloren. Eine rote, halb geronnene Lache zog sich vom Bette fast bis zur Türe hin. Das ganz steif gewordene Hemd Pochs zeigte in der Höhe der fünften Rippe, etwas links von der Brustmitte, die Spur eines Lochs, das einer Wunde von ziemlich eigner Gestalt darunter entsprach. Offenbar rührte sie von einem jener fünf bis sechs Zoll langen schwedischen Messer her, deren Klinge in einem Holzgriff mit federnder Zwinge befestigt ist. Diese Zwinge hatte auf der Haut rund um die Wundöffnung einen leicht erkennbaren Eindruck hinterlassen. Der Stoß mußte also mit großer Gewalt geführt worden sein, und ohne Zweifel hatte schon dieser einzige, der das Herz durchbohrte, genügt, den Tod sofort herbeizuführen.
Der Beweggrund zu der Untat lag klar zutage: es handelte sich hier um einen Raubmord, denn die Kassenscheine waren ja aus Pochs Mappe verschwunden.
Wie hatte der Mörder aber in das Zimmer gelangen können? Offenbar durch das nach der Straße hinaus gelegene Fenster, denn der Schenkwirt hatte, unterstützt von Broks, die von innen verschlossene Tür ja erst erbrechen müssen. Jeder Zweifel hierüber schwand übrigens, nachdem der Zustand des Fensters an der Außenseite untersucht worden war. Vorläufig konnte mit Sicherheit festgestellt werden und wurde durch mehrfache Blutspuren auf dem Kopfkissen bewiesen, daß Poch seine kostbare Mappe unter dieses Kissen gelegt und der Mörder sie mit blutigen Händen da gesucht und nach Entnahme der Kassenscheine auf den Tisch gelegt hatte.
Diese verschiedenen Merkzeichen von der Schandtat wurden mit größter Sorgfalt und im Beisein des Schenkwirtes festgestellt, der alle an ihn gerichteten Fragen klar und verständlich beantwortete.
Bevor sie ihn aber in ein eigentliches Verhör nahmen, wollten der Richter und der Major ihre Untersuchung außerhalb des Hauses durchführen. Dazu mußten sie um die ganze Schenke herumgehen, um nachzusehen, ob sich nicht hier irgendwelche Spuren von dem Mörder auffinden ließen. So gingen denn beide, begleitet von dem Doktor Hamine und dem Herrn Johausen, hinaus.
Kroff und die von Riga mitgekommenen Polizisten folgten ihnen nach, während die Bauern aus der Nachbarschaft reichlich dreißig Schritt weit entfernt bleiben mußten.
Zunächst wurde das Fenster des Zimmers, worin das Verbrechen begangen worden war, der eingehendsten Besichtigung unterzogen. Auf den ersten Blick überzeugte man sich da, daß der rechte Ladenflügel, der ohnehin in schlechtem Zustande war, mit einem Hebel aufgebrochen sein mußte, denn dessen Haspen war aus dem Fensterrahmen herausgerissen. Durch eine zertrümmerte Scheibe – die Scherben davon lagen noch am Boden umher – hatte der Einbrecher dann den Arm gesteckt und die Fensterwirbel umgedreht, so daß er nun durch das Fenster ins Zimmer steigen konnte, das er nach Verübung des Verbrechens auf demselben Wege auch wieder verlassen hatte.
Fußstapfen längs der Schenke fanden sich in großer Zahl, da sie sich in der, in der Nacht vom 13. zum 14. stark durchfeuchteten Erde sehr deutlich erhalten hatten. Sie kreuzten sich aber so vielfach, lagen zum Teil so übereinander und zeigten so verschiedene Formen der Abdrücke, daß sie als Merkzeichen nicht weiter in Betracht kommen konnten. Kein Wunder, da am Tage vorher und ehe die Polizisten aus Pernau eintrafen, so viele Neugierige das Haus umschwärmt hatten, ohne daß Kroff es hätte verhindern können.
Der Richter Kerstorf und der Major Verder begaben sich an das Fenster des Zimmers, worin der unbekannte Reisende übernachtet hatte. Hier war nichts besonders Auffälliges zu bemerken. Die Ladenflügel waren fest verschlossen und seit gestern, das heißt seit der Stunde, wo der Reisende sich so merkwürdig beeilt hatte, den Kabak zu verlassen, auch nicht wieder geöffnet gewesen. Die Fensterbank zeigte jedoch einige Schrammen, und ebenso die Außenmauer, als wären sie von den Schuhen einer Person, die hier herausgestiegen wäre, stark gestreift worden.
Der Beamte, der Major, der Arzt und der Bankier gingen nun wieder in die Schenke hinein, sie wollten jetzt das Zimmer jenes Reisenden besichtigen, das – wie erwähnt – unmittelbar neben der allgemeinen Gaststube lag. Die Tür dazu überwachte ein Polizist schon seit seinem Eintreffen im »Umgebrochenen Kreuze«.
Diese Tür wurde nun geöffnet. Im Zimmer dahinter herrschte tiefe Dunkelheit. Der Major Verder trat sofort ans Fenster, wirbelte dieses auf und öffnete es, hob dann den aus Fensterkreuz anschließenden Haken aus und stieß den Laden nach außen.
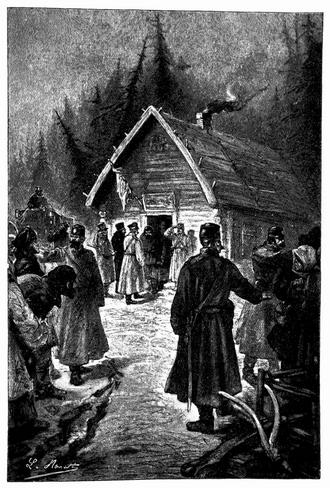
Der Landauer langte vor dem Kabak an (S. 93.)
Im Zimmer wurde es hell. Es war noch ganz in dem Zustande, wie der Reisende es verlassen hatte: das Bett, worin er geschlafen hatte, noch nicht wieder in Ordnung gebracht, die Talgkerze, die Kroff erst nach dem Weggange des Fremden ausgelöscht hatte, fast ganz heruntergebrannt. Die beiden, am gewöhnlichen Platze stehenden Holzstühle deuteten auf keine Unordnung, ebensowenig im Hintergrunde des Raumes der an der Giebelmauer befindliche Kamin, worin man noch Aschenreste und etwas Heizmaterial sah, das nicht völlig verbrannt war, oder ein alter Schrank, der sich im Innern als leer erwies. Im Zimmer war also nichts Beachtenswertes zu finden; das Ergebnis der Besichtigung beschränkte sich auf die Risse an der Fensterbank und an der Außenseite der Mauer, doch gerade diese konnten ja noch von besonderer Wichtigkeit werden.
Die Besichtigung wurde mit einer Untersuchung der Kroffschen Wohn-und Schlafstube beschlossen, die in einem Anbau nach der Gartenseite lag. Die Polizisten untersuchten inzwischen die Baulichkeiten des Geflügelhofes und den Gemüsegarten bis zu der ihn umschließenden lebenden Hecke, die nirgends eine Unterbrechung zeigte. Es blieb demnach kein Zweifel übrig: der Mörder war von draußen gekommen und durch das nach der Landstraße liegende Fenster nach gewaltsamer Öffnung des Ladens in das Zimmer seines Opfers eingedrungen.
Der Richter Kerstorf begann nun die Befragung des Schenkwirts. Er setzte sich dazu an einen Tisch in der Gaststube und sein Aktuar nahm neben ihm Platz. Der Major Verder, der Doktor Hamine und Herr Johausen, die ja ein natürliches Interesse daran hatten, zu hören, was von Kroff zu erfahren wäre, standen in der Nähe, und Kroff wurde aufgefordert, zu Protokoll zu erklären, was er von dem Falle wüßte.
»Herr Richter, begann er bestimmten Tones, vorgestern Abend gegen acht Uhr kamen zwei Reisende in meine Schenke und verlangten Zimmer für die Nacht. Der eine der Reisenden hinkte ein wenig infolge einer Verletzung durch einen Wagenunfall: die Post war zweihundert Schritte von hier auf dem Wege nach Pernau umgestürzt.
– Das bezieht sich wohl auf Poch, den Angestellten der Firma Gebrüder Johausen?
– Ja; ich habe das Nähere von ihm selbst gehört, er erzählte mir den Vorgang: die Pferde waren bei dem schweren Sturme gestürzt und hatten dabei den Wagen umgeworfen. Ohne seine Verletzung am Beine hätte er sich mit dem Postschaffner noch zu Pferde nach Pernau begeben, und wollte Gott, daß er das getan hätte!… Was den Schaffner angeht, den ich an jenem Abend nicht gesehen habe, so sollte er am nächsten Morgen zurückkehren – wie er tatsächlich zurückgekommen ist – um Poch und dessen Reisegefährten abzuholen, sobald der Wagen wieder instand gesetzt wäre.
– Poch hat sich wohl nicht darüber geäußert, was er in Reval vorhatte? fragte der Richter.
– Nein; er bat mich, ihm ein Abendbrot aufzutragen, und aß dann mit großem Appetit. Es mochte etwa neun Uhr sein, als er sich in das für ihn bestimmte Zimmer zurückzog, dessen Tür er von innen mit Schlüssel und Riegel abschloß.
– Und der andere Reisende?..
– Der andere?… Der verlangte nur ein Zimmer, wollte aber nicht erst wie Poch noch zu Abend essen. Als er sich zurückzog, sagte er mir noch, daß er die Rückkehr des Schaffners nicht abwarten und am nächsten Morgen schon früh vier Uhr aufbrechen werde.
– Sie haben auch nicht erfahren, wer der Mann war?
– Nein, Herr Richter; und der arme Poch wußte das ebensowenig. Als er aß, erzählte er mir von seinem Reisegenossen, der unterwegs keine zehn Worte gesprochen hätte und jeder Unterhaltung ausgewichen wäre. Dabei hätte er stets die Kapuze über den Kopf gezogen gehabt, so wie einer, der unerkannt zu bleiben wünscht. Auch ich habe sein Gesicht eigentlich nicht gesehen und könnte unmöglich ein Signalement von ihm abgeben.
– Befanden sich noch andere Personen im »Umgebrochenen Kreuze«, als die beiden Reisenden dahin kamen?
– Ja, ein halbes Dutzend Bauern und Holzfäller aus der Nachbarschaft, und auch der Polizeibrigadier Eck mit einem seiner Leute…
– Ah, bemerkte da Herr Johausen, der Brigadier Eck!… War denn Poch diesem nicht bekannt? –
– O gewiß; beide haben während des Essens miteinander geplaudert.
– Und später sind alle Gäste fortgegangen?…
– Ja… so gegen halb neun Uhr, antwortete Kroff. Ich habe gleich darauf die Tür zur Gaststube mit dem Schlüssel abgeschlossen und inwendig auch die Sparren vorgelegt.
– Von außen konnte man die Tür also nicht öffnen?
– Nein, Herr Richter.
– Auch nicht von innen, wenn man den Schlüssel nicht hatte?
– Ebensowenig.
– Und am Morgen haben Sie sie in unverändertem Zustande gefunden?
– Völlig unverändert. Es war ziemlich genau vier Uhr, als der Reisende aus seiner Stube trat. Ich habe ihm mit der Laterne geleuchtet. Er bezahlte mir, was er schuldete, einen Rubel. Dabei war er eingepackt, wie am Abend vorher, so daß ich sein Gesicht nicht erkennen konnte. Endlich hab’ ich ihm die Tür geöffnet und sie hinter ihm wieder sorgfältig verschlossen.
– Wohin er ging, hat er nicht gesagt?
– Nein, nicht ein Wort davon.
– Und in der Nacht ist Ihnen kein verdächtiges Geräusch aufgefallen?
– Nicht das geringste.
– Ihrer Ansicht nach, Kroff, fragte der Richter, müßte das Verbrechen wohl schon begangen worden sein, bevor der Unbekannte die Schenke verließ?
– Das glaub’ ich wenigstens.
– Was haben Sie denn nach dem Weggange des Fremden getan?
– Ich?… Da ging ich in meine Stube und warf mich noch einmal aufs Bett, den Tag abzuwarten; ich glaube aber nicht wieder eingeschlafen zu sein.
– Dann hätten Sie es also zwischen vier und sechs Uhr jedenfalls gehört, wenn in dem Zimmer Pochs ein Geräusch entstanden wäre?
– Ohne Zweifel, schon weil meine Stube, obwohl sie nach dem Garten hinaus liegt, unmittelbar an die seinige stößt, und wäre es zu einem Handgemenge zwischen Poch und dem Mörder gekommen…
– Ja ja, fiel der Major Verder ein, es hat aber kein Kampf stattgefunden, denn der Unglückliche ist in seinem Bette überfallen und durch einen Stoß, der das Herz getroffen hat, augenblicklich getötet worden.«
So war ja der Sachverhalt, und alles ließ darauf schließen, daß die Untat vor dem Weggange des anderen Reisenden ausgeführt worden war. Eine zweifellose Gewißheit hatte man dafür freilich nicht, denn zwischen vier und fünf Uhr morgens war es noch sehr finster, der Sturm wütete damals mit großer Heftigkeit, die Landstraße war menschenleer, und ein Ubeltäter hätte unter diesen Umständen durch Einbruch recht wohl unbemerkt in die Schenke eindringen können.
Kroff beantwortete ohne Zögern und mit aller Bestimmtheit auch alle weiteren Fragen, die der Kriminalbeamte an ihn richtete. Offenbar lag ihm der Gedanke ganz fern, daß sich ein Verdacht auch auf ihn lenken könnte, war es doch zuverlässig festgestellt, daß der von draußen gekommene Mordbube den Laden aufgesprengt, die Scheibe zertrümmert und das Fenster geöffnet hatte. Nach Verübung des Verbrechens war er, das stand ebenso unumstößlich fest mit den fünfzehntausend Rubeln durch dasselbe Fenster entwichen.
Kroff schilderte nun, wie er die Mordtat entdeckt habe. Gegen sieben Uhr aufgestanden, hatte er in der Gaststube aufgeräumt, bis der Schaffner Broks, der es dem Stellmacher und dem Jemschik überlassen hatte, den Wagen auszubessern, in der Schenke erschien. Beide hatten jetzt Poch wecken wollen… keine Antwort auf ihr Rufen, nichts regte sich im Zimmer, als sie stark an die Tür klopften, deshalb hatten sie diese gewaltsam geöffnet und sahen sich da… einer Leiche gegenüber.
»Sie sind Ihrer Sache sicher, fragte der Richter Kerstorf, daß in diesem Augenblick an dem Unglücklichen kein Lebenszeichen mehr zu bemerken war?
– Auch nicht das geringste, Herr Richter, versicherte Kroff, der trotz der Rauheit seiner Natur sichtlich ergriffen schien. Nein… nicht das geringste Zeichen! Broks und ich, wir haben getan, was wir konnten, ihn wieder ins Leben zurückzurufen… alles vergeblich!… Bedenken Sie nur, ein solcher Messerstich mitten ins Herz!
– Die Waffe, deren sich der Mörder bedient hat, haben Sie nicht gefunden?
– Nein, Herr Richter, dem wird daran gelegen gewesen sein, sie mitzunehmen.
– Und Sie erklären mit Bestimmtheit, forschte der Beamte weiter, daß das Zimmer Pochs von innen verschlossen gewesen ist?
– Jawohl, mit dem Schlüssel und dem Riegel, versicherte Kroff. Der Schaffner Broks kann das ebensogut bezeugen. Eben deshalb waren wir ja genötigt, die Tür zu erbrechen.
– Broks ist dann gleich fortgegangen?
– Ja, Herr Richter, in aller Eile. Er wollte schnellstens nach Pernau zurückkehren, um die Polizei zu benachrichtigen, die daraufhin auch sogleich zwei Mann hierhergeschickt hat.
– Broks ist dann nicht wiedergekommen?
– Nein, doch wird er sich noch heute Morgen einstellen, da er voraussetzt, in der Sache vernommen zu werden.
– Gut… gut, sagte Herr Kerstorf, Sie können jetzt gehen, doch verlassen Sie die Schenke nicht und halten Sie sich uns jede Minute zur Verfügung.
– Ich werde hier bleiben.«
Schon beim Beginn dieses Verhörs hatte Kroff seinen Vor-und Familiennamen, ferner Alter und Stand angegeben, was der Aktuar niederschrieb, denn wahrscheinlich wurde der Schenkwirt im Verlaufe der Untersuchung noch einmal vor Gericht gerufen.
Inzwischen war dem Kriminalbeamten gemeldet worden, daß der Schaffner Broks im »Umgebrochenen Kreuze« eingetroffen sei. Das war der zweite Zeuge, und seine Aussage war ja ebenso von Wichtigkeit, wenn sie voraussichtlich auch mit der Kroffs übereinstimmte.
Broks wurde in die Gaststube gerufen. Auf die Aufforderung des Richters hin nannte er seinen Namen, Vornamen, sein Alter und seinen Beruf. Bei seinen Angaben bezüglich der Reisenden, die er in Riga aufgenommen hatte, ebenso wie über den Unfall mit dem Postwagen und über den Entschluß Pochs und seines Reisegenossen, im Kabak »Zum umgebrochenen Kreuze« zu übernachten, ließ er keine Einzelheit unerwähnt. Seine Darstellung deckte sich vollständig mit der des Schenkwirts bezüglich der Entdeckung des Verbrechens und ihrer Zwangslage, die Zimmertür mit Gewalt zu öffnen, da Poch auf ihr Rufen und Anklopfen keine Antwort gab. Er betonte des weiteren aber einen Punkt, der ihm von Bedeutung zu sein schien, den, daß der Bankbeamte während der Fahrt im Postwagen wahrscheinlich etwas unvorsichtig von seinem Vorhaben in Reval gesprochen haben werde, dort eine größere Summe für Rechnung der Firma Johausen auszuzahlen.
»Auf jeden Fall, fügte er hinzu, haben der andere Reisende und die verschiedenen Postillone, die bei jedem Pferdewechsel die Wagenführung übernahmen, seine Dokumentenmappe sehen können, und ich selbst habe ihn auch darauf aufmerksam gemacht.«
Jetzt wurde er noch über den Reisenden befragt, der bei der Abfahrt in Riga noch einen Platz im Postwagen eingenommen hatte.
»Den Mann kenne ich leider nicht, erklärte Broks, es ist mir sogar unmöglich gewesen, sein Gesicht nur einmal ordentlich zu sehen.
– Er hatte sich erst eingefunden, als die Post zur Abfahrt bereit stand?
– Seinen Platz hatte er sich nicht im voraus gesichert?
– Nein, Herr Richter.
– Wollte er nach Reval?
– Den Fahrpreis hatte er bis Reval entrichtet, weiter kann ich hierüber nichts sagen.
– War es nicht ausgemacht, daß Sie am nächsten Morgen zurückkehren würden, um den Wagen wieder instand setzen zu lassen?
– Gewiß, Herr Richter; ebenso wie es verabredet war, daß Poch und sein Gefährte dann ihre Plätze wieder einnehmen sollten.
– Und trotzdem verließ jener Reisende das ‘Umgebrochene Kreuz’ schon am nächsten Morgen um vier Uhr?
– Ich war auch ganz erstaunt, Herr Richter, als Kroff mir mitteilte, daß der Unbekannte sich nicht mehr in der Schenke befände…
– Und was haben Sie sich dabei gedacht? fragte Kerstorf.
– Ich dachte mir, er werde wohl in Pernau bleiben wollen, und da es bis dahin nur ein Dutzend Werst weit ist, würde er sich entschlossen haben, die kurze Strecke zu Fuß zurückzulegen.
– Wenn das seine Absicht war, bemerkte hierzu der Beamte, erscheint es nur auffällig, daß er sich nicht gleich am ersten Abend nach der Beschädigung des Wagens nach Pernau begeben hat…
– Ja freilich, Herr Richter, antwortete Broks, das ist mir auch aufgefallen.«
Die Befragung des Postschaffners ging hiermit zu Ende, und Broks erhielt Erlaubnis, die Gaststube zu verlassen.
Als er hinausgegangen war, wendete sich der Major Verder an den Doktor Hamine.
»Sie haben an der Leiche des Opfers keine weiteren Aufnahmen zu machen?
– Nein, Major, erwiderte der Arzt. Ich habe die Stelle, die Form und die Richtung der Verletzung sorgfältig festgestellt…
– Der Todesstoß ist doch mit einem Messer ausgeführt worden?…
– Mit einem Messer, dessen Heftzwinge einen Eindruck rings um die Wunde hinterlassen hat«, erklärte Doktor Hamine.
Vielleicht war das ein Indizium, das zur Aufhellung der Sachlage dienen konnte.
»Kann ich nun, fragte Herr Johausen, Anordnung treffen, daß die Leiche des armen Poch nach Riga überführt wird, wo die Beerdigung stattfinden soll?
– Das steht Ihnen frei, antwortete der Richter.
– So könnten wir also wieder zurückfahren? ließ sich der Arzt vernehmen.
– Jawohl, antwortete der Major, da hier kein anderer Zeuge mehr zu verhören ist.
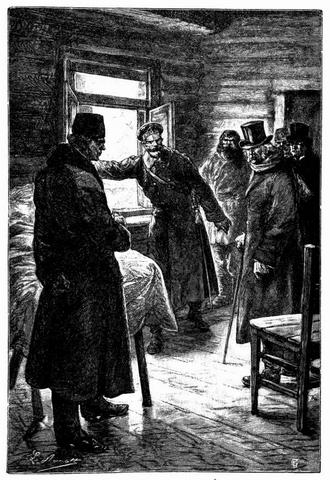
Im Zimmer wurde es hell. (S. 96.)
– Doch ehe wir die Schenke verlassen, sagte da Herr Kerstorf, möchte ich noch einmal das Zimmer des zweiten Reisenden besichtigen. Vielleicht ist uns doch noch eine wichtige Sache entgangen.«
Der Beamte, der Major, der Doktor und Johausen begaben sich nach dem betreffenden Zimmer. Der Schenkwirt schloß sich ihnen an, um eine etwa gewünschte Auskunft zu geben. Der Richter beabsichtigte, vorzüglich die Asche der Feuerstatt zu untersuchen, um sich zu überzeugen, ob sich darin etwas Verdächtiges vorfände oder nicht. Als sein Blick da auf den in einem Winkel des Kamins lehnenden eisernen Schürhaken fiel, ergriff er diesen, besichtigte ihn und erkannte, daß er offenbar gewaltsam verbogen war.
Hatte der Schürhaken beim Aufbrechen des Fensterladens als Hebel gedient? Das erschien recht gut annehmbar, und wenn man diesen Befund mit den verschiedenen Rissen auf der Fensterbank zusammenhielt, so mußte man wohl zu der Schlußfolgerung kommen, die der Richter den anderen Herren gegenüber vertrat, indem er, als sie aus der Schenke herausgetreten waren, sagte, ohne daß Kroff ihn hören konnte:
»Als Urheber des Verbrechens können nur drei Personen in Frage kommen entweder ein von außen eingedrungener Räuber, oder der Schenkwirt selbst, oder endlich der Reisende, der jene Nacht in dem anderen Zimmer geschlafen hat. Der Fund des Schüreisens, das als Beweisstück mitgenommen werden sollte, in Verbindung mit den Spuren am Fenster und an der Außenwand, beseitigten hierüber jeden Zweifel. Der Unbekannte hatte ohne Zweifel gewußt, daß Pochs Mappe eine große Geldsumme enthielt. In der Nacht war er dann nach Öffnung des Fensters seines Zimmers hinausgestiegen und hatte, den Schürhaken als Hebel benützend, den Laden des anderen Zimmers aufgesprengt. Nachdem er dann den schlafenden Bankbeamten ermordet und den Raub ausgeführt hatte, war er in sein Zimmer zurückgekehrt, aus dem er endlich um vier Uhr morgens, den Kopf mit der Kapuze verhüllt, weggegangen ist. Ich glaube bestimmt, in jenem Reisenden den Mörder zu erkennen.«
Gegen diese Darstellung der Sache ließ sich ja nichts einwenden; doch wer war der zweite Reisende, und würde es gelingen, ihn zu überführen?
»Meine Herren, sagte da der Major Verder, der traurige Vorgang hat sich jedenfalls in der Weise abgespielt, wie es der Richter, Herr Kerstorf, eben geschildert hat. Eine weitere Untersuchung bringt aber nicht selten Überraschungen zutage, man darf also keine Vorsichtsmaßregel vernachlässigen. Ich werde das Zimmer des Unbekannten abschließen, den Schlüssel mit mir nehmen und zwei Polizisten als Wache hier lassen. Sie werden Befehl erhalten, die Schenke auf keinen Fall zu verlassen und deren Wirt ständig im Auge zu behalten.«
Diese Maßregel fand allgemeine Billigung und der Major traf demgemäß seine Anordnungen.
Kurz vor dem Wiederbesteigen des Landauers nahm Herr Johausen den Richter beiseite.
»Beiläufig noch etwas, sagte er, worüber ich mich noch gegen niemand geäußert habe, Herr Kerstorf, was ich Ihnen aber doch wohl mitteilen muß…
– Das wäre?…
– Ich besitze ein Verzeichnis der Nummern der gestohlenen Kassenscheine. Es waren hundertfünfzig Stück, jeder zu hundert Rubel1, und Poch hatte diese zu einem Bündel zusammengebunden…
– Ah, Sie haben die Nummern aufgeschrieben? antwortete der Beamte nachdenklich.
– Ja, wie das bei uns üblich ist, und ich werde die Nummern den verschiedenen Banken der Ostseeprovinzen und Rußlands mitteilen lassen.
– Ich meine, das sollten Sie lieber nicht tun, antwortete Kerstorf… Unternehmen Sie diesen Schritt, so könnte das dem Räuber zur Kenntnis kommen und er wird sich desto mehr zu hüten wissen. Wahrscheinlich geht er mit dem Gelde ins Ausland und findet dann immer ein Land, wo jene Nummern nicht bekannt geworden sind. Beschränken wir ihn lieber nicht in seinem Tun und Lassen, da verrät er sich vielleicht am ersten.«
Wenige Minuten später trug der Landauer den Richter nebst seinem Aktuar, den Bankier, den Major Verder und den Doktor Hamine davon. Der Kabak »Zum umgebrochenen Kreuze« aber blieb unter der Bewachung der beiden Polizisten, die sich Tag und Nacht nicht davon entfernen durften.
Fußnoten
1 Die russischen Kassenscheine sind alle nur vom Staate ausgegeben, und zwar in Scheinen zu 500, 100, 50, 25, 10, 5 und 3 Rubeln. Dieses Papiergeld bildet fast ausschließlich das im Verkehr Rußlands übliche Zahlungsmittel. Die Staatskassenscheine haben von jeher Zwangskurs. Ihre Ausgabe wird durch eine besondere Verwaltungsabteilung geregelt, die dem Finanzministerium angegliedert ist und unter der Aufsicht des Staatsrates, wie alle Kreditanstalten des Kaiserreichs, steht, der sich für diese Angelegenheiten noch durch zwei Räte aus dem Adelsstande und den Großhändlern Petersburgs verstärkt. Der Papierrubel hatte jener Zeit einen Kurswert von zwei Mark zwanzig Pfennig, der Silberrubel dagegen wurde mit drei Mark zwanzig Pfennig berechnet. Gegenwärtig sind bezüglich des russischen Münzsystems gewisse Änderungen vorbereitet.
Achtes Kapitel.
An der Universität von Dorpat.
Am 15. April, einen Tag nach Aufnahme des Tatbestandes im »Umgebrochenen Kreuze« durch die Polizeibeamten, spazierte eine Gruppe von fünf bis sechs jungen Studenten im Hofe der Universität von Dorpat umher. Die zwischen diesen gewechselten Fragen und Antworten erfolgten mit einer gewissen außergewöhnlichen Lebhaftigkeit. Der Sand des Erdbodens knirschte unter ihren hohen Stiefeln. Die Taille von einem festanliegenden Ledergürtel umschlossen und die Mützen mit leuchtenden Farben kokett nach dem Ohre zur Seite geschoben, so wandelten sie plaudernd hin und her.
Da sagte der eine:
»Was mich betrifft, so stehe ich für die Frische der Hechte, die auf den Tisch kommen sollen, ein; sie sind erst vergangene Nacht in der Embach gefangen worden. Die Strömlinge (roh marinierte, kleine und in Livland sehr geschätzte Fische) hat man den Fischern von Oesel, die sie geliefert haben, gerade teuer genug bezahlt, und wehe dem, der sie, natürlich mit einem Schluck Kümmel dazu, nicht für einen Leckerbissen erklärt!
– Nun… und du, Siegfried? fragte der älteste der Studenten.
– Ich, antwortete Siegfried, ich habe für das Wildbret gesorgt, und wer meine Hasel-und meine Waldhühner nicht vortrefflich findet, der, das sage ich euch, der bekommt es mit mir zu tun!
– Ich beanspruche aber den Preis für den rohen und den gebackenen Schinken, sowie für die ‘Pourogens’, ließ sich ein Dritter vernehmen, und ich will gleich tot zusammensinken, wenn einer schon jemals köstlichere Fleischkuchen geschmaust hat. Dir, lieber Karl, möcht’ ich sie ganz besonders empfehlen.
– Schön, erwiderte der Student, den sein Kamerad mit jenem Vornamen genannt hatte. Mit all diesen guten Dingen werden wir das Fest der Universität ja würdig feiern können, doch eines gehört dazu: daß es nicht durch die Anwesenheit der Slawo-Moskowito-Russen gestört werde…
– Nein, rief Siegfried, durch keinen von den Burschen, die jetzt anfangen, den Kopf recht hoch zu tragen…
– Und den wir ihnen schon gehörig ducken werden! versicherte Karl. Und sie mögen nur den behüten, den sie als Anführer hinstellen möchten, jenen Jean, den ich schon auf seinen Platz zurückzuweisen wissen werde, wenn er’s noch immer wagen sollte, sich an den unsrigen zu stellen! An einem der nächsten Tage, das sehe ich voraus, werden wir schon noch mit ihm abzurechnen haben, ich möchte aber auf keinen Fall die Universität verlassen, ohne ihn gezwungen zu haben, sich vor den Germanen zu demütigen, die er so hoffärtig über die Achsel ansieht.
– Jawohl, ihn und seinen Intimus Gospodin, setzte Siegfried hinzu, während er die Faust nach dem Hintergrunde des Hofes ausstreckte.
– Gospodin ebenso wie alle übrigen, die sich uns gegenüber als die Herren aufzuspielen versuchen! rief Karl. Sie sollen’s schon merken, ob man so leicht mit der germanischen Rasse fertig wird!… Slawe, das reimt sich auf Sklave, diese Reime fügen wir unserer livländischen Hymne an und werden sie singen lassen…
– Ja… nach dem Takte und in deutscher Sprache!« erwiderte Siegfried, während seine Kommilitonen ein kräftiges »Hoch« erschallen ließen.
Der Leser ersieht ja wohl aus dem Vorhergehenden, daß die jungen Leute zu einer bevorstehenden Festlichkeit alles bestens vorbereitet hatten, sie gedachten aber etwas noch Besseres zu tun, nämlich einen Streit, vielleicht gar einen Kampf mit den Studenten slawischer Abkunft hervorzurufen. Es waren eben händelsüchtige Geister, vorzüglich der als Karl bezeichnete junge Mann. Er übte schon durch seinen Familiennamen und seine Vermögensverhältnisse einen großen Einfluß auf seine Kameraden aus und es war ihm ein Leichtes, sie nach Belieben in einen Konflikt hineinzuhetzen.
Wer war denn nun dieser Karl, der eine anerkannte Oberherrschaft über den einen Teil der Universitätsjugend ausübte, dieser junge Mann von kühnem, aber rach-und streitsüchtigem Charakter? Groß von Wuchs, mit hellblondem Haar, streng blickenden Augen und etwas abstoßenden Gesichtszügen, zauderte er nie, sich bei jeder Gelegenheit an die Spitze zu stellen. Karl war der Sohn des Bankiers Frank Johausen. Noch dieses Jahr sollte er seine Studien an der Hochschule abschließen. Nur noch wenige Monate, dann gedachte er wieder in Riga zu sein, wo ihm natürlich ein Platz im Hause seines Vaters und seines Onkels vorbehalten war.
Und wer war jener Jean, in bezug auf den Siegfried und er ihre Drohungen nicht gespart hatten? Man hat wohl bereits erraten, daß das der Sohn Dimitri Nicolefs, des Privatlehrers von Riga, war, der auf seinen Stammverwandten Gospodin ebenso zählen konnte, wie Karl auf seinen Kameraden Siegfried.
Der Ursprung Dorpats, einer alten Hansastadt, wird dem russischen Großfürsten Jaroslaw I. zugeschrieben, manche Geschichtsschreiber wollen deren Gründung jedoch noch weiter zurück, und zwar auf das berüchtigte Jahr 1000 verlegen, mit dem das Ende der Welt kommen sollte. Herrscht also über den Zeitraum, seit welchem die Stadt, eine der hübschesten Livlands, schon besteht, einige Unsicherheit, so ist das nicht der Fall bezüglich ihrer berühmten Universität, die von Gustav Adolf 1632 gegründet und 1812 in der Weise reorganisiert wurde, wie sie noch besteht. Nach dem Urteile mancher Reisenden könnte man Dorpat für eine Stadt des alten Griechenland halten, und es scheint in der Tat so, als ob viele ihrer Häuser aus der Hauptstadt des früheren Königs Otto unmittelbar hierher versetzt worden wären.
Dorpat ist weniger eine Stadt des Handels als eine solche der Wissenschaften, dank ihrer Universität, deren Besucher in Körperschaften oder vielmehr in »Nationen« vereinigt sind, die durch das feste Band der Landsmannschaft zusammengehalten werden. Aus dem Vorhergehenden hat man schon erkennen können, daß zwischen dem slawischen und dem germanischen Element hier dieselbe Gereiztheit herrschte, wie unter der Bevölkerung der anderen Städte Esthlands, Livlands und Kurlands. Von wirklicher Ruhe kann in Dorpat eigentlich nur in den Universitätsferien die Rede sein, wenn die Studierenden während der unerträglichen Hitze der Hundstage zu ihren Familien heimgekehrt sind.
Ihre beträchtliche Anzahl – jener Zeit gegen neunhundert – beschäftigt ein Personal von zweiundsiebzig Professoren für die verschiedenen Zweige der Wissenschaften. Die Vorträge werden in deutscher Sprache abgehalten und es ist dafür der nicht geringe Jahresbetrag von zweihundertvierunddreißigtausend Rubeln ausgeworfen. Fast ebensoviele Bände umfaßt die reichhaltige Universitätsbibliothek, eine der wichtigsten und bestverwalteten Europas.
Dorpat ist indes nicht ohne allen Handelsverkehr, schon infolge seiner Lage an der Kreuzung der wichtigsten Landstraßen der baltischen Provinzen, gegen zweihundert Kilometer von Riga und, in der Luftlinie, nur etwa dreihundert Kilometer von Petersburg. Dazu kommt noch, daß es ja früher eine der blühendsten Städte der Hansa gewesen ist. Zwar nur wenig entwickelt, liegt sein gesamter Handel doch in deutschen Händen. Die eigentliche, einheimische Bevölkerung, die Esthen, findet man nur als Lohnarbeiter, Handwerker oder als Dienstboten.
Dorpat ist malerisch auf einem Hügel erbaut, der im Süden den Lauf der Embach beherrscht. Die einzelnen Stadtteile sind durch lange Straßenzüge verbunden. Lustreisende besuchen ohne Ausnahme seine Sternwarte, seine im griechischen Stile gehaltene Kathedrale, sowie die Ruinen einer Spitzbogenkirche, und niemals scheiden sie gern aus den Alleen des allgemein gepriesenen Botanischen Gartens.
Ganz so wie das germanische Element jener Zeit unter der Einwohnerschaft Dorpats beiweitem überwog, war es auch unter den Universitätsbesuchern in großer Mehrzahl vertreten. Unter den neunhundert Studierenden gab es nur gegen fünfzig von slawischer Abkunft.
Unter diesen nahm nun Jean Nicolef eine bevorzugte Stellung ein. Seine Kameraden betrachteten ihn, wenn auch nicht gerade als Präsidenten, so doch als den Wortführer bei allen Streitigkeiten, die die Klugheit des Rektors und seine Neigung, vermittelnd einzugreifen, doch nicht immer zu verhüten vermochten.
Während nun heute Karl Johausen mit einigen Freunden auf dem Hofe hin und her ging, wobei diese, wir wissen in welcher Weise, sich über die Möglichkeiten einer Störung ihres Festes aussprachen, unterhielt sich eine andere Gruppe von Studenten, die nicht nur von Geburt, sondern auch mit Herz und Sinn Moskowiter waren, sich bei Seite haltend, über denselben Gegenstand.
Einer davon, der etwa achtzehn Jahre alt und für sein Alter recht kräftig und von übermittlerer Größe war, hatte einen freien, offenen Blick, ein hübsches Gesicht und auf den Wangen einen eben aufsprossenden Bart, während seine Oberlippe schon von einem seinen Schnurrbart bedeckt war. Beim ersten Blicke machte dieser junge Mann schon einen angenehm fesselnden Eindruck, trotz seines ernsten Gesichtsausdruckes, der den eifrigen Studenten, welcher seine Zukunft im Auge hatte, untrüglich erkennen ließ.
Gospodin überließ sich seiner aufbrausenden Hitze. (S. 114.)
Jean Nicolef vollendete eben sein zweites Jahr an der Universität. Man hätte ihn schon an der auffallenden Ähnlichkeit mit seiner Schwester Ilka erkannt. Beide waren ernste, überlegende Naturen von tiefem Pflichtgefühl, das bei dem jungen Manne vielleicht gar zu sehr entwickelt war. Das erklärte es aber, daß er durch den Eifer, womit er seine slawischen Ideen verfocht, auf seine Kameraden eine gewisse Macht ausübte.
Sein Kamerad Gospodin entstammte einer reichen esthnischen Familie in Reval. Obwohl er ein Jahr älter war als Jean Nicolef, zeigte er sich in seinen Handlungen doch weniger ernst. Im übrigen eine Persönlichkeit mit mehr Neigung zum Angriff als zur Abwehr, etwas vergnügungssüchtig und Liebhaber von Sportübungen; doch begabt mit vortrefflichem Herzen, gehörte er zu denen, auf die Jean rechnen konnte, denn er empfand für diesen eine aufrichtige Freundschaft, die ihn zu jedem Opfer befähigte.
Wovon hätten die jungen Leute miteinander sprechen sollen, wenn nicht von den Vorbereitungen zu jener Festlichkeit, die alle Korporationen der Universität so tief erregte?
Wie gewöhnlich überließ sich Gospodin schon seiner aufbrausenden Hitze, seinem Ungestüm, das Jean sich vergeblich zu bemeistern bemühte.
»Jawohl, rief er, sie haben sich verschworen, uns von ihrem Festmahl auszuschließen, die hochnasigen Deutschen! Unsere Beiträge haben sie abgelehnt, damit wir nicht berechtigt wären, daran teilzunehmen! Sie tun, als müßten sie sich schämen, mit uns anzustoßen!… Nun, es wird sich ja alles finden, vielleicht geht ihr Schmaus noch vor dem Nachtisch zu Ende!
– Ja, ein unwürdiges Verhalten, das geb’ ich zu, antwortete Jean, doch ist das der Mühe wert, etwa gar Streit zu suchen? Sie bestehen darauf, für sich zu tafeln, lass’ sie das also! Wir veranstalten einfach für uns eine Feier, und werden dabei unsere Becher zu Ehren der Hochschule nicht weniger fröhlich leeren!«
Das wollte dem ungestümen Gospodin freilich nicht in den Sinn. Die Sache hinzunehmen, wie sie eben lag, das wäre ein schimpflicher Rückzug, und er erhitzte sich durch die eigenen Worte nur noch weiter.
»Hast ja recht, Jean, erwiderte er, du bist einmal der verkörperte gesunde Menschenverstand, und es bezweifelt auch keiner, daß du nicht ebensoviel Mut wie Verstand hättest. Ich aber, ich bin einmal nicht so grundvernünftig und mag’s auch gar nicht sein! Meiner Ansicht nach ist das Benehmen Karl Johausens und seiner Mitläufer gegen uns eine Beleidigung, und das ertrag’ ich nicht lange!
– Laß doch den Karl, diesen Deutschen, in Ruhe, Gospodin, antwortete Jean Nicolef ermahnend, und rege dich weder über seine Handlungen noch über seine Worte auf. Binnen wenigen Monaten werdet ihr beide die Universität verlassen haben, und es ist doch sehr unwahrscheinlich, daß ihr euch im Leben jemals wieder begegnen solltet, wenigstens nicht unter Verhältnissen, bei denen die Frage nach der Abkunft und der Rasse eine Rolle spielte…
– Das ist wohl möglich, weiser Nestor, entgegnete Gospodin, und es ist auch schön, so sehr Herr über sich zu sein, wie du. Ich würde aber untröstlich sein, von hier fortzugehen, ohne dem Karl Johausen noch die Lektion erteilt zu haben, die er mit Recht verdient!
– Nun wohl, sagte Jean Nicolef, setzen wir uns aber wenigstens heute nicht zuerst dadurch ins Unrecht, daß wir ihn grundlos herausfordern.
– Grundlos? rief der aufgebrachte junge Mann. Ich habe tausend und abertausend Gründe dazu: sein Gesicht, das mich verfolgt, sein Auftreten, das mich verletzt, der Ton seiner Stimme, der mir mißfällt, sein verächtlicher Blick, die Überhebung, die er zur Schau trägt und in der seine Kommilitonen ihn bestärken, indem sie ihn stillschweigend als ihren Führer, ihren Vorsitzenden anerkennen!
– Alles das ist nicht von Bedeutung, Gospodin, widersprach ihm Jean Nicolef, der wie zur Beschwichtigung den Arm seines Freundes ergriff. Solange keine unmittelbare Beleidigung erfolgt, sehe ich in alledem keine Veranlassung zu einer Herausforderung. Ja, wenn er sich zu einer solchen verleiten ließe, dann lieber Freund, würde ich nicht erst warten, bis ein anderer darauf antwortete, das kannst du glauben!
– Und uns würdest du an deiner Seite finden, Jean, versicherten die anderen jungen Leute der Gruppe.
– Das weiß ich, antwortete der unbeugsame Gospodin. Ich wundere mich nur darüber, daß Jean nicht bemerken sollte, daß jener Karl es besonders auf ihn abgesehen hat.
– Was willst du damit sagen, Gospodin?
– Nichts anderes als: wenn wir andern mit diesen Deutschen nur sozusagen Schulreibereien auszutragen haben, so liegt die Sache zwischen Jean Nicolef und Karl Johausen doch wesentlich anders!«
Jean verstand, worauf Gospodin anspielte. Der Wettstreit zwischen der Partei Johausens und der Nicolefs in Riga war auch den Besuchern der Universität nicht unbekannt geblieben. Alle wußten, daß die Häupter beider Familien in dem Rassenkampfe, der wegen der städtischen Wahlen bald ausbrechen mußte, einander gegenüberstanden, wobei der eine von der öffentlichen Meinung auf den Schild erhoben war und von der Verwaltungsbehörde unterstützt wurde, um den Gegner zu besiegen. Gospodin tat gewiß unrecht daran, diese persönlichen Verhältnisse seines Kameraden zu berühren, um den Wettbewerb der Väter auch auf deren Söhne auszudehnen. Wenn der Ingrimm aber einmal in ihm erwacht war, ließ er sich davon fortreißen und schoß leicht über jedes Ziel hinaus.
Jean hatte jedoch keine Silbe geantwortet. Er erblaßte nur, als wenn ihm das Blut zum Herzen zurückgeflutet wäre, doch blieb ihm Kraft genug, sich zu bezwingen, und er warf nur einen grimmigen Blick nach dem anderen Teile des Hofes, wo die Gesellschaft Karl Johausens paradierte.
»Davon laß uns schweigen, Gospodin, sagte er mit ernster, leicht zitternder Stimme. Ich habe bei unserem Gespräch den Namen des Herrn Johausen niemals erwähnt, und Gott gebe, daß Karl sich bezüglich meines Vaters ebenso taktvoll zurückhaltend erwiesen habe, wie ich mich bezüglich des seinigen! Wenn er das freilich außer acht ließe…
– Jawohl, Jean hat recht, erklärte einer der anderen Studenten, und Gospodin hat unrecht! Uns kommt es nicht zu, uns mit dem, was in Riga vorgeht, zu beschäftigen, sondern nur mit dem, was in Dorpat geschieht.
– Sehr richtig, stimmte ihm Jean Nicolef zu, der das Gespräch wieder auf das ursprüngliche Thema zurückzulenken wünschte. Mindestens wollen wir uns vor jeder Übertreibung hüten und zusehen, welchen Lauf die Dinge nehmen werden.
– Du meinst also, Jean, fragte der Student, wir sollen keinen Einspruch erheben gegen das Verhalten Karl Johausens und seiner Kameraden, die uns von der heutigen Festlichkeit ausgeschlossen haben?…
– Meiner Ansicht nach tun wir, wenn keine besonderen Zwischenfälle eintreten, am besten, der Sachlage gegenüber die möglichste Gleichgültigkeit zu bewahren.
– Oho… Gleichgültigkeit! antwortete Gospodin, der abwehrend den Kopf schüttelte. Erst wollen wir einmal sehen, ob auch unsere Kameraden damit einverstanden sind. Ich denke aber, sie werden wütend werden, Jean, das sage ich dir im voraus…
– Wenn du sie aufwiegelst, Gospodin.
– Nein, Jean; jedenfalls genügt schon ein verächtlicher Blick, ein unbedachtes, aufreizendes Wort, den Funken ins Pulverfaß zu werfen.
– Na, schön! rief Jean Nicolef lächelnd. Das Pulver wird aber nicht explodieren, lieber Freund, denn wir werden Sorge tragen, es mit Champagner feucht zu halten!«
Es war die gesunde Vernunft, die dem weisesten der jungen Brauseköpfe diese Antwort eingab. Den anderen stieg freilich schon das Blut zu Kopfe, und es war unentschieden, ob sie einem verständigen Rate noch folgen würden, ebenso, welcher Ausgang dem heutigen Tage beschieden sein werde. Gerade die Festfeier konnte ja noch Veranlassung zu ernsten Reibereien geben, und wenn diese nicht von slawischer Seite ausging, dann geschah es vielleicht von deutscher Seite. Jedenfalls lag eine solche Befürchtung nahe.
Kein Wunder, daß sich bei dieser Lage der Dinge auch der Rektor der Universität ernstlich beunruhigt fühlte, wußte er doch recht gut, daß politische oder wenigstens Rassenstreitigkeiten zwischen Slawen und Germanen unter den Studenten jeden Augenblick auszubrechen drohten. Die große Mehrheit trat dafür ein, die Universität den alten Überlieferungen getreu zu erhalten, die sie von ihrer Gründung an bewahrt hatte. Die Regierung wußte gar wohl, daß ihr bei allen Versuchen zur Russifizierung, die den baltischen Provinzen bevorstand, ein ernsthafter Widerstand entgegengesetzt werden würde, und welche Folgen aus den damit ohne Zweifel einhergehenden Wirren und Unruhen entstehen könnten, das konnte niemand vorhersagen. Hier galt es also, vorsichtig zu sein. Trotz des ehrwürdigen Alters der Dorpater Universität war diese aber doch nicht gegen einen kaiserlichen Ukas gefeit, wenn sie sich zum Mittelpunkte des Widerstandes und der Agitation gegen die pauslawistische Bewegung ausbildete. Der Rektor achtete deshalb genau auf die Stimmung unter der Studentenschaft. Die Professoren sorgten sich, obwohl sie im Grunde auf deutscher Seite standen, darum auch nicht wenig, denn niemand konnte ja wissen, wie weit sich die leichtentzündliche Jugend hinreißen lassen würde, wenn es sich um politische Streitigkeiten handelte.
Heute hatte jedenfalls einer mehr Einfluß als der Rektor: das war Jean Nicoles.
Hatte es der Rektor nicht durchsetzen können, daß Karl Johausen und seine Anhänger darauf verzichteten, Nicolef und dessen Freunde von dem Bankett auszuschließen, so vermochte dieser wenigstens, Gospodin und die anderen zu bestimmen, daß sie die Festlichkeit nicht stören würden. Jedenfalls sollte keiner etwa in den Saal einzudringen suchen, und ebensowenig wollte man deutsche Lieder mit russischen Gesängen beantworten… natürlich unter dem Vorbehalt, nicht ganz besonders herausgefordert zu werden. Wer konnte aber für die, vielleicht durch Wein erhitzten Gemüter einstehen? Jean Nicolef und seine Kameraden wollten sich draußen im Freien versammeln, das Jubelfest nach ihrer Art zu feiern und sie wollten sich ruhig verhalten, wenn es niemand unternahm, ihre Ruhe zu stören.
Inzwischen verstrichen mehrere Stunden. Auf dem großen Hofe der Universität sammelten sich immer mehr Studenten an. Die Vorträge waren für diesen Tag ausgesetzt, so daß die jungen Leute nichts anderes zu tun hatten, als gruppenweise umherzuwandeln, einander scharf zu beobachten oder auch auszuweichen. Immer war zu befürchten, daß ein Zwischenfall noch vor der Stunde des Banketts eine Reiberei und daraus einen allgemein aufflammenden Streit hervorrufen könnte. Vielleicht wäre es besser gewesen, die geplante festliche Veranstaltung von vornherein zu untersagen, anderseits aber hätte ein solches Verbot die Korporationen wahrscheinlich nur destomehr erregt und den Vorwand zu Unruhen geliefert, die man ja gerade verhüten wollte. Eine Universität ist nun einmal keine Kinderschule, wo man sich mit Nachsitzenlassen und Strafarbeiten helfen kann. Hier hätte man zur Ausschließung, zur Relegierung der Rädelsführer greifen müssen, und das wäre doch eine vielleicht gar zu ernste Maßregel gewesen.
Bis zur Stunde des Banketts – vier Uhr Nachmittag – wichen Karl Johausen, Siegfried und ihre Freunde nicht vom Hofe. Die meisten Studenten wechselten einige Worte mit ihnen, so als wollten sie sich von ihnen Verhaltungsvorschriften holen. Auch schwirrte das Gerücht umher, das Bankett sei verboten, übrigens ein unbegründetes Gerücht, denn ein solches Verbot hätte, wie schon erwähnt, den Ausbruch von Feindseligkeiten eher noch beschleunigen müssen. Immerhin hatte es schon genügt, die Ansammlung der Studenten zu verstärken.
Jean Nicolef und seine Kameraden ließen sich durch diese Lage der Dinge nicht weiter erregen. Sie lustwandelten mehr auf einer Seite, wie sie das von jeher gewohnt waren, und kreuzten dabei nur gelegentlich andere Gruppen von Studenten.
Man fixierte dann einander. Die Blicke vermittelten Herausforderungen, die vorläufig noch nicht über die Lippen kamen. Jean selbst blieb ruhig und zeigte eine unerschütterte Gleichgültigkeit, dagegen kostete es ihm die größte Mühe, Gospodin im Zaume zu halten. Dieser wendete, nicht einmal als Zeichen der Mißachtung, nie den Kopf von den anderen ab und schlug auch nicht die Augen nieder. Spitz wie eine Degenklinge bohrte sich sein Blick in die Augen Karl Johausens. Schon diese Haltung genügte ja fast allein, einen Wortwechsel zu veranlassen, der dann jedenfalls nicht auf die beiden Gegner beschränkt geblieben wäre.
Endlich läutete es als Zeichen zum Beginn des Banketts. Karl Johausen begab sich, seinen Kameraden – mehreren Hunderten an Zahl – vorausgehend, nach dem großen Saale des Amphitheaters der Universität, der zu der Feier bewilligt worden war.
Bald befanden sich auf dem Hofe davor nur noch Jean Nicolef, Gospodin und etwa fünfzig slawische Studenten, die nur darauf warteten, das Gebiet der Universität zu verlassen, um zu ihren Familien oder zu Bekannten zurückzukehren.
Da sie nichts zurückhielt, hätten sie wohl am besten getan, jetzt sofort aufzubrechen. Das war auch die Ansicht Jean Nicolefs, doch versuchte er vergeblich auch seine Kameraden dazu zu bekehren. Es schien fast, als wären Gospodin und einige andere hier im Boden festgewurzelt, als würden sie von dem Amphitheater wie von einem Magneten angezogen.
So vergingen zwanzig Minuten. Alle gingen stillschweigend hin und her und näherten sich nur gelegentlich den nach dem Hofe zu liegenden Fenstern des Saales zwar halb unbewußt, dennoch vielleicht, um die lauten Reden darin zu vernehmen und auf verletzende Anspielungen zu antworten, wenn ihnen solche zu Gehör kämen.
Die Teilnehmer am Festmahle begannen in der Tat schon bald, Gesänge und Toaste »steigen« zu lassen. Die Köpfe waren nach Leerung der ersten Gläser wärmer geworden. Durch die Fenster hatten die jungen Leute Jean Nicolef und die anderen so nahe gesehen, daß diese mußten verstehen können, was im Saale gesprochen wurde, und dabei blieben persönliche Häkeleien nicht lange aus.
Nicolef bemühte sich noch einmal, seinen Freunden gut zuzureden.
»Kommt… wir wollen gehen, sagte er.
– Nein! erwiderte Gospodin.
– Nein… jetzt erst recht nicht! riefen die anderen.
– Ihr wollt nicht auf mich hören, nicht mit mir kommen?..
– Wir wollen bören, was die Deutschen da drin sich zu sagen unterstehen, und wenn uns das nicht paßt, so wirst du, Jean, es sein, der sich uns anschließt!
– Komm, Gospodin, wiederholte Jean, komm… ich will es!
– Warte nur noch ein wenig, antwortete Gospodin, in wenigen Minuten wirst du es nicht mehr wollen!«
Im Saale wurde es immer lauter, viele Stimmen schwirrten durcheinander, dazu das Anstoßen mit den Gläsern neben Ausrufen und Hochs, daß es wie Musketenfeuer schmetterte. Dann wurde ein gemeinsames Lied angestimmt, der auf allen deutschen Universitäten so beliebte Burschensang:
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus;
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus!
Man wird zugeben, diese Worte sind nicht gerade herzerhebend, man könnte sie nach der Melodie einer Begräbnishymne, oder zum Nachtisch ebensogut De profundis absingen! So urteilt man wenigstens teilweise im Auslande, in Deutschland wird das alte Lied auch weiter in Ehren gehalten werden.
Da ertönte plötzlich eine andere Stimme.
»O Riga, wer hat dich so schön gestaltet?… Das Sklaventum der Livländer? Könnten wir doch einst dein Schloß den Deutschen abkaufen und diese auf glühenden Steinen tanzen lassen!«
Gospodin war es, der diese russische Hymne mit vollem Brustton gesungen hatte.
Dann ließen seine Kameraden nach und mit ihm die Töne des Bojni »Sara-Krani«, der tief religiösen moskowitischen Hymne, erschallen.
Plötzlich flog die Tür des Festsaales auf; reichlich hundert Studenten stürmten auf den Hof hinaus. Sie umringten die Gruppe der Slawen mit Jean Nicolef in deren Mitte, der die Herrschaft über seine Kameraden völlig verloren hatte, seit diese durch die Rufe und das Verhalten ihrer Gegner auch in Hitze geraten waren. Obgleich Karl Johausen nicht unter ihnen war – er befand sich noch im Amphitheater – um sie zu Gewalttätigkeiten anzufeuern, genügte doch das überlaut gesungene, fast gebrüllte Gaudeamus igitur, die durchdringende Melodie der russischen Hymne beinahe zu ersticken.
In dieser Minute standen zwei Studenten Auge in Auge einander gegenüber, offenbar bereit, sich einer auf den anderen zu stürzen… Siegfried und Gospodin. Sollte der Rassenkampf allein zwischen ihnen ausgefochten werden? Würden sich nicht beide Parteien zugunsten ihrer Vertreter einmischen und der Streit zu einem allgemeinen Handgemenge ausarten, für den die Verantwortlichkeit zuletzt doch auf der Universität selbst lasten bliebe?
In Voraussicht des Tumultes, der durch das Herausströmen der Bankettteilnehmer veranlaßt werden mußte, beeilte sich der Rektor, beschwichtigend einzugreifen.
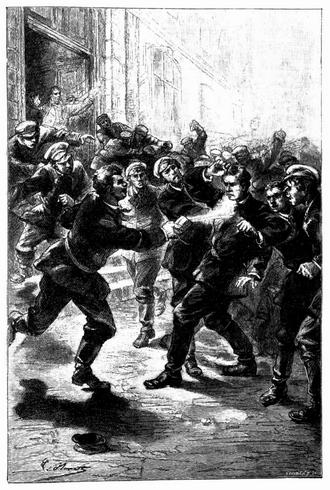
Siegfried, ein Glas in der Hand, schüttete ihm den Inhalt mitten ins Gesicht. (S 123.)
Einige Professoren, die sich ihm angeschlossen hatten, gingen auf dem Hofe von einer Gruppe zur anderen. Sie bemühten sich, die jungen Leute, die schon handgemein zu werden drohten, wieder zu beruhigen… freilich ohne besondern Erfolg. Die Autorität des Rektors wurde nicht weiter beachtet. Was konnte er auch ausrichten inmitten dieses Germanenhausens, der immer mehr anschwoll, je mehr sich der Saal des Amphitheaters entleerte!
Trotz ihrer bedeutenden Minderzahl wichen Jean Nicolef und seine Kameraden doch weder vor Drohungen noch vor Beleidigungen von der Stelle.
Da trat Siegfried, ein Glas in der Hand, näher an Gospodin heran und schüttete ihm den Inhalt mitten ins Gesicht.
Das war der erste Schlag, dem vielleicht tausend andere folgen sollten.
Als da aber Karl Johausen auf den zum Saale führenden Stufen sichtbar wurde, hielten beide Parteien doch noch einmal inne. Die Menge wich auseinander, und der Sohn des Bankiers konnte bis zu der Gruppe gelangen, unter der sich der Sohn des Privatlehrers befand.
Wie Karl Johausen in diesem Augenblicke auftrat, läßt sich schwer beschreiben. Er erschien äußerlich ruhig. Was aus seinen Zügen sprach, war nicht verhaltene Wut, sondern eher Hochmut, gepaart mit Geringschätzung, als er seinem Feinde gegenübertrat. Über Karls Absicht konnten sich seine Kameraden nicht täuschen: er näherte sich dem anderen nur, um ihm eine neue Beleidigung ins Gesicht zu schleudern.
Dem früheren Lärm war eine unheimliche Stille gefolgt. Es lag so etwas in der Luft, als ob der Streitfall, der die Korporationen der Universität eine auf die andere hetzte, zwischen Jean Nicolef und Karl Johausen ausgetragen werden sollte.
Gospodin aber, der an Siegfried schon gar nicht mehr dachte, wartete nur, bis Karl einige Schritte näher gekommen war, und machte dann eine Bewegung, ihm den Weg zu versperren.
Jean hielt ihn jedoch zurück.
»Die Sache geht mich an!« sagte dieser gelassen.
Im Grunde hatte er ja recht damit, zu erklären, daß das, was nun kommen sollte, ihn und ihn allein betraf. Kaltblütig drängte er die Hände derer zurück, die Miene machten, sich einzumischen.
»Du wirst mich nicht zurückhalten… rief Gospodin, jetzt vor Wut außer sich.
– Ich will es aber!« entgegnete ihm Jean Nicolef so bestimmten Tones, daß der andere sich wohl oder übel fügen mußte.
Dann wendete er sich an die Gesamtheit der Studenten.
»Ihr seid Hunderte, begann er, so laut, daß ihn jeder verstehen mußte, wir dagegen kaum fünfzig!… Fallt doch über uns her… wir werden uns verteidigen und werden unterliegen! Ihr aber hättet keinen ehrenhaften Sieg erfochten!«
Ein Wutgeschrei antwortete ihm.
Johausen gab durch ein Zeichen zu verstehen, daß er sprechen wolle.
Wieder wurde es still.
»Jawohl, rief er, der Kampf wäre zu ungleich!… Findet sich unter euch Slawen einer, der die Sache auf seine Rechnung nehmen will?
– Wir alle… wir alle!« erklärten die Kameraden Nicolefs.
Da trat dieser selbst hervor.
»Ich… ich nehme es selbst auf mich, und wenn Karl Johausen provoziert sein will, so nehme er das dafür hin…
– Du? rief Karl mit einer verächtlichen Bewegung.
– Ja… ich! antwortete Jean. Wähle dir zwei Sekundanten, ich habe meine Wahl schon getroffen.
– Du… du willst dich mit mir schlagen?
– Gewiß… morgen, wenn du nicht heute dazu bereit bist. Jetzt, diesen Augenblick, wenn du es willst!«
Unter den Studenten sind ja solche Zweikämpfe keine Seltenheiten, und es ist gut, daß die Universitäts-und die Staatsbehörden darüber ein Auge zudrücken, denn es kommt bei den Fechtereien gewöhnlich nicht viel heraus. Im vorliegenden Falle konnte man freilich einen ernsteren Ausgang befürchten, denn die Duellanten würden sich dabei besonders gereizt gegenüberstehen.
Karl hatte die Arme gekreuzt und sah Jean vom Kopf bis zu den Füßen an.
»Ah, du hast deine Sekundanten also schon gewählt? sagte er höhnisch.
– Hier sind sie, antwortete Jean, und wies auf Gospodin und einen zweiten Studenten.
– Und du glaubst, daß sie der Wahl zustimmen?
– Das versteht sich von selbst! antwortete Gospodin ohne Zögern.
– Mag sein, antwortete Karl Johausen; ich habe aber Veranlassung, der ganzen Sache nicht zuzustimmen, Jean Nicolef, das heißt, mich mit dir nicht zu schlagen.
– Und warum dieser neue Schimpf?
– Weil man sich nicht mit dem Sohn eines Mörders schlägt!«