Das alte Haus
1
Fern am Horizont, über den Puppen des Getreidefeldes, das gleich am Ende der Straße beginnt, liegt ein rötlicher Schein. Dort ist das Zentrum der großen Stadt, wo noch jetzt, um Mitternacht, die elektrischen Bahnen rasseln, Reklamen flammen, die Autos in dicken Strömen durch die Häuserschluchten rollen, Züge ankommen und abfahren und Menschen in Lokalen die Gläser heben.
Hier bei uns draußen, am Rande des Vorortes, ist schon alles still. Vielleicht, daß noch im >Hirschen< eine Skatrunde im Gange ist und Mizzi mit schlafroten Augen hinter der Theke hockt und die Männer verwünscht, die nicht nach Hause finden. Damit ist aber auch unser Nachtleben restlos erschöpft. Die anderen Häuser ruhen lichtlos im molligen Gefieder ihrer Gärten. Es sind meist große, alte Häuser, die noch vor dem Ersten Weltkrieg erbaut und damals von Kommerzienräten, pensionierten Ministerialräten, Industriedirektoren und Großschlächtern bewohnt wurden. Jetzt, nach einer ganzen Generation und entsprechender Abnützung, sind die Häuser billiger und die Bewohner meist nicht mehr die ursprünglichen Besitzer, sondern irgendwelche Mieter. Das sind auch wir: irgendwelche Mieter. Aber wir lieben unser großes, gemütliches Haus, als sei es das eigene. Es ruht inmitten des weiten und leicht verwilderten Gartens unter dem Mond, der seine Ziegel in Silberplatten verzaubert und seine Fensterscheiben im opalen Licht ertrinken läßt.
Unter unserem Dach wohnen sieben Personen. Als erste sei die Mama erwähnt, die sich dem achtzigsten Jahr nähert, wie ein Wiesel die Treppen ‘rauf und ‘runter saust, den ganzen Haushalt zusammenhält und in jedem Augenblick auf das Schlimmste gefaßt ist, besonders was ihre Kinder — meine Gefährtin und mich — betrifft. Sodann kommt besagte Gefährtin, die den Kriegsnamen >Frauchen< führt. Ihr Optimismus ist unbegrenzt, ihr Interesse für Haushaltskram um so begrenzter. Sie hat sehr viel Geschmack und Chic und liebt das Haus voller Gäste. Sie ist in jeder Beziehung das absolute Gegenteil der Mama. Vielleicht vertragen sich die beiden Frauen deshalb so gut.
Von mir selbst ist nur zu erwähnen, daß ich ein ziemlicher Eigenbrötler bin und mir das Leben damit schwer mache, daß ich Bücher, Novellen und (ohne sichtlichen Erfolg) Theaterstücke schreibe. Wir drei bewohnen das obere Stockwerk.
Im unteren wohnt Mathilde, der Hausgeist und Küchendiktator. An ihr ist alles üppig und solide, die Gerichte, die sie kocht, ihre Körperformen und die Treue, mit der sie an uns hängt. Ihr Zimmer liegt neben der Küche. Gegenüber liegen das große Speisezimmer und das noch größere Gesellschaftszimmer, davor die Diele, von der die Treppe in breitem Schwung in den ersten Stock hinaufführt. Hier schlafen die drei restlichen Personen, die Hauptpersonen — unsere drei Hunde.
Auch die Diele ist ziemlich groß. Ein paar abgetretene Teppiche bedecken den Boden. Eine schöne alte Kommode steht an der einen Wand, die Garderobe an der anderen, neben der Eingangstür der Schirmständer. Gegenüber, gleich neben der Treppe, ist die Kellertür. Im Keller stehen die Körbe mit den Frühäpfeln, die Mathilde und ich gestern abgenommen haben. Ihr Duft dringt bis hier herauf. Zwei vergitterte Fenster führen auf die glasüberdachte Gartenterrasse. Der Mond legt die Schatten der Gitter über die Teppiche.
Vom Kirchturm hat es gerade Mitternacht geschlagen. Die Klänge kommen merkwürdig nah und stark durch die warme Nacht dieser Augustwoche.
Nachdem der letzte Glockenschlag verklungen, herrscht wieder schläfrige Stille, die durch das Schnarchen Cockis nur noch tiefer wirkt. Cocki — der kleine Löwe genannt — ist unser ältester Hund (sechs Jahre), ein braun-weißer Springer-Cocker, dessen goldenschwärmerische Augen, weiche, dicke Knudeipfoten und mollige Hüften in seidigem Fell niemanden darüber täuschen sollten, daß sich darunter einer der charmantesten Brutaliker oder brutalsten Charmeure der Gegenwart verbirgt. Er ist eine seelische Lokomotive, die alles so oder so überrennt, eine Herrennatur, die sich ganz selbstverständlich überall vordrängt, das Beste aus innerster Überzeugung für sich beansprucht und Menschen und Hunde um sich herum in dienende Sklaven verwandelt.
Der zweite Hund, der unter seinem Deckchen an der anderen Wandseite liegt, ist Peter, eine Mischung aus Pudel und Drahthaarfoxl. Er ist Cockis treuester Sklave, war es von Anfang an, als er vor vier Jahren sein erstes Würstchen auf unseren Teppich legte. Damals glich er mehr einer Ratte als einem Hund. Heute ist er ein starkes, schnelles Tier, aber Cocki ist sein angebetetes Idol geblieben. Noch heute läßt Peter ihn ohne Knurren aus seinem Teller fressen, fällt er ihm um den Hals, wenn sie kurze Zeit getrennt waren, windet er sich demütig zu seinen Füßen, wenn der Diktator die Löwenstirn runzelt.
Noch ein dritter liegt dort in der Diele, gleich neben der Kellertreppe, unser Jüngster: Weffi, Drahthaarfoxl, ein bildschönes, leicht dekadentes, ganz auf Mensch eingestelltes Persönchen. Alle Versuche Cockis, ihn zu unterwerfen, prallten an ihm ebenso ab wie Peters wütende Eifersuchtsanfälle im ersten Jahr. Nach wilden Schlachten, bei denen besonders die unbeteiligten Menschen viel Blut lassen mußten, haben sich die beiden anderen allmählich an ihn gewöhnt. Sie behandeln ihn als einen leicht schwachsinnigen, aber harmlosen Sonderling, der immerhin zu ihnen gehört. Sie verteidigen ihn sogar gegen andere Hunde, denen gegenüber Weffi ziemlich hilflos ist, weil er in seiner träumerisch-kindlichen Verspieltheit und in seinem Glauben an die Güte aller Kreatur mit dem Zurückbeißen immer zu spät kommt.
Peter ist wach um diese späte Stunde. Er ist der einzige, der auch jetzt, im warmen August, unter einem Deckchen schläft, ganz dick eingemummelt. Das hat er noch aus der Zeit seiner Jugend beibehalten, als er so ein kleines, erbärmliches, ewig frierendes Etwas war. Er hat das Köpfchen mit dem silbergrauen Haarpuschel erhoben und starrt mit seinen seltsamen großen Affenaugen unter der Decke hervor. Er hört alles: die Tropfen, die aus dem immer undichten Wasserhahn draußen in das Bassin fallen, das Rascheln der Igelstacheln im Laub, das Flattern der Nachtfalter um die große Straßenlaterne.
Peters Augen wandern langsam umher. Sie sehen Cocki, der vor der Kommode auf dem Bauch liegt, die Beine wie ein toter Frosch nach hinten gestreckt, den Kopf schief neben die dicken Vorderpfoten gepackt, das Auge mit einem der riesengroßen Ohren zugedeckt. Er schnarcht wie eine Brettsäge, die an einen Knorpel stößt. Zwischendurch imitiert er auch eine pfeifende Lokomotive und einen überkochenden Kessel. Bei diesem Kesselgeräusch bläst er seine dicke Flappe mit den Katerborsten auf. Den Platz vor der Kommode hat er sich gewählt, weil er da noch im Schlaf die kostbaren und so schön grün verschimmelten Knochen bewachen kann, die er aus der ganzen Nachbarschaft unter die Kommode schleppt.
Auch Weffis Platz neben der Kellertreppe hat seinen Sinn. Dort ist er nämlich möglichst weit weg von dem Schirmständer. Schirme sind ihm fürchterlich. Es sind Dämonen. Wenn Herrchen mit so etwas nach einem zielt, ist es erst ganz winzig, nur eine Spitze, und dann rauscht und knarrt es, und mit einem Ruck ist es ganz groß, und man kann sich nur mit eingezogenem Hinterteil vor diesem furchtbaren Plustergespenst retten, bevor es einem etwas ganz Entsetzliches antut. Dabei war man doch gerade so schön dabei, ein Loch in Herrchens Schuhe zu knipsen oder ihm wenigstens die Senkel aufzuziehen.
Schuhe sind nämlich für Weffchen etwas ungeheuer Ulkiges. Wie sie so auf einen zukommen, dumm und blind und plump und doch nach lebendigem Leder riechend — zum Schreien komisch. Und Weffchen schreit denn auch jedesmal, wenn Herrchen mit ihm spazierengeht, schrill, unaufhörlich: »Weff-weff-weff.« Zwischendurch versucht er in die dummen Schuhdinger zu zwicken. Dazu schimpft Herrchen, daß es eine wahre Lust ist. Nur die Kieselsteine, die er einem auf den Po brennt, mindern das Vergnügen und eben — wenn es draußen regnet — der Schirm, der fürchterliche.
Peter betrachtet Weffi eine lange Weile und von der ganzen Höhe seiner ewig rätselhaften und melancholischen Seele. Wie dieser Hanswurst da an die Wand geklebt liegt, die dicken Fellbeine steif in die Luft gereckt, findet Peter ihn unsäglich albern. Jetzt wackelt er mit dem weißen Kastenbart, knurrt und fletscht die Zähne, die einem Wolf alle Ehre machen würden. Nur daß er damit nicht zu beißen versteht. Seine Plusterhosen zittern: er träumt. »Wiff-wiff«, macht er leise, ein dünnes Welpenbeilen. Wahrscheinlich hat er im Traum ein Wild gestellt — was er so ein Wild nennt. Nicht etwa Reh, Fuchs oder Hase, wie Peter und Cocki, sondern eine Maus, einen Frosch oder eine große Heuschrecke. Kindisch. Aber Peters Augen sehen noch mehr, sehen vielleicht Dinge, die ein Menschenauge nie erblickt. — Jetzt rührt sich drüben Cocki. Seine Augen, in die das Mondlicht fällt, leuchten rotgolden auf. Er mustert mit strengem Blick seine beiden Kameraden, ob sie sich auch nicht seiner Schatzkammer nähern. Dann erlischt der rotgoldene Schein. Er schläft weiter.
Peter wendet die Augen von ihm, stellt die Ohren auf und schüttelt dann die Decke von sich. Cocki nimmt das Ohr vom Auge und schaltet von Tief- auf Halbschlaf um. Was will er ,denn, sein Sklave? Etwa doch einen Knochen? Peter hat zwar gestern auch zwei vom Bummel mitgebracht und unter der Kommode geparkt, aber trotzdem gehören sie jetzt ihm, Cocki, seinem Herrn. Sollte er es vergessen haben, muß man ihm ein Ding verpassen.
Aber Peter hat andere Sorgen. Er macht eine Kniebeuge, wobei er gähnend den Rachen aufreißt, dann streckt er hinten erst das eine, dann das andere seiner dünnen kohlschwarzen Fliegenbeine weg und schleicht schließlich die Treppe hinauf. Von oben hat er dauernd Herrchens und Frauchens Stimmen gehört, und das erfüllt ihn mit einer dunklen Angst. Wie ein Schatten schwebt er über die Stufen. Einen Moment horcht er mit schiefem Kopf vor dem Zimmer der Mama. Aber die schnarcht. So geht er zu den Zimmern der beiden anderen Götter. In beiden ist noch Licht, aber Frauchens Zimmer ist leer, das riecht er. So bleibt er vor Herrchens Zimmer stehen und horcht auf die beiden Stimmen. Sie sind traurig, besonders die von Herrchen. Peter fühlt das ganz genau, denn die Schwingung des Leides ist ihm vertraut von Jugend an. Niemand weiß warum. Stets liegt dieser tragische Schatten über seinem Wesen, als habe er irgend etwas zu befürchten oder abzubüßen — vielleicht aus einem anderen Leben.
Drinnen sagt Frauchen, die im Lehnstuhl an Herrchens Couch sitzt, gerade: »Du mußt immer damit rechnen, daß mal was schief geht. Keiner bleibt davon verschont!«
Herrchen — auf der Couch liegend — hat die Hände hinter dem Kopf gekreuzt und starrt gegen die Decke: »Aber gleich beides schiefgegangen«, antwortet er mit bitterer Stimme, »das Theaterstück und der Roman! Selbst wenn mein neues Buch etwas wird — ich glaube schon fast nicht mehr daran —, werden wir ein Jahr lang ohne größere Einnahmen sein. Ist dir das klar?«
»Sicher. Aber...«
»Gar kein Aber. Es bedeutet, daß wir das Haus aufgeben und uns auf das Notwendigste einschränken müssen. Wir werden trotzdem unsere paar Spargroschen angreifen müssen.«
»Du mußt nicht immer alles so schwarz sehen.«
Herrchen dreht sich zu ihr herum und stützt sich auf den Ellbogen: »Du klammerst dich an das Haus.«
»Ich klammere mich an gar nichts.«
»Sei nicht kindisch, das ist doch kein Vorwurf! Glaubst du; mir fällt es leicht, das alles hier aufzugeben? Nicht nur meinet- und deinetwegen. Mir tut besonders die Mama leid, dieser alte Mensch, der nach so vielem Umherziehen endlich glaubte, daß er ein Heim gefunden hätte. Und was machen wir mit den Hunden?«
»Vielleicht brauchen wir das alles gar nicht.«
»Nicht? Möchtest du mir mal erklären, wie...«
»Ich habe mich umgetan in den letzten Tagen. Ich könnte eine Stellung als Modeberaterin bekommen im Salon Windschuh.«
Herrchen starrt seine Gefährtin eine Weile an, dann läßt er sich wieder zurückfallen und sagt gegen die Decke: »Der Mann ist der Ernährer der Familie — der richtige, meine ich.«
Frauchen schüttelt lächelnd den Kopf: »In welchem Jahrhundert lebst du eigentlich? Ich denke da an gewisse Artikel, die du über die moderne Frau geschrieben hast!«
»Das ist ganz was anderes.«
»Etwas ganz anderes? Weil es mich betrifft und dich? Ich will nichts mehr von diesem Unsinn hören. Morgen früh fahre ich zu Windschuh. Was kratzt denn da?«
»Es wird einer vom Verein sein«, sagt Herrchen und sieht auf die Uhr: »Mein Gott, schon Viertel nach zwölf!«
Frauchen steht auf und öffnet die Tür: »Peter!«
Er kommt hereingestakst, leckt ihr die Hand, sieht ihr prüfend in die Augen, trabt dann zur Couch, hupft herauf und kringelt sich auf Herrchens Füßen zusammen. Herrchen krault ihm die eisgraue Stirnlocke: »Er hat’s gemerkt! Er merkt immer alles zuerst. Ja, du liebe Zeit, was ist denn los?«
Die nur angelehnte Tür fliegt mit einem Ruck auf, und Cocki, mehr denn je einem kleinen Löwen ähnlich, watschelt herein. Er wirft mit gefurchter Stirn den Blick in die Runde, schaukelt dann zu Herrchens Couch und riecht Peter in die Schnauze: »Hat’s hier etwa was zu fressen gegeben ohne mich?«
Aber Peterchens Schnauze mit dem schmutzig-rötlichen Zickenbart unbekannter Herkunft riecht nicht nach frischem Fressen. So läßt sich denn Cocki mit einem dröhnenden Plumps fallen, gähnt und legt den Kopf neben die Tatzen: »Mal sehen, was sich hier tut.«
Und jetzt erscheint auch Weffchen, wie üblich völlig unorientiert. Er ist putzmunter, verdreht schelmisch die nußbraunen Augen und riskiert ein helles, fragendes Weff. Er glaubt, daß es Morgen ist und der Spaziergang mit dem Schuhbänderspiel beginnt.
»Hältst du die Bappen, du bist wohl nicht gescheit!« sagt Frauchen.
»Du weckst doch die Oma auf!« flüstert Herrchen. »Marsch, wieder ‘runter, lunkerchen!« (Lunkerchen heißt in der Geheimsprache der Familie >schlafen<.)
Worauf Weffchen wie ein Pfeil auf Herrchens Couch schießt, sich Kopf an Kopf mit ihm aufs Kissen legt, die dicken Fellbeine in die Luft steckt und selig seine Greta-Garbo-Augen mit den langen Wimpern schließt.
Na, wenn das so ist, denkt Peter, steht auf und bohrt sich mit dem Kopf unter Herrchens Decke. Dabei stößt er von unten an Weffis Hinterteil. Der ist mit einem Ruck hoch und betrachtet mit schiefem Kopf die Untergrundbewegung. Sein rundgebogenes, kurzes Schwänzchen wackelt vor Vergnügen. Dann beißt er herzhaft durch die Decke in das, was sich da bewegt. Peter knurrt und versucht — ebenfalls durch die Decke — ihn in die Beine zu zwicken. Weffi springt mit allen vieren hoch und zwickt dann zurück — ein herrliches Vergnügen! Da hat ihn Herrchen am Kragen und packt ihn mit einem Ruck aufs Kissen zurück. Weffi verzieht die Schnauze und niest, daß Herrchens ganzes Gesicht feucht ist. Herrchen muß lachen. WährenderseineBrillemitdem Taschentuch wieder klarputzt, sagt er: »Ja, was denkt ihr euch eigentlich, was?«
Als Antwort läßt Cocki einen gewaltigen Schnarcher los. Unter der Decke kommt ein Schnarcher von Peter als Entgegnung. Er hat endlich die richtige Stellung gefunden, in Herrchens Kniekehlen, und strahlt Hitze aus wie ein elektrischer Ofen.
»Ach, laß sie, wer weiß, wie lange sie noch...«
»Nein, wir müssen morgen alle frisch sein. Ich hole sie dir weg.«
Sie geht nebenan in ihr Zimmer. Von dort hört man die Schranktür quietschen und gleich darauf das klirrende Geräusch der Keksbüchse. Daraufhin Generalalarm!
Cocki hat in einer Viertelsekunde von Tiefschlaf auf Hellwach umgeschaltet und ist schon nebenan. Herrchens Decke fliegt hoch, als Peter wie ein Geschoß hinterhersaust. Weffchen reißt sich aus Herrchens Arm, stößt sich mit den Hinterbeinen von seinem Gesicht ab und spurtet hinterher. Herrchen wackelt an seiner Nase, ob sie blutet, und lehnt sich dann zur Seite, um ins Nebenzimmer zu sehen. Da sitzt Frauchen vor dem Frisiertisch, die Büchse in der Hand. Vor ihr, den Kopf schwärmerisch erhoben, die langen Ohren artig nach hinten gefaltet — der Löwe. Einen halben Schritt hinter ihm sein schwarzer Adjutant Peter. Er macht Männchen, um die größere Entfernung von der Büchse durch Charme auszugleichen. Weffi ist über beide hinweg direkt auf Frauchens Schoß gesprungen.
»So«, sagt sie, »jeder eines, und dann gehen wir alle wieder ‘runter, lunkerchen.«
Die Kekse werden von Cocki und Peter mit einem einzigen hastigen Ruck heruntergewürgt. Weffchen mimmelt wie üblich eine lange Weile daran herum. Cocki beobachtet ihn mit schiefgelegtem Kopf: Der Kerl ist selbst zum Fressen zu dämlich. Vielleicht läßt er was fallen.
Und tatsächlich, da fällt Weffi ein Stück aus der Schnauze. Der Dicke ist sofort mit der Flappe darauf und atmet es ein wie ein Staubsauger.
»So«, sagt Frauchen, »und nun marsch.« Sie nimmt Weffi auf den Arm und schleicht sich nach unten, gefolgt von den beiden anderen. Herrchen hört ihre leise, aber energische Ansprache, mit der sie sie zur Ruhe bringt. Zwischendurch ein patschender Laut: Einer hat was hinter die Ohren bekommen.
Als sie nach oben kommt, bleibt sie einen Moment im Türrahmen stehen: »Na, lohnt es sich nicht, es dafür zu versuchen?«
Herrchen seufzt: »Ich fahr’ dich morgen hin.«
2
Als ich am nächsten Morgen erwachte, war mein erster Gedanke: Es ist etwas verändert. — In den letzten Wochen, nach meinem doppelten Mißerfolg, war das Erwachen qualvoll gewesen. Hoffnungslos hatte ich dem Tag entgegengesehen, unwillig, die bleiernen Bürden seiner Sorgen wiederaufzuladen. Ich sehnte mich nach dem Schlaf zurück und war fest überzeugt, daß meine Glückssträhne ein für allemal abgerissen sei. Von jetzt an gab es nur noch Abstieg, Sinken von Stufe zu Stufe, bis ich eines Tages mit Streichhölzern an einer Straßenecke handeln würde, natürlich in einer Gegend, in der alle Leute Feuerzeuge hatten. —
Heute war es anders. Warum eigentlich? O ja, die Sache mit dem Modesalon! Ich sah auf die Uhr: zehn Minuten nach acht. Aus dem Zimmer der Gefährtin war noch nichts zu hören. Sollte sie nur so lange wie möglich schlafen. Wer weiß, wie lange sie gestern noch aufgeblieben war, gegrübelt und sich vor den Unübersehbarkeiten des neuen Berufes gegrault hatte, genau wie ich es tun würde. Jeder wohl übrigens, der als reifer Mensch noch einmal neu anfangen muß.
Aber warum sollte es ihr nicht glücken? Geschmack hatte sie immer gehabt, überdurchschnittlichen. Außerdem war sie eine gute Modeschriftstellerin gewesen, ihr Name noch heute in der Fachwelt bekannt. Plötzlich wünschte ich brennend, daß es ihr gelingen möge. Nur für kurze Zeit, für ein paar Monate meinetwegen, bis das neue Buch fertig und hoffentlich angenommen war.
Ich sah mich im Zimmer um: Mein Schreibtisch, der Bücherschrank, der Biedermeiersekretär, dessen Holz in der Morgensonne honigfarben auf leuchtete: eine Insel des Friedens und der Arbeit. Ich könnte darin bleiben.
Unten hörte ich Mathildes Stimme: »Raus da, Dicker! Nicht immer mit den dreckigen Gartenpfoten durch die Zimmer latschen!«
Ich lächelte: Mathilde — nun brauchte man ihr vielleicht nicht zu kündigen. Wahrscheinlich hätte ich das tun müssen: Hören Sie, liebe Mathilde, Sie sind doch ein vernünftiger Mensch — und Sie haben ja selbst in den letzten Wochen gesehen...
Entsetzlich. Man wächst doch zusammen mit so einem Menschen. Muß man ihm so etwas antun, dann ist es, als schneide man sich ins eigene Fleisch.
Wenn’s nun aber doch nötig wäre? Ich sprang schnell auf, um dieser Vorstellung zu entrinnen, hängte mich aus dem Fenster und sah, wie jeden Morgen, zuerst nach dem Himmel. Er war jetzt schon tiefblau, aber da im Westen zog eine Wolkenwand auf, schiefergrau mit weißen Tupfen davor. Wieder mal ein Gewitter? Möglich. Niederblickend sah ich gerade unter mir den grauen Scheitel der Mama. Sie hatte sich einen Rechen geholt und harkte damit Blätter zusammen. Als ob sie meinen Blick fühlte, sah sie auf: »Wolltet ihr nicht in die Stadt fahren?«
»Ja, das wollten wir.«
»Dann wird’s ja Zeit.«
»Warum denn?«
Sie sah mich grinsen und seufzte: »Na, ich sehe schon, das wird wieder nichts.«
Die gute Mama. Sie lebte in der Überzeugung, daß wir ohne ihre dauernden Ermahnungen und düsteren Prognosen sofort und rettungslos in ein totales Lotterleben versinken würden. Diese Überzeugung hielt sie aufrecht und machte sie glücklich. Ich zog sie damit auf, und sie schimpfte darüber. Dabei wußten wir beide, daß dies nur ein Spiel war, hinter dem wir unsere tiefe Liebe und Achtung mit der Hartnäckigkeit schamhafter Seelen verbargen. Ich war und blieb für sie der kleine Junge, nur mit Teilglatze und Biermagen verkleidet, und sie hatte mir mal gestanden, es sei die glücklichste Zeit in ihrem Leben gewesen, als sie mir den Po puderte. Das war nun jetzt, nach fünfzig Jahren, nicht mehr ganz angängig, aber die Mama hatte für diese Freuden Ersatz gefunden: unsere drei Lümmels. Gerade jetzt wurde sie wieder von ihnen in Anspruch genommen. Weffi kam im Galopp mit eingekniffenem Schwanz zu ihr gerast, setzte sich vor sie hin und schlug mit der Pfote gegen die Puschelschnute, an der ein welkes Blatt hing. Er war fürchterlich penibel in diesen Sachen, im Gegensatz zu den beiden Rowdies Cocki und Peter, die, durch alle Gebüsche und Unterhölzer der Welt brechend, Zweige und Dornenranken mit sich schleppten, ohne sich im geringsten etwas daraus zu machen. Die Mama legte den Rechen zur Seite und kniete sich vor Weffi hin: »Ach, mein armes Jungchen — na, nun ist es ja weg. Und im Äugelchen haben wir auch schon wieder was! (Es wurde mit dem Taschentuch weggewischt.) Und im Po ‘ne Ameise!« Weffi warf sich auf den Rücken und lud sie ein, auch seine anderen Körperteile zu visitieren.
Wo waren denn eigentlich die beiden anderen? Ich lehnte mich weit aus dem Fenster und konnte so gerade noch die Eingangstür sehen. Da saß Peter, wie immer am Morgen, steil aufgerichtet und wartete auf den Briefträger, um ihn anzubellen. Es war seit vier Jahren derselbe Briefträger, und seit vier Jahren bellte er ihn an. Keiner nahm den anderen ernst, aber es machte Spaß. Jetzt sah Peter zu mir auf und begrüßte mich, indem er seinen ruppigen Schwanz einmal über den Steinboden fahren ließ. Ich sah den Zweifel in seinen Augen: Was sollte er tun? Weiter auf den Briefträger warten oder zu mir nach oben kommen und mit mir turnen?
»Du wirst noch mal aus dem Fenster fallen«, prophezeite die Mama von unten.
Da kam gerade der Dicke über die Straße auf die Gartentür zu, die er sich geschickt mit der Tatze öffnete. Er hatte die erste Mülltonnentour hinter sich und brachte etwas Entsetzliches mit: ein dickes weißliches Darmgeschlinge, das ihm zu beiden Seiten aus dem Maul hing. Peter rannte ihm entgegen und leckte ihm, den Schwanz demütig zwischen die Beine gesteckt, über Stirn und Ohr. Cocki zog die Flappe kurz hoch, weil Peter dabei in bedrohliche Nähe seines Darmgeklunkers geriet, und schlug einen Bogen um die Mama, die sich empört auf ihn stürzen wollte: »Gibst du das her, dieses scheußliche Zeug!«
Der Dicke machte einen katzenhaften Satz und verschwand im Haus, ihm voraus eilte das Gezeter der Mama: »Mathilde — nehmen Sie’s ihm weg, bevor er’s unter die Kommode schleppt!«
Ich trat vom Fenster zurück und begann meine Morgenübung: zwölf Liegestütze, auf die ich unbändig stolz war, und dreimal Kerze mit Auf stehen ohne Gebrauch der Arme (noch stolzer). Beim ersten Liegestütz flog die Tür auf: Peter. Er hatte einen Tannenzapfen mitgebracht und wollte ihn geworfen haben. Ich tat es und traf genau den Federreiniger auf meinem Schreibtisch, dessen etwa zweihundert Glaskügelchen sich über das ganze Zimmer verteilten. Während ich sie zusammenschippte, warf er mir unentwegt wieder den Tannenzapfen hin. Ich fluchte, aber dann überlegte ich, daß meine Ungeschicklichkeit ja schließlich kein Grund sei, ihm sein Spiel zu verderben. So warf ich den Zapfen noch mal. Diesmal rollte er unter den Bücherschrank. Peter kniete sich davor und versuchte vergeblich, ihn mit seinen dünnen Ärmchen vorzuangeln. Ich probierte es mit der Hand, aber es ging auch nicht. Darauf nahm ich das Papiermesser und versuchte, damit nach dem Zapfen zu schießen. Der Erfolg war, daß auch das Papiermesser unter dem Schrank verschwand. Es blieb nichts anderes übrig, als den Schrank abzurücken. Ich sah auf die Uhr: acht Uhr dreißig. Also: einmal Schrankabrücken konnte man mit ungefähr vier Liegestützen berechnen. Hatte ich noch sieben zu machen. Endlich hatten wir den Zapfen wieder. Peter nahm ihn in sein Maul und warf ihn mit selig verdrehten Augen ganz nach hinten in den Rachen. Dann schmiß er sich auf den Rücken und hielt ihn über sich, und schließlich warf er ihn selbst wieder unter den Bücherschrank, um die Sache aufregender zu machen. Währenddessen war ich bei dem zehnten Liegestütz angekommen (minus vier für Schrankrücken). In diesem Augenblick kam Weffi herein und stellte sich sofort unter meine Brust: ich war seine Höhle.
In Peters Gesicht erlosch alle Seligkeit. Er sah mich nur kurz und traurig an: Schade, er ist schon wieder da, der Hanswurst. Wir können nicht weiterspielen.
Schweigend ging er aus der Tür und traf dort auf den Dicken, dem eine merkwürdige Geruchsmischung vorauswallte. Außerdem sah ich, daß er bis hinauf zu den Gelenken schwarze Sumpfhandschuhe angezogen hatte. Der Geruch war teils altes Eingeweide, teils Sumpf. Und dann war noch ein pikanter Schuß dazwischen, etwas Scharfes, fast medizinisch Riechendes — oh, jetzt wußte ich: Schafkötel. Er war also nicht nur bei den Mülltonnen gewesen, sondern hatte auch gleich einen Schlenker auf das angrenzende Feld gemacht, sich in Schafdünger gewälzt und anschließend im Graben gesuhlt — oder umgekehrt.
Da ich die beiden letzten Liegestütze nicht machen konnte, weil Weffi sich den Rücken an meiner Brust rubbelte, ging ich zur Kerze über und versuchte mit dem nötigen Geächze, meinen Körper möglichst steil aufwärts zu stemmen. Cocki legte sich aus Sympathie direkt neben mich auf den Rücken, Gesicht an Gesicht, Weffi kroch gleich hinter meinen Rücken, so daß ich die Beine nicht mehr herunterlassen konnte. Purzelbaum hintenüber? Dann landete ich im Bücherschrank. Also seitwärts umfallen lassen! Dabei schlug ich mit den Füßen auf den Schreibtischrand, und der Federputzer mit den zweihundert Glaskügelchen fiel zum zweitenmal um. Als mein Schmerzgewimmer über die Berührung mit der Schreibtischkante abgeklungen war, sammelte ich mit buddhistischer Selbstdisziplin die zweihundert Kügelchen wieder auf. Dann hielt ich dem Federputzer eine Ansprache: »Jetzt steck’ ich dich weg, du dämliches Luder! Wozu stehst du eigentlich auf meinem Schreibtisch? Wer putzt sich heutzutage noch die Feder in Glaskügelchen? Kein Mensch! Also weg mit dir!«
Als ich zum Bücherschrank ging, um das Urteil zu vollstrecken, mußte ich erst Weffi abschütteln, der meinen großen Zeh durchkaute.
Weff-weff-weff sprang er um mich herum, dann auf den Dicken zu und brüllte ihm in die Riesenohren. Cocki schloß betäubt die Augen, seufzte, stand auf und watschelte hinaus. Frauchen erschien in der Tür: »Was ist denn bloß für ‘n Krawall hier? Nicht mal ausschlafen kann man!«
»Es ist dreiviertel neun«, sagte ich.
»Dann würde ich mich anziehen an deiner Stelle.«
Ich unterdrückte eine ganze Menge von Bemerkungen und ging ins Bad. »Wie stinkt’s denn hier?« fragte sie hinter mir.
»Frag deinen Ältesten!«
Eine halbe Stunde später saßen wir unter der großen Linde im Garten beim Frühstück.
»Du wirst dir was holen in deinem dünnen Schlafrock!« sagte die Mama zu Frauchen. Keine Antwort.
»Eine Lungenentzündung mindestens«, taxierte die Mama. »Außerdem stehst du mit den bloßen Füßen im feuchten Gras, das gibt eine Nierenentzündung.«
Frauchen ließ die Zeitung sinken, sammelte einen Augenblick ihre Gedanken und sagte dann: »Du fütterst ja schon wieder den Dicken!«
Die Mama hatte geglaubt, es sehr geschickt zu machen, indem sie die Hand mit dem Butterbrot unter den Tisch hielt. »Nur so’n Häppchen!« sagte sie.
»Er wird die Fetträude kriegen«, meinte Frauchen. »Komm her, Cocki, setz dich zu mir!«
Der Löwe latschte mißmutig zu Frauchen. Sofort rückte Peter nach und machte Männchen vor der Mama. Weffi setzte sich neben ihn und übertraf ihn noch, indem er nicht nur Männchen machte, sondern auch mit beiden Vorderpfoten bittende Bewegungen ausführte.
»Sieh doch nur, wie er die Hände ringt!« sagte die Mama.
»Laß ihn ringen«, meinte Frauchen hinter der Zeitung. Die scharfen Augen der Familie aber sahen, wie sie hinter dieser Zeitung dem Dicken eine halbe Semmel in den Rachen schob.
»Aha!« machte die Familie und stopfte nun in hemmungsloser Vergeltung Peter und Weffi mit Butterbroten voll.
Frauchen ließ die Zeitung sinken: »Du solltest den Wagen fertigmachen, ich bin in fünf Minuten angezogen.«
Da ich wußte, daß ich demnach noch drei viertel Stunden Zeit hatte, schlenderte ich geruhsam zur Garage, roch unterwegs an der Rose, die neben der Eingangstür blühte, öffnete die Garagentür und sagte »Guten Morgen!« zu Muckelchen. >Muckelchen< — so hieß nämlich das Familienauto. Es war, als ich es vor vier Jahren kaufte, zehn Jahre alt. In diesen vier Jahren hatte ich alles getan, um die Spuren seines hohen Alters zu verwischen. Ich hatte Verdeck und Windschutzscheibe niedriger machen lassen, kleinere Räder gekauft, eine neue Lackierung, ein neues Steuerrad und einen neuen Motor spendiert. Auch hatte ich nach und nach Bremsbeläge, Batterie, Achsschenkelbolzen und die Holzteile der Karosserie erneuert und so allmählich das Geld für einen neuen Sechs-Zylinder in einen vierzehn Jahre alten Vier-Zylinder investiert.
Man mußte sehr vorsichtig mit Muckelchen sein. Ewig fehlte ihm was, und wenn wirklich mal alles in Ordnung war, dann tat es so, als ob ihm was fehle. Wenn man dann nicht darauf achtete, gab es die Sache von selber auf. Vor allem reagierte es unfehlbar, sofort und ausgesprochen boshaft, wenn man mal einen anderen Wagen in seiner Gegenwart lobte oder gar im Gespräch die Anschaffung eines neuen erwog. Dann konnte man sicher sein, daß einem Muckelchen in der nächsten Stunde eine Panne hinlegte oder so über einen Stein fuhr, daß einem das Kinn aufs Steuerrad schlug. Wir sprachen deshalb nur lobend über es, wenn wir in seiner Nähe waren.
Auch heute, in Gedanken an die Wichtigkeit der bevorstehenden Fahrt, war ich — während ich Wasser und öl kontrollierte — voll kriecherischer Freundlichkeit.
»Schön bist du, mein Äffchen«, sagte ich. »So schön sauber dein Ölehen! Herrchen hat dir ja auch so einen feinen Seitenspiegel geschenkt, nicht wahr? Ja, du bist das Beste! Nicht für ‘n Cadillac würde ich dich hergeben! Augenblicklich hat Herrchen zwar kein Geld, aber wenn Herrchen wieder Geld hat, weißt du, dann kauft er dir den schönsten Nebelscheinwerfer, der wirst du wohl ‘raus, du Ungeheuer!«
Das bezog sich auf Cocki, der gerade mit einem seiner Katzensprünge (Springer-Cocker!) das offene Wagenfenster enterte und. dabei den ganzen Türrahmen zerkratzte. Ich packte ihn beim


Kragen: »Was bildest du dir denn ein, Kerl? Wenn Frauchen ihre neue Stellung antritt und nach Schafköteln riecht — he?« Er watschelte weg, wobei noch sein Hinterteil Verachtung ausdrückte.
Dafür war Weffi, ehe ich mich umdrehen konnte, mit einem federnden Sprung auf dem Vordersitz, den Ball in der Schnauze, die Greta-Garbo-Wimpern halb herabgelassen: »Bitte, Chauffeur, fahren Sie mich hinaus!«
Er fuhr hinaus, aber durch die Wagentür, und kriegte auch noch seinen eigenen Ball auf den Hintern gebrannt.
Da war mir doch wirklich wieder die ganze Hundeschleppe gefolgt. Wo war denn Peter? Er saß am Garageneingang, machte Männchen und brachte es fertig, ganz besonders dürftig und bemitleidenswert auszusehen. Ich kniete mich vor ihn: »Es geht doch nicht, Kerlchen, heute nicht!« — und zu den beiden anderen, die sich durch den Gartendschungel schon wieder heranarbeiteten: »Nehmt euch ein Beispiel an Peterchen, der ist immer bescheiden!«
Ich putzte die Polster, drehte die Scheiben hoch, fuhr den Wagen vors Haus. Dann ging ich hinein, setzte mich ins Gesellschaftszimmer und nahm mir ein beruhigendes Buch vor. Es hat keinen Zweck, Frauen, die sich für eine wichtige Gelegenheit anziehen, zu drängen. Der Erfolg ist nur, daß sie den passenden zweiten Strumpf nicht finden, den Puder verschütten und sich einen Nagel abbrechen, der dann erst wieder zurechtgefeilt werden muß. Am besten macht man’s, indem man die altchinesische Methode des Nichthandelns befolgt. Ich tat es und hatte die Genugtuung, nach einer weiteren halben Stunde eine vertraute Stimme zu hören: »Wo ist er denn jetzt wieder? Ich stehe hier die ganze Zeit angezogen und warte und...«
Ich trat aus der Tür: »Hier bin ich, dein Lohengrin! Der Schwan ist vorgefahren. Nichts vergessen?«
»Natürlich nicht. Los, es ist die höchste Zeit.«
Sie hatte tatsächlich nur Handtasche und Schirm vergessen, und nach weiteren zehn Minuten fuhren wir wirklich los.
»Es ist dir doch recht«, sagte ich, auf die Ausfallstraße einbiegend, »daß wir die Hunde nicht mitgenommen haben?«
»Natürlich, sie machen uns heute nur nervös.«
In diesem Augenblick fühlte ich an meinem Gesicht eine struppig-feuchte Berührung und einen vertrauten Geruch.
»Peter!« sagte meine Gefährtin im gleichen Augenblick.
Ich bremste. Ja, da saß er, auf dem Hintersitz aufgebaut, die dünnen Pfoten auf den Lehnen des Vordersitzes, die großen Augen geradeaus gerichtet, als wolle er sagen: »Na, wollt ihr nicht weiterfahren, ich denke, ihr habt’s so eilig?«
»Ja, wie bist du denn ‘reingekommen?« fragte ich fassungslos.
»Hahaha«, lachte Frauchen, »ohne Hunde heute!«
»Wahrscheinlich ist er ‘reingesaust, als du zum zweitenmal zurückliefst und den Schirm holtest.«
»Sollte ich vielleicht ohne Schirm fahren, es fängt doch schon an zu regnen!«
Ich hätte darauf einiges zu erwidern gehabt, fuhr aber statt dessen weiter. Peter knabberte mich am Ohr, ich langte nach hinten und kraulte sein Köpfchen. Er nahm das als Aufforderung, um auf Frauchens Schoß zu springen. Dort saß er mit langem Hals, dauernd den Sitz seiner dürftigen eisgrauen Hinterschenkel wechselnd, die Augen weit aufgerissen.
Warum fuhr er eigentlich mit? Im Gegensatz zu den beiden anderen fuhr er nämlich nicht gern. Manchmal winselte er während langer Strecken leise vor sich hin. Warum also? Aus Pflichtgefühl, um uns zu bewachen? Oder nur, weil er uns den anderen nicht gönnte?
Während wir uns dem Stadtinnern näherten, wanderten meine Gedanken fort, meine Phantasie entzündete sich an der Möglichkeit eines Erfolges und schlug schließlich wilde Wellen. Wenn meine Gefährtin wirklich die Stellung und wenn ich wirklich eine Atempause dadurch bekam und wenn das neue Buch dann angenommen wurde und wenn ich viel Geld dafür bekam — bekam — bekam — bekam — wenn — wenn — wenn dann würde ich ihr einen neuen Wagen kaufen, würde ihn heimlich früh am Morgen Vorfahren und ihr dann einfach so die Schlüssel auf den Frühstückstisch werfen: »Fahr gefälligst deine Karre weg, sie versperrt die Einfahrt!«
»Rechts ‘rum und dann halten!« sagte Frauchen.
Wie? — Ach so, wir waren da.
Sie blieb einen Moment sitzen, holte tief Atem, verfrachtete dann Peterchen auf dem Hintersitz, lächelte mir etwas mühsam zu, stieg aus und warf — peng! — die Tür zu. Und — peng! — hatte ich die Fensterkurbel auf dem Schoß.
»Jetzt gib nicht so an, Muckelchen«, sagte ich wütend, »allmählich geht mir das auf die Nerven, verstehst du? Neuerdings darf man wohl schon nicht mehr denken, was? Na ja — weine nicht — wir behalten dich, selbst wenn...«
Hier trat ich endgültig meiner Phantasie in die Bremsen. Du lieber Himmel — es war doch wirklich noch nicht soweit! Ich saß da auf der Straße, vor einem Geschäft, in dem meine Gefährtin eine Stellung suchte, in einem Wagen, dessen Reparaturen ich vielleicht bald nicht mehr bezahlen konnte, und mit einem von drei Hunden, für die ich dann keine Heimat haben würde.
Ich starrte auf die Ladentür, die sich hinter Frauchen geschlossen hatte. Wenn sie nun keinen Erfolg hatte? Vielleicht war das Ganze nur so ein Gerede unter Frauen? So weit war ich also schon gesunken, daß ich von Weibergerede abhängig war!
Plötzlich fuhr mir etwas Heißes, Feuchtes über den Nacken, während zwei dürftig behaarte Beine meinen Hals von hinten umarmten. Es schien mir, als schiebe eine große Hand alle meine Kümmernisse weit weg, daß sie über den Horizont kippten und irgendwo dort hinten verschwanden.
Ich nahm seine Arme vorsichtig von meinen Schultern, drehte mich um, noch immer seine Pfötchen haltend, und sah ihn mir an, wie er da auf dem Rückpolster aufrecht hockte. Ein kräftiger, schlanker Hund von Pudelgröße, die Figur schön, muskulös, ohne jedes Fett, selbst in der Ruhe die Schnelligkeit des Pfeils ahnen lassend. Nur die äußere Ausstattung seines Fahrgestells war dürftig. Die silbergrauen Pluderhöschen um die eisenharten Schenkel waren aufs äußerste knapp bemessen. Der Bauch schimmerte kahl, und unter den Vorderarmen hatte man die Haare überhaupt gespart.
»Mein Fliegenbein«, sagte ich gerührt, »mein Fünfzig-Pfennig-Hündchen!«
Er wackelte im Sitzen mit dem Schwanz, und selbst der Schwanz brachte es fertig, dürftig auszusehen, als sei er sich bewußt, daß er nur eine Mission habe: anzuzeigen, wo bei diesem Hund hinten war.
Das Gesicht aber, das mich jetzt anlachte, dieses Gesicht ließ alles andere vergessen. Dieser Zusammenklang des schmutzigroten Ziegenbartes mit dem schwarzen Pigment des Gaumens, den schneeweißen Haifischzähnen und der Zunge, die dunkelrot zur Seite heraushing, war so grotesk, daß es schon wieder schön wirkte. Dazu das rußschwarze Näschen und die ulkige silbergraue Stirnlocke, die einzige, die er von der mütterlichen Pudelseite her zustande gebracht hatte. Was aber war das alles gegen seine Augen! Sie konnten traurig blicken wie die Augen eines jüdischen Priesters, der den Untergang Jerusalems sieht, konnten Teufelsaugen voll grausamer Wildheit sein und konnten auch über einen hinweg in visionäre Weiten starren, wo die Elementarwesen, die noch kein Mensch mit leiblichen Augen sah, im Strom der Kräfte auf und nieder steigen. Sie konnten aber auch — wie jetzt — zwei Sonnen sein, die mich voll brennender, unbändiger Liebe anstarrten.
Ich warf einen kurzen Blick auf die noch immer geschlossene Ladentür und den Strom der fremden Menschen, der draußen vorüberfloß. Dann sagte ich: »Hopp!«, und eine Sekunde später saß Peter auf meinem Schoß. Ich nahm sein Köpfchen an meine Brust und streichelte den Rücken, der sich wohlig unter meiner Hand verzog:
»Ach, mein kleines Äffchen«, sagte ich, »weißt du noch, als Frauchen dich damals brachte, mitten im Winter? Nicht größer als eine Ratte warst du damals, und der kleine Löwe wußte zunächst gar nicht, was er mit dir anfangen sollte. Bis dahin war er Alleinherrscher gewesen, und nun kam da so ein kleines, mauzendes Etwas auf ihn zugewackelt und suchte in seinen Bauchzotteln nach den mütterlichen Milchquellen. Welch lächerliche Situation für einen Diktator! Und weißt du noch, die erste Nacht mit ihm in der Küche? Die halbe Nacht ging es wüst da drinnen zu. Alle miteinander, die Mama, Mathilde, Frauchen und ich, kamen in die Küche und knipsten das Licht an, um zu sehen, ob noch etwas von dir übrig sei. Cocki lag auf der Seite, du lagst auf seinem Bauch, und rundherum waren Dutzende von Pfützen, die du angelegt hattest. >Luftaufnahme von Finnland!< sagte ich und schloß leise die Tür.
Und dann, später, zeigte dir Cocki, wie man das Bein hebt und daß man sich seine Würstchen und Seen nicht für die Wohnung aufhebt und nicht einmal für den Garten, sondern sie draußen außerhalb des Gitters erledigt. Eines Tages machtest du mit Herrchen den ersten Spaziergang. Du warst noch immer nicht mehr als ein kleiner Punkt, und die Leute lachten, wenn sie unseren Vorbeimarsch sahen. Herrchen wollte ihnen wenigstens mit deiner Folgsamkeit imponieren, aber als er pfiff, ranntest du weg. Auch das hatte dir Cocki beigebracht. Ich möchte bloß wissen, was er dir damals erzählt hat. Wahrscheinlich: >Wenn der lange Lulatsch diesen komischen Laut ausstößt, kümmere dich nicht darum. Er ist ‘n ganz netter Kerl, aber er hat manchmal so blödsinnige Ideen: Bei Fuß gehen oder Vorsicht, Auto, du mußt das ignorieren, er kann nichts dafür.<
Für Cocki hattest und hast du noch heute jenen ganz besonderen Blick, den du keinem von uns Menschen schenkst. Warum? Was ist das in dir? Die große Liebe? Das Schicksal? Beides vielleicht. Ach, Peterle, wir leben doch nun so eng miteinander, und was wissen wir im Grunde voneinander? Manchmal kommt’s mir vor, als seist du ein Stück von mir, und manchmal wieder, als lebten wir auf ganz verschiedenen Planeten.
Aber du hast dich nie in deiner Liebe zum Dicken beirren lassen. Wenn ihr auch nur ein paar Stunden voneinander getrennt seid, dann ist es für dich, als sei die Sonne untergegangen, und wenn ihr euch dann wiedertrefft, fällst du ihm um den Hals, als wäret ihr Jahre getrennt gewesen. Siehst du denn gar nicht das unverschämte Gesicht dieses Kerls, diese gespielte Gleichgültigkeit, mit der er deine Liebkosungen hinnimmt?«
Gespielt? Ja, sie ist gespielt, diese Gleichgültigkeit! Wenn ich’s mir jetzt überlege, weiß ich es ganz genau. Er liebt dich auch, wenn auch ganz anders, auf Diktatorenweise. Wenn er nach Hause kommt, und du bist mal nicht da, dann solltest du die gefurchte Stirn sehen, mit der er um sich blickt, als wollte er sagen: »Wo ist er denn, der Kerl, zum Donnerwetter!« Er watschelt durch alle Zimmer und in alle Gartenecken und sucht dich, und wenn du dann kommst und ihm um den Hals fällst und ihm die Ohren leckst und dich unter seinem Hals durchwindest und dich vor ihm niederwirfst und ihm deinen kahlen Bauch zeigst, dann hat er etwas in seinen Löwenaugen, etwas, das er gleich wieder versteckt, damit du nur ja nicht merkst, wie sehr auch sein Herz an dir hängt. Aber du merkst es natürlich. Und vielleicht ist das das Geheimnis: Die große Liebe. Vielleicht, daß ihr so das Gebot Gottes mehr erfüllt als wir Menschen, die wir eure Götter sind.
Während mir diese Gedanken durch den Kopf gingen, streichelte ich mechanisch Peterles Rücken. Nach einer Weile drehte er sich auf meinem Schoß um, steckte den Kopf zwischen die Pfoten und begann selig zu schmatzen. Meine Gedanken glitten allmählich von ihm ab und meinem neuen Werk zu. Plötzlich aber richtete er sich steil auf und versetzte mir einen stilechten Kinnhaken, daß ich schon dachte, ich hätte einen meiner wackligen Backenzähne auf der Zunge. Dann fuhr er keifend gegen die Scheibe. Was war denn los? Ach so, ein kleiner Junge war am Wagen stehengeblieben und hatte die Klinke angefaßt.
Ich betrachtete Peter halb erstaunt, halb amüsiert. So war er doch sonst nicht? Das tat doch nur Cocki! Und da, als er mich mit so einem ganz erwachsenen Blick voller Verantwortungsglück ansah, verstand ich ihn: Er war endlich einmal allein mit mir, der Alleinhund, der mit niemandem zu teilen brauchte. Ja, wirklich, solange ich zurückdenken konnte, hatte er kaum zwei-, dreimal einen Menschen für sich allein gehabt. Nun genoß er es, nun schwelgte er. Jetzt war er der Boß und für mich und mein Eigentum verantwortlich. Jetzt mußte er mir alle anderen ersetzen, vor allem Cocki. Er mußte mich bewachen, verteidigen und trösten. Ach, er hatte ja plötzlich so unheimlich vieles und Wichtiges zu tun! Und das mindeste, was ich von mir aus tun konnte, war, ihn dabei ernst zu nehmen: »Ja, ja, Peter«, sagte ich (ganz ernst >Peter<, nicht >Fliegenbein< oder >Affenauge< oder so was Ähnliches), »paß schön auf!«
Er war so gerührt, daß er mir die Pfote reichte, sprang dann sofort auf und machte noch einmal die Runde im Wagen. Glücklicherweise entdeckte er auch einen im Passantenstrom vorbeitrottenden Schäferhund, den er heftig zurechtweisen konnte. Der Schäferhund blieb stehen, schaute auf und stellte ein Ohr nach vorn. Peter erklärte ihm ungefähr: »Das hier ist unser Wagen, verstehst du, du dickes, vollgefressenes, albernes Riesenmöbel? Und wenn du nicht bald weitergehst, springe ich aus dem Fenster und reiße dir den Schwanz ab und das Ohr und sonst noch alles, was um deinen dicken Bauch herumhängt!«
Es gibt unter Hunden so etwas wie einen Ehrenkodex des Besitzes. Man versucht sehr selten, dem anderen sein Eigentum streitig zu machen, ob es sich nun um Haus, Garten, Schlafdecke oder Freßnapf handelt oder auch um das eigene Auto. So drehte denn der Schäferhund das Ohr wieder nach hinten und trottete mit hängender Rute weiter. Nur mit einem kurzen Blick schaute er auf das Wagenfenster zurück, hinter dem der rote Ziegenbart auf und nieder fuhr: »Ja, ja, weiß schon, reg dich nicht auf, Hanswurst!«
Die Ladentür! Da war sie — Frauchen! Peter hatte sie auch gleich entdeckt und schnellte hoch. Wir starrten ihr beide mit angehaltenem Atem entgegen. Was machte sie für ein Gesicht? Auf jeden Fall war es ernst. Aber nicht niedergeschlagen. Mein Herz klopfte. Als sie nach der Türklinke griff, lächelte sie mir zu.
»Was ist?« Meine eigene Stimme kam mir fremd vor.
»Alles in Ordnung!«
»Wann fängst du an?«
»Morgen. Grüß dich, mein Peterle! Denke mal, du brauchst nicht aus deinem Häuschen und aus deinem Garten. Du kannst weiter den Igel anbellen und auf der Schwelle liegen und im Frühling, wenn es wieder Pusteblumen gibt, so ganz vorsichtig zwischen ihnen liegen, daß keine von ihnen eine einzige Locke verliert.«
»Dann fahr’ ich uns nach Haus.«
»Ja, bitte.«
Sie hob Peter nach hinten, wobei er ihr schnell die Hand leckte, und setzte sich neben mich. Er baute sich hinter uns so auf, daß er zwischen unseren Köpfen nach vorn und gleichzeitig auch aus beiden Seitenfenstern sehen konnte. Ich fuhr an.
Wir fuhren schweigend, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt. Also — die Atempause. Ich würde sie ausnutzen, weiß Gott, ich würde es! Arbeiten, arbeiten und noch mal arbeiten, bis ich den Laden wieder auf ebenem Kiel hatte.
Langsam ziehen die Geschäfte und der Menschenstrom der Hauptstraße an uns vorbei. Die Gesichter sind mir nun nicht mehr fremd und feindselig. Das Tageslicht scheint heller zu sein.
Da schreit Peter auf. Es ist ein wilder, stöhnender Laut äußerster Todesnot, wie ihn ein Hund nur ausstößt, wenn er in den Fängen eines stärkeren Gegners zu verenden droht. Ich werfe den Kopf nach links, und da sehe ich ihn auch, den Lastzug, der aus der Nebenstraße auf uns zurast — riesenhoch, donnernd, mit einem hin und her schlagenden Anhänger dran. So einfach nach dem Prinzip: Ich bin der Dickere, der andere wird schon bremsen.
Irgend etwas in mir, das schneller ist als jeder Gedanke, übernimmt des Kommando und läßt mich das Steuer nach links herumreißen: Auf Gegenkurs gehen, damit er uns nicht in der Seite faßt! Vielleicht kommen wir so noch aneinander vorbei. Jetzt haut auch der Große die Bremsen ‘rein, meine Gefährtin schreit auf, ich fühle ihre Hand, die sich in meine Schulter krallt. Als sei mein Auge plötzlich auf Zeitlupentempo geschaltet, sehe ich, wie meine Kühlerfigur sich in der Schwenkung an den riesigen Vorderrädern des Lasters vorbeidreht. Das erste ist vorüber. Wir stehen schon ganz schräg — zweites Riesenrad vorbei — eine Hundertstelsekunde lang atme ich auf: ich liege jetzt tatsächlich auf Gegenkurs. Aber da kommt der Anhänger, er schleudert auf dem nassen Pflaster und rast von rechts auf uns zu wie eine Wand — ich drehe verzweifelt weiter, stehe nun schon schräg rückwärts — erstes Anhängerrad vorbei — aber da — da — Krach! Es schmettert rechts neben mir im Wagen. Ich spüre einen Schlag gegen die Brust, einen Schmerz im Knie, auch mein Kopf stößt irgendwo an. Dann ist der Spuk vorbei. Wir stehen. Pause. Einen Moment bleibe ich wie erstarrt und stiere nur dumpf auf das Stück des Steuerrades in meiner Hand. Ich lebe! Erstaunlicherweise lebe ich. Meine Gefährtin! Ich lasse das zerbrochene Steuerrad fallen und drehe mich zu ihr um. Gerade sinkt sie neben mir zusammen. Ihr Gesicht ist ganz klein und gelb. Ein großer Glassplitter, wie ein Dolch, steckt in ihrer Wange, kippt dann langsam nach vorn und gleitet über ihre Schulter aufs Polster. Ein Strom von Blut schießt hinterher. Auch aus ihrem Mundwinkel fließt Blut, und auch die rechte Hand, die lahm im Schoß liegt, ist blutig. Tot? Entsetzlicher Traum! Wann wache ich auf?
Da bringt mich der Schmerz im Knie wieder zu mir. Ringsherum Geschrei und nun viele Gesichter. Ich werfe mich mit der Schulter gegen die Tür. Sie klemmt, aber ich stemme sie auf. Etwas Schwarzes schießt einen Moment über meine Schulter weg an mir vorbei: Peter! Ihm ist nichts passiert. Hände packen mich am Arm, unter den Schultern. Ich stehe draußen zwischen vielen Menschen und wanke. Mir wird schlecht, grüne Nebel — aber ich drücke sie weg. Dann humple ich um den Wagen herum. Man hat die rechte Tür, die nur noch lose zerbrochen in den Angeln hängt, schon aufgerissen. Ich sehe, wie meine Gefährtin gleich einer Puppe, einer fürchterlichen Marionette herauskippt. Man faßt sie unter den Armen. »Vorsicht!« schreit jemand. »Nicht anrühren!« Ganz langsam läßt man sie auf das Pflaster gleiten, das voller Glasscherben und Holzsplitter liegt. Da schlägt sie die Augen wieder auf. Sie will mit der Hand nach mir greifen, aber sie kann es nicht. Nur die Finger bewegen sich ein bißchen. Ihre Lippen sind weiß bis auf das Blut, das daran herunterläuft. Sie flüstert: »Nicht hinlegen — ich will stehen!« Dann sinkt sie wieder in sich zusammen.
Polizeiuniformen. Wo ist denn der Lastzug? — Ach, da hinten, weit hinten in einer Nebenstraße. — Aber das ist ja auch alles egal. Ich beuge mich herunter und helfe, sie auf die Beine zu stellen. Sie reißt sich mit übermenschlicher Anstrengung zusammen und bleibt so eine Weile, von vielen Händen gehalten und langsam hin und her schwankend. Ihr Kleid hängt in Fetzen. »Mein Hut — meine Handtasche«, murmelt sie verwirrt. Jetzt klingelt es, die Menschenhaufen weichen zur Seite, Bremsenquietschen, Ambulanz — und jetzt eine Sirene — Unfallkommando.
»Gleich um die Ecke ist das Krankenhaus!« sagt jemand. Wieder grüne Nebel.
Als ich zu mir komme, stehe ich in einem Raum mit gekachelten Wänden und glitzernden Instrumenten. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Schwestern und Ärzte mit Tüchern vor dem Mund, Operationstisch, ein dunkles Bündel drauf. Braunes Haar, blutüberronnen. Eine Hand hängt herunter, wird von einer Schwester wieder heraufgehoben, festgehalten. Etwas wird an diesem Bündel gemacht, es bäumt sich auf, stöhnt.
»Was ist denn mit Ihnen?« Das ist ein anderer Arzt, ein junges gebräuntes Gesicht, schwarzes Kraushaar.
»Nichts — nur das Knie — aber nicht viel — was ist denn...«
Das Gesicht des Arztes ist sehr ernst: »War sie ohnmächtig?«
»Ich glaube — einen Augenblick — aber was ist...«
»Hat sie sich übergeben?«
»Ich weiß nicht — nein — aber...«
»Wir werden sehen! Beruhigen Sie sich. Hier, trinken Sie mal!« Er reicht mir ein Gläschen mit einer milchigen Flüssigkeit, beobachtet mich, während ich schlucke. Mir wird etwas klarer. Das Bündel drüben ist ganz still. Der Arzt, der sich darüberbeugt, hat die Hand ausgestreckt, und eine der Schwestern steckt ihm etwas hinein.
»Wenn Sie sich dann danach fühlen«, sagt der junge Arzt zu mir, »gehen Sie lieber ‘raus zum Wagen. Eine Schwester geht mit Ihnen und bringt Sie wieder zurück. Man braucht Sie da draußen.«
Zwischendurch setzt es immer für Sekunden bei mir aus. Da gehe ich schon die Stufen hinunter auf die Straße. Eine Hand ist an meinem Arm, eine Schwester, eine kleine dicke Blonde. Sie hat freundliche Augen und sieht entschlossen aus. »So, noch eine Stufe!« sagt sie.
Menschen — es sind noch viel mehr Menschen geworden, die halbe Straße voll, so weit man sehen kann. Wer spricht da mit mir? — Ach so, ein Polizist.
Die Menschen weichen zur Seite, einen Moment sehe ich Muckelchen. Was von ihm übrig ist. Ein zerschlagenes, schauerliches Wrack, eine verbeulte Blechschachtel mit Blutflecken. Es hat das rechte Vorderrad unter dem Bauch, die Motorhaube ist zusammengeknüllt, als habe eine Riesenfaust hineingehauen. Da ist ein grüner Wagen mit blauen Scheinwerfern und Milchglasscheiben. Man hilft mir zwei Stufen hinauf. Drinnen ist ein richtiger Schreibtisch und ein Polizeibeamter dahinter. Er hilft seinem Kollegen, mich in einen Stuhl zu setzen. Ich soll — so gut es geht — erzählen, wie es kam. Ich starre ihn nur an. Da stellt er Fragen. Ich antworte mechanisch. Allmählich komme ich zu mir. Es tut mir wohl, wieder zur Sachlichkeit gezwungen zu werden. Ein Dritter im Hintergrund rattert auf der Schreibmaschine. Dann schiebt man mir ein Blatt Papier hin: »Bitte unterschreiben!« Ich tue es.
»Besser ist es, Sie stellen auch gleich Strafantrag gegen den schuldigen Fahrer!« sagt der Wachtmeister.
Ich zögere. »Ich mache so was nicht gem.«
»Er hatte zwanzig Meter Bremsspur«, sagt der Beamte, »wahrscheinlich war er auch betrunken. Es ist besser, wenn Sie unterschreiben, wegen der Versicherung!«
Ich unterschreibe. Dann fällt mir etwas ein: »Wo ist Peter?«
»Wer?«
»Peter — ein Hund — ein kleiner schwarzer Hund.«
Der Beamte starrt mich besorgt an und wechselt einen kurzen Blick mit seinem Kollegen: »Es ist besser, Sie lassen sich auch untersuchen!«
Dann bin ich wieder in dem Operationssaal. Das Bündel sitzt jetzt aufrecht, der Kopf ist ein dickes weißes Paket. Nur die Augen schauen heraus, das eine ist ganz zugeschwollen, nur noch ein Schlitz ist sichtbar. Eine Schwester steckt ihr das zerfetzte Kleid mit Sicherheitsnadeln zusammen. Frauchens Hand kommt auf mich zugekrochen. »Laß mich nicht hier!« flüstert es aus dem Verband. »Ich war doch nicht ohnmächtig — laß mich nicht hier —, ich habe mich auch nicht übergeben, nicht wahr? Sie denken, es ist Schädelbruch, aber ich habe mich doch nicht übergeben, laß mich nicht hier.« Die geflüsterten, kaum verständlichen Worte schnurren herunter wie ein Uhrwerk, immer wieder von neuem. Ich sehe mich nach dem Arzt um: »Sie hat solche Angst vor dem Krankenhaus. Geht es nicht, daß wir sie heimbringen, Doktor?«
Er zaudert, dann zuckt er die Schultern: »Auf Ihre Verantwortung!«
»Dann lassen Sie doch bitte ein Taxi rufen!«
»Na schön, aber derweilen werden wir Ihr Knie verbinden.«
Ich sehe an mir herunter, das linke Hosenbein ist zerfetzt, das Knie schaut heraus und ist blutig. Auch mein Hemd ist auf der Brust zerrissen. »Was ist denn das?« fragt der Arzt, während er das Knie verbindet.
»Ich weiß nicht — vielleicht die Steuersäule.« Man betastet mir das Brustbein. »Gebrochen ist nichts.«
»Nein, sicher nicht«, sage ich hastig, »ein blauer Fleck wahrscheinlich nur.« Ich will weg hier, heraus hier. — Wo ist Peter? Ich traue mich nicht noch einmal nach ihm zu fragen, sonst halten mich vielleicht auch die hier für verrückt.
Dann wieder draußen. Es hat aufgehört zu sprühen, noch immer viele Menschen. Auf der anderen Straßenseite flutet wieder der Verkehr. Auf dieser hier ziehen sie jetzt Kreidestriche und fotografieren. Ein Taxi. Während es sich mit uns durch die Menge zwängt, kommen wir an dem Lastwagen vorbei. Der Fahrer steht zwischen zwei Polizisten und gestikuliert. Meine Gefährtin lehnt schwer an meiner Schulter. Der verbundene Kopf ist nach vorn gesunken.
Dann das Haus. Ein Wagen steht davor, unser Hausarzt, Dr. Nebelthau. Man hat wohl schon vom Krankenhaus aus nach ihm telefoniert. Mama und Mathilde am Zaun. Menschen aus der Nachbarschaft. Sie starren uns an. Die Mama ist weiß wie eine Wand und hat die Hand vor den Mund geschlagen. Jetzt ist sie bei uns, während man Frauchen aus dem Wagen hilft.
»Mein Junge — und mein armes Kind —, ich dachte schon so etwas, als Peter kam.«
»Peter?«
»Ja, er kam vor ein paar Minuten und hat sich gleich verkrochen. Wir haben ihn aus dem Keller geholt.«
Peter! — Jetzt sind wir in Frauchens Schlafzimmer. Dr. Nebelthau ist ein dicker, gemütlicher Mann, ein weiser Mann. Seine Gegenwart tröstet mich merkwürdig.
Mathilde räumt gerade die blutigen Kleider weg. Sie weint. Der Arzt steht über das Bett gebeugt. Etwas drängt mich zur Seite, ist dann mit einem Satz auf der Steppdecke — Cocki! Er stöhnt wild auf, leckt Frauchen über die Bandage, dann fährt er herum und faucht zähnefletschend den Arzt an. Ich packe Cocki am Kragen, er strampelt und will auch mich beißen. Der Arzt dreht sich zu mir um: »Lassen Sie mich bitte allein!«
Er sieht besorgt aus, während er sein Stethoskop auspackt.
Wir schleichen uns aus dem Zimmer, ich noch immer mit Cocki auf dem Arm, der jetzt still geworden ist und nur noch winselt. Er hat den Kopf nach hinten gedreht und starrt auf die Tür von Frauchens Zimmer. Während ich die Treppe zum Erdgeschoß hinunterhumpele, streichele ich ihn: »Es ist ja nichts«, sage ich, »es ist ja nichts, mein Dickerchen! Es wird ja alles wieder gut!«
Dann stehe ich unten im großen Gesellschaftszimmer. Mein Knie brennt. Es fällt mir jetzt auch schwer, das Bein zu bewegen. Draußen ist heller Sonnenschein. Da blüht ja noch die große rote Rose am Eingang — jetzt ist sie wie ein Klumpen Blut. Vor dem Zaun stehen noch immer die Nachbarn und starren nach unseren Fenstern. Merkwürdig...
Jetzt wird mir aber doch wieder schlecht. Ich drehe mich um, lasse mich in einen Sessel fallen, Cocki rutscht aus meinen Armen und kratzt an der Tür.
Da sehe ich hinten auf dem Sofa etwas leuchten: Peterles Augen! Er liegt da, starrt mich an, zittert. Ich quäle mich noch einmal aus dem Sessel und setze mich neben ihn. Als ich ihn streichele, zittert er noch mehr. »Peterle«, höre ich mich sagen, »wie hast du denn bloß den Weg gefunden, Junge, mitten aus der Stadt bis hierher? Wie bist du bloß über die Dämme gekommen?«
Etwas kratzt an der Tür. Weffi. Die Tür wird von außen geöffnet. Mathildes Stimme sagt: »Na, geh hier ‘rein — und du bleibst schön drin, Cocki!«
Dann kommen, tip-tip-tip, Weffchens Krallen über das Parkett. Er sieht mich aus seinen stillen braunen Augen an und springt auf meinen Schoß. Da faucht ihn Peter an wie eine Natter, daß er verdutzt wieder herunterspringt. Peter kriecht auf meinen Schoß. Er »besitzt« mich im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt ist er mein Hund, durch das, was wir gemeinsam erlebten, mit mir noch inniger verbunden, und er scheint entschlossen, dieses Vorrecht so lange wie möglich zu verteidigen.
Dann knarren schwere Tritte die Treppe hinunter: Dr. Nebel-thau. Er setzt sich vor mich in den Sessel.
»Da rechts von Ihnen steht der Cognac«, sage ich zu ihm. Er nickt und gießt sich einen ein. Dann füllt er ein zweites Glas und bringt es mir herüber. »Sie können auch einen gebrauchen!«
»Was ist, Doktor?«
Er sieht an mir vorbei aus dem Fenster: »Tja — man muß sehen. Im ersten Augenblick kann man noch gar nichts sagen. Erst wenn der Schock abgeklungen ist.«
»Lebensgefahr? «
»Nein, das nicht, aber...«
»Ich hätte sie vielleicht nicht herbringen dürfen?«
»Doch, ich glaube, es war richtig. In der gewohnten Umgebung läßt der Schock am schnellsten nach. Ich habe ihr eine Spritze gegeben, sie wird bald schlafen.«
Dann, als Dr. Nebelthau gegangen ist, sitze ich wieder an ihrem Bett. Das Morphium beginnt schon zu wirken.
»Ich werde ein verstümmeltes Gesicht haben«, flüstert sie.
»Unsinn! Selbst wenn eine kleine Narbe bleibt — so was bringt man heute ohne weiteres weg.«
»Aber meine Stellung — ich werde meine Stellung nicht antreten können.«
»Das wird uns die Versicherung ersetzen. Du lebst, und es ist nichts Ernstes. Sei dankbar.«
Das Auge, das eine Auge ist ihr zugefallen, aber das Lid flattert, hebt sich wieder: »Was ist mit — Peterchen?«
»Er ist hier, nach Haus gelaufen!«
»Nach — Haus...«, ihre Stimme wird lallend: »Wie — konnte — er — denn — finden?« Sie schläft.
Etwas streicht an meinem Bein vorbei, Cocki. Er quetscht sich unter das Bett, dreht sich ächzend um, und dann kommt seine dicke Schnauze mit den Tatzen wieder zum Vorschein. Seine Augen sehen mich vorwurfsvoll an. So, als ob ich Schuld hätte. Aber ich habe doch keine Schuld, ich habe doch alles versucht!
Mit einemmal bin ich müde, entsetzlich müde. Es ist, als ob die Decke auf mich herunterkommt. Das Knie. — Ich schleiche in mein Zimmer, lasse mich auf die Couch fallen. Etwas kringelt sich auf meinen Füßen zusammen. Ach, Peterle! — Jemand tritt mir aufs Gesicht und wirft sich neben mir auf das Kissen: Weffi.
Aber ich habe doch keine Schuld. »Zwanzig Meter Bremsspur — wollen Sie nicht Strafantrag stellen?« Keine Schuld. Was wird nun?
Dann weiß ich nichts mehr.
Als ich wieder aufwache, ist draußen schon tiefe Dämmerung. Ich liege angezogen auf der Couch? Wieso denn, was war denn? Und nun kommt es über mich, als presse sich ein schwerer Stein auf mein Herz. Nach links drehen, links — links — geht denn das Steuer nicht weiter? — Erstes Rad — zweites Rad — Riesenrad — Peter schreit auf — und da — der Anhänger — der Glassplitter in Frauchens Gesicht, ganz langsam kippt er nach vorn — das rote Blut hinterher über das gelbe kleine Gesicht. Ich presse die Hände vor die Augen und fange mich wieder. Ich nehme die Hände wieder herunter und streichele die beiden Köpfchen, den weißen Kastenbart neben mir, der durch die Dämmerung des Zimmers schimmert, und die kleine Silberlocke dort in meinen Kniekehlen. Ein leises Geräusch rechts von mir, ich drehe mich um. Da sitzt die Mama an meinem Schreibtisch und legt sich in der halben Finsternis eine Patience.
»Mach doch das Licht an«, sage ich, »du wirst dir die Augen verderben.«
»Sparen«, sagt sie, »immer sparen.«
»Das hat jetzt doch keinen Zweck mehr, es ist eh schon egal.«
Ihre Hand mit einer Karte zwischen den Fingern bleibt in der Luft stehen: »Ist es so schlimm mit uns?«
»Ziemlich.«
Die Finger beginnen zu zittern, legen dann schnell die Karte hin.
»Möchtest du dich nicht ausziehen und zu Bett gehen?« fragt sie.
Ich sehe auf die offene Tür, die zu Frauchens Zimmer führt. »Hast du mal nachgeschaut?«
»Schläft noch. Geh nicht ‘rein, sonst blökt Cocki, er liegt noch immer unter ihrem Bett. Willst du nun schlafen? Dann mache ich dir die Couch zurecht.«
Schlafen! Plötzlich wird alles um mich herum zu eng: »Nein, ich will noch mal mit den Hunden ‘raus.«
»Das ist doch Unsinn, und mit deinem Bein vor allem.«
Aber ich bin schon aufgestanden. Der Verband am Knie ziept. Weffi verdreht die Augen und läßt ein halblautes Probe-Weff los. Ich packe ihn und hebe ihn hoch, damit er nicht weiter quäkt. Peterle ist schon an der Tür, er winkt mit dem Kopf. Nebenan ein Ächzen und Knarren. Cocki quält sich unter dem Bett vor. Da ist er auch schon.
Die Stufen tun meinem Knie lausig weh, so daß ich mich frage, ob es nicht wirklich Unsinn ist, noch mal hinauszugehen. Aber ich beiße die Zähne zusammen, angle mir den Stock der Mama aus dem Schirmständer und mache die Tür auf. Cocki und Peter schießen gegen die Gartenpforte. Mit einem halben Auge sehe ich, wie Mathilde mir aus dem Küchenfenster nachschaut.
Weffi strampelt wie wild, aber ich setze ihn erst draußen auf der Straße hin. Er rast den anderen nach, die schon an der Ecke mit ihrem Freund, dem Schäferhund Alf, hin und her toben. Peter scheint ja den Schock überwunden zu haben. Wenigstens er. Während ich ihnen langsam nachhinke, sehe ich mich um. Ich darf nichts von alledem hier versäumen: die Pappeln da neben der Kirche, die Rosen in den Gärten — nichts. Es wird ja sowieso bald alles vorbei sein, mit dem Haus, mit der Straße hier, mit unseren friedlichen Abendgängen. Und außerdem: jede Sekunde des Lebens sollte man genießen, auspressen bis zum letzten. Man sieht ja, wie schnell alles vorbei sein kann.
Ich bin die Straße hinuntergehinkt und stehe nun am Ende, wo das Feld beginnt. Die Getreidepuppen heben sich dunkel wie eine marschbereite schweigende Armee gegen den Himmel. Die Sonne ist schon versunken und hat ein Gewölbe schwerer Wolken in einem dunkelroten Brand hinterlassen, der schnell verglüht. Das Licht hier auf der Erde nimmt rasch ab, so daß ich meine drei auf dem Feld nur mit Mühe entdecken kann. Weffi gräbt anscheinend in einem Mauseloch, der Dicke bricht gerade aus einer Getreidepuppe, in der er herumgeschnüffelt hat, und Peterle steht ganz nah links von mir, die eine Pfote erhoben, und riecht in den Wind.
Nun ist am Himmel nur noch ein meergrüner Schein. Aus dem Wolkengeschiebe im Westen hat sich ein ungeheurer Gewitteramboß geformt, der schnell über unseren Köpfen heraufwächst. Ich starre ihn gebannt an und fühle, wie sich vor dieser Gewalt der Natur der Krampf in meiner Brust etwas löst. Das Wolkenmonstrum muß Tausende von Metern dick sein, denn sein höchster Gipfel leuchtet noch weiß mit einem ganz leichten rosa Schimmer. Jetzt wacht der Wind auf, ein böser Wind voll Elektrizität, der sich über das Feld hin anschleicht wie eine Katze. Nun springt er mit voller Kraft los, daß es mir den Atem verschlägt und die Büsche am Feldrand sich tief hintenüber legen. Alle drei Hunde sind plötzlich bei mir.
»Na, kommt«, sage ich.
Hinten über der Stadt beginnt es zu wetterleuchten. Weffi trabt als erster heim, der Dicke hinterher. Ich kann gerade noch erkennen, wie bei jedem Watschelschritt seine langen Ohren hin und her pendeln. Peter bleibt an meiner Seite, er sieht prüfend zu mir auf: »Na, geht’s schon etwas besser?«
Ich bleibe stehen, beuge mich zu ihm hinunter und streiche über sein Köpfchen: »Ja, geht schon, wir werden’s schon schaffen, Peterle!«
Oben hat die Mama meine Couch zurechtgemacht, ein Tablett mit Abendbrot steht auf dem Stuhl daneben. Ich schaue vorsichtig in Frauchens Zimmer. Die Mama hat die Nachttischlampe an die Erde gestellt. In ihrem halben Licht sehe ich den bandagierten Kopf. Sie schläft noch, murmelt mitunter vor sich hin. Es war also wirklich geschehen — kein böser Traum. Ich schließe die Tür, ziehe mich aus und werfe mich auf die Couch, ohne das Essen anzurühren. Ich verteile es unter die drei. Dann kriecht der Dicke auf meinen Schreibtischsessel, und die beiden anderen beziehen ihre Posten auf der Couch.
Lange liege ich bei ausgelöschtem Licht und starre in die Finsternis. Der Sturm tobt in den Bäumen, und manchmal stößt er seine Faust durchs Fenster, daß sich die Vorhänge blähen. Ich fühle bis in die letzte Zelle, wie sich da hoch über uns das Wetter aufbaut, gleich einer riesigen dunklen Welle, die sich jeden Augenblick überschlagen kann. Symbol meiner Situation, dieser Tag. Heute morgen noch schien alles gesichert und voller Hoffnung. Und jetzt — das Schiff sinkt. Ich darf mir darüber nichts vormachen.
Hui — war das ein Blitz! Für eine Sekunde stehen die Scheiben des Bücherschrankes im blauen Licht — zwei — drei — vier — und jetzt der Donner, gleich einer riesigen Eisenkugel durch einen gewundenen Schacht herunterrollend und gegen die Wände krachend. Das ganze Haus zittert.
Im nächsten Augenblick habe ich alle Hände voll zu tun. Weffi ist neben mir hochgefahren, steht mit zitternden Hosen und eingeklemmtem Schwanz und starrt gegen das Fenster. Ich knipse schnell das Licht an, damit er die Blitze nicht so sieht. Aber der nächste Einschlag fegt ihn auf den Teppich. Dort bleibt er hechelnd und schlotternd stehen. Der Dicke fällt mit einem Plumps aus dem Schreibtischsessel und kratzt an Frauchens Tür. Auch er zittert und hat den langen, dicken Zungenlappen schlaff aus dem Maul hängen. Die Mama erscheint:
»Was ist mit den Hunden, soll ich einen nehmen?«
»Hat keinen Zweck, Mamachen, ich werde schon mit ihnen fertig. Ich schlafe sowieso nicht.«
»Na, glaubst du, ich schlafe?«
»Natürlich nicht, natürlich nicht, aber jetzt geh und — schlaf weiter!«
Sie verzieht sich gekränkt.
Ich lächle hinter ihr her. Dann wandere ich, unter immer neuen Einschlägen, mit den beiden Angsthasen herum. Nirgends ist es sicher und finster genug, selbst im Heizungskeller nicht. Schließlich einige ich mich mit Cocki auf die leere Garage und mit Weffi auf den großen Stollenschrank unten im Gesellschaftszimmer. Dort kringelt er sich schlotternd auf Mamis alten Nählumpen. Ich decke ihn mit einer durchlöcherten Tischdecke zu. Die Schranktür lasse ich angelehnt, damit er wieder herauskann.
Als ich wieder nach oben komme, sitzt Peter im Schreibtischsessel und starrt aus dem Fenster. Er allein hat keine Furcht und folgt mit großen Geisteraugen den Blitzen. Das eine Ohr ist spitz aufgereckt, das andere ergeben-verbindlich weggeknuckelt. Wahrscheinlich für den Fall, daß seine Furchtlosigkeit höheren Orts doch übel vermerkt würde. —
Ich hebe ihn hoch und nehme ihn mit auf die Couch: »Mein Dunkelmännchen«, sage ich, »mein Jenseitsauge!«
3
In den folgenden Tagen wurde mir sehr schnell klar, daß der Pessimismus, die dunkle Schicksalsangst dieser Gewitternacht berechtigt waren. Der schleudernde Anhänger des Lastzuges hatte nicht nur das Muckelchen, sondern auch unser ganzes bisheriges Leben zertrümmert.
Frauchens Verletzungen waren schwerer als ursprünglich angenommen. Der dicke Dr. Nebelthau wurde zunehmend besorgter. Heimtückische Lähmungserscheinungen traten auf. Irgendwas war kaputt, an der Wirbelsäule oder gar am Kopf. Spezialisten wurden zugezogen, immer neue Röntgenaufnahmen, schmerzhafte Untersuchungen. Es war gar keine Rede mehr davon, daß sie in absehbarer Zeit ihre Stellung antreten konnte. Statt dessen zehrten Ärzte, Medikamente und Rechtsanwaltskosten an unseren Spargroschen. Nur mühsam und widerwillig ließ sich die gegnerische Versicherung das Allernotwendigste entreißen. Sie biß wütend um sich, schoß zurück mit einer ganzen Batterie gewiegter Anwälte, mit der Anforderung immer neuer Gutachten und Gegengutachten. Es war klar, daß ich das Haus nicht mehr halten konnte und mich in meinem Leben vollkommen umstellen mußte.
Der Gefährtin gegenüber mimte ich den Optimisten:
»Die Sache ist ganz einfach, du brauchst dich gar nicht aufzuregen. Du machst jetzt deine Badekur und bist für zwei Monate untergebracht, die die Versicherung bezahlt. Die Mama, Mathilde und ich lösen hier in aller Ruhe den Haushalt auf. Die Möbel werden im Speicher untergestellt, bis mein neues Buch angenommen ist. Die Mama und ich gehen aufs Dorf, irgendwohin, wo’s ganz billig ist. Es wird großartig. Ich freue mich schon drauf. Wenn ich mir vorstelle, daß ich morgens die Augen aufmache, und die Hähne krähen, die Ferkel grunzen, die Kühe muhen. Es riecht nach — nach — na, eben nach Land. Man frühstückt in einer richtigen Bauernstube mit frischen Eiern und Kuckucksuhr und zahmen Tauben auf der Stuhllehne. Dann geht man aufs Herzelhäuschen und liest dabei im Lokalblatt, daß in Hintertupfingen Bullenmarkt ist und der Alois Oberhuber in Wollershausen den ersten Preis im Schafkopfen gewonnen hat. Darauf geht man in den Kuhstall, die Schwalben fliegen ‘raus und ‘rein.«
»Die Schwalben sind bald fort«, sagte Frauchen, die derweil mit geschlossenen Augen auf der Couch lag. Ihr Gesicht ganz spitz und weiß, das einzig Rote darin die jetzt vernarbende Wunde. »Und was ist mit Mathilde?«
»Mathilde hat mir gestern selbst die Kündigung angeboten. Und weißt du, was sie mir sogar noch angeboten hat? Ihre Ersparnisse! Ich war so gerührt, daß ich beinahe geheult hätte. Na, ist das nicht sehr erfreulich, eine solche Treue? Sie war direkt beleidigt, als ich das Geld nicht nahm, es war ganz ernst gemeint. Sobald mein neues Buch angenommen ist, nehmen wir sie wieder!«
»Natürlich«, sagte Frauchen, »und was ist mit den Hunden?«
»Was mit den Hunden werden soll? Es wird urgemütlich, was sonst! Ich stelle es mir so vor: wenn jetzt der Winter kommt und es fällt Schnee — man sitzt hinter den Scheiben, womöglich gibt’s gar Eiszapfen, das Öfchen bullert, ich schreibe, die Mama strickt, die Hunde liegen ringsherum und schnarchen — tiefer Friede. Was meinst du, was mir da alles einfällt!«
»Kein Mensch nimmt dich mit drei Hunden«, sagte sie.
»Du meinst nicht?«
»Ich weiß es.«
Ich wußte es natürlich auch oder fürchtete es wenigstens. Aber wie sie es jetzt so mit dieser Bestimmtheit sagte, wurde mir doch etwas flau um die Magengrube, und einen Moment hatte ich Angst, daß mein Innenleben aus dem Leim gehen würde. Aber ich riß mich zusammen:
»Hm — na, dann lassen wir eben den einen von ihnen bei Gutknechts oder Wesselys. Die werden sich nach ihnen reißen. Jedesmal, wenn sie hier waren, haben sie doch gesagt, sie wollten sie mal haben, und wenn’s nur für ein paar Wochen wäre.«
Max Gutknecht machte von Zeit zu Zeit technische Erfindungen, ganz brauchbare sogar. Einmal war es ein neuartiges Antennenkabel für Fernseher, dann eine Autoantenne, die man nicht auszuziehen brauchte, oder ein Füllhalter mit besonders großem Reservoir. Durch meine Beziehungen zur Presse hatte ich ihm geholfen, so daß Besprechungen in jene Rubriken kamen, die »Technik von heute< oder »Wissen für alle< heißen. Er war ein kleines, schmales Männchen mit markantem Gesicht und dunklen, ziemlich harten Augen. Seine Frau Ottilie war ein riesiges Weib mit Doppelkinn, blaßblauen Augen, die vorstanden, und zwei sommersprossigen Oberschenkeln — Verzeihung, Oberarmen, die ihr rechts und links aus der Bluse hingen. Max und Ottilie waren seit Jahren mindestens einmal in der Woche bei uns zu Gast und hatten dabei unsere Hunde über alle Maßen bewundert. Cocki und Weffi waren ihnen denn auch nicht von der Pelle gewichen, zumal sich diese Gutknechtsche Bewunderung in zahlreichen Häppchen äußerte. Sobald sich Max hinsetzte, hatte er einen halben Löwen auf den Knien, manchmal auch eine Tatze im Gesicht, und eine dicke Flappe mit Katerbart versuchte jeden Happen abzufangen, bevor dieser in die Gutknechtsche Speiseöffnung eingefahren wurde.
»Schmeiß den aufdringlichen Kerl doch ‘runter, Max!« sagte ich. Aber da kam ich schön an!
»Wie kannst du so was sagen! Sieh doch diese Augen!«
»Ich sehe sie, aber er zerdrückt dir die ganze Hose und macht dein Jackett voller Haare.«
»Dafür gibt’s ja schließlich eine Bürste.«
Ich hatte die Schultern gezuckt, mich aber innerlich doch sehr gefreut. Menschen, die sich vor Hunden graulen, waren mir stets unsympathisch und charakterlich verdächtig gewesen. Max graulte sich nicht. Max war in Ordnung.
Weffi saß derweilen auf dem Schoß Ottiliens. Auf diesem Schoß aber gab’s auch was zu sitzen! Das war kein ungemütliches Gewackel wie auf meinen beiden Holzleisten, das war wie eine Roßhaarmatratze, aus einem Stück gearbeitet. Auf der ineinanderfließenden Doppelrundung der Ottilieschen Oberschenkel konnte er nicht nur unbesorgt seinen Fellpopo placieren, sondern sogar Männchen machen und die Hände ringen. Das rührte Ottilie jedesmal fast zu Tränen, und er wurde stürmisch an ihren gewaltigen Busen gepreßt.
»Ein Zauberwesen!« sagte sie mit ihrer Baßstimme und hängte die Augen noch weiter heraus: »So etwas müßten wir haben.«
»Gewiß, gewiß, Kind, aber wenn — dann Cocki! Übrigens, Hans, du kennst doch den Redakteur von der >Technischen Umschau<.«
Nur Peter hielt sich von den Gutknechts fern. Er wich ihren Händen elegant, aber entschieden aus. »Er ist immer so still«, sagte Ottilie, »ist er krank?«
»Ach wo«, meinte Frauchen, »er ist nur sehr eigenartig, immer für sich, schließt sich sehr schwer an.«
Max drehte sich nach ihm um und schoß unter nachdenklich gerunzelter Stirn einen harten Blick auf Peter: »Ja, sehr eigenartig.« Und dann spülte er seine Nachdenklichkeit mit einem Schluck Wein hinunter.
Wesselys, Stefan und Renate, waren ein Künstlerehepaar. Das heißt, er war ein Künstler, Maler, abstrakt und ziemlich erfolgreich. Mit seinen Dreiecken und Kringelchen riß er dem internationalen Verein hoffnungslos versnobter Zeitgenossen eine Menge Geld aus dem Leib. Renate brachte es mit atemberaubender Schnelligkeit durch. Nicht daß sie es irgendwie in Putz, Barbesuchen oder Liebhabern anlegte — sie hatte den Lernfimmel und kam dabei auf die sonderbarsten Einfälle. Das einemal nahm sie Reitunterricht. Nach drei Monaten wurde der Gaul stillgelegt, und sie lernte in kurzer Folge Florettfechten, Kunstblumenherstellung, Modezeichnen und Kraulen im Schmetterlingsstil.
Stefan war darüber tief gerührt. »Sieh mal«, sagte er mir einmal, als wir bei uns im Garten lagen, »das ist doch eigentlich — ich meine, dir gegenüber kann ich ja den Ausdruck gebrauchen — ergreifend. Findest du nicht auch? Andere Weiber kaufen sich Handtaschen für zweihundert Mark, qualmen den ganzen Tag und versaufen den Rest mit ihren Liebhabern. Sie lernt! Und sie lernt ja schließlich für mich, sie will sich vervollkommnen — für mich!«
»Aber Schmetterlingskraulen...«
»Schön, ich gebe zu, was sie lernt, läßt sich nicht immer gleich in Geld umsetzen. Aber es kommt ja letztlich auf das Motiv an. Psychoanalytisch betrachtet, liegt dem der Wunsch zugrunde, meine Last mitzutragen. Muß man sie nicht bewundern?«
»Ich bewundere vor allem dich.«
»Und was empfindest du für mich?« fragte Renate, die plötzlich hinter mir stand und ihren Garçonkopf an meine Wange legte.
»Komm mal mit hinters Gebüsch!« sagte ich.
»Ach, du alter Angeber. Komm her, Weffi, du bist ja so viel besser und netter und höflicher als dein doofes Herrchen. Hat dein Herrchen so ein süßes Bärtchen? Ich könnte Hundetrimmen lernen, extra ihm zuliebe!«
»Dann würdest du wenigstens endlich mal was verdienen«, sagte ich und bekam einen Tritt vors Schienbein.
Stefan betrachtete Weffi nachdenklich: »Er ist nicht so klug wie Peter, aber ist Peter überhaupt noch ein Hund?«
»Nein«, erklärte Renate entschieden, »Peter — vor seinen Augen würde ich mich genieren, wenn ich mich abends ausziehe oder wenn ich dich anschwindle. Aber Weffi — du mußt die beiden malen, Stefan!«
Stefan machte ein ernstes Gesicht: »Hm.« Dann kniff er die Augen zusammen und ließ sie von einem Hund zum anderen hin und her wandern. »Keine schlechte Idee, Renate. Nehmt doch mal den Peter und setzt ihn neben Weffi da vor das Gebüsch.«
Frauchen tat es. Kaum saß Peter (von ihr festgehalten) neben Weffi, als dieser ihm ein begeistertes »Weff« ins Ohr brüllte. Worauf Peter hilfesuchend die Augen verdrehte und wütend zu strampeln begann.
»Nein«, sagte Stefan, »nicht Gebüsch, der Hintergrund ist zu unruhig. Setzt sie mal beide da vor die Mauer — so — nein, den Peter mehr im Profil! Jetzt gebt mir mal Papier und Bleistift.«
Frauchen und Renate hielten die beiden Hunde fest, ich rannte nach Zeichenmaterial. Die nächste halbe Stunde lang durften wir nur flüstern und mußten uns bei den Hunden ablösen, weil uns die Hände lahm wurden. Endlich war der künstlerische Schöpfungsakt vorüber. Peter entfloh Frauchens Händen wie eine Rakete, rannte auf die Straße und blieb dort mit gehobenem Bein an einem Baum kleben. Es nahm überhaupt kein Ende.
Nach vierzehn Tagen brachte Stefan das Bild. In Farben. Er lehnte es oben in meinem Zimmer gegen die Wand: »Da hast du die beiden Strolche!« Ich hielt den Atem an. Weffi sah aus wie ein neurotischer Küchenstuhl und Peter wie ein notgeschlachteter Schornsteinfeger.
»Na??« fragte Stefan.
»Sehr eigenartig in der Auffassung«, murmelte ich.
»Ich bin, der ich bin!« erwiderte er bescheiden. »Und wie gesagt, wenn du mal einen von den Brüdern nicht mehr brauchst
— am liebsten natürlich Weffi!«
In diesem Augenblick kam die Mama ins Zimmer. Sie konnte die Wesselys nicht sehr leiden und nannte sie »die Zigeuner«, hauptsächlich wohl, weil sie fürchtete, daß unser eigenes Lebenskuddelmuddel durch den Umgang mit ihnen noch vergrößert würde. Es hatte einiger sehr ernster Aussprachen bedurft, um sie wenigstens zu einer Art bewaffneter Neutralität zu bekehren. Als Dame alter Schule ließ sie sich von alledem nichts merken und wurde von Stefan und Renate mit ahnungsloser Familiarität behandelt.
Stefan nahm sie beim Arm: »Ah — die Mami — gleich mal herkommen — ansehen!« Er führte sie vor seine Schöpfung: »Na
— was sagen Sie?«
Die Mama schluckte und warf um Stefans Brustkasten herum einen hilfesuchenden Blick auf mich.
»Sehr schön in den Farben«, sagte sie dann. »Nur...«
»Nur?« Stefan schoß einen triumphierenden Blick zu mir herüber und preßte sie an sich.
»Nur«, stammelte die Mama, »die rechte Seite vom Haus ist — so etwas schief!«
Stefan drehte sie mit einem Ruck zu sich herum und bohrte seinen Blick in ihre Augen: »Haus?«
»Ja — ist denn das nicht unser Haus?« fragte die Mama, nun völlig verwirrt. Ich fiel in den Sessel und konnte mich nicht mehr halten. Ich brüllte vor Lachen.
»Hör auf!« schrie mich Stefan an. »Das verdient sie nicht!«
Ich keuchte. Um ein Haar hätte ich gesagt: »Aber ich lache doch über dich!« Doch das hätte ihn zu sehr gekränkt.
Stefan sah wieder die Mama an. Sein Blick war eine Mischung aus zärtlicher Güte, Gram und Mitleid.
»Mama!« sagte er. »Sie sind eine großartige Frau, aber Sie haben zwei schwere Fehler.« Er wies mit dem Daumen auf mich: »Erstens haben Sie diesen blökenden Idioten in die Welt gesetzt. Und außerdem — völliger Mangel an abstrakter Vorstellung. Ab-so-lut gefangen im Gegenständlichen. Verschüttet. Schade, Mami.«
Er wandte sich zu mir um: »Weffi!«
»Was ist mit Weffi?«
»Gib ihn mir bald, ehe er dir ähnlich wird.«
Ja, und dann war da noch Professor Paul Kluge, Chefarzt im Benediktinerkrankenhaus. Er trug sein fahlblondes Haar in der Mitte gescheitelt, eine altmodische, goldgeränderte Brille und war für gewöhnlich nur im weißen Kittel sichtbar, gefolgt von einem Schwarm Schwestern und Assistenten. Er wirkte konzentriert, sachlich und extrem nüchtern. Seine Rauheit war bei den Studenten gefürchtet. In den wenigen Stunden aber, wo man ihn mal seiner chirurgischen Passion entreißen konnte, zeigte er überraschende Seiten. Es erwies sich, daß seine langen, sensitiven Hände nicht nur Blinddärme und Tumore beseitigen, sondern auch Klaviersonaten spielen konnten. Des weiteren liebte er gute alte Weine, kräftige Witze und war Junggeselle aus Überzeugung. »Die Ehe«, erklärte Paul, »ist eine Zwangsvorstellung!« Weswegen man ihn für einen Zyniker hielt. Ich bezweifelte stets, daß er es wirklich war, und vermutete statt dessen, daß sich hinter diesem Zynismus nur ein tief und unheilbar verwundetes Herz verschanzen wollte. Ich wußte, daß ihm eine über alles geliebte Verlobte, eine begnadete Pianistin, unter den Händen gestorben war, als er sie an einem Gehirntumor operierte. —
Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft an ihm war, daß man ihn, wenn man einmal seine Freundschaft errungen hatte, jederzeit und ohne Einschränkung in Anspruch nehmen konnte.
Nach einem Bummel bei ihm schlafen, weil einem der Nachhauseweg zu weit war? »Hau dich da auf die Couch. Hier, ein Pyjama, Rasierzeug im Bad, Schnarchen verboten.« Geld pumpen? »Wieviel?« Er war böse, wenn man sagte: »Ich gebe es dir in spätestens einer Woche zurück.«
Am meisten aber freute mich, daß er unsere Gastfreundschaft genauso selbstverständlich in Anspruch nahm, wie er die seine gab. Manchmal brauste er bei uns durch, ohne daß wir ihn überhaupt zu Gesicht bekamen. Dann kam er so über Mittag, wenn wir unterwegs waren, ließ sich von Mathilde, die ihn in sklavischer Verehrung anbetete (ich weiß wirklich nicht, warum zynische Junggesellen immer so besonders angebetet werden), etwas zu essen machen, tankte aus der Hausbar, steckte sich eine Handvoll von meinen Brasil ein und fuhr weiter. Mitunter nahm er sich auch ein neues Hemd von mir und Taschentücher. Manchmal sahen wir uns ein Vierteljahr nicht, aber wenn es dann endlich wieder mal klappte, war es, als seien wir erst gestern auseinandergegangen.
Seine im Augenblick wertvollste Eigenschaft aber bestand darin, daß er von allen drei Hunden Peterle am meisten liebte. Er pflegte ihn mit seinen Chirurgenhänden abzutasten wie einen Patienten: »Prachtvoll, der Kerl, wie aus Eisen! Man sollte systematisch nur Kreuzungen züchten, viel gesünder und in den Instinkten schärfer. Lümmel — wie siehst du mich wieder an!«
Peters Verhalten ihm gegenüber war zwiespältig. Einerseits schreckte ihn der Krankenhausgeruch ab, der nun einmal untilgbar in Pauls Kleidern hing. Andererseits spürte er die klare und starke Sympathie des Mannes. So zog er denn zwar das schwarze Rußnäschen kraus, rückte aber trotzdem immer näher an Kluge heran und reichte ihm gravitätisch die Pfote. Paul faßte ihn dann unter den rötlichen Klebebart und wandte sich lebhaft nach mir um:
»Verstehst du, was das bedeutet? Mein Gestank stört ihn, aber er weiß, daß ich ihn liebe, de profundis liebe. Kerl, weißt du eigentlich, wie wunderbar bizarr du bist? Ich glaube, er weiß sogar das! Himmelherrgott, wenn Peter sprechen könnte — dieses Wesen, halb Mensch, halb Elementargeist. — Du, Peter, hör mal, wenn sie dich hier nicht mehr wollen, kommst du zu mir, verstanden? Ich verwende dich als Gedankenleser bei Patienten, die durchaus nicht zahlen wollen, und wenn sie trotzdem nicht zahlen und alles nichts hilft, treten wir beide im Zirkus auf.«
All diese Chancen breitete ich vor meiner Gefährtin aus: »Du siehst, du kannst ganz beruhigt wegreisen. Wenn es gar nicht anders geht, können wir sie alle drei eine Zeitlang bei Menschen unterbringen, die sie lieben.«
»Ich bleibe, bis das Haus aufgelöst ist«, sagte sie darauf.
»Aber du kannst doch dabei gar nicht helfen!«
»Was soll das heißen? Bin ich ein Krüppel?«
»Nein, natürlich nicht. Aber...«
»Ich bleibe.«
4
Ja, und so gingen wir an die Auflösung des Hauses. Über sieben Jahre hatten wir darin gelebt und gehofft, daß wir bis zum Lebensende darin bleiben könnten. Eine törichte Hoffnung, weil sie im Widerspruch steht zu den persönlichen Erfahrungen, die wir alle in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Aber der Mensch schlägt eben gern Wurzeln, und in jeden Winkel des Hauses, in jede Mauerritze und jeden Meter des Gartens hatten sich die Wurzeln unseres Gefühls tief gesenkt.
Vorher waren wir uns dessen gar nicht bewußt gewesen. Wenn jemand das Haus lobte, hatten wir gesagt: »Ach, es ist ‘ne alte Bude, und dies und jenes müßte gemacht werden — nie wieder mieten wir so’n großes Haus.« Aber jetzt mußten alle diese Wurzeln, diese feinen, langen Herzenswurzeln herausgerissen werden, bis da nichts mehr blieb als ein leerer Steinwürfel und ein verwilderter Garten, der jetzt schon fremd aussah und sich gewissermaßen zurücknahm, noch bevor wir gegangen waren. Irgend etwas starb. Nicht das Haus (andere würden nach uns darin wohnen, und dieser Gedanke tat besonders weh), aber das, was uns mit dem Haus verbunden hatte, jenes unerklärliche Dritte, das wie ein lebendiges Wesen war — es starb unter großen Schmerzen.
Wir hatten uns Kisten geliehen und packten die lockeren Sachen, Bücher, Wäsche, Geschirr, selbst. Es war billiger. Die Umzugfirma hatte dann nur die Kisten und Möbel aufzuladen. So begannen wir mit dem Ausräumen der Schränke und überhaupt mit dem großen Aufräumen und Sortieren. Was da nicht alles aus dem Sediment dieser Schränke und Truhen, Böden und Keller zum Vorschein kam! Zum Beispiel der Brieföffner aus Damaszenerstahl mit den eingelegten jagenden Pferden, der vor sieben Jahren verschwunden war. Wir hatten seinerzeit den Elektriker in Verdacht gehabt, weil er sich dafür interessiert hatte. Jetzt mußten wir es ihm tief innerlich und beschämt abbitten. Dann die beiden hölzernen Serviettenringe der Urgroßmutter. Ihr Verschwinden wurde seinerzeit zum Anlaß eines solennen Familienkrachs, bei dem die schweren Brocken wie >Lieblosigkeit, Mangel an Familiensinn, Kluft zwischen den Generationen< nur so durch die Zimmer flogen. Wir fanden sie total zerknabbert in einer Kellerecke, in die sich Peterle in seiner ersten Zeit immer bei dicker Luft geflüchtet hatte.
Ferner tauchten auf: unzählige Medizinflaschen, kaputte Lampen, ein Kindernachttopf, auf dessen Herkunft sich kein Mensch mehr besinnen konnte, Gardinenringe, Mottenkugeln, Zinnsoldaten, eine Mundharmonika aus meiner Jugend, Haufen von Filmspulen, ausgebrannte Radioröhren, Zahnbürsten, Rasierapparate, ein vermotteter Tirolerhut, Muscheln und Steine von der Nordsee, alte Taschenmesser, angeklopfte Kaffeekannen, Kisten mit alten Modezeitschriften und mit Romanen, die ich zu schreiben begonnen und nie zu Ende gebracht hatte.
»Hänschens unvollendete Werke!« bemerkte die Mama und warf mir gute zwanzig Pfund dieser Kunstwerke herüber.
»Schmeiß sie gleich auf den Altpapierhaufen«, sagte die Gefährtin, die sich neben mir damit abquälte, alte Nägel mit einem Hammer geradezuklopfen.
»Ne, nicht doch«, meinte ich, »vielleicht ist doch das eine oder andere...« Und ich begann mich an einem meiner Romanfragmente festzulesen.
»Du solltest lieber die Geschirrkiste zunageln«, sagte Frauchen, »und was machst du denn da, Mami?«
Die Mama war gerade dabei, einen Karton in eine bereits übervolle Kleiderkiste zu pressen.
»Die Erinnerungsschachtel!« erkärte sie feierlich.
Ich warf mein Fragment bedauernden Blickes auf den Altpapierstapel und half ihr pressen. Aber der Karton wollte absolut nicht hineinpassen.
»Könntest du nicht einiges davon wegschmeißen?« fragte ich sie schließlich.
»Aber ich bitte dich!«
»Zeig mal her — sei nicht albern, ich will ja nur mal nachsehen!« Ich entriß ihr den Karton und machte ihn auf. Es quoll mir entgegen und roch sachte nach Moder und Lavendel: zwei ganz verknautschte Babyschuhe, eine Babyhaube, ein vergilbtes Hemdchen, ein Kuvert mit einer blonden Locke, ein Gipswildschwein zwischen zwei Quarzkristallen: >Erinnerung aus der Sächsischen Schweiz< und das Bild eines jungen Mannes mit Schafsgesicht und Zwicker, der an einer Säule lehnte.
»Bin ich das?« fragte ich entsetzt.
»Natürlich! Das Einsegnungsbild!« sagte sie vorwurfsvoll. »Es war der erste Anzug mit langen Hosen. Erinnerst du dich denn gar nicht?«
Ich klimperte mit den Augen und bemühte mich. Und da kam er wieder herauf, jener Einsegnungsmorgen Anno 1916. Erster Weltkrieg. Hunger und Verarmung der Daheimgebliebenen. Zur Feier dieses Tages hatte ich zwei neue Schuhe bekommen, mit Holzsohle, und zwar von der allerschlimmsten Sorte: aus einem Stück gearbeitet. Als ich vor dem Geistlichen niederknien wollte und zu diesem Behufe erst das eine Knie beugte, brach mit Getöse die Holzsohle. Ich blieb erstarrt in dieser Stellung wie ein Auto mit Reifenpanne und fühlte mehrere hundert Augen gespannt auf mich gerichtet: Was wird er jetzt machen? Nach einer halben Minute räusperte sich der Geistliche, und mit Todesverachtung bog ich auch das zweite Knie. — Krach, brach auch die zweite Sohle durch. Der Schweiß tropfte mir von der Stirn, ich war puterrot, kriegte meinen Segen und schlich mich weg wie ein geprügelter Hund. Ein paar alberne Gänse kicherten, als ich auf meinen Bruchsohlen an ihnen vorbeiknirschte.
Ich wachte auf, als die Mama mir das Bild wegriß und schnell wieder einpackte’. »Dafür wird ja wohl noch Platz sein! Wenn wir mal wieder ein eigenes Heim haben sollten, woran ich allerdings zweifle, denn es wird ja nichts gespart. Es werden ja, kaum daß ein bißchen Geld da ist, tausend Leute eingeladen und Autos und Mäntel gekauft und alles zum Schornstein hinausgejagt.«
»Pack nur alles in die Kiste, was du willst, Mamachen«, sagte ich hastig. Die Mama jedoch schien entschlossen, noch eine ganze Menge zum Thema >Spare in der Zeit< zu sagen. Glücklicherweise erschien in diesem Augenblick Weffi, sein Bällchen im Maul. Er richtete sich an der Kleiderkiste auf, ließ den Ball hineinfallen, sprang dann nach, roch mit angewidertem Gesicht an den Mottenkugeln, rollte sich aber trotzdem auf den Kleidern zusammen: »Vergeßt mich nicht!«
Einen Moment sahen wir uns alle schweigend an. Da saßen wir zwischen unseren Kisten mit staubigen Händen und Gesichtern, mit Hämmern in den Händen. Die Mama richtete sich ächzend auf: »Ich hole mir jetzt einen Cognac.«
»Mir auch!« sagte Frauchen.
»Mir auch!« sagte ich. »Weffi, geh da ‘raus, du kommst ja mit.« Als ich den Cognac ‘runter hatte, erklärte ich, ich müßte mal in die Garage. In der Diele sah ich ein Stück Cocki unter der Kommode Vorschauen: die dicken Tatzen mit dem Kopf darauf. Er folgte mir nicht in den Garten wie sonst, hob nicht einmal den Kopf, als ich vorüberging. Nur seine blutunterlaufenen traurigen Säuferaugen folgten mir, als wolle er sagen: »Ich kann leider nicht mit, sonst klaut man mir die Kommode!«
Auf den Stufen vor dem Haus saß Mathilde. Sie hatte Peter auf dem Schoß, mit den Beinen nach oben wie einen Säugling, flüsterte mit ihm und heulte. Als ich kam, stand sie schnell auf und setzte ihn auf die Erde: »Die Bohnen — ich habe ja die Bohnen auf dem Feuer.«
Sie wischte sich mit der Schürze über die Augen und rannte an mir vorbei.
Ich blieb mit Peterle allein. Er sah zu mir auf mit den Augen des alten jüdischen Propheten und zitterte. Dann klemmte er das Schwänzchen ein und steckte mir den Kopf zwischen die Knie.
»Jetzt fang du auch noch an!« sagte ich wütend. Er zog den Kopf aus meinen Knien, richtete sich an mir hoch, seine kleinen schwarzen Krallen kratzten meinen Overall. Er weinte. Ich beugte mich hinunter und küßte ihn auf die Rußnase: »Na ja, eines Tages werden wir wieder ein Häuschen haben und einen Garten.«
Ich richtete mich auf. Meine Augen gingen durch den Garten. Oben in den Apfelbäumen hingen noch ein paar Rotbacken, die Mathilde und ich nicht erwischt hatten. Diese letzten Äpfel hatte ich sonst immer mit Steinen heruntergeworfen, und Peter hatte sie mir angeschleppt, und wir hatten Ball damit gespielt. Diesmal würden sie wohl oben bleiben. Drüben die jetzt leeren Himbeersträucher, die ich selbst gepflanzt hatte. Der Wasserhahn am Bassin, der seit sieben Jahren repariert werden sollte und noch immer tropfte. Man hätte einfach eine Gummischeibe... aber dazu war es jetzt auch zu spät.
»Komm«, sagte ich zu Peterle, »wir gehen in die Garage.« Er trippelte neben mir her, rannte schnell zum Bassin und schlappte ein paar durstige Züge aus dem schwarz funkelnden Wasser, auf dem sich ein paar erste gelbe Herbstblätter um sich selber drehten. Als ich an den Fenstern des großen Zimmers vorbeikam, hörte ich von drinnen Hammerschläge — als ob man einen Sarg zunagelte. Peterchen war schon wieder neben mir. Er hatte sich einen Zweig mitgebracht und warf ihn mir vor die Füße: »Bißchen spielen, vielleicht wird uns dann besser!« Ich warf ihm den Zweig, er rannte hinterher, ließ ihn aber schon auf dem halben Rückweg aus der Schnauze fallen. »Hat keinen Zweck«, sagten seine Augen.
Jetzt waren wir in der Garage. Schauerlich leer — eine Gruft. Beklemmend deutlich sah ich wieder Muckelchen vor mir, das zerschlagene, zerbeulte Muckelchen, das da irgendwo im Winkel einer Reparaturwerkstatt lag, bis die Versicherungen sich untereinander über die Schadenszahlung ausgerauft hatten.
Hier bei uns war jetzt nur noch ein dunkler Ölfleck auf dem Betonboden. Immer hatte die eine Manschette an der Hinterachse durchgelassen. Gerade wollte ich sie erneuern lassen. Aber auch das war jetzt nicht mehr nötig. Peterle roch mit hochgezogenem Vorderbein an der Öllache und sah mich dann jammervoll an. Ja — was wollte ich eigentlich hier? Ach so, da waren also noch ein Wagenheber, die alten Felgen, eine Reservezündspule, Signalhorn und ein Reifen mit dem halben Profil drauf. Zusammenpacken und verkaufen: zwanzig, dreißig Mark würde ich schon noch dafür bekommen.
Der Kies der Einfahrt knirschte. Etwas Breites, Schwarzes, silbern Blinkendes schob sich herein: Pauls Kabriolett. Nanu!? Josef, der Chauffeur, stieg aus und grüßte freundlich. Im gleichen Augenblick ertönten Cockis wildes Gebell und Weffis Trompete. An seinen Kniekehlen vorbei stürzten sie in den Wagen, so daß der gute Josef beinahe umfiel. Auf der anderen Seite stieg Paul aus, unter seinem Arm durch flog Peter in den Wagen.
»Da schau«, sagte Paul, »ich denke, der war mit beim Unfall?«
Wir schüttelten uns die Hand. »Ja«, sagte ich, »es ist merkwürdig, vor Personenwagen hat er keine Angst, nur vor Lastwagen. Als so einer gestern die Kisten brachte, hat er sich verkrochen. Es sind wohl besonders die großen Räder, vor denen er sich fürchtet.«
Ich klopfte Pauls Wagen auf die lange Haube. Es war ein schweres Kabriolett, das er sich vor drei Jahren nach eigenen Angaben hatte bauen lassen, mit Klimaanlage, Radio, drei Fanfaren, vielen Aschenbechern und ähnlichem Schnokes. Besonders stolz war Paul auf die Vordersitze, die man mit einem Hebelzug zurückklappen und damit den Wagen in eine Doppelcouch verwandeln konnte.
»Ja, wenn man Junggeselle ist«, hatte die Gefährtin spitz bemerkt, als er es ihr vorführte.
»Goldkind, benimm dich!« hatte Paul augenzwinkernd gesagt.
»Ich meine ja nur den Preis, den Preis, den sie dir dafür abgenommen haben!«
»Ach so.«
Ich löste meine Hand seufzend von dem Prachtstück: »Schöner Kerl!« Wir gingen beide in die Garage. Paul sah sich um: »Scheußlich leer hier. Vermißt Peterle eigentlich das Muckelchen?«
»Ja. Er hatte eben noch ganz traurig an der Ölpfütze gerochen. Du hättest ihn sehen sollen.«
»Nichts von der Versicherung gehört?«
»Gehört schon. Augenblicklich streiten wir uns um den Preis für Muckelchen. Sie haben mir ein ganz lächerliches Angebot gemacht.«
»Wieviel denn?«
»Zwei. Aber mein Rechtsanwalt hat einen Gegenvorschlag gemacht. Ich denke, wir werden uns auf zwei-fünf einigen. Willst du nicht ins Haus? Es wird allerdings wild genagelt.«
»Nein, ich bleibe lieber bei dir.« Er nahm eine Zange von der Werkzeugkiste und setzte sich. »Tja«, sagte er nach einer Weile des Schweigens, »wenn du einen alten Wagen verkaufen willst, ist er plötzlich nichts mehr wert. Das habe ich jetzt gerade erfahren.«
»Wieso? Du willst doch nicht etwa...«
Er grinste mich an: »Doch. Ich habe sogar schon einen neuen.«
»Was denn?«
»Den Dreihunderter.«
»Na, und der hier, dein Prachtstück?«
Er zog sorgfältig seine Bügelfalte gerade: »Deswegen komme ich ja gerade her. Weißt du — ich habe mich derartig über die Kerls geärgert. Sie haben mir kaum mehr als den Schrottpreis geboten, als ich ihn jetzt in Zahlung geben wollte. Dabei habe ich erst vor einem halben Jahr eine neue Maschine hineingetan, und Josef pflegt ihn doch wirklich gut!«
»Das kann man wohl sagen. Er sieht aus wie neu.«
Paul räusperte sich: »Hm — ehe ich ihn diesen Halunken für einen solchen Preis in den Hals werfe, gebe ich ihn lieber dir.«
»Aber...«
»Gar kein Aber. Du zahlst mir dafür das, was sie dir für Muckelchen geben. Dabei mache ich ein glänzendes Geschäft, es ist immerhin ein Mehrfaches des Schrottpreises.«
»Aber...«
»Du sollst mich nicht ständig unterbrechen, hörst du? Du brauchst einen Wagen. Du mußt deine Rundfunkgesellschaften und deine Verleger besuchen. Du mußt dir ein neues Heim suchen, und dabei mußt du wenigstens die notwendigsten Klamotten und außerdem die Mama und die Hunde mit dir ‘rumschleppen können.«
»Aber...«
»Willst du mich jetzt ausreden lassen oder nicht? Ich weiß selbstverständlich, daß du das, was du jetzt von der Versicherung kriegst, für dringendere Sachen brauchst. Du sollst es mir ja auch gar nicht sofort zahlen. Nach einem Jahr — würde ich Vorschlägen.« Er warf mir einen strengen Blick zu: »Mit fünf Prozent Zinsen natürlich!«
»Und wenn ich nach einem Jahr noch immer Pech habe?«
Er gab sich ungeheuer vergnügt und gerieben: »Na, großartig, dann zahlst du noch mal fünf Prozent, besser kann ich mein Geld nicht anlegen. Im übrigen, du Hammel, du blöder, du weißt doch selbst, was du kannst. Schön — Pech hat jeder mal. Aber wer was kann, der hat auch wieder mal Glück. Ich gehe jede Wette mit dir ein, daß du in einem Jahr spätestens wieder obenauf bist, wahrscheinlich schon nach einem halben.«
Er stand auf: »Im übrigen ist der Wagen noch für ein halbes Jahr versichert und versteuert. Das schmeiße ich mit ‘rein. Na, ist das ein Angebot?«
Mir schwindelte der Kopf. Da stand es, das silbern-schwarz blinkende Ungeheuer, und sah mich über die mächtige Stoßstange hinweg mit seinen Scheinwerferaugen an. Mir gehören — es war ja nicht auszudenken. Ich versuchte noch einen letzten Widerstand: »Ich glaube dir kein Wort von der Sache mit dem Schrottpreis, Paul«, sagte ich schwach.
»Jetzt wirst du beleidigend, das verbitte ich mir.« Er griff in seine Tasche und holte ein Papier heraus: »Hier, der Vertrag. Du brauchst bloß zu unterschreiben, dann fahre ich gleich mit Josef weg und besorge die Umschreibung, und am Nachmittag kannst du die Karre schon vor der Tür haben.«
»Paul — ich — ich meine — ich müßte doch erst mal mit — meiner — Teuren...«
»Schlappschwanz! Brauchst du eine Amme, um deinen Namen hier drunterzuhauen?«
»Na schön.« Ich unterschrieb. Sein Gesicht löste sich, er zwinkerte mir zu: »Willst du nicht durchlesen, was drinsteht?«
»Dazu bin ich viel zu aufgeregt.«
»Auch gut.« Er faltete das Papier zusammen und steckte es weg. In diesem Augenblick kam die Teure, den Hammer in der Hand: »Ja, wo bleibst du denn? Die Bretter für den einen Kistendeckel sind alle zu lang. Tag, Paul. Du bist doch Chirurg — könntest du sie nicht mal schnell kürzer sägen?«
Er nahm sein Taschentuch und wischte ihr einen Schmutzfleck von der Nase: »Leider keine Zeit, laß das den Lulatsch hier machen.«
»Er hat mir seinen Wagen verkauft!« sagte ich.
Sie sah erschrocken mich und dann hilfesuchend Paul an, offenbar hielt sie mich für geistesgestört.
»Ja, ja«, sagte er, »stimmt schon, laß es dir von ihm erklären. Also, Kinderchen, ich muß weiter.« Mit einem Satz war er im Wagen: »Schnell, Josef, ‘raus, weg!«
»Was ist das?« fragte sie und starrte ihm mit offenem Mund nach.
»Er hat alle drei Hunde drin«, sagte ich. »Na, die wird Josef schon nachmittags wieder abliefern, wenn er den Wagen bringt.«
»Also, ich verstehe das überhaupt nicht. Seid ihr alle verrückt?«
Ich erzählte ihr, was sich abgespielt hatte. »Du hast recht«, schloß ich, »wahrscheinlich bin ich wirklich verrückt.«
Sie sah an mir vorbei auf die Straße, von der Paul verschwunden war: »Ein Freund — ein wirklicher Freund! — Daß es so etwas gibt.«
Sie drehte sich zu mir um, und ich sah, daß ihre Augen feucht waren: »Vielleicht ist das der Wendepunkt, das Ende deiner Pechsträhne. Ich wünsche es dir, alter Junge!«
Noch immer kopfschüttelnd ging sie ins Haus: »Ein Freund...«
Am späten Nachmittag brachte Josef den Wagen. Obwohl ich noch einen Kronleuchter und sieben Gardinenstangen abzunehmen hatte, stand ich unter dem Vorwand, Luft zu schnappen, schon seit einer Stunde an der Ecke der großen Ausfallstraße. Endlich kam >er< dann. Es waren doch vorher schon viele Wagen gekommen, aber diesmal wußte ich mit Bestimmtheit: er ist es! Ich drückte mich gegen den Zaun und ließ ihn an mir vorbeigleiten: ein langgestrecktes, breites Ungeheuer, die Wucht eines Rhinozerosses kombiniert mit der Grazie einer fliehenden Gazelle. Vollkommen lautlos schwenkte er ein, nur der Kies der Seitenstraße knirschte leise unter seinen mächtigen Rädern. Innen saß Weffi mit langem Hals auf Josefs Schoß, der mit einem Lächeln in den Augenwinkeln um ihn herum steuerte. Cocki pennte zusammengerollt auf dem Vordersitz und richtete sich jetzt gerade auf, weil er fühlte, daß die heimatliche Höhle in Sicht kam. Peter stand mit den Hinterbeinen auf den Rücksitzen und mit den Vorderbeinen auf den Lehnen der Vordersitze. Da in dem großen Wagen beides sehr weit voneinander entfernt war, mußte er sich entsprechend ausrecken und ähnelte einer eisernen Messerbank, die ich mal als kleiner Junge gehabt hatte. Er hatte mich sofort entdeckt, drehte sich um, und während der Wagen entrollte und mich zurückließ, sah ich Peterles kleines Affengesicht, beide Öhrchen ergeben weggeknuckelt, im Rückfenster hin und her tanzen.
Ich wanderte langsam hinterdrein. Auf halbem Wege schon kam mir Peter entgegengerast, Weffi hinterher. Peter sprang mir aus dem Stand bis über den Kopf, während Weffi meinen rechten Senkel abmontierte. Dann kam eilig der Dicke hinterdreingewackelt. Erstaunlich, was für ein Tempo er entfalten konnte, trotz seiner Schwere, seiner großen Schuhnummer und seiner krummen Watschelpfoten. Er schien ein ausgesprochen schlechtes Gewissen zu haben, denn er machte einen hohen Buckel und hielt mir den Po hin, während er den Zungenlappen neckisch aus dem Maul hängen ließ. Ich knudelte alle drei ab, und dann marschierten wir selbdritt dem Hause zu.
Als ich an der Küche vorüberging, sah ich drinnen Josef am Tisch sitzen, umringt von Kaffee, Kuchen und Mathilde. Josef war ein gemütlicher, älterer Mann, Junggeselle wie sein Chef. Die silbernen Schläfen standen gut zu seinem braunen Gesicht. Er könnte doch Mathilde heiraten, schoß ein flüchtiger Gedanke durch mein Hirn, mit der wäre er bestimmt nicht angeschmiert.
Der Wagen stand noch in der Garageneinfahrt. Cocki schnellte mir voraus, versuchte zunächst hineinzuspringen, gab es aber auf, da die Fenster hochgekurbelt waren, kroch daraufhin unter den Wagen und blökte mich von dort her an.
»Aber sonst geht’s dir gut!« sagte ich.
Etwas tippte mich an mein Hosenbein. Es war Peterle, der Männchen machte. Er hatte seine vergnügtesten Murmelaugen und winkte damit gegen die Wagentür. Weffi erschien, ganz geschäftsmäßig mit dem Ball in der Schnauze: »Los, Abfahrt!«
»So!« sagte ich. »Ihr Opportunisten, ihr habt ihn schon völlig annektiert, was? Und das gute Muckelchen vergessen, he?«
Josef kam zur Einfahrt: »Die sind ja zum Brüllen!« sagte er.
»Wann haben Sie denn gemerkt, daß die drei noch im Wagen waren?«
»Als mir Peter plötzlich von hinten um den Hals fiel. Ich hab’ mich richtig erschreckt. Mittag haben sie schon zweimal bekommen, einmal beim Herrn Professor und einmal bei mir. Ich bin nämlich schnell mal zu mir nach Hause gefahren, um die drei meiner Wirtin zu zeigen.«
»Na, und was hat die Wirtin zu drei Hunden gesagt?« fragte ich, plötzlich interessiert.
»Joldig, janz joldig, aber haben — nee.«
»Ich fahre Sie bis zur Autobushaltestelle«, sagte ich, »dabei können Sie mir gleich noch ein bißchen den Wagen erklären. Und ihr drei bleibt hier, verstanden?«
Josef überreichte mir feierlich die Schlüssel, beugte sich dann herunter, bekam Cocki am Halsband und streichelte ihn: »Na, nu sei mal schön brav, das nächstemal kommst du ja wieder mit, Dicker!«
Ich ging um den Wagen herum, schloß andächtig die Tür auf und setzte mich hinter das Steuer. Die lange, schimmernde Haube! Hinter mir rülpste etwas. Ich fuhr herum. Da saß der Dicke, offensichtlich mit der inneren Verarbeitung des doppelten Mittagessens beschäftigt, und draußen stand Josef mit dem leeren Halsband in der Hand.
»Na, der is jut, der kann so bleiben!« sagte er.
Ich mußte lachen: »Ich hätte Sie auf seinen Jiu-Jitsu-Trick vorbereiten sollen. Morgens, wenn man ihm das Halsband umbindet, bläht er nämlich seinen Hals ganz dick auf und erreicht damit, daß es ganz weit gesteckt werden muß. Wenn man ihn dann an die Leine nimmt, kann er sich mit irgend so einem ganz besonderen Ruck im Nu ‘rausdrehen!«
»Na ja«, sagte Josef, »die Polster müssen Sie ja sowieso wieder sauber machen.«
Er setzte sich neben mich, und bevor er sich noch in den Sitz zurückfallen lassen konnte, waren die beiden anderen auch drin.
Ich hatte den Wagen schon mehrfach gefahren, aber jetzt, da er mir gehörte, war es doch ein ganz anderes Gefühl, besonders, nachdem ich Josef abgesetzt hatte und nun allein mit ihm war. Der unhörbar weiche Lauf der Maschine, der rapide, rucklose Anzug des schweren Sechs-Zylinders, die Weichheit der Bremsen, der viele Raum innen — prächtig. »Weißt du was«, sagte ich zu ihm, »ich werde dich >Prächtig< nennen.«
Als ich wieder in der Garageneinfahrt hielt, geruhten die drei Herren hinter mir endlich auszusteigen und verstreuten sich in der Gegend. Ich holte das Leder und säuberte die Hintersitze. Dann ging ich ins Haus und lud die Gefährtin und die Mama zu einer Probefahrt ein.
»Na??« fragte ich, als wir wieder zu Hause waren.
»Ich fühle mich wie neugeboren«, seufzte Frauchen.
»Und du, Mami?«
»Wie eine Hochstaplerin.«
Dann montierte ich den Kronleuchter und die Gardinenstangen ab. Es wurde dunkel darüber. Dauernd mußte ich an Prächtig denken. Es war grotesk — verrückt, das Ganze. Aber es tat gut. Nach dem Abendessen schlich ich mich wieder in die Garage. Ich strich über die Haube, sie war noch warm. Neben mir ein Geräusch. Peterle. Er verfolgte aufmerksam meine Hantierungen, als könne er meine Gedanken lesen. Dabei hatte er jenen Blick, mit dem er sonst über unsere Köpfe hinweg die Elementargeister sah. Ich strich über die Positionslichter, die in schweren, spitz zulaufenden Chromhülsen steckten. »Fein, was?« sagte ich zu ihm. Er hob das Bein und machte an den Reifen. »Na also«, sagte ich, »Taufe.«
5
Am nächsten Morgen kamen die Möbelleute, fünf Mann hoch mit blauen Schürzen und Gurten. Cocki brüllte sie an, blieb aber dann verdutzt stehen, weil es so viele waren, die sich in das Haus ergossen. Zunächst legten sie auf der hinteren Veranda ein Depot von Bierflaschen, Wurst und Frühstücksbroten an. Als sie sich dann zu einer ersten Besichtigungstour durch das Haus verstreuten, schlich ich mich schnell hinaus und legte alles Eßbare oben auf den Gartentisch. Cocki war schon in der Nähe und hatte interessiert die Stirn gefurcht. Als ich ihm zuvorkam, warf er mir seinen berühmten alten Säuferblick zu und watschelte weg. Noch sein Hinterteil drückte gekränkte Unschuld aus: »Hattest du etwa gedacht, daß...?«
Unter den Händen der Professionals begannen sich Schränke in einzelne Bretter aufzulösen, Sessel wanderten die Treppen hinunter. Leuchter wurden auseinandergeschraubt, unser ganzes Innenleben kam in Bewegung und schwankte zur Tür hinaus. Cocki hatte seinen Beobachtungsposten unter der Kommode bezogen. Weffi legte den Männern abwechselnd sein Bällchen hin und bekam es auch ab und zu geworfen. Peterchen war verschwunden. Ich fand ihn in der allerhintersten Gartenhecke, dort, wo im Frühjahr immer ein paar von mir sehr bewunderte wilde Erdbeeren wuchsen. Er lag dort, zierlich und jämmerlich zugleich, wie ein frischgeworfenes Kitz. Als ich ihn aufstöberte, leckte er sich die Pfoten, als wolle er sagen: »Habe mich zurückgezogen — bißchen Maniküre!« Aber wir brauchten uns beide nichts vorzumachen.
Nach einer knappen Stunde war bereits die Frühstückspause gekommen, die ja von Umzugsleuten mit dem feierlichen Zeremoniell einer japanischen Teestunde begangen wird. Sie setzten sich in der schon etwas dünnen Herbstsonne auf die hintere Veranda, stülpten die Bierflaschen in den Mund und packten das Frühstück aus, das sie mit Taschenmessern in Würfel schnitten. Cocki graste mit dem Ausdruck eines verhungerten Waisenknaben Mann für Mann gewissenhaft ab, schlang mit Todesverachtung Brothäppchen und schielte dabei nach den Wurststücken, die sie sich genüßlich in den Mund schoben, ganz offensichtlich ohne daran zu denken, daß ein Hund auch Wurst frißt.
Ich ging, von Weffi begleitet, nach oben und fand Frauchen, die ihre Koffer packte. Mathilde und die Mama klapperten in der Küche. Dann ging ich schnell zu Prächtig in die Garage, um mich moralisch aufzufrischen. Schließlich wanderte ich wieder nach hinten zur Veranda. Der Himmel war blaßblaue Seide, mit langgeschwungenen Föhnfahnen darin. Aber ich sah ihn nur wie durch eine dicke Glasscheibe. Die Dahlien auf den Beeten — hinten die Rotbuche —, alles wie in einem Traum. Jetzt war auf der Veranda das Frühstück zu Ende. Die Männer standen auf und stampften gewichtig ins Haus zurück. Nur einer blieb zurück und suchte etwas: »Ja mei — da war doch noch die Wurscht —, habt’s ihr die Wurscht nöt g’seh’n?« Er erhielt keine Antwort und folgte kopfschüttelnd den anderen. Hinter mir hörte ich es schlappen. Cocki stand am Bassin und soff. Die Wurst schien ziemlich gepfeffert gewesen zu sein.
Jetzt kam auch Peter aus seiner Ecke und steckte neben Cocki seine kleine dunkelrote Zunge in das Wasser. Auch Weffi kam angetrabt, ließ sein Bällchen ins Wasser fallen, wo es hin und her schaukelte, und trank. Die beiden anderen sahen ihn mißbilligend an und drehten ab. Ich blieb noch eine Weile stehen und sah mich um. Am liebsten hätte ich das alles in mein Herz einbrennen mögen. Die letzte Rose, die aussah wie Blut, war nun auch verschwunden. In meinen Eingeweiden fühlte ich mich ganz leer und leicht. Ich ging ins Haus zurück.
Eben kamen die Umzugsmänner aus der oberen Etage, wo sie mit dem Ausräumen fertig waren, in die Diele herunter.
»Gleich mal die Kommode hier!« sagte ihr Anführer, ein Mensch mit Schultern wie ein Berg und einem traurigen Seehundsbart. In diesem Augenblick, wie durch Telepathie herbeigerufen, schoß Cocki aus der Küche, schlidderte unter die Kommode und fuhr von dort mit gefletschten Zähnen gegen die Stiefel der Leute. Der Seehund sah mich an: »Beißt er?«
Ich konnte den Mann nicht leiden in diesem Augenblick. Mich hatte schon den ganzen Morgen die gleichgültige Geschäftsmäßigkeit geärgert, mit der dieser Verein mein Leben auseinandernahm und in eine fahrbare Kiste steckte. Als ob man ein ganzes Leben, ein Leben von sieben Jahren, so einfach wegpacken könnte! Und dann diese flaschenbiersaufende Frühstücksfröhlich-keit inmitten meiner Ruinen. —
»Wenn Sie ‘runterfassen, beißt er natürlich!« sagte ich spitz. Aber dann riß ich mich zusammen: Was erwartest du eigentlich, Idiot? Daß sie in Tränen ausbrechen, wenn sie deine Klamotten schleppen? Ich räusperte mich: »Aber Sie brauchen bloß die Kommode anzuheben. Sobald er nichts mehr über sich hat, ist er friedlich.«
Der Große grinste: »Seine Höhle, was?«
»Woher wissen Sie das? Haben Sie auch Hunde?«
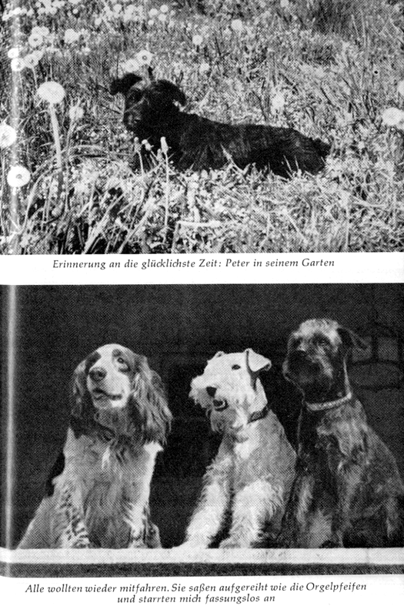
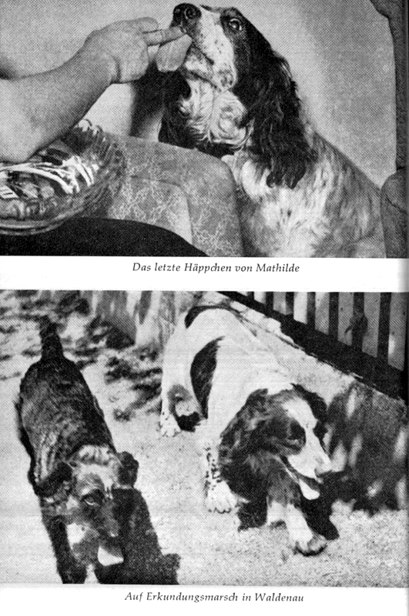
»Einen, ‘nen Schäferspitz. Nich so ‘nen echten, aber treu! Und klug is der, kann ich Ihnen sagen!«
Plötzlich wurde mir der Seehund sympathisch. Er und ein kleiner Dünner mit einem Glasauge hoben die Kommode vorsichtig an. Cockis Gebrüll steigerte sich zur Raserei. Er hatte Schaum vor dem Maul. Noch nie war er so wütend gewesen, und er hatte mir doch schon allerhand Wutanfälle vorgeführt.
Die Männer schwenkten die Kommode herum, und mit einem Ruck war Cocki still. Wo eben noch seine Höhle stand, gab’s jetzt nur noch Luft und einen hellen Fleck an der Wand. Zwei verschimmelte Knochen lagen kahl und unmotiviert an der Fußleiste zwischen grauen Staubflocken. Cocki ließ die gesträubten Stirnhaare herunter, legte die Ohren nach hinten und roch an den Knochen. Dann wandte er sich um und warf mir einen halb ratlosen, halb verachtenden Blick zu: »Und das hast du erlaubt!« Er watschelte in die Küche zurück. Ich starrte ihm lange nach. Ja, so ging es, wenn man stürzte. Der eigene Hund verachtete mich.
Die Männer begannen jetzt das Gesellschaftszimmer auszuräumen. Die Gefährtin rief mich: »Sieh zu, daß sie die Bilder richtig in den Wagen stellen und daß nichts Schweres auf meinen Toilettentisch kommt, sonst bricht die Glasplatte.«
Ich ging hinaus zum Wagen. Innen drin waren sie mit dem Verstauen nicht ganz mitgekommen. Mehrere Möbel standen noch auf der Straße, darunter das große schwarze Sofa aus dem Gesellschaftszimmer. Und auf dem Sofa — auf seinem Sofa —, ganz zusammengekringelt, mit jammervollen Negeraugen: Peterchen.
»Warum bist du denn nicht hinten im Garten geblieben?« fragte ich ihn. Er seufzte nur, ganz schwer, aus der letzten Falte seines Herzens.
»So«, sagte der Große, »weiter, das Sofa hier!« Er sah Peterchen. »Ja, du mußt aber hier ‘runter, Kleiner!« Peter rührte sich nicht, preßte sich nur noch fester in seine Ecke. Da beugte sich der Große nieder, packte ihn mit seinen beiden Bratpfannenhänden ganz vorsichtig wie eine zerbrechliche Vase, hob ihn hoch und setzte ihn sanft auf die Erde. Peter war so verdutzt, daß er zu strampeln und zu fauchen vergaß, was er sonst bei der Berührung durch einen Fremden unweigerlich tat. Er setzte sich neben meinen Fuß und duldete es sogar, daß der Große ihm über die Locke strich.
Ich räusperte mich: »Ach — kommen Sie doch bitte mal ‘n Augenblick herein!«
Der Große folgte mir sichtlich verwundert. Drin holte ich die Cognacflasche aus der Ecke, und da verstand er sofort. Wir bliesen gemeinsam das letzte Viertel aus. Er wischte sich über den Seehundsbart und seufzte: »Guter Stoff!« Dann sah er sich in dem leeren Zimmer um und steckte mir die rechte Bratpfanne hin: »Na, dann wünsche ich Ihnen, daß Sie bald wieder so was finden, schon wegen der Hündchen!«
»Danke.«
»In zehn Minuten sind wir fertig.«
»Gut.«
Kurz vor dem Mittagessen waren wir allein. Gedeckt wurde auf einer großen Kiste, um die wir auf jenen alten, eisernen Gartenstühlen saßen, die schon der Vormieter voller Verachtung im Keller hatte stehenlassen. Peterle hatte sich wieder in seine Gartenecke verkrochen. Ich brachte ihm seinen Napf dorthin, aber er wich angewidert davor zurück. Cocki hatte seinen großen Tag. Nach dem Motto: »Weiß ich, was ich in mei’ Schmerz tu?« leerte er nach seinem eigenen auch noch Peterles Napf und den halben von Weffi, der ebenfalls wenig Appetit zeigte und darauf bestand, dauernd meinen Schoß zu verzieren. Wir unterhielten uns krampfhaft über die Dinge, die zunächst getan werden mußten.
»Hast du fertig gepackt, Frauchen?«
»Ja.«
»Auch wirklich alles? Der Zug fährt in fünfzig Minuten.«
»Ja, natürlich. Wo werdet ihr schlafen?«
»Mathilde in der Küche auf der Matratze, die Mama und ich auf den Klappbetten.«
»Und was wird mit den Hunden? Wir wissen noch immer nicht, was wir mit ihnen machen sollen!«
»Ich werde versuchen, auf alle Fälle Cocki bei den Gutknechts zu parken. Er ist der schwierigste, aber innerlich am robustesten.«
»Dann würde ich jetzt Gutknechts anrufen. Ich kann dann beruhigter fahren, wenn ich weiß, daß sie ihn nehmen.«
Ich dachte einen Moment nach: »Ich weiß nicht recht... Nein, das werde ich nicht machen. Die Leute haben oft merkwürdige Hemmungen, wenn sie sich zu etwas entschließen sollen. Ich überrumple sie einfach, fahre morgen bei ihnen vorbei und nehme den Dicken gleich mit.«
Frauchen stocherte in den Resten der drei Fleischstückchen herum, die sie sich anstandshalber auf den Teller gelegt hatte: »Wie du meinst. Sie haben sich übrigens gar nicht gemeldet in den letzten Tagen.«
»Sicher aus Delikatesse. Stell dir vor, sie wären in unserer Situation, dann würden wir auch nicht dauernd bei ihnen herumwimmeln.«
»Quatsch!« sagte plötzlich die Mama. »Sie sind ja im Anfang immer hergekommen, solange es noch was zu erben gab. Allein die Einmachgläser! Ihr werdet ja sehen, was sie euch erzählen, wenn ihr jetzt mal was von ihnen wollt.«
Frauchen verstaute ihr Stück Fleisch in Weffis Kastenmaul, wo es umständlich herumgeworfen wurde, als sei es aus Eisenbeton. »Du bist ungerecht, Mami. Bisher können wir uns wirklich nicht beklagen, denke an Paul.«
»Der spinnt. Alle Junggesellen spinnen. Aber nicht die Gutknechts.«
»Ich glaube, du mußt dich jetzt fertigmachen«, sagte ich zu Frauchen.
Wie auf Kommando sahen wir uns in dem Raum um. Überall jetzt die heilen Flecken auf der Tapete. Das Eßzimmer, in dem wir saßen, und das Gesellschaftszimmer nebenan sahen noch größer aus als sonst. In der einen Ecke stand noch die Leiter zum Abnehmen der Gardinen, eine Schachtel mit Nägeln und ein Hammer daneben. Überall Papierfetzen und Holzwolle. Der Garten draußen versank plötzlich in Schatten, als ob ein Vorhang fiele. Eine Wolke zog wohl vor die Sonne. Sie stand auf: »Mathilde muß dann noch alles saubermachen.«
»Natürlich«, sagte die Mama, die auch aufgestanden war. Dann fiel sie ihr um den Hals und schluchzte: »Mein armes Kind!«
»Hör auf, bitte!« sagte die Gefährtin und weinte auch.
Ich rannte schnell aus dem Zimmer und fuhr Prächtig vor. Schon beim Anlassen hatte ich alle drei Hunde hinten drin. Dann ging ich ins Haus und holte Frauchens Koffer. Sie nahm gerade Abschied von Mathilde. Auch die heulte. Als ich heraufkam, ging sie taktvoll aus dem Zimmer. Frauchen und ich standen uns in ihrem Schlafzimmer gegenüber. Ich nahm sie um die Schultern, und wir standen und starrten einen Augenblick lang, der einer Ewigkeit glich, auf ihren Balkon. Dort wurden die Blätter des wilden Weins schon bunt. Dann wandte sie sich zu mir um: »Vergiß nicht, ein sauberes Hemd anzuziehen, wenn du morgen zu Gutknechts fährst.«
»Nein.«
»Und pack die langen Unterhosen gleich obenauf, wenn ihr fahrt. Es wird kühl sein im Gebirge.«
»Du schreibst mir gleich?«
»Natürlich. Aber ängstige dich nicht, wenn du mal keine Post bekommst, du weißt, wie das ist.«
»Laß uns jetzt ganz schnell fahren.«
»Ja.«
Sie strich über die Zentralheizung, das einzig Möbelähnliche, das in dem leeren Raum noch geblieben war, nahm ihren Handkoffer und rannte die Treppe hinunter, als sei der Teufel hinter ihr her.
Ich brachte sie zum Zug. Sie bestand darauf, daß ich wegging, ehe er abfuhr. Als ich zum Wagen zurückkam, sahen mich sechs Augen — vier braune und zwei goldene — befremdet und vorwurfsvoll an. »Ja, ihr müßt euch mal eine Weile mit Herrchen allein begnügen«, sagte ich. Aber die Augen blieben unverwandt auf mir. Ich setzte mich hinter dem Steuer zurecht. Warum war denn die Scheibe so trüb? Ich schnaubte mich und wischte mir schnell über die Augen. Da war sie wieder klar.
Plötzlich fiel mir etwas ein: Ich konnte ja auch ebensogut jetzt gleich zu den Gutknechts fahren. So gewann ich Zeit, und es drängte sich nicht alles auf den letzten Tag zusammen. Ich fuhr langsam und beklommen. Die Gefährtin war nicht mehr da. Sie war ein Schild gewesen vor der Welt, selbst als sie da lag, bandagiert und hilflos. Die Stadt erschien mir plötzlich wieder fremd und feindselig. Sie hatte mich zur Strecke gebracht und stieß mich jetzt aus. Nichts hatte sie mir gelassen als mein rollendes Häuschen und die drei Lümmel. Ich tat mir ungeheuer leid, und das wiederum tat mir so wohl, daß ich fast getröstet war, als ich vor Gutknechts Haus parkte. Dann aber überlegte ich es mir anders: Lieber in der Nebenstraße parken, damit er meinen neuen Wagen nicht sieht. Weffi und Peter unten lassen, um ihn nicht zu verwirren. — Die beiden waren natürlich kreuzunglücklich. Als ich mich noch mal umwandte, starrten sie mir durch die Scheibe nach, Kopf an Kopf, schwarz und weiß.
Ich klingelte, Max öffnete. Er sah klein, grau und verbissen aus.
»Ach, du bist es«, sagte er ziemlich trocken. Vielleicht hatte er gerade sein Mittagschläfchen gehalten — daran hätte ich natürlich denken sollen.
»Prost Neujahr!« sagte ich ungeheuer fröhlich. »Cocki, gib Onkel die Hand! Ottilie auch da?«
Sie erschien in diesem Moment, rauschte mir tragisch entgegen wie eine Wagner-Sängerin: »Wie geht’s euch denn?«
»Na danke, gemischt. Wir haben heute vormittag die letzten Brocken in Richtung Speicher verfrachtet, und eben habe ich die Meine in den Zug gesetzt.«
»Möchtest du nicht ‘n bißchen ‘reinkommen?« fragte Max. (Bißchen? Hm.) Laut sagte ich: »Was sonst? Dachtest du, wir sind gekommen, um deinen Flur anzusehen? Hast du, zum Donnerwetter, ‘ne Tasse Kaffee für ‘nen alten Obdachlosen?«
Ich nahm ihn um die Schulter, Ottilie unter den Arm, und so gingen wir ins Speisezimmer. Cocki war derweilen wie immer in die Küche gewandert. Bisher, wenn ich ihn zu Max mitnahm, war er dort von der Maid namens Christine maßlos verwöhnt worden. Jetzt jedoch, als wir uns ins Speisezimmer wälzten, öffnete sich die Küchentür, und Cocki wurde gewissermaßen pneumatisch herausbefördert, mit Christines Schuhsohle an seinem Schwanzfragment.
In mir schoß plötzlich heiße Wut hoch: »Nanu? Christine, schlechte Laune heute?«
»Sie hatte wohl gerade die Küche sauber«, meinte Ottilie hastig.
»Deshalb braucht sie ihn nicht zu treten. Bisher hat sie ihn verwöhnt. Er kann doch nicht ahnen, daß es plötzlich anders ist.«
»Du kennst doch die Frauen«, schaltete sich Max ein. »Außerdem hat es viel zu tun, das Mädel.«
»Ja wirklich, sehr viel zu tun, das arme Mädel«, echote Ottilie. Sie blickte an mir vorbei und schnaufte durch die Nase. Ich folgte ihrem Blick und sah den Dicken, der es sich wie immer in dem Ledersessel mit den Stickkissen gemütlich gemacht hatte. Er lag da, majestätisch hingegossen, mehr denn je einem kleinen Löwen ähnlich, und ließ die Augen über den Tisch hin und her wandern. Dann blickte er mich an: »Sorge dafür, daß die Bande bald mit dem Kuchen ‘rüberkommt!«
»Möchtest du dich nicht setzen? Cocki hat sich’s ja schon bequem gemacht«, sagte Ottilie. (Sonst pflegte sie sich mit knarrendem Fischbeingerüst vor dem Sessel niederzuknien und Cockis Seidentatzen zärtlich an ihr Doppelkinn zu legen.)
»Stammgastmanieren«, sagte ich kurz. »Aber hört mal, Kinder, vielleicht kommen wir euch nicht recht? Dann sagt’s!«
»Aber keineswegs«, meinte Max ohne jede Überzeugung.
»Vielleicht habe ich dich gerade beim Mittagschlaf gestört?«
»Ach wo, wo denkst du denn hin, lieber Hans, ich habe ja soviel zu tun!«
»Ja, soviel zu tun!« echote Ottilie.
»Hier, setz dich, lieber Hans«, sagte Max, »auf deinen gewohnten Platz! Der Kaffee kommt gleich, und Kuchen haben wir auch.«
»Noch von gestern«, meinte Ottilie.
Etwas plumpste auf die Erde, daß das Kristall auf dem Büfett klirrte. Cocki hatte was von Kuchen gehört. Wir produzierten einen solchen Unterhaltungskrampf, daß mir die Kinnbacken weh taten. (>Lieber Hans!< Sonst hatten wir den Old-boy-Ton unter uns kultiviert. Er pflegte mir auf die Schulter zu hauen: »Na, du alter Tintenkuli, du verrückter, kaufen sie dir noch immer deinen Schund ab?«, und ich pflegte darauf zu erwidern: »Na, noch nicht im Zuchthaus, alter Roßtäuscher?« >Lieber Hans!< Als ob ich die Krätze hätte oder fünfhundert Mark von ihnen gepumpt und um Prolongation bäte!)
Endlich erschien Christine mit Kaffee und Kuchen. Ich faßte sie scharf ins Auge, und sie errötete. Wenigstens noch ein Mensch, der sich schämen konnte in diesem Laden. Der Kaffee schmeckte mir wie Abwaschwasser und der Kuchen wie Galle. Ach, Cocki, was tue ich nicht für dich! Er richtete sich gerade an Max hoch, kratzte in altbewährtem Vertrauen sein Hosenbein und leckte sich erwartungsvoll die Katerborsten.
»Nein, das geht aber nicht, Cocki!« sagte Max, packte die Tatzen und warf sie weg. Ja — er warf sie weg, wie man einen Schmutz wegwirft. Cocki saß einen Augenblick verdutzt auf dem Hinterteil. Dann trat ein ganz seltsamer Ausdruck in seine Augen, die er unverwandt auf Max geheftet hielt. Ich kann diesen Ausdruck nicht beschreiben, aber er war so, daß ich hoch über mir die Räder der himmlischen Registrierkasse klicken und eine große Minussumme auf Maxens Konto buchen hörte.
»Wir haben dauernd an euch denken müssen«, sagte Ottilie schnell. Offenbar hatte sie Angst, es ganz mit mir zu verderben — falls doch noch mal ein Propagandaartikel für ihren Wasserzwerg nötig war. Und mit so was hatten wir unter unserer Linde bei einem alten Rotwein gesessen und über Buddha und das Atomzeitalter gesprochen! —
»Besonders wegen der Hündchen!« hörte ich ganz von fern Ottilies Stimme. Mit einem Ruck war ich wieder bei mir. Wegen der Hündchen. Vielleicht hatte ich mich doch getäuscht! Man redet sich so leicht in Wut und Enttäuschung hinein, wenn man nicht in Form ist.
»Ja, und besonders wegen Cocki!« sagte Max. »Die beiden anderen sind ja leicht unterzubringen, aber unser lieber Schwerenöter hier...« Er streichelte den Kopf des Löwen, der sich an meinen Stuhl gepreßt hatte. Der Dicke sah ihn erstaunt an und kniff dann neckisch ein Auge gegen ihn zu. In mir löste es sich. Gott sei Dank, da hatte ich mir also alles eingebildet. Meine verdammte Phantasie, Arm in Arm mit dem mütterlichen Pessimismus, war wieder mal mit mir durchgegangen.
»Ja«, sagte ich, »Cocki ist das Problem. Aber ihr wißt ja, wie goldig er ist, wenn man Humor hat und ihn versteht.«
»Eben — eben«, sagte Max abwesend und suchte in seinen Taschen. »Wo habe ich denn das hingelegt, Ottilie, du hast doch den Schreibtisch sauber gemacht?«
Sie versicherte, daß sie das niemals wagen würde, auch nur so am Rande herumzuwischen: »Ich weiß doch, wie du dich damit hast.«
Schließlich fand er es in der Brieftasche, ein kleines Stück Papier, setzte sich die Brille auf, studierte es ehrfürchtig, wie eine Kostbarkeit, und reichte es mir dann herüber: »Ich glaube, lieber Hans, das löst das Problem. Ich habe es extra für dich ausgeschnitten. Na — was sagst du?«
Ich starrte verblüfft auf das Papier. Es war ein Zeitungsausschnitt. Ein Inserat:
Wo bleibt dein Hund?
Müller im Thal. Die erstklassige Hundepension für beliebige Zeitdauer. Pensionspreis von 1.50 bis 5 — DM. Einzel- und Gemeinschaftskäfige. Großer Auslauf. Sachverständige Behandlung. Ärztliche Betreuung.
Als ich wieder zu mir kam, merkte ich, daß ich während der ganzen Zeit, in der mein Seelenschubfach mit der Aufschrift >Gutknecht< endgültig in Stücke ging, Cockis Kopf gestreichelt hatte.
Ich faltete das Papier zusammen: »Auf jeden Fall werde ich das mal behalten. Als Erinnerungsstütze — sozusagen.«
Was war in meinem Gesicht, daß die beiden plötzlich so erschraken?
Ich sah auf die Uhr: »Also Kinder, ich danke für die diversen Genüsse — und Aufschlüsse — reimt sich sogar. Wir müssen jetzt weiter.« Ich stand auf.
»Hier, Cocki«, sagte Max, »noch ‘n Stückchen Kuchen auf den Weg.«
Ich hielt seine Hand fest: »Bitte nicht, er hat schon zweimal heute Mittag gefressen.«
»Du schreibst doch?« fragte Ottilie, als ich die Klinke in der Hand hatte.
»Natürlich«, sagte ich, »— Bücher hoffentlich.«
Max schüttelte meine Hand: »Hahaha — dein Humor — dein goldener Humor!«
Ich feixte ebenso pseudo-herzlich zurück, während alles in mir danach schrie, diese Pesthöhle der geschminkten Herzlosigkeit hinter mich zu bringen: »Golden? Na, sagen wir — Doublé — im Augenblick.«
Ich hatte noch nicht drei Stufen hinter mir, da schloß sich oben die Tür, und die Kette wurde vorgehängt. Sie hatte sich in ihrer Plüschburg verschanzt, die Bande. Ich ging noch den Treppenabsatz zu Ende hinunter und setzte mich dann hin. Cocki war mir unwillig gefolgt und hatte mehrmals zwischen der geschlossenen Tür und mir hin und her geblickt: »Haben wir nicht was vergessen? Ein gewisses Stück Kuchen zum Beispiel?«
Jetzt stand er auf der Stufe über mir. Ich zog seinen Kopf an mein Gesicht: Hundepension! Mein Löwe! Sachverständige Behandlung! Wie behandelt man Seidenlöwen mit Diktatorenherzen sachverständig? Indem man ihnen das Löwenherz bricht? Kommt nicht in Frage!
Es kam jemand die Treppe herauf. Ich stand schnell auf. Mein Rücken schmerzte, und meine Knie waren weich.
6
Als ich mit Cocki wieder vor der Haustür stand, war mir übel. Es war, so stellte ich durch Selbstanalyse fest, Menschenekel und — noch mehr — Angst vor der Zukunft. Bisher war ich immer gerade noch so weggekommen. Wenn eine Sache nicht mehr zog, stellte sich stets rechtzeitig die nächste ein und trug mich ein Stück weiter.
Ein Ruck brachte mich zur Besinnung. Cocki, des Angeleintseins völlig ungewohnt, betrachtete mich als lästiges Anhängsel, das man mit Brachialgewalt zu all den aufregend riechenden Plätzen ringsum schleppen mußte. Da war zum Beispiel gleich dieser Stein am nächsten Hauseingang. —
»Komm, Dicker«, sagte ich, »wir müssen weiter, die beiden anderen warten im Wagen auf uns.«
Er sah nicht mal auf. Die massive Nase an den Steinpfosten geklebt, blieb er in einem Riechen.
»Hör zu«, sagte ich, »wir wollen in unser Haus, in unsere Höhle! Herrchen will in seine Höhle! Auch wenn sie leer ist und wir sie nur noch eine Nacht haben!«
Er kratzte mit der Tatze am Stein, was mich mit Hoffnung erfüllte. Gewöhnlich war dies das vorletzte Stadium der Zeremonie. Tatsächlich hob er auch das Bein, um das Genossene zu quittieren. Dann aber fing er mit dem Gerieche von vorn an.
»Also jetzt ist Schluß!« erklärte ich und zerrte an der Leine. Er stemmte sich dagegen, drehte den Kopf mit einem Ruck aus dem Halsband und roch weiter. Ich legte ihm das Halsband wieder an, diesmal zwei Löcher enger. Dann warf ich mich ins Geschirr wie ein Wolgaschiffer. Als er merkte, daß er den Kopf nicht herausbekam, schmiß er sich hin und ließ sich wie ein ungezogenes Kind über das Pflaster schleifen.
»Sie! Das ist Tierquälerei!« sagte eine Stimme neben mir. Es war eine entschlossen aussehende Dame mit gewaltigem Busen, flachem Hut und noch flacheren Absätzen.
»Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Sachen!« entgegnete ich wütend.
Ihr Busen wuchs mir bedrohlich entgegen: »Ich bin im Tierschutzverein!«
»Ich auch.« Damit beugte ich mich nieder, lud mir achtundvierzig Pfund Springer-Cocker auf den Arm und wankte damit um die Ecke zum Wagen. Nach zwanzig Schritten taten mir die Arme so weh, daß sie ganz steif waren, und je steifer sie wurden, desto glitschiger wurde der Dicke. Wenn er nicht auf dem Arm bleiben wollte — und das wollte er nie —, konnte er seine Knochen auf mysteriöse Weise in Gallert verwandeln. Er war eine einzige seidenweiche, schlüpfrige Masse, die einem überall heraus- und herunterfloß.
Ich blieb pustend stehen: »Wenn du jetzt nicht artig bist, Lümmel!«
Er hatte die dicke Schnute ganz breit gequetscht auf der weißseidenen Zottelbrust und blickte mich mit scheinheiligem Vorwurf an: »Was willst du denn? Mache ich irgendwas?«
Die Knudelpfoten hingen ihm vorn herunter, und die langen goldenen Ohren flössen über meinen Arm. Da übermannte es mich, und ich knutschte ihn direkt auf die dicke Flappe: »Scheißkerl!«
Jemand tippte mich auf den Arm: »Sie — davon bekommen Sie Würmer!« Es war ein kleiner, dürrer Mann mit spitzer Nase und einem breitkrempigen Hut, der seine Ohren umbog.
»Das weiß ich«, sagte ich, »aber die brauche ich zum Angeln.«
Dem Mann fiel der Unterkiefer herunter. Ich packte mein Fellbündel wieder auf Schulterhöhe und wankte weiter. Gerade, als ich am Wagen ankam, floß mir der Dicke aus den völlig erstarrten Armen. Sobald ich die Wagentür öffnete, schoß Weffi wie ein Blitz heraus. Er stellte seine Belle an, daß mir sämtliche Gedanken entschwanden, und biß mich in die Schuhe. Dann sah er einen Rehpinscher im Schlepptau einer alten Dame mit Schirm. Der Rehpinscher hatte ein Halsband mit Glöckchen um und eine blaue Decke auf dem Rücken. Weffi roch ihm in die Schnauze, worauf der Rehpinscher stehenblieb, die Augen herausdrehte und zu zittern begann. Weffi beschnupperte erstaunt seine Decke, roch ihm am Gegenteil, das postgelb gefärbt war, und klemmte ihn sich dann entschlossen unter. Der Rehpinscher schrie wie am Spieß. Auch die Dame schrie: »Wirst du wohl...« Und damit schwang sie den Schirm. Weffi floh, von Panik erfaßt, wild in die Gegend, prallte gegen die Schienbeine eines Herrn, der seine Aktentasche fallen ließ, und raste dann auf den Damm. Ein Lieferwagen bremste mit quietschenden Reifen. Der Chauffeur gebrauchte eine große Anzahl volkstümlicher Ausdrücke. Ich raste hinterher, Weffi floh in meine Arme, er zitterte, der Chauffeur schimpfte noch lauter, Leute sammelten sich an.
»Wir leben sonst auf dem Lande«, sagte ich ziemlich lahm.
»Da gehörst du auch hin, Depp, blöder!« erklärte abschließend der Chauffeur und fuhr weiter. Ich stopfte Weffi in den Wagen, wischte mir den Schweiß von der Stirn und schaute mich dann nach dem Rest meines Zoos um.
Das erste, was ich sah, war Cocki, der gerade an der Kartoffelkiste eines Gemüseladens das Bein hob. Während er es tat, fixierte er sehr interessiert eine Markttasche, die jemand neben der Kiste abgestellt hatte. Gerade als ich hinkam, war er mit der Kartoffelbewässerung fertig und steckte den Kopf in die Tasche. Ich hob ihn hoch, er knurrte. Da flog er schon aufs Wagenpolster. Das Polster sah aus! Als ich die Tür zuwarf, brüllte er wütend hinter mir her. Weffi — wie üblich völlig ahnungslos — kläffte sicherheitshalber mit. Wo war denn nun Peter?
Er saß zehn Meter weiter auf dem Bürgersteig und machte ein Würstchen. Dabei sah er wie gewöhnlich besonders jämmerlich aus. Während ich mich bückte, um ihn an die Leine zu legen, sagte ein wohlwollend aussehender dicker Herr: »Lassen Sie das nicht den Polizisten sehen.«
Ich zerrte die auf den Hinterbeinen rutschende Jammergestalt auf den Damm. Während die Prozedur dort weiterging, tauchte tatsächlich das Auge des Gesetzes auf. Es musterte streng den Vorgang, räusperte sich dann und sagte: »Das ist Verkehrsbehinderung!«
»Aber, wo soll er denn? Auf dem Bürgersteig darf er nicht, auf dem Damm ist’s Verkehrsbehinderung — wofür zahle ich eigentlich Hundesteuer?«
»Ziehen Sie ihn mehr an den Rand!«
Noch mal ziehen! Ich blickte auf das schwarze Fragezeichen, das mich seinerseits mit gequälten Augen ansah. Außerdem war es auch noch eine schwierige Sache, bei der ihm die dürftigen Hosen zitterten, während er am Kopfende angestrengt hechelte. Ich zog, er sperrte sich. Da kam ein Lastwagen vorbei. Und im Augenblick, da die großen Räder an ihm vorüberdröhnten, schrie er vor Entsetzen auf, warf den ganzen Ballast mit einem Ruck ab und zerrte mich winselnd in Richtung Wagen.
Das Auge des Gesetzes musterte das vollendete Werk und schien im Zweifel, ob es nicht sein Notizbuch zücken sollte. Peter und ich krochen schnell in den Wagen, ich ließ an und fuhr los. Nur weg von hier!
Zwei Straßen weiter hielt ich und legte erst mal einen Moment den Kopf aufs Steuer, um meine Seelenknochen zu sammeln. Dann drehte ich mich um. Weffi sprang zu mir nach vorn und schlotterte mit den Vorderbeinen.
Weffi! Ich zog ihn an mich: »Jetzt müssen wir’s eben mit dir versuchen, mein Holzpferdchen, mein geliebtes. So geht’s eben nicht mit euch dreien, das mußt du doch einsehen! Und du bist so’n kleines Schäfchen, das zu jedem lieb ist. Vielleicht ist es leichter mit dir als mit Cocki. Wer nimmt schon so’nen wilden Mann! Und es ist ja auch bloß für kurze Zeit. Die Wesselys werden dich nehmen. Aber die werde ich nicht überraschen, sondern Renate vorher anrufen. Die gute Tante Renate, weißt du, die dich so liebt!«
Da war ja auch gerade eine Telefonzelle. Ich stieg aus, fing Weffi ab, der hinter mir herschießen wollte, und ging dann in die Zelle. Renate war am Apparat: »Das ist aber nett, Hannes, daß du anrufst! Wir haben gerade gestern von dir gesprochen!«
Wie mir die Wärme ihres Tones guttat. »Das ist lieb von dir, Renatchen, hör mal zu...«
»Du, Hannes, behalte mal, was du sagen wolltest. Ach, du mußt unbedingt herkommen, gleich, ja?«
»Gewiß, aber — ich meine...«
»Du — ach, ich muß es dir gleich sagen. Eigentlich sollte es ja ‘ne Überraschung sein. >Was wird der Hannes nur für Augen machen!< hab’ ich zu Stefan gesagt. Du — wir haben einen Hund!«
»Einen...« Ich fühlte, wie mir wieder übel wurde.
»Ja, seit drei Tagen schon. Einen Pudel! Willibald heißt er! Der süßeste Pudel, den du dir denken kannst! Anderthalb Jahre, ein Mordskerl! Was macht denn die Deine?«
»Ich habe sie eben zur Bahn gebracht.«
»Ach Gott, ihr zieht ja morgen! Daran habe ich gar nicht gedacht! Armer Kerl! Jetzt mußt du aber gleich herkommen — gleich, ich muß dich trösten!«
»Gut, ich bin in zehn Minuten bei dir. Hör mal, sperr doch den Willibald ein, wenn ich komme. Ich habe Weffi bei mir.«
»Weffi, der süße — wo läßt du ihn denn?«
»Darüber wollte ich ja eben mit dir reden — also bis gleich!«
Ich hängte schnell auf. Als ich wieder im Wagen war, nahm ich Weffi auf den Schoß: »Also, mein kleines Holzpferdchen, da ist schon wieder ‘ne Komplikation! Aber du wirst dich mit Willibald vertragen, nicht wahr? An dir wird’s nicht liegen, das weiß ich. Und wenn ihr euch anfreundet und du für die Zeit, wo Herrchen nicht bei dir ist, einen Kameraden hättest — wär das nicht fein?«
Bei >fein< spitzte er die Ohren und sah mich mit glänzenden Augen an.
Renate öffnete, beugte sich zu Weffi nieder und nahm ihn auf den Arm: »Ach, mein süßer Struppeldipubbel!« Weffi leckte sie am Ohr und hechelte vergnügt. Dann legte er den Kopf schief, denn hinter der Tür zum Bad tobte Willibald. Er kratzte, weinte und bellte abwechselnd. Weffi sprang von Renates Arm und beschnüffelte den Türritz. Renate gab mir einen Kuß: »Na, Strohwitwer? Was machst du denn für’n Beerdigungsgesicht? Ich dachte, du kommst hier an mit ‘m Hut im Genick und ‘ner Stichflamme! Na, komm mal ‘rein, du siehst aus, als ob du einen Cognac brauchst!«
»Das ist das erlösende Wort!«
»Na also. Meinst du, ich kann Willibald ‘rauslassen?«
»Probieren wir’s. Wenn’s was gibt, stürzt sich jeder auf seinen. Außerdem — warte mal —, füll auf jeden Fall einen Eimer mit Wasser.«
»Warum denn?«
»Zum Rübergießen, wenn wir sie anders nicht auseinanderbekommen.«
Wir füllten gemeinsam den Wassereimer, dann machte Renate die Badezimmertür auf. Etwas Großes, Schwarzes mit langen Hosen und einer ganz hohen Stirn schoß daraus hervor, sprang an Frauchen hoch und stutzte dann, als es Weffi sah.
»Schön artig, Willibald«, sagte Renate beschwörend, »schön artig!«
»Laß mal — sei ganz still. Wir wollen so tun, als ob wir sie gar nicht beachten.«
»Na gut, verlegen wir den Kriegsschauplatz ins Zimmer, setz dich auf die Couch, ich hole den Cognac.«
»Einverstanden.«
Auf dem Teppich vor uns beschnüffelten sich die beiden Hunde mit aufgestellten Schwänzen. Weffi schlotterte dabei mit den Vorderbeinen, während mich seine stillen braunen Augen fragend ansahen: »Was ist denn das für ‘ne Veranstaltung?«
Wir nahmen den Cognac in Angriff und stießen die Schalen gegeneinander. »Ist er nicht bildschön?« fragte Renate.
»Ja, ein Prachtkerl! Seine Augen erinnern mich an Peterchen. Nicht locken, Renate, sonst gibt’s Eifersucht. Wir wollen uns unterhalten. Wo ist Stefan?«
»In der Galerie. Ich hoffe, er kommt bald. Du bleibst doch?«
»Lange nicht, mein Kind, ich muß die Mama trösten.«
»Also, zunächst erzähle mal, was los ist!«
Da erzählte ich ihr alles, was ich auf dem Herzen hatte. Es tat mir wohl, und Renate verstand es. Sie und Stefan hatten ebensolche Zeiten des Auf und Ab mitgemacht.
»Gräm dich nicht über die Gutknechts«, sagte sie, »je eher man entdeckt, welche Leute man abschreiben muß, desto besser. Und mach dir keine Sorgen wegen Weffi. Wenn sie sich einigermaßen vertragen, behalte ich ihn, bis du ihn wieder abholst. Es ist überhaupt keine Last für mich. Im Gegenteil — wenn ich mir vorstelle, daß ich mit zwei so Süßen spazierengehe —, da, sieh mal!«
Willibald roch Weffi umständlich an der Schnauze. Dann legte er ihm den Kopf auf den Rücken: »Ich bin der Herr hier!« Weffi wedelte verbindlich: »Ich erkenne dich als Herrn an!«
»Scheint ja zu klappen!« meinte Renate. »Jetzt werde ich dir Kaffee machen. Kommst du mit in die Küche?«
»Meinst du, man kann sie schon allein lassen? An sich habe ich ja schon Kaffee getrunken.«
»Das war Gutknechtscher, der zählt nicht. Wir lassen die Tür auf, komm.«
Weffi kam mit, sah uns eine Weile zu und trippelte dann wieder zu Willibald ins Zimmer.
»Du mußt darauf achten«, sagte ich zu Renate, »daß sie beim Fressen getrennt sind, wenigstens am Anfang. Ich bringe dir morgen den Napf. Viel Gemüse für beide, geriebene rohe Mohrrüben, morgens und abends die Äugelchen auswischen, fleißig bürsten und kämmen. Ich bring’ dir auch Puder und Salbe, wenn einer mal ‘n Ekzem hat.«
In diesem Augenblick hörten wir ein Geräusch aus dem Zimmer, ein Knurren. Dann ein Wutröcheln. »Schnell — Renate!«
Wir stürzten aus der Küche, aber es war schon zu spät. Ich weiß nicht, weshalb der Kampf ausgebrochen war. Jedenfalls wälzte sich ein fauchendes, beißendes schwarzweißes Bündel auf dem Teppich. Ich packte die beiden am Genick und riß sie auseinander. Dann aber entschlüpfte mir Willibald und biß sich an Weffis Schenkel fest, den ich hochgerissen hatte. Weffi schrie auf, Renate stand da, die Hand vor den Mund geschlagen, unfähig, sich zu bewegen. So mußte ich Weffi wieder loslassen, damit er sich verteidigen konnte.
»Schnell den Eimer!« schrie ich. Das brachte sie zur Besinnung, und sie rannte in die Küche. Derweilen hatte Willibald Weffi unter sich und grub seine Zähne in sein Genick. Weffi warf sich herum, kam wieder auf die Beine und packte Willibald am Ohr. Der schüttelte ihn ab, sprang nach und warf Weffi abermals um. Der aber packte ihn von unten her am Vorderbein. Jetzt schrie Willibald auf. Ich tanzte hilflos um die beiden herum wie ein Indianer am Lagerfeuer. Schließlich warf ich mich auf die Knie, um sie besser fassen zu können. In diesem Augenblick ging eine eiskalte Sturzflut nieder, hauptsächlich auf mich. Aber es blieb noch genug für die Hunde übrig. Sie keuchten, gurgelten und ließen sich los. Ich packte Weffi und sauste mit ihm ins Bad. Er zitterte, schluckte und geiferte. »Ist ja gut«, krächzte ich, noch ganz außer Atem, »ist ja gut!«
Dann untersuchte ich ihn: eine Schramme am Hinterschenkel und ein Loch im Nackenfell. Aber da waren ja plötzlich überall Blutflecken — im Fell — und da — und da auch! Schließlich merkte ich, daß es meine Hand war. Zwei Finger klafften ganz ordentlich, und jetzt tat’s auch weh. Draußen schloß es. Irgend jemand kam, Renate sagte etwas.
»Hast du Verbandzeug?« rief ich durch die Tür. Sie öffnete sich, es war Stefan.
»Schnell — mach zu«, schrie ich, »daß Willibald nicht ‘reinkommt!«
»Zu Befehl!« sagte Stefan und schloß die Tür. Dann setzte er sich auf den Thron, sah mich an und lachte schallend: »‘ne Wasserleiche! Sieh doch mal in den Spiegel, Mensch! Geht’s dir immer so, wenn du mit Renate allein bist?«
»Gib mir lieber Verbandzeug, dummes Luder!«
»Zu Befehl. Hier hast du Wasserstoff — und da ist Pflaster — hahaha!«
Jetzt kam auch Renate: »Mein Gott, wie siehst du aus! Entschuldige bitte, es war meine Premiere im Wassergießen! Stefan, hol ihm ein anderes Hemd — zeig mal deine Hand!«
»Was ist mit Willibald?« fragte ich.
»Gar nichts. Bißchen an der Pfote. Er steht hinter der Ateliertür und will weiterraufen.«
Stefan erschien mit strengem Gesicht und einem Hemd in der Hand. »Hier«, sagte er und blickte Renate finster an, »zwei Knöpfe fehlen!«
»Dann hol eben eins von den anderen!«
»An den anderen fehlen mindestens drei Knöpfe.«
»Du weißt, daß ich in Knöpfen ausgesprochen schwach bin.«
Er grinste: »Nur darin?«
»Ich mache jetzt das Hemd fertig. Hilf Hans derweile.«
Er tat es und sah dabei auf Weffi, der zitternd in der Ecke neben dem Thron saß: »Dem ist’s aber ganz schön in die Glieder gefahren.«
»Mir auch.«
Er sah mich an, und sein Gesicht wurde ernst: »Ja — Pech, Alter.«
»Ich habe nur noch Pech in letzter Zeit.«
»Man könnte es ja vielleicht noch mal versuchen. Vielleicht raufen sie sich zusammen.«
»Nett von dir, aber lassen wir’s. Ich werde schon sehen.«
Renate erschien mit dem Hemd: »So, ich habe dir die beiden Knöpfe angenäht.«
Stefan schlug die Hände vor die Brust: »Ein Wunder! Ein leibhaftiges Wunder! Sonst findest du doch nie die Reserveknöpfe!«
»Habe ich auch jetzt nicht«, erklärte sie stolz, »ich habe einfach zwei von unten abgetrennt und oben angenäht.«
»Oben hui, unten pfui«, verkündete Stefan. »Hoffentlich holst du dir keinen Schnupfen, mein Junge.«
»Der Kaffee ist fertig«, erklärte Renate, »macht jetzt endlich. Bring Weffi mit, Hannes, Willibald ist im Atelier und leckt sich die Pfote.«
»Hans meint, es wird nichts mit den beiden!« sagte Stefan.
Sie sah mich zaudernd an: »Ja — sieht fast so aus —, aber was willst du jetzt machen?«
»Ich könnte es noch mit Peter versuchen. Professor Kluge würde ihn sicher nehmen. Er hat ihn sehr gern und hat keinen Hund. Nur, gerade Peter!«
»Einer muß es ja schließlich sein«, sagte Renate. »Ruf den Kluge gleich nachher mal an. Aber erst kommt zum Kaffee.«
Weffi saß bei uns und zitterte. Er nahm keinen Kuchen, ging immer wieder zur Flurtür und winkte mir von dort her mit dem Kopf: »Komm ‘raus, hier ist’s nicht geheuer!«
Von nebenan hörte man Willibald schimpfen und kratzen. »Der arme Kerl!« sagte ich.
Stefans Antwort kam etwas undeutlich aus dem vollen Mund: »Der soll erst mal Manieren lernen!«
»Du auch«, sagte Renate, »ich habe dich schon besser mit vollem Mund reden hören.«
»Er war im Recht«, sagte ich.
»Wer, Stefan?«
»Nein, Willibald.«
»Hast du immer recht bekommen, wenn du im Recht warst?« fragte Stefan. »Na also!«
Es klingelte. Er stand auf und ging ‘raus. Draußen war eine aufgeregte Männerstimme. »Der Portier!« flüsterte Renate.
»Ist bei Ihnen ein Wasserrohrbruch?« hörte ich eine schnauzige Stimme. »Es kommt bei Möllers unten durch die Decke.«
»Nein«, sagte Stefan ernst, »ich habe nur meinen Kanarienvogel gebadet. Das nächstemal lege ich ‘nen Schwamm unter.« Er schloß die Tür.
Ich sah auf die Uhr: »Gleich sechs — na, da werde ich mal anrufen.«
Renate nickte: »Tue das.« Sie ging taktvoll in die Küche. Stefan verzog sich ins Atelier.
Ich wählte. »Benediktinerkrankenhaus? Kann ich Professor Kluge sprechen? Danke. Tag, Paul! Ja, ich mache ganz schnell. Du warst so nett zu mir mit dem Wagen, und jetzt hast du noch den Undank davon, denn ich muß dich noch um etwas bitten: Könntest du für ‘n paar Wochen das Peterle nehmen?«
Am Apparat war eine kurze Pause: »Natürlich kann ich das. Hast du es schon mit den beiden anderen versucht?«
»Ja, alles schiefgegangen. Aber wenn du auch nur im geringsten...«
»Unsinn. Es ist nur — du weißt, ich bin fast nie daheim, und das Kerlchen braucht doch Gesellschaft.«
»Und was ist mit Agathe?« (Seine Wirtschafterin.)
»Versuch’s. Wenn du mit dem Drachen fertig wirst — mir ist es recht.«
»Ich fahr’ gleich hin.«
»Viel Glück.«
Wie üblich machte Agathe die Tür erst mal auf, ohne die Sicherheitskette auszuhaken, und blinzelte mißtrauisch über ihre Augensäcke. Dann verklärte sich ihr Gesicht: »Ach, der Herr Doktor!« (Für sie waren alle Leute mit schwarzen Brillen Doktoren.) Die Kette klirrte, und die Festung öffnete sich: »Ach, und das liebe Peterchen!«
Peter, den ich mitgenommen hatte, wedelte sie unverbindlich an und ging dann mit steifen Beinen gegen das große Tigerfell mit dem fletschenden Kopf zu, das in der Diele hing. Er sträubte die Nackenhaare und knurrte tief wie ein Bernhardiner.
»Der Professor hat schon telefoniert«, sagte Agathe, »das Abendbrot ist fertig.«
»Aber ich möchte eigentlich mit der Mama...«
Ihre altersblassen Augen sahen mich an: »Sie werden mir doch das nicht antun, Herr Doktor! Nur ein kleiner Imbiß.«
Sie wollte mir aus dem Mantel helfen, ich wehrte ab: »Nein, danke, erst nach dem ersten Schlaganfall!«
Sie kicherte: »Das hat lange Zeit!«
An einem Löwenfell und einem Arrangement von Zuluspeeren entlang gingen wir in die Bibliothek. Eichengetäfelte Decke, Bücher bis obenhin, deren goldbeschriftete Rücken im Rampenlicht blinkten. Vor dem Kamin ein niedriger Tisch, Damasttuch, schweres Silber, eine alte staubige Rotweinflasche im Körbchen, Hummersalat, kaltes Huhn, Importen und Hennessy auf einem Tischchen nebenan.
»Agathe«, sagte ich, »wollen Sie mich verführen?«
Sie kicherte wieder mit ihren drei Zähnen: »Ich weiß, daß die Liebe durch den Magen geht!«
»Dann müßten Sie ja Paul längst verführt haben.«
Sie seufzte: »Ach, der Professor merkt ja gar nichts. Er ißt mit dem Buch auf dem Schoß, wenn er überhaupt nach Hause kommt.«
»Hm!«
»Wie war denn der Hummer?«
»Wunderbar, Agathe. Aber von dem Huhn nehme ich nichts. Ich muß mit der Mama essen.«
»Dann nehmen Sie wenigstens eine Zigarre. Für den kleinen habe ich Schabefleisch besorgt.«
Sie holte vom Kaminbord ein Näpfchen und stellte es Peter hin. Der hatte sich inzwischen mit dem Eisbärfell unterhalten, das vor dem Kamin lag. Erst war er vor dem Riesenkopf mit den Glasaugen und den gewaltigen Hauern zurückgewichen. Dann hatte er sich — ein Fliegenbein vorsichtig vor das andere setzend — angepirscht, ihn berochen und ihm schließlich in die Nase gebissen. Darauf kriegte er eine Niestour. Der alte Kerl haarte sicher. Als Agathe Peterchen jetzt das Näpfchen hinstellte, fraß er es gierig leer, immer wieder kurz aufblickend und den Kopf mit den Glasaugen herausfordernd anknurrend. Zwischendurch sah er mich, Anerkennung heischend, an. Es war ein Spiel. Er wußte ganz genau, daß der da tot war. Aber ich sollte ihn loben. Schließlich leckte er den Napf sauber und sprang anschließend Agathe auf den Schoß. Sie streichelte ihn mit feuchten Augen: »Na, so ein liebes Kerlchen und so klug!«
Ich lehnte mich zurück und zündete mir die Zigarre an: »Wollen Sie ihn hierbehalten für ‘n paar Wochen?«
Sie seufzte: »Der Professor hat’s mir schon gesagt...«
»Na, und wie ist das, Agathe? Sie würden mir einen großen Gefallen tun!«
Sie seufzte wieder: »Ich tät’s gewiß gern, von Herzen gern, Herr Doktor. Aber sehen Sie — ich bin ‘ne alte Frau — und die große Wohnung — und so schlecht auf den Beinen.«
»Warum nehmen Sie sich denn dann nicht ‘ne junge Hilfe?«
Ihre Augen funkelten: »So ‘n junges Ding — das könnte mir


fehlen! Das nur mit dem Steiß wackelt und um den Professor herumgirrt! Weiberwirtschaft — hier im Haus!«
»Na ja, Agathe, wenn das so ist...«
Sie neigte sich zu mir vor und legte mir die Hand auf den Arm: »Und sehen Sie, vor allem eins, lieber Herr Doktor! So’n Seelchen wie der Peter braucht Liebe. Der will die ganze Liebe von ‘nem Menschen für sich. Und ich habe doch mein Lorchen, und — ich kann nicht teilen! Und Peter würde das merken, glauben Sie nicht?«
»Ja«, sagte ich, »Agathe, ich glaube es.« Ich sah mich um. Die Lampe brannte still. Die tausend Gesichter der Bücher, der schwere Danziger Barocktisch mit dem Fries tanzender Bauern, die dunkelroten Vorhänge — ein Heim, ein schönes, ruhiges, eigenes Heim.
»Tja — Agathe, dann werden wir so allmählich wieder aufbrechen.«
»Aber wohin wollen Sie denn mit den drei kleinen Kerlchen und der alten Mama?«
Ich stand auf: »Irgendwohin, Agathe, irgendwohin. Komm, mein Peterle!«
7
Es war schon dunkel, als wir zu Hause ankamen. Zu Hause!
Alle anderen Häuser hatten schon Licht. Nur unseres lag dunkel. Was war denn los? Ach so, man hatte ja schon alle Lampen abmontiert!
Aus der Küche drang ein schwachrötlicher Schein. Ich schlich mich ans Fenster. Da saß Mathilde bei einer Petroleumlampe vor einer dicken Kaffeetasse und las einen Fünfzig-Pfennig-Schmöker. Ich trat leise zurück und blickte zu den Bäumen auf, die groß unter silbernen Mondwolken rauschten. Was mochte Frauchen jetzt machen? Vor zwei Stunden war sie angekommen und ging vielleicht gerade in den Speisesaal hinunter. Plötzlich hatte ich wieder Hunger. Auf was Solides, Schnitzel ä la Holstein mit einem ordentlichen Schluck Bier zum Runterspülen. Wo waren eigentlich meine drei? Aha: Getöse vom Ende der Straße. Cocki und Weffi rasten mit Schäferhund Alf (sie draußen, Alf drinnen) am Zaun entlang und spielten >furchtbar böse<. Und Peter? Vom Bassin her kam ein Schlapfen. Dann tip-tip-tip seine Schritte über die Fliesen. Ich sah seinen Schatten undeutlich im Mondlicht. Jetzt blieb er stehen und roch an einer Aster.
»Komm, mein kleiner Sonderling«, sagte ich. »Sehen wir, was hier innen los ist!«
Er richtete sich mit eingezogenem Schwänzchen an mir hoch. Ich streichelte ihn. Dann pfiff ich den beiden anderen und schloß auf.
Als ich in die Diele trat, blieb ich überwältigt stehen: auf der Treppe zum ersten Stock brannte als einzige Beleuchtung eine Stearinkerze. Das gesamte Mobiliar der Diele bestand aus einem Besen, einer Müllschaufel und den drei Hundedecken, die in verschiedenen Ecken lagen. Mathilde kam aus der Küche, Peterle, der genauso erstarrt war wie ich, kroch auf sie zu und schmiegte sich an ihr Knie. »Mein armer, kleiner Kerl!« sagte sie und nahm ihn auf den Arm. Und dann streng zu mir: »Das Haus ist besenrein!«
»Aha!« sagte ich ziemlich dumm. »Und wo ist die Mama?«
»Im Speisezimmer.«
Hinter mir kratzte es an der Tür: Weffi. Ich machte auf. Er sprang mit Weff-weff herein und blieb dann auch verdutzt stehen. Auch Cocki kam angewatschelt, einen Zweig hinter dem Ohr und einen gewaltigen Knochen im Maul, offenbar eine Kalbshaxe. Er knurrte mich sicherheitshalber an und steuerte dann die Stelle an, wo sonst seine Kommode stand. Dort fiel ihm vor Erschütterung die Haxe aus dem Maul. Er drehte sich um und sah mich befehlend an: »Bring mir mal meine Höhle, damit ich meinen Knochen gegen dich verteidigen kann!«
Ich holte tief Atem: »Na, dann mal los, Kerls«, sagte ich munter, »Abendessen!«
Ich machte die Tür zum Eßzimmer auf und war abermals überwältigt: die Mama saß in dem leeren Raum auf einem Gartenstuhl. Vor ihr standen zwei Kerzen auf einer Kiste. Auf der Kiste zwei Teller mit je zwei Bratheringen und je einer Käseschnitte. Sie hatte eine uralte schwarze Schürze an, und über ihr hingen die Kabel des abmontierten Kronleuchters aus der Decke, als griffen die Fühler irgendeines scheußlichen Tieres nach ihrem Kopf.
»Du kommst spät!« sagte sie düster. Der flackernde Lichtschein fuhr über ihr Gesicht, so daß die Runen ihres Alters noch tiefer wurden.
»Na, Servus!« sagte ich. »Was wird hier eigentlich gespielt? Gorkis Nachtasyl?«
»Für dich ist der Klappstuhl da. Ich habe dir auch eine Flasche Bier besorgt. Wo warst du denn so lange?«
Ich setzte mich vorsichtig auf den Klappstuhl und nahm ein Lorbeerblatt und eine schwarze Kaper von einem Brathering. Er sah dadurch noch bösartiger aus: »Ich war bei Gutknechts, Wesse-lys und Kluge.«
Sie zog die Gräte aus ihrem ersten Hering und hielt sie Cocki hin, der die Nase krauszog und empört in die Diele watschelte: »Na — und?«
»Es geht bei allen dreien nicht.«
»Das wußte ich! Und was soll nun werden?«
Ihre blaßblauen Augen sahen mich mit einer Art makabren Triumphes an. Die ganzen Jahre, in denen wir hier im Hause unser munteres Treiben entfalteten, mit vielen Gästen und noch viel mehr Flaschen, hatte sie ein schlimmes Ende prophezeit. Sie traute meinem Glück ebensowenig wie Lätitia, die Mutter Napoleons, dem Stern des Hauses Bonaparte. Jetzt war die Pleite da und mit ihr die große Stunde ihrer Tragik.
Plötzlich mußte ich lachen, immer mehr lachen.
»Hör auf«, sagte sie, »ich kann das gar nicht hören! Es gellt hier so. Außerdem kann ich nicht finden, was es so Komisches gibt.«
»Dich«, keuchte ich, »dich, mein liebes, altes, gutes Pessimunkelchen!«
Ich streckte den Bratheringen die Zunge heraus, stand auf und küßte sie (die Mutter) auf den Scheitel und dann auf beide Augen. Sie stemmte mich mit den Händen von sich ab: »Geh weg, verrückter Kerl!« Aber um ihren Mund war ein Lächeln, der Geist eines Lächelns. Ich setzte mich vor ihr auf den Boden, interessiert berochen von Peter und Weffi.
»Du wirst dir die Hose dreckig machen!« sagte die Mama. »Wir können sie vorläufig nicht reinigen lassen.«
»Das Haus ist besenrein!« gab ich zu bedenken. »Weißt du, was wir jetzt machen?«
»Bei dir bin ich auf alles gefaßt.«
»Schöner Zug von dir. Also — du ziehst diesen traurigen Sack aus, mit dem du dich da dekoriert hast, und dann gehen wir in den >Hirschen<.«
»Du bist verrückt. Ich denke gar nicht daran.«
»Bist du noch nicht umgezogen?«
»Wir haben doch kein Geld mehr!«
»Wer sagt dir das? Momentane Verklammung. Ich nehme Vorschuß bei meiner sonnigen Zukunft.«
Sie stand auf und zog die Trauerschürze aus: »Unverbesserlich. Ich möchte wirklich mal wissen, wann ihr erwachsen werdet.« Sie drehte plötzlich wieder um: »Nein, geh allein, wenn dir das hier nicht gut genug ist. In dieser Situation! Ich hätte gar keinen Appetit. Der Bissen würde mir im Munde quellen.«
»Das macht nichts. Bist du noch immer nicht fertig?«
»Und die Hunde?« fragte sie schwach.
»Nehmen wir mit.«
Wir gingen zum >Hirschen<, und es wurde ein glorioser Abend. Ich aß Holsteiner Schnitzel und wusch es mit drei großen Bier herunter. Der Mama bestellte ich Bouillon mit Mark und hinterher ihr Lieblingsgericht: Hirn mit Ei. Dazu flößte ich ihr zwei Viertel Tiroler Spezial ein. »Wie ist das«, fragte sie dann, »möchtest du nicht noch eine Käseplatte in deinem Mund quellen lassen?«
»Kann ich sehr empfehlen, gnädige Frau!« sagte der Ober hinter ihrem Stuhl.
Sie kicherte und drohte ihm mit dem Finger. Dabei fiel ihr die Gabel herunter. Dann erschrak sie wieder über ihre eigene gute Laune und versuchte mich streng anzusehen: »So viel Geld! Ich zahle meinen Anteil.«
»Nächstens, Mulleken, nächstens.« Ich winkte dem Ober. Er verschwand in Richtung Küche.
»Wo sind denn die Kinder?« Sie rückte mit dem Stuhl ab und warf nunmehr das Messer herunter. Ich sah mich um: Weffi saß bei einer Dame am Nachbartisch auf dem Schoß und wurde mit Schinkenbrot gefüttert. Peter machte bei einem Dicken mit ganz kahlem Kopf Männchen und erntete eine halbe Weißwurst. Cocki wurde gerade von der Wirtin mit einem fleischbehangenen Kotelettknochen aus der Küche gelockt. »Du siehst, alles in Ordnung.«
Die Mama trank mit einem Ruck ihr Glas leer und griff dann über den Tisch nach meiner Hand: »Erzähle mir doch noch mal den Witz von dem Betrunkenen, der seiner Schwiegermutter fünf Mark in die Hand drückt.«
Als wir in unseren Bunker heimkehrten, gab es Schwierigkeiten mit dem Schloß. Die Mama hatte ihren Hut etwas schief auf und nahm ihn auch nicht ab, als sie sich auf den Gartenstuhl setzte und die Bratheringe aß, >damit nichts umkommt<.
Ich brachte Cocki und Weffi zur Ruhe, nahm dann meine Kerze und zuckelte nach oben. Wo, zum Teufel, war denn nun Peter?
Ich fand ihn in Frauchens Zimmer. Er kam mir eilig entgegengerannt, kehrt wieder um und machte Männchen vor der Stelle, wo sonst der Schrank stand. Er wollte sein Gute-Nacht-Plätzchen. Ich sah mir das, während es mir kalt über den Rücken lief, an. Dann setzte ich das Licht auf den Boden und zog ihn vorsichtig an mich: »Ach, mein Äffchen, mein Jenseits-Auge, es ist doch kein Schrank mehr da — und kein Frauchen, du Dummchen!«
Er sah mich ernst an, und da wußte ich: Es war nicht Dummheit. Es war Magie. Mit seiner Beschwörung wollte er die geliebten Dinge wieder ins Haus zurückbringen. Ins leere Haus.
Ich kraulte seine Brust. Er winselte leise.
»Nutzt nichts, Fliegenbein«, flüsterte ich, »kein Zauber hilft. Komm, wir schlafen beide auf dem Klappbett.« Es war lausig hart, aber es war — ein letztesmal — im alten Haus.