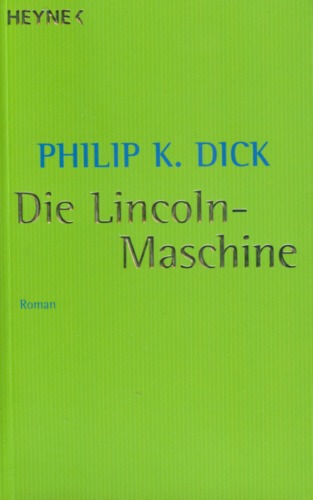
Für Robert und
Ginny Heinlein,
deren Freundlichkeit uns gegenüber mehr bedeutete, als schlichte Worte ausdrücken können.
Eins
In den frühen 1970ern wurde unsere Verkaufstechnik optimiert. Zuerst setzten wir immer eine Kleinanzeige in die jeweilige Lokalzeitung:
Kleinklavier und elektronische Orgel, wieder in Besitz genommen, in einwandfreiem Zustand, UNTER WERT. Bargeld oder geringes Kreditrisiko erwünscht zwecks Übernahme der Raten statt Rückführung nach Oregon. Kontakt: Frauenzimmer Pianos, Mr. Rock, Kreditmanager, Ontario, Oregon.
Diese Annonce haben wir jahrelang in einer Stadt nach der anderen laufen lassen, überall in den westlichen Bundesstaaten, bis hinein nach Colorado. Das Ganze steht auf einer wissenschaftlichen, systematischen Basis. Wir benutzen Landkarten, decken sämtliche Städte ab. Wir haben vier turbinengetriebene Transporter, die ständig unterwegs sind, mit je einem Mann pro Wagen.
Wir platzieren die Anzeige also etwa im San Rafael Independent, und bald trudeln die ersten Reaktionen in unserem Büro in Ontario ein, wo sich mein Partner Maury Rock um alles kümmert. Er sortiert die Briefe, erstellt Listen, und sobald in einer bestimmten Gegend, sagen wir im Umkreis von San Rafael, genug Kontakte zusammengekommen sind, lässt er dem jeweiligen Fahrer die Unterlagen zukommen. Zum Beispiel Fred unten in Marin County. Wenn Fred die Adressen bekommt, zieht er seine Landkarte hervor und listet die Anfragen in der richtigen Reihenfolge auf. Und dann klemmt er sich hinters Telefon und ruft den ersten Interessenten an.
In der Zwischenzeit hat Maury jeder Person, die auf die Anzeige geantwortet hat, einen Brief geschickt:
Sehr geehrter Mr. Soundso,
vielen Dank für Ihre Antwort auf unsere Kleinanzeige im San Rafael Independent! Der für diese Angelegenheit zuständige Mitarbeiter befindet sich zurzeit im Außendienst, daher haben wir ihm Ihren Namen und Ihre Anschrift weitergeleitet und ihn gebeten, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen und Sie über die Einzelheiten zu informieren.
Und so weiter. Dieser Brief hat der Firma jetzt seit etlichen Jahren gute Dienste geleistet. In letzter Zeit jedoch sind die Verkäufe der elektronischen Orgeln eingebrochen. In der Gegend von Vallejo etwa haben wir vor Kurzem vierzig Kleinklaviere verkauft und nicht eine einzige Orgel.
Dieses enorme Ungleichgewicht bei den Absatzzahlen hat zu einem ziemlich hitzigen Wortwechsel zwischen meinem Partner Maury Rock und mir geführt.
Ich kam spät in Ontario an, nachdem ich unten im Süden, in Santa Monica, gewesen war und mich mit ein paar Weltverbesserern herumgeschlagen hatte, die von den Behörden verlangten, unsere Verkaufsmethoden unter die Lupe zu nehmen – ein völlig überflüssiges Unterfangen, da wir uns strikt auf dem Boden des Gesetzes bewegen.
Ontario ist nicht meine Heimatstadt. Ich stamme aus Wichita Falls, Kansas, und bin während meiner Highschool-Zeit erst nach Denver und dann nach Boise, Idaho, gezogen. In mancher Hinsicht ist Ontario eine Vorstadt von Boise; es liegt an der Grenze nach Idaho – man überquert eine lange Metallbrücke – und mitten zwischen Wiesen und Feldern. Die Wälder des östlichen Oregon fangen so weit im Landesinneren noch nicht an. Die größte Industrieansiedlung ist die Ore Ida Potato Patty-Fabrik, insbesondere ihre Elektroniksektion, und dann gibt es da noch einen ganzen Haufen japanischer Farmer, die es während des Zweiten Weltkriegs hierher verschlagen hat und die hier Zwiebeln oder so anbauen. Die Luft ist trocken, Grund und Boden sind billig, zum Einkaufen kann man nach Boise fahren – eine Stadt, die ich nicht ausstehen kann, weil man dort kein anständiges chinesisches Essen bekommt. Sie liegt nahe am alten Oregon Trail, und die Eisenbahn hält dort auf ihrem Weg nach Cheyenne.
Unser Büro befindet sich in einem Backsteingebäude im Zentrum von Ontario, gegenüber von einem Eisenwarenladen. Um das Gebäude herum hat man Schwertlilien gepflanzt, deren Farben umwerfend aussehen, wenn man gerade die Wüstenstraßen Kaliforniens und Nevadas hinter sich hat.
Ich parkte also meinen staubigen Chrevrolet Magic Fire am Straßenrand und betrat den Eingang, neben dem unser Firmenschild hing:
MASA ASSOCIATES
MASA für MULTIPLEX ACOUSTICAL SYSTEM OF AMERICA, ein erfundener, irgendwie nach Elektronik klingender Name, passend zu unserer Elektroorgelfabrikation, in die ich aufgrund meiner familiären Bindungen schwer involviert bin. Es war Maury, der sich Frauenzimmer Piano Company einfallen ließ, was besser zu unserem Transportunternehmen passt. Frauenzimmer ist Maurys ursprünglicher Name, Rock ist ebenfalls ausgedacht. Ich habe meinen deutschen Namen beibehalten: Louis Rosen. Einmal habe ich Maury gefragt, was Frauenzimmer bedeutet, und er sagte, es bedeute »das weibliche Geschlecht«.
Ich fragte, wie er ausgerechnet auf den Namen Rock gekommen ist.
»Ich hab die Augen zugemacht und einen Band der Encyclopaedia Britannica berührt, und das war eben ROCK bis SUBUD.«
»Dann hast du einen Fehler gemacht. Du hättest dich Maury Subud nennen sollen.«
Die Eingangstür unseres Gebäudes ist noch von 1965 und sollte mal erneuert werden, aber dazu fehlt uns das Geld. Ich stieß sie auf – sie ist massiv und schwer, schwingt aber schön – und ging zum Fahrstuhl, einem dieser alten automatischen. Eine Minute später betrat ich oben unsere Büroräume. Die Jungs waren lautstark am Quatschen und Trinken.
»Die Zeit hat uns überholt«, sagte Maury zu mir, als er mich sah. »Unsere elektronische Orgel ist veraltet.«
»Da liegst du falsch«, erwiderte ich. »Der Trend geht zur Elektroorgel, weil Amerika genauso seine Erforschung des Weltalls angehen wird: elektronisch. In zehn Jahren werden wir nicht mal mehr ein Kleinklavier am Tag verkaufen – das Klavier wird ein Relikt aus der Vergangenheit sein.«
»Louis, nimm bitte mal zur Kenntnis, was die Konkurrenz gemacht hat. Die Elektronik mag auf dem Vormarsch sein, aber ohne uns. Denk an die Hammerstein-Stimmungsorgel. Oder die Waldteufel-Euphoria. Und sag mir, warum sich irgendjemand damit zufrieden geben sollte, einfach nur Musik herauszuhämmern.«
Maury ist ein großer Kerl mit der Erregbarkeit eines Schilddrüsenkranken. Seine Hände neigen zum Zittern, und er verdaut sein Essen zu schnell; er muss Pillen nehmen, und wenn die nicht mehr helfen sollten, muss er irgendwann zu radioaktivem Jod greifen. Würde er gerade stehen, wäre er eins neunzig groß. Er hat – oder hatte früher – schwarze Haare, sehr lang, aber schon ziemlich schütter. Große Augen und einen irgendwie beunruhigten Blick, als würde ständig alles schiefgehen.
»Ein gutes Musikinstrument veraltet nie«, sagte ich. Doch es war etwas dran an dem, was Maury gesagt hatte. Was uns aus dem Rennen geworfen hatte, waren die umfangreiche Kartografierung des Gehirns Mitte der 60er und die Tiefenelektroden-Techniken von Penfield und Jacobson und Olds gewesen, vor allem ihre Entdeckungen im Mittelhirn. Der Hypothalamus ist der Sitz der Gefühle, und bei der Entwicklung und Vermarktung unserer elektronischen Orgel hatten wir den Hypothalamus nicht ausreichend berücksichtigt. Die Rosen-Fabrik hat nie bei der Übertragung von Kurzzeit-Elektroschocks mitgemischt, die ganz bestimmte Zellen des Mittelhirns stimulieren, und wir haben nie begriffen, wie entscheidend es sein würde, statt der Regler eine Klaviatur anzuschließen.
Wie die meisten habe auch ich mal auf den Tasten einer Hammerstein-Stimmungsorgel herumgeklimpert, und es macht Spaß. Aber es hat nichts Kreatives. Klar, man kann auf immer neue Möglichkeiten der Hirnstimulation stoßen und so Gefühle in seinem Kopf erzeugen, die sich ansonsten dort nie gezeigt hätten. Man könnte theoretisch sogar jene Kombination treffen, die einen in den Zustand des Nirwana versetzt. Sowohl Hammerstein als auch Waldteufel haben einen hohen Preis dafür ausgeschrieben. Aber das ist keine Musik. Das ist Flucht. Und wer will das schon?
»Ich will das«, hatte Maury schon im Dezember ’78 gesagt. Und war losgezogen und hatte einen von der Federal Space Agency gefeuerten Elektroingenieur engagiert, in der Hoffnung, dass er uns eine neue Version der hypothalamusstimulierenden Orgel bauen würde.
Aber bei aller Begabung für Elektronik fehlte Bob Bundy doch jede Erfahrung mit Orgeln. Er hatte für die Regierung Simulacra-Schaltkreise entworfen. Simulacra sind diese künstlichen Menschen, die ich immer als Roboter bezeichnet habe; sie werden für die Erforschung des Mondes eingesetzt und dazu vom Cape aus hochgeschossen.
Die Gründe für Bundys Entlassung sind uns nicht ganz klar. Er trinkt, aber das beeinträchtigt seine Fähigkeiten nicht. Er läuft den Frauen nach, aber das tun wir doch alle. Vermutlich hat man ihn rausgeworfen, weil er ein Sicherheitsrisiko darstellte; kein Radikaler – Bundy wäre nie auch nur auf die Idee gekommen, dass es politische Vorstellungen gab –, doch ein Risiko in dem Sinne, dass er offenbar an leichter Hebephrenie leidet. Mit anderen Worten, er neigt zu spontanen Ausfällen. Seine Kleidung ist schmutzig, seine Haare sind ungekämmt, seine Wangen unrasiert, und er blickt einem nicht in die Augen. Er grinst blöde. Er ist, was die Psychiater vom Federal Bureau of Mental Health »verwahrlost« nennen. Wenn ihm jemand eine Frage stellt, will ihm einfach keine Antwort einfallen; er hat Sprachblockade. Doch was seine Hände angeht – die können etwas. Er macht seinen Job sehr gut. Also ist der McHeston Act nicht auf ihn anzuwenden.
Trotzdem hatte ich in den über drei Jahren, die Bundy für uns arbeitete, nicht eine Erfindung von ihm zu sehen bekommen. Da ich im Außendienst tätig war, hatte vor allem Maury mit ihm zu tun.
»Du hältst doch nur an dieser elektrischen Hawaiigitarre mit Keyboard fest«, sagte Maury zu mir, »weil dein Vater und dein Bruder die Dinger bauen. Deshalb willst du der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen.«
»Jetzt greifst du aber zu einem ad hominem.«
»Ach, du und deine jüdische Gelehrsamkeit.« Maury war schon gut abgefüllt, wie alle anderen auch; der Bourbon war bereits ihre Kehlen hinabgeflossen, als ich noch draußen die lange, harte Strecke heruntergerissen hatte.
»Dann willst du die Partnerschaft aufkündigen?« In diesem Moment hätte ich es wegen Maurys abfälliger Bemerkung über meinen Vater und meinen Bruder und die ganze Rosen-Elektroorgelfabrik in Boise mit ihren siebzehn Vollzeitkräften am liebsten selbst getan.
»Ich sage nur, dass die neuesten Zahlen aus Vallejo und Umgebung das Ende für unser Hauptprodukt bedeuten. Trotz der 600.000 möglichen Tonkombinationen, von denen das menschliche Ohr manche noch nie gehört hat. Du bist genauso wie der Rest deiner Familie in diese Weltraum-Voodoo-Geräusche vernarrt, die euer Elektroschrott da von sich gibt. Und ihr habt noch den Nerv, dieses Ding ein Musikinstrument zu nennen. Von euch Rosens hat keiner ein Gehör. Ich würde mir keine Sechzehnhundert-Dollar- Rosen-Elektroorgel ins Haus stellen, selbst wenn ihr sie mir zum Selbstkostenpreis anbieten würdet. Da würde ich mir ja eher noch ein Vibrafon zulegen.«
»Na schön, du bist eben ein Purist. Und es sind nicht 600.000, sondern 700.000.«
»Diese aufgemotzten Schaltkreise heulen doch nur ein einziges Geräusch heraus, wie immer man es auch modifiziert. Eigentlich ist es nicht mehr als ein Pfeifen.«
»Man kann auf ihr komponieren.«
»Komponieren? Dieses Ding zu benutzen ist ungefähr so, als ob man Heilmittel für Krankheiten erfindet, die es gar nicht gibt. Ich sage, fackelt den Teil eurer Fabrik ab, in dem die Dinger produziert werden, oder stellt verdammt noch mal um, Louis. Stellt auf etwas Neues und Nützliches um, damit die Menschheit bei ihrem beschwerlichen Aufstieg etwas hat, an dem sie sich festhalten kann. Hörst du?« Maury stand schwankend da und hielt mir seinen langen Finger entgegen. »Wir sind jetzt im Weltall. Greifen zu den Sternen. Der Horizont der Menschheit hat sich geweitet. Hörst du?«
»Bin ja nicht taub. Aber soweit ich mich erinnere, waren es du und Bob Bundy, die sich eine Lösung für unsere Probleme einfallen lassen wollten. Und bisher ist nichts dabei herausgekommen.«
»Wir haben eine. Und wenn du sie siehst, wirst du zugeben müssen, dass sie eindeutig zukunftsorientiert ist.«
»Dann zeig sie mir.«
»Schön, fahren wir rüber zur Fabrik. Dein Vater und dein Bruder Chester sollten auch mitkommen. Das ist nur fair, schließlich werden sie sie bauen.«
Ein Glas in der Hand, stand Bundy da und grinste mich auf seine verstohlene Art an. Diese ganze zwischenmenschliche Kommunikation machte ihn offenbar nervös.
»Ihr Burschen werdet uns noch ruinieren«, sagte ich zu ihm. »Ich spüre das.«
»Wir stehen ohnehin vor dem Ruin«, erwiderte Maury, »wenn wir an eurer Wolfgang-Monteverdi-Orgel festhalten, oder wie immer sie dein Bruder diesen Monat nennt.«
Darauf fiel mir nichts ein. Bedrückt mixte ich mir einen Drink.
Zwei
Der Mark VII Saloon Jaguar ist ein riesiges, weißes Auto, ein Sammlerstück, mit Nebelscheinwerfern, einem Kühlergrill wie beim Rolls Royce, Armaturen aus handpoliertem Walnussholz, Ledersitzen und viel Innenraumbeleuchtung. Maury hielt seinen 54er Mark VII in tadellosem Zustand und perfekt eingestellt, aber auf dem Freeway, der Ontario mit Boise verbindet, konnten wir nicht schneller als neunzig Meilen fahren.
Das Spaziertempo machte mich ganz unruhig. »Ich wünschte, du würdest endlich mit dem Erklären anfangen, Maury. Bring mir die Zukunft gleich jetzt nahe, so gut es in Worten eben geht!«
Hinter dem Steuer zog Maury an seiner Corina-Sport-Zigarre und lehnte sich zurück. »Was geht Amerika heutzutage im Kopf herum?«
»Sex.«
»Nein.«
»Die inneren Planeten des Sonnensystems zu beherrschen, bevor die Russen so weit sind.«
»Nein.«
»Na schön, sag du’s mir.«
»Der Bürgerkrieg von 1861.«
»Das glaubst du wohl selbst nicht.«
»Doch, mein Freund. Dieses Land ist besessen vom Krieg zwischen den Nord- und Südstaaten. Und ich sag dir, warum. Er ist das erste und einzige Nationalepos, an dem wir teilhatten – darum.« Er blies Zigarrenrauch in meine Richtung. »Er hat aus uns Amerikanern Männer gemacht.«
»Mir geht er nicht im Kopf herum.«
»Halte in irgendeiner Großstadt der USA an einer belebten Straßenkreuzung und frag zehn Passanten, was ihnen im Kopf herumgeht – sechs davon würden antworten: ›Der amerikanische Bürgerkrieg von 1861.‹ Seit mir das vor ungefähr einem halben Jahr klargeworden ist, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was man damit anfangen kann. Ich glaube, es ist von eminenter Wichtigkeit für MASA Associates. Wenn wir das wollen. Wenn wir bereit sind. Erinnerst du dich noch an die Hundert-Jahr-Feiern?«
»Ja. 1961.«
»Ein Reinfall. Eine Handvoll Leute ist losgezogen und hat ein paar Schlachten nachgespielt, und das war’s. Schau mal auf die Rückbank.«
Ich knipste die Innenbeleuchtung an, drehte mich um und sah auf der Rückbank ein langes, in Zeitungspapier gewickeltes Bündel von der Form einer Schaufensterpuppe. Aus dem mangelnden Brustumfang schloss ich, dass es sich nicht um eine Frau handelte. »Ja, und?«
»Das ist es. Daran habe ich gearbeitet.«
»Während ich kreuz und quer durch das Land gefahren bin!«
»Genau. Das hier wird, nach einer gewissen Anlaufzeit, den Verkauf von Kleinklavieren und Elektroorgeln dermaßen in den Schatten stellen, dass uns ganz schwummrig werden wird.« Maury nickte entschieden. »Wenn wir also in Boise ankommen… Hör zu, ich will nicht, dass uns dein Vater oder Chester das Leben schwer machen. Deshalb weihe ich dich jetzt schon ein. Diese Maschine da hinten ist Millionen wert, für uns oder wer sonst zufällig darüber stolpert. Ich hätte gute Lust, irgendwo anzuhalten und sie dir zu demonstrieren. Vielleicht an irgendeinem Imbiss. Oder an einer Tankstelle. Jedenfalls irgendwo, wo es hell ist.« Er wirkte jetzt sehr angespannt, seine Hände zitterten stärker als sonst.
»Das ist nicht zufällig eine Louis-Rosen-Attrappe, oder? Du willst mir keins überbraten, damit das Ding meinen Platz einnimmt?«
Er warf mir einen merkwürdigen Blick zu. »Wie kommst du denn darauf? Nein, das nicht. Aber so ganz daneben liegst du gar nicht, mein Freund. Das zeigt mir, dass wir immer noch auf einer Wellenlänge funken, wie damals, in den frühen Siebzigern, als wir jung und ahnungslos und ohne Verstärkung waren, mal abgesehen von deinem Vater und deinem kleinen Bruder, der uns allen eine Warnung sein sollte. Ich frage mich, warum Chester nicht Veterinär geworden ist, das hatte er doch eigentlich werden wollen. Dann wären wir verschont geblieben. Stattdessen eine Klavierfabrik in Boise, Idaho. Was für ein Wahnsinn!«
»Deine Familie hat nicht einmal das getan, die hat nie irgendwas gebaut oder etwas erfunden. Das sind nur Zwischenhändler, die in der Bekleidungsindustrie Aufträgen hinterherhecheln. Ich meine, was haben sie denn dazu beigetragen, uns ins Geschäft zu bringen, so wie Chester und mein Vater? Also, was ist das da hinten? Ich will es wissen. Und ich werde nicht an irgendeiner Tankstelle oder einem Imbiss halten. Ich habe das Gefühl, dass du mich hintergehen willst.«
»Ich kann es mit Worten nicht beschreiben.«
»Natürlich kannst du das. Du bist doch ganz groß darin, jemanden einzuwickeln.«
»Okay. Ich werde dir sagen, warum dieses Fest zum Bürgerkriegsjubiläum in die Hosen gegangen ist. Weil alle, die damals bereit gewesen sind, ihr Leben für die Union oder für die Konföderation zu lassen, längst tot sind. Es wird ja keiner hundert Jahre alt, und wenn doch, dann sind sie für nichts mehr zu gebrauchen – sie können nicht kämpfen, sie können kein Gewehr mehr halten. Richtig?«
»Du meinst, du hast da hinten eine Mumie liegen oder einen Untoten, wie in den Horrorfilmen?«
»Ich werde dir sagen, was ich dort habe. Dort hinten auf der Rückbank, in Zeitungen eingewickelt, liegt Edwin M. Stanton.«
»Und wer ist das?«
»Lincolns Kriegsminister.«
»Ja, klar!«
»Wirklich.«
»Wann ist er gestorben?«
»Vor langer Zeit.«
»Dachte ich’s mir doch.«
»Hör zu. Dort auf dem Rücksitz liegt ein Simulacrum. Eine Mensch-Maschine. Ich habe sie gebaut, beziehungsweise ich habe sie Bob Bundy bauen lassen. Sie hat mich 6000 Dollar gekostet, aber das war es wert. Lass uns an einer Raststätte anhalten, dann packe ich sie aus und führe sie dir vor. Anders geht’s nicht.«
Ich bekam eine Gänsehaut. »Stimmt das wirklich?«
»Denkst du etwa, ich erzähle dummes Zeug?«
»Nein.«
»Also schön.« Maury betätigte den Blinker. »Ich halte dort vorn, bei Tommy’s Italian Fine Diner.«
»Und dann? Was meinst du mit vorführen?«
»Wir packen sie aus, gehen mit ihr rein und lassen sie eine Pizza mit Hähnchen und Schinken bestellen. Das meine ich mit vorführen.«
Maury parkte den Jaguar, stieg aus, öffnete die hintere Tür und riss das Zeitungspapier von dem menschenförmigen Bündel. Ein älterer Herr mit geschlossenen Augen und weißem Bart kam zum Vorschein. Seine Kleidung war museumsreif. Er hatte die Hände über der Brust gefaltet.
»Du wirst schon sehen, wie überzeugend diese Maschine ist, wenn sie erst ihre Pizza bestellt.« Maury betätigte einige Schalter auf dem Rücken des Simulacrums.
Auf einmal nahm das Gesicht der Maschine einen mürrischen, in sich gekehrten Ausdruck an, und sie sagte: »Ich darf Sie doch sehr bitten, mein Freund, Ihre Finger von meinem Leib zu lassen.« Sie schob Maurys Hände weg.
Maury grinste mich an. »Siehst du?«
Die Maschine setzte sich auf und klopfte sich methodisch ab; ihr Blick war ernst, fast feindselig, als wäre sie überzeugt, wir hätten ihr irgendetwas angetan, sie hinterrücks k.o. geschlagen vielleicht, und sie sei gerade erst wieder zu sich gekommen. Mir war klar, dass sich der Mann hinter dem Tresen von Tommy’s Italian Fine Diner würde täuschen lassen; klar, dass Maury seine Sache längst bewiesen hatte. Wenn ich nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, wie er sie eingeschaltet hatte, wäre ich selbst überzeugt gewesen, nur einen schlecht gelaunten älteren Herrn in altmodischer Kleidung und mit langem weißem Kinnbart vor mir zu sehen, der sich zornig abklopfte.
»Ja«, murmelte ich.
Maury hielt die hintere Tür des Jaguars auf. Die Edwin-M.-Stanton-Maschine rutschte herüber und stieg in würdevoller Haltung aus.
»Hat sie denn überhaupt Geld?«, fragte ich.
»Klar. Aber stell keine so albernen Fragen – das hier ist die ernsteste Angelegenheit, mit der du je konfrontiert wurdest. Hier geht es um unsere wirtschaftliche Zukunft, ja die des ganzen Landes. Heute in zehn Jahren könnten wir beide stinkreich sein, dank dieses Maschinchens hier.«
Wir betraten das Restaurant und bestellten eine Pizza. Als sie kam, war die Kruste an den Rändern verbrannt. Die Edwin M. Stanton machte eine lautstarke Szene, drohte dem Inhaber mit der Faust. Schließlich bezahlten wir unsere Rechnung und gingen wieder.
Inzwischen lagen wir eine Stunde hinter dem Zeitplan zurück, und ich fragte mich, ob wir überhaupt noch zur Rosen-Fabrik kommen würden. Also bat ich Maury, auf die Tube zu drücken, als wir wieder in den Jaguar einstiegen.
Maury betätigte den Anlasser. »Der Wagen schafft glatte dreihundert. Ich verwende diesen trockenen Raketentreibstoff, den sie gerade auf den Markt gebracht haben.«
»Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein«, belehrte ihn die Edwin M. Stanton mit verdrießlicher Stimme, als der Wagen auf die Straße hinausschoss. »So lange der mögliche Gewinn diese nicht bei weitem übertrifft.«
»Danke gleichfalls«, erwiderte Maury.
Die Rosen Kleinklaviere & Elektronische Orgeln-Fabrik in Boise, Idaho, fällt nicht sonderlich auf, denn das eigentliche Gebäude, die Produktionsanlage technisch gesprochen, ist ein einstöckiger Bau, so flach wie ein Blechkuchen. Der Parkplatz geht nach hinten raus, und über dem Büro hängt ein Schild mit Buchstaben aus schwerem Kunststoff und roten Lampen dahinter. Nur das Büro hat Fenster.
Zu dieser späten Stunde war alles dunkel und abgesperrt, niemand war mehr da. Also fuhren wir zum Wohngebiet hinüber.
»Was halten Sie von der Gegend?«, fragte Maury die Edwin M. Stanton.
Die Maschine, die aufrecht hinten im Jaguar saß, erwiderte: »Recht unwürdig und zweifelhaft.«
»Hören Sie«, sagte ich, »meine Familie wohnt hier in der Nähe des Industriegebiets, um problemlos zu Fuß zur Fabrik zu kommen.« Es machte mich wütend, dass eine bloße Nachbildung tatsächliche menschliche Wesen in ein schlechtes Licht rückte, zumal einen so grundanständigen Menschen wie meinen Vater. Und was meinen Bruder anging – nur wenige Strahlungsmutanten kommen in der Kleinklavier- und Elektroorgelindustrie so weit wie Chester Rosen. ›Personen besonderer Geburtsjahrgänge‹, wie sie genannt werden. Diskriminierung und Vorurteile lauern überall, die meisten, gesellschaftlich höhergestellten Berufe sind ihnen verwehrt.
Es war natürlich immer eine gewisse Enttäuschung für die Familie Rosen, dass Chesters Augen da liegen, wo sein Mund sein sollte, und umgekehrt. Aber dafür kann er nichts – keiner von denen, die so sind wie er, kann etwas dafür. Daran sind die Wasserstoffbombentests der 50er- und 60er-Jahre schuld. Ich weiß noch, wie ich als Junge medizinische Bücher über angeborene Defekte gelesen habe – das Thema interessiert die Öffentlichkeit jetzt natürlich schon eine ganze Weile –, und da gibt es welche, gegen die ist Chester gar nichts. Bei dem einen, der mich damals in eine wochenlange Depression gestürzt hat, zerfällt der Embryo in der Gebärmutter und wird in Stücken geboren, ein Kiefer, ein Arm, eine Handvoll Zähne, einzelne Finger; wie einer von diesen Plastikbausätzen, mit denen kleine Jungs sich ein Flugzeug basteln, nur dass sich die Einzelteile des Embryos überhaupt nicht verbinden lassen, mit keinem Klebstoff der Welt. Dann gibt es Embryos, die vollständig behaart sind, wie ein Pantoffel aus Yak-Fell. Und welche, die austrocknen, sodass die Haut einreißt; sie sehen aus, als wären sie draußen in der Sonne verwittert. Also lasst mal bloß Chester in Ruhe!
Der Jaguar hielt vor dem Haus meiner Familie. Ich’ konnte Licht im Haus sehen, im Wohnzimmer; meine Mutter, mein Vater, mein Bruder sahen fern.
»Schicken wir die Edwin M. Stanton allein die Treppe hinauf«, sagte Maury. »Sie soll an der Tür klopfen, und wir bleiben im Auto sitzen und sehen zu.«
»Mein Vater wird sie als Fälschung erkennen, eine Meile gegen den Wind. Gut möglich, dass er sie sogar die Treppe hinunterwirft, und dann bist du die sechshundert los, die du in das Ding gesteckt hast.« Oder wie viel Maury doch noch gleich investiert hatte auf MASA-Kosten.
»Das Risiko gehe ich ein.« Er wandte sich um, sah die Maschine an. »Gehen Sie hoch zu der Tür, auf der 1429 steht, und läuten Sie. Und wenn ein Mann aufmacht, sagen Sie: ›Nun gehört er der Ewigkeit an.‹ Und dann bleiben Sie einfach dort stehen.«
»Was soll das denn bedeuten?«, fragte ich. »Was für eine Gesprächseröffnung soll das sein?«
»Das ist Stantons berühmter Kommentar, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Bei Lincolns Tod.«
»Nun gehört er der Ewigkeit an«, übte die Stanton, während sie den Gehweg überquerte und die Stufen hinaufging.
»Ich werde dir zu gegebener Zeit erklären, wie die Edwin M. Stanton konstruiert ist«, sagte Maury zu mir. »Wie wir das gesamte verfügbare Datenmaterial über Stanton zusammengestellt und es an der Universität von Los Angeles in die Zentralmonade eingespeist haben, die dem Simulacrum als Gehirn dient.«
»Weißt du eigentlich, was du da tust, Maury? Du ruinierst MASA mit diesen Spielchen, mit diesem hirnverbrannten Blödsinn. Ich hätte mich nie mit dir einlassen sollen. Ich…«
»Ruhig«, unterbrach mich Maury, als die Stanton an der Tür klingelte.
Die Tür ging auf, und mein Vater erschien, in Pyjamahosen, Pantoffeln und dem neuen Bademantel, den ich ihm zu Weihnachten geschenkt hatte. Zweifellos eine ehrfurchtgebietende Gestalt.
Die Edwin M. Stanton, die schon zu ihrer kleinen Rede angesetzt hatte, stockte. »Sir«, sagte sie schließlich, »ich habe die Ehre, Ihren Sohn Louis zu kennen.«
»Ah ja«, erwiderte mein Vater. »Er ist im Moment unten in Santa Monica.«
Die Edwin M. Stanton schien nicht zu wissen, was Santa Monica war. Neben mir fluchte Maury verzweifelt; ich hingegen fand es urkomisch, wie das Simulacrum dort stand – wie ein trotteliger Handelsvertreter, dem nichts zu sagen einfiel.
Trotzdem war es beeindruckend zu sehen, wie die beiden alten Herren einander gegenüberstanden: die Stanton mit ihrem weißen Kinnbart, in ihrer altmodischen Kleidung, und mein Vater, der auch nicht viel neuer aussah. Das Zusammentreffen der Patriarchen, dachte ich. Wie in der Synagoge.
Nach einer Weile sagte mein Vater: »Wollen Sie nicht hereinkommen?« Er hielt die Tür auf, die Stanton trat ein, die Tür ging zu, und die erleuchtete Veranda war wieder leer.
Verdutzt sah ich Maury an. »Was sagt man dazu?«
Wir folgten den beiden. Die Haustür war nicht abgeschlossen, also gingen wir hinein.
Die Stanton saß im Wohnzimmer, in der Mitte des Sofas, die Hände auf den Knien, und unterhielt sich mit meinem Vater, während Chester und meine Mutter weiter fernsahen.
»Dad«, sagte ich, »du verschwendest nur deine Zeit, wenn du mit diesem Ding sprichst. Weißt du, was das ist? Eine Maschine, die Maury in seinem Keller zusammengebastelt hat.«
Mein Vater und die Stanton hielten inne und sahen mich an.
»Dieser nette alte Herr?« Das Gesicht meines Vaters nahm einen Ausdruck rechtschaffenen Zorns an, seine Brauen sträubten sich. »Vergiss nicht, Louis, dass der Mensch nur ein Schilfrohr ist, das schwächste Glied der Natur. Aber verdammt noch mal, mein Sohn, er ist ein denkendes Schilfrohr. Es muss sich nicht gleich das ganze Weltall gegen ihn waffnen, ein Wassertropfen genügt, um ihn zu töten.« Er deutete mit dem Finger auf mich. »Aber selbst wenn ihn das ganze Weltall zermalmen würde, na und? Weißt du, was ich dann sagen würde? Der Mensch wäre nur umso edler! Und willst du wissen warum? Weil er weiß, dass er sterben wird – und weil das Weltall nichts davon weiß. Darin besteht unsere ganze Würde. Im Denken. Der Mensch ist klein und kann Raum und Zeit nicht ermessen, aber er kann Gebrauch von dem Gehirn machen, das Gott ihm gegeben hat. Und was dieses ›Ding‹ hier angeht, wie du es nennst. Das ist kein Ding. Das ist ein enosch, ein Mensch… Aber da muss ich euch einen Witz erzählen.« Und schon legte er los, halb auf jiddisch, halb auf englisch.
Als er fertig war, schmunzelten wir alle, obwohl es mir so vorkam, als ob das Lächeln der Edwin M. Stanton etwas förmlich, ja gezwungen war.
Ich kramte in meinen Erinnerungen an das, was ich über Stanton gelesen hatte. Er hatte als ziemlich ruppiger Typ gegolten damals, während des Bürgerkriegs und der anschließenden Wiedereingliederung, vor allem in jener Zeit, als er mit Andrew Johnson aneinandergeriet, als er versuchte, den Präsidenten seines Amtes entheben zu lassen. Vermutlich schätzte er den humanistisch angehauchten Witz meines Vaters nicht sonderlich, hatte er sich so etwas während seiner Arbeit doch ständig von Lincoln anhören müssen. Aber mein Vater war auf keine Weise zu bremsen; er war der Sohn eines bedeutenden Spinoza-Experten, und obwohl er nie über die Seventh Grade hinausgekommen war, hatte er doch alle möglichen Bücher und Dokumente gelesen und mit literarischen Persönlichkeiten auf der ganzen Welt korrespondiert.
»Tut mir leid, Jerome«, sagte Maury zu meinem Vater, als der gerade eine kurze Pause einlegte, »aber es stimmt.« Er ging zu der Edwin M. Stanton, bückte sich und betätigte einen Schalter hinter ihrem Ohr.
»Oh«, gab die Stanton von sich und erstarrte. Das Leuchten ihrer Augen erlosch, sie war so leblos wie eine Schaufensterpuppe. Ein ziemlich heftiger Anblick. Wir wurden alle still, und selbst Chester und meine Mutter sahen für einen Moment vom Fernseher auf. Wenn an dem Abend nicht ohnehin schon philosophiert worden wäre, das hätte definitiv dazu geführt. Schließlich stand mein Vater auf und ging hinüber, um das Ding in Augenschein zu nehmen.
Er schüttelte den Kopf. »Wie brutal.«
»Ich kann sie wieder anstellen«, sagte Maury.
»Nein, darum geht es mir gar nicht.« Mein Vater setzte sich wieder, machte es sich leidlich bequem und fragte dann mit leicht resignierter, ernüchterter Stimme: »Und, Jungs? Wie waren die Verkäufe in Vallejo?« Während wir uns noch eine Antwort überlegten, zückte er eine Anthony & Cleopatra-Zigarre, wickelte sie aus und zündete sie an. Es war eine hochwertige Zigarre mit Havannafüllung und grünem Deckblatt, und ihr Duft erfüllte augenblicklich das Wohnzimmer. »Haufenweise Orgeln und Amadeus-Gluck-Klaviere verkauft?« Er kicherte in sich hinein.
»Die Klaviere sind weggegangen wie geschnitten Brot«, sagte Maury. »Aber nicht ein Mensch wollte eine Orgel haben.«
Mein Vater runzelte die Stirn.
»Wir haben uns schon darüber Gedanken gemacht, Jerome, und sind zu einigen Ergebnissen gekommen. Die Rosen-Elektroorgel…«
»Moment. Nicht so schnell, Maurice. Auf dieser Seite des Eisernen Vorhangs gibt es nichts, was mit der Rosen-Orgel vergleichbar wäre.« Mein Vater nahm eine der Hartfaserplatten vom Beistelltisch, auf denen wir zu Demonstrationszwecken Widerstände, Solarzellen, Transistoren, Verkabelung und so weiter angebracht hatten. »Das hier zeigt, wie sie funktioniert. Hier der Verzögerungskreis, der dem Klang mehr Volumen, Kraft und Dynamik verleiht, und hier…«
»Jerome, ich weiß, wie die Orgel funktioniert. Lass mich bitte ausreden.«
»Na schön.« Mein Vater legte die Platte wieder weg. »Aber wenn du von uns erwartest, dass wir die Basis unseres Lebensunterhalts lediglich aus verkaufstechnischen Gründen aufgeben – und ich weiß, wovon ich spreche, ich bin auf dem Gebiet ja selbst nicht unerfahren –, nur weil vielleicht die Verkaufstechnik überholt ist oder sich keiner mehr Mühe gibt, einen Abschluss zu…«
»Jerome, hör mir zu. Ich schlage vor, dass wir uns vergrößern.«
Mein Vater hob eine Braue.
»Ihr Rosens könnt natürlich so viele Elektroorgeln herstellen, wie ihr wollt. Aber der Umsatz, den wir mit ihnen machen, wird immer weiter sinken, so einzigartig und toll sie auch sind. Was wir brauchen, ist etwas wirklich Neues. Hammerstein produziert diese Stimmungsorgeln und kommt hervorragend an damit – die haben den Markt fest in der Hand, in der Richtung brauchen wir es gar nicht erst zu versuchen. Darum also meine Idee hier.«
Mein Vater griff sich ans Ohr und schaltete seine Hörhilfe ein.
»Dieses Simulacrum hier. Die Edwin-M.-Stanton-Maschine. Es ist, als wäre Stanton heute Abend leibhaftig hier, um mit uns zu diskutieren. Das könnte man wunderbar in Schulen einsetzen, für Lehrzwecke. Aber das ist noch gar nichts – ich hatte das zunächst im Sinn, aber jetzt kommt erst der richtige Knüller. Wir gehen zu Präsident Mendoza und schlagen ihm vor, den Krieg – Krieg generell – abzuschaffen und durch einen Festakt zum, sagen wir, 125. Jubiläum des Amerikanischen Bürgerkriegs zu ersetzen. Und die Rosen-Fabrik liefert dafür sämtliche Teilnehmer, Simulacra von allen: Lincoln, Stanton, Jeff Davis, Robert E. Lee, Longstreet und als Soldaten ungefähr drei Millionen einfache Modelle, die wir ständig auf Vorrat halten. Und die Schlachten werden richtig gekämpft, mit richtigen Toten, die Simulacra werden zu Klump geschossen, anstatt nur eine billige Nummer abzuliefern wie irgendwelche Collegeschüler, die Shakespeare aufführen. Versteht ihr, worauf ich hinauswill? Seht ihr, was das für Potenzial hat?«
Wir schwiegen alle. Ja, dachte ich, das hat durchaus Potenzial.
»In fünf Jahren könnten wir so groß wie General Dynamics sein«, fügte Maury mit stolzgeschwellter Brust hinzu.
Mein Vater sah ihn nachdenklich an und zog an seiner Zigarre. »Ich weiß nicht, Maurice. Ich weiß nicht.« Er schüttelte den Kopf.
»Wieso nicht? Was stimmt denn daran nicht?«
»Vielleicht, dass du dich von den Zeitläufen hast mitreißen lassen.« Die Stimme meines Vaters klang erschöpft. Er seufzte. »Oder werde ich langsam alt?«
»Ja, du wirst alt!« Maury war plötzlich ganz rot im Gesicht.
»Gut möglich.« Mein Vater war einen Moment lang still, dann setzte er sich auf und sagte: »Nein, deine Idee ist zu… ehrgeizig, Maurice. Ich bin kein auscher Godel, und du auch nicht.«
»Jetzt komm mir nicht wieder mit deinem Jiddisch.«
»Wir sind keine schwerreichen Leute, meine ich. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht übernehmen.«
»Na gut, wenn euch die Idee nicht zusagt… Aber ich habe schon zu viel hineingesteckt, ich mache weiter. Ich habe in der Vergangenheit eine Menge guter Ideen gehabt, die wir umgesetzt haben, und das ist bis jetzt die beste. So sind die Zeiten nun mal, Jerome. Wir müssen etwas unternehmen.«
Betrübt, in sich versunken, rauchte mein Vater seine Zigarre weiter.
Drei
Maury, der nach wie vor hoffte, mein Vater würde sich überzeugen lassen, ließ die Stanton dort – in Kommission, wenn man so will –, und wir fuhren zurück nach Ontario. Inzwischen war es fast Mitternacht, und da die mangelnde Begeisterung meines Vaters uns beide bedrückte, lud Maury mich ein, bei ihm zu übernachten – was ich nur allzu gerne annahm.
Als wir bei seinem Haus ankamen, stießen wir auf seine Tochter Pris, von der ich angenommen hatte, dass sie immer noch in der Kasanin-Klinik in Kansas City war, in der Obhut des Federal Bureau of Mental Health. Pris stand, wie ich von Maury wusste, seit ihrem dritten Jahr in der Highschool unter der Vormundschaft des Staates; Tests, die in den öffentlichen Schulen routinemäßig durchgeführt wurden, hatten ihre »Problemdynamik« ergeben, wie es die Psychiater heutzutage nennen – anders ausgedrückt, ihren schizophrenen Zustand.
»Sie wird dich aufmuntern«, sagte Maury, als er meine Zögerlichkeit bemerkte. »Und Aufmunterung ist genau das, was wir beide brauchen. Sie ist ganz schön groß geworden, seit du sie das letzte Mal gesehen hast. Sie ist kein Kind mehr. Komm rein.« Er griff meinen Arm und zog mich ins Haus.
Sie saß im Wohnzimmer auf dem Fußboden. Sie trug pinkfarbene Sporthosen, ihre Haare waren kurz geschnitten, und sie hatte abgenommen. Um sie herum lagen lauter bunte Kacheln, die sie mit einer großen Zange in unregelmäßige Scherben zerbrach.
»Komm, sieh dir das Badezimmer an«, sagte sie und sprang auf. Ich folgte ihr misstrauisch.
Sie hatte alle möglichen Seeungeheuer und Fische an die Badezimmerwände gemalt. Sogar eine Meerjungfrau, die rote Mosaiksteine als Brüste besaß, jeweils mit einem hellen Stein in der Mitte. Der Anblick war abstoßend und faszinierend zugleich.
»Warum nicht gleich kleine Glühbirnen als Nippel nehmen?«, fragte ich. »Wenn jemand zum Pinkeln reinkommt und das Licht anmacht, leuchten sie auf und weisen ihm den Weg.«
Es bestand kein Zweifel daran, dass die jahrelange Beschäftigungstherapie in Kansas City sie in diesen Mosaikrausch getrieben hatte; die Psycholeute standen auf alles, was kreativ war. Vater Staat hatte buchstäblich Zehntausende von Patienten in seinen übers Land verteilten Kliniken stecken, die alle eifrig webten oder malten oder tanzten oder Schmuck herstellten oder Bücher banden oder Theaterkostüme nähten. Und diese Patienten waren dort nicht freiwillig, sondern von Gesetzes wegen. Wie Pris waren viele von ihnen während der Pubertät auffällig geworden, die Zeit, in der Psychosen dazu neigten, auszubrechen.
Offenbar ging es Pris jetzt besser, sonst hätten sie sie wohl kaum hinausgelassen. Nur dass sie mir immer noch nicht normal oder natürlich vorkam. Als wir zurück ins Wohnzimmer gingen, sah ich sie mir genauer an; ihr kleines, herzförmiges Gesicht, die schwarzen, mit einem Haarreif zurückgehaltenen Haare, der Harlekin-Effekt, den sie ihrem seltsamen Make-up verdankte, die Augen schwarz umrandet, der Lippenstift fast schon lila. Es ließ sie unwirklich und puppenhaft erscheinen; irgendwo hinter der Maske, die sie aus ihrem Gesicht gemacht hatte, war sie verlorengegangen. Und ihre Magerkeit setzte dem Effekt noch die Krone auf: Sie sah aus wie eine auf merkwürdige Weise animierte Figur aus einem Totentanz. Das kam vermutlich nicht von der üblichen Aufnahme von fester und flüssiger Nahrung – vielleicht kaute sie nur Walnussschalen. Aber irgendwie sah sie auch gut aus, nur ein bisschen extravagant, um es milde auszudrücken. Insgesamt sah sie allerdings weniger normal aus als die Stanton.
»Schatz«, sagte Maury zu ihr, »wir haben die Edwin M. Stanton drüben bei Louis’ Vater gelassen.«
Sie blickte auf. »Abgeschaltet?« In ihren Augen war ein wildes Feuer, das mich zugleich entsetzte und beeindruckte.
»Pris«, sagte ich, »die Ärzte haben ja wirklich ganze Arbeit geleistet. Was für eine gut aussehende Frau aus dir geworden ist, jetzt wo du erwachsen und wieder draußen bist.«
»Danke«, erwiderte sie ohne jeden Gefühlsausdruck. Ihr Tonfall war schon früher immer völlig flach gewesen, ganz egal in welcher Situation, sogar während schwerer Krisen. Und dabei war es geblieben.
Ich wandte mich Maury zu. »Uff, ich bin ganz schön geschafft.«
Wir klappten das Bett im Gästezimmer auseinander, warfen Laken und Decken drauf und ein Kissen. Pris machte keine Anstalten, uns zu helfen; sie blieb im Wohnzimmer und zerschnitt Kacheln.
»Wie lange arbeitet sie schon an diesem Wandbild im Bad?«, fragte ich.
»Seit sie aus Kansas City zurück ist, also schon eine ganze Weile. Die ersten paar Wochen musste sie sich regelmäßig beim hiesigen FBMH melden. Sie ist nicht richtig draußen, sie ist auf Bewährung, bekommt ambulante Therapie. Man könnte sagen, sie ist leihweise draußen.«
»Geht’s ihr wirklich besser?«
»Viel besser. Ich hab dir ja nie erzählt, wie schlimm es war auf der Highschool. Wir hatten keine Ahnung, was nicht stimmte. Ehrlich gesagt bin ich heilfroh über den McHeston Act. Wenn man es nicht gemerkt hätte, wenn sie immer kränker geworden wäre, wäre sie inzwischen entweder eine ausgewachsene schizophrene Paranoikerin oder eine verwahrloste Hebephrenikerin. Mit Dauereinweisung.«
»Sie sieht so merkwürdig aus.«
»Was hältst du von dem Mosaik?«
»Es wird den Wert des Hauses nicht gerade steigern.«
»Und ob es ihn steigert!«
Pris erschien an der Tür zum Gästezimmer. »Ich hab gefragt, ob sie abgeschaltet ist.« Sie funkelte uns an, als hätte sie erraten, dass wir über sie geredet hatten.
»Ja«, erwiderte Maury. »Außer Jerome hat sie wieder angemacht, um Spinoza mit ihr zu diskutieren.«
»Was weiß die Stanton denn überhaupt?«, fragte ich. »Ist sie mit einem Haufen zufällig ausgewählter Fakten ausgestattet worden? Denn wenn nicht, dann wird mein Vater schnell das Interesse verlieren.«
Pris verzog den Mund. »Sie verfügt über dieselben Fakten, die der originale Edwin M. Stanton gehabt hat. Wir haben sein Leben bis in die kleinste Einzelheit recherchiert.«
Ich komplimentierte die beiden aus dem Zimmer, dann zog ich mich aus und legte mich hin. Bald darauf hörte ich Maury seiner Tochter gute Nacht sagen und im Schlafzimmer verschwinden. Und dann hörte ich nichts – außer, wie zu erwarten gewesen war, das scharfe Knacken vom Zerlegen der Fliesen.
Eine Stunde lang lag ich da und versuchte zu schlafen, dämmerte weg und wurde von dem Geräusch wieder zurückgeholt. Schließlich stand ich auf, machte Licht, zog mich an, brachte meine Haare in Ordnung, rieb mir die Augen und ging ins Wohnzimmer. Pris saß genauso da wie vorher, nach Yoga-Art, mit einem riesigen Haufen zerbrochener Kacheln um sich herum.
»Bei dem Lärm kann ja keiner schlafen.«
»Wie furchtbar.« Sie sah nicht einmal auf.
»Ich bin ein Gast.«
»Geh halt woanders hin.«
»Ich weiß genau, was der Gebrauch dieser Zange symbolisiert, Pris. Die Kastration von abertausend Männern, einer nach dem anderen. Hast du dafür die Klinik verlassen? Um hier die ganze Nacht herumzusitzen und so was zu machen?«
»Nein. Ich besorge mir einen Job.«
»Und was für einen? Bei den Arbeitslosenzahlen?«
»Die machen mir keine Angst. Es gibt auf der ganzen Welt niemanden wie mich. Ich habe bereits ein Angebot von einer Firma, die Auswanderungen organisiert. Die haben haufenweise statistische Arbeiten zu erledigen.«
»Dann wirst du also darüber entscheiden, wer die Erde verlassen darf.«
»Nein, ich habe abgelehnt. Ich habe nicht vor, irgendeine x-beliebige Büroangestellte zu werden. Hast du je von Sam K. Barrows gehört?«
»Nein.« Aber irgendwie kam mir der Name bekannt vor.
»In Look war mal ein Artikel über ihn. Mit zwanzig stand er jeden Morgen um fünf auf, aß ein Schälchen Backpflaumen, machte einen Dreikilometerlauf durch die Straßen von Seattle und kehrte anschließend auf sein Zimmer zurück, um sich zu rasieren und eine kalte Dusche zu nehmen. Und dann zog er los und studierte seine Gesetzesbücher.«
»Dann ist er also Rechtsanwalt.«
»Nicht mehr. Geh mal zum Bücherregal. Da liegt die Look-Ausgabe noch.«
»Warum sollte mich das interessieren?« Trotzdem ging ich mir die Zeitschrift holen.
Und tatsächlich war auf der Titelseite das Foto eines Mannes, unter dem
SAM K. BARROWS, AMERIKAS GESCHÄFTSTÜCHTIGSTER JUNGER MULTIMILLIARDÄR
stand. Die Ausgabe war vom 18. Juni 1981, also noch ziemlich aktuell. Barrows joggte gerade eine der am Wasser gelegenen Straßen in der Innenstadt von Seattle hinauf, in Khakishorts und einem grauen Sweatshirt, bei Sonnenaufgang, wie es aussah, munter keuchend, ein Mann mit glänzendem, völlig kahl rasiertem Schädel, die Augen wie die kleinen Steine im Gesicht eines Schneemanns: ausdruckslos, winzig. Ohne jede Emotion – nur die untere Gesichtshälfte schien zu grinsen.
»Falls du ihn mal im Fernsehen gesehen hast…«
»Ja, ich habe ihn im Fernsehen gesehen.« Jetzt erinnerte ich mich wieder, denn damals, vor etwa einem Jahr, hatte der Mann einen ziemlich schlechten Eindruck auf mich gemacht. Seine monotone Sprechweise – er hatte sich zu dem Interviewer hinübergebeugt und auf ihn eingemurmelt. »Und für ihn möchtest du arbeiten?«
»Sam Barrows ist der größte Immobilienspekulant, den es je gegeben hat.«
»Darum geht uns wahrscheinlich der Grund und Boden aus. Alle Grundstücksmakler gehen pleite, weil es nichts zu verkaufen gibt. Millionen von Menschen – und keinen Platz, wo sie hinkönnen.« Dann fiel es mir wieder ein: Barrows hatte genau dieses Problem gelöst. Mit einer ganzen Serie von Klagen hatte er die Regierung der Vereinigten Staaten dazu gezwungen, private Spekulationen mit Grund und Boden auf anderen Planeten zu genehmigen. Praktisch im Alleingang hatte er den Weg für Parzellierungsunternehmer auf Luna, Mars und Venus freigemacht; sein Name würde für immer in die Geschichtsbücher eingehen. »Das also ist der Mann, für den du arbeiten möchtest. Der Mann, der unberührte Welten verseucht hat.« Seine Vertreter priesen die Parzellen von Büros überall in den USA aus an.
»Unberührte Welten verseucht? Das ist doch nur ein Slogan dieser Umweltschützer.«
»Aber wahr. Wie will man das Land denn nutzen, wenn man es erst einmal gekauft hat? Wie lebt man darauf? Ohne Wasser, ohne Luft, ohne Wärme, ohne…«
»Das wird alles geliefert.«
»Und wie?«
»Genau darum ist Barrows ein so großer Mann. Wegen seiner Vision. Barrows Enterprises arbeitet Tag und Nacht…«
»Das alles ist reine Abzocke.«
Stille. Angespannte Stille.
»Hast du dich je wirklich mit Barrows unterhalten? Es ist das eine, einen Helden zu haben – du bist eine junge Frau, und es ist nur natürlich für dich, einen Mann zu verehren, der auf den Titelbildern der Zeitschriften und im Fernsehen zu sehen ist. Und er ist reich und hat im Alleingang den Mond für Kredithaie und Immobilienspekulanten zugänglich gemacht. Aber du hast mir etwas davon erzählt, dass du dir einen Job besorgen willst.«
»Ja, ich habe mich für einen Job in einer seiner Firmen beworben. Und ich habe ihnen gesagt, dass ich ihn gern persönlich sprechen möchte.«
»Da haben sie aber gelacht.«
»Nein, sie haben mich zu seinem Büro geschickt. Er hörte mir für eine geschlagene Minute zu. Dann hatte er sich natürlich wieder um seine anderen Geschäfte zu kümmern.«
»Und was hast du zu ihm gesagt in deiner Minute?«
»Ich habe ihn angesehen, er hat mich angesehen. Du hast ihn nie in Wirklichkeit erlebt. Er ist unglaublich attraktiv.«
»Im Fernsehen hat er eher was Echsenhaftes.«
»Ich habe ihm gesagt, dass ich ein Gespür für Versager habe. Wenn ich seine Sekretärin wäre, käme niemand an mir vorbei, der nur seine Zeit verschwenden will. Ich kann knallhart sein. Und gleichzeitig würde ich nie jemanden abweisen, der wichtig ist. Verstehst du?«
»Aber kannst du auch Briefe öffnen?«
»Dafür gibt es Maschinen.«
»Dein Vater tut das. Das ist sein Job bei uns.«
»Und genau darum würde ich auch nie für euch arbeiten. Weil ihr so erbärmlich klein seid, euch gibt es eigentlich gar nicht. Nein, ich kann keine Briefe öffnen. Ich kann keinerlei Routinearbeiten. Aber ich sag dir, was ich kann. Es war meine Idee, die Edwin M. Stanton zu bauen.«
Ich sah sie ungläubig an.
»Maury wäre da gar nicht draufgekommen. Bundy – er ist ein Genie. Voller Inspiration. Aber das ist das Einzige, was er kann, der Rest seines Gehirns ist durch die fortschreitende Hebephrenie völlig hinüber. Ich habe die Stanton entworfen, und er hat sie gebaut. Und sie ist ein Erfolg, du hast sie gesehen. Aber ich will es gar nicht als Verdienst angerechnet haben, das habe ich nicht nötig. Es hat Spaß gemacht. Wie das hier.« Sie begann wieder, ihre Kacheln zu zerschneiden. »Kreative Arbeit.«
»Und Maury, was hat der getan? Dem Ding die Schuhe zugebunden?«
»Maury hat das Ganze organisiert. Er hat dafür gesorgt, dass wir alles hatten, was wir brauchten.«
Ich bekam das entsetzliche Gefühl, dass das, was sie sagte, der Wahrheit entsprach. Klar, ich konnte zur Sicherheit Maury fragen. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass dieses Mädchen überhaupt wusste, wie man log; sie war praktisch das genaue Gegenteil ihres Vaters. Vielleicht schlug sie ja nach ihrer Mutter, die ich nie kennengelernt hatte. Die Familie war zerbrochen, lange bevor ich Maury kennengelernt hatte. »Und? Wie läuft deine ambulante Psychoanalyse so?«
»Gut. Und deine?«
»Ich brauche keine.«
»Da liegst du falsch. Du bist sehr krank, genau wie ich.« Sie lächelte zu mir herauf. »Stell dich den Tatsachen.«
»Würdest du mit diesem Geknackse aufhören, damit ich schlafen kann?«
»Nein. Ich will den Kraken heute Nacht noch fertig kriegen.«
»Wenn ich nicht schlafen kann, fall ich irgendwann um.«
»Ja und?«
»Bitte!«
»Noch zwei Stunden.«
»Sind die alle wie du? Die Leute, die aus den staatlichen Kliniken kommen? Die jungen Leute, die wieder auf Kurs gebracht wurden? Kein Wunder, dass wir Probleme mit dem Orgelabsatz haben.«
»Organabsatz? Was für Organe wollt ihr denn absetzen? Ich für meinen Teil habe alle Organe, die ich brauche.«
»Orgeln, nicht Organe. Elektronische Orgeln. Obwohl, wer weiß. Vielleicht verkaufen wir ja bald auch elektronische Organe.«
»Ich brauche keine, ich habe welche aus Fleisch und Blut.«
»Besser, sie wären elektronisch und du würdest ins Bett gehen und deinen Gast schlafen lassen.«
»Du bist nicht mein Gast. Bloß der von meinem Vater. Und komm mir nicht mit ins Bett gehen – oder ich sag meinem Vater, dass du mich gefragt hast, ob ich mit dir schlafen will, und das war’s dann mit MASA Associates und deiner Karriere. Du wirst dir wünschen, nie irgendeine Orgel gesehen zu haben, elektronisch oder nicht. Also geh brav in die Heia und sei froh, dass du keine größeren Sorgen hast als nicht einschlafen zu können.« Sie fuhr fort, Kacheln zu zerbrechen.
Einen Moment lang stand ich da und fragte mich, was ich tun sollte. Schließlich wandte ich mich ab und ging – ohne dass mir eine schlagfertige Entgegnung eingefallen wäre – zurück in mein Zimmer. Mein Gott, dachte ich. Gegen die ist diese Stanton-Kiste reinste Wärme und Freundlichkeit.
Und doch hatte sie mir keine Feindseligkeit entgegengebracht. Sie hatte einfach nur kein Gespür dafür, was sie so von sich gab, ob sie etwas Verletzendes gesagt hatte – sie machte eben mit ihrer Arbeit weiter. Aus ihrer Sicht war nichts weiter geschehen, ich spielte keine Rolle für sie.
Und wenn sie mich nun wirklich nicht leiden konnte… Aber war das überhaupt möglich? Hatte dieses Wort für sie irgendeine Bedeutung? Vielleicht wäre das besser, dachte ich, während ich die Zimmertür abschloss. Es wäre menschlicher, nachvollziehbarer, wenn sie eine Abneigung gegen mich gehabt hätte. Aber einfach weggescheucht zu werden, nur damit sie weitermachen, ihre Arbeit beenden konnte – als wäre ich irgendein Hemmnis, ein störendes Element, nichts weiter.
Vermutlich konnte sie nur die Oberfläche der Menschen wahrnehmen, entschied ich. War sich ihrer nur bewusst, soweit es ihre einschränkende oder nicht einschränkende Wirkung auf sie betraf… Mit solchen Gedanken lag ich da, das eine Ohr ins Kissen gepresst, das andere mit dem Arm abgedeckt, um das Geknackse zu dämpfen, die endlose Folge von Schnitten, die sich bis in alle Ewigkeit fortsetzte.
Mir war klar, warum sie sich zu Sam K. Barrows hingezogen fühlte. Zwei vom gleichen Schlag, oder eher aus der gleichen Werkstatt. Im Fernsehen und auch jetzt wieder, beim Blick auf die Zeitschrift – es war, als wäre Barrows der obere Teil seines Kopfes geöffnet und das Gehirn durch ein Steuersystem oder eine Rückkopplungsschaltung aus Selenoiden und Relais ersetzt worden, die ferngesteuert wurde. Oder vielleicht saß dort oben auch irgendetwas an den Kontrollen, betätigte mit raffinierten Bewegungen die Schalter.
Und wie merkwürdig es doch war, dass diese junge Frau mitgeholfen hatte, das fast schon liebenswerte Simulacrum zu erschaffen, als wäre sie sich auf einer unterbewussten Ebene des Defizits in ihrem Inneren bewusst, der leeren, abgestorbenen Mitte, und würde es fleißig kompensieren.
Am nächsten Morgen frühstückten Maury und ich in einem kleinen Café in der Nähe der Firma. Als wir einander in der Essnische gegenübersaßen, fragte ich: »Wie krank ist deine Tochter eigentlich, Maury? Wenn sie immer noch unter der Vormundschaft des FBMH steht, muss sie ja…«
»Ein Zustand wie der ihre lässt sich nicht heilen.«
Maury nippte an seinem Orangensaft. »Es ist ein lebenslanger Prozess, der immer wieder schwierige und weniger schwierige Phasen durchläuft.«
»Würde sie immer noch als Schizophrene unter den McHeston Act fallen, wenn man heute mit ihr den Benjamin-Sprichworttest durchführen würde?«
»Die würden nicht mehr den Benjamin-Test nehmen, sondern diesen sowjetischen Test, diese bunten Bauklötze von Vygotsky und Luria. Dir ist gar nicht klar, wie früh sie von der Norm abgewichen ist, falls man überhaupt von jemandem sagen kann, er sei Bestandteil einer ›Norm‹.«
»Ich hab den Benjamin-Test in der Schule damals bestanden.« Der Test war seit 1975 – in manchen Bundesstaaten sogar noch früher – die unerlässliche Voraussetzung, um als ›normal‹ zu gelten.
»Also nach dem zu urteilen, was sie mir in der Klinik erzählt haben, als ich sie abgeholt habe, würde man sie im Moment nicht als schizophren einstufen. Das war sie praktisch nur drei Jahre lang. Sie haben ihren Zustand zurückgedreht auf vor diesem Zeitpunkt, auf das Integrationsvermögen, das sie ungefähr mit zwölf gehabt hat. Und das ist ein nicht-psychotischer Zustand und fällt somit nicht unter den McHeston Act. Also darf sie frei herumlaufen.«
»Dann ist sie also eine Neurotikerin.«
»Sie nennen es atypische Entwicklung oder latente beziehungsweise Borderline-Psychose. Sie kann sich zu einer Neurose entwickeln, zu einer Zwangsneurose oder zu voller Schizophrenie aufblühen, wie es bei Pris während ihres dritten Highschool-Jahres passiert ist.«
Während er sein Frühstück aß, erzählte mir Maury von ihrer Entwicklung. Ursprünglich war sie ein sehr zurückhaltendes Kind gewesen, also das, was das FBMH verkapselt oder introvertiert nennt. Sie hielt sich abseits, hatte alle möglichen Geheimnisse, etwa ein Tagebuch und kleine Verstecke im Garten. Dann, mit ungefähr neun Jahren, begann sie unter Angstvorstellungen zu leiden, so massiv, dass sie einen Großteil der Nacht aufblieb und durchs Haus tigerte. Mit elf entwickelte sie großes Interesse an Naturwissenschaften; sie besaß einen Chemiebaukasten und tat nach der Schule nichts anderes, als damit herumzuexperimentieren. Sie hatte wenige bis gar keine Freunde und schien auch keine zu wollen.
Doch die richtigen Probleme kamen erst in der Highschool. Sie hatte Angst, große Gebäude zu betreten, also auch die Schule, und fürchtete sich vor dem Busfahren. Wenn sich die Türen des Busses schlossen, hatte sie das Gefühl zu ersticken. Und sie konnte in der Öffentlichkeit nicht essen. Selbst wenn ihr nur eine einzige Person zusah, musste sie ihr Essen schon in irgendeine Ecke tragen wie ein wildes Tier. Etwa zur gleichen Zeit war sie zwanghaft geworden: Alles hatte ganz genau an seiner Stelle zu sein. Sie streifte den ganzen Tag ruhelos durchs Haus und stellte sicher, dass alles sauber war. Sie wusch sich die Hände manchmal zehn-, fünfzehnmal hintereinander.
»Nicht zu vergessen«, fügte Maury hinzu, »dass sie stark übergewichtig wurde. Sie war wirklich ganz schön dick, als du sie zum ersten Mal gesehen hast. Von selbst fing sie an, Diät zu machen. Hungerte sich die Pfunde herunter. Das tut sie sogar heute noch.«
»Und ihr brauchtet den Sprichworttest, um herauszufinden, dass sie geistig nicht gesund war? Bei der Vorgeschichte?«
Maury zuckte mit den Schultern. »Wir haben uns etwas vorgemacht. Haben uns gesagt, dass sie bloß neurotisch ist. Phobien und Rituale und so was…«
Am meisten bekümmerte es ihn, dass seine Tochter irgendwann den Sinn für Humor verloren hatte. Anstatt albern und sorglos zu sein wie früher, wurde sie so penibel wie ein Buchhalter. Und nicht nur das: Früher hatte sie Tiere gemocht; dann, während ihres Aufenthalts in Kansas City, konnte sie plötzlich keine Hunde oder Katzen mehr ertragen. Ihr Interesse an Chemie war allerdings geblieben, und das – ein Beruf sozusagen – erschien Maury als gute Sache.
»Hilft ihr die ambulante Therapie?«
»Sie bleibt damit auf einem stabilen Niveau. Sie rutscht nicht wieder ab. Sie hat immer noch starke hypochondrische Tendenzen, wäscht sich immer noch viel die Hände. Damit wird sie nie aufhören. Und sie ist immer noch überpenibel und verschlossen. Ich kann dir sagen, wie man das nennt: schizoide Persönlichkeit. Ich habe die Auswertung des Rorschachtests gesehen, den Doktor Horstowski mit ihr gemacht hat. Das ist der ambulante Arzt hier in Zone 5 nach der Systematik des FBMH. Horstowski soll sehr gut sein, aber er nimmt keine Kassenpatienten, also kostet es uns einen Haufen Geld.«
»Da seid ihr nicht die Einzigen, wenn man der Fernsehwerbung trauen darf. Wie war das noch gleich, jeder Vierte hat eine gewisse Zeit in einer staatlichen Klinik verbracht?«
»Das mit der Klinik ist mir egal, die ist umsonst. Was mich stört, ist diese teure ambulante Nachbehandlung. Es war Pris’ Idee, wieder nach Hause zu kommen, nicht meine. Ich glaube nach wie vor, sie wird wieder in der Kasanin landen, aber sie hat sich auf den Entwurf des Simulacrums gestürzt, und wenn sie nicht damit beschäftigt war, hat sie die Badezimmerwände mit Mosaiken gepflastert. Sie ist ständig in Bewegung. Ich habe keine Ahnung, wo sie die Energie hernimmt.«
»Wenn ich so darüber nachdenke, wie viele Leute ich kenne, die an einer psychischen Erkrankung gelitten haben, dann ist das kaum zu fassen. Meine Tante Gretchen, sie ist in der Harry-Stack-Sullivan-Klinik in San Diego. Mein Cousin Leo Roggis. Mein Englischlehrer an der Highschool, Mr. Haskins. Der alte italienische Rentner ein Stück die Straße runter, George Oliveri. Ich erinnere mich noch an einen Kumpel beim Militär, Art Boles. Er hatte Schizophrenie und kam in die Fromm-Reichmann-Klinik in Rochester, New York. Dann Alys Johnson, mit der ich auf dem College zusammen war. Sie ist in der Samuel-Anderson-Klinik in Zone 3, also in Baton Rouge, Louisiana. Und ein Mann, für den ich gearbeitet habe, Ed Yeats – Schizophrenie, die sich zur Paranoia auswuchs. Und Waldo Dangerfield, noch ein Kumpel. Gloria Milstein, eine frühere Bekannte von mir, die wirklich enorme Brüste hatte, wie Birnen… Sie ist weiß Gott wo. Sie wurde bei einem psychologischen Einstellungstest erwischt, als sie sich als Schreibkraft beworben hatte. Die Typen vom FBMH kamen runtergesaust und zack, weg war sie. Sie war sehr süß. Dann John Franklin Mann, ein Gebrauchtwagenhändler, den ich kannte. Er erwies sich bei einem Test als Schizophrener und wurde abgeholt und vermutlich in die Kasanin gesteckt, weil er Verwandte in Missouri hatte. Und Marge Morrison, noch eine Bekannte von mir. Sie hatte die Sorte Hebephrenie, an die ich lieber nicht denken will. Aber sie ist wieder draußen, ich hab eine Karte von ihr bekommen. Und Bob Ackers, ein ehemaliger Mitbewohner. Und Eddy Weiss…«
Maury war aufgestanden. »Gehen wir lieber.«
Wir verließen das Café. »Kennst du eigentlich diesen Sam Barrows?«, fragte ich.
»Klar. Nicht persönlich natürlich. Aber ich weiß, dass er ein Teufelskerl ist. Er würde auf alles wetten. Wenn eine seiner Geliebten – und das ist allein auch schon wieder eine Geschichte –, wenn eine seiner Geliebten aus dem Fenster springen würde, würde er darauf wetten, womit sie zuerst auf dem Pflaster aufschlägt, mit dem Kopf oder mit dem Hintern. Als würde einer dieser Großspekulanten von früher in ihm weiterleben. Für einen Menschen wie ihn ist das Leben ein Glücksspiel. Ich bewundere ihn.«
»Pris bewundert ihn auch.«
»Nein – sie betet ihn an, verdammt. Sie ist ihm begegnet. Sie haben sich gegenseitig niedergestarrt. Er hat sie elektrisiert oder magnetisiert oder irgend so einen Scheiß. Danach hat sie wochenlang kaum ein Wort rausgebracht.«
»Das war, als sie auf Jobsuche war?«
Maury nickte. »Sie hat den Job zwar nicht gekriegt, aber sie ist ins Allerheiligste vorgedrungen. Weißt du, dieser Bursche kann in alle Richtungen Möglichkeiten aufspüren, Chancen, die andere in tausend Jahren nicht sehen würden. Such dir bei Gelegenheit mal die Fortune-Ausgabe raus, die haben vor zehn Monaten oder so einen Riesenartikel über ihn gebracht.«
»Nach dem, was Pris mir erzählt hat, hat sie ihm gegenüber den Mund ganz schön voll genommen.«
»Sie hat ihm gesagt, dass sie eine unglaublich wertvolle Mitarbeiterin sein könnte – was niemand erkennt. Er sollte es wohl erkennen, jedenfalls hat sie gesagt, dass sie in seiner Firma bis an die Spitze aufsteigen und im ganzen Universum bekannt werden würde. Davon abgesehen hat sie sich einfach so aufgeführt, wie sie nun mal ist. Sie hat ihm gesagt, dass sie ebenfalls eine Spielernatur wäre und bereit sei, alles aufs Spiel zu setzen, um für ihn arbeiten zu können. Kannst du das glauben?«
»Nein.« Davon hatte sie mir nichts erzählt.
Maury schwieg einen Moment, dann sagte er: »Die Edwin M. Stanton war ihre Idee.«
Also stimmte es. In meinem Magen machte sich ein flaues Gefühl breit. »Und war es auch ihre Idee, Stanton zu nehmen?«
»Nein, das kam von mir. Sie wollte eigentlich ein Simulacrum, das wie Sam Barrows aussieht. Aber es gab nicht genug Datenmaterial für das Zentralmonadenlenksystem, also haben wir uns Nachschlagewerke über berühmte historische Figuren besorgt. Und ich habe mich schon immer für den Bürgerkrieg interessiert, das war früher mal ein Hobby von mir. Das hat dann den Ausschlag gegeben.«
»Verstehe.«
»Sie denkt trotzdem ständig nur an Barrows. Ihr Therapeut nennt das eine Obsession.«
Wir gingen weiter zum Büro von MASA Associates.
Vier
Als wir dort ankamen, rief gerade mein Bruder Chester aus Boise an und erinnerte uns daran, dass wir die Edwin M. Stanton bei ihnen zurückgelassen hatten und bitte doch abholen sollten.
»Wir schauen, dass wir heute noch vorbeikommen«, versprach ich ihm.
»Sie sitzt noch da, wo ihr sie gelassen habt. Vater hat sie heute Morgen für ein paar Minuten angestellt, um zu sehen, ob sie die Nachrichten hat.«
»Nachrichten?«
»Ja, die Morgennachrichten. Wie bei David Brinkley im Fernsehen.«
Er meinte, ob sie die Nachrichten brachte. Also war meine Familie zu dem Schluss gekommen, dass ich recht hatte – es war nur eine Maschine, kein Mensch.
»Und? Hat sie?«
»Nein. Sie hat sich über die Unverschämtheit bestimmter Kommandanten auf dem Schlachtfeld ausgelassen.«
Als ich auflegte, sagte Maury: »Pris kann sie abholen.«
»Hat sie denn ein Auto?«
»Sie kann den Jaguar nehmen. Und vielleicht fährst du besser mit, für den Fall, dass dein Vater doch noch Interesse zeigt.«
Später am Tag kam Pris im Büro vorbei, und kurz darauf waren wir auf dem Weg nach Boise.
Zunächst fuhren wir schweigend dahin, Pris am Steuer, als sie unvermittelt fragte: »Hast du Verbindung zu jemandem, der sich für die Edwin M. Stanton interessiert?«
»Nein. Was für eine seltsame Frage.«
»Was ist dein wahres Motiv, mit auf diese Fahrt zu kommen? Du hast irgendein verborgenes Motiv – es dringt dir aus jeder Pore. Wenn ich hier etwas zu sagen hätte, würde ich dich nicht auf dreißig Meter an die Stanton heranlassen.« Sie warf mir einen misstrauischen Blick zu. »Warum bist du nicht verheiratet?«
»Keine Ahnung.«
»Bist du homosexuell?«
»Nein.«
»Fand dich irgendeine Jugendliebe zu hässlich?«
Ich stöhnte leise.
»Wie alt bist du?«
Eigentlich eine ganz normale Frage, doch in Anbetracht des Verhaltens, das sie mir gegenüber an den Tag legte, war ich sogar hier zögerlich. »Ähmmm…«
»Vierzig?«
»Nein. Dreiunddreißig.«
»Aber du hast graue Schläfen und deine Zähne sehen komisch aus, so abgeschliffen.«
Ich wäre am liebsten im Boden versunken.
»Was war deine erste Reaktion auf die Stanton?«
»Ich dachte: Was für ein nett aussehender älterer Herr das doch ist.«
»Du lügst, oder?«
»Ja.«
»Was hast du wirklich gedacht?«
»Ich dachte: Was für ein nett aussehender älterer Herr da in Zeitungspapier eingewickelt wurde.«
»Ach, du bist wahrscheinlich ein Schwuler, der auf alte Männer steht. Also zählt deine Meinung nicht.«
»Jetzt hör mir mal zu, Pris. Eines Tages wird dir jemand den Schädel mit einem Wagenheber einschlagen. Alles klar?«
»Du kannst deine Aggressionen kaum im Zaum halten, stimmt’s? Liegt es daran, dass du dich als Versager siehst? Vielleicht gehst du zu hart mit dir ins Gericht. Erzähl mir deine Kindheitsträume, dann sag ich dir, ob…«
»Nicht für eine Million Dollar.«
»Sind sie dir unangenehm?« Sie starrte mich eindringlich an. »Hast du etwa peinliche sexuelle Handlungen an dir vollzogen, wie sie in den Psychologiebüchern beschrieben werden?«
Das durfte doch alles nicht wahr sein!
»Offensichtlich habe ich ein heikles Thema angeschnitten. Aber du musst dich nicht schämen. Du tust es doch nicht mehr, oder? Obwohl, vielleicht doch – du bist Single, also ist dir normale Triebabfuhr verwehrt.« Sie dachte kurz nach. »Ich frage mich, was Sam tut, in sexueller Hinsicht.«
»Sam Vogel? Unser Fahrer, der gerade in Nevada unterwegs ist?«
»Nein. Sam K. Barrows.«
»Du bist wirklich zwanghaft. Deine Gedanken, deine Art zu reden, die Verzierungen im Bad – dein Engagement für die Stanton.«
»Das Simulacrum ist von hoher Originalität.«
»Was würde dein Therapeut dazu sagen?«
»Milt Horstowski? Ich hab ihm davon erzählt. Er hat sich schon dazu geäußert.«
»Und? Hat er nicht gesagt, dass es sich um eine manische Zwangshandlung handelt?«
»Nein, er fand auch, dass ich etwas Kreatives tun sollte. Als ich ihm von der Stanton erzählt habe, hat er mir gratuliert und mir die Daumen gedrückt, dass sie funktioniert.«
»Wahrscheinlich hast du ihm eine völlig geschönte Version untergejubelt.«
»Nein, ich habe ihm die Wahrheit gesagt.«
»Dass ihr den Bürgerkrieg mit Robotern nachkämpfen wollt?«
»Ja. Er sagte, das hätte was.«
»Jesus, sind denn hier alle verrückt?«
»Alle.« Pris streckte den Arm aus und fuhr mir durch die Haare. »Bloß du nicht, Kleiner. Stimmt’s?«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
»Du nimmst alles viel zu ernst. Du bist der anale Typ. Pflichtversessen. Du solltest den Schließmuskel auch einmal loslassen – und sehen, wie es sich anfühlt. Du wärst gern böse, das ist der heimliche Wunsch des analen Typs. Trotzdem denkt er, er müsse seine Pflicht tun. Deshalb ist er so pedantisch und muss ständig an allem zweifeln. Wie du jetzt gerade – du hast deine Zweifel.«
»Ich habe keine Zweifel. Ich habe nur eine ungeheure Angst.«
Pris lachte.
»Sie ist also zum Lachen, meine Angst.«
»Du hast gar keine Angst. Das ist bloß eine ganz natürliche, irdische Gier. Nach mir. Nach Geld. Nach Macht. Nach Ruhm.« Pris hielt die Hand hoch, Daumen und Zeigefinger einige Millimeter voneinander entfernt. »Ungefähr so viel insgesamt. Das ist der Umfang deiner überwältigenden Gefühle.« Sie sah mich träge an, offenbar sehr zufrieden mit sich.
Wir fuhren weiter.
In Boise holten wir bei meinem Vater das Simulacrum ab, wickelten es wieder in Zeitungspapier und trugen es zum Wagen. Dann fuhren wir nach Ontario zurück. Wir redeten kaum; Pris war in sich gekehrt, ich sprachlos vor Zorn. Mein Verhalten schien sie zu amüsieren – ich war jedoch klug genug, nichts zu sagen.
Als ich schließlich wieder das Büro betrat, wartete eine kleine, pummelige, dunkelhaarige Frau auf mich. Sie trug einen schweren Mantel und hatte eine Aktentasche bei sich. »Mr. Rosen?«
»Ja.« Ich fragte mich, ob sie wohl eine Zustellungsbeamtin war.
»Mein Name ist Colleen Nild. Von Mr. Barrows’ Büro. Mr. Barrows hat mich gebeten, mit Ihnen zu reden. Wenn Sie also einen Moment Zeit haben.« Sie hatte eine leise, ziemlich unsichere Stimme.
»Was will Mr. Barrows denn?« Ich bot ihr einen Stuhl an und setzte mich gegenüber.
»Ich habe hier Kopien eines Briefes von Mr. Barrows an Miss Pris Frauenzimmer. Eine ist für Sie.« Sie hielt drei Blatt Papier hoch; ich sah einen schwarz-weißen, offensichtlich korrekten Briefkopf über einem sehr ordentlichen Geschäftsbrief. »Sie sind die Familie Rosen aus Boise, nicht wahr? Diejenigen, die die Produktion von Simulacra angeregt haben?«
Beim Überfliegen des Briefes fiel mir immer wieder das Wort ›Stanton‹ auf; Barrows antwortete offenbar auf einen Brief, den Pris ihm in der Angelegenheit geschickt hatte. Aber ich begriff nicht, worauf er hinauswollte; es war alles ein bisschen unklar.
Dann machte es klick.
Barrows hatte Pris falsch verstanden. Er nahm an, bei dem Plan, den Bürgerkrieg mit von uns gefertigten Simulacra nachzustellen, würde es sich um eine gemeinnützige Unternehmung, einen gutgemeinten patriotischen Versuch zur Hebung des Bildungsniveaus handeln, nicht um eine Geschäftsidee. Das also bekam sie zur Antwort - Barrows dankte ihr für ihre Idee und dafür, dass sie in dem Zusammenhang an ihn gedacht hatte… aber, schrieb er, er erhalte derartige Anfragen täglich und habe bereits alle Hände voll mit ehrenamtlichen Unternehmungen zu tun; etwa fließe kein geringer Teil seiner Zeit in den Kampf gegen den Abriss einiger Häuser in Oregon, und so weiter.
»Kann ich den Brief behalten?«, fragte ich Mrs. Nild.
»Natürlich. Und falls Sie etwas dazu sagen möchten, so ist Mr. Barrows gewiss an jeglichem Kommentar von Ihrer Seite interessiert.«
»Wie lange arbeiten Sie schon für Mr. Barrows?«
»Acht Jahre.« Sie klang sehr zufrieden.
»Ist er wirklich Milliardär, wie die Zeitungen behaupten?«
»Ich nehme es an, Mr. Rosen.« Ihre braunen, durch die Brille vergrößerten Augen blitzten.
»Und ist er ein guter Chef?«
Sie lächelte, erwiderte aber nichts.
»Was ist dieses Wohnungsprojekt, dieses Green Peach Hat, von dem Barrows in seinem Brief schreibt?«
»Das ist eine Bezeichnung für die Gracious Prospect Heights, eine der größten Wohnsiedlungen im Nordwesten. Mr. Barrows nennt sie immer so, obwohl es sich ursprünglich um eine Verballhornung handelte. Die Leute, die sie abreißen wollen, haben sich diese Bezeichnung einfallen lassen, und Mr. Barrows hat sie übernommen – die Bezeichnung, meine ich –, um die Menschen zu schützen, die dort leben, damit sie nicht das Gefühl haben, man würde ihnen ins Gesicht spucken. Sie wissen das zu schätzen. Sie haben eine Unterschriftensammlung gestartet, um ihm für seine Hilfe im Kampf gegen die Abrisspläne zu danken und es haben fast zweitausend Leute unterschrieben.«
»Dann wollen die Menschen, die dort leben, also nicht, dass alles abgerissen wird?«
»Oh nein, sie hängen sehr an der Siedlung. Aber ein paar Berühmtheiten wollen damit den Wert ihrer Immobilien hochtreiben. Sie wollen, dass das Land für einen Country-Club oder so etwas genutzt wird. Diese Gruppe nennt sich Nordwestliches Bürgerkomitee für besseres Wohnen. Eine Mrs. Devorac ist die Vorsitzende.«
Ich erinnerte mich, diesen Namen in den Oregoner Zeitungen gelesen zu haben. Ja, Silvia Devorac. Sie war ständig für irgendetwas engagiert, ihr Foto erschien regelmäßig auf der ersten Seite des Lokalteils. »Und warum will Mr. Barrows diese Wohnsiedlung retten?«
»Ihn empört die Tatsache, dass amerikanische Bürger ihrer Rechte beraubt werden. Die meisten Leute dort sind recht arm, sie könnten nirgendwo anders hin. Mr. Barrows versteht ihre Gefühle, weil er selbst jahrelang in Mietshäusern gewohnt hat. Wussten Sie, dass seine Familie auch nicht mehr Geld gehabt hat als andere? Dass er sich das alles selbst verdient hat, durch harte Arbeit?«
»Ja.« Sie schien darauf zu warten, dass ich noch mehr sagte. »Schön, dass er sich immer noch mit der arbeitenden Bevölkerung identifiziert, obwohl er jetzt Milliardär ist.«
»Da Mr. Barrows den Großteil seines Geldes mit Immobilien gemacht hat, hat er ein geschärftes Bewusstsein für die Probleme, denen sich die Menschen in ihrem Kampf um angemessenen Wohnraum gegenübersehen. Für snobistische Damen wie Silvia Devorac ist Green Peach Hat nur eine unansehnliche Ansammlung alter Häuser. Die sie nie betreten hat – das würde ihr auch nie in den Sinn kommen.«
»Wissen Sie, das von Mr. Barrows zu hören, gibt mir Hoffnung, dass unsere Gesellschaft doch noch nicht im Niedergang begriffen ist.«
Sie bedachte mich mit einem warmen Lächeln.
»Was wissen Sie von dem Stanton-Simulacrum?«
»Ich weiß, dass eines gebaut wurde. Miss Frauenzimmer erwähnte das sowohl in ihrem Brief als auch am Telefon. Mr. Barrows hat mir außerdem erzählt, dass Miss Frauenzimmer das Simulacrum in einen Greyhound-Bus setzen und ohne Begleitung nach Seattle fahren lassen wollte, wo sich Mr. Barrows gegenwärtig aufhält. Damit wollte sie demonstrieren, dass es sich in der Öffentlichkeit zeigen kann, ohne aufzufallen.«
»Von dem komischen Bart und der altmodischen Jacke mal abgesehen.«
»Dieser Faktoren war ich mir nicht bewusst.«
»Vielleicht könnte sich das Simulacrum mit dem Taxifahrer über den kürzesten Weg vom Busbahnhof zu Mr. Barrows’ Büro streiten. Das wäre ein zusätzlicher Beweis seiner Menschlichkeit.«
»Ich werde das Mr. Barrows gegenüber erwähnen.«
»Kennen Sie die Rosen-Orgel oder vielleicht unsere Kleinklaviere?«
»Ich bin mir nicht so sicher.«
»Die Rosen-Fabrik in Boise produziert die beste elektronische Chororgel, die es je gegeben hat. Sie übertrifft die Hammerstein-Stimmungsorgel bei weitem.«
»Dessen war ich mir ebenfalls nicht bewusst. Ich werde das Mr. Barrows gegenüber erwähnen. Er hat schon immer etwas für Musik übrig gehabt.«
Ich war immer noch damit beschäftigt, Barrows’ Brief zu lesen, als Maury von seiner Kaffeepause zurückkehrte. Ich zeigte ihm den Brief.
»Aha, Barrows schreibt Pris.« Er setzte sich und dachte nach. »Haben wir es geschafft, Louis? Das ist jedenfalls nicht nur eine Ausgeburt von Pris’ Phantasie. Aber Herrgott, dieser Bursche ist kaum zu verstehen. Hat er nun Interesse an der Stanton oder nicht?«
»Ich verstehe das so, dass er gerade voll und ganz mit einem anderen Projekt zu tun hat, dieser Wohnsiedlung namens Green Peach Hat.«
»Ja, da hab ich mal gewohnt. Ende der Fünfziger.«
»Und? Wie ist es da so?«
»Die reinste Hölle. Diese Dreckslöcher sollten abgefackelt werden. Nur ein Streichholz, nichts anderes, bringt dieser Gegend den Fortschritt.«
»Einige sehen das genauso wie du.«
»Nun, wenn sie wollen, dass es jemand für sie in Brand steckt, ich tu’s gern. Du darfst mich ruhig zitieren. Sam Barrows gehört das alles.«
»Aha.«
»Er macht ein Vermögen mit den Mieten. Mieteinnahmen aus Slums sind heutzutage die reinste Lizenz zum Gelddrucken. Man kriegt fünf- oder sechshundert Prozent seiner Investitionen wieder raus. Aber gut, ich denke, wir müssen persönliche Ansichten außen vorlassen. Barrows ist ein cleverer Geschäftsmann und derjenige, der die Simulacra am besten unterstützen kann, auch wenn er ein reicher Saftsack ist. Aber du meinst, dieser Brief ist eine Ablehnung des Vorschlags?«
»Du könntest ihn ja anrufen und es herauskriegen. Pris hat ihn offenbar angerufen.«
Maury griff zum Hörer und wählte.
»Warte!«
Er starrte mich an.
»Ich habe da eine Vorahnung. Das wird böse enden.«
»Mr. Barrows«, sagte Maury ins Telefon.
Ich nahm ihm den Hörer weg und legte auf.
Maury bebte vor Zorn. »Was bist du nur für ein Feigling!« Er hob wieder ab und sah sich nach dem Brief um, auf dem Barrows’ Durchwahl stand. Ich nahm den Brief, zerknüllte ihn und warf ihn in den Papierkorb.
Mit einem Fluch knallte Maury den Hörer auf die Gabel. »Was ist denn mit dir los?«
»Ich glaube nicht, dass wir uns mit einem Menschen wie ihm einlassen sollten.«
»Mit was für einem Menschen?«
»Wen die Götter verderben wollen, den blenden sie zuerst.«
Maury legt den Kopf schief und funkelte mich an. »Was meinst du damit? Du denkst, ich bin übergeschnappt, dass ich dort anrufen will? Ja, vielleicht hast du recht. Aber ich mach’s trotzdem.« Er ging an mir vorbei, klaubte den Brief aus dem Papierkorb, glättete ihn, merkte sich die Nummer, ging wieder zum Telefon und wählte erneut.
»Damit sind wir geschiedene Leute«, sagte ich.
Stille. »Hallo«, rief Maury plötzlich. »Ich würde gern Mr. Barrows sprechen. Maury Rock aus Ontario, Oregon.«
Wieder Stille.
»Mr. Barrows! Hier ist Maury Rock.« Maury hatte jetzt ein entschlossenes Grinsen im Gesicht. Er beugte sich vor, stützte den Ellenbogen auf den Schenkel. »Ich habe Ihren Brief vorliegen, Sir, an meine Tochter, Pris Frauenzimmer. Betreffend unsere weltbewegende Erfindung, das elektronische Simulacrum, in der Verkörperung der charmanten Persönlichkeit von Lincolns Kriegsminister Edwin McMasters Stanton.« Eine kurze Pause, in der er mich abwesend anstarrte. »Sind Sie interessiert, Sir?« Noch eine Pause, diesmal viel länger.
Du wirst deinen Coup nicht landen, Maury, schoss es mir durch den Kopf.
»Ja, das leuchtet mir ein. Das ist richtig, Sir. Aber lassen Sie mich eines verdeutlichen, falls Sie es übersehen haben sollten…« Das Gespräch schien nicht enden zu wollen; sie kamen vom Hundertsten ins Tausendste.
Schließlich bedankte sich Maury, verabschiedete sich und legte auf. Er sah mich finster und erschöpft an. »Puh.«
»Was hat er gesagt?«
»Das Gleiche wie im Brief. Er sieht das nach wie vor nicht als kommerzielle Unternehmung an. Er hält uns für irgendeinen Patriotenverein.« Er blinzelte und schüttelte verwundert den Kopf.
»So ein Pech, was?«
»Vielleicht ist es besser so.« Aber es hörte sich nicht so an, als ob Maury das auch glaubte – es klang lediglich etwas entmutigt. Er würde es wieder versuchen, er hatte immer noch Hoffnung.
Die Distanz zwischen uns war nie größer.
Fünf
In den darauf folgenden zwei Wochen schienen sich Maury Rocks Voraussagen bezüglich des Absatzrückgangs der Rosen-Elektroorgel zu bestätigen. Die Fahrer meldeten nur wenige bis überhaupt keine Verkäufe von Orgeln. Und wir erfuhren, dass Hammerstein inzwischen eine seiner Stimmungsorgeln für unter tausend Dollar anbot. Natürlich waren dabei Frachtkosten oder Klavierstuhl nicht einberechnet, aber trotzdem – schlechte Nachrichten für uns.
In der Zwischenzeit sah die Stanton immer mal wieder in unserem Büro vorbei. Maury kam auf die Idee, für Passanten einen Ausstellungsraum einzurichten und die Stanton dort Kleinklaviere vorführen zu lassen. Ich gab meine Zustimmung zur Bestellung eines Bauunternehmers, der das Erdgeschoss des Gebäudes umbauen sollte; die Arbeiten begannen, und die Stanton spazierte oben herum, half Maury mit der Post und hörte sich an, was sie zu tun haben würde, sobald der Ausstellungsraum fertig war. Maury schlug vor, dass sie sich ihren Bart abrasierte, doch nach einem wortreichen Schlagabtausch zog er die Idee wieder zurück, und die Stanton lief herum wie eh und je: mit ihren langen weißen Bartfransen.
»Später«, erklärte Maury mir, als die Stanton mal nicht in der Nähe war, »werde ich sie sich selbst vorführen lassen. Ich gebe gerade der entsprechenden Verkaufstechnik den letzten Schliff.« Dies wollte er dann direkt in das Zentralmonadengehirn der Stanton einspeisen, um sich einen Streit wie den um den Bart zu ersparen.
Außerdem war Maury die ganze Zeit über damit beschäftigt, ein zweites Simulacrum zu bauen. Es wurde in unserer Autowerkstatt auf einer der Werkbänke montiert, und eines Donnerstags gestatteten mir die Mächte, die unsere neue Ausrichtung verfügt hatten, einen ersten Blick darauf.
»Wer ist es denn diesmal?« Argwöhnisch betrachtete ich das Ding, das aus kaum mehr als einem großen Komplex Solenoide, Kabeln, Stromkreisunterbrechern und so weiter bestand, das alles auf Aluminiumplatten gesetzt. Bundy prüfte gerade ein Zentralmonadenspulenrad; er hatte sein Voltmeter zwischen die Kabel gesteckt und las die Anzeige ab.
»Das ist Abraham Lincoln«, sagte Maury.
»Jetzt hast du wirklich deinen Verstand verloren.«
»Ganz und gar nicht. Ich will einen richtigen Knaller präsentieren, wenn ich Barrows nächste Woche besuche.«
»Ach so, verstehe. Von diesem Termin hast du mir noch gar nichts erzählt.«
»Denkst du etwa, ich gebe auf?«
»Nein. Ich wusste, dass du nicht aufgeben würdest. Ich kenne dich.«
»Ich habe immer den richtigen Riecher.«
Tags darauf, nach einigem Grübeln, schlug ich Doktor Horstowski im Telefonbuch nach. Das Büro von Pris’ Psychiater lag in einer der besseren Gegenden von Boise. Ich rief in der Praxis an und bat um einen kurzfristigen Termin.
»Dürfte ich Sie fragen, wer uns empfohlen hat?«, wollte die Arzthelferin wissen.
»Miss Priscilla Frauenzimmer«, sagte ich etwas widerwillig.
»In Ordnung, Mr. Rosen. Doktor Horstowski kann morgen um halb zwei mit Ihnen sprechen.«
Eigentlich hätte ich längst wieder unterwegs sein, Karten erstellen und Kleinanzeigen in Zeitungen aufgeben müssen. Aber seit Maurys Anruf bei Barrows gärte etwas in mir.
Vielleicht hatte es mit meinem Vater zu tun. Seit dem Tag, an dem er seine Augen auf die Stanton gerichtet und erfahren hatte, dass es sich um eine Maschine handelte, die möglichst nah an einen echten Menschen herankommen sollte, hatte er zunehmend abgebaut. Anstatt wie üblich jeden Morgen in die Fabrik zu gehen, blieb er jetzt oft zu Hause und saß vor dem Fernseher – in sich zusammengesunken, bekümmert, geistig irgendwie nicht auf der Höhe.
Ich erwähnte es Maury gegenüber.
»Armer Bursche. Louis, ich sage dir das ja nicht gern, aber Jerome wird langsam gebrechlich.«
»Dessen bin ich mir bewusst.«
»Er kann nicht mehr mithalten.«
»Und was soll ich deiner Meinung nach tun?«
»Frag doch mal deine Mutter und deinen Bruder. Vielleicht kriegt ihr heraus, was Jerome schon immer hobbymäßig tun wollte. Flugzeuge aus dem Ersten Weltkrieg nachbauen, die Fokker-Dreidecker, die Spad. Oder irgendetwas anderes. Das solltet ihr mal rausfinden, dem alten Herrn zuliebe.«
Ich nickte.
»Weißt du, du bist nicht ganz unschuldig daran. Du hast dich nicht genug um ihn gekümmert. Wenn man alt wird, braucht man Unterstützung. Ich meine keine finanzielle – moralische.«
Am nächsten Tag fuhr ich nach Boise und parkte um zwanzig nach eins vor dem hypermodernen Bürogebäude, in dem Doktor Horstowski residierte.
Doktor Horstowski erschien im Flur, um mich in sein Sprechzimmer zu bitten, und ich sah mich einem Mann gegenüber, der eiförmig gebaut war: Sein Körper war rundlich, sein Kopf war rundlich, er trug eine winzige runde Brille, es gab keinerlei Ecken und Kanten an ihm. Seine Bewegungen hatten etwas Fließendes, Weiches, so als rollte er. Auch seine Stimme war weich und gedämpft. Doch dann, als ich sein Sprechzimmer betrat und mich setzte und genauer hinsah, stellte ich fest, dass es ein Merkmal an ihm gab, das mir entgangen war: Er hatte einen wahren Zinken von Nase, so glatt und scharf wie ein Papageienschnabel. Und jetzt, da mir das aufgefallen war, konnte ich in seiner Stimme auch eine unterdrückte Härte mitschwingen hören.
Er setzte sich mit Block und Stift mir gegenüber, verschränkte die Beine und stellte mir einige Routinefragen.
»Womit kann ich Ihnen helfen?«, fragte er schließlich.
»Nun, ich habe da ein Problem. Ich bin Partner in dieser Firma, MASA Associates. Und ich habe das Gefühl, dass mein Partner und seine Tochter gegen mich sind und hinter meinem Rücken etwas aushecken. Vor allem habe ich das Gefühl, dass sie meine Familie demütigen und aus dem Geschäft drängen wollen, besonders meinen Vater Jerome, der schon zu alt und zu schwach ist, um sich zu wehren.«
»Um sich gegen was zu wehren?«
»Gegen die vorsätzliche, rücksichtslose Demontage der Rosen-Kleinklavier- und -Elektroorgelfabrik und unseres gesamten Vertriebssystems. Zugunsten eines verrückten Plans zur Rettung der Menschheit oder zum Sieg über die Russen oder so. Ich habe es, ehrlich gesagt, noch nicht ganz begriffen.«
»Warum nicht?« Sein Stift kratzte über das Papier.
»Weil sich der Plan von Tag zu Tag ändert.« Ich hielt inne; der Stift hielt ebenfalls inne. »Damit wollen sie mich offenbar voll und ganz verwirren. Und dann übernimmt Maury die Firma und die Fabrik vielleicht gleich auch noch. Außerdem haben sie sich mit einer reichen, mächtigen, finsteren Gestalt eingelassen, Sam K. Barrows aus Seattle, den Sie vermutlich aus den Magazinen kennen.«
»Ja. Fahren Sie fort.«
»Darüber hinaus handelt es sich bei der Tochter meines Partners, die bei der ganzen Sache die Hauptantriebskraft ist, um eine ehemalige Psychotikerin, die völlig skrupellos vorgeht.« Ich sah Horstowski erwartungsvoll an, doch er zeigte keine sichtliche Reaktion. »Pris Frauenzimmer.«
Er nickte.
»Was ist Ihre Meinung dazu?«
Horstowski starrte auf seine Notizen. »Pris ist ein sehr dynamischer Mensch.«
Ich wartete, aber es kam nichts mehr. »Sie denken, ich bilde mir das alles nur ein?«
»Was, meinen Sie, könnte deren Motiv sein?«
»Keine Ahnung. Ist es meine Aufgabe, das herauszufinden? Sie wollen die Simulacra an Barrows verhökern und ein Heidengeld verdienen, was denn sonst? Und berühmt werden und mächtig. Der reinste Größenwahn.«
»Und Sie stehen ihnen im Weg?«
»Richtig.«
»Sie haben keine derartigen Träume?«
»Ich bin ein Realist oder versuche jedenfalls einer zu sein. Was mich betrifft, ist diese Stanton… Haben Sie die Maschine je gesehen?«
»Pris hat sie einmal mitgebracht. Sie hat im Wartezimmer gesessen während der Sitzung.«
»Und was hat sie getan?«
»Eine Zeitschrift gelesen.«
»Haben Sie keine Gänsehaut bekommen bei dem Anblick?«
»Nein.«
»Ihnen macht die Tatsache, dass Maury und Pris sich etwas so Widernatürliches, Gefährliches ausdenken konnten, keine Angst?«
Horstowski zuckte mit den Schultern.
»Herrgott noch mal, Sie haben sich hier in Ihrer Praxis verbarrikadiert. Was interessiert es Sie schon, was draußen in der Welt vor sich geht?«
Der Arzt grinste leicht süffisant, was mich wütend machte.
»Ich verrate Ihnen mal was, Doktor. Pris spielt ein grausames Spiel mit Ihnen. Sie hat mich hierher geschickt. Ich bin ein Simulacrum, wie die Stanton. Ich sollte Ihnen das eigentlich nicht verraten, aber ich mache dieses Versteckspiel nicht länger mit. Ja, ich bin bloß eine Maschine, ein Haufen Schaltkreise und Relais. Was sagen Sie dazu?«
Horstowski sah mich mit mildem Blick an. »Haben Sie mir nicht erzählt, dass Sie verheiratet sind? Wenn ja, wie lautet der Name Ihrer Frau und wie alt ist sie und hat sie einen Beruf?«
»Ich bin nicht verheiratet. Ich hatte einmal eine Freundin, eine Italienerin, die in einem Nachtklub gesungen hat. Sie war groß und hatte dunkle Haare. Sie hieß Lucrezia, aber wir sollten sie Mimi nennen. Sie ist an TBC gestorben. Das war nach unserer Trennung. Wir hatten uns ständig gestritten.«
Horstowski schrieb das alles sorgfältig auf.
»Dann wollen Sie also meine Frage nicht beantworten, Doktor?« Es war wirklich hoffnungslos. Sollte die Stanton etwas in ihm ausgelöst haben, so würde er mir nicht verraten, was. Aber vielleicht hatte sie ja auch gar nichts in ihm ausgelöst, vielleicht war ihm völlig egal, wer ihm gegenübersaß – vielleicht hatte er sich vor langer Zeit dazu erzogen, jeden zu akzeptieren. Jeden und jedes. »Ich habe eine Militärpistole Kaliber .45 und Munition. Mehr brauche ich nicht, die Gelegenheit wird sich ergeben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Pris sich jemand anderem gegenüber genauso grausam verhält wie mir gegenüber. Ich halte es für meine heilige Pflicht, sie zu beseitigen.«
Wieder dieser milde Blick. »Wissen Sie, Mr. Rosen, Ihr eigentliches ›Problem‹, wie Sie es genannt haben, ist die Feindseligkeit, die Sie empfinden. Eine unterdrückte, versteckte Feindseligkeit, die ein Ventil sucht und sich nun gegen Ihren Partner und seine achtzehnjährige Tochter richtet, die selbst Schwierigkeiten hat und nach Lösungen sucht, so gut sie eben kann.«
So formuliert, war es nicht gerade schmeichelhaft für mich. Es waren meine eigenen Gefühle, die mir zusetzten, nicht der Feind. Es gab keinen Feind. »Und was können Sie für mich tun?«
»Ich kann Ihnen die Wirklichkeit nicht schmackhaft machen. Ich kann Ihnen nur helfen, sie zu verstehen.« Er öffnete eine Schreibtischschublade. Ich sah Schachteln und Flaschen voller Medikamente, ein fürchterliches Durcheinander. Nach einigem Gewühl zog Horstowski ein Fläschchen heraus. »Nehmen Sie hiervon zwei am Tag, eine nach dem Aufstehen und eine vorm Schlafengehen. Hybrisin.« Er gab mir das Fläschchen.
»Welche Wirkung haben die?« Ich steckte die Flasche in meine Jackentasche.
»Hybrisin wirkt anregend auf den vorderen Abschnitt der septalen Region des Gehirns. Die Stimulation dieses Areals führt zu größerer geistiger Schärfe sowie dem Glauben, dass sich alles schon fügen wird. Es lässt sich mit dieser Einstellung der Hammerstein-Stimmungsorgel vergleichen.« Er reichte mir einen Zettel, auf dem Einstellhinweise für die Hammerstein standen. »Aber dieses Medikament wirkt ungleich stärker. Wie Sie ja wissen, ist die Stärke der von der Stimmungsorgel produzierten Erregungsschocks gesetzlich erheblich eingeschränkt.«
Ich sah mir die Einstellungen an. Es war kaum zu glauben, aber wenn man sie in Noten übertrug, kamen sie an den Anfang von Beethovens Streichquartett Nr. 16 heran. Schon allein beim Anblick der Zahlenkombinationen ging es mir besser. »Ich kann dieses Medikament praktisch summen«, sagte ich. »Soll ich?«
»Nein, danke. Also, Mr. Rosen, für den Fall, dass die medikamentöse Behandlung bei Ihnen nicht anschlägt, können wir es immer noch mit einer Lobotomie im Bereich der Temporallappen versuchen, selbstverständlich gestützt auf ein sorgfältiges Brainmapping, das in der Universitätsklinik von San Francisco oder Mount Zion durchgeführt werden müsste – wir sind dafür nicht ausgestattet. Ich persönlich würde das ja vermeiden wollen, da es sich oft herausstellt, dass der beteiligte Abschnitt der Temporallappen unverzichtbar ist. In den staatlichen Kliniken ist man längst wieder davon abgekommen, wissen Sie.«
»Ich würde mir eine Lobotomie auch lieber ersparen. Freunde von mir haben eine machen lassen… aber mir verursacht das eine Gänsehaut. Darf ich Sie etwas fragen, Doktor? Haben Sie vielleicht zufällig ein Medikament, das von der Wirkung her dem Chorsatz von Beethovens Neunter auf der Stimmungsorgel entspricht?«
»Da müsste ich nachsehen.«
»Wenn ich auf der Stimmungsorgel spiele, berührt mich besonders die Stelle, an der der Chor singt: ›Muss ein lieber Vater wohnen‹. Und dann, wie Engel, die Geigen und die Sopranstimmen des Chors antworten: ›Überm Sternenzelt‹.«
»So genau bin ich damit nicht vertraut.«
»Diese Stelle jedenfalls – wenn Sie eine pharmakologische Entsprechung finden würden, davon könnte ich enorm profitieren.«
Horstowski zog eine dicke Mappe aus dem Regal und blätterte sie durch. »Ich fürchte, ich kann kein Medikament finden, das Ihren Wünschen entspricht. Vielleicht wenden Sie sich einmal an die Ingenieure bei Hammerstein.«
»Gute Idee.«
»Nun noch zu Ihrem Verhältnis zu Pris. Ich glaube, Sie übertreiben, wenn Sie meinen, dass sie eine Bedrohung darstellt. Schließlich steht es Ihnen doch frei, nichts mit ihr zu tun zu haben, oder?« Er sah mich verschmitzt an.
»Ja, denke schon.«
»Pris hat Sie herausgefordert. Sie provoziert gern. Ich könnte mir vorstellen, dass es den meisten Menschen, die mit ihr zu tun haben, genauso geht wie Ihnen. Das ist Pris’ Art, sie zu einer Reaktion zu zwingen. Es geht vermutlich Hand in Hand mit ihrer naturwissenschaftlichen Veranlagung – eine Art Neugierde, sie will wissen, wie die Menschen ticken.«
»Nun, in diesem Fall hat sie das Objekt beinahe umgebracht, während sie es erforschte.«
»Bitte?« Horstowski hielt eine Hand hinters Ohr. »Ach so, Objekt, ja. Sie nimmt andere manchmal als ein solches wahr. Aber ich würde mir das nicht so zu Herzen nehmen. Leben wir nicht in einer Gesellschaft, in der Distanziertheit beinahe lebensnotwendig ist?« Er kritzelte etwas in seinen Terminkalender. »Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Pris denken.«
»Milch.«
»Milch?« Er lüpfte eine Augenbraue. »Interessant. Milch…«
»Ich werde nicht wiederkommen. Sie brauchen mir gar keinen neuen Termin geben.« Ich nahm das Terminkärtchen, das er mir reichte, trotzdem. »Wissen Sie, das war kein Witz, als ich gesagt habe, dass ich so ein Simulacrum bin. Es hat einmal einen Louis Rosen gegeben, aber jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch mich. Und wenn mir etwas zustößt, nehmen Pris und Maury meine gespeicherten Erinnerungen und stellen eine neue Louis Rosen her. Den Körper fertigt Pris aus Badezimmerkacheln an. Er ist ziemlich gut, nicht? Sie sind darauf reingefallen und mein Bruder Chester und beinahe auch mein Vater. Das ist der eigentliche Grund, warum er so unglücklich ist – er hat die Wahrheit erkannt.« Damit verabschiedete ich mich und verließ die Praxis. Sie aber, fügte ich noch in Gedanken hinzu, Sie kommen da nie drauf, Doktor Horstowski, in tausend Jahren nicht. Ich bin gut genug, um Sie und Ihresgleichen reinzulegen.
Ich stieg in meinen Chevrolet Magic Fire und fuhr ins Büro zurück.
Sechs
Nachdem ich Doktor Horstowski erzählt hatte, dass ich ein Simulacrum sei, ließ mich die Vorstellung nicht mehr los. Früher hatte es einmal einen echten Louis Rosen gegeben, aber nun war er tot, und ich nahm seine Stelle ein und täuschte damit jeden, mich eingeschlossen.
Natürlich wusste ich auf einer anderen Ebene, dass es ein völlig absurder Gedanke war, nur ein Haufen Unsinn, den ich mir aufgrund meiner feindseligen Gefühle Doktor Horstowski gegenüber ausgedacht hatte. Dennoch brachte mich diese Vorstellung dazu, gleich nach meinem Termin bei Horstowski die Edwin M. Stanton zu besuchen. Ich fragte Maury, wo die Maschine war.
»Bundy speist gerade neue Daten ein«, sagte Maury. »Pris ist über eine Stanton-Biografie gestolpert, die einiges neues Material beinhaltet.«
Bundy war in der Werkstatt. Er setzte die Stanton gerade wieder zusammen und stellte ihr dabei Fragen. »Andrew Johnson ließ die Union im Stich aufgrund seiner Unfähigkeit, die rebellischen Staaten als…« Er brach ab, als er mich sah. »Hallo, Rosen.«
»Ich würde gern mit der Maschine reden.«
Bundy ließ mich mit der Stanton allein. Sie saß, ein Buch im Schoß, in einem braunen Sessel und sah mich ernst an.
»Erinnern Sie sich an mich, Sir?«
»Ja, das tue ich. Sie sind Mr. Louis Rosen aus Boise, Idaho. Ich erinnere mich an den netten Besuch bei Ihrem Herrn Vater. Geht es ihm gut?«
»Nicht so gut, wie ich es mir wünschen würde.«
»Wie schade.«
»Sir, ich würde Sie gern etwas fragen. Kommt es Ihnen nicht merkwürdig vor, dass Sie, obwohl Sie um 1800 herum geboren wurden, 1982 immer noch am Leben sind? Und kommt es Ihnen nicht merkwürdig vor, dass Sie dann und wann abgeschaltet werden? Und dass Sie aus Transistoren und Relais bestehen? So sind Sie früher nicht gewesen – 1800 gab es noch keine Transistoren und Relais.«
»Ja, das ist in der Tat merkwürdig. Ich habe hier ein Buch, das sich mit der Wissenschaft der Kybernetik befasst. Diese Wissenschaft bringt ein wenig Licht in das Dunkel meines Falls.«
»Ihres Falls?«
»Ja. Während meines Aufenthalts bei Ihrem Vater habe ich einige verwirrende Themen mit ihm erörtert. Wenn ich die kurze Spanne meines Lebens betrachte, die von der Ewigkeit davor und danach begrenzt, ja verschluckt wird, den winzigen Raum, den ich ausfülle, der in der Unendlichkeit von Räumen untergeht, die ich nicht kenne und die mich nicht kennen, dann bekomme ich es mit der Angst.«
»Verständlicherweise.«
»Ich bekomme es mit der Angst, und ich wundere mich, dass ich mich hier und nicht dort befinde. Denn es gibt keinen Grund, warum ich hier und nicht dort sein sollte oder jetzt und nicht irgendwann.«
»Und sind Sie zu einem Schluss gekommen?«
Die Stanton räusperte sich, zog ein Stofftaschentuch hervor und säuberte sich sorgfältig die Nase. »Es scheint mir, dass die Zeit in Sprüngen vonstatten geht und dazwischenliegende Epochen auslässt. Aber warum sie das tut oder wie, das weiß ich nicht. Ab einem gewissen Punkt vermag der Geist die Dinge nicht weiter zu durchdringen.«
»Wollen Sie meine Theorie hören?«
»Sehr gerne.«
»Ich behaupte, dass es keinen Edwin M. Stanton oder Louis Rosen gibt. Es gab sie einmal, aber sie sind tot. Wir sind Maschinen.«
Die Stanton sah mich an, das runde Gesicht leicht verknittert. »Daran könnte etwas Wahres sein.«
»Und Maury Rock und Pris Frauenzimmer haben uns entworfen, und Bob Bundy hat uns gebaut. Und im Augenblick arbeiten sie an einem Abraham-Lincoln-Simulacrum.«
Jetzt verdüsterte sich das runde, zerknitterte Gesicht. »Mr. Lincoln ist tot.«
»Ich weiß.«
»Sie meinen, sie holen ihn wieder zurück?«
»Ja.«
»Warum?«
»Um Mr. Barrows zu beeindrucken.«
»Wer ist Mr. Barrows?« Die Stimme der Stanton klang kratzig.
»Ein Multimillionär aus Seattle, Washington. Er hat den Mond parzelliert.«
»Haben Sie je von Artemus Ward gehört?«
»Nein, Sir.«
»Wenn Sie Mr. Lincoln wieder ins Leben zurückholen, werden Sie sich zahllose humoristische Zitate aus den Schriften von Artemus Ward anhören müssen.« Mit diesen Worten nahm die Stanton ihre Lektüre wieder auf. Ihr Gesicht war gerötet, ihre Hände zitterten.
Offensichtlich hatte ich das Falsche gesagt.
Tatsächlich wusste ich kaum etwas über Edwin M. Stanton. Da in unserer Zeit jeder Abraham Lincoln bewundert, war es mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass die Stanton anders empfinden konnte. Aber man lernt eben nie aus. Immerhin hatten sich die Ansichten der Maschine vor über einem Jahrhundert entwickelt.
Ich verabschiedete mich – die Stanton nickte, ohne aufzusehen – und ging die Straße hinunter zur Bücherei. Kurz darauf hatte ich die entsprechenden Bände der Encyclopaedia Britannica vor mir liegen und schlug unter ›Lincoln‹, ›Stanton‹ sowie ›Amerikanischer Bürgerkrieg‹ nach.
Der Eintrag zu Stanton war kurz, aber sehr aufschlussreich. Stanton hatte Lincoln zunächst nicht ausstehen können; er war Mitglied der Demokraten gewesen und hatte nichts für die neue Republikanische Partei übrig gehabt. Stanton wurde als ziemlich streng beschrieben, was mir bereits aufgefallen war, und der Eintrag wusste von zahlreichen Auseinandersetzungen mit Generälen, vor allem mit Sherman, zu berichten. Aber, so hieß es weiter, er hatte unter Lincoln gute Arbeit verrichtet, hatte betrügerische Zulieferer in die Wüste geschickt und für eine gute Ausrüstung der Truppen gesorgt. Und am Ende der Feindseligkeiten hatte er 800.000 Mann aus dem Kriegsdienst entlassen – keine schlechte Leistung nach einem blutigen Bürgerkrieg.
Der Ärger hatte erst nach Lincolns Tod so richtig begonnen. Zwischen Stanton und Präsident Johnson war es eine Zeit lang hoch hergegangen. In dieser Zeit hatte es so ausgesehen, als würde der Kongress die Macht übernehmen und als einzige Staatsgewalt bestehen bleiben. Während ich den Eintrag las, bekam ich eine ziemlich gute Vorstellung von Stanton: Er war eine richtige Kämpfernatur; er war jähzornig und besaß eine scharfe Zunge; es hatte nicht viel gefehlt, und er hätte Johnson abgesetzt und sich zu einer Art Diktator aufgeschwungen. Aber die Britannica führte auch aus, dass er ein zutiefst aufrichtiger Mensch und überzeugter Patriot gewesen war.
Während ich die Lexikonbände zurück ins Regal stellte, stieß ich einen Seufzer der Erleichterung aus. Schon allein diese kurzen Einträge vermittelten ein Bild der giftgetränkten Atmosphäre, die damals vorgeherrscht hatte. Die Intrigen und der Hass hatten etwas vom Russland des Mittelalters, oder besser: vom Russland unter Stalin.
Auf dem Weg zurück ins Büro dachte ich: sympathischer älterer Herr – von wegen. Das Rock-Frauenzimmer-Kombinat hatte nicht nur einen Menschen wieder zum Leben erweckt, sondern eine beängstigende Geisteshaltung aus einem düsteren Kapitel in der Geschichte unseres Landes. Sie hätten besser eine Zachary-Taylor-Maschine produzieren sollen. Zweifellos war es Pris – ihr pervertierter, nihilistischer Verstand –, die diese Wahl aus Abertausenden, ja Millionen von Möglichkeiten getroffen hatte. Warum nicht Sokrates? Warum nicht Gandhi?
Und nun wollten sie ein zweites Simulacrum ins Leben rufen: jemanden, gegen den Edwin M. Stanton einige Animositäten hegte. Wie dumm konnte man sein!
Ich ging in die Werkstatt und fand die Stanton immer noch lesend vor; sie hatte das Kybernetikbuch fast durch. Keine drei Meter entfernt lag der Haufen halb fertiger Schaltkreise, der einmal die Abraham Lincoln werden sollte. War das der Stanton klar? Sah sie zwischen diesem Durcheinander von Bauteilen und dem, was ich gesagt hatte, eine Verbindung? Ich warf einen verstohlenen Blick auf die neue Maschine. Sie machte nicht den Eindruck, als hätte jemand – oder etwas – daran irgendwelche Manipulationen vorgenommen. Bundys sorgfältige Arbeitsweise war zu erkennen, nichts anderes. Wenn die Stanton sich in meiner Abwesenheit an ihr zu schaffen gemacht hätte, wären bestimmt einige zerbrochene oder verschmorte Teile zu erkennen gewesen – ich sah nichts dergleichen.
Pris, überlegte ich, war vermutlich zu Hause und trug gerade lebensechte Farbe auf die Wangen der Abraham-Lincoln-Hülle auf, die diese ganzen Teile bald in sich tragen würde. Der Bart, die großen Hände, die dünnen Beine, die traurigen Augen – da konnte sich Pris’ künstlerische Seele austoben. Sie würde hier nicht auftauchen, bevor sie nicht erstklassige Arbeit verrichtet hatte.
Ich ging nach oben und baute mich vor Maury auf. »Hör zu, mein Freund. Die Stanton wird Abe ordentlich eins überbraten. Oder habt ihr euch etwa nicht die Mühe gemacht, die Geschichtsbücher zu lesen? Doch, natürlich musstet ihr die Bücher lesen, um die Datensätze zusammenzustellen. Also wisst ihr, wie die Stanton Lincoln gegenüber empfindet. Ihr wisst, dass sie die Lincoln wahrscheinlich kurz und klein schlagen wird.«
Maury legte die Post beiseite und seufzte. »Misch dich nicht in Entscheidungen ein, die längst getroffen sind. Erst war es meine Tochter, jetzt ist es die Stanton. Ständig lauert irgendein Schrecken hinter der Ecke. Du hörst dich schon an wie eine alte Jungfer, weißt du das? Komm, lass mich arbeiten.«
Ich ging wieder hinunter in die Werkstatt. Die Stanton hatte ihr Buch ausgelesen und dachte nach. »Junger Mann«, sagte sie, als sie mich sah, »geben Sie mir bitte mehr Informationen über diesen Barrows. Sie sagten, er lebt in der Hauptstadt unserer Nation…«
»Nein, Sir. Im Staat Washington.« Ich erklärte ihr, wo Washington lag.
»Und trifft es zu, wie Mr. Rock sagt, dass dieser Barrows durch seinen Einfluss dafür gesorgt hat, dass die Weltausstellung in diese Stadt kam?«
»Ja, habe ich gehört. Natürlich gibt es bei einem so reichen und exzentrischen Menschen immer alle möglichen Gerüchte.«
»Ist diese Ausstellung noch im Gange?«
»Nein, das ist Jahre her.«
»Ein Jammer. Ich hätte sie gern besucht.«
Irgendwie rührte mich das zutiefst. Mein erster Eindruck von ihr bestätigte sich erneut: dass sie in vielerlei Hinsicht – Gott steh uns bei! – menschlicher war als wir, als Pris oder Maury oder sogar ich, Louis Rosen. Nur mein Vater stand mit all seiner Würde über ihr. Doktor Horstowski – nur ein teilweise menschliches Wesen, das neben diesem Simulacrum ziemlich mickrig aussah. Und was war mit Barrows? Wie würde er sich im Vergleich mit der Stanton machen, wenn sie einander gegenüberstanden?
Dann dachte ich: Und die Lincoln? Was wird sie uns für ein Gefühl geben, wie werden wir neben ihr aussehen?
»Ich würde gerne Ihre Meinung über Miss Frauenzimmer wissen, Sir. Wenn Sie die Zeit erübrigen können.«
»Durchaus, Mr. Rosen.«
Ich setzte mich ihr gegenüber auf einen Lkw-Reifen.
»Ich kenne Miss Frauenzimmer schon eine geraume Zeit. Ich bin mir nicht sicher, wie lange genau, aber wir sind einander wohlbekannt. Tatsächlich wohne ich derzeit bei den Frauenzimmers. Sie hat kürzlich die Kasanin-Nervenklinik in Kansas City verlassen und ist zu ihrer Familie zurückgekehrt. Sie hat hellgraue Augen und ist ein Meter achtundsechzig groß. Ihr Gewicht beträgt gegenwärtig sechzig Kilogramm. Sie hat Gewicht verloren, habe ich mir sagen lassen. Ich kann mich nicht erinnern, sie je anders als bildschön erlebt zu haben. Nun zu ihren inneren Qualitäten: Ihre Abstammung ist, wenngleich eingewandert, von der besten Sorte. In ihr lebt die amerikanische Vision, die da lautet, dass ein Mensch allein durch seine Fähigkeiten begrenzt wird und zu jedweder gesellschaftlichen Position aufsteigen kann, die diesen Fähigkeiten entspricht. Daraus ist natürlich nicht zu schließen, dass alle Menschen gleichermaßen aufsteigen werden, weit gefehlt. Aber Miss Frauenzimmer hat durchaus recht darin, alles abzulehnen, was ihren Fähigkeiten nicht entgegenkommt.«
»Das hört sich an, als ob Sie ziemlich lange über sie nachgedacht haben.«
»Dieses Thema verdient auch einiges Nachdenken.« Die Augen der Maschine funkelten kurz. »Miss Frauenzimmer ist im Grunde ihres Herzens ein guter Mensch. Sie wird ihren Weg gehen. Natürlich ist sie voller Ungeduld, voller Zorn. Aber der Zorn ist der Amboss der Gerechtigkeit, auf dem die harten Tatsachen des Lebens geschmiedet werden. Menschen ohne Zorn sind wie Tiere ohne Leben, er ist der Funke, der einen Klumpen Fell, Fleisch, Knochen und Fett in eine lebendige Äußerung des Schöpfers verwandelt.«
Ich musste zugeben, dass mich dieser Vortrag ziemlich beeindruckte.
»Was mir an Priscilla Sorgen bereitet, ist nicht ihr Feuer und ihr Mut, beileibe nicht. Wenn sie ihrem Herzen vertraut, geht sie nicht fehl. Doch sie hört nicht immer auf ihr Herz. Ich sage das nicht gern, aber sie schenkt oft ihrem Kopf zu viel Beachtung. Das macht mir Sorgen.«
»Aha.«
»Ja. Denn die Logik einer Frau ist nicht die Logik des Philosophen. Sie ist ein bleicher Schatten dessen, was das Herz weiß, und als Schatten ist sie kein verlässlicher Ratgeber. Frauen, die auf ihren Verstand statt auf ihr Herz hören, verfallen leicht in Irrtümer, und dies mag sich in Priscilla Frauenzimmers Fall allzu rasch erweisen. Wenn sie nur auf ihren Verstand horcht, breitet sich eine große Kälte in ihr aus.«
»Meinen Sie?«
»Ja.« Die Stanton nickte und wackelte mit dem Zeigefinger. »Auch Sie, Mr. Rosen, haben diesen Schatten bemerkt, diese eigentümliche Kälte, die von Miss Frauenzimmer ausgeht. Und ich sehe, dass er Ihrem Herzen ebenso Kummer bereitet wie meinem. Wie sie damit in Zukunft zurechtkommen wird, weiß ich nicht, aber sie wird damit zurechtkommen müssen. Denn ihr Schöpfer wollte, dass sie mit sich zurechtkommt, und gegenwärtig vermag sie diesen Teil von ihr nicht mit Nachsicht zu betrachten, diese kalte, ungeduldige, vernünftige, berechnende Seite ihres Charakters. Sie besitzt, was viele von uns in ihrem Inneren finden: die Tendenz, einer dürftigen, bornierten Philosophie das Eindringen in den Alltag zu gestatten. Nichts ist gefährlicher als dieses uralte Gemisch aus Meinung, Glaube, Vorurteil und längst verworfenen wissenschaftlichen Ansichten – diese überkommenen Rationalismen bilden den sterilen, stumpfen Ursprung ihrer Handlungen. Dabei könnte sie, wäre sie nur bereit dazu, den individuellen und gesunden Ausdruck ihres eigenen Herzens hören.«
Damit beendete die Stanton ihre kleine Rede zum Thema Pris. Woher hatte sie sie nur? Sich ausgedacht? Oder hatte Maury sie als Datei eingespeist, damit sie für eine solche Gelegenheit bereitlag? Nur dass sie ganz und gar nicht nach Maury klang… War etwa Pris selbst dafür verantwortlich? War es ihre bittere Ironie, die sie bewog, der Maschine eine so treffende Analyse ihrer Persönlichkeit in den Mund zu legen? Wenn es so war, dann war der schizophrene Prozess in ihr immer noch im Gange.
»Vielen Dank«, sagte ich. »Ich muss gestehen, ich bin sehr davon beeindruckt, was Sie da so einfach aus dem Stegreif gesagt haben.«
»Aus dem Stegreif?«
»Ohne Vorbereitung.«
»Aber dies entsprang langer Vorbereitung. Ich mache mir ernsthafte Sorgen um Miss Frauenzimmer.«
»Ich auch.«
»Doch nun wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir etwas über Mr. Barrows erzählen könnten. Soweit ich weiß, hat er Interesse an mir bekundet.«
»Ich besorge Ihnen den Look-Artikel. Tatsächlich bin ich ihm nie begegnet, aber ich habe vor Kurzem mit seiner Sekretärin gesprochen und ich habe einen Brief von ihm…«
»Dürfte ich den Brief sehen?«
»Ich bringe ihn morgen mit.«
»Hatten Sie auch den Eindruck, dass Mr. Barrows an mir interessiert ist?«
»Ich… denke schon.«
»Sie zögern.«
»Sie sollten selbst mit ihm reden.«
»Ja.« Die Stanton kratzte sich am Nasenflügel. »Ich werde Mr. Rock oder Miss Frauenzimmer bitten, mich dorthin zu befördern und mir dabei behilflich zu sein, Mr. Barrows persönlich kennenzulernen.« Sie nickte, als wollte sie ihre Entscheidung damit unterstreichen.
Sieben
Die Stanton hatte also beschlossen, Sam K. Barrows zu besuchen. Blieb nur noch die Frage des geeignetsten Zeitpunkts.
Unterdessen näherte sich das Abraham-Lincoln-Simulacrum seiner endgültigen Fertigstellung. Maury setzte den ersten Test für das folgende Wochenende an. Dann würde der Innenteil komplett montiert und ins Gehäuse eingesetzt sein.
Als Pris und Maury dann die Lincoln-Hülle ins Büro brachten, war ich ziemlich geplättet. Selbst in inaktivem Zustand war sie so lebensecht, dass man den Eindruck hatte, sie würde jeden Moment aufstehen und loslegen. Pris und Maury trugen das Ding mit Bob Bundys Hilfe in die Werkstatt; ich folgte ihnen und sah zu, wie sie es auf die Werkbank legten.
»Das muss ich dir lassen, Pris…«, sagte ich.
Mit den Händen in den Manteltaschen stand sie düster da. Ihre Augen lagen tief in den Höhlen und sie war sehr blass – sie hatte kein Make-up aufgelegt und vermutlich die letzten Nächte durchgearbeitet, um rechtzeitig fertig zu werden. Außerdem hatte sie abgenommen; sie wirkte jetzt regelrecht dünn. Unter dem Mantel trug sie Jeans und ein gestreiftes T-Shirt. Sie schaukelte auf ihren Absätze vor und zurück und biss sich auf die Lippe.
»… du hast erstklassige Arbeit geleistet.«
Sie sah mich an. »Louis, bring mich hier raus. Irgendwohin. Spendier mir einen Kaffee, oder lass uns einfach Spazierengehen.« Sie ging zur Tür, und nach einem Moment des Zögerns folgte ich ihr.
Wir schlenderten den Gehweg hinunter. Pris kickte einen kleinen Stein vor sich her. »Die Erste war gar nichts«, sagte sie, »verglichen mit dieser. Stanton ist niemand besonderes und doch hat er uns fast überfordert. Ich habe zu Hause ein Buch mit jedem Foto, das jemals von Lincoln gemacht wurde. Ich habe sie studiert, bis ich sein Gesicht besser kannte als mein eigenes.« Sie ließ den Stein in einen Gully fallen. »Kaum zu glauben, wie gut diese alten Fotografien sind. Man benutzte damals Glasplatten, und der zu Porträtierende musste ganz still sitzen. Man hatte besondere Stühle dafür, mit denen man den Kopf fixierte, damit er nicht wackelt.« Sie blieb stehen. »Wird er wirklich zum Leben erwachen?«
»Keine Ahnung, Pris.«
»Es ist alles Selbstbetrug. Wir können nichts Totes lebendig machen.«
»Ist es das, worum es dir geht? Wenn du es so formulierst, stimme ich dir zu. Aber es klingt, als wärst du emotional zu sehr involviert. Am besten, du machst einen Schritt zurück.«
»Dann erschaffen wir also nur eine Nachbildung, die herumläuft und redet wie das Original? Der Geist ist nicht da, nur die Erscheinung?«
»Ja.«
»Bist du je zu einer katholischen Messe gegangen, Louis?«
»Nein.«
»Sie glauben, dass Brot und Wein wirklich das Fleisch und das Blut Jesu sind. Dass es ein Wunder ist. Wer weiß, wenn wir die Speicher perfekt hinkriegen und die Stimme und das äußere Erscheinungsbild und…«
»Ich hätte nie gedacht, einmal zu erleben, wie du Angst hast.«
»Ich habe keine Angst. Es ist bloß alles zu viel für mich. In der Junior Highschool war Lincoln mein Held, ich habe sogar ein Referat über ihn gehalten. Du weißt, wie das als Kind ist – alles, was du in einem Buch liest, gibt es wirklich. Für mich gab es Lincoln wirklich. Aber natürlich habe ich ihn mir nur herbeiphantasiert. Ich brauchte Jahre, um diese Phantasien wieder abzuschütteln, Phantasien über die Kavallerie der Unionisten, über Schlachten, über Ulysses S. Grant… Nun ja, du weißt schon.«
»Ja.«
»Glaubst du, eines Tages wird jemand von dir und mir Simulacra herstellen? Und wir müssen wieder zum Leben erwachen?«
»Eine reichlich morbide Vorstellung.«
»Da sind wir dann, tot, ohne jede Sinneswahrnehmung – und auf einmal fühlen wir eine Regung. Sehen vielleicht ein wenig Licht. Und dann prasselt alles auf uns ein, die ganze Wirklichkeit. Und wir können den Prozess nicht aufhalten, wir sind gezwungen, zurückzukommen. Wiederaufzuerstehen!« Pris erschauderte.
»Aber das macht ihr ja gar nicht, das ist etwas ganz anderes. Du musst in deinem Kopf den echten Lincoln von dieser…«
»Aber in meinem Kopf existiert der echte Lincoln.«
»Das glaubst du doch nicht im Ernst. Was willst du denn damit sagen? Du meinst, du hast die Vorstellung in deinem Kopf.«
Sie sah mich an. »Nein, Louis, ich habe wirklich Lincoln in meinem Kopf. Und ich habe nächtelang daran gearbeitet, ihn dort herauszubekommen, zurück in die Welt.«
Ich musste lachen.
»Eine ziemlich schreckliche Welt ist das, in die ich ihn bringe. Aber ich sag dir mal was, ich weiß da einen Weg, diese Wespen loszuwerden, die einen immer piesacken. Es ist ganz leicht, man braucht nur einen Eimer Sand.«
»Aha.«
»Man wartet, bis es dunkel ist, dann sind alle Wespen in ihrem Nest und schlafen. Man geht hin und gießt den Sand darüber aus. Und jetzt pass auf. Du denkst natürlich, dass der Sand sie erstickt. Aber so ist es nicht. Tatsächlich passiert Folgendes: Am nächsten Morgen wachen die Wespen auf und stellen fest, dass ihr Eingang versperrt ist, also beginnen sie, den Sand wegzuschaffen. Doch sie können ihn nirgendwo anders hintragen als in andere Teile des Baus. Und je mehr Sand sie vom Eingang wegschaffen, desto mehr fällt herunter.«
»Verstehe.«
»Ist das nicht furchtbar?«
»Ja.«
»Sie füllen ihr eigenes Nest langsam mit Sand. Und je härter sie arbeiten, um den Eingang freizulegen, desto schneller ist es vorbei – sie ersticken. Es ist wie eine orientalische Folter. Als ich das gehört habe, Louis, wäre ich am liebsten gestorben. Ich will nicht in einer Welt leben, in der so etwas möglich ist.«
»Wann hast du von dieser Methode erfahren?«
»Vor Jahren, ich glaube, ich war sieben. Ich habe mir immer vorgestellt, wie es in dem Nest wäre. Ich würde schlafen.« Sie griff plötzlich nach meinem Arm und kniff die Augen zu. »In tiefster Dunkelheit. Überall um mich herum andere wie ich. Dann – wuusch. Ein Geräusch, jemand kippt den Sand aus. Aber wir wissen nicht, was es bedeutet, wir schlafen alle weiter.« Sie ließ sich jetzt von mir den Gehweg entlangführen. »Wir schlafen und schlafen, die ganze Nacht lang, weil es kalt ist. Dann kommt die Sonne, und der Boden wird warm. Aber immer noch ist es dunkel. Wir wachen auf. Warum gibt es kein Licht? Wir gehen zum Eingang. Er ist blockiert, von diesen seltsamen Körnern. Wir haben Angst. Was ist los? Wir packen alle mit an, versuchen, nicht in Panik zu geraten. Wir verbrauchen den Sauerstoff nur langsam, organisieren uns in Teams, arbeiten ruhig, effizient. Aber wir werden kein Tageslicht mehr sehen, egal, wie viele Sandkörner wir wegschaffen. Wir arbeiten und warten, doch es kommt nicht. Nie wieder.« Sie öffnete die Augen wieder und sagte mit erstickter Stimme: »Wir sterben, Louis. Dort in unserem Nest.«
Ich nahm ihre Hand in meine. »Wie wäre es mit einem Kaffee?«
»Nein, ich möchte nur Spazierengehen… Diese Insekten, Louis, Wespen und Ameisen – sie machen ganz viel da in ihren Nestern. Das ist äußerst komplex.«
»Ja, bei Spinnen auch.«
»Vor allem bei Spinnen. Ich habe mich gefragt, was eine Spinne empfindet, wenn ihr jemand das Netz zerreißt.«
»Sie sagt wahrscheinlich ›Mist‹.«
»Nein. Zuerst ist sie sauer – doch dann kommt diese furchtbare Verzweiflung über sie. Sie begreift, dass ihr auch das nächste Netz wieder zerstört werden wird.«
»Und trotzdem bauen Spinnen immer wieder das Nächste.«
»Ja, sie können nicht anders, es liegt in ihren Genen. Darum sind sie schlechter dran als wir – sie können nicht einfach aufgeben und sterben, sie müssen immer weitermachen.«
»Weißt du, du solltest ab und zu mal auch an die schönen Seiten des Lebens denken. Du leistest erstklassige Arbeit – die Mosaiken, die Simulacra –, vergiss das nicht. Erfüllt es dich nicht mit Freude zu sehen, was deine Kreativität vermag?«
»Nein. Es spielt keine Rolle. Es reicht nicht.«
»Was würde denn reichen?«
Pris entzog ihre Finger den meinen. Es wirkte automatisch, sie schien es nicht mit Absicht zu machen. Ein Reflex, dachte ich. Wie bei Spinnen. »Ich weiß nicht. Aber eines weiß ich, egal wie hart ich arbeite oder wie lange oder was dabei herauskommt – es wird nie reichen.«
»Wer sagt das?«
»Ich sage das.«
»Du meinst, wenn du nachher zusiehst, wie die Lincoln zum Leben erwacht, wirst du keinen Stolz empfinden?«
»Ich weiß, was ich empfinden werde – noch größere Verzweiflung als vorher.«
Ich sah sie an. Warum das denn?, fragte ich mich. Verzweiflung angesichts eines Erfolgs – das ist doch Unsinn. Was würdest du dann empfinden, wenn du versagst? Begeisterung? »Ich erzähl dir eine Geschichte, Pris. Hör gut zu.«
»Okay.«
»Eines Tages wollte ich in einer kleinen Stadt in Kalifornien ein Postamt betreten, in dessen Dachvorsprüngen Vögel nisteten, da sah ich, dass ein kleiner Vogel aus seinem Nest gefallen oder geflogen war. Er saß auf dem Gehsteig, und seine Eltern flogen ängstlich umher. Ich ging zu ihm in der Vorstellung, ihn aufzuheben und zurück ins Nest zu setzen. Weißt du, was der Vogel gemacht hat?«
»Was denn?«
»Er hat seinen Schnabel aufgerissen – damit ich ihn füttere.«
Pris zog eine Augenbraue hoch.
»Verstehst du? Der Vogel kannte nur Lebensformen, die ihn fütterten und beschützten, und als er mich sah – eine völlig andere Lebensform, wie er nie eine gesehen hatte –, nahm er an, dass auch ich ihn füttern würde.«
»Und was heißt das?«
»Dass es in der Natur nicht nur Kälte und Schrecken gibt, sondern auch Wohlwollen und Freundlichkeit und gegenseitige Liebe und selbstlose Hilfe.«
»Nein, Louis, aufseiten des Vogels war es Unwissenheit. Du hast ihn ja nicht gefüttert.«
»Aber ich habe ihm geholfen. Er hatte recht darin, mir zu vertrauen.«
»Ich wünschte, ich könnte diese Seite des Lebens sehen. Aber für mich… ist es einfach nur Unwissenheit.«
»Unschuld.«
»Das ist das Gleiche. Aber es wäre toll, wenn du dir das bewahren könntest. Ich wünschte, ich hätte es mir bewahrt. Doch im Laufe des Lebens verliert man diesen Blick, denn Leben heißt Erfahrung sammeln, und Erfahrungen…«
»Jetzt wirst du aber zynisch.«
»Nein, ich bin bloß realistisch.«
»Okay, ich sehe es ja ein, es ist hoffnungslos. Zu dir kann niemand durchdringen. Und weißt du, warum? Weil du so sein willst, wie du bist. Du findest es gut so. Du bist faul, auf eine furchtbare Weise faul, und du wirst so weitermachen, bis du zu einer Veränderung gezwungen bist. Von allein wirst du dich nie ändern. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer werden mit dir.«
Pris lachte – ein scharfes, kaltes Lachen.
Schweigend gingen wir zurück.
Als wir in die Werkstatt kamen, arbeitete Bob Bundy gerade an der Lincoln.
»Das wird der Mann, der Ihnen immer diese ganzen Briefe wegen der Amnestierung von Soldaten geschickt hat«, sagte Pris zu der Stanton, deren Blick fest auf das entstehende Simulacrum gerichtet war.
»Darüber bin ich mir im Klaren«, erwiderte sie. Sie räusperte sich geräuschvoll und verschränkte die Hände hinter dem Rücken, wiegte sich vor und zurück. Das hier geht mich etwas an, schien ihre Haltung auszudrücken. Alles von öffentlicher Bedeutung geht mich etwas an.
Sie verhält sich nun so, ging es mir durch den Kopf, wie in ihrem früheren, authentischen Leben. Sie kehrt zu ihrer gewohnten Pose zurück. Ob das gut war oder nicht, vermochte ich nicht zu sagen. Jedenfalls waren wir uns beim Betrachten der Lincoln stets der Stanton in unserem Rücken bewusst, und vielleicht war es mit Stanton früher immer so gewesen – man konnte ihn einfach nicht ignorieren, ganz egal, wie man ihm gegenüber empfand, ob man ihn nun hasste oder fürchtete oder verehrte.
»Maury, ich glaube, die hier funktioniert jetzt schon besser als die Stanton«, sagte Pris unvermittelt. »Schau, sie bewegt sich.«
Ja, die auf dem Bauch liegende Lincoln hatte sich bewegt.
Pris rang aufgeregt die Hände. »Sam Barrows müsste hier sein. Wenn er sie sehen könnte, wäre er überwältigt – das weiß ich genau. Sogar er, Maury, sogar Sam K. Barrows!«
Es war zweifellos beeindruckend.
»Ich weiß noch, wie unsere erste Elektroorgel fertig war«, wandte sich Maury an mich. »Und wir alle darauf gespielt haben, den ganzen Tag lang, bis um ein Uhr morgens. Weißt du noch?«
»Ja.«
»Du und ich und Jerome und dein Bruder, wir haben das verdammte Ding wie ein Cembalo klingen lassen und eine Hawaiigitarre und eine Dampforgel. Wir haben alles mögliche Zeug darauf gespielt, Bach und Gershwin. Und dann haben wir uns eigene Kompositionen ausgedacht, und wir haben alle möglichen Sorten von Klangeinstellungen gefunden, Tausende, haben uns Musikinstrumente ausgedacht, die es gar nicht gab. Wir haben komponiert! Und wir haben dieses Aufnahmegerät geholt und mitlaufen lassen. Junge, das war was.«
»Ja, das war wirklich was.«
»Und ich habe mich auf den Boden gelegt und die Fußpedale bedient, mit denen man diese tiefen Noten macht – beim tiefen G bin ich weggetreten, wenn ich mich recht entsinne. Zu viel Drinks. Und die Orgel hat immer weitergespielt. Als ich am nächsten Morgen wieder zu mir kam, dröhnte dieses verfluchte tiefe G immer noch wie ein Nebelhorn. Wow! Diese Orgel – wo die jetzt wohl ist, Louis?«
»In irgendeinem Wohnzimmer. Sie nutzen sich ja nicht ab, weil sie keine Wärme erzeugen. Und sie müssen nie gestimmt werden. Irgendjemand spielt darauf gerade irgendeine Melodie.«
»Bestimmt.«
»Helft ihr, sie aufzusetzen«, sagte Pris.
Mühsam versuchte die Lincoln-Maschine in eine sitzende Position zu kommen. Sie blinzelte, zog Grimassen; ihre groben Züge waren in Bewegung. Maury und ich stützten sie. Wie schwer sie war, wie massives Blei. Aber schließlich bekamen wir sie hoch und lehnten sie gegen die Wand, damit sie nicht wieder umkippte.
Sie ächzte.
Irgendetwas an dem Ton verursachte mir eine Gänsehaut. Ich sah Bundy an. »Was meinen Sie? Ist alles in Ordnung mit ihr? Sie leidet doch nicht, oder?«
»Keine Ahnung.« Bundy fuhr sich nervös mit den Fingern durch die Haare; mir fiel auf, dass seine Hände zitterten. »Ich kann sie ja noch mal durchchecken. Die Schmerzschaltungen.«
»Schmerzschaltungen?«
»Ja klar, die muss sie haben, damit sie nicht gegen die Wand läuft oder gegen irgendetwas anderes und sich selbst Schaden zufügt.« Der Techniker zeigte mit dem Daumen zu der Stanton. »Die hat auch welche.«
Kein Zweifel: Wir waren Zeugen, wie ein Lebewesen zur Welt kam. Die Lincoln nahm uns jetzt wahr; ihre pechschwarzen Augen bewegten sich hin und her, sogen uns geradezu auf. Was zeigte sich in diesen Augen? Argwohn, der jede menschliche Vorstellungskraft überstieg. Die Intelligenz einer Lebensform von jenseits unserer Welt, aus einem fremden Land. Ein Wesen, das auf einmal in unserer Zeit und unserem Raum war, sich unser bewusst, sich seiner selbst bewusst. Die Augen rollten hin und her, sahen alles, sahen zugleich nichts – als würde es sich in der Schwebe befinden. Es wartete. Es hatte Angst, so große Angst, dass das Wort Emotion dafür nicht ausreicht. Die Angst war die Basis seiner Existenz. Es war abgetrennt worden, fortgerissen aus einer Verschmelzung, die wir nicht kannten, noch nicht kannten. Vielleicht hatten wir ja alle einmal in dieser Verschmelzung existiert, aber für uns lag der Bruch weit zurück, für die Lincoln hatte er sich gerade erst ereignet.
Ihr Blick ließ sich noch immer nicht irgendwo nieder; sie weigerte sich, einen bestimmten Gegenstand wirklich wahrzunehmen.
»Mann«, sagte Maury leise. »Die guckt uns echt komisch an.«
Irgendetwas war mit diesem Ding, es besaß irgendeine unergründliche Fähigkeit. Hatte Pris sie ihr verliehen?
Ich bezweifelte es. Maury? Auf gar keinen Fall. Keiner von ihnen hatte das getan, auch nicht Bob Bundy, dessen Vorstellung von Vergnügen es war, nach Reno zu düsen, um zu zocken und mit einer Nutte herumzumachen. Sie hatten diesem Ding Leben eingehaucht, doch es war nur eine Übertragung, keine Erfindung. Sie hatten Leben weitergegeben, aber es hatte seinen Ursprung in keinem von ihnen und auch nicht in allen zusammen. Es war wie eine Seuche; die drei hatten sie sich irgendwann eingefangen, und nun war dieses Material daran erkrankt. Das Leben ist ein Zustand, den Materie annimmt, dachte ich, während ich zusah, wie dieses Lincoln-Ding uns und sich selbst wahrnahm. Es ist etwas, was Materie tut. Der erstaunlichste, ja der einzige wahrhaft erstaunliche Zustand im Universum – der, hätte er nicht existiert, niemals hätte vorhergesagt oder auch nur erträumt werden können.
Und in diesem Moment, da ich Zeuge wurde, wie die Lincoln Stück für Stück in eine Beziehung zu dem trat, was sie sah, wurde mir etwas klar: Die Grundlage des Lebens ist nicht Gier oder sonst ein Verlangen. Es ist Angst – die Angst, die ich hier sah. Und nicht einmal Angst, nein, viel schlimmer. Absolutes Grauen. Lähmendes Entsetzen, das so groß war, dass es zu Apathie führte. Aber die Lincoln erhob sich daraus. Warum? Weil sie musste. Alles Handeln war dem Schrecken geschuldet. Dieser Zustand war unerträglich, jegliche Aktivität des Lebens war eine Anstrengung, sich von diesem Zustand zu befreien, war der Versuch, die Situation zu mildern, die wir gerade vor uns sahen.
Geburt, wurde mir klar, ist nichts Angenehmes. Ja, sie ist schlimmer als der Tod. Über den Tod kann man philosophieren – jeder tut das. Aber Geburt! Da gibt es kein Philosophieren, kein Mildern der Situation. Und die Aussichten sind trübe: Alles, was man tut und denkt, zieht einen nur tiefer ins Leben hinein.
Wieder ächzte die Lincoln. Und dann, mit einem heiseren Grollen, murmelte sie etwas.
»Was?«, fragte Maury. »Was hat sie gesagt?«
Bundy kicherte. »So ein Mist aber auch, die Stimme läuft rückwärts.«
Die ersten Worte der Lincoln-Maschine: rückwärts gesprochen aufgrund einer fehlerhaften Programmierung.
Acht
Es dauerte einige Tage, das Lincoln-Simulacrum in Ordnung zu bringen. In dieser Zeit fuhr ich von Ontario aus westwärts durch die Oregon Sierras, und durch die kleine Holzfällerstadt John Day, die immer meine Lieblingsstadt im Westen der USA gewesen ist. Ich machte dort jedoch nicht Halt; ich war zu ruhelos. Ich fuhr weiter nach Westen, bis ich den Highway erreichte. Diese schnurgerade Nord-Süd-Verbindung, die alte Route 99, führt über Hunderte von Meilen zwischen Nadelbäumen hindurch, und am kalifornischen Ende findet man sich zwischen Vulkanbergen wieder, stumpf und aschfarben, übrig geblieben aus der Zeit der Giganten.
Zwei kleine gelbe Finken, die in der Luft spielten, sausten auf die Motorhaube meines Autos zu. Ich hörte nichts, aber ich schloss aus ihrem Verschwinden, dass sie in den Kühlergrill geraten waren. Tot und verbrannt. Und tatsächlich, an der nächsten Tankstelle fand der Tankwart sie. Hellgelb hingen sie im Grill. Ich schlug sie in ein Taschentuch, trug sie zum Rand des Highways und warf sie dort zwischen die Bierdosen und verrottenden Pappkartons.
Vor mir lagen Mount Shasta und die Grenzstation von Kalifornien. Ich fühlte mich nicht danach weiterzufahren. Die Nacht verbrachte ich in einem Motel in Klamath Falls, und am nächsten Tag fuhr ich die Küste entlang den Weg zurück, den ich gekommen war.
Es war gerade einmal halb acht und es gab nur wenig Verkehr, als ich über mir etwas sah, das mich veranlasste, auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Wie immer bekam ich bei dem Anblick ein Gefühl von Demut, zugleich belebte er mich. Ein riesiges Schiff zog langsam vorüber, auf seinem Weg zurück von Luna oder einem der Planeten zum Raumhafen irgendwo in der Wüste von Nevada. Düsenjäger der Air Force begleiteten es; neben ihm waren sie kaum mehr als schwarze Punkte.
Andere Wagen hatten ebenfalls angehalten. Ein Mann machte ein Foto, eine Frau und ein kleines Kind winkten. Die Bremsraketen des Schiffes ließen jetzt die Erde erbeben. Seine Außenhülle, konnte ich sehen, war von Meteoriteneinschlägen übersät und verbrannt vom Wiedereintritt in die Atmosphäre.
Dort zieht unsere Hoffnung vorüber, dachte ich und schirmte meine Augen vor der Sonne ab. Was hat es an Bord? Bodenproben? Hinweise auf außerirdisches Leben? Zerbrochene Krüge, die man in der Asche eines erloschenen Vulkans gefunden hat – Überreste einer untergegangenen Zivilisation? Nun, vermutlich bloß eine Horde Bürokraten. Bundesbeamte, Kongressmitglieder, Techniker, Militärbeobachter, Raketenwissenschaftler, vielleicht auch ein paar Reporter und Fotografen von Life und Look und Fernsehteams von NBC und CBS. Beeindruckend war es trotzdem. Ich winkte, so wie die Frau mit dem kleinen Jungen.
Als ich wieder in mein Auto stieg, dachte ich: Eines Tages wird es hübsche kleine Reihenhäuser dort oben auf dem Mond geben. Mit Fernsehanschluss und Rosen-Kleinklavieren in den Wohnzimmern. Vielleicht werde ich in zehn Jahren ja Anzeigen in extraterrestrischen Zeitungen aufgeben. Unsere Firma wäre mit den Sternen verbunden…
Doch in gewisser Weise war sie das bereits. Ja, ich bekam allmählich eine Ahnung von der Leidenschaft, die Pris beherrschte, von der Besessenheit in Sachen Barrows. Er war, in vielerlei Hinsicht, das Bindeglied zwischen uns gewöhnlichen Sterblichen und dem All, war in beiden Welten beheimatet, den einen Fuß auf Luna, den anderen auf Grundbesitz in Seattle und Oakland. Ohne Barrows war das alles nur ein Traum – er machte es greifbar. Man konnte nicht umhin, ihn zu bewundern. Ihn versetzte die Vorstellung, Menschen auf dem Mond anzusiedeln, nicht in Ehrfurcht; für ihn war es ein weiteres, vielversprechendes Geschäftsfeld. Eine Chance auf hohe Investitionserträge, höher noch als bei der Vermietung von Wohnraum in Slums.
Also zurück nach Ontario, sagte ich mir. Ran an die Simulacra, unser neues Produkt, das Mr. Barrows herauslocken, uns für ihn wahrnehmbar machen soll. Das uns zu einem Teil der neuen Welt, ja uns lebendig machen soll.
Als ich die Straße zu MASA Associates hinauffuhr und nach einem Parkplatz Ausschau hielt, sah ich eine Menschenmenge, die sich vor unserem Firmengebäude versammelt hatte und in den Vorführraum blickte, den Maury hatte bauen lassen. Ich parkte und mischte mich unter die Leute.
Dort, im Vorführraum, saß die große, bärtige Gestalt von Abraham Lincoln an einem altmodischen Rollladensekretär aus Walnussholz. Der Sekretär gehörte meinem Vater, sie hatten ihn für die Lincoln aus Boise hierhergeholt. Das ärgerte mich etwas, doch ich musste zugeben, dass es passte. Die Maschine, die ganz ähnliche Kleidung trug wie die Stanton, schrieb gerade mit der Feder einen Brief. Der wirklichkeitsgetreue Eindruck, den sie machte, war wirklich verblüffend. Hätte ich es nicht besser gewusst, ich wäre überzeugt gewesen, dass es sich um einen auf unnatürliche Weise wieder zum Leben erweckten Lincoln handelte. Aber war es nicht genau das? Hatte Pris letztlich nicht doch recht?
Mir fiel ein Schild im Fenster auf; es erläuterte dem Publikum, was hier vor sich ging:
DIES IST EIN LEBENSECHTER NACHBAU DES SECHZEHNTEN PRÄSIDENTEN DER VEREINIGTEN STAATEN, ABRAHAM LINCOLN. ER WURDE HERGESTELLT VON MASA Associates IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER ROSEN-ELEKTROORGELFABRIK IN BOISE, IDAHO. ER IST DER ERSTE SEINER ART. DAS GESAMTE GEDÄCHTNIS UNSERES GROSSEN BÜRGERKRIEGSPRÄSIDENTEN WURDE IN DER ZENTRALMONADENKONSTRUKTION DIESER MASCHINE EXAKT REPRODUZIERT; SIE IST DAMIT IN DER LAGE, SÄMTLICHE HANDLUNGEN, REDEN UND ENTSCHEIDUNGEN DES PRÄSIDENTEN WIEDERZUGEBEN. ANFRAGEN ERWÜNSCHT.
Die hochtrabenden Worte ließen eindeutig auf Maury schließen. Wütend schob ich mich durch die Menge und betrat den Vorführraum. In der Ecke auf einer Couch saßen Maury, Bob Bundy und mein Vater und sahen schweigend der Lincoln zu.
»Hey, Kumpel«, sagte Maury, als er mich erblickte.
»Und? Die Kosten schon wieder reingeholt?«
»Nein. Wir nehmen kein Geld dafür. Wir führen sie einfach nur vor.«
»Dieses Schild dort ist auf deinem Mist gewachsen, nicht wahr? Mit was für Passanten rechnest du, die Anfragen stellen? Warum lässt du die Kiste nicht Autowachs verkaufen oder Geschirrspülmittel? Warum lässt du sie nur dort sitzen und schreiben? Oder nimmt sie gerade an irgendeinem Preisausschreiben teil?«
»Sie erledigt eben ihre Korrespondenz.«
»Wo ist deine Tochter?«
»Sie kommt gleich wieder.«
Ich wandte mich meinem Vater zu. »Stört es dich nicht, dass die Maschine deinen Schreibtisch benutzt?«
»Nein, mein Sohn. Komm, rede mit ihr. Selbst wenn man sie unterbricht, legt sie eine verblüffende Gelassenheit an den Tag. Davon könnte ich mir eine Scheibe abschneiden.«
Ich hatte meinen Vater noch nie so nachdenklich erlebt. »Okay«, sagte ich und ging zu der schreibenden Gestalt hinüber. Draußen vor dem Schaufenster gafften die Leute. »Mr. President.« Meine Kehle war trocken. »Sir, ich störe Sie nur ungern.« Ich war nervös und mir doch gleichzeitig absolut darüber im Klaren, dass es sich nur um eine Maschine handelte. Zu ihr zu gehen und sie so anzusprechen, machte mich zu einem Bestandteil der Fiktion, zu einem ebensolchen Schauspieler wie sie. Aber mich hatte niemand programmieren müssen, ich spielte meine Rolle in diesem Unsinn freiwillig.
Warum sagte ich nicht einfach ›Mr. Simulacrum‹? Das war schließlich die Wahrheit. Die Wahrheit? Was hieß das denn? Wie bei einem kleinen Jungen, der im Kaufhaus zum Weihnachtsmann geht – die Wahrheit kundzutun, wäre wie sterben. Mein Sterben. Wollte ich das? Das Simulacrum würde nicht darunter leiden. Maury, Bundy und mein Vater würden es nicht einmal mitbekommen. Also machte ich weiter. Weil ich es war, den ich schützte.
Die Lincoln blickte auf, legte die Feder beiseite und sagte mit hoher, angenehmer Stimme: »Guten Tag. Ich nehme an, Sie sind Mr. Louis Rosen.«
»Ja, Sir.«
In diesem Moment explodierte der Raum. Der Rollladensekretär zersprang in tausend Stücke, die mir ins Gesicht flogen. Ich kniff die Augen zu und fiel nach vorn. Ich streckte noch nicht einmal die Hände aus, um den Aufprall abzufedern. Dunkelheit hüllte mich ein.
Oben im Büro auf einem Sofa kam ich wieder zu mir. Maury saß neben mir, rauchte eine seiner Corina Larks und hielt mir eine Flasche Haushaltsammoniak unter die Nase. »Jesus«, sagte er, als er merkte, dass ich wieder bei Bewusstsein war. »Du hast eine Beule an der Stirn und eine Platzwunde an der Lippe.«
Ich hob die Hand und befühlte die Beule. Sie schien die Größe einer Zitrone zu haben. Und ich hatte Fetzen von meiner Lippe auf der Zunge. »Ich bin ohnmächtig geworden.«
»Ach, wirklich?«
Nun sah ich auch meinen Vater. Und Pris Frauenzimmer in ihrem langen grauen Leinenmantel, die auf und ab ging und mich halb amüsiert, halb verächtlich betrachtete. »Ein Wort von ihr«, sagte sie, »und du fällst um. Meine Güte!«
Ich rieb mir die Augen. »Ja, und?«
Maury sah seine Tochter grinsend an. »Das beweist, dass sie wirkt.«
»Was… hat die Lincoln gemacht? Nachdem ich umgefallen bin?«
»Sie hat dich genommen und nach oben getragen.«
»Wirklich?«
»Warum bist du überhaupt ohnmächtig geworden?« Pris beugte sich über mich, starrte mich eindringlich an. »Du Idiot! Aber gut, die Leute waren jedenfalls hin und weg. Du hättest sie hören sollen. Man hätte meinen können, wir hätten Gott zusammengeschraubt oder so was. Sie haben wirklich gebetet, und ein paar alte Damen haben sich bekreuzigt. Und andere, du wirst es kaum glauben…«
»Schon gut, Pris.«
»Lass mich ausreden.«
»Nein. Halt den Mund, ja?«
Wir funkelten einander an, dann richtete sich Pris auf. »Weißt du eigentlich, dass deine Lippe aufgeplatzt ist? Du solltest sie nähen lassen.«
Ich berührte meine Lippe und stellte fest, dass sie immer noch blutete. Vielleicht hatte Pris recht.
»Ich bring dich zu einem Arzt.« Sie ging zur Tür. »Komm.«
»Das braucht nicht genäht zu werden«, murmelte ich. Trotzdem stand ich auf und folgte ihr wacklig.
Während wir im Flur auf den Fahrstuhl warteten, sagte Pris: »Du bist nicht gerade der Mutigste, hm?«
Ich antwortete nicht.
»Du hast schlimmer reagiert als ich, schlimmer als alle bisher. Das überrascht mich. Du bist offenbar weniger stabil, als wir dachten. Eines Tages, unter Stress, wird sich das gravierend bemerkbar machen. Eines Tages wirst du schwerwiegende psychische Probleme bekommen.«
Der Fahrstuhl kam, wir traten ein, die Türen schlossen sich. Ich sah sie an. »Ist es denn so schlimm, eine Reaktion zu zeigen?«
»In Kansas City habe ich gelernt, wie man erst dann eine Reaktion zeigt, wenn es im ureigenen Interesse ist. Das hat mich gerettet, das hat mich da wieder rausgebracht. Ein extremer Effekt ist immer ein schlechtes Zeichen, wie in deinem Fall. Es zeugt von mangelhafter Anpassung. In Kansas City sagt man Parataxie dazu -Emotionalität drängt sich in zwischenmenschliche Beziehungen und verkompliziert sie. Wobei es keine Rolle spielt, ob man dabei Hass oder Neid oder, wie in deinem Fall, Angst ausagiert – alles bloß Parataxie. Und wenn die Gefühle übermäßig stark werden, hast du eine psychische Erkrankung. Und wenn sie völlig die Kontrolle übernehmen, hast du Schizophrenie, wie bei mir vor einer Weile. Das ist das Schlimmste.«
Ich tupfte mit einem Taschentuch an meiner Lippe herum. Mir war klar, dass es keine Möglichkeit gab, Pris meine Reaktion begreifbar zu machen; ich versuchte es gar nicht erst.
»Soll ich es küssen? Damit es wieder gut wird.«
Ich warf ihr einen wütenden Blick zu, doch dann erkannte ich, dass sie wirklich Mitgefühl empfand. »Das wird schon wieder.« Ich fühlte mich wie ein kleiner Junge. »Weißt du, Erwachsene reden nicht so miteinander. Küssen, damit es wieder gut wird…«
»Ich will dir nur helfen.« Sie sah mich traurig an. »Ach, Louis – es ist vorbei.«
»Was ist vorbei?«
»Sie lebt. Ich kann sie nie wieder anrühren. Was soll ich jetzt tun? Ich habe kein Ziel mehr.«
»Ach, Pris.«
»Mein Leben ist leer, ich könnte ebenso gut tot sein. Mein ganzes Tun und Denken ist nur um die Lincoln gekreist.« Die Fahrstuhltüren öffneten sich, und wir traten in die Eingangshalle hinaus. »Ist es dir wichtig, zu was für einem Arzt du gehst? Ich bring dich am besten gleich zu der Praxis weiter die Straße hinunter.«
»Gut.«
Wir stiegen in den Jaguar. »Sag mir, was ich machen soll, Louis. Ich muss sofort irgendetwas machen.«
»Du wirst da schon wieder rauskommen.«
»So habe ich mich noch nie gefühlt.«
»Lass dich doch zum Papst wählen.« Es war das Erste, was mir in den Kopf gekommen war; es war völlig hirnrissig.
»Sehr witzig. Ich wünschte, ich wäre ein Mann. Frauen ist so viel verwehrt. Ihr könnt alles werden, aber was kann eine Frau schon werden? Hausfrau oder Verkäuferin oder Schreibkraft oder Lehrerin.«
»Werd doch Ärztin. Nähe verletzte Lippen.«
»Ich kann kranke oder behinderte Menschen nicht ertragen. Darum bringe ich dich ja zum Arzt. Ich kann dich gar nicht ansehen, verstümmelt wie du bist.«
»Ich bin nicht verstümmelt. Ich habe nur eine aufgeplatzte Lippe!«
Pris ließ den Motor an und fädelte in den Verkehr ein. »Ach, ich lass es einfach gut sein mit der Lincoln. Von nun an ist sie nur noch eine Sache. Etwas, das sich vermarkten lässt.«
Ich nickte.
»Ich werde dafür sorgen, dass Sam Barrows sie kauft. Eine andere Aufgabe habe ich nicht. Von nun an wird sich mein gesamtes Denken und Tun um Sam Barrows drehen.«
So sehr mich ihre Worte auch zum Lachen reizten, ich brauchte sie nur anzusehen – in ihrem Gesicht stand eine solche Niedergeschlagenheit, ein solcher Mangel an Zufriedenheit oder Freude oder auch nur Humor, dass ich lediglich nicken konnte. Während Pris mich zum Arzt fuhr, damit meine Lippe genäht wurde, hatte sie offenbar einen heiligen Eid geleistet. Darin lag etwas Manisches, und mir war klar, dass es aus lauter Verzweiflung geschehen war. Sie ertrug es nicht, auch nur einen Moment ohne Beschäftigung zu sein; sie brauchte ein Ziel. Das war ihre Art, der Welt einen Sinn abzutrotzen.
»Weißt du, Pris, dein Problem ist, dass du so rational bist.«
»Aber das bin ich gar nicht. Alle sagen, dass ich immer das tue, wonach mir der Sinn steht.«
»Nein, du wirst von einer unerbittlichen Vernunft getrieben. Und die musst du loswerden. Sag Horstowski das. Sag ihm, er soll dich von dieser Vernunft befreien. Du wirkst, als ob dein Leben auf einem geometrischen Beweis beruhen würde. Mach mal etwas Unvernünftiges. Bring mich nicht zum Arzt, sondern setz mich stattdessen bei einem Schuhputzer ab, damit er mir die Schuhe poliert.«
»Deine Schuhe sind schon poliert.«
»Siehst du? Siehst du, wie du ständig vernünftig sein musst? Halt an der nächsten Kreuzung an, und wir steigen beide aus und lassen das Auto stehen. Oder wir gehen in einen Blumenladen und kaufen Blumen und bewerfen die anderen Autos damit.«
»Und wer bezahlt die Blumen?«
»Wir klauen sie. Wir rennen ohne zu bezahlen wieder raus.«
»Lass mich kurz darüber nachdenken.«
»Nachdenken? Bloß nicht! Hast du je etwas geklaut als Kind? Oder einfach nur aus Spaß etwas kaputt gemacht, irgendetwas, das der Allgemeinheit gehört – eine Straßenlaterne?«
»Ich hab mal im Laden an der Ecke einen Schokoriegel mitgehen lassen.«
»Dann machen wir das jetzt. Wir suchen uns einen Laden an der Ecke und sind wieder Kinder. Wir lassen jeder einen Schokoriegel mitgehen und suchen uns einen Platz auf einer Wiese und essen ihn.«
»Mit deiner Lippe kannst du doch gar nicht essen.«
Das verschlug mir kurzzeitig die Stimme. »Gut, zugegeben. Aber das gilt nur für mich, stimmt’s? Du könntest jederzeit in einen Laden gehen und es tun, auch ohne mich.«
»Würdest du trotzdem mitkommen?«
»Wenn du das willst. Oder ich warte draußen mit laufendem Motor, damit wir schnell abhauen können.«
»Nein, ich möchte, dass du mit in den Laden kommst. Du kannst mir zeigen, welchen Schokoriegel ich nehmen soll. Ich brauche deine Hilfe.«
»Okay.«
»Welche Strafe steht denn auf so was?«
»Ewiges Leben.«
»Du machst Witze.«
»Nein, ich meine es ernst.« Und ich meinte es tatsächlich ernst.
»Machst du dich über mich lustig? Wirke ich so lächerlich, liegt es daran?«
»Gott, nein.«
»Du musst wissen, dass ich alles glaube. In der Schule haben sie mich immer wegen meiner Leichtgläubigkeit gehänselt. ›Alice im Dummerland‹ haben sie mich genannt.«
»Komm mit in den Laden, Pris, dann beweise ich dir, dass ich es ernst meine. Ich will dich retten.«
»Vor was denn retten?«
»Vor deinem Verstand.«
Ich sah, wie sich ihr Gesicht verzog, wie sie mit sich selbst kämpfte, herauszufinden versuchte, was sie tun sollte. Sie wandte sich mir zu. »Louis, ich glaube dir das mit dem Laden. Ich weiß, dass du dich nie über mich lustig machen würdest. Du kannst mich vielleicht nicht ausstehen – du empfindest Hass auf mich, auf vielen Ebenen –, aber du bist nicht die Sorte Mensch, die daraus Vergnügen zieht, Schwächere zu verhöhnen.«
»Du bist nicht schwach.«
»Doch. Aber dir fehlt das Gespür, das wahrzunehmen. Das ist in Ordnung, Louis. Ich bin genau andersherum – ich habe das Gespür und bin nicht in Ordnung.«
»In Ordnung, nicht in Ordnung. Hör auf damit, Pris. Du bist deprimiert, weil deine Arbeit an der Lincoln beendet ist. Du weißt gerade nichts mit dir anzufangen, und wie viele andere kreative Menschen hast du ein Tief zwischen dem einen und…«
»Da ist die Praxis.« Pris hielt an.
Nachdem mich der Arzt untersucht und wieder entlassen hatte, ohne die Notwendigkeit zu sehen, irgendetwas zu nähen, gelang es mir, Pris zu einem kurzen Kneipenbesuch zu überreden. Ich brauchte dringend etwas zu trinken. Ich sagte ihr, es sei etwas, das wir tun mussten, das von uns erwartet wurde, eine Art zu feiern. Wir hatten mitangesehen, wie die Lincoln zum Leben erwacht war, und das war ein großer Moment, vielleicht der größte Moment unseres Lebens. Und doch lag in diesem Moment auch etwas Unheilvolles, Trauriges, etwas, das uns alle verstörte.
»Ein Bier, mehr nicht«, sagte Pris, während wir den Gehsteig überquerten.
In der Kneipe bestellte ich ein Bier für sie und einen Irish Coffee für mich. »Ja, ich kann mir vorstellen, dass du dich hier wohlfühlst«, sagte sie. »Du verbringst viel Zeit damit, in Kneipen herumzuhocken, stimmt’s?«
»Ich muss dich mal was fragen, Pris. Glaubst du das, was du da ständig über andere sagst, eigentlich selbst? Oder plapperst du einfach nur drauflos, Hauptsache, der andere fühlt sich schlecht dabei?«
»Was denkst du?«
»Keine Ahnung.«
»Warum willst du das überhaupt wissen?«
»Mich interessiert einfach alles, was dich betrifft. Die kleinsten Kleinigkeiten.«
»Warum?«
»Du hast eine faszinierende Geschichte. Schizoid mit zehn, zwangsneurotisch mit dreizehn, vollständig schizophren und unter staatlicher Aufsicht mit siebzehn, jetzt halbwegs geheilt und zurück in der Welt, aber immer noch…« Ich schluckte. Nein, das war nicht der Grund. Nicht ihre Geschichte. »Okay, ich werde dir die Wahrheit sagen. Ich liebe dich.«
»Du lügst.«
»Gut, ich könnte dich lieben.«
»Wenn was wäre?« Sie wirkte jetzt äußerst nervös, ihre Stimme bebte.
»Ich weiß nicht. Irgendetwas hält mich zurück.«
»Angst.«
»Vielleicht. Ja, vielleicht ist es einfach nur Angst.«
»Machst du dich lustig über mich, Louis?«
»Nein.«
Sie lachte kurz auf. »Wenn du deine Angst besiegen würdest, könntest du eine Frau für dich gewinnen. Nicht mich, aber irgendeine andere. Ich kann gar nicht fassen, dass du das zu mir gesagt hast. Louis, wir sind so verschieden, wie es nur geht, siehst du das nicht? Du zeigst deine Gefühle, ich behalte sie für mich. Wie wäre das wohl, wenn wir ein Kind hätten… Ich kann Frauen nicht verstehen, die ständig Kinder haben wollen, sie sind wie Hundeweibchen – jedes Jahr ein Wurf.« Sie sah mich aus dem Augenwinkel an. »Das ist ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Sie finden Erfüllung durch ihre Fortpflanzungsorgane. Ich bin solchen Frauen begegnet, aber ich könnte nie so sein. Ich bin unglücklich, wenn ich nicht etwas mit meinen eigenen Händen tun kann. Warum ist das so?«
»Weiß ich nicht.«
»Es muss eine Erklärung dafür geben, alles hat einen Grund. Weißt du, Louis, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber ich glaube nicht, dass je irgendjemand gesagt hat, er sei in mich verliebt.«
»Ach, bestimmt. Jungs in der Schule.«
»Nein, du bist der Erste. Keine Ahnung, wie ich darauf reagieren soll. Ich weiß nicht mal, ob es mir gefällt. Es fühlt sich komisch an.«
»Nimm es einfach an.«
»Liebe und Kreativität… Wir setzen mit der Stanton und der Lincoln Kinder in die Welt. Liebe und Kinder kriegen – beides hängt miteinander zusammen, nicht? Man liebt, was man in die Welt setzt, und da du mich liebst, Louis, willst du auch mit mir zusammen etwas Neues in die Welt setzen, oder nicht?«
»Denke schon.«
»Wir sind wie Götter. Stanton und Lincoln, eine neue Spezies… Aber während wir ihnen das Leben schenken, bleibt in uns selbst eine Leere zurück. Fühlst du dich nicht auch leer?«
»Nein, überhaupt nicht.«
»Du bist eben anders als ich. Du hast kein Gespür für das, was wir getan haben. Gehst hier in diese Kneipe… Das war ein spontaner Impuls, dem du nachgegeben hast, nicht wahr? Maury und Bob und dein Vater und die Stanton sind immer noch bei MASA, bei der Lincoln – du denkst gar nicht an sie, du willst hier sitzen und etwas trinken.« Sie lächelte mich an.
»Kann schon sein.«
»Ich langweile dich, oder? Du interessierst dich gar nicht für mich, interessierst dich nur für dich selbst.«
»Das stimmt, du hast recht.«
»Warum hast du dann gesagt, du willst alles über mich wissen? Warum hast du gesagt, dass du mich lieben könntest und nur diese Angst dich daran hindert?«
»Weiß ich nicht.«
»Siehst du nie in den Spiegel und versuchst, deine Motive zu verstehen? Ich analysiere mich ständig selbst.«
»Pris, denk mal für einen Moment lang nach. Du bist nur ein Mensch von vielen, nicht besser, nicht schlechter. Tausende von Amerikanern sind in psychiatrischer Behandlung. Tausende kriegen Schizophrenie und fallen unter den McHeston Act. Du bist attraktiv, zugegeben, aber jedes x-beliebige Starlet aus Schweden oder Italien sieht noch besser aus. Deine Intelligenz ist…«
»Du versuchst doch nur dich selbst zu überzeugen.«
»Bitte?«
»Du bist es doch, der mich auf ein Podest stellt, schon vergessen?«
Ich schob mein Glas weg. »Fahren wir zurück.« Der Alkohol brannte scharf auf meiner Lippe.
»Habe ich etwas Falsches gesagt? Du bist so ambivalent mir gegenüber…«
Ich legte ihr die Hand auf den Arm. »Trink aus. Lass uns fahren.«
Als wir die Kneipe verließen, sagte Pris matt: »Du bist schon wieder sauer auf mich.«
»Nein.«
»Ich versuche nur, nett und höflich zu dir zu sein, aber ich ecke jedes Mal an. Es ist ein Fehler, mich so gekünstelt zu benehmen. Ich hab dir ja gesagt, ich sollte keine Handlungsmuster annehmen, die mir nicht liegen. Das geht nie gut.« In ihren Worten schwang ein Vorwurf mit, so als wäre es meine Idee gewesen.
»Hör zu, Pris«, sagte ich, als wir in den Jaguar einstiegen. »Wir fahren zurück und widmen uns entschlossen der Aufgabe, Sam Barrows für uns zu gewinnen. Okay?«
»Nein, das kann nur ich tun. Du hast damit nichts zu schaffen.«
Ich klopfte ihr auf die Schulter. »Weißt du, ich empfinde jetzt viel mehr Sympathie für dich als vorher. Ich glaube, wir sind gerade dabei, eine gute, stabile Beziehung zueinander aufzubauen.«
»Vielleicht.« Pris hatte den sarkastischen Unterton offenbar nicht wahrgenommen. Sie lächelte mich an. »Ich hoffe, Louis. Die Menschen sollten einander verstehen.«
Als wir wieder bei MASA waren, kam uns Maury aufgeregt entgegen. »Warum habt ihr so lange gebraucht?« Er zog ein Blatt Papier hervor. »Ich habe Sam Barrows ein Telegramm geschickt. Hier, lies mal.« Er drückte es mir in die Hand.
Ich faltete das Blatt auseinander.
Empfehle dringend Ihre sofortige Anreise. Lincoln-Simulacrum durchschlagender Erfolg. Erbitte Ihre Entscheidung. Halte Exemplar für erste Prüfung bereit wie telefonisch besprochen. Es übertrifft kühnste Erwartungen. Hoffe, noch heute von Ihnen zu hören.
Maury Rock,
MASA Associates
»Und hat er schon geantwortet?«, fragte ich.
»Noch nicht, aber es ist auch gerade erst rausgegangen.«
Jetzt kam auch Bob Bundy und sah mich an. »Mr. Lincoln hat mich gebeten, Ihnen sein Bedauern auszudrücken. Es erkundigt sich, wie es Ihnen geht.« Bundy selbst schien ziemlich durch den Wind zu sein.
»Sagen Sie ihm, dass es mir gut geht. Und dass ich ihm danke.«
»Okay.« Der Techniker verzog sich wieder.
Ich wandte mich Maury zu. »Ich muss zugeben, ihr habt da wirklich ein Pfund in der Hand. Offenbar habe ich mich getäuscht.«
»Schön, dass du wieder zur Vernunft kommst.«
»Freut euch nur nicht zu früh«, sagte Pris.
Maury zog an seiner Corina. »Wir haben einen Haufen Arbeit vor uns. Ich bin mir sicher, dass wir Barrows’ Interesse geweckt haben. Aber worauf wir unbedingt achten müssen…« Er senkte die Stimme. »Ein Mann wie er kann uns beiseitefegen wie Streichhölzer. Hab ich recht, Kumpel?«
»Absolut.« Das hatte ich mir auch schon überlegt.
»Er hat das vermutlich schon tausendmal gemacht mit kleinen Firmen. Wir müssen die Reihen schließen, wir vier. Oder fünf, wenn man Bob Bundy mitzählt. Richtig?« Er sah Pris und mich und meinen Vater an, der sich zu uns gestellt hatte.
»Vielleicht solltet ihr damit zur Regierung, Maurice.« Mein Vater sah mich an. »Was meinst du, mein Sohn?«
»Er hat Barrows schon kontaktiert. Womöglich ist er schon auf dem Weg hierher.«
»Auch wenn er hierher kommt«, sagte Maury, »können wir immer noch nein sagen. Wenn wir der Meinung sind, wir sollten damit lieber nach Washington.«
»Frag doch die Lincoln.«
»Was?« Pris warf mir einen scharfen Blick zu. »Du hast sie doch nicht mehr alle.«
»Nein, im Ernst. Holen wir uns ihren Rat.«
»Und was bitte schön weiß ein hinterwäldlerischer Politiker aus dem letzten Jahrhundert über Sam K. Barrows?«
»Vielleicht mehr als du.«
»Wir wollen uns nicht streiten, Leute«, ging Maury dazwischen. »Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Ich denke, wir sollten weitermachen und Barrows die Lincoln vorführen, und wenn es aus irgendeinem Grund…« Er brach ab. Das Telefon klingelte. Er ging ran. »MASA Associates, Maury Rock.«
Stille. Maury wandte sich uns zu und formte ein Wort mit den Lippen: Barrows.
Das war’s, dachte ich. Die Würfel sind gefallen.
»Ja, Sir«, sagte Maury in den Hörer. »Wir holen Sie vom Flughafen ab. Ja, wir sind dann dort.« Sein Gesicht glühte, er blinzelte mir zu.
»Wo ist die Stanton?«, fragte ich meinen Vater.
»Was meinst du?«
»Die Stanton-Maschine – ich sehe sie nirgends.« Mir fiel ein, wie abschätzig sie sich über die Lincoln geäußert hatte. Ich wandte mich Pris zu. »Wo ist die Stanton?«
»Weiß nicht. Bundy hat sie irgendwohin verfrachtet, vermutlich nach unten in die Werkstatt.«
»Einen Moment bitte.« Maury senkte den Hörer und sah mich an. Sein Gesicht hatte einen merkwürdigen Ausdruck angenommen. »Die Stanton ist in Seattle. Bei Barrows.«
»Oh nein«, flüsterte Pris.
»Sie hat gestern Nacht den Greyhound-Bus genommen. Ist heute Morgen dort angekommen und schnurstracks zu ihm gegangen. Barrows sagt, sie haben sich in aller Ausführlichkeit miteinander unterhalten. Er hat unser Telegramm noch nicht bekommen. Er ist an der Stanton interessiert. Soll ich ihm von der Lincoln erzählen?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Warum nicht? Das Telegramm ist ja eh unterwegs.«
»Mr. Barrows«, sagte Maury ins Telefon. »Wir haben Ihnen gerade ein Telegramm geschickt. Ja, wir haben die Lincoln-Maschine zum Laufen gebracht, und sie ist phantastisch, noch besser als die Stanton.« Er sah mich an. »Sir, die Stanton wird Sie auf dem Flug doch begleiten, oder? Wir möchten sie unbedingt zurückhaben.« Pause, dann senkte Maury erneut den Hörer. »Barrows sagt, die Stanton möchte noch einen Tag in Seattle bleiben und sich die Sehenswürdigkeiten anschauen. Sie will sich die Haare schneiden lassen und die Bibliothek besuchen, und wenn ihr die Stadt gefällt, will sie dort vielleicht sogar eine Kanzlei eröffnen und sich dort niederlassen.«
»Jesus!« Pris ballte die Fäuste. »Sag ihm, er soll sie überreden, zurückzukommen.«
Maury nahm den Hörer wieder auf. »Können Sie sie nicht davon überzeugen, dass sie Sie begleitet, Mr. Barrows?« Wieder Stille. »Sie ist weg«, wandte er sich an uns. »Sie hat sich von Barrows verabschiedet und ist gegangen.« Er runzelte die Stirn.
»Egal«, sagte ich. »Mach das mit dem Flug klar.«
»Ja.« Maury nickte und sagte in den Hörer: »Sie wird schon zurechtkommen. Sie hatte doch Bargeld, oder?« Stille. »Sie haben ihr zwanzig Dollar gegeben. Gut. Wir holen Sie ab. Die Lincoln ist noch um einiges besser. Ja, Sir. Danke. Auf Wiederhören.« Er legte auf und blickte zu Boden. »Ich habe nicht mal gemerkt, dass sie weg war. Glaubt ihr, sie war verärgert wegen der Lincoln?«
Ich legte ihm die Hand auf die Schulter. »Sinnlos, über vergossene Milch zu jammern.«
»Ja.« Maury biss sich auf die Lippen. »Aber ihre Batterie hält sechs Monate. Wer weiß, ob wir sie dieses Jahr noch mal zu sehen bekommen. Immerhin haben wir da ein paar tausend Dollar reingesteckt… Und was ist, wenn Barrows uns an der Nase herumführt? Vielleicht hat er sie ja in irgendeinen Tresor eingeschlossen.«
»Dann würde er nicht hierher kommen«, sagte Pris. »Wahrscheinlich war es sogar gut so. Ohne die Stanton würde Barrows vielleicht gar nicht kommen. Das Telegramm allein hätte vermutlich nicht ausgereicht. Und wenn die Stanton sich nicht abgesetzt hätte, hätte er sie sich womöglich unter den Nagel gerissen, und wir wären jetzt draußen. Richtig?«
»Ja«, gab Maury verdrießlich zu.
Mein Vater räusperte sich. »Aber Mr. Barrows ist ein ehrenwerter Mann. Wo er doch so viel soziales Engagement an den Tag legt – dieser Brief, den mein Sohn mir gezeigt hat, über die Mieter, die er beschützt.«
Maury nickte.
Pris klopfte meinem Vater auf die Schulter. »Ja, Jerome. Er ist ein sehr engagierter Mann. Er wird dir gefallen.«
Mein Vater strahlte erst Pris an, dann mich. »Na, sieht doch ganz danach aus, dass sich alles zum Guten wendet, nicht wahr?«
Wir nickten alle, auf unseren Gesichtern eine Mischung aus Bedrückung und Angst.
Die Tür ging auf, und Bob Bundy kam herein, ein zusammengefaltetes Blatt in der Hand. Er gab es mir. »Ein Brief von Lincoln.«
Ich faltete ihn auf.
Sehr geehrter Mr. Rosen,
ich möchte mich nach Ihrem Zustand erkundigen. In der Hoffnung, dass es Ihnen ein wenig besser geht.
Hochachtungsvoll
A. Lincoln
»Ich gehe mich mal bedanken«, sagte ich zu Maury.
»Ja, tu das.«
Neun
Während wir im kalten Wind auf das Flugzeug aus Seattle warteten, dachte ich: Inwieweit wird er sich von den anderen Passagieren unterscheiden?
Die Boeing 900 landete und rollte auf der Landebahn aus. Die Gangways wurden ausgefahren, die Türen geöffnet, Stewardessen halfen den Leuten hinaus. Gleichzeitig sausten Gepäckwagen umher wie große Käfer, und auf der gegenüberliegenden Seite stand mit blinkenden Warnleuchten ein Tanklastzug.
Die Passagiere strömten die Gangways hinunter. Um uns herum schoben sich Freunde und Verwandte so weit auf das Flugfeld hinaus, wie es eben gestattet war.
Maury tänzelte unruhig hin und her. »Los, gehen wir ihm guten Tag sagen.«
Pris und er marschierten los, ich folgte ihnen. Ein blau uniformierter Fluglinienangestellter wollte uns zurückschicken, doch wir ignorierten ihn. An der Gangway der ersten Klasse blieben wir stehen. Die Passagiere kamen einer nach dem anderen herunter, die meisten mit ausdruckslosen müden Gesichtern.
»Da ist er«, sagte Maury.
Ein schlanker Mann im grauen Anzug kam die Gangway hinab, ein leichtes Lächeln auf den Lippen, einen Mantel über dem Arm. Ich hatte den Eindruck, dass sein Anzug besser saß als die der anderen Männer. Zweifellos maßgeschneidert, in England oder Hongkong. Und er sah entspannter aus. Er trug eine grüne, randlose Sonnenbrille; die Haare waren, wie auf den Fotos, extrem kurz, fast schon militärisch kurz. Eine fröhlich aussehende Frau folgte ihm. Ich kannte sie bereits: Colleen Nild, unter dem Arm ein Klemmbrett und Papiere.
»Sie sind zu dritt«, stellte Pris fest.
Der andere Mann war klein, korpulent und trug einen braunen Anzug, dessen Ärmel und Hosenbeine zu lang waren; ein Mann mit rotem Gesicht, einer Doktor-Doolittle-Nase und schütteren schwarzen Haaren, die er sich um den gewölbten Schädel geklatscht hatte. Er trug eine Krawattennadel, und die Art und Weise, wie er kurzbeinig hinter Barrows herschritt, ließ mich vermuten, dass es sich um einen Rechtsanwalt handelte. Genau so stampfte der Manager eines Baseballvereins auf das Spielfeld hinaus, um gegen eine Schiedsrichterentscheidung zu protestieren. Die Haltung des Protestierens, dachte ich, ist in allen Berufen dieselbe – man bläst sich ordentlich auf, redet drauflos und fuchtelt mit den Armen.
Tatsächlich redete der Anwalt gerade auf Colleen Nild ein. Er machte einen sympathischen Eindruck auf mich, voller Energie und guter Laune, genau die Sorte Anwalt, die ich in Barrows’ Diensten erwartet hätte. Wie letztes Mal trug Colleen einen blauschwarzen Wollmantel, der wie Blei an ihr hing. Dazu Handschuhe, Hut und eine Handtasche aus Leder.
Jetzt erreichte Barrows das Ende der Gangway. Seine Augen waren hinter der Sonnenbrille nicht zu erkennen. Er hielt den Kopf leicht gesenkt, um sehen zu können, was seine Füße taten.
Maury trat vor. »Mr. Barrows!«
In einer fließenden Bewegung blieb Barrows stehen, glitt zur Seite, damit die Leute hinter ihm die Gangway verlassen konnten, und streckte die Hand aus. »Mr. Rock?«
»Ja, Sir.« Sie schüttelten sich die Hände. Wir anderen scharten uns um sie. »Das ist Pris Frauenzimmer. Und das ist mein Partner, Louis Rosen.«
»Sehr erfreut, Mr. Rosen.« Barrows gab auch mir die Hand. »Das ist Mrs. Nild, meine Sekretärin. Und dieser Gentleman hier ist Mr. Blunk, mein Rechtsanwalt. Frisch hier draußen auf dem Rollfeld, nicht wahr?« Barrows ging Richtung Flughafengebäude. So schnell, dass wir anderen hinter ihm hergaloppieren mussten wie eine Herde schwerfälliger Kühe. Blunks kurze Beine bewegten sich wie in einem mit doppelter Geschwindigkeit abgespielten Film; es schien ihm jedoch nichts ausmachen, er verströmte weiterhin gute Laune. »Boise«, verkündete er und sah sich um. »Boise, Idaho. Was werden sie sich noch alles einfallen lassen?«
Colleen Nild schloss zu mir auf. »Schön, Sie wiederzusehen, Mr. Rosen. Wir fanden dieses Stanton-Wesen sehr amüsant.«
»Ja, eine fabelhafte Konstruktion«, dröhnte Blunk. »Wir dachten, es wäre jemand vom Finanzamt.« Er grinste mich breit an.
Barrows und Maury betraten das Flughafengebäude, gefolgt von Pris, dann kam Mr. Blunk, Colleen Nild und ich bildeten das Schlusslicht. Bis wir uns alle durch das Gebäude gedrängt hatten und auf der Straßenseite waren, wo die Taxis warteten, hatten Barrows und Maury bereits die Limousine ausfindig gemacht. Der uniformierte Fahrer hielt eine der hinteren Türen auf, und Barrows und Maury stiegen ein.
»Gepäck?«, fragte ich Mrs. Nild.
»Nein. Darauf zu warten, kostet zu viel Zeit. Wir sind nur für ein paar Stunden hier, dann fliegen wir wieder zurück. Sollten wir wider Erwarten über Nacht bleiben, kaufen wir alles Nötige.«
»Aha.« Ich war einigermaßen beeindruckt.
Wir anderen stiegen ebenfalls ein. Der Fahrer setzte sich hinters Steuer, und schon waren wir unterwegs in die Stadt.
»Ich begreife nicht, wie die Stanton in Seattle eine Kanzlei eröffnen kann«, sagte Maury zu Barrows. »Sie ist überhaupt nicht berechtigt, im Staat Washington als Anwalt zu arbeiten.«
»Stimmt. Ich glaube, Sie werden sie in den nächsten Tagen wiedersehen.« Barrows bot Maury und mir eine Zigarette aus seinem Etui an.
Er agierte, wurde mir bewusst, als wäre ihm sein grauer englischer Anzug gewachsen wie einem Tier das Fell; er war ein Teil von ihm, wie seine Fingernägel und seine Zähne. Er war sich des Anzugs gar nicht bewusst, ebenso wenig wie seiner Krawatte, seiner Schuhe, seinem Zigarettenetui – er war sich der eigenen Erscheinung nicht bewusst.
So ist das also, wenn man Multimillionär ist, dachte ich. Meilenweit entfernt von unsereins, die wir uns ständig fragen, ob unser Hosenschlitz offen ist. Sam K. Barrows warf in seinem ganzen Leben keinen verstohlenen Blick zu seinem Hosenschlitz. Wenn er offen war, machte er ihn einfach zu. Wenn ich doch auch nur reich wäre!
Aber meine Aussichten waren hoffnungslos. Ich hatte es bisher nicht einmal so weit geschafft, mir Sorgen über meinen Krawattenknoten zu machen wie andere Männer. Vermutlich kam ich nie dorthin.
Außerdem sah Barrows auch noch richtig gut aus, vom Typ her wie Robert Montgomery. Nun, nicht ganz so attraktiv wie Montgomery, denn als er die Sonnenbrille abnahm, sah ich, dass die Haut unter seinen Augen geschwollen und zerknittert war. Doch er hatte diesen athletischen Körperbau, vermutlich vom regelmäßigen Training in seiner eigenen Sporthalle. Und er hatte einen erstklassigen Arzt, der ihm verbot, billigen Fusel zu trinken oder in Schnellrestaurants zu essen. Er aß wahrscheinlich auch nie Schweinefleisch, immer nur Lammfilet und Steak und Roastbeef und so was, und natürlich hatte er mit einer solchen Ernährung kein Gramm zu viel auf den Rippen. Das deprimierte mich noch mehr.
Jetzt wurde mir klar, wie die Sechskilometerläufe morgens um fünf da hineinpassten. Der exzentrische junge Millionär, dessen Foto wir in Look gesehen hatten, würde nicht mit vierzig an Herzproblemen sterben; er hatte vor, am Leben zu bleiben und sich seines Vermögens zu erfreuen. Keine Witwe würde es erben, auch wenn das Klischee es anders wollte.
Exzentrisch? Quatsch!
Clever.
Es war kurz nach sieben, als wir die Innenstadt erreichten und unsere Gäste verkündeten, dass sie noch nicht zu Abend gegessen hätten. Ob wir ein gutes Restaurant in Boise wüssten?
Leider gibt es in Boise kein gutes Restaurant.
»Irgendeinen Laden, wo wir gebratene Garnelen oder so was kriegen«, sagte Barrows. »Wir hatten ein paar Drinks während des Fluges, aber keiner von uns hat etwas gegessen.«
Schließlich fanden wir ein ganz passables Lokal. Der Kellner führte uns nach hinten zu einer hufeisenförmigen Nische. Wir legten unsere Mäntel ab, setzten uns und bestellten etwas zu trinken.
»Haben Sie Ihr erstes Geld wirklich beim Pokern gemacht?«, fragte ich Barrows.
»Nein, beim Würfeln. Bei einem sechs Monate dauernden Würfelspiel, um ganz genau zu sein. Das war meine Militärzeit. Pokern muss man können – ich habe Glück.«
»Sie sind aber nicht aus purem Glück ins Immobiliengeschäft gekommen«, meldete sich Pris.
»Nein, das war, weil meine Mutter früher Zimmer vermietet hat, in unserer alten Wohnung in L.A.«
»Und Sie sind auch nicht aus purem Glück zum Streiter für die Gerechtigkeit geworden, der vor den Supreme Court gezogen ist und sich gegen die Space Agency und ihre Monopolisierung ganzer Planeten durchgesetzt hat.«
Barrows sah sie lächelnd an. »Sie sind sehr großzügig in Ihrer Darstellung. Ich besaß meiner Meinung nach Besitzansprüche auf lunares Land und wollte die Rechtmäßigkeit dieser Ansprüche so weit juristisch abklopfen lassen, dass sie nie wieder jemand infrage stellen kann. Aber sagen Sie, wir sind uns schon einmal begegnet?«
»Ja.« Pris strahlte.
»Ich weiß nur nicht, wo ich Sie hintun soll. Helfen Sie mir!«
»Es war nur für einen kurzen Moment. In Ihrem Büro. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, dass Sie sich nicht erinnern können. Aber ich kann mich an Sie erinnern.«
»Sie sind Rocks Tochter?«
»Ja.«
Pris sah heute um einiges besser aus. Sie hatte sich die Haare machen lassen und trug genug Make-up, um ihre Blässe zu verbergen, aber nicht so viel, dass sie wieder dieses schrille, maskenhafte Aussehen bekam. Jetzt, wo sie ihren Mantel abgelegt hatte, sah ich, dass sie einen hübschen kurzärmeligen Jersey-Pullover und über der rechten Brust eine goldene Brosche in Form einer Schlange trug. Mein Gott, dachte ich, sie hat sogar einen BH an, einen von denen, die für Oberweite sorgen, wo keine vorhanden ist. Für diesen besonderen Anlass hatte Pris sich also einen Busen zugelegt.
»Sind Sie sicher«, dröhnte Blunk plötzlich und zeigte auf Maury, »dass dieser alte Schwerenöter wirklich Ihr Vater ist? Oder ist es nicht vielmehr so, Sir, dass Sie sich einer Sünde schuldig machen, der Unzucht mit Minderjährigen? Schande über Ihr Haupt!« Er grinste bräsig.
»Sie wollen Sie ja nur für sich selbst, Blunk.« Barrows biss einer Garnele den Schwanz ab und legte ihn beiseite. »Woher wollen Sie wissen, dass sie nicht auch eines von diesen Simulacra ist, wie die Stanton?«
»Dann nehm ich gleich ein Dutzend«, rief Blunk. Seine Augen leuchteten.
»Sie ist wirklich meine Tochter. Sie war etliche Jahre auf einer Schule.« Maury schien sich unwohl zu fühlen.
»Und jetzt ist sie wieder da…« Blunk senkte die Stimme und schlug Maury auf die Schulter. »In anderen Umständen, stimmt’s?«
Maury grinste gequält.
»Wissen Sie, dieser Stanton-Roboter hat uns eine Heidenangst eingejagt«, sagte Barrows nun. Seine Ellbogen ruhten auf dem Tisch, die Arme waren verschränkt. Er hatte seine Garnelen gegessen und sah sehr zufrieden aus. Für einen Menschen, der den Tag mit eingeweichten Backpflaumen begann, schien er wirklich gern zu essen. Ich empfand das als ermutigendes Zeichen.
»Ja, Leute, man kann euch nur gratulieren«, rief Blunk. »Ihr habt ein Monster geschaffen.« Er lachte laut auf. »Ich sage: Macht es kalt! Holt den Mob mit seinen Fackeln!«
Wir mussten alle lachen.
»Wie ist Frankensteins Monster am Ende eigentlich gestorben?«, fragte Colleen Nild.
»Erfroren«, erwiderte Maury. »Das Schloss ist niedergebrannt, und sie haben das Feuer gelöscht, und das Wasser wurde zu Eis.«
»Im nächsten Film allerdings haben sie es im Eis gefunden«, sagte ich. »Und es dann wieder zum Leben erweckt.«
Blunk schlug mit der Hand auf den Tisch. »Es ist in einer brodelnden Lavagrube versunken. Ich war dabei. Ich besitze einen Knopf von seinem Mantel.« Er zog einen Knopf aus der Tasche und zeigte ihn uns. »Vom weltberühmten Frankenstein-Monster.«
»Der ist von deiner Weste, David«, sagte Mrs. Nild.
»Was?« Blunk starrte finster an sich hinab. »Tatsächlich! Der Knopf ist von mir.« Er lachte erneut.
Barrows, der sich mit dem Daumennagel die Zähne säuberte, wandte sich Maury und mir zu. »Wie viel hat es Sie gekostet, den Stanton-Roboter zusammenzuschrauben?«
»Ungefähr fünftausend«, erwiderte Maury.
»Und für wie viel lässt er sich in großen Stückzahlen herstellen? Sagen wir, ein paar hunderttausend?«
»Ich würde sagen, um die sechshundert Dollar. Vorausgesetzt, dass sie identisch sind, die gleichen Zentralmonaden haben und die gleichen Speicherinhalte.«
»Im Grunde ist das Ganze eine lebensgroße Version dieser Sprechpuppen, die früher so beliebt gewesen sind.«
»Nicht ganz.«
»Na, er spricht aber und läuft herum. Er hat den Bus nach Seattle genommen. Ist das nicht einfach ein weiterentwickelter Roboter? Worauf ich hinauswill, ist, dass an der Sache eigentlich nichts neu ist, oder?«
Stille.
»Aber ja.« Maury sah nicht sonderlich vergnügt aus.
Und auch Pris schien plötzlich ihre gute Laune verloren zu haben.
»Nun, dann verdeutlichen Sie mir das doch bitte.« Barrows nippte an seinem Glas Green Hungarian.
»Das ist alles andere als ein Roboter, Sir. Kennen Sie die Arbeiten von William Grey Walter in England? Seine ›Schildkröten‹? Das nennt man ein homöostatisches System. Es ist von seiner Umwelt unabhängig, regelt sich selbst. Wie die vollautomatische Fabrik, die sich selbst repariert. Wissen Sie, was mit ›Rückkopplung‹ gemeint ist? In elektrischen Systemen gibt es…«
Blunk legte Maury eine Hand auf die Schulter. »Was Mr. Barrows wissen möchte, hat mit der, wenn ich so sagen darf, Patentfähigkeit Ihrer Roboter zu tun.«
Mit ruhiger, beherrschter Stimme sagte Pris: »Wir stehen unter vollem Patentschutz. Wir haben eine hervorragende Rechtsvertretung.«
Barrows lächelte sie an. »Das höre ich gern. Anderenfalls gäbe es nämlich nichts zu kaufen.«
»Zahllose Bestandteile sind neu«, fuhr Maury fort. »Das Stanton-Simulacrum verkörpert die jahrelangen Mühen etlicher staatlicher und nicht-staatlicher Forscherteams, und wir sind alle mehr als erfreut, ja sogar verblüfft über die Ergebnisse. Wie Sie selbst gesehen haben, als die Stanton in Seattle aus dem Greyhound gestiegen ist und sich ein Taxi zu Ihrem Büro genommen hat.«
»Sie ist zu Fuß gegangen.«
»Wie bitte?«
»Ich sagte, sie ist vom Busbahnhof zu Fuß zu meinem Büro gegangen.«
»Wie auch immer.« Maury lehnte sich zurück. »Was wir hier erreicht haben, hat es in der Elektronikbranche noch nicht gegeben.«
Nach dem Essen fuhren wir nach Ontario und kamen um zehn bei MASA Associates an.
»Merkwürdiges Städtchen.« Blunk betrachtete die leeren Straßen. »Alle schon im Bett.«
»Warten Sie, bis Sie die Lincoln sehen«, sagte Maury, als wir ausstiegen.
Beim Schaufenster blieben unsere Gäste stehen und lasen das Schild, das Maury angebracht hatte.
»Klingt ja toll.« Barrows legte die Stirn an die Scheibe und spähte hinein. »Ist nur keine Spur von ihr zu sehen. Was macht sie denn nachts, schlafen? Oder lassen Sie jeden Nachmittag um fünf, wenn die meisten Passanten unterwegs sind, einen Attentäter auf die Lincoln los?«
Maury schloss die Tür auf. »Sie ist vermutlich unten in der Werkstatt. Wir sehen mal nach.«
Kurz darauf standen wir alle in der Werkstatt. Maury machte Licht.
Und dort war die Lincoln. Sie hatte allein im Dunklen gesessen.
»Mr. President«, entfuhr es Barrows. Ich sah, wie er Mrs. Nild einen kleinen Schubs gab. Blunk grinste mit der gierigen Miene einer ausgehungerten, aber zuversichtlichen Katze; er genoss das Ganze. Colleen Nild reckte den Kopf und schnappte sichtlich beeindruckt nach Luft. Barrows wiederum wusste genau, was er zu tun hatte. Er streckte der Lincoln nicht etwa die Hand entgegen; er blieb als Respektsbezeugung ein paar Schritt vor ihr stehen.
Die Lincoln wandte den Kopf und sah ihn schwermütig an. Eine solche Hoffnungslosigkeit hatte ich noch nie in einem Gesicht gesehen. Ich zuckte zurück, Maury ebenfalls. Pris reagierte überhaupt nicht, sie blieb einfach in der Tür stehen. Die Lincoln erhob sich langsam, und der schmerzliche Ausdruck verschwand aus ihrem Gesicht. Mit brüchiger, schriller Stimme, die überhaupt nicht zu ihrer hochgewachsenen Gestalt passen wollte, sagte sie: »Ja, Sir.« Sie betrachtete Barrows freundlich und interessiert. Ihre Augen blinzelten leicht.
»Meine Name ist Sam Barrows. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen, Mr. President.«
»Vielen Dank, Mr. Barrows. Wollen Sie und Ihre Freunde es sich nicht bequem machen?«
Blunk riss mit einem Pfeifen die Augen auf. Er klopfte mir auf den Rücken. »Donnerwetter.«
»Sie erinnern sich an mich, Mr. President«, sagte ich zu dem Simulacrum.
»Ja, Mr. Rosen.«
»Und was ist mit mir?«, fragte Pris.
Die Maschine deutete eine Verbeugung an. »Miss Frauenzimmer. Und Sie, Mr. Rock – der Fels, auf dem das alles hier gebaut ist, nicht wahr?« Sie lachte in sich hinein. »Der Eigentümer oder Miteigentümer, wenn ich mich nicht irre.«
Maury fuhr sich durch die Haare. »Darf ich fragen, was Sie hier gerade gemacht haben?«
»Ich habe über eine Bemerkung von Lyman Trumbull nachgedacht. Wie Sie wissen, hat sich Richter Douglas mit Buchanan getroffen, und sie haben über die Zuordnung von Kansas unter die Lecompton Constitution gesprochen. Richter Douglas stellte sich später quer und bekämpfte Buchanan, ungeachtet der Tatsache, dass es sich um eine Regierungsmaßnahme handelte. Ich habe Richter Douglas nicht unterstützt, im Gegensatz zu einigen Freunden in meiner Partei. Aber in Bloomington, wo ich Ende 1857 war, sah ich keine Republikaner zu Douglas überwechseln, wie es in der New York Tribune stand. Ich bat Lyman Trumbull, mir nach Springfield zu schreiben und mir zu sagen, ob…«
»Sir, verzeihen Sie bitte«, unterbrach Barrows das Simulacrum. »Wir haben etwas Geschäftliches zu erledigen, und anschließend muss ich mit diesem Gentleman, Mr. Blunk, und Mrs. Nild hier zurück nach Seattle fliegen.«
Die Lincoln verbeugte sich. »Mrs. Nild.« Sie streckte ihr die Hand hin, und mit einem Lächeln trat Colleen Nild vor und schüttelte sie. »Mr. Blunk.« Die Lincoln gab dem kleinen, dicken Anwalt ebenfalls die Hand. »Sie sind nicht zufällig mit Nathan Blunk aus Cleveland verwandt?«
»Nein, tut mir leid. Sie haben einmal als Anwalt gearbeitet, nicht wahr, Mr. Lincoln?«
»Ja, Sir.«
»Ich praktiziere ebenfalls.«
»Ah ja. Sie besitzen also die göttliche Gabe, über Nichtigkeiten zu streiten.«
Blunk brach in ein herzhaftes Lachen aus.
»Mr. President«, meldete sich Barrows wieder zu Wort. »Wir sind von Seattle hierher geflogen, um mit Mr. Rosen und Mr. Rock eine finanzielle Transaktion zu besprechen – die eventuelle Unterstützung von MASA Associates durch Barrows Enterprises. Bevor wir eine endgültige Entscheidung treffen, wollten wir Sie kennenlernen und mit Ihnen reden. Wir haben kürzlich die Stanton getroffen, sie kam uns besuchen. Wir würden Sie und die Stanton gerne erwerben, dazu die zugrundeliegenden Patente. Als ehemaliger Rechtsanwalt sind Sie mit derartigen Transaktionen bestimmt vertraut. Nun möchte ich Sie etwas fragen. Ist Ihnen klar, in welcher Zeit Sie sich befinden? Wissen Sie beispielsweise, was Vitamine sind? Wissen Sie, welches Jahr wir haben?«
Als die Lincoln nicht gleich etwas erwiderte, winkte Maury Barrows beiseite. Ich trat hinzu.
»Um das geht es doch gar nicht«, sagte Maury. »Sie wissen nur zu gut, dass sie nicht dafür gebaut ist, mit solchen Themen klarzukommen.«
»Stimmt. Aber ich bin eben neugierig.«
»Lieber nicht. Sie könnten einen ihrer Hauptstromkreise zum Durchbrennen bringen.«
»Ist sie dermaßen empfindlich?«
»Nein. Aber mit solchen Fragen piesacken Sie sie ganz schön.«
»Ganz und gar nicht. Sie wirkt so überzeugend lebensecht, dass ich wissen möchte, in welchem Umfang sie sich ihrer neuen Existenz bewusst ist.«
»Lassen Sie sie in Ruhe.«
»Na schön.« Barrows nickte Colleen Nild und seinem Rechtsanwalt zu. »Dann fliegen wir eben zurück nach Seattle. David, sind Sie zufrieden mit dem, was Sie sehen?«
»Nein«, dröhnte Blunk. »Sie funktioniert bei weitem nicht so gut wie die Stanton, meiner Meinung nach.«
»Wieso das denn?«, fragte Maury.
»Sie… läuft unrund.«
»Sie ist gerade erst zu sich gekommen«, warf ich ein.
Maury sah mich an. »Nein, damit hat es nichts zu tun. Sie besitzt eine andere Persönlichkeit. Stanton ist unflexibler, dogmatischer. Lincoln dagegen ist immer wieder in Grübeleien verfallen – er hat gerade eben, als wir hereinkamen, auch vor sich hin gebrütet. Zu anderen Zeiten ist er besser aufgelegt.« Er wandte sich Blunk zu. »Wenn Sie erst eine Weile mit ihm zusammen sind, werden Sie ihn auch anders erleben. Er hat eben Stimmungsschwankungen. Ich meine, das ist kein Fehler in der Programmierung – die Maschine muss so sein.«
»Verstehe.« Doch Blunk klang nicht überzeugt.
»Ich weiß, was Sie meinen, Blunk«, sagte Barrows. »Irgendetwas bei ihr scheint zu haken.«
»Genau das«, erwiderte der Anwalt. »Ich habe große Zweifel, dass die schon den letzten Schliff bekommen hat. Da sind noch etliche Fehler auszubügeln.«
»Und der Versuch, das zu vertuschen. Von wegen keine Fragen zu aktuellen Themen stellen – der ist Ihnen sicher nicht entgangen.«
»Im Gegenteil.«
Ich räusperte mich. »Bei allem Respekt, Mr. Barrows, Sie haben noch nicht ganz begriffen, worum es hier geht. Das Prinzip, das den Simulacra zugrunde liegt. Aber wir wollen uns nicht streiten, nicht wahr?« Ich lächelte.
Barrows betrachtete mich, ohne etwas zu erwidern; Blunk ebenfalls. Maury steckte sich eine Zigarre an und blies einen blauen Rauch in die Luft.
»Ich verstehe ja, dass Sie von der Lincoln enttäuscht sind«, fuhr ich fort. »Um ehrlich zu sein, mit der Stanton hatten wir alles Mögliche eingeübt.«
»Aha.« Blunks Augen blitzten.
»Die Idee kam nicht von mir. Mein Partner hier war nervös, und er wollte, dass alles klappte.« Ich nickte zu Maury hinüber. »Es war die falsche Entscheidung, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Nun geht es allein um die Lincoln-Maschine, denn sie ist die Basis unserer eigentlichen Idee. Nehmen wir sie doch einfach weiter in Augenschein.«
Wir gingen wieder zu dem großen, bärtigen Simulacrum hinüber, dem Colleen Nild und Pris gerade andächtig zuhörten.
»… zitiert mich in dem Sinne, dass die Klausel der Unabhängigkeitserklärung, die besagt, dass alle Menschen gleich sind, auch den Neger mit einschließe. Das hätte ich in Chicago gesagt, behauptet Richter Douglas und fügt hinzu, in Charleston hätte ich gesagt, dass der Neser einer niederen Rasse angehöre und das Ganze kein moralisches Problem sei, sondern eine Frage der Abstufung – nur um in Galesburg eine Kehrtwendung zu machen und nun wieder zu sagen, es sei ein moralisches Problem.« Die Lincoln bedachte uns mit einem sanften Lächeln. »Woraufhin jemand im Publikum ruft: ›Er hat ganz recht.‹ Ich war froh, dass mir jemand recht gab, denn mir selbst schien es eher, als hätte Richter Douglas mich bei den Rockschößen. Den kräftigsten Beifall bekam er, als er sagte, dass sich die Republikanische Partei im Norden der Doktrin ›Keine Sklavereistaaten mehr‹ verpflichtet hat und dass eben diese Doktrin von den Republikanern in anderen Teilen der Union nicht anerkannt wird. Und der Richter fragte sich, ob Mr. Lincoln und seine Partei nicht selbst ein Beispiel für das wären, was Mr. Lincoln aus der Heiligen Schrift zitierte – dass nämlich keine Familie, die in sich gespalten ist, Bestand haben wird. Und ob meine Prinzipien denn noch mit denen der Republikanischen Partei übereinstimmten. Leider bekam ich erst im Oktober in Quincy die Gelegenheit zu einer Entgegnung. Dort sagte ich ihm, er könne ebenso gut die Ansicht vertreten, dass ein Bienenstich das Gleiche wäre wie der Stich einer Biene. Ich hatte gewiss nicht die Absicht, politische und soziale Gleichheit zwischen der weißen und der schwarzen Rasse einzuführen. Zwischen ihnen besteht ein physischer Unterschied, der es meiner Meinung nach verbietet, auf der Grundlage absoluter Gleichheit miteinander zu leben. Aber ich denke, der Neger hat das gleiche Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück wie jeder Weiße. Er gleicht mir in vielerlei Hinsicht nicht, ganz sicher nicht in der Farbe, vielleicht auch nicht in der intellektuellen oder moralischen Kapazität – wohl aber in dem Recht, das Brot zu essen, das er mit eigener Hände Arbeit verdient, ohne dass es ihm erst jemand erlauben muss. Darin gleicht er mir und Richter Douglas und jedem anderen Menschen. In diesem Moment wurde mir einiger Jubel zuteil.«
Barrows sah mich an. »Da haben Sie aber ganz schön Text in diese Maschine eingegeben, was?«
»Sie kann sagen, was immer sie will.«
»Ganz egal was? Sie meinen, sie will hier Volksreden halten? Nein, in meinen Augen ist das hier nichts weiter als der altbekannte mechanische Mensch, nur ein bisschen aufgemotzt mit historischem Schnickschnack. Genau so ein Spielzeug wurde 1939 auf der Weltausstellung in San Francisco vorgestellt, Pedro der Voder.«
Der Wortwechsel zwischen Barrows und mir war der Aufmerksamkeit der Lincoln nicht entgangen. Sie wandte sich an Barrows. »Habe ich nicht erst vor Kurzem gehört, wie Sie die Absicht äußerten, mich ›erwerben‹ zu wollen, als eine Art Besitzstück? Habe ich das richtig in Erinnerung? Wenn ja, dann stünde die Frage im Raum, wie Sie das denn tun können, wo doch Miss Frauenzimmer mir erzählt hat, dass es heute eine größere Verständigung zwischen den Rassen gibt als je zuvor. Ich bringe vielleicht etwas durcheinander, aber soweit ich weiß, kann man heute weltweit keine Menschen mehr ›erwerben‹, nicht einmal in Russland, wo schlimme Zustände herrschen sollen.«
»Das trifft jedoch nicht auf mechanische Menschen zu«, entgegnete Barrows.
»Meinen Sie etwa mich damit?«
Barrows lachte. »Genau das.«
»Hätten Sie dann die Güte, Sir, mir zu sagen, was ein Mensch ist?«
»Ja, hätte ich.« Barrows sah grinsend zu Blunk. »Ein Mensch ist ein gegabelter Rettich. Ist Ihnen diese Definition geläufig, Mr. Lincoln?«
»Ja, Sir. Shakespeare lässt seinen Falstaff das sagen, nicht wahr?«[i]
»Richtig. Und ich möchte noch ergänzen: Der Mensch lässt sich als ein Tier definieren, das ein Taschentuch bei sich hat. Wie gefällt Ihnen das? Das ist nicht von Shakespeare.«
Das Simulacrum lachte herzhaft. »Ganz sicher nicht. Ich schätze Ihren Humor, Mr. Barrows. Dürfte ich diese Bemerkung in einer Rede verwenden?«
Barrows nickte.
»Vielen Dank. Nun haben Sie den Menschen also als ein Tier definiert, das ein Taschentuch bei sich hat. Aber was ist ein Tier?«
»Sie sind jedenfalls keines, das kann ich Ihnen sagen. Ein Tier ist von biologischer Herkunft und Beschaffenheit, und an beidem mangelt es Ihnen. Sie bestehen aus Platinen und Kabeln und Schaltern. Sie sind eine Maschine. Wie eine…« Barrows überlegte. »Eine Dampfmaschine.« Er zwinkerte Blunk zu. »Kann eine Dampfmaschine unter dem Schutz der von Ihnen zitierten Verfassungsklausel stehen? Hat sie wie ein Mensch das Recht, das von ihr hergestellte Brot zu essen?«
»Kann eine Maschine reden?«
»Aber sicher. Radios, Diktiergeräte, Kassettenrekorder, Telefone – sie quasseln alle wie verrückt.«
Die Lincoln dachte kurz nach. »Und was, Sir, ist dann eine Maschine?«
»Sie sind eine. Diese Leute hier haben Sie gebaut. Sie gehören diesen Leuten.«
Das faltige, dunkelbärtige Gesicht der Lincoln verzog sich, während sie auf Barrows hinunterblickte. »Dann sind auch Sie, Sir, eine Maschine. Denn auch Sie haben einen Schöpfer. Und Er hat Sie genauso wie ›diese Leute hier‹ nach Seinem Bild gemacht. Ich glaube, Spinoza hatte diese Ansicht über Tiere – dass sie schlaue Maschinen sind. Der kritische Punkt ist, meine ich, die Seele. Eine Maschine kann alles, was ein Mensch kann – dem werden Sie zustimmen. Aber sie besitzt keine Seele.«
»Es gibt keine Seele. Das sind Hirngespinste.«
»Dann ist eine Maschine genau das Gleiche wie ein Tier. Und ein Tier ist genau das Gleiche wie ein Mensch. Trifft das nicht zu?«
»Ein Tier ist aus Fleisch und Blut, und eine Maschine ist aus Kabeln und Platinen, so wie Sie. Was soll das alles? Sie wissen verdammt gut, dass Sie eine Maschine sind. Als wir hereingekommen sind, haben Sie hier im Dunkeln gesessen und darüber nachgedacht. Ich weiß, dass Sie eine Maschine sind, und es ist mir egal. Mir ist nur nicht egal, ob Sie funktionieren oder nicht. Und Sie funktionieren nicht gut genug, um mein Interesse zu wecken. Vielleicht später einmal, wenn die meisten Fehler ausgemerzt sind. Sie können ja nicht mehr, als Reden über Richter Douglas und irgendwelches politisches Zeugs zu schwingen. Wer will das hören?« Barrows wandte sich seinem Anwalt zu. »Ich glaube, wir machen uns besser wieder auf den Weg nach Seattle.« Und zu Maury und mir sagte er: »Hier ist meine Entscheidung. Wir beteiligen uns, aber nur, wenn wir die Mehrheitsanteile bekommen, damit wir die Firmenpolitik bestimmen können. Diese Bürgerkriegsidee etwa ist der reinste Unsinn.«
Ich schluckte. »Wie bitte?«
»Sie haben ganz recht gehört. Dieser Bürgerkriegsplan könnte nur auf eine einzige Weise akzeptablen Profit bringen. Und die würde Ihnen in tausend Jahren nicht einfallen. Den Bürgerkrieg mit Robotern erneut austragen, ja. Aber Profit wird das nur abwerfen, wenn man auf das Ergebnis Wetten platzieren kann.«
»Auf welches Ergebnis?«
»Welche Seite gewinnt. Die Blauen oder die Grauen.«
Blunk machte ein nachdenkliches Gesicht. »So wie bei einem Liga-Endspiel.«
Barrows nickte. »Genau.«
»Aber der Süden könnte gar nicht gewinnen«, sagte Maury. »Ihm fehlt die Industrie.«
»Dann entwickeln Sie eben ein Handicap-System.«
»Das… meinen Sie nicht ernst«, brachte ich stotternd hervor.
»Ernster geht’s nicht.«
»Ein Nationalepos ummünzen? In ein Pferderennen? Ein Hunderennen? Eine Lotterie?«
Barrows zuckte mit den Schultern. »Diese Idee ist eine Million Dollar wert. Mindestens. Wenn sie Ihnen nicht zusagt, lassen Sie’s. Aber eins sage ich Ihnen: Geld bringen Ihnen Ihre Puppen mit dieser Bürgerkriegssache nur so ein. Ich würde sie ja ganz anders einsetzen. Ich weiß, woher Sie Ihren Ingenieur Robert Bundy haben. Er hat vorher bei der Federal Space Agency an deren Simulacra gearbeitet. Die Stanton und die Lincoln sind nur geringfügige Modifikationen von Regierungsapparaturen.«
»Weitreichende Modifikationen«, korrigierte Maury heiser. »Die staatlichen Simulacra sind einfach nur Maschinen, die über eine atmosphärelose Oberfläche krabbeln, auf der der Mensch nie leben könnte.«
»Ich werde Ihnen sagen, was mir vorschwebt, Mr. Rock. Können Sie Simulacra herstellen, die wie Freunde daherkommen?«
»Bitte?«
»Simulacra, die genauso aussehen wie die Familie von nebenan. Eine freundliche, hilfsbereite Familie, die man gern als Nachbarn hat. Leute, wie man sie aus seiner Kindheit in Omaha, Nebraska oder sonstwo kennt.«
»Sie meinen, Sie wollen sie als Massenware verkaufen.«
»Nicht verkaufen. Verschenken. Die Kolonisierung muss endlich in die Gänge kommen, sie ist schon viel zu lange hinausgezögert worden. Aber der Mond ist kahl und unwirtlich, es ist schwer, irgendjemanden zu finden, der den Anfang macht. Sie kaufen Land, aber niemand lässt sich darauf nieder. Wir wollen dort Städte entstehen lassen. Um das zu ermöglichen, müssen wir für eine erste Besiedlungswelle sorgen.«
»Und werden die echten Siedler wissen, dass ihre Nachbarn bloß Simulacra sind?«, fragte ich.
»Selbstverständlich.«
»Sie würden sie nicht zu täuschen versuchen?«
»Nein«, warf Blunk ein. »Das wäre Betrug.«
Maury und ich wechselten einen Blick.
»Sie würden ihnen Namen geben«, sagte ich. »Gute alte amerikanische Namen. Die Edwards – Bill und Mary Edwards und ihr Sohn Tim, der sieben ist. Sie ziehen zum Mond. Sie haben keine Angst vor der Kälte und der fehlenden Atemluft und den kahlen Einöden.«
Barrows betrachtete mich neugierig.
»Und während mehr und mehr Menschen anbeißen, können Sie heimlich, still und leise die Simulacra wieder zurückziehen. Die Edwards und die Jones und alle anderen – sie würden ihre Häuser verkaufen und wegziehen.
Bis Ihre Parzellen schließlich alle von richtigen Menschen bewohnt sind. Und niemand hätte es je mitbekommen.«
»Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das gut geht«, sagte Maury. »Irgendein echter Siedler könnte versuchen, mit Mrs. Edwards ins Bett zu gehen, und dann würde er es rauskriegen. Man weiß ja, wie es in derartigen Siedlungen zugeht.«
Blunk grinste schmierig. »Wunderbar!«
»Ich bin überzeugt davon, dass es funktionieren würde«, sagte Barrows ruhig.
»Was bleibt Ihnen anderes übrig? Ihnen gehören diese ganzen Parzellen Land da oben. Und die Leute haben offenbar keine Lust auszuwandern. Ich dachte eigentlich, dass nur die strengen Gesetze sie daran gehindert haben.«
»Ja, die Gesetze sind streng. Aber wir wollen uns doch nichts vormachen. Sobald man die Gegend dort oben gesehen hat… Die meisten Menschen haben nach zehn Minuten genug. Ich bin selbst oben gewesen. Und ich habe nicht vor, noch mal hinzufliegen.«
»Nun, danke für die offenen Worte, Barrows«, sagte ich.
Er sah mich an. »Ich weiß, dass die Regierungs-Simulacra auf der Mondoberfläche gut funktioniert haben. Und ich weiß, was Sie hier haben: eine Modifikation dieser Simulacra. Ich will also nur, dass Sie eine weitere Modifikation vornehmen. Irgendein anderes Arrangement steht nicht zu Debatte. Von der Planetenerkundung abgesehen ist der Marktwert Ihrer Simulacra gleich null. Diese ganze Bürgerkriegsgeschichte ist doch Quatsch. Wenn Sie mit mir ins Geschäft kommen wollen, dann nur so, wie ich es gerade umrissen habe.«
Ich starrte Barrows mit offenem Mund an. Meinte er das wirklich ernst? Simulacra, die sich als menschliche Kolonisten ausgaben und auf dem Mond wohnten, um die Illusion einer aufblühenden Stadt zu schaffen? Wohnzimmer mit Mutter-Vater-Kind-Simulacra, die so taten, als ob sie zu Abend äßen und auf die Toilette müssten? Was für eine schreckliche Vorstellung. Damit also wollte der Mann aus seinen Schwierigkeiten herauskommen. Sollten wir uns davon abhängig machen?
Maury paffte betrübt an seiner Zigarre; seine Gedanken bewegten sich zweifellos in eine ähnliche Richtung.
Und dennoch verstand ich Barrows’ Position. Er musste Menschen in großer Zahl davon überzeugen, dass die Auswanderung zum Mond erstrebenswert war; seine wirtschaftliche Zukunft hing davon ab. Und wer weiß, vielleicht heiligte der Zweck ja die Mittel. Die Menschheit musste ihre Angst besiegen, musste zum ersten Mal in ihrer Geschichte in eine extraterrestrische Umwelt vordringen. Damit ließ sie sich vielleicht überzeugen. Rein materiell betrachtet würde es ja an nichts fehlen – nur die psychische Realität war eben furchtbar, die Ausstrahlung der lunaren Umwelt. Nichts, das lebte, nichts, das wuchs, alles blieb ewig gleich. Ein hell erleuchtetes Haus nebenan, mit einer Familie, die am Frühstückstisch saß und vergnügt plauderte – Barrows konnte das zur Verfügung stellen, wie er Luft, Wärme und Wasser zur Verfügung stellen würde.
Das musste man ihm lassen: Es war eine glänzende Idee, bis auf einen einzigen Unsicherheitsfaktor. Offensichtlich würde jede Anstrengung unternommen werden, das Geheimnis zu wahren. Doch wenn diese Anstrengungen versagten, wenn die Sache ans Licht kam, drohte ihm der finanzielle Ruin, ja vielleicht würde er sogar ins Gefängnis dafür kommen. Und wir – mitgefangen, mitgehangen.
Wie viel von Barrows’ Imperium war noch auf diese Weise entstanden? Schöne Fassaden, die eine arglistige Täuschung verbargen…
Es gelang mir schließlich, unsere Gäste zu überreden, die Nacht in einem Motel in der Nähe zu verbringen und erst tags darauf nach Seattle zurückzufliegen. Dann zog ich mich zurück und rief meinen Vater in Boise an.
»Er will uns da in etwas hineinziehen, das zu groß für uns ist«, erzählte ich ihm. »Wir sind diesem Burschen nicht gewachsen.«
Mein Vater klang schläfrig; offenbar war er bereits im Bett gewesen. »Dieser Barrows, ist er gerade da?«
»Ja. Und er ist brillant. Er hat sogar mit der Lincoln debattiert und ist überzeugt, gewonnen zu haben. Vielleicht hat er ja gewonnen. Er hat Spinoza zitiert, über Tiere, die nichts als schlaue Maschinen sind. Nein, das war die Lincoln, nicht Barrows. Hat Spinoza das tatsächlich gesagt?«
»Bedauerlicherweise.«
»Wann kannst du kommen?«
»Heute Nacht nicht mehr.«
»Dann morgen. Sie bleiben über Nacht. Wir machen Schluss für heute und setzen uns morgen wieder zusammen. Wir brauchen deinen Humanismus, also sieh zu, dass du morgen da bist.«
Ich legte auf und ging zu den anderen zurück. Die fünf – sechs, wenn man das Simulacrum mitrechnete – waren am Plaudern.
»Wir gehen noch um die Ecke einen Schlummertrunk nehmen«, sagte Barrows zu mir. »Sie kommen doch bestimmt mit.« Er sah die Lincoln an. »Die hätte ich auch gern dabei.«
Ich ächzte, erklärte aber mein Einverständnis.
Kurz darauf saßen wir in einer Bar. Die Lincoln hatte während unserer Bestellung geschwiegen, doch Barrows hatte ihr einen Tom Collins geordert. Nun gab er ihr das Glas.
»Cheers«, sagte Blunk zu der Maschine und hob seinen Whisky Sour.
»Ich bin zwar kein Abstinenzler«, entgegnete sie mit ihrer merkwürdig hohen Stimme, »aber ich trinke nur selten etwas.« Sie nahm ihren Drink misstrauisch in Augenschein und nippte daran.
»Ihr Jungs hättet festeren Boden unter den Füßen gehabt«, ließ sich Barrows vernehmen, »wenn ihr eure Position besser ausgearbeitet hättet. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Was immer eure menschengroße Puppe als vermarktbare Idee wert ist – die Idee, sie in der Raumforschung einzusetzen, ist mindestens genauso viel wert, vielleicht sogar mehr. Also heben die beiden Ideen sich gegenseitig auf. Seht ihr das nicht auch so?« Er sah uns an.
»Auf die Idee mit der Raumforschung«, sagte ich, »ist die Regierung gekommen.«
»Dann eben meine Modifikation dieser Idee. Worauf ich hinaus will, ist, dass es sich ausgleicht.«
»Ich weiß nicht, was Sie damit meinen, Mr. Barrows«, warf Pris ein. »Was gleicht sich aus?«
»Ihre Idee – die Simulacra, die man nicht von Menschen unterscheiden kann – und unsere Idee, sie auf Luna in ein modernes Haus zu stecken und Edwards zu nennen.«
»Das war Louis’ Idee«, rief Maury. »Das mit den Edwards. Stimmt’s, Louis?«
»Ja.« Jedenfalls nahm ich es an. Bloß weg hier, dachte ich. Der drückt uns immer weiter an die Wand.
Die Lincoln saß da und nippte an ihrem Tom Collins.
»Wie schmeckt Ihnen der Drink, Mr. President?«, fragte Barrows.
»Gut. Sehr aromatisch. Aber er trübt die Sinne.« Dennoch nippte sie erneut daran.
Genau das, was wir brauchen, schoss es mir durch den Kopf. Getrübte Sinne!
Zehn
Wir machten für den Abend Schluss. »Nett, Sie kennengelernt zu haben, Mr. Barrows.« Ich streckte ihm die Hand hin.
»Gleichfalls.« Er schüttelte mir die Hand, dann Maury und Pris. Die Lincoln stand ein Stück abseits und sah mit traurigem Gesicht zu. Barrows bot ihr nicht die Hand an, und er sagte auch nicht auf Wiedersehen zu ihr.
Darauf gingen wir vier zurück zu MASA Associates und atmeten dabei die kalte Nachtluft ein. Die Luft roch gut, sie klärte unsere Köpfe. Zurück im Büro zogen wir den Old Crow hervor. Wir nahmen Pappbecher und schenkten uns Bourbon und Wasser ein.
»Wir sind in Schwierigkeiten«, sagte Maury.
Wir anderen nickten.
»Was halten Sie davon?«, wandte er sich an die Lincoln. »Was ist Ihre Meinung von ihm?«
»Er ist wie die Krabbe, die vorankommt, indem sie seitwärtsläuft.«
»Und das bedeutet?«, fragte Pris.
»Ich weiß, was er damit sagen will.« Maury nahm einen tiefen Schluck. »Der Bursche hat uns dermaßen in die Knie gezwungen, dass wir nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Wir sind Memmen. Memmen!« Er zeigte auf mich. »Und wir zwei nennen uns Geschäftsleute. Dabei haben wir uns über den Tisch ziehen lassen. Hätten wir nicht vertagt, würde die Firma jetzt schon ihm gehören.«
»Mein Vater…«, begann ich.
»Dein Vater! Der ist ja noch bescheuerter als wir. Ich wünschte, wir hätten uns nie mit diesem Barrows eingelassen. Jetzt werden wir ihn nicht wieder los.«
»Wir müssen ja nicht mit ihm ins Geschäft kommen«, sagte Pris.
Ich nickte. »Wir sagen ihm einfach, er soll wieder zurück nach Seattle fliegen.«
»Macht keine Witze! Wir können ihm überhaupt nichts sagen. Der wird morgen früh frisch und munter hier vor der Tür stehen. Und uns zermalmen.« Maury starrte mich an.
»Also, ich glaube, Barrows ist verzweifelt. Sein Projekt, die Kolonisierung des Mondes, steht vor dem Scheitern, merkt ihr das nicht auch? Wir haben keinen mächtigen, erfolgreichen Unternehmer vor uns. Sondern jemanden, der sein ganzes Geld in Wohnsiedlungen auf dem Mond gesteckt hat, in Kuppeln zur Wärme- und Luftversorgung und in Konverter, die Eis in Wasser umwandeln. Und jetzt kriegt er die Leute nicht dazu, dorthin zu ziehen. Ich habe eher Mitleid mit ihm.«
Die anderen sahen mich aufmerksam an.
»Um sich zu retten, hat er sich jetzt zu diesem Betrug entschlossen. Zu Städten voller Simulacra, die so tun, als wären sie menschliche Siedler. Aus diesem Plan spricht die reinste Verzweiflung. Zugegeben, als ich vorher davon gehört habe, hielt ich es für möglich, dass es sich um eine dieser hochfliegenden Visionen handelt, die Männer von Barrows’ Schlag haben, die wir anderen nie haben, weil wir Normalsterbliche sind. Aber jetzt bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, er ist so in Panik, dass er nicht mehr klar denken kann. Die Idee ist völlig abwegig. Damit kann er doch nicht ernsthaft irgendwen täuschen wollen. Die Regierung würde es sofort spitz kriegen.«
»Und wie?«, fragte Maury.
»Das Gesundheitsministerium überprüft jede auswanderungswillige Person. Wie also will Barrows die Simulacra auch nur von der Erde fortkriegen?«
Maury winkte ab. »Ich meine, es steht uns überhaupt nicht zu, zu beurteilen, wie vernünftig der Plan ist. Wer sind wir denn? Nur die Zeit wird es erweisen, und wenn wir nicht mit ihm ins Geschäft kommen, dann nicht mal sie.«
»Das sehe ich auch so«, sagte Pris. »Wir sollten uns darauf beschränken, was für uns herausspringen könnte.«
»Gar nichts, wenn die Sache auffliegt und er dafür ins Gefängnis wandert«, erwiderte ich. »Und das wird er. Ich bin der Meinung, wir sollten uns aus der Sache raushalten. Mit diesem Menschen sollten wir keine Geschäfte machen. Es ist unsicher, riskant und schlichtweg bescheuert. Unsere eigenen Ideen sind schon verrückt genug.«
»Könnte Mr. Stanton hierher kommen?«, fragte die Lincoln unvermittelt.
Maury wandte den Kopf. »Wie bitte?«
»Ich denke, es wäre von Vorteil, wenn Mr. Stanton bei uns wäre anstatt in Seattle, wo er sich Ihren Worten nach befindet.«
Wir sahen uns alle an.
»Sie hat recht«, sagte Pris. »Wir sollten die Stanton zurückholen. Sie wäre uns hier von Nutzen. Sie ist so stur.«
Ich nickte. »Ja, eisernen Willen können wir gebrauchen. Wir haben zu wenig davon.«
»Wir können sie zurückholen«, sagte Maury. »Sogar noch heute Nacht. Wir chartern ein Privatflugzeug, fliegen nach Seattle, treiben die Stanton auf und fliegen gleich wieder zurück. Dann ist sie morgen früh dabei, wenn wir uns Barrows stellen.«
»Aber dann wären wir völlig kaputt«, entgegnete ich. »Wir würden auf dem Zahnfleisch gehen. Und vielleicht dauert es ja auch viel länger, sie zu finden. Vielleicht ist sie inzwischen gar nicht mehr in Seattle. Sie könnte nach Alaska oder nach Japan geflogen sein – oder sogar zu einer von Barrows’ Siedlungen auf dem Mond.«
Wir nippten missmutig an unseren Pappbechern, nur die Lincoln nicht, sie hatte ihren beiseitegestellt.
»Hat von euch jemand je Känguruschwanzsuppe gegessen?«, fragte Maury in die Stille hinein. Wir sahen ihn alle an. »Ich hab hier noch irgendwo eine Dose. Wir können sie heiß machen. Schmeckt sehr lecker.«
»Für mich nicht«, sagte ich.
»Nein, danke«, sagte Pris.
Das Simulacrum lächelte sein sanftes Lächeln.
»Na schön, dann nicht. Aber wollt ihr wissen, wie ich da rangekommen bin? Ich war im Supermarkt und stand an der Kasse an. Die Kassiererin sagte zu jemandem: ›Nein, die Känguruschwanzsuppe nehmen wir demnächst aus dem Sortiment.‹ Und auf einmal ist hinter den Cornflakespackungen oder so diese hohle Stimme zu hören: ›Keine Känguruschwanzsuppe mehr? Nie mehr?‹ Und dieser Typ kommt mit seinem Wagen um die Ecke geflitzt, um die letzten Dosen aufzukaufen. Da hab ich mir auch ein paar gegriffen. Kostet mal, das muntert euch auf.«
»Ist euch aufgefallen, wie Barrows uns zermürbt?«, fragte ich. »Erst nennt er die Simulacra Roboter, dann nennt er sie Spielereien, und am Ende sind es nur noch Puppen.«
»Es ist eine Technik«, sagte Pris, »eine Verhandlungstechnik. Er gräbt uns das Wasser ab.«
»Worte«, murmelte die Lincoln, »sind Waffen.«
»Können Sie nicht irgendetwas zu ihm sagen?«, fragte ich sie. »Sie haben doch mit ihm debattiert.«
Die Lincoln schüttelte den Kopf.
Pris schnaubte. »Natürlich kann sie ihm nichts sagen. Weil sie fair argumentiert. So haben sie damals debattiert, Mitte des letzten Jahrhunderts. Barrows argumentiert nicht fair, und es gibt auch kein Publikum, das ihm auf die Finger klopft. Richtig, Mr. Lincoln?«
Das Simulacrum antwortete nicht; sein Lächeln kam mir jetzt noch trauriger vor, sein Gesicht länger und die Sorgenfalten tiefer.
»Früher war alles besser«, brummte Maury.
Aber, dachte ich, eines können wir doch tun. »Also gut, womöglich hat er die Stanton weggeschlossen. Oder sie in ihre Einzelteile zerlegen lassen, und seine Ingenieure fertigen gerade ihr eigenes, leicht abgewandeltes Modell an, damit unsere Patente nicht greifen.« Ich sah Maury an. »Haben wir wirklich Patentschutz?«
»Kommt drauf an. Du weißt ja, wie das läuft. Er kann uns die Idee mit den Simulacra klauen, jetzt wo er sie gesehen hat. Bei solchen Sachen muss man nur wissen, dass sie funktionieren, dann wird man sie irgendwann auch selbst zum Laufen kriegen.«
»Okay, dann ist es eben wie beim Verbrennungsmotor. Aber wir haben einen Vorsprung. Lasst uns so rasch wie möglich mit der Produktion beginnen. Bringen wir unsere Simulacra auf den Markt, bevor Barrows so weit ist.«
Stille.
Maury kaute an seinem Daumen. »Ich glaube, da ist was dran. Was bleibt uns auch anderes übrig? Was meinst du, kriegt dein Vater das Montageband sofort zum Laufen? Kann er so schnell umrüsten?«
»Im Handumdrehen.«
»Red keinen Unsinn«, sagte Pris. »Der alte Jerome? Schon allein für die Fertigung der Stanzen wird er ein Jahr brauchen. Und die Verkabelung wird in Japan vorgenommen werden – er wird also nach Japan müssen, um das zu arrangieren, und er wird wieder per Schiff reisen wollen, wie schon einmal.«
Ich sah sie spöttisch an. »Jedenfalls hast du auch schon dran gedacht.«
»Selbstverständlich. Ich habe es sogar ernsthaft in Erwägung gezogen.«
»Ich glaube, es ist unsere einzige Hoffnung. Wir müssen die verfluchten Dinger endlich in den Handel bringen – wir haben schon genug Zeit verschwendet.«
Maury nickte. »Okay. Wir machen Folgendes: Wir fahren morgen nach Boise und erteilen Jerome und deinem komischen Bruder Chester den Auftrag. Sie sollen sofort mit der Fertigung der Stanzen beginnen und nach Japan fliegen. Aber was sagen wir Barrows?«
Erneut Stille.
Ich räusperte mich. »Wir sagen ihm, dass die Lincoln kaputtgegangen ist. Dass sie nicht funktioniert und wir sie nicht produzieren werden. Dann wird er das Interesse an der ganzen Sache verlieren.«
Maury kam zu mir. »Du meinst, wir legen sie lahm? Schalten sie ab?«
Ich nickte.
»Gefällt mir nicht.«
Wir sahen beide verstohlen zu der Lincoln hinüber.
»Er wird natürlich darauf bestehen, sie sich selber anzusehen«, sagte Pris. »Aber soll er doch. Soll er an ihr rütteln wie an einem Kaugummiautomaten, wenn er möchte. Wenn wir sie abgeschaltet haben, gibt sie keinen Pieps mehr von sich.«
»Na schön«, brummte Maury.
Ich legte ihm die Hand auf die Schulter. »Dann ist es beschlossene Sache.«
Wir schalteten die Lincoln unverzüglich ab. Gleich darauf verkündete Maury, dass er ins Bett wolle, setzte sich ins Auto und fuhr heim. Pris bot an, mich auf dem Nachhauseweg in meinem Motel abzusetzen und am nächsten Morgen wieder abzuholen. Ich war so müde, dass ich das Angebot erfreut annahm.
»Sind alle Reichen und Mächtigen so«, fragte sie, als wir durch das schlafende Ontario fuhren.
»Klar. Alle jedenfalls, die es selbst zu etwas gebracht haben – die bloß geerbt haben vielleicht nicht.«
»Es war schrecklich, die Lincoln abzuschalten. Mit anzusehen, wie sie zu leben aufhört – als hätten wir sie noch einmal getötet. Findest du nicht auch?«
»Ja.«
Dann, als wir vor meinem Motel hielten, sagte sie: »Denkst du, dass man nur so reich werden kann? Indem man so ist wie er?« Sam K. Barrows hatte sie verändert, zweifelsohne. Aus ihr war eine desillusionierte Frau geworden.
»Frag mich nicht. Ich verdiene siebenhundertfünfzig im Monat, wenn überhaupt.«
»Aber bewundern muss man ihn schon.«
»Ich wusste, dass du das früher oder später sagen würdest.«
Pris seufzte. »Ich bin also ein offenes Buch für dich.«
»Nein, du bist das größte Rätsel, das mir je über den Weg gelaufen ist. Nur dieses eine Mal dachte ich mir: Pris sagt gleich: ›Aber bewundern muss man ihn schon.‹ Und dann hast du es gesagt.«
»Und ich wette, du glaubst auch, dass ich zu meiner alten Haltung ihm gegenüber zurückkehren werde und das ›aber‹ weglasse und ihn einfach nur wieder bewundere.«
Ich erwiderte nichts. Aber sie hatte recht.
»Ist dir aufgefallen, dass ich in der Lage war, das Abschalten der Lincoln zu ertragen? Und wenn ich das ertragen kann, dann kann ich alles ertragen. Ja, ich habe es sogar genossen, auch wenn ich mir das natürlich nicht habe anmerken lassen.«
»Du lügst wie gedruckt.«
»Nein, ich hatte ein sehr angenehmes Gefühl von Macht dabei, von absoluter Macht. Wir haben ihr das Leben geschenkt und dann – zack! – haben wir es ihr wieder genommen. Ganz einfach. Die moralische Verantwortung dafür tragen nicht wir, die trägt Sam Barrows, und er hätte nicht mit der Wimper gezuckt, er hätte einen Riesenspaß dabei gehabt. Und in Wirklichkeit wollen wir genauso sein. Ich bedauere es nicht, sie abgeschaltet zu haben – ich bedauere, dass es mich so aufwühlt. Ich verachte mich dafür, das ich so bin. Kein Wunder, dass ich mit euch hier herumkrebse und Sam Barrows ganz oben an der Spitze ist. Der Unterschied zwischen ihm und uns liegt doch auf der Hand.« Sie steckte sich eine Zigarette an und blies Rauch in die Luft. »Und was ist mit Sex?«
»Sex? Sex ist noch schlimmer als nette Simulacra abschalten.«
»Ich meine, Sex verändert einen. Die Erfahrung des Geschlechtsverkehrs.«
Es ließ mir das Blut gefrieren, sie so reden zu hören.
»Was ist mit dir?«
»Du machst mir Angst.«
»Wieso?«
»Du redest, als würdest du…«
»Als würde ich sogar auf meinen eigenen Körper von oben herabblicken. Ja, das tue ich. Ich bin nicht mein Körper. Ich bin meine Seele.«
»Und wo sind die Beweise, würde Blunk sagen.«
»Ich habe keine, aber es stimmt trotzdem. Ich bin kein physischer Körper in Raum und Zeit. Platon hatte recht.«
»Und wir anderen? Was ist mit uns?«
»Ach, das ist eure Sache. Ich nehme euch als Körper wahr, also seid ihr vielleicht welche, vielleicht ist nicht mehr an euch dran. Weißt du es denn nicht? Wenn du es nicht selber weißt, kann ich es dir auch nicht sagen.« Sie machte ihre Zigarette aus. »Ich fahre jetzt besser nach Hause, Louis.«
»Gut.« Ich öffnete die Wagentür. Das Motel war trotz der vielen Zimmer stockdunkel, sogar das große Neonschild war für die Nacht abgeschaltet worden.
»Weißt du, ich habe immer ein Diaphragma dabei.«
Ich sah sie amüsiert an. »Ein Pessar im Handtäschchen? Oder ein Zwerchfell in der Brust?«
»Das ist nicht komisch, Louis. Damit ist es mir sehr ernst – mit Sex, meine ich.«
»Dann will ich dich in deiner Ernsthaftigkeit nicht stören.« Ich machte die Tür hinter mir zu.
Pris kurbelte auf meiner Seite das Fenster hinunter. »Ich werde jetzt etwas Sentimentales sagen.«
»Nein, wirst du nicht. Weil ich nämlich nicht zuhören werde. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ernste Menschen sentimentale Anwandlungen haben. Bleib du mal lieber ein distanzierter Geist, der sich über leidende Tiere lustig macht, dann kann ich dich wenigstens…« Ich zögerte. »Dann kann ich dich wenigstens in Ruhe hassen und Angst vor dir haben.«
»Und wenn ich nun trotzdem etwas Sentimentales sage?«
»Dann gehe ich morgen ins Krankenhaus und lasse mich kastrieren oder wie man das heutzutage nennt.«
»Du willst also sagen, dass ich nur dann begehrenswert bin, wenn ich grausam und schizoid bin. Aber wenn ich sentimental werde, dann bin ich nicht mal das.«
»Das ›nicht mal‹ kannst du weglassen. Es ist verdammt viel.«
»Nimm mich mit auf dein Zimmer und besorg’s mir.«
»Weißt du, deine Sprache hat irgendwie etwas an sich, das wenig Raum für Begehren lässt.«
»Du bist doch nur feige.«
»Nein.«
»Doch.«
»Nein, aber ich werde es nicht beweisen, indem ich es tue. Ich bin wirklich nicht feige, ich habe in meinem Leben mit allen möglichen Frauen geschlafen. In Sachen Sex macht mir nichts mehr Angst, dafür bin ich einfach zu alt. Du redest von einem College-Jungen, der sich gerade seine erste Schachtel Präservative gekauft hat.«
»Trotzdem willst du nicht mit mir schlafen.«
»Nein. Weil du nicht nur distanziert bist, du bist brutal. Und das nicht nur zu mir, sondern auch zu dir selbst, indem du deinen Körper verachtest. Erinnerst du dich nicht an die Debatte zwischen Lincoln – der Lincoln-Maschine, meine ich – und Barrows? Das Tier ist dem Menschen nah verwandt, beide sind aus Fleisch und Blut. Und genau das versuchst du, nicht zu sein.«
»Ich versuche es nicht – ich bin’s nicht.«
»Was bist du dann? Eine Maschine?«
»Eine Maschine hat Drähte. Ich habe keine Drähte.«
»Was bist du dann?«
»Ich weiß, was ich bin. Schizoidität ist in diesem Jahrhundert sehr verbreitet, so wie im neunzehnten Jahrhundert die Hysterie. Es ist eine tiefe, innere Entfremdung. Ich wünschte, ich wäre nicht so, aber ich bin es nun mal. Du hast Glück, Louis, du bist in diesem Sinne altmodisch. Ich würde gerne mit dir tauschen. Und es tut mir leid, wenn dich meine Sprache in Sachen Sex verschreckt hat. Ich bin da sehr unbeholfen.«
»Nicht unbeholfen. Schlimmer. Unmenschlich. Du würdest… ich weiß, was du tun würdest. Wenn du Geschlechtsverkehr mit jemandem hättest, würdest du alles beobachten, die ganze Zeit lang. Sämtliche Aspekte. Ganz bewusst.«
»Ist das ein Fehler? Ich dachte, das machen alle so.«
»Gute Nacht, Pris.«
»Gute Nacht, Feigling.«
»Leck mich.«
»Ach, Louis.« Ihre Stimme bebte.
»Entschuldige.«
»Wie kannst du nur so etwas Schreckliches sagen?«
»Verzeih mir. Ich habe meine Zunge nicht mehr ganz unter Kontrolle.«
Sie nickte stumm. Dann ließ sie den Motor an.
»Fahr jetzt nicht weg, Pris. Hör zu, sieh es einfach als einen verrückten unterbewussten Versuch meinerseits, eine Verbindung zu dir herzustellen. Dein Gerede – wie du dich dazu bringst, Sam Barrows noch mehr zu verehren als vorher –, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe dich sehr gern, wirklich. Mitzuerleben, wie du dich für einen Augenblick einer warmen, menschlichen Sichtweise öffnest…«
»Danke, Louis. Dafür, dass du versuchst, mich aufzumuntern.« Sie schenkte mir ein Lächeln.
»Lass nicht zu, dass dich das hier noch mehr runterzieht.«
»Wird es schon nicht. Tatsächlich hat es mich kaum getroffen.«
»Komm mit mir rein.«
»Nein. Weißt du, wir stehen einfach alle unter großem Druck. Mir ist klar, dass ich dich verärgert habe. Dass ich solche ungeschickten Worte benutze, liegt einfach daran, dass ich es nicht besser weiß. Niemand hat mir je beigebracht, wie man über solche Sachen spricht.«
»Das wirst du schon lernen, keine Sorge. Aber, Pris, du musst mir etwas versprechen. Versprich mir, dass du vor dir selbst nicht leugnest, dass ich dich verletzt habe. Es ist gut, fühlen zu können, was du gerade eben gefühlt hast.«
»Du meinst, es ist gut, verletzt zu werden?«
»Nein. Ich meine, es ist ermutigend. Die Tatsache, dass du durch das, was ich gesagt habe, eine so intensive Verletzung erfahren hast…«
»Einen Scheiß habe ich.«
»Hast du wohl. Mach dir nichts vor.«
»Okay, Louis.« Sie ließ den Kopf hängen. »Du hast ja recht.«
Ich öffnete die Wagentür. »Komm mit rein, Pris.«
Sie schaltete den Motor ab und stieg aus. Ich nahm sie am Arm.
»Ist das der erste Schritt zu körperlichen Freuden?«, fragte sie.
Ich lächelte sanft.
»Weißt du, ich möchte nur darüber reden können, ich will es gar nicht tun. Wir werden einfach nebeneinandersitzen, und dann fahre ich nach Hause. Das ist für uns beide das Beste.«
Wir betraten das kleine Motelzimmer. Ich schaltete das Licht ein, drehte die Heizung auf und machte den Fernseher an.
»Wieso das denn? Damit uns niemand stöhnen hört?« Sie schaltete den Fernseher wieder ab. »Das ist nicht nötig, ich stöhne immer ganz leise.« Sie zog den Mantel aus und gab ihn mir. »Wo soll ich sitzen. Hier?« Sie setzte sich auf einen Stuhl, faltete die Hände im Schoß und sah mich feierlich an. »Wie ist das? Was soll ich noch ausziehen? Die Schuhe? Alles, was ich anhabe? Oder willst du das übernehmen? Wenn ja, mein Rock hat keinen Reißverschluss, man muss ihn aufknöpfen. Aber pass auf, dass du nicht zu sehr ziehst, sonst geht der oberste Knopf ab und ich muss ihn nachher wieder annähen.« Sie neigte sich zur Seite. »Hier sind die Knöpfe, siehst du.«
»Das ist alles sehr interessant, Pris.«
»Weißt du, was toll wäre?« Ihre Augen leuchteten auf. »Wenn du uns koscheres Cornedbeef und jüdisches Brot und Bier und zum Nachtisch ein bisschen Halvah besorgst. Dieses dünn geschnittene Cornedbeef für zwei fünfzig das Pfund.«
»Würde ich gern machen. Aber das kriegt man hier im Umkreis von über hundert Meilen nicht.«
»Kriegt man es nicht in Boise?«
»Nein. Außerdem ist es längst zu spät für koscheres Cornedbeef. Ich meine nicht zu spät am Abend. Ich meine zu spät in unserem Leben.« Ich setzte mich ihr gegenüber, zog den Stuhl dicht an sie heran und ergriff ihre Hände. Sie waren trocken und fest. Von ihrem Fliesenzerschneiden hatte sie sehnige Arme und starke Finger bekommen. »Lass uns abhauen, Pris. Nach Süden fahren und nie mehr wiederkommen. Weit weg von den Simulacra, weit weg von Sam Barrows.«
»Nein. Sam Barrows ist unser Schicksal, siehst du das nicht? Wir können ihm nicht entkommen.«
»Na schön. Wenn das so ist.«
»Du verhältst dich manchmal wie ein kleines Kind, das vom Leben noch nichts mitbekommen hat.«
»Nun, ich habe hier und da kleine Stücke aus der Wirklichkeit herausgehackt und mich mit ihnen vertraut gemacht. Ungefähr so wie ein Schaf, das einen bestimmten Weg durch das Weideland findet und dann nie wieder von ihm abweicht.«
»Und das gibt dir ein Gefühl von Sicherheit?«
»Ich fühle mich meistens sicher. Nur in deiner Nähe nie.«
Sie nickte. »Für dich bin ich das ganze Weideland.«
»So kann man es sagen.«
Sie lachte unvermittelt auf. »Das ist ja, als würde man mit Shakespeare schlafen. Du wirst zwischen meinen lieblichen Hügeln und Tälern weiden und grasen, vor allem in meinem duftenden Wiesengrund, du weißt schon, wo sich Wildfarne und Gräser in Fülle wiegen. Ich brauche es nicht deutlicher zu sagen, oder?« Ihre Augen blitzten. »Jetzt zieh mich um Himmels willen aus oder versuch es wenigstens.«
»Nein.«
»Haben wir die Poesie-Phase nicht längst hinter uns? Können wir uns das nicht ersparen und einfach zur Sache kommen?« Sie begann, ihren Rock aufzuknöpfen, aber ich hielt sie zurück.
»Ich kann es einfach nicht, Pris. Das hier ist mir alles viel zu hoch. Ich fühle mich, als hätte ich mich in einem dunklen Wald verlaufen. Das Einzige, was ich gerade hinkriegen würde, wäre dich zu küssen. Auf die Wange vielleicht, wenn es dir recht ist.«
»Du bist alt, daran liegt es. Du gehörst einer sterbenden Welt an.« Sie beugte sich vor. »Aber um dir eine Freude zu machen, erlaube ich dir, dass du mich küsst.«
Ich gab ihr einen Kuss auf die Wange.
»Und wenn du die Wahrheit wissen willst – die Wildfarne und Gräser schwanken gar nicht in Fülle. Da gibt es eine Handvoll Wildfarne und vielleicht vier Grashalme, und das war’s. Ich bin kaum erwachsen, Louis. Ich habe erst vor einem Jahr angefangen, einen BH zu tragen, und manchmal vergesse ich ihn heute noch. Ich brauche eigentlich gar keinen.«
»Kann ich dich auf den Mund küssen?«
»Nein, das wäre zu intim.«
»Du kannst ja die Augen zumachen.«
»Dann machen wir lieber das Licht aus.« Sie entzog mir ihre Hände, stand auf und ging zum Lichtschalter.
»Warte. Ich habe das Gefühl, dass gleich etwas Schreckliches passieren wird.«
»Tut mir leid, Louis. Ich kann jetzt nicht aufhören.« Sie machte das Licht aus.
»Hör zu, ich fahre nach Portland und hole das koschere Cornedbeef. Was meinst du?«
»Wo kann ich meinen Rock hintun?«, kam ihre Stimme aus der Dunkelheit. »Damit er nicht verknittert.«
»Das ist alles nur ein verrückter Traum.«
»Nein, es ist das Glück. Erkennst du das Glück nicht, wenn es dir begegnet? Komm, hilf mir, meine Sachen aufzuhängen. Ich muss in einer Viertelstunde gehen.«
Ich hörte, wie sie im Dunklen herumraschelte, ihre Sachen auszog, nach dem Bett tastete. »Es gibt kein Bett, Pris.«
»Dann auf dem Fußboden.«
»Da schürfst du dir die Knie auf.«
»Ich doch nicht. Du.«
»Ich leide an einer Phobie. Ich muss es bei Licht machen oder ich bekomme die Angstvorstellung, dass ich mit einem Ding schlafe, das aus Draht und Klaviersaiten und der alten orangen Steppdecke meiner Großmutter besteht.«
Pris lachte. »Das bin ich. Das beschreibt perfekt mein Wesen. Ich hab dich gleich.« Sie stieß irgendwo an. »Du entkommst mir nicht.«
»Hör auf. Ich mach jetzt das Licht an.« Ich fand den Schalter, drückte ihn, und auf einmal war das Zimmer wieder da und vor mir stand eine vollständig bekleidete Frau. Pris hatte sich gar nicht ausgezogen. Ich starrte sie verblüfft an.
»Reingelegt. Ich wollte dich im letzten Moment abblitzen lassen, wollte dein Begehren auf die Spitze treiben und dann…« Sie schnippte mit den Fingern. »Gute Naahacht.«
Ich versuchte zu lächeln.
»Lass dich bloß nicht gefühlsmäßig auf mich ein. Sonst breche ich dir das Herz.«
»Wieso einlassen?« Meine Stimme klang erstickt. »Ist doch alles nur ein Spielchen, das die Leute im Dunkeln treiben. Ich wollte mir bloß was aufreißen, wie man so sagt.«
»Diese Redewendung kenne ich nicht.« Sie sah mich kühl an. »Aber ich verstehe ihren Sinn.«
»Jetzt mal was anderes. In Boise gibt es doch koscheres Cornedbeef zu kaufen. Ich hätte es die ganze Zeit ohne Probleme besorgen können.«
»Du mieser Kerl.«
»Da rieselt Sand unter der Tür durch.«
»Was?« Sie sah sich um. »Wovon sprichst du?«
»Wir sind hier gefangen. Irgendjemand hat einen Sandhaufen über uns ausgeschüttet, wir kommen hier nie wieder raus.«
»Hör auf damit!«
»Weißt du, du hättest mir nie etwas anvertrauen sollen.«
»Ja, weil du es dann gegen mich benutzt. Um mich zu quälen.«
»Bin nicht ich es, der gequält wurde?«
»Jetzt gerade, meinst du? O Mann, vielleicht wäre ich ja gar nicht rausgerannt. Vielleicht wäre ich geblieben.
Ich hatte mich noch nicht entschieden. Es hätte von dir abgehangen, von deinem Talent. Ich erwarte eine Menge. Ich bin sehr idealistisch.« Sie zog ihren Mantel an.
»Wir ziehen uns wieder an, ohne uns überhaupt erst ausgezogen zu haben.«
»Jetzt bereust du es, was? Reue – für mehr bist du nicht gut.«
»Ich könnte auch ein paar Gemeinheiten über dich sagen.«
»Wirst du aber nicht. Weil du weißt, dass ich dann so scharf zurückschießen würde, dass du auf der Stelle tot wärst.«
Ich konnte nur mit den Schultern zucken.
»Es war also doch Angst.« Pris öffnete die Tür und ging zu ihrem Auto hinunter.
»Angst, genau.« Ich lief ihr nach. »Angst, die auf dem Wissen gründet, dass so etwas aus dem Einverständnis zweier Menschen erwachsen muss. Das kann nicht der eine dem anderen aufzwingen.«
»Angst vor dem Gefängnis, meinst du.« Sie stieg in das Auto. »Was du hättest tun sollen, was ein richtiger Mann getan hätte, wäre mich zu packen und zum Bett zu schleifen, ohne auch nur ansatzweise darauf zu hören, was ich sage.«
»Wenn ich das gemacht hätte, hättest du gar nicht mehr aufgehört, dich zu beklagen. Erst bei mir, dann bei Maury, dann bei der Polizei.«
Darauf schwiegen wir beide.
»Jedenfalls habe ich dich geküsst«, sagte ich schließlich.
»Aber nur auf die Wange.«
»Auf den Mund.«
»Du lügst.«
»Für mich war es der Mund.« Ich schloss die Autotür.
Sie kurbelte das Fenster hinunter. »So legst du dir das alles also zurecht.«
»Ja, ich werde die Erinnerung daran immer bewahren. In meinem Herzen.« Ich legte eine Hand auf die Brust.
Pris ließ den Motor an, schaltete das Licht ein und fuhr davon.
Einen Moment lang stand ich da, dann ging ich zurück in mein Motelzimmer. Wir drehen langsam durch, dachte ich. Wir sind so demoralisiert, dass wir nicht mehr können. Wir müssen uns Barrows unbedingt vom Hals schaffen. Pris – die arme Pris hat es am schlimmsten erwischt. Und zwar durch das Abschalten der Lincoln. Das war der Wendepunkt.
Am nächsten Morgen strahlte die Sonne warm ins Zimmer, und ich fühlte mich schon beim Aufwachen besser. Und dann, nach einem Frühstück im Motelrestaurant mit Eierkuchen und Schinken und Kaffee und Orangensaft, nach dem Zeitunglesen, fühlte ich mich so gut wie neu.
Da kann man mal sehen, was ein Frühstück so vermag, sagte ich mir. Bin ich wieder ein gesunder Mensch? Nein. Uns geht es besser, aber geheilt sind wir noch nicht. Weil wir davor ja auch nicht gesund gewesen sind, und man kann nicht gesund werden, wenn man nie gesund gewesen ist.
Was ist das für eine Krankheit? Pris hat sie in fast tödlichem Ausmaß gehabt. Und dann fiel ihr Hauch auf mich, sie drang in mich ein, ging nicht mehr weg. Dann kamen Maury und Barrows und nach ihm alle anderen bis hin zu meinem Vater; mein Vater hat sie sich als Letzter eingefangen. Vater! Ich hatte es ganz vergessen – er war auf dem Weg hierher.
Ich ging nach draußen und winkte mir ein Taxi.
Ich kam als Erster im Büro von MASA Associates an. Einige Minuten später sah ich durch das Fenster Pris aus ihrem Auto aussteigen. Sie trug ein blaues Baumwollkostüm und eine langärmelige Bluse; ihre Haare waren hochgesteckt, ihr Gesicht glänzte frisch gewaschen.
Als sie das Büro betrat, lächelte sie mich an. »Tut mir leid, wenn ich gestern das Falsche gesagt habe. Vielleicht nächstes Mal.«
»Nicht weiter schlimm.«
»Bist du sicher, Louis?«
»Ja.« Ich erwiderte ihr Lächeln.
Die Tür ging auf, und Maury kam herein. »Ich bin gut drauf. Lasst uns diesem Schweinehund Barrows das Fell über die Ohren ziehen.«
Gleich nach ihm kam mein Vater, in dunklem Nadelstreifenanzug. Er begrüßte Pris, dann wandte er sich Maury und mir zu. »Ist er schon da?«
»Nein, Vater. Aber er müsste jeden Moment kommen.«
»Ich finde, wir sollten die Lincoln wieder einschalten«, sagte Pris. »Wir sollten keine Angst vor Barrows haben.«
Ich nickte. »Finde ich auch.«
»Nein«, erwiderte Maury. »Und ich sag euch auch, warum. Sie regt Barrows’ Appetit an.«
Ich sah ihn an. »Na gut, lassen wir sie abgeschaltet. Barrows kann sie ruhig mit seinen Fäusten bearbeiten. Er wird ohnehin nur von Habgier getrieben.« Und wir, dachte ich, werden nur von Angst getrieben; hinter etlichen unserer Handlungen der letzten Zeit hat Angst gesteckt, nicht gesunder Menschenverstand…
Es klopfte an der Tür.
»Da ist er.«
Die Tür öffnete sich, und dort standen Sam K. Barrows, David Blunk, Colleen Nild und die düstere Gestalt von Edwin M. Stanton.
»Sie war gerade auf dem Weg hierher«, dröhnte Blunk vergnügt. »Da haben wir sie in unserem Taxi mitgenommen.«
Die Stanton-Maschine sah uns säuerlich an.
Großer Gott, schoss es mir durch den Kopf. Damit hat keiner von uns gerechnet. Verändert das nun alles?
Ich hatte keine Ahnung. Aber wir konnten jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Jetzt ging es um alles.
Elf
»Wir haben uns mit Stanton hier unterhalten«, sagte Barrows lächelnd. »Und sind, wenn ich das so sagen darf, zu einer Einigung gekommen, zumindest ansatzweise.«
»Ah ja?«, murmelte ich. Neben mir hatte Maury eine unbewegte Miene aufgesetzt. Pris zitterte sichtlich.
Mein Vater streckte die Hand aus. »Ich bin Jerome Rosen, Eigentümer der Rosen Kleinklavier- und Elektroorgelfabrik in Boise, Idaho. Habe ich die Ehre, Mr. Samuel Barrows kennenzulernen?«
So haben wir also jeder eine Überraschung für die andere Seite parat, sagte ich mir. Sie haben es geschafft, die Stanton aufzutreiben; wir hatten meinen Vater.
Dieser Stanton! Wie es in der Britannica stand: er hatte zu seinem eigenen Vorteil mit dem Feind gemeinsame Sache gemacht. Vermutlich war er in Seattle die ganze Zeit über bei Barrows gewesen; er hatte sich gar nicht abgesetzt. Sie hatten von Anfang an miteinander verhandelt.
Verraten und verkauft – von unserem eigenen Simulacrum. Aber die Lincoln hätte so etwas nie getan, dachte ich. Und als mir das klar wurde, ging es mir um einiges besser. Ich wandte mich meinem Partner zu.
»Maury, gehst du bitte Lincoln fragen, ob er hier heraufkommen könnte.«
Er hob die Braue.
»Wir brauchen ihn.«
»Ja«, stimmte Pris zu.
»Gut.« Maury nickte und verschwand.
Barrows kam auf mich zu. »Wissen Sie, als wir Stanton hier das erste Mal getroffen haben, haben wir ihn wie irgendein Gerät behandelt. Doch Blunk erinnerte mich daran, wie beharrlich Sie ihn ein lebendiges Wesen nennen. Also bin ich neugierig zu erfahren, was Sie Stanton so zahlen.«
Zahlen? Was meinte er?
»Leibeigenschaft ist schließlich verboten«, sagte Blunk. »Haben Sie einen Arbeitsvertrag mit Mr. Stanton geschlossen? Und wenn ja, so entspricht er hoffentlich den gesetzlichen Vorschriften zum Mindestlohn. Tatsächlich haben wir das bereits mit Stanton besprochen, und er kann sich nicht erinnern, irgendeinen Vertrag unterschrieben zu haben. Ich sehe darum keinen Hinderungsgrund für Mr. Barrows, ihn für, sagen wir, sechs Dollar die Stunde einzustellen. Das ist, da werden Sie mir zustimmen, eine mehr als gerechte Entlohnung. Auf dieser Basis hat Mr. Stanton sein Einverständnis gegeben, mit uns nach Seattle zurückzukehren.«
Ich starrte den Anwalt mit offenem Mund an.
Die Tür ging auf, und Maury trat ein, die große dunkelbärtige Lincoln-Maschine im Schlepptau.
»Ich denke, wir sollten sein Angebot akzeptieren«, sagte Pris.
»Welches Angebot?«, fragte Maury. »Ich habe kein Angebot gehört. Hast du irgendein Angebot gehört, Louis?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Pris, hast du dich etwa bereits mit Barrows verständigt?«
Barrows räusperte sich. »Also schön, hier ist mein Angebot. Wir schätzen MASA auf einen Wert von fünfundsiebzigtausend Dollar. Ich packe noch…«
»Habt ihr zwei schon miteinander geredet?«, unterbrach Maury ihn.
Weder Pris noch Barrows sagten etwas dazu. Aber es lag auf der Hand; für mich, für Maury, für uns alle.
»Ich packe noch einmal dieselbe Summe drauf«, fuhr Barrows fort. »Und halte natürlich die Mehrheitsanteile.«
Maury schüttelte den Kopf.
»Können wir das bitte kurz unter uns besprechen?«, fragte Pris Barrows.
»Selbstverständlich.«
Wir zogen uns in einen kleinen Lagerraum auf der anderen Seite des Gangs zurück.
Maurys Gesicht war grau. »Das war’s. Wir sind erledigt.«
Wir sahen uns stumm an.
Nach einer Weile sagte mein Vater: »Lasst euch bloß nicht auf diesen Barrows ein. Es wäre ein großer Fehler, ihm die Kontrolle über die Firma zu geben, so viel weiß ich.«
Ich wandte mich an die Lincoln. »Sie sind Rechtsanwalt – in Gottes Namen, helfen Sie uns.«
»Nun, Mr. Barrows und seine Leute sind in der Position des Stärkeren. In seinem Tun liegt keine Täuschung – er ist die stärkere Partei.« Sie verzog die schweren Lippen und sah uns gequält, aber mit einem Funkeln in den Augen an. »Sam Barrows ist Geschäftsmann, doch Sie sind ebenfalls Geschäftsmänner. Verkaufen Sie MASA Associates an Mr. Jerome Rosen hier, für einen Dollar. Damit geht sie in das Betriebsvermögen von Rosen Kleinklaviere und Elektroorgeln über, die kapitalstark ist. Um an MASA heranzukommen, müsste Barrows dann das gesamte Unternehmen kaufen, einschließlich der Fabrik, und darauf ist er nicht vorbereitet. Und was Stanton betrifft, so kann ich Ihnen eines versichern: Er wird sich zur Rückkehr bewegen lassen. Stanton hat seine Launen, aber er ist ein guter Mensch. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Er war schon in der Regierung Buchanan, und ich entschied mich trotz zahlreicher Proteste, ihn zu behalten. Er ist zwar aufbrausend und sehr auf sein eigenes Fortkommen bedacht, aber auch eine ehrliche Haut. Er wird sich am Ende nie mit Gaunern zusammentun. Wissen Sie was? Ich sage ihm, dass Sie ihn zu Ihrem Vorstandsvorsitzenden machen werden, dann wird er bestimmt bleiben.«
Nach einer Weile erwiderte Maury leise: »Darauf wäre ich nie gekommen.«
»Ich bin dagegen«, meldete sich Pris. »MASA darf nicht den Rosens überlassen werden, das kommt überhaupt nicht infrage. Und Stanton wird ein solches Angebot auf gar keinen Fall annehmen.«
»Doch, bestimmt. Wir geben ihm eine wichtige Position. Warum auch nicht? Er besitzt die Fähigkeiten dazu. Wer weiß, wahrscheinlich macht er binnen eines Jahres eine millionenschwere Marke aus uns.«
»Sie werden es nicht bereuen«, sagte die Lincoln ruhig, »Ihre Firma in Mr. Stantons Hände zu legen.«
Wir gingen zurück ins Büro. Barrows sah uns erwartungsvoll an.
Maury räusperte sich. »Wir haben Ihnen Folgendes zu sagen. Wir haben MASA an Mr. Jerome Rosen verkauft.« Er deutete auf meinen Vater. »Für einen Dollar.«
Barrows blinzelte. »Haben Sie? Wie interessant.« Er sah zu Blunk, der in einer theatralischen Geste die Hände hob.
Die Lincoln wandte sich der Stanton zu. »Edwin, Mr. Rock und die beiden Mr. Rosens würden sich freuen, Sie in ihrem neugebildetem Unternehmen als Vorstandsvorsitzenden begrüßen zu dürfen.«
In die säuerlichen Züge der Stanton kam Bewegung, ein Lächeln zeigte sich, verschwand wieder. »Entspricht dies den Tatsachen?«
»Ja, Sir«, sagte Maury. »Das Angebot gilt. Wir können einen Mann mit Ihren Fähigkeiten gut gebrauchen.«
Ich nickte. »So ist es.«
»Ich bin ebenfalls einverstanden, Mr. Stanton«, ergänzte mein Vater. »Und ich darf auch für meinen anderen Sohn sprechen, Chester. Wir meinen es ernst.«
Maury setzte sich an eine unserer Underwood-Schreibmaschinen, spannte ein Blatt Papier ein und begann zu tippen. »Wir machen es am besten gleich schriftlich, dann ist alles wasserdicht.«
Mit leiser, kalter Stimme sagte Pris: »Ich betrachte das als einen hinterlistigen Verrat nicht nur an Mr. Barrows, sondern auch an allem, wofür wir stehen.«
Maury sah sie an. »Jetzt aber mal halblang.«
»Ich mache da nicht mit, es ist grundverkehrt.« Pris hatte ihre Stimme absolut im Griff; sie hätte ebenso gut telefonisch bei Macy’s etwas zum Anziehen bestellen können. »Mr. Barrows, Mr. Blunk, wenn Sie wollen, dass ich mich Ihnen anschließe – ich bin bereit.«
Wir trauten unseren Ohren nicht.
Barrows hob eine Augenbraue. »Sie haben bei der Produktion der beiden Simulacra geholfen. Dann könnten Sie also ein weiteres bauen?« Er sah Pris an.
»Nein, könnte sie nicht«, sagte Maury. »Sie hat ihnen nur die Gesichter aufgepinselt. Sie hat keine Ahnung von Elektronik.«
Pris verzog keine Miene. »Bob Bundy wird mitkommen.«
»Er auch?« Meine Stimme zitterte. »Du und Bundy, ihr habt…« Ich brachte den Satz nicht zu Ende.
»Bob mag mich«, sagte Pris kühl.
Barrows griff in seine Jackentasche und zog eine Brieftasche hervor. »Ich gebe Ihnen das Geld für den Flug. Sie können nachkommen. Dann gibt es keine rechtlichen Komplikationen – wir fliegen getrennt.«
»Ist mir recht«, erwiderte Pris. »Ich komme morgen oder übermorgen nach Seattle. Aber behalten Sie Ihr Geld – ich habe genug.«
Barrows nickte. »Nun, damit wäre unsere Besprechung beendet. Wir können uns auf den Rückweg machen. Dann lassen wir Sie hier, Stanton. Ist das Ihre Entscheidung?«
»Ja, Sir«, erwiderte die Stanton.
»Dann wünsche ich einen guten Tag.« Barrows verließ den Raum. Sein Anwalt und seine Sekretärin folgten ihm.
Ich sah Pris an. »Du bist verrückt.«
»Das liegt im Auge des Betrachters.« Ihre Stimme klang abwesend.
»Meinst du das wirklich ernst?« Maurys Gesicht war aschfahl. »Dass du zu Barrows überlaufen willst? Nach Seattle fliegen und bei ihm anfangen?«
»Ja.«
»Dann hole ich die Polizei und lass dich festnehmen. Du bist noch minderjährig. Ich verständige das FBMH. Ich sorge dafür, dass du wieder in die Klinik kommst.«
»Du kannst mich nicht daran hindern. Das FBMH kann mich nur festhalten, wenn ich mich selbst einweise, was ich nicht tun werde, oder wenn ich psychotisch bin, was nicht der Fall ist. Ich bin absolut in der Lage, mich um meine Angelegenheiten zu kümmern. Also steigere dich nicht in einen Wutanfall hinein – er nützt sowieso nichts.«
Maury leckte sich die Lippen und verfiel in Schweigen. Pris hatte zweifellos recht. Und Barrows’ Leute würden dafür sorgen, dass es keine juristischen Schlupflöcher gab. Immerhin ging es um viel Geld.
»Ich glaube nicht, dass Bob Bundy uns deinetwegen verlassen wird«, sagte ich zu ihr. Aber ihrem Gesichtsausdruck war zu entnehmen, dass ich falsch lag. Das war auch so etwas: Wie lange lief das schon zwischen den beiden? Man konnte es nicht sagen. Es war Pris’ Geheimnis. Ich sah die Lincoln an. »Damit haben Sie nicht gerechnet, oder?«
Die Maschine schüttelte den Kopf.
»Jedenfalls haben wir uns Barrows vom Hals geschafft«, sagte Maury mit brüchiger Stimme. »Wir haben MASA Associates behalten und die Stanton auch. Die lassen sich hier nicht noch mal blicken. Und wenn Pris und Bundy zu Barrows wollen, dann viel Glück.« Er funkelte seine Tochter böse an, doch sie hielt seinem Blick mühelos stand. In einer Krise war sie nur noch kälter, noch effizienter, noch kontrollierter.
Vielleicht, dachte ich, sollten wir froh sein, sie loszuwerden. Wir wären gar nicht in der Lage gewesen, mit ihr fertig zu werden – ich jedenfalls nicht. Und Barrows? Womöglich kann er sie für sich nutzbar machen – oder sie schadet ihm, ruiniert ihn vielleicht sogar. Oder beides. Aber sie haben ja auch noch Bundy, und Pris und Bundy zusammen können problemlos ein Simulacrum bauen. Maury brauchen sie dazu gar nicht, mich erst recht nicht.
Die Lincoln beugte sich zu mir herunter. »Sie werden von Mr. Stantons Entscheidungsstärke profitieren. Er wird Ihrem Unternehmen gute Dienste leisten.«
»Meine Gesundheit ist nicht mehr die Beste«, brummte die Stanton, aber sie sah trotzdem erfreut und zuversichtlich drein. »Ich werde tun, was ich kann.«
»Das mit deiner Tochter tut mir leid«, sagte ich zu Maury.
»Wie konnte sie nur?«, flüsterte er.
Mein Vater klopfte ihm auf die Schulter. »Sie kommt wieder. Das tun sie immer, die Kinder.«
»Sie kann mir gestohlen bleiben«, erwiderte Maury. Aber wir wussten, dass er das nicht so meinte.
»Kommt, gehen wir einen Kaffee trinken«, schlug ich vor.
»Ja, geht mal«, sagte Pris. »Ich fahre nach Hause. Ich habe noch eine Menge zu tun. Kann ich noch einmal den Jaguar nehmen?«
»Nein«, knurrte Maury.
Sie zuckte mit den Achseln, nahm ihre Handtasche und verließ das Büro. Die Tür schloss sich hinter ihr. Weg war sie.
Als wir in der Caféteria auf der anderen Straßenseite saßen, dachte ich: Die Lincoln hat uns sehr gute Dienste geleistet vorhin mit Barrows. Sie hat einen Ausweg gefunden. Und es war ja nicht ihre Schuld, dass sich die Dinge dann so entwickelt haben. Sie konnte nicht ahnen, dass Pris so hochgehen würde. Und auch nicht das mit ihr und Bundy. Da wäre niemand von uns draufgekommen.
Die Kellnerin hatte uns eine Zeit lang beobachtet. Jetzt kam sie an unseren Tisch. »Das ist diese Abraham-Lincoln-Schaufensterpuppe, nicht wahr?«
»Nein«, erwiderte ich. »In Wirklichkeit ist es eine W.-C.-Fields-Schaufensterpuppe. Aber sie trägt ein Kostüm, ein Lincoln-Kostüm.«
»Mein Freund und ich haben uns neulich die Vorführung angesehen. Sie sieht wirklich echt aus. Darf ich sie mal anfassen?«
»Klar.«
Sie berührte die Lincoln vorsichtig an der Hand. »Oh, sie ist ja sogar warm. Und sie trinkt Kaffee!«
Nach einer Weile konnten wir sie abwimmeln und auf unser eigentliches Thema zurückkommen. Ich sah die Lincoln an. »Eins steht fest, Sie haben sich auf unsere Zeit eingestellt. Sogar besser als manche von uns.«
In brüskem Ton sagte die Stanton: »Mr. Lincoln ist in der Lage, sich auf alles und jeden einzustellen – er erzählt einfach einen Witz.«
Die Lincoln nippte schmunzelnd an ihrem Kaffee.
»Ich frage mich, was Pris jetzt gerade macht«, meldete sich Maury. »Packen wahrscheinlich. Ich finde es furchtbar, dass sie jetzt nicht bei uns ist. Als Teil des Teams.«
Wir haben vorhin eine Menge Leute verloren, wurde mir bewusst. Wir sind Barrows, Blunk, Mrs. Nild und zu unserer Überraschung auch gleich noch Pris Frauenzimmer und unseren einzigen Ingenieur Bob Bundy losgeworden. Ob wir Bob wohl je wiedersehen werden? Ob wir Pris je wiedersehen werden, und wenn ja, wird sie sich verändert haben?
»Wie konnte sie uns nur so abservieren? Diese Klinik und dieser Doktor Horstowski haben nichts gebracht, überhaupt nichts. Am liebsten würde ich das ganze Geld zurückfordern, das ich dafür rausgeballert habe. Aber sie – von ihr will ich nichts mehr wissen. Ich bin fertig mit ihr.«
Um das Thema zu wechseln, sagte ich zur Lincoln: »Haben Sie einen weiteren Rat für uns, Sir? Was sollen wir jetzt tun?«
»Ich fürchte, ich bin Ihnen weniger nützlich gewesen, als ich gehofft hatte. Bei Frauen weiß man nie… Dennoch schlage ich vor, dass Sie mich zu Ihrem Rechtsberater berufen. So wie die andere Seite Mr. Blunk berufen hat.«
»Eine hervorragende Idee.« Ich zog mein Scheckheft. »Wie viel möchten Sie als Vorschuss?«
»Zehn Dollar genügen vollauf.«
Ich schrieb einen Scheck über diese Summe aus; die Lincoln nahm ihn und dankte mir.
Maury, der in tiefes Grübeln verfallen war, blickte auf.
»Heutzutage ist ein Vorschuss von mindestens zweihundert Dollar üblich. Der Dollar ist nicht mehr so viel wert wie früher.«
Die Lincoln schüttelte den Kopf. »Zehn sind in Ordnung. Und als Erstes werde ich die Papiere für den Verkauf von MASA Associates aufsetzen. Was die Rechtsform betrifft, so schlage ich eine Kapitalgesellschaft vor, ganz ähnlich wie Mr. Barrows es vorhatte. Ich werde mich die Tage in die Gesetze vertiefen, um herauszufinden, wie die Anteile verteilt werden sollten. Das wird eine Weile dauern, fürchte ich.«
»Kein Problem«, sagte ich. Pris zu verlieren, hatte uns alle tief getroffen, vor allem Maury. Viel verloren und nichts gewonnen, so kamen wir aus der Sache heraus. Und doch – hätten wir es irgendwie verhindern können? Die Lincoln hatte recht: Es war unvorhersehbar gewesen; Barrows war ebenso überrascht gewesen wie wir. »Können wir ohne Pris ein Simulacrum bauen?«, fragte ich Maury.
»Klar. Aber nicht ohne Bob Bundy.«
»Wir können uns jemanden als Ersatz besorgen.«
Maury seufzte. »Ich sag euch, was sie kaputt gemacht hat. Dieses gottverdammte Buch ›Marjorie Morningstar‹.«
»Wieso das denn?« Es war bitter mitanzusehen, wie Maury in dieses zusammenhanglose Gezeter verfiel. Er kam mir fast senil vor.
»Dieses Buch hat Pris auf die Idee gebracht, sich jemanden zu suchen, der reich und berühmt ist und gut aussieht. Wie Sam K. Barrows. Diese Vorstellung vom Heiraten stammt aus der alten Welt. Rein auf den Vorteil bedacht. In diesem Land hier heiraten die jungen Leute aus Liebe, und das ist vielleicht kitschig, aber jedenfalls geschieht es nicht aus Berechnung. Nachdem sie dieses Buch gelesen hatte, begann sie, mit Berechnung an Liebesdinge heranzugehen. Das Einzige, was sie hätte retten können, wäre, wenn sie sich Hals über Kopf in jemanden verknallt hätte. Und jetzt ist sie weg.« Er seufzte abermals. »Machen wir uns nichts vor, hier geht’s nicht nur ums Geschäft. Ich meine, eigentlich schon. Aber nicht um das Geschäft mit den Simulacra. Sondern um sie. Sie will etwas von Barrows, du weißt, was ich meine, Louis. Und er kann ihr geben, was sie will.«
»Stimmt.«
»Ich hätte ihn nie auch nur in ihre Nähe lassen dürfen. Aber ich werfe ihm nichts vor, es ist ihre Schuld. Alles, was jetzt mit ihr passiert, ist ihre Verantwortung. Was immer sie tut, was immer aus ihr wird. Wir behalten besser die Zeitungen im Blick, Louis. Wir werden etwas über Pris aus den gottverdammten Nachrichten erfahren.« Er nahm einen Schluck von seinem Kaffee.
Wir schwiegen eine Weile.
Schließlich fragte die Stanton: »Wann übernehme ich meine Pflichten als Vorstandsvorsitzender?«
»Wann immer Sie wollen«, erwiderte Maury.
»Findet das die Zustimmung der anderen Gentlemen?« Mein Vater und ich nickten, die Lincoln ebenfalls. »Dann, Gentlemen, betrachte ich mich als berufen.« Die Stanton räusperte sich und spielte mit ihrem Bart. »Wir müssen baldmöglichst mit der Arbeit beginnen. Die Zusammenführung der beiden Unternehmen wird zu einer neuen Blütezeit führen. Ich habe mir Gedanken über das Produkt gemacht, das wir herstellen sollten. Ich glaube nicht, dass es klug wäre, weitere Lincoln-Simulacra zu produzieren, ebenso wenig wie…« Ein sardonisches Lächeln huschte über ihre Züge. »… mehr Stantons. Jeweils eines reicht völlig. Lassen Sie uns etwas Schlichteres herstellen. Das wird gleichzeitig unser Mechanikerproblem lindern. Ich muss ohnehin erst Belegschaft und Ausstattung in Augenschein nehmen und sehen, ob alles so ist, wie es sich gehört. Trotzdem bin ich schon jetzt zuversichtlich, dass unser Unternehmen ein schlichtes, anständiges Produkt herstellen kann, das alle Welt haben möchte. Ein Simulacrum, das zwar nicht einzigartig oder komplex ist, aber doch gebraucht wird. Arbeiter-Simulacra vielleicht, die selbst weitere Simulacra produzieren können.«
Das war eine gute, wenn auch ziemlich beängstigende Idee.
»Meiner Meinung nach«, fuhr die Stanton fort, »sollten wir ein Standardmodell entwerfen und zur Produktionsreife bringen. Es wird das erste offizielle Simulacrum unseres Unternehmens sein, und noch bevor Mr. Barrows Gebrauch von Miss Frauenzimmers Wissen und Talenten gemacht hat, werden wir es auf dem Markt haben.«
Wir nickten alle.
»Ich schlage insbesondere ein Simulacrum vor, das eine simple haushälterische Tätigkeit ausführen kann und zu diesem Zweck angeboten wird: einen Babysitter. Und wir sollten es so weit vereinfachen, das wir es für einen möglichst niedrigen Preis anbieten können. Sagen wir, für vierzig Dollar.«
Wir sahen einander an; das war auch keine schlechte Idee.
»Ich weiß aus Erfahrung, welch großer Bedarf nach jemandem besteht, der sich jederzeit um den Nachwuchs einer Familie kümmern kann, und bin mir daher sicher, dass sich ein solches Produkt sofort absetzen ließe und wir in Zukunft keine Probleme finanzieller Art mehr hätten. Darum möchte ich zu einer Abstimmung in dieser Frage aufrufen. Alle, die dafür sind, sagen ›Aye‹.«
»Aye«, sagte ich.
»Aye«, sagte Maury.
Nach kurzem Nachdenken sagte mein Vater: »Ich bin ebenfalls dafür.«
»Damit ist der Antrag angenommen«, erklärte die Stanton. Sie nahm einen Schluck Kaffee und sagte dann mit ernster, entschlossener Stimme: »Das Unternehmen braucht einen Namen, einen neuen Namen. Ich schlage vor, wir nennen es R & R Associates of Boise, Idaho. Findet das Ihre Zustimmung?« Sie sah sich um. Wir nickten. »Gut. Dann wollen wir gleich beginnen. Mr. Lincoln, wollen Sie als unser Justiziar bitte dafür sorgen, dass unsere Papiere in Ordnung sind. Falls nötig, können Sie einen jüngeren Anwalt hinzuziehen, der mit der gegenwärtigen Rechtslage besser vertraut ist – ich autorisiere Sie ausdrücklich dazu. Gentlemen, vor uns liegt eine Vielzahl ehrenwerter Anstrengungen, und wir wollen nicht in der Vergangenheit verweilen, in den Unannehmlichkeiten und Rückschlägen, die wir erst kürzlich erfahren haben. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass wir stattdessen nach vorne blicken. Können wir das tun, Mr. Rock?«
»Klar.« Maury nickte. »Sie haben recht, Stanton.« Er ging zur Kasse und kam mit zwei langen, in Goldpapier eingewickelten Zigarren zurück. Eine davon gab er meinem Vater. »Elconde de Guell. Von den Philippinen.« Er wickelte seine aus und steckte sie an; mein Vater tat es ihm gleich.
»Es wird uns gutgehen, nicht wahr?«, sagte mein Vater paffend.
»Ja, ganz richtig«, erwiderte Maury und paffte ebenfalls drauf los.
Wir anderen tranken unseren Kaffee aus.
Zwölf
Ich hatte befürchtet, Pris’ Wechsel zu Barrows würde Maury so belasten, dass er als Partner nicht mehr viel taugte. Aber da lag ich falsch. Tatsächlich verdoppelte er seine Anstrengungen, beantwortete schriftliche Anfragen bezüglich Orgeln und Kleinklaviere, arrangierte Lieferungen in alle Himmelsrichtungen und stürzte sich in die Aufgabe, das Babysitter-Simulacrum zu designen und in Produktion zu bringen.
Ohne Bob Bundy konnten wir keine neuen Schaltungen entwickeln, also galt es, die alten zu modifizieren. Unser Babysitter würde eine Weiterentwicklung der Lincoln sein – sozusagen ein Nachfahr.
Vor vielen Jahren war Maury ein Science-Fiction-Magazin namens Thrilling Wonder Stories in die Hände gefallen, und darin stand eine Story über Roboter, die wie riesige mechanische Hunde kleine Kinder beschützten. Sie wurden ›Nannys‹ genannt, offenbar nach der Hündin Nana in ›Peter Pan‹. Maury gefiel der Name, und als sich unser Vorstand zusammensetzte – Stanton als Vorsitzender, dazu ich, Maury, Jerome und Chester sowie unser Justiziar Abraham Lincoln –, schlug er vor, ihn zu benutzen.
»Das Magazin oder der Autor könnte uns verklagen«, gab ich zu bedenken.
»Ach, das ist dermaßen lange her«, erwiderte Maury. »Das Magazin gibt es gar nicht mehr, und der Autor ist wahrscheinlich längst tot.«
»Fragen wir unseren Justiziar.«
Nach sorgfältiger Erwägung kam die Lincoln zu dem Schluss, dass die Bezeichnung ›Nanny‹ für einen mechanischen Babysitter inzwischen nicht mehr geschützt war. »Denn mir ist aufgefallen«, argumentierte sie, »dass der Name Ihnen allen bekannt war, obwohl Sie die Geschichte nicht gelesen haben, aus der er ursprünglich stammt.«
Also nannten wir unsere Babysitter-Simulacra Nannys. Die Entscheidungsfindung kostete uns allerdings mehrere Wochen, weil die Lincoln erst noch ›Peter Pan‹ lesen musste. Und es machte ihr so viel Spaß, dass sie es zu den Vorstandssitzungen mitbrachte und unter viel Gekicher daraus vorlas. Wir hatten keine Wahl, wir mussten diese Lesungen über uns ergehen lassen.
»Ich habe Sie ja gewarnt«, sagte die Stanton, als die Lincoln einmal gerade nicht im Raum war.
»Und dann noch ausgerechnet ein verfluchtes Kinderbuch«, brummte Maury. »Wenn er schon laut vorlesen muss, warum dann nicht die New York Times?«
Maury hatte zwischenzeitlich in der Hoffnung, etwas über Pris zu erfahren, die Seattier Zeitungen abonniert. Er war zuversichtlich, bald eine entsprechende Meldung zu finden. Dass sie dort war, stand fest, denn bei ihm zu Hause war ein Umzugswagen vorgefahren und hatte den Rest ihrer Sachen mitgenommen – und der Fahrer hatte Maury erzählt, dass er alles nach Seattle transportieren sollte.
»Du könntest immer noch zur Polizei gehen«, sagte ich zu ihm.
Bedrückt schüttelte er den Kopf. »Ich habe Vertrauen in Pris. Ich weiß, dass sie den richtigen Weg finden und zu mir zurückkehren wird. Und machen wir uns doch nichts vor – sie steht unter Vormundschaft. Rechtlich gesehen habe ich ihr gar nichts mehr zu sagen.«
Ich für meinen Teil hoffte nach wie vor, dass sie nicht zurückkehrte; ohne sie war ich wesentlich entspannter. Außerdem hatte ich trotz Maurys Niedergeschlagenheit den Eindruck, dass er besser arbeiten konnte. An ihm nagten nicht mehr so viele familiäre Sorgen. Und er musste nicht mehr jeden Monat Doktor Horstowskis horrende Rechnung bezahlen.
»Glaubst du, Sam Barrows hat einen besseren Analytiker für sie aufgetan?«, fragte er mich eines Abends. »Wie viel ihn das wohl kostet? Drei Tage die Woche für jeweils vierzig Dollar – das sind fast fünfhundert im Monat. Nur um ihre kaputte Psyche in Ordnung zu bringen.« Er schüttelte den Kopf.
Mir fiel dieser Werbespruch wieder ein, mit dem die Behörden vor einem Jahr oder so jedes Postamt der Vereinigten Staaten zugeklebt hatten.
WEISEN SIE DEN WEG ZU GEISTIGER GESUNDHEIT -
SEIEN SIE DER ERSTE IN IHRER FAMILIE, DER IN EINE NERVENKLINIK GEHT!
Und Schulkinder mit grellen Buttons auf der Brust hatten abends an der Tür geklingelt, um Spenden für die psychologische Forschung zu sammeln. Alles im Namen der Volksgesundheit.
»Barrows tut mir leid«, sagte Maury. »Ich hoffe um seinetwillen, dass sie ein Simulacrum für ihn designt, aber ich bezweifle es. Ohne mich ist sie nur ein Amateur. Dieses Mosaik im Badezimmer – das war eine der wenigen Sachen, die sie je zu Ende gebracht hat. Und dabei ist noch für ein paar Hunderter Material übrig geblieben.«
»Wow.« Ich gratulierte mir und uns allen im Stillen für die Tatsache, dass Pris nicht mehr bei uns war.
»Natürlich: Diese kreativen Projekte – sie stürzt sich immer richtig auf sie, jedenfalls am Anfang. Man darf sie nicht unterschätzen. Schau dir nur mal an, wie sie die Körper von Stanton und Lincoln designt hat. Du musst zugeben, dass sie gut ist.«
»Durchaus.«
»Und wer wird uns jetzt das Nanny-Design machen, wo Pris weg ist? Du nicht, du hast nicht für einen Zehner künstlerisches Talent. Ich auch nicht. Und auch nicht diese Witzfigur, die du deinen Bruder nennst.«
»Wie wäre es mit mechanischen Babysittern im Bürgerkriegs-Design?«
Er sah mich verwirrt an.
»Dieses Design haben wir ja schon. Wir produzieren zwei Modelle, einen Babysitter im Blau der Yankees, einen im Grau der Rebellen. Feldposten, die ihre Pflicht erfüllen. Was sagst du dazu?«
»Was ist ein Feldposten?«
»So etwas wie ein Wächter, nur dass es sehr viele davon gibt.«
Maury dachte kurz nach. »Ja, ein Soldat verkörpert Pflichterfüllung. Und die Kinder wären begeistert. Außerdem kämen wir damit von diesem unpersönlichen Roboter-Design weg. Das ist eine gute Idee, Louis. Rufen wir den Vorstand zusammen und entscheiden darüber. Jetzt gleich, damit wir mit der Arbeit beginnen können.« Er lief voller Eifer zur Tür. »Ich rufe Jerome und Chester an und dann gehe ich runter und sage Lincoln und Stanton Bescheid.« Die beiden Simulacra wohnten im Erdgeschoss von Maurys Haus; die Wohnungen waren ursprünglich vermietet gewesen, doch jetzt hielt Maury sie für diesen Zweck frei. »Sie werden doch nichts dagegen haben, oder? Gerade Stanton – er ist so ein Dickschädel. Wenn er nun findet, dass es… Blasphemie ist?«
»Wenn sie dagegen sind, werben wir eben weiter dafür.
Am Ende werden wir uns durchsetzen, denn was sollte man ernsthaft dagegen haben? Von irgendwelchen puritanischen Vorstellungen von Stantons Seite abgesehen.«
Doch obwohl es meine eigene Idee war, überkam mich ein seltsames Gefühl – als hätte ich in meinem Moment der Kreativität, meinem letzten Ausbruch von Inspiration, uns und allem, wofür wir standen, den Todesstoß versetzt. Warum war das so? War sie mir zu leicht zugeflogen, diese Idee? Es war doch nur eine Adaption dessen, womit wir – das hieß Maury und seine Tochter – ursprünglich angefangen hatten. Damals hatten sie davon geträumt, sämtliche Schlachten des Bürgerkriegs nachzuspielen, mit Millionen von Teilnehmern; jetzt begeisterten wir uns an der schlichten Vorstellung eines mechanischen Dieners im Bürgerkriegsdesign, der der Hausfrau ihre täglichen Pflichten abnahm. Irgendwo unterwegs war unsere Vision auf der Strecke geblieben. Wir waren wieder nur eine kleine Firma, die versuchte, Geld zu machen. Ein Schmalspur- Barrows, wenn man so wollte. Bald würden wir diesen Nanny-Plunder auf den Markt werfen und mit einer verlogenen Werbemasche anpreisen oder irgendeinem Trick wie die Kleinanzeigen.
»Nein«, rief ich Maury hinterher. »Die Idee ist Schrott. Vergiss es!«
Er blieb in der Tür stehen. »Warum? Sie ist super!«
»Weil sie…« Ich konnte es nicht erklären. Ich fühlte mich ausgelaugt. Verzweifelt. Einsam. Wer oder was fehlte mir? Pris Frauenzimmer? Die ganze Bande, Barrows und Blunk und Colleen Nild und Bob Bundy und Pris – was machten sie jetzt gerade? Welchen verrückten Plan heckten sie gerade aus?
»Spuck’s aus. Warum?«
»Sie ist… kitschig.«
»Kitschig? Von wegen.« Er funkelte mich an.
»Vergiss die Idee. Was, glaubst du, treibt Barrows jetzt gerade? Meinst du, die bauen die Edwards? Oder klauen sie uns gerade die Idee mit der Hundertjahrfeier? Oder hecken etwas völlig Neues aus? Maury, wir haben keine Vision. Das ist unser Problem.«
»Klar haben wir eine.«
»Nein. Weil wir nicht verrückt sind. Wir sind viel zu normal. Wir sind nicht wie deine Tochter, wir sind nicht wie Barrows. Ist doch so, oder? Sag bloß, du fühlst es nicht? Den Mangel an Verrücktheit hier? Das Herumbasteln an irgendeinem monströsen, durchgeknallten Projekt bis in die Puppen, das vielleicht mittendrin abgebrochen wird, damit man etwas Neues, genauso Durchgeknalltes anfangen kann.«
»Ja, mag sein. Aber Herrgott noch mal, Louis, wir können uns nicht einfach zum Sterben hinlegen, nur weil Pris die Seite gewechselt hat. Kannst du dir nicht denken, dass ich selbst solche Gedanken gehabt habe? Ich kenne sie besser als du, mein Freund, viel besser. Aber wir müssen weitermachen und tun, was wir können. Deine Idee eben, die kommt vielleicht nicht an die Glühbirne oder das Streichholz ran, aber sie ist gut. Sie ist machbar und lässt sich verkaufen. Sie wird funktionieren. Und was haben wir denn Besseres? Auf jeden Fall sparen wir damit Geld – wir brauchen keinen Designer von außen holen, der die Nannys entwirft, und auch keinen Ingenieur als Ersatz für Bundy, falls der sich überhaupt ersetzen lässt.«
Geld sparen, dachte ich. Darüber brauchen sich Pris und Barrows keine Gedanken zu machen, die schicken mal kurz einen Umzugswagen rüber, um Pris’ Kram von Boise nach Seattle zu schaffen. Wir sind Schmalspurunternehmer. Wir sind Zwerge. Ohne Pris sind wir nichts…
Was ist denn jetzt los? Habe ich mich etwa in sie verliebt? In eine Frau mit Augen aus Eis, eine von Ehrgeiz zerfressene Schizoide, die unter Vormundschaft des FBMH steht und für den Rest ihres Lebens in therapeutischer Behandlung bleiben muss? Eine ehemalige Psychotikerin, die sich in hirnrissige Projekte stürzt, die jeden verleumdet und angreift, der ihr nicht genau das gibt, was sie haben will? Wie kann man sich in eine solche Frau, in ein solches Monstrum verlieben?
Es war, als wäre Pris für mich nicht nur das Leben, sondern auch das Anti-Leben – das Tote, das Grausame, das Verletzende. Und damit zugleich die personifizierte Existenz. Leben in seiner berechnenden, harten, rücksichtslosen Realität. Ich ertrug ihre Gegenwart nicht und ihre Abwesenheit auch nicht. Ohne Pris vertrocknete ich wie eine Fliege auf der Fensterbank, unbemerkt und unwichtig; in ihrer Nähe war ich zerrissen, am Boden zerstört, doch irgendwie lebendig – dann gab es mich. Genoss ich es, zu leiden? Nein. Aber das Leiden schien einfach zum Leben dazuzugehören, und ohne Pris gab es kein Leiden, nichts Unberechenbares, Unfaires, Verrücktes. Und es gab auch kein Leben, nur Möchtegernpläne und ein verstaubtes kleines Büro, in dem zwei Männer Sandkastenspiele veranstalteten… Ich wollte weiß Gott nicht, dass Pris oder irgendjemand sonst mir Leid zufügte. Aber zu leiden hieß, dass man nah an der Wirklichkeit war. In einem Traum gibt es Angst, aber keinen tatsächlichen, körperlichen Schmerz, keine alltäglichen Qualen, wie Pris sie uns durch ihre bloße Gegenwart verschaffte. Es war nichts, was sie uns antat; es war eine natürliche Folge dessen, was sie war.
Wir konnten diesen Qualen nur entkommen, indem wir uns Pris vom Hals schafften. Aber etwas anderes war geschehen: Wir hatten Pris verloren. Und damit die unmittelbare Wirklichkeit mit all ihren Widersprüchen und Absurditäten. Von nun an war das Leben vorhersagbar: Wir würden die Bürgerkriegs-Nannys produzieren, würden das eine oder andere Geld machen und so weiter. Aber was für eine Bedeutung hatte das? Was spielte es für eine Rolle?
»Hör mir zu, Louis«, sagte Maury. »Wir müssen da durch.«
Ich nickte.
»Ernsthaft. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir rufen jetzt den Vorstand zusammen, und du unterbreitest ihnen deine Idee. Und du hängst dich richtig rein, als ob du wirklich daran glaubst. Ja? Versprichst du mir das?« Er kam zu mir und schlug mir auf den Rücken. »Komm schon. Hoch mit dem Hintern, Kumpel!«
»Na gut. Aber du sprichst mit jemandem, der eigentlich schon unter der Erde ist.«
»Ja, genau so guckst du auch aus der Wäsche. Aber jetzt komm. Wir müssen ohnehin nur Stanton überzeugen. Lincoln wird uns keine Probleme machen – er hockt ja bloß in seinem Zimmer und lacht sich über ›Winnie Pu‹ kaputt.«
»Was zum Teufel ist das nun schon wieder? Noch so ein Kinderbuch?«
»Genau das, Kumpel. Los jetzt!«
Ich gab mir einen Ruck und machte mich auf den Weg. Aber ins Leben zurückholen konnte mich nichts außer Pris. An dieser Tatsache kam ich nicht vorbei, und sie kostete mich jeden Tag mehr Kraft.
Der erste Artikel in einer Seattler Zeitung, in dem Pris vorkam, wäre uns beinahe entgangen, denn auf den ersten Blick handelte er gar nicht von ihr. Wir mussten ihn mehrmals lesen, bis wir uns ganz sicher waren.
Er handelte von Sam Barrows – das hatte unsere Aufmerksamkeit erregt. Und von einer hinreißenden jungen Künstlerin, mit der er sich in den Nachtclubs sehen ließ. Der Name der jungen Frau lautete, dem Verfasser zufolge, Pristine Womankind.
»Herrgott noch mal«, rief Maury mit tiefrotem Gesicht. »Womankind, das ist englisch für Frauenzimmer. Es soll eine Übersetzung sein, aber es stimmt nicht. Ich habe euch da nämlich immer etwas vorgemacht, dir und Pris und meiner Exfrau. Frauenzimmer bedeutet nicht das weibliche Geschlecht, es bedeutet Hure.« Er las sich den Artikel noch einmal durch. »Sie hat ihren Namen geändert, aber sie hat keine Ahnung. Es müsste Pristine Streetwalker heißen. Was für eine Farce! Und weißt du, wo sie das her hat? Aus ›Marjorie Morningstar‹. Morgenstern… Daher hat Pris die Idee. Und aus Priscilla wird Pristine.« Er stiefelte hektisch durch das Büro. »Ich weiß, dass es Pris ist, es muss Pris sein. Hör dir die Beschreibung an:
Bei Swami’s gesichtet: Niemand anders als Sam (The Big Man) Barrows, in Begleitung seines – wie wir es für Kinder, die lange aufbleiben, gern ausdrücken – »neuen Proteges«, einem Mädel schärfer als der Bleistift, mit dem eine Lehrerin der sechsten Klasse die Schulaufgaben benotet, das da heißt – und jetzt verschlucken Sie sich nicht – Pristine Womankind, mit einem Nicht-von-dieser-Welt- Gesichtsausdruck, schwarzen Haaren und einer Figur, die diese alten hölzernen Galionsdinger (Sie wissen schon) vor Neid erblassen lässt. Ebenfalls dabei Dave Blunk, der Rechtsanwalt, der uns erzählt, dass Pris eine Künstlerin und darüber hinaus mit Gaben gesegnet ist, die man nicht sehen kann. Und, sagte er, vielleicht wird sie demnächst im Fernsehen zu sehen sein, als Schauspielerin…
Gott, was für ein Dreck!« Maury warf die Zeitung auf den Tisch. »Diese Klatschkolumnisten haben doch alle ein Rad ab. Aber es geht eindeutig um Pris. Nur was soll das heißen, dass sie als Fernsehschauspielerin auftreten wird?«
»Barrows gehört vermutlich auch ein Fernsehsender.«
»Ihm gehört eine Hundefutterfabrik, die eine wöchentliche Fernsehshow sponsert, eine Art Variete-Sendung. Und wahrscheinlich macht er ordentlich Druck, dass sie Pris ein paar Minuten geben. Nur wozu? Sie kann überhaupt nicht schauspielern. Sie hat keinen Funken Talent. Ich glaube, ich gehe zur Polizei. Er schläft mit ihr! Dieses Vieh schläft mit meiner Tochter!« Maury rief beim Flughafen an und versuchte, einen Raketenflug nach Seattle zu bekommen. »Ich flieg da hin und lass ihn festnehmen«, erklärte er zwischen den Telefonaten. »Nein, ich nehme gleich selbst eine Waffe mit – zur Hölle mit der Polizei. Die Kleine ist erst achtzehn, das ist eine Straftat. Ich mach ihn fertig. Der geht für fünfundzwanzig Jahre hinter Gitter.«
»Jetzt hör mir mal zu, Maury. Barrows hat das alles von vorne bis hinten durchdacht. Er hat diesen Anwalt, Blunk. Die haben sich abgesichert. Frag mich nicht wie, aber die haben an alles gedacht. Bloß weil irgendein Klatschkolumnist schreibt, dass deine Tochter…«
»Dann bring ich eben sie um.«
»Warte! Setz dich um Himmels willen hin und hör mir zu. Ob sie mit ihm schläft oder nicht, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich ist sie seine Geliebte. Aber wir können es nicht beweisen. Natürlich, du kannst sie zwingen, nach Ontario zurückzukehren, doch selbst dann wird er sich irgendwas einfallen lassen.«
»Wäre sie doch bloß in Kansas City geblieben. Wäre sie bloß nie aus der Nervenklinik rausgekommen. Sie ist doch noch ein Kind.« Er sah mich an. »Und was könnte er sich einfallen lassen?«
»Er könnte sie mit irgendeinem Hiwi in seiner Firma verheiraten. Dann hat ihr niemand mehr etwas zu sagen.« Ich hatte mit der Lincoln gesprochen und wusste Bescheid. Sie hatte mir klargemacht, wie schwer es war, gegen einen Mann wie Barrows anzutreten, der die Paragrafen zurechtbiegen konnte wie Pfeifenreiniger. Für ihn waren sie keine Vorschriften, keine Hindernisse, sondern Gebrauchsgegenstände.
»Ja, ich verstehe, worauf du hinauswillst. Als rechtmäßigen Vorwand, sie in Seattle zu behalten.« Maurys Gesicht war grau.
»Und dann siehst du sie nie wieder.«
»Und sie wird mit zwei Männern schlafen. Mit ihrem Hiwi-Ehemann, irgendeinem Büroboten in irgendeiner Fabrik, die Barrows gehört, und… mit Barrows.« Er starrte mich an.
»Maury, du solltest den Tatsachen ins Auge sehen. Pris hat wahrscheinlich schon mit Männern geschlafen.«
Seine Züge verzerrten sich noch mehr.
»Ich sag dir das wirklich nicht gern, aber die Art und Weise, wie sie neulich abends mit mir geredet hat…«
»Na schön. Belassen wir es dabei.«
»Mit Barrows zu schlafen, wird sie nicht umbringen, und dich wird es auch nicht umbringen. Zumindest wird sie kein Kind kriegen, dafür wird er schon sorgen. Er ist schlau genug, sie regelmäßig impfen zu lassen.«
Maury nickte düster. »Am liebsten wäre ich tot.«
»Geht mir genauso. Aber weißt du noch, was du vor nicht einmal zwei Tagen zu mir gesagt hast? Dass wir weitermachen müssen, ganz egal, wie wir uns fühlen? Jetzt sage ich dasselbe zu dir. Ganz egal, was Pris dir und mir bedeutet hat.«
»Ja.«
Also machten wir da weiter, wo wir aufgehört hatten.
Auf der letzten Vorstandssitzung hatte sich die Stanton dagegen verwahrt, dass die Nannys das Grau der Rebellen trugen. Sie war durchaus bereit, das Bürgerkriegsthema mitzutragen, doch die Soldaten mussten treue Unionisten sein. Wer würde sein Kind schon einem Rebellen anvertrauen? Wir akzeptierten das, und Jerome erhielt den Auftrag zur Umrüstung der Fabrik. In der Zwischenzeit machten wir uns in Ontario an die Entwürfe, berieten uns mit einem japanischen Elektroingenieur, den wir auf Teilzeitbasis eingestellt hatten.
Ein paar Tage später stolperte ich über einen weiteren Artikel in einer Seattler Zeitung, diesmal vor Maury.
Miss Pristine Womankind, das faszinierende junge Starlet mit dem rabenschwarzen Haar, eine Entdeckung von Barrows Enterprises, wird für die Überreichung des goldenen Baseballs an die Champions der Little League zur Verfügung stehen. Das erklärte Irving Kahn, der Pressesprecher von Mr. Barrows, heute gegenüber Vertretern der Nachrichtenagenturen. Da noch ein Entscheidungsspiel der Little League aussteht, ist offen, wer…
Also beschäftigte Barrows neben Blunk und der übrigen Meute auch noch einen Presseagenten. Er hielt seinen Teil des Handels ein, worauf auch immer sie sich geeinigt hatten, daran bestand kein Zweifel. Und ich bezweifelte ebenso wenig, dass auch Pris ihren Teil einhielt. Sie ist in guten Händen, sagte ich mir. Vermutlich gibt es in den USA niemanden, der geeigneter wäre, ihr zu geben, was sie sich vom Leben verspricht.
Der Artikel trug die Überschrift OBERLIGA ZEICHNET DEN NACHWUCHS AUS, womit Pris jetzt ›Oberliga‹ war. Die weitere Lektüre ergab, dass Barrows für die Trikots der Little-League-Mannschaft aufgekommen war, die aller Voraussicht nach den goldenen Baseball gewinnen würde – überflüssig zu erwähnen, dass er auch den goldenen Baseball selbst sponserte.
Ja, ich hatte keinen Zweifel, dass Pris sehr zufrieden war. Schließlich hatte Jayne Mansfield in den 50ern auch als ›Miss Gerader Rücken‹ angefangen; ihre Wahl durch die amerikanischen Chiropraktiker war ihr erster öffentlicher Auftritt gewesen. Und sie hatte damals eine fast schon krankhafte Neigung zu gesunder Ernährung gehabt.
Schauen wir also mal, was für Pris drin ist, dachte ich. Als Erstes überreicht sie einer Schulmannschaft den goldenen Baseball, und von da an steigt sie rasch auf. Vielleicht verschafft ihr Barrows eine Strecke mit Aktfotos in Life, das ist durchaus drin, sie bringen ja jede Woche eine. Das würde ihren Bekanntheitsgrad sprunghaft ansteigen lassen. Dann könnte sie kurz Präsident Mendoza heiraten. Er ist schon wie oft verheiratet gewesen? Einundvierzigmal, manchmal kaum länger als eine Woche. Oder sich zumindest zu einer der Partys im Weißen Haus einladen lassen oder auf die Hochseeyacht des Präsidenten oder auf seinen luxuriösen Feriensatelliten. Aber am besten zu einer Party; die Schönheiten, die dort aufmarschieren, haben eine goldene Zukunft vor sich, ihnen stehen alle möglichen Karrieren offen, vor allem im Showbereich. Denn wenn Präsident Mendoza sie will, dann will sie auch jeder andere Mann in den USA; schließlich hat der Präsident der Vereinigten Staaten, wie jedermann weiß, nicht nur einen unglaublich erlesenen Geschmack, sondern auch die erste Wahl an…
Ich machte mich selbst verrückt mit diesen Gedanken.
Eine Woche später entdeckte ich Pris beim Durchblättern der Fernsehzeitschrift. Sie trat tatsächlich in der Show auf, die von Barrows’ Hundefutterfabrik gesponsert wurde. Dem Programm zufolge spielte sie die Assistentin in einer Messerwerfernummer; brennende Messer wurden auf sie geworfen, während sie den Lunar Fling tanzte und dabei einen dieser neuen durchsichtigen Badeanzüge trug. Die Szene war in Schweden gedreht worden – solche Badeanzüge sind an den Stränden der USA nach wie vor verboten.
Ich erzählte Maury nichts davon, doch er stolperte selbst darüber. Einen Tag vor der Sendung rief er mich zu sich und zeigte mir die Zeitschrift. Dort war auch ein kleines Foto von Pris abgedruckt, nur ihr Kopf und die Schultern. Es war jedoch so aufgenommen, dass man den Eindruck hatte, sie sei nackt. Wir starrten es beide grimmig an. Aber es gab nichts daran zu rütteln – sie sah glücklich aus. Im Hintergrund waren grüne Hügel und Wasser zu sehen. Und davor diese lachende, schwarzhaarige, schlanke junge Frau, voller Leben und Begeisterung und Energie. Voller… Zukunft.
Ja, die Zukunft gehört ihr, wurde mir beim Betrachten des Fotos klar. Ob sie nun nackt auf einem Ziegenhaarteppich für Life posiert oder ein Wochenende lang die Geliebte des Präsidenten spielt oder wild im Fernsehen tanzt, während brennende Messer auf sie geschleudert werden – sie ist immer noch authentisch, so schön wie die Hügel und der Ozean, und niemand kann das zerstören oder beschädigen, wie wütend und elend er sich auch fühlen mag. Was haben Maury und ich denn zu bieten? Was können wir ihr geben? Nur etwas, das nach gestern, nach der Vergangenheit riecht. Nach Alter und Sorge und Tod.
»Ich glaube, ich flieg mal nach Seattle«, sagte ich.
Maury erwiderte nichts; er las zum tausendsten Mal den Text in der Fernsehzeitschrift.
»Ich mache mir ehrlich gesagt nichts mehr aus Simulacra. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber so ist es nun mal. Ich möchte einfach nur nach Seattle und schauen, wie es ihr geht. Vielleicht komme ich danach…«
»Du kommst nicht wieder. Und sie auch nicht.«
»Vielleicht doch.«
»Wollen wir wetten?«
Ich hielt zehn Dollar dagegen. Mehr konnte ich nicht tun – es nutzte nichts, ihm ein Versprechen zu geben, das ich womöglich nicht halten konnte.
»Das ist das Ende von R & R Associates«, murmelte er.
»Vielleicht. Aber ich muss trotzdem dorthin.«
Am gleichen Abend noch packte ich meine Sachen und buchte für den nächsten Morgen einen Raketenflug nach Seattle. Jetzt konnte mich nichts mehr aufhalten; ich machte mir nicht einmal die Mühe, Maury anzurufen und ihm Bescheid zu sagen. Wozu auch? Er konnte ja doch nichts ausrichten.
Meine .45er aus der Militärzeit war zu groß, also packte ich stattdessen eine kleinere Pistole ein, eine .38er. Ich wickelte sie in ein Handtuch und legte eine Schachtel Munition dazu. Ich war nie ein besonders guter Schütze gewesen, doch in einem Raum normaler Größe traf ich ein menschengroßes Ziel. Und wenn alles schiefging – meinen eigenen Kopf würde ich ganz bestimmt treffen.
Da es nichts mehr zu tun gab, machte ich es mir mit ›Marjorie Morningstar‹ gemütlich, das mir Maury geliehen hatte. Vermutlich war es dasselbe Exemplar, das Pris damals gelesen hatte. Durch die Lektüre hoffte ich einen tieferen Einblick in ihre Psyche zu bekommen.
Am nächsten Morgen stand ich früh auf, rasierte mich, nahm ein leichtes Frühstück zu mir und machte mich auf den Weg zum Flughafen.
Dreizehn
Wenn Sie wissen wollen, wie San Francisco ohne das Erdbeben und das Feuer ausgesehen hätte, müssen Sie nach Seattle fahren – eine alte Hafenstadt, die auf Hügeln errichtet wurde, mit Straßen wie Schluchten, durch die der Wind pfeift. Außer der öffentlichen Bibliothek ist nichts modern, und in den Slums sieht man Kopfsteinpflaster und roten Backstein wie in Teilen von Pocatello, Idaho. Die Slums ziehen sich meilenweit hin und wimmeln von Ratten. Im Zentrum, in der Nähe der großen Hotels, gibt es ein blühendes Einkaufsviertel. Der Wind bläst von Kanada herüber, und wenn die Boeing 900 auf dem Sea-Tac-Flugplatz landet, erhascht man einen Blick auf die Berge, aus denen er kommt. Sie sind furchterregend.
Am Flughafen nahm ich ein Taxi. Die Fahrerin kroch mehrere Meilen im Schneckentempo durch den Verkehr, bis wir endlich das Olympus erreicht hatten, ein typisches Großstadthotel mit Einkaufspassage im Untergeschoss und zahllosen Speisesälen. Tatsächlich war es eine Welt für sich, eine gelb beleuchtete Welt aus Teppichen, altem versiegeltem Holz, gut angezogenen und munter plaudernden Menschen, Fluren und Aufzügen sowie Zimmermädchen, die alles fleißig sauber hielten.
Auf meinem Zimmer machte ich das Radio an, sah kurz aus dem Fenster zur Straße hinunter, stellte die Belüftung ein, zog die Schuhe aus und schlurfte auf dem Teppichboden umher. Dann öffnete ich den Koffer und machte mich ans Auspacken. Vor einer Stunde war ich noch in Boise gewesen; jetzt befand ich mich an der Westküste, an der Grenze zu Kanada. Das war besser als Autofahren – ich war von der einen Stadt direkt in die nächste gelangt, ohne das platte Land dazwischen ertragen zu müssen. Nichts hätte mich mehr freuen können.
Ein gutes Hotel kann man daran erkennen, dass einen der Zimmerservice nie direkt ansieht, wenn man ihn kommen lässt. Er blickte zu Boden, durch einen hindurch, an einem vorbei; man bleibt unsichtbar, selbst wenn man in Unterhosen dasteht oder nackt ist. Der Angestellte kommt ganz leise herein mit dem gebügelten Hemd oder dem Essen, der Zeitung oder dem Drink; man drückt ihm das Trinkgeld in die Hand, er murmelt ein leises Dankeschön, und schon ist er wieder weg. Es hat beinahe etwas Japanisches, wie sie einen nicht ansehen. Man hat das Gefühl, als wäre überhaupt niemand im Zimmer gewesen. Die Hotelangestellten haben so großen Respekt vor der Privatsphäre ihres Gastes, dass es schon unheimlich ist. Natürlich muss man das alles nachher bezahlen. Aber lassen Sie sich nie weismachen, dass es das nicht wert wäre. Ein Mensch, der sich am Rande eines psychotischen Zusammenbruchs befindet, könnte durch wenige Tage in einem First-Class-Hotel mit seinen Geschäften und seinem Rund-um-die-Uhr-Service vollständig wiederhergestellt werden, glauben Sie mir.
Langsam fragte ich mich, wieso ich mich tags zuvor überhaupt dermaßen aufgeregt hatte. Ich kam mir vor wie auf einer wohlverdienten Erholungsreise. Ich hätte mein Leben hier verbringen können, mit Essen im Speisesaal, Zeitunglesen, Shopping – bis mir das Geld ausging. Aber ich hatte hier etwas zu erledigen. Das ist das Harte daran: das Hotel zu verlassen und draußen diese windigen grauen Gehwege hinunterzudackeln. Man ist wieder in einer Welt, in der einem niemand die Tür aufhält; man steht an der Kreuzung neben Leuten, denen man nichts mehr voraus hat; man ist wieder nur ein ganz normales, leidendes Individuum, Beute für jede vorbeikommende Unbill. Es ist, als würde man noch einmal das Trauma seiner Geburt erleben, aber wenigstens kann man am Ende, wenn man seine Sachen erledigt hat, wieder zurück ins Hotel flitzen.
Und wenn man regen Gebrauch von dem Telefon in seinem Zimmer macht, kann man sich einige Ausflüge ersparen. Man erledigt möglichst viel auf diese Weise, ja man versucht sogar, die Leute dazu zu bringen, einen im Hotel aufzusuchen statt umgekehrt.
Diesmal jedoch ließen sich meine Angelegenheiten nicht im Hotel erledigen; ich versuchte es gar nicht erst. Ich schob es einfach so lange hinaus, wie es ging: Ich verbrachte den Rest des Tages auf meinem Zimmer, und als es dunkel wurde, ging ich hinunter zur Bar und dann in einen der Speisesäle, und danach spazierte ich durch die Läden und in die Lobby und noch einmal durch die Läden. Ich trieb mich herum, wo immer man sich herumtreiben konnte, ohne nach draußen in die kalte, fast schon kanadische Nacht treten zu müssen.
Und die ganze Zeit über hatte ich die .38er in der Innentasche meines Mantels.
Es war seltsam, hierherzukommen, um etwas Illegales zu tun. Vielleicht ließ sich das alles ja auch auf legale Weise erledigen, ließ sich durch die Lincoln ein Weg finden, Pris Barrows’ Händen zu entreißen. Aber auf einer tieferen Ebene genoss ich es, mit einer Waffe nach Seattle gekommen zu sein. Ich mochte das Gefühl, allein zu sein und niemanden zu kennen und mich bald mit Mr. Sam Barrows auseinanderzusetzen, ohne dass mir jemand half. Es war wie in einem alten Western. Ich war der Fremde in der Stadt, bewaffnet und mit einer Mission.
Ich ging zurück auf mein Zimmer, lag auf dem Bett, las Zeitung, sah fern, ließ mir um Mitternacht einen Kaffee kommen. Morgen früh spüre ich Barrows auf, sagte ich mir.
Dann – es war vielleicht halb eins und ich wollte gerade schlafen gehen – kam mir ein Gedanke: Warum nicht Barrows jetzt gleich anrufen? Ihn wecken. Ohne ihm zu sagen, wer ich bin, einfach nur: Ich krieg dich, Sam. Ihm richtig Angst einjagen, ihn wissen lassen, dass ich in der Stadt bin.
Raffiniert!
Ich hatte ein, zwei Drinks intus, oder waren es sechs oder sieben? Ich nahm den Hörer ab und sagte der Vermittlung des Hotels: »Geben Sie mir Sam K. Barrows. Die Nummer weiß ich nicht.«
Kurz darauf hörte ich Barrows’ Telefon klingeln und spielte im Kopf noch einmal durch, was ich sagen würde. Lassen Sie Pris wieder zu R & R Associates zurück, würde ich sagen. Ich hasse sie, aber sie gehört zu uns. Für uns ist sie das personifizierte Leben… Das Telefon klingelte und klingelte; offenbar war niemand zu Hause oder niemand mehr wach genug, um ranzugehen. Schließlich legte ich auf.
Was für eine dämliche Situation für einen erwachsenen Mann! Wie konnte jemand wie Pris für uns auf einmal das Leben an sich repräsentieren? Sind wir dermaßen verwirrt? Oder sagt das nicht eher etwas über das Leben aus als über uns? Es ist doch nicht unser Fehler, dass das Leben so ist. Wir haben uns das doch nicht ausgedacht. Oder etwa doch?
Und so weiter. Ich muss ein paar Stunden herumgetigert sein, ohne etwas anderes im Kopf zu haben als diese diffusen Grübeleien. Ich befand mich in einem schrecklichen Zustand. Es war wie eine Virusgrippe, aber eine, die den Stoffwechsel im Gehirn angreift und einen fast umbringt. So kam es mir jedenfalls vor. Ich hatte jeden Kontakt mit der Realität verloren, sogar mit der des Hotels; ich wusste nichts mehr vom Zimmerservice, von der Einkaufspassage, den Bars und den Speisesälen, ja ich blieb nicht einmal mehr am Fenster des Zimmers stehen, um mir die erleuchteten Straßenschluchten anzusehen. Es ist eine Art zu sterben, so den Kontakt zur Stadt zu verlieren.
Nach einer Weile – ich lief immer noch auf und ab – klingelte das Telefon.
Ich nahm ab. »Hallo.«
Es war nicht Sam Barrows. Es war Maury, der mich von Ontario aus anrief.
»Woher wusstest du, dass ich im Olympus bin?« Ich war völlig von den Socken; es war, als hätte er mich mithilfe irgendeiner magischen Fähigkeit aufgespürt.
»Ich wusste, dass du in Seattle bist. Und ich wusste, dass du das beste Hotel nehmen würdest. Ich wette, du hast dich in der Hochzeitssuite eingenistet und gerade irgendeine Frau bei dir.«
»Da muss ich dich enttäuschen. Ich bin hier, weil ich Sam Barrows umbringen will.«
»Umbringen? Mit was denn? Mit deinem Dickschädel? Willst du ihm damit so lange in die Magengrube hauen, bis er tot umfällt?«
Ich erzählte Maury von der .38er.
»Jetzt pass mal auf, Kumpel.« Seine Stimme war ganz ruhig. »Wenn du das tust, sind wir alle ruiniert.«
Ich erwiderte nichts.
»Dieser Anruf kostet uns ein Vermögen. Ich habe nicht vor, hier stundenlang auf dich einzureden wie ein Seelsorger. Schlaf dich aus und ruf mich morgen an, ja? Versprich mir das oder ich ruf die Polizei an und lass dich auf deinem Zimmer festnehmen, so wahr mir Gott helfe.«
»Gut, okay.«
»Du musst es versprechen.«
»Schon gut, Maury, ich verspreche dir, heute Abend nichts mehr zu unternehmen.« Wie konnte ich auch? Ich hatte es versucht und war bereits gescheitert; ich lief ja nur auf und ab.
»Na schön. Hör zu, Louis. Deswegen kommt Pris nicht zurück. Ich habe selbst auch schon daran gedacht. Aber es würde nur ihr Leben ruinieren, wenn du dorthin fährst und diesen Typen über den Haufen schießt. Lass dir das mal durch den Kopf gehen, dann kommst du zu demselben Schluss wie ich, glaub mir. Denkst du denn, ich würde es nicht selber machen, wenn ich davon überzeugt wäre, dass es etwas bringt?«
»Keine Ahnung.« Ich hatte Kopfschmerzen und war todmüde. »Ich möchte bloß noch ins Bett.«
»Ja, du kannst gleich schlafen. Aber vorher möchte ich, dass du dich mal im Zimmer umsiehst. Steht da irgendwo so ein Tischchen mit Schubladen? Ja? Schau in die obere Schublade. Jetzt gleich, während ich noch am Telefon bin. Schau da rein.«
»Wozu?«
»Da liegt eine Bibel drin.«
Ich knallte den Hörer auf die Gabel. Dieser Schweinepriester, dachte ich. Mir so einen Rat zu geben. Wäre ich bloß nicht nach Seattle gekommen. Ich war wie das Stanton-Simulacrum, wie eine Maschine, die sich durch eine Welt bewegte, die sie nicht verstand. Die Seattle nach einer Ecke absuchte, die ihr bekannt vorkam, wo sie ihre gewohnten Kunststückchen vorführen konnte. In Stantons Fall eine Kanzlei eröffnen. In meinem Fall – was? Irgendwie versuchen, wieder eine vertraute Umgebung herzustellen, so unangenehm sie auch sein mochte. Ich hatte mich an Pris und ihre Grausamkeit gewöhnt, ja, ich hatte mich sogar an die Begegnungen mit Sam K. Barrows und seinem Anwalt gewöhnt. Mein Instinkt trieb mich vom Unbekannten zum Bekannten zurück, es war die einzige Richtung, in der ich funktionierte.
Jetzt weiß ich, was ich will, sagte ich mir. Ich will Barrows Enterprises angehören. Ich will dazugehören, wie Pris. Ich will ihn überhaupt nicht erschießen.
Ich wechsle zur anderen Seite über.
Ich will nicht unbedingt den Lunar Fling tanzen, darauf bin ich nicht aus. Ich will nicht ins Fernsehen kommen, bin nicht daran interessiert, meinen Namen in Neonschrift zu sehen. Ich will mich einfach bloß nützlich machen. Ich will, dass der große Mann sich meiner Fähigkeiten bedient.
Ich griff zum Hörer und wählte Maurys Nummer. Es klingelte eine Weile, dann ging Maury ran. Er klang verschlafen.
»Warst du schon im Bett? Hör zu, Maury. Ich muss es dir sagen. Ich tue mich mit Barrows zusammen, und zum Teufel mit dir und meinem Vater und Chester und Stanton, der ohnehin nur ein Diktator ist und uns das Leben zur Hölle machen würde. Der Einzige, dem ich das nur ungern antue, ist Lincoln. Aber wenn er wirklich so allwissend und verständnisvoll ist, dann wird er mir schon vergeben.«
»Wie bitte?« Maury schien mich nicht verstanden zu haben.
»Ich verkaufe meine Anteile.«
»Nein. Da liegst du falsch.«
»Wie kann ich falschliegen? Was soll das heißen, ich liege falsch?«
»Wenn du zu Barrows gehst, wird es keine R & R Associates mehr geben. Also auch nichts, was du verkaufen könntest. Wir machen dann einfach dicht, Kumpel.«
»Ist mir doch egal. Ich weiß nur, dass Pris recht hat – du kannst einem Menschen wie Barrows nicht begegnen, ohne dass er nicht dein Leben verändert. Er ist ein Stern, ein Komet. Du folgst ihm, oder dein Leben hat jeden Sinn und Zweck verloren. Es ist ein Instinkt. Du wirst das eines Tages auch merken. Barrows ist genial. Ohne ihn sind wir Schnecken. Was ist der Sinn des Lebens? Sich durch den Staub zu schleppen? Man lebt nicht ewig. Wenn du dich nicht zu den Sternen streckst, bist du tot. Die .38er, die ich dabeihabe – wenn ich es nicht zu Barrows Enterprises schaffe, werde ich mir das Hirn aus dem Schädeln ballern. Das meine ich ernst.«
Maury erwiderte nichts.
»Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Aber ich musste es dir sagen.«
»Du bist krank. Ich werde… ich rufe Doktor Horstowski an.«
»Wozu das denn?«
»Damit er mit dir Kontakt aufnimmt. Telefonisch. Jetzt gleich.«
»Gut.« Ich legte auf.
Ich saß auf dem Bett und wartete, und tatsächlich etwa zwanzig Minuten später klingelte erneut das Telefon.
»Hallo.«
Eine weit entfernte Stimme. »Hier ist Milton Horstowski.«
»Louis Rosen.«
»Mr. Rock hat mich angerufen.« Pause. »Wie geht es Ihnen, Mr. Rosen? Mr. Rock sagte, Sie wirkten wegen irgendetwas aufgeregt.«
»Ja, aber, das geht Sie gar nichts an. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit meinem Partner, mehr nicht. Ich bin jetzt in Seattle, um mich einem viel größeren, fortschrittlicheren Unternehmen anzuschließen. Erinnern Sie sich noch, dass ich Sam K. Barrows erwähnt habe?«
»Ja, ich kenne ihn.«
»Ist das also so verrückt?«
»Nein, ganz und gar nicht.«
»Das mit der Pistole habe ich nur erzählt, um ihn zu provozieren. Es ist spät, und ich bin ein bisschen betrunken. Es ist nicht einfach, eine Partnerschaft zu beenden.« Ich wartete kurz, aber Horstowski erwiderte nichts. »Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Wenn ich nach Boise komme, schaue ich vielleicht einmal bei Ihnen vorbei. Wissen Sie, das alles geht mir ganz schön an die Nieren. Pris ist weg. Sie hat sich Barrows angeschlossen.«
»Ja, ich weiß. Wir stehen immer noch in Kontakt.«
»Ich glaube, ich habe mich in sie verliebt. Könnte das sein? Ich meine, bei einer Person meines psychologischen Typs?«
»Wäre möglich.«
»Na ja, jedenfalls kann ich ohne sie nicht leben, also bin ich jetzt in Seattle. Aber das mit der Pistole war nur so dahergeredet, das können Sie Maury gern ausrichten, falls es ihn beruhigt. Ich wollte ihm nur zeigen, dass ich es ernst meine, verstehen Sie?«
»Ja. Ich glaube schon.«
Wir redeten noch eine Weile, ohne dass dabei etwas herauskam, dann verabschiedete er sich. Ich legte auf und dachte: Der Bursche verständigt wahrscheinlich gleich die Polizei oder das hiesige FBMH. Ich darf kein Risiko eingehen; dass er es könnte, reicht schon.
Also packte ich so schnell wie möglich meine Sachen. Dann verließ ich das Zimmer, nahm den Aufzug hinunter ins Erdgeschoss und bat am Empfang um die Rechnung.
»War vielleicht irgendetwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit, Mr. Rosen?«, fragte der Hotelangestellte.
»Nein, nein. Ich habe endlich die Person erreicht, die ich hier treffen wollte, und ich soll gleich bei ihm vorbeikommen.«
Ich bezahlte die Rechnung – sie war ziemlich moderat – und bat um ein Taxi. Als es kam, trug der Portier meinen Koffer nach draußen und verstaute ihn im Kofferraum des Wagens. Ich gab ihm ein paar Dollar Trinkgeld, und einen Moment später schoss das Taxi in den für diese Zeit überraschend dichten Verkehr hinaus.
Als wir an einem ansprechend aussehenden Motel vorbeikamen, merkte ich mir die Adresse. Ich ließ das Taxi ein paar Blocks weiter anhalten, bezahlte und ging zu Fuß zurück. Dem Motelbesitzer erzählte ich, dass ich mit dem Wagen liegengeblieben sei und trug mich unter dem Namen James W. Byrd – Geschäftsmann auf Durchreise – ein, den ich mir gerade ausgedacht hatte. Ich zahlte im Voraus und ging mit dem Schlüssel in der Hand zu Zimmer sechs.
Es war sauber und hell, genau, was ich wollte. Ich legte mich gleich hin. Beim Wegdämmern dachte ich: Jetzt kriegen sie mich nicht, ich bin in Sicherheit. Morgen gehe ich zu Barrows und unterbreite ihm die Neuigkeit, dass ich auf seine Seite wechsle. Und dann bin ich wieder bei Pris, werde sie bei ihrem Aufstieg zum Ruhm begleiten. Ich werde ihr sagen, was ich für sie empfinde, dass ich sie liebe. Vielleicht heiraten wir ja. Sie ist vermutlich noch viel schöner als früher, jetzt wo sie unter Barrows’ Obhut war. Und wenn er mir Konkurrenz machen will, dann fege ich ihn vom Angesicht der Erde. Der wird mir nicht im Weg stehen, der nicht…
Mit diesem Gedanken schlief ich ein.
Gegen acht weckte mich die Sonne; ich hatte vergessen, die Vorhänge zuzuziehen. Die in einer Reihe geparkten Autos draußen glitzerten. Es würde ein schöner Tag werden.
Was war mir in der Nacht durch den Kopf gegangen? Wirres Zeug, wie ich Pris heiratete und Sam Barrows killte. Die Phantasien eines kleinen Jungen. Beim Einschlafen fällt man wieder in die Kindheit zurück, eindeutig… Und doch: Ich war hierhergekommen, um Pris für mich zu gewinnen, und wenn Barrows sich mir in den Weg stellte – Pech für ihn.
Ich schlurfte ins Bad, nahm eine lange kalte Dusche und dachte über mein Vorgehen nach. Zunächst musste ich mich Barrows auf angemessene Weise nähern, musste meine tatsächlichen Gefühle verbergen, meine wahren Motive. Ich würde ihm sagen, dass ich für ihn arbeiten wollte, vielleicht beim Design des Simulacrums helfen, die ganze Erfahrung einbringen, die ich während der Jahre mit Maury und Jerome gesammelt hatte. Aber kein Sterbenswörtchen von Pris, denn wenn er auch nur ansatzweise etwas davon merkte, dann… Du bist clever, Sam K. Barrows, dachte ich. Aber meine Gedanken lesen kannst du nicht.
Während ich mich anzog, übte ich vor dem Spiegel. Mein Gesicht war absolut gelassen, niemand wäre darauf gekommen, dass mein Herz gerade aufgefressen wurde, vom Wurm der Begierde, von der Liebe zu Pris Frauenzimmer oder Womankind oder wie sie sich derzeit nannte. Das ist ein Zeichen von Reife, sagte ich mir. In der Lage zu sein, seine wahren Gefühlen zu verbergen, eine Maske aufzusetzen. Einen Mann wie Barrows zu täuschen. Wenn man das kann, hat man es geschafft.
Wenn nicht – ist man erledigt.
Ich ging frühstücken – Eier mit Schinken, Toast, Kaffee, Saft –, dann, um halb zehn, kehrte ich auf mein Zimmer zurück und zog das Telefonbuch von Seattle hervor. Ich brauchte eine ganze Weile, die Aufstellung von Barrows’ diversen Unternehmen durchzugehen, bis ich endlich das eine fand, in dem er wohl gerade war. Ich wählte die Nummer.
»Northwest Electronics«, meldete sich eine junge Frau munter. »Guten Morgen.«
»Ist Mr. Barrows schon da?«
»Ja, Sir, aber er spricht gerade. Ich verbinde Sie mit seinem Büro.«
Eine Pause, dann eine andere Stimme, ebenfalls weiblich, aber viel tiefer und älter klingend. »Mr. Barrows’ Büro. Mit wem spreche ich?«
»Ich hätte gern einen Termin mit Mr. Barrows. Louis Rosen aus Boise. Mr. Barrows kennt mich.«
»Einen Moment.« Wieder eine Pause. »Mr. Barrows kann jetzt mit Ihnen sprechen. Bitte, Sir.«
Ich räusperte mich. »Hallo.«
»Wie geht’s Ihnen, Rosen? Was kann ich für Sie tun?« Barrows klang gut gelaunt.
»Wie… wie geht es Pris?«
»Pris geht es gut. Wie geht es Ihrem Vater und Ihrem Bruder?«
»Gut.«
»Muss interessant sein, einen Bruder zu haben, dessen Gesicht auf dem Kopf steht. Ich hätte ihn wirklich gern kennengelernt. Hören Sie, warum kommen Sie nicht auf einen Sprung vorbei, solange Sie in Seattle sind? Heute so gegen eins?«
»Ja, gegen eins.«
»Gut. Bis dann.«
»Warten Sie, Barrows. Werden Sie Pris heiraten?«
Keine Antwort.
»Ich knall Sie ab.«
»Wie bitte?«
»Ich habe hier eine in Japan hergestellte, encephalotrope flugfähige Antipersonenmine. Und ich werde sie im Raum Seattle aussetzen. Wissen Sie, was das heißt?«
»Ähm, nicht genau. Encephalotrop – hat das nicht irgendwas mit dem Gehirn zu tun?«
»Ja, mit Ihrem Gehirn. Wir haben Ihr Hirnstrommuster aufgezeichnet, als Sie in unserem Büro in Ontario waren. Es war ein Fehler, dorthin zu kommen. Die Mine wird Sie aufspüren und detonieren. Sobald sie unterwegs ist, lässt sie sich nicht mehr aufhalten. Es ist aus mit Ihnen.«
»Ja, klar.«
»Pris liebt mich. Sie hat es mir gestanden. Lassen Sie die Finger von ihr. Wissen Sie überhaupt, wie alt sie ist?«
»Ja, achtzehn.«
Ich knallte den Hörer auf die Gabel. Ich bring ihn um, sagte ich mir. Wirklich! Er hat meine Kleine. Wer weiß, was er mit ihr anstellt…
Ich wählte noch mal und landete wieder bei der munteren jungen Frau in der Zentrale. »Northwest Electronics. Guten Morgen.«
»Ich habe gerade mit Mr. Barrows gesprochen.«
»Oh, sind Sie unterbrochen worden? Ich stelle Sie noch mal durch, Sir, einen Moment.«
»Nein. Sagen Sie Mr. Barrows einfach, dass ich ihn mit meiner hochentwickelten Technik erwischen werde. Können Sie ihm das bitte ausrichten? Wiederhören.« Ich legte wieder auf.
Er wird die Nachricht bekommen, dachte ich. Aber vielleicht hätte ich besser gesagt, dass er Pris herbringen soll oder so. Würde er das tun, um seine Haut zu retten? Und ob er das tun würde! Er würde sie jederzeit aufgeben. Sie bedeutete ihm nichts; für ihn war sie nur eine schöne junge Frau mehr. Ich war der Einzige, der sie für das liebte, was sie wirklich war.
Ich nahm den Hörer ab und wählte. »Northwest Electronics. Guten Morgen.«
»Stellen Sie mich bitte noch einmal zu Mr. Barrows durch.«
Eine Reihe von Klicklauten.
»Büro von Mr. Barrows. Wer spricht?«
»Hier ist Louis Rosen. Ich würde gern mit Barrows reden.«
»Einen Augenblick, Mr. Rosen.«
Ich wartete.
»Hallo, Louis. Sie scheuchen ja ganz schön die Hühner auf, was?« Barrows gluckste. »Ich habe den Army-Stützpunkt ein Stück die Küste runter angerufen, und es gibt tatsächlich so etwas wie eine encephalotrope Mine. Wie sind Sie da denn rangekommen? Ich wette, in Wirklichkeit haben Sie gar keine.«
»Überlassen Sie mir Pris, und ich verschone Sie.«
»Jetzt mal halblang.«
»Sie denken, das ist irgendein Spielchen? Nein, ich liebe Pris. Alles andere ist mir egal. Also, was ist nun?« Meine Stimme bebte. »Oder muss ich erst rüberkommen und sie holen? Ich habe hier alle möglichen Waffen. Ich meine es ernst!« In meinem Hinterkopf sagte eine Stimme: Der Hurensohn wird sie aufgeben, der ist doch stinkfeige.
»Beruhigen Sie sich, Mann.«
»Na schön, dann mach ich mich jetzt auf den Weg zu Ihnen.«
»Jetzt hören Sie mal zu, Rosen. Ich vermute, Maury Rock hat Sie dazu angestachelt. Aber ich habe mit Dave gesprochen und er hat mir versichert, dass der Tatbestand der Unzucht mit Minderjährigen nicht greift, wenn…«
»Unzucht?«, rief ich. »Ich mach Sie kalt!« In meinem Hinterkopf sagte die Stimme: Ja, mach ihn fertig, den Hurensohn.
»Sie sind ja psychotisch, Rosen. Ich werde Maury anrufen, der ist wenigstens normal. Ich werde ihm sagen, dass Pris wieder zurück nach Boise fliegt.«
»Wie bitte? Wann?«
»Heute. Aber nicht mit Ihnen zusammen. Ich glaube, Sie sollten zu einem Psychiater gehen, Sie sind sehr krank.«
»Also gut.« Ich wurde etwas ruhiger. »Heute. Aber ich bleibe hier, bis Maury anruft und sagt, dass Pris in Boise ist.« Dann legte ich auf.
Wow!
Ich stolperte ins Bad und wusch mir das Gesicht mit kaltem Wasser.
Sich dermaßen irrational und unbeherrscht aufzuführen, zahlte sich also aus. Was für eine Lektion in meinem Alter. Ich hatte ihn dermaßen erschreckt, dass er mich für irre hielt. Aber war ich das nicht wirklich? Hatte mich die Angst, Pris zu verlieren, nicht durchdrehen lassen?
Ich ging wieder zum Telefon und rief Maury in der Fabrik in Boise an. »Pris kommt zurück. Sag mir Bescheid, sobald sie bei euch ist. Ich bleibe noch hier. Ich habe Barrows einen Riesenschrecken eingejagt.«
»Das glaube ich erst, wenn ich sie sehe.«
»Der Mann hat Angst vor mir, Maury, panische Angst. Dir ist nicht klar, was der ganze Stress für einen gemeingefährlichen Irren aus mir gemacht hat.« Ich gab ihm die Telefonnummer des Motels.
»Hat dich Horstowski gestern Nacht angerufen?«
»Ja, aber er ist inkompetent. Du hast dein ganzes Geld verschwendet. Ich habe nichts als Verachtung für ihn übrig, und wenn ich zurückkomme, werde ich ihm das auch sagen… Maury, ich liebe Pris.«
Längeres Schweigen, dann: »Hör mal, sie ist noch ein Kind.«
»Ich möchte sie heiraten. Ich bin nicht so einer wie Sam Barrows.«
»Mir doch egal, was du für einer bist oder nicht bist. Du kannst sie nicht heiraten, sie ist zu jung. Sie muss zurück auf die Schule. Lass die Finger von meiner Tochter, Louis!«
»Nein, wir lieben uns. Du kannst uns nicht trennen. Ruf mich an, sobald sie in Boise eintrifft. Sonst mache ich Barrows fertig.«
»Du brauchst Hilfe vom FBMH, Louis. Ich würde dich Pris nie heiraten lassen, für alles Geld der Welt nicht. Und auch aus sonst keinem Grund. Wärst du nur nie nach Seattle geflogen. Sie sollte bei Barrows bleiben, ja, mit Barrows ist sie besser dran als mit dir. Was kannst du ihr schon bieten? Sieh dir doch an, was Barrows einer Frau alles bieten kann.«
»Er hat eine Prostituierte aus ihr gemacht.«
»Ach, das ist doch nur Geschwätz, weiter nichts. Unsere Partnerschaft ist beendet, Louis. Ich rufe Barrows an und sage ihm, dass ich nichts mehr mit dir zu tun habe. Pris soll bei ihm bleiben.«
»Zum Teufel mit dir!«
»Du als mein Schwiegersohn? Du denkst, ich habe sie zur Welt gebracht, damit sie dich heiraten kann? Ich lach mich tot. Du bist ein Niemand! Scher dich fort!«
Ich war wie betäubt. »Ich… ich will sie heiraten.«
»Hast du Pris gesagt, dass du sie heiraten willst?«
»Nein, noch nicht.«
»Sie wird dir ins Gesicht spucken.«
»Na und.«
»Na und? O Mann, du hast sie wirklich nicht mehr alle. Ich werde mit der Lincoln besprechen, wie ich unsere Partnerschaft für immer beenden kann.«
Das Telefon klickte; er hatte aufgelegt.
Ich konnte es nicht fassen. Ich saß auf dem Bett und starrte zu Boden. Also war Maury genau wie Pris hinter dem Geld her, wollte wie sie ganz nach oben. Nun, von irgendwoher musste sie es ja haben…
Was mache ich jetzt?, fragte ich mich. Wenn ich mir eine Kugel durch den Kopf jage, sind alle zufrieden. Sie kommen bestens ohne mich zurecht.
Doch die Stimme in meinem Kopf, die Stimme meiner Instinkte, sagte Nein. Mach sie alle fertig, sagte sie. Die ganze Bagage – Pris und Maury, Barrows, Stanton, die Lincoln. Steh auf und kämpfe.
Ein Schock, so etwas von seinem Partner zu erfahren: Wie er wirklich über einen denkt, wie er einen insgeheim sieht. Was für eine furchtbare Sache – die Wahrheit.
Kein Wunder, dass er sich auf dieses Babysitter-Simulacrum gestürzt hat; er ist froh, dass seine Tochter abgehauen ist, um Sam Barrows’ Geliebte zu werden. Er hat das Buch auch gelesen: ›Marjorie Morningstar‹.
Jetzt wusste ich, wie die Welt funktioniert. Wie die Menschen tickten. Was ihnen das Wichtigste im Leben war. Und es genügte, um auf der Stelle tot umzufallen oder sich einweisen zu lassen.
Aber ich gebe nicht auf, sagte ich mir. Ich will Pris, sie gehört zu mir. Mir doch egal, was Maury oder Barrows oder sonstwer davon halten. Mir egal, welchen Götzen sie hinterherhecheln. Ich weiß, was mir meine innere Stimme sagt: Hol Pris von ihnen weg und heirate sie. Sie war von Anfang an dazu bestimmt, die Frau von Mr. Louis Rosen aus Ontario, Oregon zu werden.
Ich griff zum Hörer und wählte.
»Northwest Electronics. Guten Morgen.«
»Geben Sie mir noch mal Mr. Barrows. Louis Rosen hier.«
Pause, dann: »Mr. Barrows’ Büro.«
»Geben Sie mir Barrows.«
»Mr. Barrows ist nicht im Hause. Mit wem spreche ich?«
»Louis Rosen. Richten Sie Mr. Barrows aus, er soll Miss Frauenzimmer…«
»Wen?«
»Miss Womankind. Sagen Sie Barrows, er soll sie mit einem Taxi zu mir ins Motel schicken.« Ich gab die Adresse durch. »Sagen Sie ihm, er soll sie auf gar keinen Fall in ein Flugzeug nach Boise setzen. Sagen Sie ihm, dass ich sonst komme und sie hole.«
»Ich kann ihm nichts sagen, weil er nicht hier ist. Er ist nach Hause gefahren.«
»Dann rufe ich ihn eben zu Hause an.« Ich drückte die Gabel und wählte die Nummer von gestern Nacht.
Pris ging ran.
»Ich bin’s. Louis. Louis Rosen.«
»Du meine Güte! Wo bist du? Du klingst so nahe.« Sie wirkte nervös.
»Ich bin in Seattle. Ich bin hier, um dich vor Sam Barrows zu retten.«
»Mein Gott!«
»Hör zu, Pris. Bleib, wo du bist. Ich komme gleich vorbei. Ja? Hast du verstanden?«
»Nein, Louis.« Ihre Stimme wurde hart. »Ich habe heute Morgen mit Horstowski gesprochen. Er hat mich vor dir und deinen Wutanfällen gewarnt.«
»Sag Barrows, er soll dich in ein Taxi setzen und hierher schicken.«
»Ich dachte eigentlich, dass Sam anruft.«
»Wenn du nicht mitkommen willst, bring ich dich um.«
»Ha! Versuch’s doch, du Widerling.«
Ich war wie vor den Kopf geschlagen. »Pris, ich…«
»Du Prolet. Du Schwachkopf. Geh zum Teufel, wenn du denkst, du kannst hier mal eben ein Stück vom Kuchen abkriegen. Ich weiß genau, was du willst. Ihr Idioten kriegt es ohne mich nicht hin, ein Simulacrum zu designen, stimmt’s? Also wollt ihr mich zurückhaben. Aber wenn du hier aufkreuzst, mach ich eine Riesenszene und behaupte, dass du mich vergewaltigt hast, und dann wanderst du für den Rest deines Lebens ins Gefängnis. Also denk lieber noch mal darüber nach.«
»Ich liebe dich, Pris.«
»Ach, geh dir was fürs Bett suchen. Und nenn mich nicht Pris. Ich heiße Pristine, Pristine Womankind. Jetzt tu mir den Gefallen und flieg zurück nach Boise und spiel weiter mit deinen armseligen kleinen Simulacra herum, ja?« Sie wartete, doch mir fiel nichts ein, was ich hätte erwidern können, jedenfalls nichts, das es wert war, ausgesprochen zu werden. »Lebwohl, du jämmerlicher Niemand. Und bitte nerv mich zukünftig nicht mehr mit deinen Anrufen. Heb sie dir für irgendeine Tussi auf, die von dir betatscht werden will. Falls du es überhaupt hinkriegst, eine aufzutreiben, die billig genug ist.« Ein Klicken – sie hatte aufgelegt.
Ich zitterte, bebte vor Erleichterung, endlich vom Telefon, von ihr weggekommen zu sein. Weg von dieser schneidenden, anklagenden, vertrauten Stimme.
Pris, dachte ich, ich liebe dich. Aber warum? Was habe ich getan, dass ich so von dir angezogen werde? Was für ein verrückter Trieb ist das?
Ich setzte mich aufs Bett und schloss die Augen.
Vierzehn
Mir blieb also nichts anderes übrig, als nach Boise zurückzukehren.
Ich war besiegt worden – nicht vom mächtigen Sam K. Barrows, auch nicht von meinem Partner Maury Rock, sondern von der achtzehnjährigen Pris. Es hatte keinen Sinn, länger in Seattle zu bleiben.
Was lag vor mir? Zurück zu R & R Associates, mich wieder mit Maury versöhnen, da weitermachen, wo ich aufgehört hatte. Zurück zur Arbeit an dem Bürgerkriegs-Babysitter, zur Arbeit für den stets schlecht gelaunten Edwin M. Stanton. Zurück zu den endlosen Lesungen des Lincoln-Simulacrums aus ›Winnie Pu‹ und ›Peter Pan‹. Der Geruch von Corina-Lark-Zigarren und ab und an der süßere Duft der A & Cs meines Vaters. Die Welt, die ich verlassen hatte, die Elektroorgel- und Kleinklavierfabrik in Boise und unser Büro in Ontario… Aber es bestand immer noch die Möglichkeit, dass Maury mich nicht zurückkommen ließ, dass es ihm ernst damit war, die Partnerschaft zu beenden. Vielleicht konnte ich also nicht einmal mehr dem entgegensehen.
War jetzt der Moment gekommen, die .38er herauszuholen und mir die Schädeldecke wegzupusten?
Ich spürte, wie sich der Stoffwechsel meines Körpers beschleunigte und wieder verlangsamte, beschleunigte, wieder verlangsamte. Ich griff haltsuchend um mich. Pris hatte mich eingefangen und im selben Moment wieder weggeworfen. Es war, als würde ein Magnet Teilchen anziehen und zugleich abstoßen; ich war in einer tödlichen Schwingung gefangen. Während Pris einfach weitermachte, ohne irgendetwas davon zu merken.
Der Sinn meines Lebens war mir nun klar. Ich war dazu verdammt, ein grausames, kaltes, steriles Etwas zu lieben – Pris Frauenzimmer. Es wäre besser gewesen, die ganze Welt zu hassen.
Die Lage war hoffnungslos, und doch entschloss ich mich zu einer allerletzten Maßnahme. Bevor ich aufgab, wollte ich die Lincoln um Rat fragen. Sie hatte mir schon einmal geholfen – vielleicht konnte sie mir auch jetzt helfen. Ich griff zum Hörer.
»Hier ist noch mal Louis«, sagte ich, als ich Maury dran hatte. »Kannst du bitte jetzt gleich die Lincoln zum Flughafen fahren und in eine Rakete nach Seattle setzen? Ich möchte sie mir für vierundzwanzig Stunden ausleihen.«
Ein hitziger Wortwechsel folgte, doch am Ende gab er nach; als ich auflegte, hatte ich sein Versprechen, dass die Lincoln noch vor Einbruch der Dunkelheit in der Boeing 900 nach Seattle sitzen würde.
Erschöpft legte ich mich hin und dachte: Jetzt holen wir unsere Investition zumindest teilweise wieder herein. Die Lincoln hat uns eine Stange Geld gekostet, und nun sitzt sie den ganzen Tag nur herum, liest aus Kinderbüchern vor und kichert sich eins.
Irgendwo in meinem Hinterkopf geisterte eine Anekdote herum, die von einer Jugendliebe Abraham Lincolns handelte. Einer unglücklichen Liebe. Lincoln und ich haben eine Menge gemeinsam, dachte ich. Die Frauen haben uns ganz schön zugesetzt. Also wird er Verständnis für das alles haben.
Was sollte ich tun, bis das Simulacrum eintraf? Im Motel bleiben war riskant… Ich entschied, in die Stadtbibliothek von Seattle zu gehen und Lincolns Frauengeschichten zu recherchieren. Ich sagte dem Motelbesitzer, wo ich war, falls jemand, der wie Abraham Lincoln aussah, nach mir fragte, dann rief ich ein Taxi und machte mich auf den Weg. Ich hatte ziemlich viel Zeit, es war erst zehn Uhr morgens.
Es gibt noch Hoffnung, sagte ich mir, während mich der Wagen zur Bibliothek brachte. Noch gebe ich nicht auf! Nicht, solange mir einer der größten Präsidenten der amerikanischen Geschichte und gleichzeitig ein erstklassiger Rechtsanwalt zur Seite steht.
Ja, wenn mir irgendjemand helfen konnte, dann Abraham Lincoln.
Was ich in der Bibliothek fand, machte mir allerdings nicht gerade Mut. Offenbar war Lincoln von seiner Jugendliebe abgewiesen worden, war darauf für mehrere Monate in tiefe Schwermut versunken und hätte fast Selbstmord begangen. Das Ereignis hatte für immer seelische Narben hinterlassen.
Na toll, dachte ich, als ich die Lexika zurück ins Regal stellte. Genau das, was ich brauche: einen noch größeren Versager als mich. Vielleicht bringen wir uns ja einfach zusammen um. Lesen uns ein paar alte Liebesbriefe vor und dann – bamm, mit der .38er.
Andererseits hatte er später Erfolg gehabt – er war Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Das bedeutete, dass es irgendwie weiterging, auch wenn man den Schmerz natürlich nie ganz vergaß. Er macht einen zu einem melancholischen, nachdenklichen Menschen. Mir war diese Schwermut an Lincoln bereits aufgefallen. Vermutlich stand mir dieselbe Entwicklung bevor.
Aber das war noch Jahre hin – und ich musste über jetzt nachdenken.
Ich verließ die Bibliothek und spazierte durch die Straßen von Seattle, bis ich einen Buchladen fand, der Taschenbücher im Angebot hatte. Dort kaufte ich mir eine Ausgabe von Carl Sandburgs Lincoln-Biografie und ging damit zurück ins Motel, wo ich es mir mit einem Sixpack und einer großen Tüte Kartoffelchips gemütlich machte.
Ich nahm mir natürlich vor allem jene Abschnitte vor, in denen besagte junge Dame eine Rolle spielte: Ann Rutledge. Aber irgendwie stellte Sandburg das Ganze nur sehr verschwommen dar; er schien dem Thema auszuweichen. Also legte ich Buch, Bier und Chips wieder zur Seite und zurück in die Bibliothek. Es war inzwischen früher Nachmittag.
Die Geschichte mit Ann Rutledge… Nach ihrem Tod an Malaria im Jahre 1835 – im Alter von neunzehn Jahren – war Lincoln in etwas verfallen, was die Britannica »einen Zustand krankhafter Niedergeschlagenheit« nannte, »offensichtlich der Auslöser für Spekulationen, ob Lincoln eine Spur Wahnsinn in sich trug. Anscheinend hatte er vor diesem Aspekt seines Charakters selbst Angst – eine Angst, die sich mehrere Jahre später in dem rätselhaftesten Ereignis seines Lebens manifestierte.« Damit war ein Vorfall im Jahre 1841 gemeint.
Ein Jahr zuvor hatte Lincoln sich mit einer hübschen jungen Frau namens Mary Todd verlobt. Er war damals neunundzwanzig. Am 1. Januar 1841 sollte Hochzeit gefeiert werden. Die Braut trug ihr Kleid; alles war bereit. Nur Lincoln kam nicht. Freunde gingen nachsehen und fanden ihn in einem Zustand des Wahnsinns, ein Zustand, von dem er sich nur langsam erholte. Am 23. Januar schrieb er seinem Freund John T. Stuart:
Ich bin der unglücklichste Mensch der Welt. Wenn dieses mein Gefühl zu gleichen Teilen auf die gesamte Menschheitsfamilie verteilt würde, gäbe es kein fröhliches Gesicht mehr auf Erden. Ob es mir je wieder besser gehen wird, vermag ich nicht zu sagen; ich habe die entsetzliche Ahnung, dass mein Zustand sich nicht ändern wird. So zu bleiben, ist unmöglich – entweder muss es mir besser gehen oder ich muss sterben.
Und in einem vorangegangenen Brief an Stuart vom 20. Januar:
Ich habe mich in den letzten Tagen auf höchst diskreditierende Weise als Hypochonder aufgeführt und dadurch die Erkenntnis gewonnen, dass Dr. Henrys Gegenwart überlebensnotwendig für mich ist. Wenn er die Stellung nicht bekommt, wird er Springfield verlassen. Sie sehen also, wie sehr mir an dieser Angelegenheit liegt.
Die »Angelegenheit« war, dass Dr. Henry zum Postmeister von Springfield ernannt werden sollte, um Lincoln weiterhin zur Verfügung stehen zu können. Mit anderen Worten: Lincoln stand zu diesem Zeitpunkt seines Lebens am Rande des Selbstmords oder des Wahnsinns oder beidem zugleich.
Die Nachschlagewerke um mich ausgebreitet, kam ich zu dem Schluss, dass Lincoln das gewesen war, was man heute einen Manisch-Depressiven nennt. In der Britannica hieß es:
Sein ganzes Leben lang war ihm eine gewisse Distanziertheit eigen, die ihn zwar nicht zu einem Realisten machte, die aber so verschleiert durch augenscheinlichen Realismus war, dass achtlose Menschen sie nicht wahrnahmen. Ihn kümmerte allerdings auch nicht, ob man sie wahrnahm oder nicht; er ließ sich treiben, gestattete den Umständen großen Einfluss auf die Bestimmung seines Kurses und verfiel in Haarspaltereien, wie etwa ob seine Zuneigungen der konkreten Wahrnehmung von Seelenverwandtschaft entsprangen oder davon abhingen, inwieweit jemand seinen Träumen und Idealen entsprach.
Und bezüglich Ann Rutledge war zu lesen:
Hier offenbarten sich seine tiefe Sensibilität wie auch die Neigung zur unverhüllten emotionalen Reaktion und zur Schwermut, die bis zum Ende seiner Tage im Wechsel mit ausgelassener Heiterkeit kam und ging.
Später, in seinen politischen Reden, befleißigte er sich eines beißenden Spotts, ein Charakterzug, der sich, wie ich herausfand, auch in Manisch-Depressiven findet. Und ein Wechsel zwischen »ausgelassener Heiterkeit« und »Schwermut« ist geradezu die Definition des Manisch-Depressiven.
Die folgende Anmerkung jedoch stellte meine Diagnose infrage:
Zurückhaltung, die manchmal in Verschlossenheit ausartete, war einer seiner wesentlichen Charakterzüge.
Und:
… Seine Fähigkeit zu »großer, schöpferischer Untätigkeit«, wie Stevenson es nannte, war bemerkenswert.
Untätigkeit, Unentschlossenheit – das war kein Symptom der manisch-depressiven Psychose, sondern der introvertierten Psychose. Der Schizophrenie.
Es war jetzt halb sechs; mir taten die Augen weh, und ich hatte Hunger. Ich stellte die Nachschlagewerke weg, dankte der Bibliothekarin und machte mich in den kalten, windigen Straßen auf die Suche nach einem Restaurant.
Ich hatte Maury also gebeten, mir einen der vergrübeltsten, kompliziertesten Menschen in der Geschichte der USA zu schicken. Während ich zu Abend aß, ließ ich mir das durch den Kopf gehen. Lincoln war genau wie ich, ich hätte dort in der Bibliothek ebenso gut meine eigene Biografie lesen können. Auf psychologischer Ebene glichen wir uns wie ein Ei dem anderen, und wenn ich ihn verstand, verstand ich auch mich.
Und er war das Gegenteil von Pris, dem kalten, schizoiden Typ. Schmerz und Einfühlungsvermögen standen ihm ins Gesicht geschrieben. Er spürte die Leiden des Krieges mit jeder Faser, jeden einzelnen Toten.
Entsprechend schwer fiel es mir zu glauben, dass seine »Distanziertheit«, wie die Britannica es nannte, ein Anzeichen von Schizophrenie war. Das Gleiche galt für seine Unentschlossenheit. Außerdem hatte ich ja persönliche Erfahrung mit ihm – mit seinem Simulacrum, um genau zu sein. Und bei dem Simulacrum empfand ich nicht jene Fremdartigkeit, Andersartigkeit, die ich bei Pris wahrnahm.
Nein, ich empfand ein ganz selbstverständliches Vertrauen zu Lincoln, er war mir sympathisch, er hatte etwas von Natur aus Gutes, Warmes, Menschliches an sich: eine Verletzlichkeit. Und ich wusste aus meinem Umgang mit Pris, dass der Schizoide eben nicht verletzlich war; er war verschlossen, ließ nichts an sich heran, bis zu dem Punkt, wo er andere Menschen beobachten, mit ihnen auf quasi wissenschaftliche Weise umgehen konnte, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Pris’ größte Angst, wurde mir klar, war die Angst vor Nähe. Und damit ging Misstrauen einher; sie neigte dazu, den Leuten Motive zu unterstellen, die sie in Wirklichkeit gar nicht hatten. Ja, das war es, was die beiden letztlich unterschied: Lincoln kannte die Widersprüchlichkeiten der menschlichen Seele, ihre großartigen Seiten und ihre schwachen, all die so merkwürdig geformten Teile, aus denen sie zusammengesetzt war. Pris dagegen besaß eine rigide, schematische Sicht der Menschen, eine Risszeichnung, eine Abstraktion. Und in der lebte sie. Kein Wunder, dass man nicht an sie herankam.
Ich beendete mein Abendessen, bezahlte die Rechnung und trat auf die Straße. Inzwischen war es dunkel geworden. Wohin jetzt? Zurück ins Motel! Ich winkte ein Taxi heran.
Als ich vor dem Motel ausstieg, sah ich Licht in meinem Zimmer. Der Besitzer kam aus seinem Büro gestürzt. »Sie haben einen Gast und er sieht wirklich wie Lincoln aus, wie Sie gesagt haben. Was ist das, ein Gag oder so? Jedenfalls habe ich ihm aufgemacht.«
»Danke.« Ich ging auf mein Zimmer.
Und dort saß, die langen Beine von sich gestreckt, die Lincoln auf einem Stuhl. Sie bemerkte mich erst nicht, sie war in die Biografie von Carl Sandburg vertieft. Neben ihr auf dem Boden stand eine kleine Leinentasche – ihr Gepäck.
»Mr. Lincoln«, sagte ich.
Sie sah auf und lächelte mich an. »Guten Abend, Mr. Rosen.«
»Was halten Sie von dem Buch?«
»Ich hatte noch nicht die Zeit, mir eine Meinung zu bilden.« Sie markierte die Seite, schloss das Buch und legte es weg. »Mr. Rock sagte mir, dass Sie in großen Schwierigkeiten wären und meine Anwesenheit und meinen Rat erbäten. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät gekommen.«
»Nein, Sie kommen genau richtig. Wie hat Ihnen der Flug gefallen?«
»Der Anblick der rasch unter uns dahinziehenden Landschaft hat mich in Erstaunen versetzt. Wir waren kaum aufgestiegen, da waren wir auch schon hier, und die junge Dame mit dem Hütchen sagte mir, dass wir über eintausend Meilen geflogen sind.«
»Hütchen? Ach so, die Stewardess.«
»Verzeihen Sie meine Unwissenheit.«
»Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?« Ich deutete auf das Bier, aber sie schüttelte den Kopf.
»Lieber nicht. Warum machen Sie mich nicht mit Ihren Problemen vertraut, Mr. Rosen, und wir schauen, was sich machen lässt.« Die Lincoln sah mich an, wartete.
Ich setzte mich ihr gegenüber. Doch ich zögerte. Nach dem, was ich heute gelesen hatte, fragte ich mich, ob ich sie überhaupt noch zurate ziehen wollte. Nicht, weil ich kein Vertrauen in ihre Ansichten gehabt hätte, sondern weil mein Problem womöglich an das Leid rührte, das sie tief in ihrem Inneren vergraben hatte. Meine Situation ähnelte zu sehr der mit Ann Rutledge.
»Ich bin ganz Ohr.«
»Lassen Sie mich erst ein Bier eingießen.« Ich spielte eine Weile mit der Dose herum und fragte mich, was ich machen sollte.
»Dann sollte vielleicht ich reden. Während meiner Reise hierher habe ich Überlegungen über die Situation mit Mr. Barrows angestellt.« Die Lincoln beugte sich vor, öffnete ihre Reisetasche und zog mehrere mit Bleistift beschriebene Blätter hervor. »Hegen Sie den Wunsch, große Geschütze gegen Mr. Barrows aufzufahren? Damit er Miss Frauenzimmer von sich aus zurückschickt, ganz gleich, wie sie darüber denkt?«
Ich nickte.
»Dann telefonieren Sie mit dieser Person.« Er reichte mir einen Zettel mit einem Namen:
SILVIA DEVORAC
Ich hatte den Namen schon einmal gehört, konnte ihn aber nicht zuordnen.
»Sagen Sie ihr, dass Sie sie gern aufsuchen würden, um eine Angelegenheit von heikler Natur zu besprechen, die mit Mr. Barrows zusammenhängt. Das wird genügen – sie wird Sie sofort einladen.«
»Und dann?«
»Ich werde Sie begleiten. Sie werden Ihre Darstellungen ihr gegenüber nicht ausschmücken müssen. Sie müssen nur Ihre Verbindung zu Miss Frauenzimmer beschreiben – dass Sie ihren Vater vertreten und dass Sie sich sehr zu der jungen Frau hingezogen fühlen.«
»Wer ist diese Silvia Devorac?«
»Die Gegenspielerin von Mr. Barrows. Sie ist es, die versucht, das Green-Peach-Hat-Wohnprojekt, das ihm gehört und aus dem er enorme Mieteinnahmen erzielt, für abbruchreif erklären zu lassen. Sie ist eine sozial engagierte Dame und widmet sich lobenswerten Aktivitäten.« Das Simulacrum reichte mir eine Handvoll Zeitungsausschnitte aus Seattier Blättern. »Wie Sie dem hier entnehmen können, ist sie unermüdlich. Und sie verfügt über einigen Scharfsinn.«
»Sie meinen, dass wir die Geschichte mit Pris’ Minderjährigkeit und ihrer psychischen Verfassung…«
»Ich meine, Mr. Rosen, dass Mrs. Devorac wissen wird, was sich mit den Informationen anfangen lässt, die Sie ihr geben.«
Ich dachte kurz nach. »Aber: Ist es das wert? So etwas zu tun…«
»Das weiß nur Gott.«
»Was ist Ihre Meinung?«
»Pris ist die Frau, die Sie lieben. Ist das nicht der eigentliche Kern der Sache? Würden Sie in diesem Wettstreit etwa nicht Ihr Leben aufs Spiel setzen? Ich denke, Sie haben es bereits getan und, wenn Mr. Rock recht hat, die Leben anderer noch dazu.«
»Die Liebe ist eine amerikanische Obsession. Wir nehmen sie zu ernst. Sie ist praktisch eine Staatsreligion.«
Die Lincoln erwiderte nichts. Sie schaukelte nur vor und zurück.
»Gut. Es ist mir ernst damit.«
»Dann sollten Sie über Folgendes nachdenken: Ist es nicht die Wahrheit, dass Mr. Barrows das genaue Gegenteil von Ihnen darstellt? Ihm ist es mit seinem Gefühl für Pris nicht ernst. Wenn er dieselben Gefühle wie Sie hegen würde, würde er Mrs. Devorac ihren Willen lassen und Pris heiraten. Aber er tut das nicht. Sie dagegen würden alles riskieren – Sie tun es bereits. Für Sie ist der Mensch, den Sie lieben, wichtiger als alles andere.«
»Danke. Wissen Sie, Sie haben ein tiefes Verständnis dafür, was die wichtigen Werte im Leben sind. Ich meine, ich bin schon vielen Leuten begegnet, aber Sie kommen gleich zum Kern der Sache.«
Das Simulacrum beugte sich vor und klopfte mir auf die Schulter. »Ich denke, dass es zwischen uns beiden eine Verbindung gibt, Mr. Rosen. Sie und ich, wir haben viel gemeinsam.«
»Ich weiß.«
Wir waren beide tief bewegt.
Fünfzehn
Die Lincoln ging mit mir durch, was ich am Telefon zu Mrs. Devorac sagen sollte. Ich prägte es mir ein, suchte die Nummer aus dem Telefonbuch heraus und wählte.
Kurz darauf hatte ich die wohlklingende Stimme einer Frau mittleren Alters im Ohr: »Ja?«
»Bitte verzeihen Sie die Störung, Mrs. Devorac. Ich interessiere mich für Green Peach Hat beziehungsweise Ihr Vorhaben, die Siedlung abreißen zu lassen. Mein Name ist Louis Rosen. Ich komme aus Ontario, Oregon.«
»Ich hatte keine Vorstellung, dass unser Komitee so weit weg Beachtung findet.«
»Ich wollte fragen, ob ich einmal kurz mit meinem Anwalt bei Ihnen vorbeischauen und mit Ihnen reden kann.«
»Mit Ihrem Anwalt? Stimmt denn irgendetwas nicht?«
»Es stimmt tatsächlich etwas nicht, aber das betrifft nicht Ihr Komitee. Es betrifft…« Ich sah zur Lincoln, die aufmunternd nickte. »Es betrifft Sam K. Barrows.«
»Ich verstehe.«
»Ich kenne Mr. Barrows aufgrund einer unglückseligen geschäftlichen Verbindung, die ich mit ihm in Ontario hatte. Und ich dachte, Sie könnten mir vielleicht behilflich sein.«
»Sie haben einen Anwalt, wie Sie sagen. Ich weiß nicht, was ich für Sie tun könnte, das er nicht ebenfalls kann. Aber Sie können gerne vorbeikommen, wenn wir es auf, sagen wir, eine halbe Stunde beschränken können. Ich erwarte um acht Gäste.«
Ich dankte ihr und legte auf.
»Das ist Ihnen durchaus gelungen, Mr. Rosen«, sagte die Lincoln und erhob sich. »Wir sollten uns sofort auf den Weg machen.« Sie ging zur Tür.
»Warten Sie.«
Sie sah mich an.
»Ich kann das nicht.«
»Na gut. Dann lassen Sie uns stattdessen einen Spaziergang machen.« Die Lincoln öffnete die Tür. »Genießen wir die Nachtluft, sie duftet nach den Bergen.«
Wir spazierten den dunklen Bürgersteig entlang.
»Was, meinen Sie, wird aus Pris werden?«, fragte die Lincoln nach einer Weile.
»Es wird ihr gut gehen. Barrows wird ihr alles geben, was sie sich vom Leben erwartet.«
Die Lincoln blieb vor einer Telefonzelle stehen. »Sie werden Mrs. Devorac noch einmal anrufen müssen, damit sie Bescheid weiß.«
Ich ging in die Zelle und wählte Mrs. Devoracs Nummer. Ich fühlte mich noch schlechter als vorher; ich bekam kaum die Finger in die richtigen Löcher der Wählscheibe.
»Ja?«
»Louis Rosen noch einmal. Es tut mir leid, aber ich fürchte, ich habe meine Fakten noch nicht ausreichend geordnet, Mrs. Devorac.«
»Und Sie möchten das Treffen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben?«
»Ja.«
»Das ist absolut kein Problem. Wann immer es Ihnen passt. Aber bevor Sie auflegen, Mr. Rosen – sind Sie je in Green Peach Hat gewesen?«
»Nein.«
»Es ist sehr schlimm dort.«
»Das überrascht mich nicht.«
»Bitte sehen Sie es sich bei Gelegenheit einmal an.«
»Ja, mach ich.«
Sie legte auf. Ich stand da, mit dem Hörer in der Hand. Schließlich verließ ich die Telefonzelle wieder.
Die Lincoln war nirgends zu sehen. Ist sie abgehauen?, fragte ich mich. Bin ich jetzt allein auf mich gestellt? Ich spähte in die Dunkelheit.
Sie saß in einer Tankstelle einige Meter entfernt dem Tankwart gegenüber, wippte mit dem Stuhl hin und her und plauderte. Ich öffnete die Tür. »Gehen wir!«
Die Lincoln sagte dem Tankwart gute Nacht, und wir spazierten weiter. Nach einer Weile sah sie mich an. »Warum nicht Pris einen Besuch abstatten?«
»Bloß nicht«, erwiderte ich entsetzt. »Vielleicht geht heute Nacht noch eine Maschine nach Boise. Wenn ja, sollten wir sie nehmen.«
»Sie macht Ihnen Angst. Aber ich glaube, wir würden sie und Mr. Barrows ohnehin nicht zu Hause antreffen. Sie sind bestimmt ausgegangen und amüsieren sich. Der Bursche in der Auftankstelle hat mir erzählt, dass regelmäßig berühmte Unterhaltungskünstler, manche sogar aus Europa, in Seattle auftreten. Ich glaube, er sagte, dass Earl Grant gerade hier gastiert. Wird er geschätzt?«
»Sehr.«
»Der Junge sagte auch, dass die Künstler in der Regel nur an einem Abend auftreten. Und da Mr. Grant heute Abend hier ist, werden sich Mr. Barrows und Pris vielleicht seine Vorstellung ansehen.«
»Er ist Sänger, ein sehr guter.«
»Haben wir genug Geld dafür?«
»Ja.«
»Nun, warum gehen wir dann nicht hin?«
»Ich will nicht.«
»Ich bin eine weite Strecke gereist, um Ihnen behilflich zu sein, Mr. Rosen. Ich finde, im Gegenzug könnten Sie mir einen Gefallen tun. Ich würde es genießen, Mr. Grant zu hören, wie er die aktuellen Lieder vorträgt. Wären Sie so entgegenkommend, mich zu begleiten?«
»Sie wollen mich nur in Schwierigkeiten bringen.«
»Ich möchte, dass Sie den Ort aufsuchen, wo Sie höchstwahrscheinlich Mr. Barrows und Pris begegnen werden. Was ist so schlimm daran?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Na schön.« Mit einem flauen Gefühl im Magen hielt ich nach einem Taxi Ausschau.
Etliche Leute waren gekommen, um den berühmten Earl Grant zu hören; wir konnten uns gerade noch hineinzwängen. Von Pris und Barrows war allerdings nichts zu sehen. Wir setzten uns an die Bar, bestellten Getränke und sahen von dort aus zu. Sie kommen vermutlich gar nicht, sagte ich mir. Es ging mir ein wenig besser.
»Er singt wunderschön«, sagte die Lincoln zwischen zwei Stücken.
»Ja.«
»Der Neger hat die Musik im Blut.«
Ich warf ihr einen Blick zu. War sie sarkastisch? Offenbar nicht, ihr Gesicht war ernst. Vielleicht hatte die Bemerkung einfach zu ihrer Zeit eine andere Bedeutung gehabt als heute.
»Ich erinnere mich noch an meine Reise nach New Orleans als Junge. Dort erlebte ich zum ersten Mal den Neger und seine bemitleidenswerte Lage. Das war, glaube ich, 1826. Der spanische Charakter der Stadt verblüffte mich. Sie war ganz anders als das Amerika, in dem ich aufgewachsen war.«
»Das war, als Denton Offcutt Sie engagiert hatte, nicht wahr?«
»Sie sind mit meinen Anfangsjahren offenbar sehr vertraut.«
»Ich hab’s nachgeschlagen. 1835 starb dann Ann Rutledge, und 1841…« Ich brach ab. Warum hatte ich das nur erwähnt? Ich hätte mir am liebsten selbst in den Hintern getreten. Sogar im schummrigen Licht der Bar war die tiefe Erschütterung auf dem Gesicht der Lincoln zu erkennen. »Entschuldigen Sie bitte«, murmelte ich.
Gott sei Dank hatte Grant inzwischen mit einem weiteren Stück begonnen. Ein leiser, trauriger Blues. Ich winkte dem Barmann und bestellte mir einen doppelten Scotch.
Die Lincoln saß vornübergebeugt da und brütete vor sich hin. Sie hatte die Füße auf die Querstäbe des Barhockers gestellt. Als das Lied zu Ende war, rührte sie sich nicht. Offenbar nahm sie ihre Umgebung gar nicht mehr richtig wahr. Ihr Gesicht war leer.
Ich machte mir richtig Sorgen. »Tut mir leid, wenn ich Sie deprimiert habe.«
»Es ist nicht Ihre Schuld. Diese Stimmungen überkommen mich zuweilen. Ich bin, falls Sie das noch nicht wussten, extrem abergläubisch. Ist das ein Fehler? Auf jeden Fall kann ich es nicht abstellen, es ist ein Teil meines Wesens.« Die Worte kamen stockend, als ob sie kaum die Kraft aufbrachte, zu sprechen.
»Trinken Sie noch was«, sagte ich und bemerkte dann, dass sie noch nicht einmal ihren ersten Drink angerührt hatte.
Die Lincoln schüttelte stumm den Kopf.
»Dann lassen Sie uns von hier verschwinden und die Rakete zurück nach Boise nehmen.« Ich sprang von meinem Hocker. »Kommen Sie.«
Das Simulacrum blieb, wo es war.
»Jetzt lassen Sie sich doch nicht so runterziehen. Ach, es hätte mir klar sein müssen – Bluesgesang hat immer diese Wirkung.«
»Nein, am Gesang des Farbigen liegt es nicht. Es liegt an mir. Geben Sie nicht ihm die Schuld, und auch nicht sich selbst. Auf dem Flug hierher sah ich auf die Wälder hinunter und dachte an meine frühen Jahre und an den Tod meiner Mutter und unsere Reise nach Illinois mit dem Ochsenkarren.«
»Herrgott, lassen Sie uns ein Taxi zum Flughafen nehmen und…« Ich brach ab.
Pris und Barrows hatten den Raum betreten; eine Kellnerin geleitete sie zu ihrem reservierten Tisch.
Als die Lincoln die beiden erblickte, lächelte sie. »Ich hätte auf Sie hören sollen, Mr. Rosen. Nun ist es zu spät, fürchte ich.«
Ich stand bewegungslos neben dem Barhocker.
Sechzehn
»Mr. Rosen, Sie müssen wieder auf Ihren Hocker steigen«, sagte die Lincoln leise in mein Ohr.
Ich nickte und setzte mich unbeholfen wieder. Pris… sah hinreißend aus. Sie trug ihre Haare jetzt viel kürzer und nach hinten gebürstet, und ein eigenartiger Lidschatten ließ ihre Augen riesengroß und schwarz erscheinen. Barrows dagegen war mit seinem rasierten Kopf und seiner jovialen Art ganz wie immer; geschäftsmäßig grinsend nahm er die Speisekarte entgegen.
»Sie ist wunderschön«, sagte das Simulacrum.
»Ja.« Um uns herum an der Bar hatten fast alle Männer – und auch einige Frauen – innegehalten und sie kurz inspiziert; ich konnte es ihnen nicht verdenken.
»Wir müssen etwas tun, Mr. Rosen. Ich werde zu ihrem Tisch hinübergehen und ihnen sagen, dass Sie für den späten Abend eine Verabredung mit Mrs. Devorac haben. Mehr kann ich nicht tun, der Rest lastet auf Ihren Schultern.« Noch bevor ich sie aufhalten konnte, bewegte sich die Lincoln schon von der Bar weg.
Sie kam bei Barrows’ Tisch an, beugte sich vor, legte ihm eine Hand auf die Schulter, sprach ihn an. Prompt wandte sich Barrows zu mir um. Pris sah ebenfalls herüber; ihre dunklen, kalten Augen glitzerten.
Schließlich kehrte die Lincoln an die Bar zurück. »Gehen Sie zu ihnen, Mr. Rosen.«
Blitzartig stand ich auf und schlängelte mich zwischen den Tischen hindurch zu Barrows und Pris. Sie starrten mich an. Sie glaubten wohl, dass ich meine .38er dabeihatte, aber das stimmte nicht – sie lag im Motel. »Sie sind erledigt, Barrows«, sagte ich. »Ich habe sämtliche Informationen für Silvia beisammen.« Ich sah auf meine Armbanduhr. »Zu schade für Sie, aber jetzt ist es zu spät. Sie haben Ihre Chance gehabt und alles vermasselt.«
»Setzen Sie sich, Rosen.«
Ich nahm an ihrem Tisch Platz. Die Bedienung brachte Martinis.
Barrows grinste mich an. »Wir haben unser erstes Simulacrum gebaut.«
»Ah ja? Wen denn?«
»George Washington.«
»Ein Jammer, mitansehen zu müssen, wie Ihr Imperium zu Staub zerfällt.«
»Ich verstehe zwar nicht, was Sie damit meinen, aber ich freue mich, dass wir uns hier über den Weg laufen. Eine gute Gelegenheit, einige Missverständnisse aus der Welt zu schaffen.« Er wandte sich Pris zu. »Tut mir leid, Geschäftliches besprechen zu müssen, Liebling, aber es ist ein glücklicher Zufall, Louis hier anzutreffen. Du hast doch nichts dagegen?«
»Doch, habe ich. Wenn er nicht geht, ist es aus mit uns.«
»Aber Liebes, wenn es dich so aufregt, kann ich dir ja ein Taxi rufen.«
Sie sah ihn mit eisiger Miene an. »Ich lasse mich nicht wegschicken. Wenn du versuchst, mich loszuwerden, wirst du dich so schnell auf einer Müllhalde wiederfinden, dass dir der Kopf schwirrt.«
Wir sahen sie beide an. Unter der schönen Fassade war es immer noch die alte Pris.
»Ich denke, ich werde dich nach Hause schicken.«
»Nein.«
Barrows winkte der Bedienung. »Rufen Sie bitte ein Taxi für die…«
»Du hast mich vor Zeugen gevögelt«, rief Pris.
Barrows erbleichte und schickte die Bedienung wieder weg. »Jetzt hör aber auf.« Seine Hände zitterten. »Kannst du dich nicht einen Abend mal benehmen?«
»Ich sage, was ich will und wann ich will.«
»Na schön, was für Zeugen?« Barrows brachte ein Lächeln zustande. »Dave Blunk? Colleen Nild? Nur weiter, Liebling.«
»Du bist ein obszöner alter Mann, der den Frauen unter die Röcke sieht. Du gehörst hinter Gitter.« Ihre Stimme war nicht laut, aber so deutlich, dass an den Tischen in der Nähe mehrere Leute herübersahen. »Du hast ihn mir einmal zu oft reingesteckt. Und eins kann ich dir sagen: es ist ein Wunder, dass du ihn überhaupt hochgekriegt hast. Dieses kleine, wabbelige Ding.«
Barrows’ Lächeln wurde zu einem schiefen Grinsen. »Sonst noch was?«
»Ja. Du hast die Leute alle gekauft, damit sie nicht gegen dich aussagen.«
»Bist du jetzt fertig?«
Sie sah ihn schweigend an.
Barrows wandte sich nun mir zu. »So, jetzt können wir.« Es war erstaunlich – er wirkte nach wie vor gelassen.
Ich räusperte mich. »Soll ich mich an Mrs. Devorac wenden oder nicht?«
Barrows warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Haben Sie etwas dagegen, wenn wir Dave Blunk kommen lassen?«
»Nein.« Ich war überzeugt, dass Blunk ihm dazu raten würde, einzulenken.
Barrows entschuldigte sich und ging telefonieren. Während er weg war, saßen Pris und ich einander gegenüber, ohne dass jemand etwas sagte. Schließlich kam er wieder zurück. Pris funkelte ihn argwöhnisch an. »Was für eine Schweinerei hast du jetzt vor, Sam?«
Barrows erwiderte nichts, sondern lehnte sich nur bequem zurück.
»Louis, er hat irgendwas in die Wege geleitet.« Pris blickte sich hektisch um. »Merkst du es nicht?«
»Mach dir keine Sorgen, Pris«, sagte ich. Aber besonders wohl fühlte ich mich auch nicht. Ich sah, dass die Lincoln unruhig an der Bar saß und ein finsteres Gesicht machte. Hatte ich etwa einen Fehler gemacht? Nun, jetzt war es zu spät – ich hatte zugestimmt.
»Könnten Sie bitte kommen?«, rief ich. Die Lincoln stand sofort auf und kam zu uns. »Mr. Barrows wartet noch auf seinen Anwalt.«
Die Maschine setzte sich und dachte nach. »Ich glaube, das schadet nicht.«
Wir warteten. Nach etwa einer halben Stunde erschien Dave Blunk und schlängelte sich zu uns durch. Hinter ihm kamen Colleen Nild in Abendgarderobe und ein junger Mann mit Bürstenschnitt und Fliege, der einen ziemlich aufgeweckten Eindruck machte.
Wer ist das?, fragte ich mich. Meine Beklommenheit nahm zu.
»Tut mir leid, dass wir so spät sind«, dröhnte Blunk, während er Mrs. Nild mit dem Stuhl behilflich war. Er und der junge Mann mit der Fliege setzten sich. Niemand stellte irgendjemanden vor.
Das muss irgendein Angestellter von Barrows sein, dachte ich. Etwa der Hiwi, der die Formalie einer rechtskräftigen Ehe mit Pris übernehmen würde?
Als Barrows bemerkte, dass ich den Mann anstarrte, sagte er: »Das hier ist Johnny Booth. Johnny – Louis Rosen.«
Der junge Mann nickte flüchtig. »Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Mr. Rosen.« Dann nickte er den anderen zu. »Hallo.«
»Moment mal.« Ein kalter Schauer lief mir den Rücken hinunter. »John Booth? John Wilkes Booth?«
Barrows grinste. »Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen.«
»Aber er sieht gar nicht wie John Wilkes Booth aus.« Ich hatte ja gerade erst in den Nachschlagewerken geblättert: John Wilkes Booth war Theaterschauspieler gewesen, und seine Ausstrahlung soll spektakulär gewesen sein. Das hier dagegen war bloß einer dieser Laufburschen, wie man sie in allen Großstädten der Vereinigten Staaten über die Büroflure flitzen sieht. »Das ist also Ihr erster Versuch? Dann gebe ich Ihnen einen Tipp – fangen Sie besser noch mal ganz von vorn an.« Doch während ich das sagte, starrte ich das Ding entsetzt an, denn so beknackt es auch aussah, im technischen Sinne war es ein Erfolg.
Das Simulacrum von Lincolns Attentäter! Ich konnte nicht vermeiden, einen Seitenblick auf die Lincoln zu werfen, um ihre Reaktion zu sehen. Konnte sie etwas mit dem Namen anfangen?
Sie rührte sich nicht. Aber die Falten in ihrem Gesicht, die Schatten der Schwermut, waren tiefer geworden. Sie schien zu wissen, was ihr bevorstand, was dieses neue Simulacrum bedeutete.
Ich konnte nicht fassen, dass Pris dieses Ding designt hatte. Doch dann wurde mir klar, dass sie es gar nicht designt hatte – darum hatte es ja so ein Allerweltsgesicht. Das war allein Bundys Werk. Er hatte für Barrows die Elektronik entwickelt, und der hatte sie dann in diesen Jedermann-Behälter stopfen lassen, der hier am Tisch saß und lächelte und nickte. Sie hatten nicht einmal versucht, das authentische Aussehen von Booth nachzubilden, das hatte sie gar nicht interessiert. Das Ganze diente nur einem einzigen Zweck.
»So, wir können unser Gespräch jetzt fortsetzen«, sagte Barrows.
Blunk nickte, die Booth-Maschine ebenfalls. Mrs. Nild studierte die Karte, während Pris das Simulacrum wie versteinert anstarrte. Also hatte ich recht – es war eine Überraschung für sie. Während sie zu rauschenden Partys eingeladen, schick eingekleidet und verschönert worden war, hatte Bob Bundy in irgendeiner Werkstatt von Barrows Enterprises gestanden und an diesem Ding hier herumgelötet.
»Na schön«, erwiderte ich. »Machen wir weiter.«
Barrows sah sein Simulacrum an. »Johnny, der Große mit dem Bart dort ist übrigens Abe Lincoln. Ich habe dir von ihm erzählt, weißt du noch?«
»Aber ja, Mr. Barrows.« Das Booth-Ding nickte aufgeregt. »Ich weiß es noch genau.«
Ich hob empört die Hände. »Barrows, das ist eine Fälschung, die Sie uns hier servieren. Irgendeine Mordsmaschine namens ›Booth‹, die weder richtig aussieht noch richtig redet. Das Ding ist einfach nur billig hingepfuscht. Ich schäme mich für Sie.«
Barrows zuckte mit den Schultern.
Ich wandte mich dem Booth-Ding zu. »Zitieren Sie irgendwas von Shakespeare.«
Es grinste dümmlich.
»Dann irgendwas auf Latein.«
Es hörte gar nicht mehr auf zu grinsen.
»Wie lange hat es gedauert, ihn zusammenzuschrauben?«, fragte ich Barrows. »Einen halben Vormittag? Wo ist die Liebe zum Detail geblieben? Was ist aus der Handwerkskunst geworden? Der reine Pfusch – bis auf den eingebauten Killerinstinkt, stimmt’s?«
»Ich glaube, Mr. Rosen, Sie möchten Ihre Drohung, sich an Mrs. Devorac zu wenden, angesichts von Johnny Booth hier wieder zurückziehen.«
»Wie wird es vorgehen? Mit einem Giftring? Mit bakteriologischen Waffen?«
Blunk und Colleen Nild grinsten, und das Booth-Ding tat es ihnen gleich. Ganz wie ihr Boss es von ihnen verlangte. Sie waren alle Barrows’ Marionetten.
Pris starrte das Booth-Simulacrum unentwegt an. Sie reckte den Hals wie ein Huhn, ihre Augen waren voller Lichtsplitter. Plötzlich hob sie die Hand und zeigte auf die Lincoln. »Die habe ich gebaut.«
Barrows wandte sich Pris zu.
»Sie gehört mir. Wussten Sie das, Mr. President? Dass mein Vater und ich Sie gebaut haben?«
»Pris«, sagte ich, »um Himmels willen…«
»Sei still!«
»Nein, Pris, das hier geht nur Barrows und mich etwas an.« Meine Stimme zitterte. »Du meinst es bestimmt gut, und mir ist jetzt auch klar, dass du nichts mit dem Bau dieses Booth-Dings zu tun hast. Aber du…«
»Herrgott, nun halt schon den Mund.« Pris funkelte Barrows an. »Du hast Bob Bundy dieses Ding bauen lassen, um die Lincoln zu zerstören, und du hast dafür gesorgt, dass ich nichts mitbekomme. Du miese Ratte! Das werde ich dir nie verzeihen.«
Barrows runzelte die Stirn. »Was regst du dich denn so auf, Pris? Du willst mir doch nicht sagen, dass du eine Affäre mit dem Lincoln-Simulacrum hast.«
»Ich werde mir meine Arbeit nicht kaputt machen lassen.«
»Vielleicht doch.«
Die Lincoln wandte sich Pris zu. »Ich glaube, dass Mr. Rosen recht hat. Sie sollten ihm und Mr. Barrows gestatten, eine Lösung für ihre Streitigkeiten zu finden.«
»Ich habe schon eine.« Pris beugte sich nach unten, verschwand beinahe unter dem Tisch. Was hatte sie vor? Wir saßen wie erstarrt da. Schließlich kam sie wieder hoch, einen ihrer hochhackigen Schuhe in der Hand, den metallbeschlagenen Absatz nach vorn gerichtet. »Zum Teufel mit dir«, sagte sie zu Barrows.
Barrows hob die Hände. »Nicht.«
Der Schuh krachte gegen den Kopf des Booth-Simulacrums, gleich hinter dem Ohr. Pris’ Augen glänzten feucht, ihr Mund war ein schmaler, verzerrter Strich.
»Glob«, machte das Booth-Simulacrum. Seine Hände fuhren ruckartig in der Luft herum; seine Füße trampelten auf dem Boden. Dann zog es sich krampfhaft zusammen und erstarrte.
»Schlag es nicht noch mal, Pris.« Ich hatte das Gefühl, kein weiteres Mal ertragen zu können.
»Warum sollte ich?« Pris bückte sich und zog den Schuh wieder an. Die Leute an den Tischen um uns herum starrten verdutzt herüber.
Barrows wischte sich mit einem Taschentuch die Stirn ab. Er setzte zum Sprechen an, überlegte es sich dann anders, blieb still.
Langsam begann das Booth-Simulacrum von seinem Stuhl zu rutschen. Ich stand auf und versuchte es zu stützen. Blunk erhob sich ebenfalls, und gemeinsam konnten wir es so platzieren, dass es nicht mehr umfiel. Dann wandte sich Blunk den Leuten um uns herum zu. »Keine Panik, das ist nur eine Puppe, eine mechanische Puppe zu Demonstrationszwecken.« Er deutete auf das nun sichtbare Metall und Plastik im Inneren des Schädels. In dem Loch, das Pris geschlagen hatte, konnte ich etwas schimmern sehen, die beschädigte Zentralmonade vermutlich. Ich fragte mich, ob Bob Bundy sie wieder reparieren konnte. Aber interessierte mich das überhaupt?
Barrows drückte seine Zigarette aus, trank sein Glas leer und sagte mit heiserer Stimme zu Pris: »Damit hast du dir einen Feind gemacht, kleine Lady.«
»Leb wohl, Sam K. Barrows, du dreckige Schwuchtel.« Pris stand auf und warf dabei absichtlich ihren Stuhl um. Dann ging sie zwischen den Tischen hindurch zum Eingang, wo sie sich von der Garderobiere ihren Mantel geben ließ und verschwand.
Wir sahen ihr schweigend nach.
Nach einer Weile deutete Barrows seufzend auf das Booth-Ding. »Was mache ich jetzt damit? Wir müssen es hier irgendwie rausschaffen.« Er sah mich mit müdem Blick an. »Wir werden sie nie wiedersehen. Aber wer weiß, vielleicht steht sie auch draußen auf dem Gehsteig und wartet. Können Sie es sagen? Ich nicht – ich blicke bei ihr nicht durch.«
Ich sprang auf, lief zum Eingang und stürzte auf die Straße. Der uniformierte Türsteher nickte mir höflich zu.
Von Pris war nichts zu sehen.
»Wo ist die junge Frau hin, die gerade rausgekommen ist?«
Der Türsteher hob die Schultern. »Keine Ahnung, Sir.« Er deutete auf die zahllosen Leute, die wie Bienen um den Eingang des Lokals herumschwärmten. »Tut mir leid.«
Ich blickte den Bürgersteig hinauf und hinunter, rannte sogar ein Stück in jede Richtung, um sie noch irgendwo ausfindig zu machen. Aber nichts.
Schließlich ging ich wieder in das Lokal zurück. »Sie haben alles verloren«, sagte ich zu Barrows.
»Ich habe überhaupt nichts verloren.«
Blunk sah mich an. »Sam hat recht. Was hat er denn schon verloren? Bob Bundy kann jederzeit ein neues Simulacrum bauen.«
»Sie haben Pris verloren. Also alles.«
Barrows grinste. »Ach, wer kennt sich schon mit Pris aus? Wahrscheinlich nicht einmal sie selbst.«
»Mag sein.« Meine Zunge fühlte sich geschwollen an. Ich wackelte mit dem Kiefer, spürte keinen Schmerz, spürte überhaupt nichts. »Jedenfalls habe ich sie nicht mehr gefunden.«
»Offensichtlich. Aber denken Sie mal darüber nach – könnten Sie jeden Tag so eine Szene ertragen?«
»Nein.«
In diesem Moment betrat Earl Grant wieder die Bühne. Das Piano spielte, und er begann zu singen:
I’ve got grasshoppers in my pillow, baby.
I’ve got crickets all in my meal.
Sang er zu mir? Hatte er meinen Gesichtsausdruck gesehen, wusste er, wie mir zumute war? Es war ein altes, trauriges Lied.
Pris ist keine von uns, ging es mir durch den Kopf. Pristine – das war wirklich der passende Name: die Unberührte, Makellose. Was Menschen bewegt, was sich zwischen Menschen abspielt, kann sie nicht berühren. Wenn man sie ansieht, sieht man uns, wie wir begonnen haben, vor ein oder zwei Millionen Jahren… Der Song, den Earl Grant sang, war eine der Möglichkeiten, uns zu zähmen, zu mäßigen, langsam zu formen. Ja, der Schöpfer war noch immer bei der Arbeit, er formte noch immer. Doch nicht Pris – bei ihr gab es kein Formen, kein Gestalten mehr.
Als ich Pris angesehen habe, habe ich das Andere gesehen, dachte ich. Was bleibt mir jetzt noch? Nur das Warten auf den Tod. So wie bei dem Booth-Simulacrum. Am Ende hat es doch noch die gerechte Strafe für seine Tat von vor über einem Jahrhundert erhalten. Lincoln hatte vor seinem Tod im Traum einen schwarz verhüllten Sarg und eine Trauerprozession gesehen. Was hatte das Simulacrum wohl letzte Nacht geträumt?
Dieser Traum würde uns alle heimsuchen. Der schwarze Krepp, drapiert auf dem durch Kornfelder fahrenden Zug. Menschen, die ihn kommen sehen und die Hüte abnehmen. Der Sarg, bewacht von Soldaten in Blau, die Gewehre tragen und sich die ganze Zeit über nicht vom Fleck rühren, vom Beginn bis Ende der langen Fahrt…
»Mr. Rosen?«
Erschrocken blickte ich auf. Colleen Nild stand neben mir.
»Könnten Sie uns behilflich sein? Mr. Barrows geht gerade das Auto holen. Wir wollen das Booth-Simulacrum hier wegschaffen.«
»Oh.« Ich nickte. »Sicher.«
Ich sah zu der Lincoln, die mit gesenktem Kopf dasaß. Hörte sie Earl Grant zu? War sie von seinem Lied überwältigt? Sie rührte sich nicht, atmete offenbar nicht einmal. Es ist eine Art von Gebet, dachte ich. Und gleichzeitig ganz und gar kein Gebet. Das Stocken eines Gebets vielleicht, sein Ende…
Blunk und ich ergriffen das Booth-Ding und stellten es auf die Füße. Es war ziemlich schwer.
»Er fährt einen Mercedes«, keuchte Blunk, während wir Richtung Tür gingen. »Weiß mit roten Ledersitzen.«
Als wir schließlich auf der Straße standen, sah uns der Türsteher neugierig an, aber weder er noch irgendjemand anders machte Anstalten, sich einzumischen oder zu helfen oder herauszufinden, was los war.
»Da kommt er«, sagte Blunk.
Barrows hielt den Wagen an, und Blunk und ich schafften es, irgendwie das Simulacrum auf die Rückbank zu verfrachten.
»Sie kommen besser mit«, sagte Colleen Nild zu mir, als ich vom Wagen zurücktrat.
»Ja, gute Idee«, dröhnte Blunk. »Wir bringen die Booth in die Werkstatt und fahren dann rüber zu Colleens Wohnung und trinken was zusammen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Na los«, meldete sich Barrows hinter dem Steuer. »Rein mit euch. Damit sind auch Sie und Ihr Simulacrum gemeint, Rosen. Gehen Sie es holen.«
»Nein. Nein danke. Fahrt mal.«
»Na schön. Wie Sie wollen.«
Blunk und Colleen Nild stiegen ein, und das Auto verschwand im dichten Abendverkehr.
Mit den Händen in den Taschen ging ich in das Lokal zurück, und bahnte mir einen Weg zu unserem Tisch, an dem immer noch die Lincoln saß, den Kopf gesenkt, die Arme um sich geschlungen, völlig reglos.
Was konnte ich ihr sagen? Wie konnte ich sie aufmuntern?
»Wissen Sie, Sie sollten sich von so etwas wirklich nicht runterziehen lassen.«
Die Lincoln erwiderte nichts.
»Der Quatsch wird immer quetscher, bis er quietscht.«
Sie hob den Kopf, starrte mich an. »Und was soll das heißen?«
»Keine Ahnung, absolut keine Ahnung… Hören Sie, ich bringe Sie zurück nach Boise und besorge Ihnen einen Termin bei Doktor Horstowski. Vielleicht kann er ja etwas gegen diese Depressionen tun.«
Die Lincoln zog ein großes rotes Taschentuch hervor und schnäuzte sich die Nase. »Danke für Ihre Besorgnis.«
»Einen Drink? Oder eine Tasse Kaffee oder einen Happen zu essen?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Wann sind diese Depressionen zum ersten Mal aufgetreten? Wollen Sie vielleicht darüber reden? Erzählen Sie mir einfach, was Ihnen einfällt. Bitte. Danach geht es Ihnen bestimmt besser.«
Die Lincoln räusperte sich. »Kehren Mr. Barrows und sein Hofstaat noch einmal zurück?«
»Das glaube ich nicht. Sie fahren rüber zu Mrs. Nilds Wohnung.«
Die Lincoln hob eine Augenbraue. »Warum fahren sie dorthin und nicht zu Mr. Barrows?«
»Dort gibt es was zu trinken. Hat jedenfalls Dave Blunk gesagt.«
Die Lincoln räusperte sich und machte ein überaus merkwürdiges Gesicht – als sei sie verwirrt und hätte zugleich etwas begriffen.
»Was ist los?«
»Fahren Sie zu Mrs. Nilds Wohnung, Mr. Rosen. Verschwenden Sie keine Zeit.«
»Warum?«
»Weil sie dort ist.«
Mir kribbelte die Kopfhaut.
»Ja, sie hat dort bei Mrs. Nild gewohnt. Ich werde ins Motel zurückkehren. Machen Sie sich um mich keine Sorgen – falls nötig, bin ich durchaus in der Lage, morgen allein nach Boise zurückzufliegen. Nun machen Sie schon, bevor die Truppe dort ankommt.«
Ich stand auf. »Ich weiß nicht…«
»Die Adresse finden Sie im Telefonbuch.«
»Ja, danke für den Hinweis. Wissen Sie, ich habe den Eindruck, Sie haben da gerade eine gute Idee gehabt. Dann machen Sie es mal gut. Wir sehen uns. Und falls…«
»Nun gehen Sie schon.«
Ich ging.
In einem Drugstore konsultierte ich das Telefonbuch, fand Colleen Nilds Anschrift, ging wieder hinaus auf die Straße und winkte nach einem Taxi.
Sie wohnte in einem großen Backsteinhaus. Nur wenige Fenster waren um diese Zeit noch erleuchtet. Ich drückte die Klingel unten an der Tür. Aus dem kleinen Lautsprecher kam Rauschen, dann fragte die gedämpfte Stimme einer Frau, wer ich war.
»Louis Rosen.« War das etwa Pris? »Kann ich raufkommen?«
Die Tür summte, ich machte einen Satz und drückte sie auf. Dann durchquerte ich die menschenleere Eingangshalle und ging die Treppe zum zweiten Stock hinauf. Keuchend stand ich schließlich vor ihrer Wohnung.
Die Tür war offen. Ich klopfte, wartete, dann ging ich hinein.
Im Wohnzimmer saß Colleen Nild mit einem Drink in der Hand auf einer Couch, ihr gegenüber Sam Barrows. Beide sahen sie mich mit großen Augen an.
»Hi, Rosen.« Barrows deutete mit dem Kopf zu einem Couchtisch, auf dem eine Flasche Wodka, Limonensaft, Eiswürfel und Gläser standen. »Bedienen Sie sich.« Dann, während ich mir einen Drink machte, sagte er: »Ich habe Neuigkeiten für Sie. Jemand, der Ihnen sehr am Herzen liegt, ist hier. Schauen Sie mal ins Schlafzimmer.« Er und Colleen Nild lächelten.
Ich stellte das Glas ab und ging zögerlich zur Schlafzimmertür.
Barrows schwenkte seinen Drink. »Wie kommt es, dass Sie Ihre Meinung geändert haben und doch noch gekommen sind?«
»Die Lincoln dachte, Pris ist hier.«
»Also, ich sage das ja wirklich nicht gern, aber man muss wirklich bekloppt sein, um sich von der Kleinen so einwickeln zu lassen.«
»Das sehe ich anders.«
»Aber nur, weil ihr krank seid, ihr alle, Pris und die Lincoln und Sie. Johnny Booth war tausend Lincolns wert. Wir werden ihn wieder zusammenflicken und für die Monderschließung verwenden. Booth ist schließlich ein alter, vertrauter amerikanischer Name, es spricht nichts dagegen, dass die Familie nebenan Booth heißt. Sie müssen wirklich eines Tages mal nach Luna kommen, Mr. Rosen, und sich ansehen, was wir dort aufgebaut haben.«
»Ein erfolgreicher Geschäftsmann hat es nicht nötig, zu solchen Tricksereien zu greifen.«
»Tricksereien? Ich gebe den Leuten lediglich eine kleine Starthilfe, damit sie endlich das tun, was sie sowieso längst vorhatten… Aber ich will mich nicht streiten. Es war ein ziemlich harter Tag. Ich bin müde und hege niemandem gegenüber irgendwelche Feindseligkeiten.« Er grinste mich an. »Wenn Ihre kleine Firma sich mit uns zusammengetan hätte – Sie müssen geahnt haben, was das bedeutet hätte. Schließlich sind Sie auf mich zugekommen, nicht ich auf Sie. Aber das ist jetzt alles vorbei. Für Sie jedenfalls. Für mich nicht – wir ziehen das durch, auf die eine oder andere Art.«
»Daran besteht kein Zweifel, Sam«, flötete Colleen Nild.
»Danke, Colleen. Ich kann es einfach nicht ertragen, diesen Burschen hier so zu sehen, ohne Ziele, ohne Vision, ohne Ehrgeiz. Es zerreißt einem das Herz, ehrlich.«
Ich erwiderte nichts. Ich stand vor der Schlafzimmertür und hoffte, sie würden aufhören, über mich zu reden.
Colleen Nild lächelte mir zu. »Gehen Sie schon rein.«
Ich öffnete die Tür.
Das Schlafzimmer lag im Dunkeln. In der Mitte waren die Umrisse eines Bettes zu erkennen. Und auf dem Bett lag eine Gestalt. Sie hatte ein Kissen im Rücken und rauchte eine Zigarette. Aber war es wirklich eine Zigarette? Der Raum roch nach Zigarrenrauch. Ich betätigte den Lichtschalter.
Auf dem Bett lag mein Vater. Eine Zigarre in der Hand, sah er mich nachdenklich an. Er trug Bademantel und Pyjama, und neben das Bett hatte er seine Pelzpantoffeln gestellt.
»Mach die Tür zu, mein Sohn«, sagte er leise.
In meiner Verblüffung gehorchte ich. Ich schloss die Tür jedoch nicht schnell genug, um mir das Gelächter aus dem Wohnzimmer zu ersparen, das laute Feixen von Sam Barrows und Colleen Nild. Was hatten sie sich doch für einen Scherz mit mir geleistet, mit ihrem ganzen Gerede – wissend, dass Pris gar nicht hier war, dass die Lincoln sich geirrt hatte.
Mein Vater hatte ihr Lachen ebenfalls gehört. »Ja, vielleicht hätte ich rauskommen und dieser Farce ein Ende machen sollen, Louis, aber ich wollte wissen, was Mr. Barrows sagt. Er ist in mancher Beziehung ein großer Mann. Setz dich.«
Ich nahm auf einem Stuhl neben dem Bett Platz. »Du weißt auch nicht, wo sie ist? Du kannst mir auch nicht helfen?«
»Ich fürchte nicht, Louis.«
Die Tür knallte auf, und ein Mann, dessen Gesicht verkehrt herum war, kam herein – mein Bruder Chester, geschäftig wie eh und je. »Ich habe ein gutes Zimmer für uns gefunden, Dad«, sagte er. Dann sah er mich und lächelte glücklich. »Hier steckst du also, Louis. Haben wir dich endlich aufgetrieben.«
Mein Vater legte mir die Hand auf den Arm. »Ich war mehrere Male versucht, Mr. Barrows zu korrigieren. Aber einem Mann wie ihm kann man nichts Neues mehr beibringen, also wozu die Zeitverschwendung?«
Ich merkte, wie ich langsam wegdriftete. Die Worte meines Vaters verschwammen. Ich stellte mir vor, wie es gewesen wäre, wenn ich Pris hier in diesem Zimmer gefunden hätte, hier auf dem Bett liegend, schlafend, betrunken vielleicht. Ich hätte sie aufgestützt und in meinen Armen gehalten, hätte ihr die Haare aus den Augen gestrichen und sie hinters Ohr geküsst. Ich sah sie vor mir, wie sie langsam wieder ins Leben zurückkehrte.
»Du hörst mir gar nicht zu«, sagte mein Vater tadelnd. Das stimmte: Ich war ganz woanders, nicht mehr in dieser trostlosen, enttäuschenden Wirklichkeit, sondern in meiner Pris-Phantasie, in meinem Traum von einem glücklicheren Leben.
In diesem Traum küsste ich Pris noch einmal, und sie öffnete die Augen. Ich ließ sie wieder zurücksinken, legte mich neben sie, umarmte sie.
»Wie geht es der Lincoln?« Pris’ Stimme, ein Flüstern an meinem Ohr. Sie war überhaupt nicht erstaunt, mich zu sehen; tatsächlich zeigte sie gar keine Reaktion. Aber so war sie eben.
»Ganz gut.« Ich strich ihr über die Haare, während sie dalag und in der Dunkelheit zu mir sah. »Nein, tatsächlich geht es ihr sehr schlecht. Sie hat eine Depression. Aber was kümmert dich das? Du hast sie ja so gebaut.«
»Ich habe sie gerettet«, erwiderte Pris kühl. »Gib mir eine Zigarette, ja?«
Ich steckte ihr eine Zigarette an und reichte sie ihr.
Schwach konnte ich die Stimme meines Vaters hören. »Ignoriere dieses Zerrbild, mein Sohn. Es entfernt dich aus der Realität. Das ist, was Doktor Horstowski krankhaft nennt, erkennst du das nicht?«
Dann Chesters Stimme: »Es ist Schizophrenie, Dad. Millionen Amerikaner leiden daran, ohne es zu wissen. Sie gehen nie in die Klinik deswegen. Ich habe einen Artikel darüber gelesen.«
»Du bist ein guter Mensch, Louis«, sagte Pris. »Ich empfinde Mitleid für dich, weil du mich liebst. Du verschwendest deine Zeit, aber das ist dir egal. Kannst du mir sagen, was Liebe ist? Eine Liebe wie diese?«
»Nein.«
»Kannst du es nicht versuchen?« Sie stützte sich auf. »Ist die Tür abgeschlossen? Wenn nicht, dann geh sie abschließen.«
»Aber… ich kann sie nicht aussperren. Wir werden sie nie loswerden, wir werden nie allein sein.« Trotzdem stand ich auf, machte die Tür zu und schloss ab.
Als ich mich wieder zum Bett umdrehte, öffnete Pris gerade den Reißverschluss ihres Rocks. Sie zog sich den Rock über den Kopf und schleuderte ihn von sich. Dann trat sie ihre Schuhe weg. »Wer sonst kann es mir beibringen, Louis, wenn nicht du?« Sie begann, ihre Unterwäsche auszuziehen.
»Nein, Pris!«
»Warum nicht?«
»Ich halte das nicht aus. Ich muss nach Boise und Doktor Horstowski aufsuchen. Das kann doch jetzt nicht so weitergehen, nicht hier mit meiner Familie im selben Zimmer.«
»Morgen fliegen wir nach Boise zurück. Aber nicht jetzt.« Sie schlug die Decke zurück, schlüpfte hinein und nahm sich wieder ihre Zigarette. »Ich bin so müde, Louis. Bleib heute Nacht bei mir.«
»Das geht nicht.«
»Dann nimm mich dorthin mit, wo du übernachtest.«
»Das geht auch nicht. Die Lincoln ist dort.«
»Ach, ich möchte einfach nur schlafen. Leg dich zu mir. Sie werden uns schon nicht stören. Hab keine Angst vor ihnen. Es tut mir leid, dass die Lincoln einen ihrer depressiven Schübe hat. Aber gib nicht mir dafür die Schuld – so ist sie eben. Und ich habe ihr das Leben gerettet. Sie ist mein Kind, nicht wahr?«
»So könnte man es ausdrücken, ja.«
»Ich habe sie zur Welt gebracht, und ich bin darauf sehr stolz. Als ich dieses Booth-Ding gesehen habe, da wollte ich nur eines – es auf der Stelle töten. Ach, ich wünschte, ich hätte dich genauso zur Welt gebracht wie die Lincoln, ich wünschte, ich hätte alle möglichen Leute zur Welt gebracht – alle. Ich schenke Leben, aber heute Nacht habe ich Leben genommen. Es braucht einige Stärke, jemandem das Leben zu nehmen, meinst du nicht auch, Louis?«
»Ja.« Ich setzte mich neben sie auf das Bett.
Sie streckte die Hand aus und strich mir die Haare aus dem Gesicht. »Ich habe diese Macht über dich. Ich kann dir Leben schenken und es dir wieder nehmen. Ängstigt dich das?«
»Nicht mehr. Es hat mich einmal geängstigt, als es mir zum ersten Mal klar geworden ist.«
»Mich hat es nie geängstigt. Sonst hätte ich diese Macht verloren. Und ich muss sie behalten – irgendjemand muss sie doch haben.«
Ich antwortete nicht. Zigarrenrauch zog an mir vorbei, verursachte mir Übelkeit, machte mir meinen Vater und meinen Bruder bewusst, die beide aufmerksam zusahen.
»Der Mensch braucht immer ein paar Illusionen«, sagte mein Vater paffend, »aber das hier ist lachhaft.« Chester nickte.
»Pris«, flüsterte ich.
»Schau dir das an«, rief mein Vater aufgebracht. »Er redet mit ihr.«
»Raus mit euch!« Ich wedelte heftig mit den Armen, doch es nützte nichts, sie rührten sich nicht von der Stelle.
»Du sollst wissen, Louis«, sagte mein Vater, »dass ich Verständnis für dich habe. Ich sehe, was Mr. Barrows nicht sieht – das Edle an deiner Suche.«
In der Dunkelheit konnte ich Pris wieder ausmachen. Sie hatte ihre Sachen aufgeklaubt und saß nun auf der Bettkante, die Kleider an ihren Bauch gepresst. »Spielt es eine Rolle, was irgendwer über uns sagt oder denkt?«, fragte sie. »Ich würde mir darüber nicht den Kopf zerbrechen, ich würde Wörtern nicht so viel Wirklichkeit zubilligen. Da draußen sind sie alle wütend auf uns, Sam und Maury und der ganze Rest. Aber die Lincoln hätte dich nie hierher geschickt, wenn es nicht das Richtige wäre, meinst du nicht auch?«
»Pris, ich weiß, dass alles gut wird. Vor uns liegt eine glückliche Zukunft.«
Sie lächelte. Es war ein Lächeln voller Traurigkeit, und für einen Moment kam es mir vor, als stammte das, was ich am Lincoln-Simulacrum wahrgenommen hatte, von Pris. Der Schmerz, den sie empfand – sie hatte ihn in ihr Werk einfließen lassen, ohne es zu wollen, vielleicht sogar ohne auch nur von ihm zu wissen.
»Ich liebe dich, Pris.«
Sie richtete sich auf – nackt, dünn, zitternd –, legte die Hände an die Seiten meines Kopfes und zog mich hinunter.
»Er schläft«, sagte mein Vater zu Chester. »Mein Sohn schläft. Und er liebt – wenn du mir folgen kannst.«
»Was werden sie in Boise dazu sagen?«, fragte mein Bruder verärgert. »Ich meine, wie können wir denn mit ihm wieder nach Hause, wenn er so ist?«
»Ach halt den Mund, Chester. Du verstehst seine Psyche nicht, das, was er sucht. Es ist wie eine Art Rückkehr zum Ursprung, zu der Quelle, von der wir uns abgewandt haben.«
»Hörst du sie?«, fragte ich Pris.
An mich gepresst lag sie da und sah mich mit ausdruckslosem Gesicht an. Und doch war sie absolut aufmerksam. Für sie hatte in diesem Moment alles ein Ende – Veränderung und Wirklichkeit, die Ereignisse ihres Lebens, die Zeit an sich… Sie hob die Hand und berührte mich an der Wange, strich mit ihren Fingerspitzen darüber.
Von der Tür her vernahm ich Colleen Nilds Stimme. »Wir werden jetzt gehen, Mr. Rosen, und die Wohnung Ihnen überlassen.«
Weder Pris noch ich erwiderten etwas. Kurz darauf hörten wir, wie die Wohnungstür ins Schloss fiel.
»Das ist aber nett von ihnen«, sagte mein Vater. »Louis, du hättest dich wenigstens bedanken können. Dieser Mr. Barrows ist wirklich ein Gentleman.«
»Ja, du solltest dankbar sein«, knurrte Chester.
Die beiden starrten uns vorwurfsvoll an.
Ich drückte Pris an mich. Das war alles, was ich wollte.
Siebzehn
Als mein Vater und Chester mich am nächsten Tag nach Boise zurückbrachten, stellte sich heraus, dass Doktor Horstowski mich nicht behandeln konnte oder wollte. Er machte jedoch verschiedene psychologische Tests mit mir, um eine Diagnose zu stellen. Bei einem musste ich einer Aufnahme von Stimmen zuhören, die so leise flüsterten, dass nur ab und zu ein paar Satzbrocken zu verstehen waren. Die Aufgabe bestand darin, aus dem, was man verstand, zu schließen, um was es insgesamt ging.
Ich glaube, Horstowski hat seine Diagnose aufgrund der Ergebnisse dieses Tests gestellt, denn ich war mir sicher, dass sich die Stimmen über mich ausließen, über meine Fehler, meine Schwächen. Sie analysierten mich, bewerteten mein Verhalten, ja ich hörte sie über Pris und unsere Beziehung herziehen.
Horstowski seufzte. »Jedes Mal, wenn Sie das Wort ›ist‹ gehört haben, dachten Sie, man hätte ›Pris‹ gesagt. Und was Sie für ›er‹ gehalten haben, waren meist nur Wörter wie ›sehr‹ oder ›schwer‹.« Er sah mich betrübt an – und dann wollte er nichts mehr mit mir zu tun haben.
Aber noch war ich für die Psychiater nicht verloren, denn Doktor Horstowski übergab mich dem Bundesbeauftragten des Federal Bureau of Mental Health in Zone 5, dem pazifischen Nordwesten. Ich hatte schon von ihm gehört. Sein Name war Doktor Ragland Nisea, und ihm oblag es, die abschließende Entscheidung über sämtliche seine Zone betreffende Einweisungsverfahren zu fällen. Seit 1980 hatte er Tausende von psychisch Kranken in die überall im Land verteilten Kliniken des FBMH eingewiesen. Er wurde allgemein als brillanter Psychiater angesehen, und wir hatten seit Jahren gescherzt, dass wir alle Nisea früher oder später in die Hände fallen würden – ein Witz, der sich für einen gewissen Prozentsatz von uns als zutreffend erwies.
»Sie werden sehen, Doktor Nisea ist äußerst einfühlsam«, sagte Horstowski, während er mich zur Geschäftsstelle des FBMH in Boise fuhr.
»Nett von Ihnen, dass Sie mich hinbringen.«
»Ich muss da sowieso fast jeden Tag hin. Wissen Sie, ich erspare Ihnen damit das Erscheinen vor Gericht. Bei Doktor Nisea sind Sie besser dran als vor einer Jury.«
Ich nickte.
»Sie hegen doch keine feindseligen Gefühle deswegen, oder? Es ist keine Schande, in eine Klinik des FBMH eingewiesen zu werden. Das geschieht fast jede Minute – einer von neun Menschen leidet an einer psychischen Erkrankung, die es ihm unmöglich macht…« Er redete weiter; ich hörte nicht hin. Ich kannte das alles schon, aus der Fernsehwerbung, aus unzähligen Zeitungsartikeln.
Aber tatsächlich hatte ich feindselige Gefühle ihm gegenüber – weil er mich loswerden wollte, weil er mich dem FBMH übergab –, obwohl ich wusste, dass er gesetzlich dazu verpflichtet war, wenn er zu dem Schluss kam, ich wäre psychotisch. Und ich hatte feindselige Gefühle allen anderen gegenüber, die beiden Simulacra eingeschlossen. Während wir durch die sonnigen, vertrauten Straßen von Boise fuhren, war mir, als ob sie alle Verräter und Feinde wären, als wäre ich von einer fremden, hasserfüllten Welt umgeben.
Das alles hatte sich natürlich in den Tests gezeigt, die Horstowski mit mir durchgeführt hatte. Beim Rorschachtest etwa hatte ich jeden Klecks, jedes Bild als voller scheppernder, scharfkantiger Maschinen interpretiert, die am Anbeginn der Zeit geschaffen worden waren, um mir Verletzungen zuzufügen. Und jetzt, auf der Fahrt zum FBMH, sah ich reihenweise Autos, die uns folgten. Uns folgten, weil ich wieder in der Stadt war – die Fahrer der Autos waren in dem Moment informiert worden, als ich auf dem Flughafen von Boise gelandet war.
»Kann Doktor Nisea mir helfen?«, fragte ich, als wir vor einem großen, modernen Bürogebäude hielten. Auf einmal spürte ich eine leichte Panik. »Ich meine, das FBMH verfügt über diese ganzen neuen Methoden, die nicht einmal Sie haben, die gerade erst…«
»Das hängt davon ab, was Sie mit ›helfen‹ meinen.« Horstowski öffnete die Tür und bedeutete mir, mitzukommen.
Und so war ich schließlich dort, wo vor mir so viele andere gelandet waren: im Federal Bureau of Mental Health, diagnostische Abteilung. Der erste Schritt in einen neuen Abschnitt meines Lebens – vielleicht.
Wie recht Pris doch gehabt hatte! Dass ich einen zutiefst instabilen Zug an mir hätte, der mich eines Tages in Schwierigkeiten bringen würde. Unter Wahnvorstellungen leidend, erschöpft und hoffnungslos war ich schließlich von den Behörden einkassiert worden, wie sie selbst vor einigen Jahren. Ich hatte Horstowskis Diagnose zwar nicht gesehen, aber ich war mir sicher, dass er schizophrene Reaktionen festgestellt hatte – ich spürte sie ja selbst. Wozu also das Offensichtliche leugnen?
Aber es gab noch Hilfe für mich. Noch befand ich mich im Frühstadium, war die Krankheit nicht voll ausgebrochen, hatten sich noch keine dauerhaften Verhaltensstörungen wie Hebephrenie oder Paranoia eingestellt. Noch war ich therapierbar. Ich konnte meinem Vater und Bruder also dankbar sein, dass sie genau zur rechten Zeit gehandelt hatten.
Und obwohl mir das alles klar war, begleitete ich Horstowski in einem zutiefst verängstigten Zustand in die Büroräume des FBMH. Ich war einsichtig und war es gleichzeitig nicht; ein Teil von mir wusste Bescheid, verstand, der Rest war in Aufruhr wie ein gefangenes Tier, das zurück in seine vertraute Umgebung wollte, zurück an die Orte, die es kennt. In diesem Augenblick konnte ich nur für einen kleinen Teil von mir sprechen – der Rest machte, was er wollte.
Das alles verdeutlichte mir die Notwendigkeit des McHeston Act. Ein psychotisches Individuum, wie ich es war, konnte nicht von sich aus Hilfe suchen; es musste per Gesetz dazu gezwungen werden.
Du bist auch mal so gewesen, Pris, dachte ich. Sie haben dich aufgestöbert und von den anderen getrennt, haben dich weggeholt, wie sie mich weggeholt haben. Und sie haben es geschafft, dich wiederherzustellen, dich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Wird ihnen das auch mit mir gelingen? Und werde ich wie du sein, wenn die Therapie vorbei ist? In welchen früheren Zustand meines Ich werden sie mich zurückversetzen? Was werde ich dann für dich empfinden? Werde ich mich noch an dich erinnern? Und wenn ja, wirst du mir immer noch so viel bedeuten?
Doktor Horstowski lieferte mich im Warteraum ab, und eine Stunde lang saß ich inmitten der anderen verwirrten, kranken Menschen, bis endlich eine Schwester kam und mich ins Büro von Doktor Nisea brachte. Er erwies sich als gutaussehender Mann, nur wenig älter als ich, mit sanften braunen Augen, dichtem Haar und einer vorsichtigen Art, die ich bisher nur bei Tierärzten bemerkt hatte. Er fragte mich, ob ich wusste, warum ich bei ihm war.
»Ich bin hier, weil ich keine Basis mehr habe, von der aus ich anderen Menschen meine Bedürfnisse und Gefühle mitteilen kann.« Während des Wartens hatte ich mir das alles genau überlegt. »So besteht für mich keine Möglichkeit mehr, meine Bedürfnisse in der Realität zu befriedigen. Stattdessen muss ich mich in meine Phantasie flüchten.«
Nisea lehnte sich in seinem Stuhl zurück und sah mich nachdenklich an. »Und das möchten Sie ändern.«
»Ich möchte Befriedigung finden, echte Befriedigung.«
»Haben Sie denn überhaupt nichts mit den anderen Menschen gemein?«
»Gar nichts. Meine Wirklichkeit liegt gänzlich außerhalb der Welt, die die anderen erfahren. Sie zum Beispiel -Sie würden es für ein Hirngespinst halten, wenn ich Ihnen davon erzählen würde. Von ihr, meine ich.«
»Von ihr?«
»Pris.«
Er wartete, aber ich sagte nichts weiter.
»Doktor Horstowski hat mir am Telefon von Ihnen erzählt. Offensichtlich haben wir es hier mit einer Problemdynamik zu tun, die wir den Magna-Mater-Typus der Schizophrenie nennen. Gesetzlich bin ich allerdings verpflichtet, zuerst den James-Benjamin-Sprichworttest an Ihnen durchzuführen und dann den sowjetischen Vygotsky-Luria-Klotztest.« Nisea nickte, und eine Assistentin mit Notizblock und Bleistift kam nach vorne zum Tisch. »Ich werde Ihnen jetzt verschiedene Sprichwörter nennen, und Sie sagen mir, was sie bedeuten. Sind Sie bereit?«
»Ja.«
»›Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.‹«
Ich überlegte. »Ohne Aufsicht kommt es zu Übeltaten.«
Wir fuhren fort, und ich machte so weit alles richtig, bis wir zu einem Sprichwort kamen, das sich für mich als fatal erwies.
»›Ein Stein, der rollt, setzt kein Moos an.‹«
So sehr ich mir auch den Kopf zerbrach, ich kam nicht auf die Bedeutung. Schließlich sagte ich ins Blaue hinein: »Na ja, es bedeutet, dass jemand, der ständig aktiv ist und niemals innehält und nachdenkt…« Nein, das klang falsch. »Es bedeutet, dass jemand, der ständig aktiv ist und immer mehr an geistiger und moralischer Statur gewinnt, nicht erstarren wird.« Auch nicht. »Ein Mensch, der tätig ist und in Bewegung bleibt, wird im Leben weiterkommen.«
Nisea nickte. »Ah ja.« Mir wurde klar, dass ich gerade, im Rahmen der rechtsgültigen Diagnostik, eine schizophrene Denkstörung hatte erkennen lassen.
»Habe ich es falsch gesagt?«
»Ich fürchte, ja. Die allgemein anerkannte Bedeutung des Sprichworts ist das genaue Gegenteil dessen, was Sie gesagt haben. Es wird so verstanden, dass ein unbeständiger…«
»Nein, sagen Sie es mir nicht. Ich weiß es wieder. Ein unbeständiger Mensch wird es zu nichts bringen.«
Nisea schmunzelte leicht und ging zum nächsten Sprichwort über. Doch die gesetzliche Bedingung war erfüllt – ich wies nun offiziell eine psychische Beeinträchtigung auf.
Nach den Sprichwörtern probierten wir es mit dem Sortieren bunter Klötze, jedoch ohne großen Erfolg. Nisea war ebenso erleichtert wie ich, als ich aufgab und die Klötze wegschob.
»Gut, das wär’s.« Er schickte die Assistentin hinaus. »Wir können uns jetzt den Formalitäten widmen. Ziehen Sie eine bestimmte Klinik vor? Meiner Meinung nach ist die in Los Angeles die beste, aber das liegt vielleicht auch nur daran, dass ich sie am besten kenne. Die Kasanin-Klinik in Kansas City…«
»Ja, schicken Sie mich dorthin.«
»Aus irgendeinem bestimmten Grund?«
»Freunde von mir waren dort.«
Er sah mich skeptisch an.
»Und einen guten Ruf hat sie auch. Fast alle, die ich kenne, denen mit ihrer Erkrankung wirklich geholfen wurde, sind in der Kasanin gewesen. Andere Kliniken sind natürlich auch gut, aber das ist die beste. Meine Tante Gretchen etwa – sie war der erste psychisch kranke Mensch, den ich kennengelernt habe. Und von denen gibt es eine ganze Menge. Mein Cousin Leo Roggis, er ist immer noch irgendwo in einer der Kliniken. Mein Englischlehrer auf der Highschool, Mr. Haskins, er ist in einer Klinik gestorben. Dann war da noch ein alter Italiener, der in meiner Straße wohnte, George Oliveri. Er hatte katatone Zustände. Ein Kumpel beim Militär, Art Bowles – er hatte Schizophrenie und kam in die Fromm-Reichmann-Klinik in Rochester, New York. Dann Alys Johnson, mit der ich auf dem College zusammen war. Sie ist in der Samuel-Anderson-Klinik in Zone 3 – das ist in Baton Rouge, Laramie. Und ein Mann, für den ich einmal gearbeitet habe, Ed Yeats. Er erkrankte an Schizophrenie, die in akute Paranoia überging. Waldo Dangerfield, noch ein Kumpel von mir. Gloria Milstein, eine Bekannte – sie wurde durch einen Psychotest aufgespürt, als sie sich um eine Stelle als Schreibkraft bewarb. Die Leute vom FBMH haben sie gleich mitgenommen. Sie war sehr attraktiv, ohne den Test wäre da niemand draufgekommen. Und John Franklin Mann, ein Gebrauchtwagenhändler, den ich kannte – ein Test erwies ihn als Schizophrenen, und ab ging’s, in die Kasanin, glaube ich, weil er Verwandte in Missouri hat. Und Marge Morrison, noch eine Bekannte von mir. Sie ist wieder draußen, und ich bin mir sicher, dass sie in der Kasanin war. Von den ganzen Leuten waren alle, die in die Kasanin geschickt wurden, anschließend so gut wie neu. In der Kasanin werden nicht nur die Vorschriften des McHeston Act erfüllt – dort wird richtig geheilt. So kommt es mir jedenfalls vor.«
Nisea schrieb ›Kasanin-Klinik K.C.‹ in das Formular. »Ja, Kansas City soll gut sein. Der Präsident hat zwei Monate dort verbracht, wussten Sie das?«
»Davon habe ich gehört.« Jeder kannte die Geschichte vom heldenhaften Kampf des Präsidenten mit seiner psychischen Erkrankung in der Pubertät.
»Nun gut, bevor wir uns voneinander verabschieden, möchte ich Ihnen noch etwas über den Magna-Mater-Typus erzählen.«
»Gerne.«
»Tatsächlich handelt es sich um ein besonderes Interessengebiet von mir. Ich habe mehrere Monografien darüber geschrieben. Sie kennen die Anderson-Theorie, die jede Unterform der Schizophrenie mit einer Unterform der Religion gleichsetzt?«
Ich nickte. Diese Theorie war von praktisch jedem Hochglanzmagazin der USA thematisiert worden; es war die aktuelle Mode.
»Die Hauptform der Schizophrenie ist demnach die heliozentrische. Darunter leiden Sie nicht. Die heliozentrische Form ist die simpelste und entspricht der frühesten bekannten Religion, der Sonnenanbetung, darunter der Mithraismus, der heliozentrische Kult der Römerzeit, und die Verehrung von Mazda, der frühe persische Sonnenkult. Die Sonne steht für den Vater der Patienten.«
Ich nickte.
»Die Magna Mater nun, die Form, die Sie haben, bezieht sich auf den Kult der Großen Göttin im mediterranischen Raum zur Zeit der mykenischen Kultur. Ischtar, Kybele, Attis, später dann Athene, schließlich die Jungfrau Maria. Ihnen ist Folgendes widerfahren: Ihre Anima, die Verkörperung Ihres Unbewussten, wurde nach außen projiziert und wird nun dort von Ihnen wahrgenommen und verehrt.«
»Verstehe.«
»Und sie wird als gefährliches, feindseliges, doch zugleich anziehendes Wesen wahrgenommen. Die Verkörperung aller Gegensätze: Sie hat alles Leben in sich und ist doch tot, alle Liebe und ist doch kalt, alle Kreativität und neigt doch zu destruktivem analytischem Denken. Wenn diese Gegensätze unmittelbar erfahren werden, wie es gerade bei Ihnen geschieht, ist es unmöglich, mit ihnen fertig zu werden. Sie verwirren Ihr Ego und vernichten es schließlich, denn wie Sie wissen, sind sie in ihrer ursprünglichen Form Archetypen und können nicht durch das Ego integriert werden.«
»Aha.«
»Es ist der große Kampf des Bewusstseins, zu einem Verständnis seiner eigenen kollektiven Aspekte zu gelangen, seines Unbewussten, und dieser Kampf ist zum Scheitern verurteilt. Die Archetypen des Unbewussten müssen mittelbar erfahren werden, durch die Anima, und in einer gutartigen Form, die frei von bipolaren Eigenschaften ist. Dafür müssen Sie eine völlig andere Beziehung zu Ihrem Unbewussten aufbauen. So, wie die Sache gerade aussieht, sind Sie passiv, das Unbewusste besitzt sämtliche Entscheidungsgewalt.«
»Richtig.«
»Ihr Bewusstsein ist verkümmert und daher nicht länger handlungsfähig. Es besitzt keine andere Autorität als diejenige, die es aus dem Unbewussten bezieht, und im Augenblick ist es vom Unbewussten abgeschnitten. Also lässt sich über die Anima keine Harmonie herstellen. Sie haben eine relativ harmlose Form der Schizophrenie, Mr. Rosen. Aber es ist immer noch eine Psychose und erfordert die Behandlung in einer staatlichen Klinik. Ich würde Sie gern wiedersehen, wenn Sie aus Kansas City zurückkommen – es wird Ihnen dann viel besser gehen.« Nisea lächelte mich aufmunternd an, und ich erwiderte sein Lächeln.
In einer formalen Anhörung vor Zeugen überreichte er mir dann den Einweisungsbescheid und fragte, ob es irgendwelche Gründe gäbe, warum ich nicht sofort nach Kansas City überstellt werden sollte. Mir fielen keine ein. Er gab mir acht Stunden zur Regelung meiner persönlichen Angelegenheiten und ließ seine Assistentin einen Flug reservieren. Dann verabschiedeten wir uns voneinander.
Ich fuhr mit einem Taxi zu Maurys Haus, wo ich einen Großteil meiner Habseligkeiten zurückgelassen hatte. Dort angekommen, klopfte ich an der Tür.
Es war offenbar niemand zu Hause. Ich drehte den Türknauf – es war nicht abgeschlossen. Also betrat ich das stille, verlassene Haus.
Im Badezimmer war das Wandmosaik, an dem Pris damals gearbeitet hatte. Jetzt war es fertig. Ich betrachtete es für eine Weile, die Meerjungfrau und den Fisch, den Kraken mit den hellen Knopfaugen. Ein Stück Fliese hatte sich gelockert. Ich riss es ganz ab, rieb den krümeligen Klebstoff von der Rückseite und steckte es in die Tasche.
Nur für den Fall, dass ich dich vergessen sollte, dachte ich. Dich und dein Badezimmermosaik, deine Meerjungfrau mit den pinken Brüsten, deine schönen, monströsen Geschöpfe, die unter der Wasseroberfläche tanzen, im friedlichen, ewigen Wasser… Sie hatte die Linie über Kopfhöhe gezogen, beinahe zwei Meter fünfzig hoch. Darüber Himmel, allerdings nur ein wenig – der Himmel spielte in ihrer Schöpfung keine Rolle.
Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Jemand war ins Haus gekommen. Ich wartete, und nach einiger Zeit kam Maury Rock an der Badezimmertür vorbeigerauscht. Als er mich sah, blieb er ruckartig stehen. »Louis Rosen… In meinem Badezimmer.«
»Ich bin gleich wieder weg.«
»Eine Nachbarin hat mich im Büro angerufen. Sie hat gesehen, wie du hineingegangen bist.«
»Immer wird mir hinterherspioniert. Überall. Egal, wo ich bin.« Ich blieb stehen, wo ich war, die Hände in den Taschen.
»Sie fand einfach, dass ich Bescheid wissen sollte. Ich dachte mir schon, dass du es bist.« Er sah meinen Koffer und die Sachen, die ich zusammengesucht hatte. »Du bist doch kaum erst aus Seattle zurück – und jetzt willst du schon wieder los?«
»Ich muss, Maury. Das verlangt das Gesetz.«
Er blickte mich an und wurde dabei ganz rot im Gesicht. »Tut mir leid, Louis. Ich wollte nicht…«
»Ich bin heute beim Benjamin-Test und bei diesem Klotz-Ding durchgefallen. Es ist bereits alles arrangiert.«
Er rieb sich das Kinn. »Wer hat dich verpfiffen?«
»Mein Vater und Chester.«
»Deine eigene Familie?«
»Sie haben mich vor der Paranoia bewahrt. Aber sag mal, Maury – weißt du, wo sie steckt?«
»Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen, ganz ehrlich. Trotz allem.«
»Rat mal, wo ich zur Behandlung hinkomme.«
»Kansas City?«
Ich nickte.
»Vielleicht findest du sie dort. Vielleicht hat das FBMH sie sich wieder geschnappt und vergessen, mir Bescheid zu sagen.«
»Ja, könnte sein.«
Er klopfte mir auf den Rücken. »Viel Glück, mein Freund. Ich weiß, dass du da wieder rauskommst. Du hast bestimmt Schizophrenie – was anderes gibt’s ja gar nicht mehr.«
Ich holte die Scherbe aus der Tasche und zeigte sie ihm. »Ein Andenken an sie. Ich hoffe, du hast nichts dagegen.«
»Nein. Behalte sie nur. Oder nimm gleich einen ganzen Fisch. Oder eine Brust.«
»Die Scherbe genügt.«
Eine Weile standen wir verlegen da und sahen uns an. »Und wie ist es so, schizophren zu sein?«, fragte er schließlich.
»Schlimm, Maury. Ganz, ganz schlimm.«
»Hab ich mir gedacht. Hat Pris auch immer gesagt. Sie war froh, es hinter sich zu haben.«
»Dass ich nach Seattle gefahren bin, damit ging es los. Das nennt man katatone Erregtheit, das Gefühl, dass man unbedingt etwas unternehmen muss. Es stellt sich dann aber immer als das Falsche heraus, man erreicht nichts damit. Man merkt es und gerät in Panik, und dann kriegt man sie, die richtige Psychose. Ich hab Stimmen gehört und… Dinge gesehen.«
»Was denn für Dinge?«
»Pris.«
»Auutsch.«
»Bringst du mich zum Flughafen?«
»Natürlich.« Er nickte energisch.
»Ich muss erst am späten Abend dort sein. Also könnten wir vielleicht vorher noch etwas zusammen essen. Weißt du, ich möchte es vermeiden, meiner Familie zu begegnen nach dem, was passiert ist. Ich schäme mich irgendwie.«
»Wie kommt es, dass du so vernünftige Sachen sagst, wo du doch schizophren bist?«
»Ich stehe gerade nicht unter Druck, also kann ich meine Aufmerksamkeit bündeln. Das passiert nämlich bei einem schizophrenen Schub – die Aufmerksamkeit wird geschwächt, sodass sich unbewusste Prozesse breitmachen und die Macht übernehmen. Sie kapern sozusagen das Bewusstsein, sehr archaische Prozesse, archetypische, wie sie ein Nicht-Schizophrener zuletzt gehabt hat, als er fünf gewesen ist.«
»Du denkst also verrücktes Zeug, wie dass alle gegen dich sind und du der Mittelpunkt des Universums bist?«
»Nein. Wie Doktor Nisea mir erklärt hat, sind es die heliozentrischen Schizophrenen, die…«
»Nisea? Ragland Nisea? Natürlich, es ist ja gesetzlich vorgeschrieben, dass du ihn aufsuchen musst. Er hat auch Pris damals eingewiesen. Er hat den Vygotsky-Luria-Klotztest mit ihr gemacht, persönlich. Ich wollte ihn immer mal kennenlernen.«
»Brillanter Mann. Und sehr human.«
»Bist du denn gefährlich?«
»Nur, wenn man mich reizt.«
»Sollte ich dann besser gehen?«
»Ja. Aber ich sehe dich heute Abend, hier, zum Essen. Gegen sechs. Dann bleibt noch genug Zeit, den Flug zu kriegen.«
»Kann ich irgendetwas für dich tun? Dir irgendetwas besorgen?«
»Nein. Aber danke.«
»Okay.« Maury drehte sich um und ging. Kurz darauf hörte ich die Vordertür zufallen. Es war wieder still im Haus. Ich war wieder allein.
Später aßen Maury und ich zusammen, dann fuhr er mich in seinem weißen Jaguar zum Flughafen. Ich sah zu, wie die Straßen an mir vorbeizogen, und jede Frau, die ich sah, erinnerte mich – wenigstens für einen Moment – an Pris; jedes Mal dachte ich, dass sie es war, aber sie war es nicht.
Der Flug, den man für mich gebucht hatte, war erster Klasse und auf dieser neuen australischen Rakete, der C-80. Das FBMH, dachte ich, hat offenbar jede Menge öffentlicher Gelder zum Verbraten. Nach einer halben Stunde Flug landeten wir bereits wieder. Ich stieg aus der Rakete und hielt nach meinem Empfangskomitee Ausschau.
Ein junger Mann und eine junge Frau kamen auf mich zu. Beide trugen sie Mäntel mit bunten, strahlenden Schottenmustern. Das waren sie – in Boise hatte man mir gesagt, dass ich auf solche Mäntel achten sollte.
»Mr. Rosen?«, fragte der junge Mann.
»Ja.«
Die beiden nahmen mich in die Mitte, und gemeinsam gingen wir zum Flughafengebäude. »Ein bisschen arg kalt heute, nicht wahr?«, sagte die Frau. Sie waren keine zwanzig, halbe Kinder noch. Vermutlich waren sie aus lauter Idealismus zum FBMH gegangen. Sie lenkten mich zur Gepäckausgabe, machten gedämpfte Konversation über nichts Besonderes… Ich wäre ganz entspannt gewesen, hätte ich nicht bereits im grellen Licht der Leuchtfeuer, mit denen die Schiffe eingewiesen wurden, gesehen, dass die junge Frau Pris erstaunlich ähnlich sah.
»Wie heißen Sie?«, fragte ich sie.
»Julie. Und das ist Ralf.«
»Haben Sie… erinnern Sie sich noch an eine Patientin, die Sie hier vor ein paar Monaten gehabt haben, eine junge Frau aus Boise namens Pris Frauenzimmer?«
»Tut mir leid, ich bin erst letzte Woche in die Kasanin-Klinik versetzt worden. Er auch. Wir sind noch nicht lange beim Bureau.«
»Und gefällt es Ihnen? Entspricht es Ihren Erwartungen?«
»Oh, es ist unglaublich bereichernd, nicht, Ralf?« Ihr Kollege nickte. »Wir möchten hier gar nicht wieder aufhören.«
»Wissen Sie irgendetwas über mich?«
»Nur dass Doktor Shedd mit Ihnen arbeiten wird«, erwiderte Ralf.
»Und er ist super«, fügte Julie hinzu. »Er wird Ihnen gefallen. Er tut so viel für die Menschen, er hat so viele geheilt!«
Meine Koffer kamen; Ralf nahm einen, ich den anderen, und wir gingen zum Ausgang.
»Das ist ein schöner Flughafen«, sagte ich. »Ich bin hier noch nie gewesen.«
»Ja, sie haben ihn erst dieses Jahr fertiggestellt. Es ist der Erste, der sowohl Erd- als auch Weltraumflüge abfertigen kann. Sie können von hier aus direkt zum Mond fliegen.«
»Ich nicht«, flüsterte ich.
Kurz darauf saßen wir in einem Klinik-Hubschrauber und flogen über die Dächer von Kansas City. Die Luft war kalt und frisch, und unter uns glühten eine Million Lichter in unzähligen Mustern, die gar keine Muster waren.
»Glauben Sie«, fragte ich meine Begleiter, »dass jedes Mal, wenn jemand stirbt, in Kansas City ein neues Licht aufblinkt?«
Ralf und Julie schmunzelten.
»Wissen Sie, was mit mir passiert wäre, wenn es das FBMH-Programm nicht gäbe? Ich wäre jetzt tot. Es hat mir buchstäblich das Leben gerettet.«
Jetzt lächelten sie.
»Gott sei Dank ist der McHeston Act durch den Kongress gekommen.«
Sie nickten feierlich.
»Sie wissen nicht, wie es ist, dieses katatone Drängen zu spüren, diesen Druck. Er treibt einen weiter und weiter, und dann bricht man plötzlich zusammen. Man weiß, dass man nicht richtig im Kopf ist, dass man in einem Schattenreich lebt. Ich hatte vor meinem Vater und meinem Bruder Geschlechtsverkehr mit einer Frau, die nur in meiner Phantasie existierte. Ich hörte Leute über uns reden, während wir es miteinander machten. Durch die Tür.«
»Sie haben es durch die Tür miteinander gemacht?«, fragte Ralf erstaunt.
Julie schüttelte den Kopf. »Er meint, er hat sie durch die Tür reden gehört. Nicht wahr, Mr. Rosen?«
»Ja. Dass Sie es erklären mussten, zeigt, in welchem Maße mir meine Fähigkeit zur Kommunikation abhanden gekommen ist. Früher hätte ich das mit Leichtigkeit klar und deutlich ausdrücken können. Erst als Doktor Nisea zu dem Stein, der rollt, kam, wurde mir bewusst, was für eine Kluft sich zwischen mir und dem Rest der Gesellschaft aufgetan hat.«
»Ah ja, die Nummer 6 im Benjamin-Sprichwort-Test.«
»Ich frage mich, welches Sprichwort Pris damals nicht hinbekommen hat.«
»Pris?«, fragte Julie.
»Schätze mal«, sagte Ralf, »die Frau, mit der er Geschlechtsverkehr hatte.«
»Ganz genau. Sie ist mal hier gewesen, vor Ihrer Zeit. Jetzt geht es ihr wieder gut. Sie ist meine Große Mutter, sagt Doktor Nisea. Ich habe mein Leben der Verehrung von Pris gewidmet. Ich habe ihren Archetypus nach außen projiziert, ich sehe nichts als sie, alles andere ist für mich unwirklich. Dieser Flug gerade, Sie beide, Doktor Nisea, die Klinik – das sind alles bloß Schatten.«
Nachdem ich das gesagt hatte, ließ sich das Gespräch nur schwerlich fortsetzen. Also brachten wir den Rest des Fluges schweigend hinter uns.
Achtzehn
Am darauf folgenden Vormittag um zehn traf ich im Dampfbad der Kasanin-Klinik mit Doktor Albert Shedd zusammen. Die Patienten fläzten sich nackt in den Dampfschwaden, während das Personal in blauen Badehosen umherschlurfte.
Doktor Shedd tauchte aus dem weißen Dampf auf und lächelte mich freundlich an; er war mindestens siebzig, mit Haarsträhnen, die wie gebogener Draht von seinem runden, runzeligen Kopf abstanden. Im Dampfbad leuchtete seine Haut rosa.
»Guten Morgen, Mr. Rosen.« Er nickte und sah mich verschmitzt an. »Wie war der Flug?«
»Gut.«
»Dann sind Sie nicht von irgendwelchen anderen Flugzeugen verfolgt worden, nehme ich an.« Er lachte glucksend.
Ich war ihm für diesen Witz dankbar, denn er implizierte, dass Shedd irgendwo in mir ein grundsätzlich gesundes Element ausgemacht hatte, das er über den Weg des Humors ansprechen wollte. Er machte sich über meine Paranoia lustig – und dadurch schwächte er sie geschickt ab.
»Sehen Sie sich in der Lage, in dieser reichlich ungezwungenen Atmosphäre frei zu reden?«
»Aber ja. In Los Angeles bin ich immer in ein finnisches Dampfbad gegangen.«
»Also gut, dann schauen wir mal.« Er konsultierte seine Unterlagen. »Sie handeln mit Klavieren? Und Elektroorgeln?«
»Richtig, mit der Rosen-Elektroorgel – der besten der Welt.«
»Sie waren zu Beginn Ihrer schizophrenen Episode geschäftlich in Seattle unterwegs und haben sich mit einem Mr. Barrows getroffen. Zumindest laut dieser Aussage Ihrer Familie.«
»Ja, genau.«
»Uns liegen Ihre schulischen Psychotests vor, Sie scheinen damals keinerlei Probleme gehabt zu haben. Sie reichen bis zum neunzehnten Lebensjahr, dann kommen die Unterlagen vom Militärdienst. Auch hier alles in Ordnung. Genauso wie in den anschließenden Bewerbungstests. Es scheint mir eher eine situationsgebundene Schizophrenie zu sein als ein lebenslanger Prozess. Sie haben in Seattle unter ganz besonderem Stress gestanden, nicht wahr?«
»Ja.«
»Es kann sein, dass die Krankheit nie wieder auftreten wird, aber wir müssen den Vorfall als ein Warnzeichen betrachten – wir müssen uns darum kümmern.« Er musterte mich durch den wogenden Dampf. »In Ihrem Fall könnte möglicherweise eine Therapie helfen, die sich ›kontrollierter Wachtraum‹ nennt. Sagt Ihnen das etwas?«
»Nein.« Aber es klang gut.
»Dabei würden wir Ihnen halluzinogene Medikamente verabreichen, also Medikamente, die Sie zum Halluzinieren anregen. Für einen sehr begrenzten Zeitraum täglich. Das würde Ihrer Libido die Erfüllung der regressiven Impulse gestatten, die im Moment zu stark sind, als dass sie auszuhalten wären. Diese Wachträume würden wir dann sukzessive einschränken, bis wir sie hoffentlich ganz weglassen können. Einen Teil dieser Zeit würden Sie hier verbringen, wir würden jedoch anstreben, dass Sie später nach Boise zurückkehren können, zu Ihrer Arbeit, und dort eine ambulante Therapie erhalten. Die Kasanin-Klinik ist hoffnungslos überbelegt, müssen Sie wissen.«
»Ich weiß.«
»Würden Sie das gern versuchen?«
»Ja.«
»Es würde weitere schizophrene Episoden bedeuten, die natürlich unter Beobachtung stattfänden, unter kontrollierten Bedingungen.«
»Das ist mir egal.«
»Es würde Sie nicht stören, dass ich und andere Mitarbeiter Zeuge Ihres Verhaltens während dieser Episoden wären? Mit anderen Worten, dass wir in Ihre Privatsphäre eindringen…«
»Nein, das würde mich nicht stören. Mir ist egal, wer dabei zusieht.«
»Ihre paranoiden Tendenzen können nicht allzu stark sein, wenn Sie so wenig dagegen haben, beobachtet zu werden.«
»Ich habe überhaupt nichts dagegen.«
»Sehr schön.« Er nickte erfreut. »Das ist ein hoffnungsvolles Zeichen.« Und damit spazierte er davon, in seiner blauen Badehose, das Klemmbrett unter dem Arm. Mein erstes Gespräch mit meinem Psychiater in der Kasanin-Klinik war vorbei.
Eines Nachmittags also wurde ich in einen großen Raum mit nackten Wänden gebracht, wo mich mehrere Schwestern und zwei Ärzte in Empfang nahmen. Sie schnallten mich auf einen Tisch mit Lederpolstern und spritzten mir das halluzinogene Medikament. Dann traten sie zurück und warteten. Ich wartete ebenfalls, auf meinem Tisch festgeschnallt, in meinem Krankenhauskittel, die Arme an den Seiten.
Wenige Minuten später fand ich mich in der Innenstadt von Oakland, Kalifornien wieder. Ich saß auf einer Parkbank am Jack-London-Square. Neben mir fütterte jemand Brotkrumen an einen Schwarm blaugrauer Tauben. Eine junge Frau. Pris. Sie trug Caprihosen und einen grünen Rollkragenpulli, und ihre Haare waren mit einem rotkarierten Tuch zurückgebunden.
»Hey«, sagte ich.
Sie sah mich zornig an. »Verdammt, ich hab dir doch gesagt, dass du leise sein sollst. Wenn du redest, verjagst du sie noch, und dann füttert sie dieser alte Knacker da drüben.«
Auf einer Bank ein Stück den Weg hinunter saß Doktor Shedd und lächelte zu uns herüber. Er hielt ebenfalls eine Tüte Brotkrumen in der Hand.
»Pris, ich muss mit dir reden.«
»Wieso? Es ist für dich wichtig, aber ist es das auch für mich? Oder ist dir das egal?«
»Es ist mir nicht egal.«
»Dann zeig es mir – sei leise. Ich bin ziemlich glücklich mit dem, was ich gerade mache.« Sie fütterte weiter die Vögel.
»Liebst du mich?«
»Himmel, nein!«
Und doch spürte ich, dass sie es tat.
Wir saßen eine Weile schweigend nebeneinander, dann blichen der Park, die Bank und Pris langsam aus, und ich war wieder auf dem Tisch festgeschnallt, neben mir Doktor Shedd und die Schwestern der Kasanin-Klinik.
»Das lief schon viel besser«, sagte Shedd.
»Besser als was?«
»Als die beiden Male davor.«
Ich konnte mich nicht an irgendwelche Male davor erinnern und sagte ihm das.
»Kein Wunder, da hat es ja auch nicht geklappt. Es wurde kein Phantasieleben aktiviert – Sie sind einfach eingeschlafen. Doch ab jetzt können wir mit Resultaten rechnen.«
Am nächsten Morgen erschien ich wieder im Therapieraum, um mir meine Ration Traumleben abzuholen, meine eine Stunde mit Pris.
Als man mich gerade festschnallte, kam Doktor Shedd herein. »Ich werde Sie nun auch Gruppentherapie machen lassen, Mr. Rosen. Wissen Sie, was das ist? Sie werden Ihre Probleme einer Gruppe von Mitpatienten schildern, die dann Kommentare dazu abgeben. Sie sitzen dabei und hören sich an, wie die anderen über Sie diskutieren. Sie werden feststellen, dass das Ganze in einer freundlichen und zwanglosen Atmosphäre vonstatten geht. Und meist ist es sehr hilfreich.«
»Sehr gern.« Ich fühlte mich ziemlich einsam, hier in der Klinik.
»Sie haben nichts dagegen, dass der Inhalt Ihrer Wachträume der Gruppe zugänglich gemacht wird?«
»Aber nein. Warum sollte ich?«
»Dass wir jeden Ihrer Wachträume aufzeichnen und, mit Ihrer Erlaubnis, in der Gruppe diskutieren?«
»Selbstverständlich gebe ich Ihnen meine Erlaubnis. Ich habe nichts dagegen, dass eine Gruppe Mitpatienten meine Phantasien kennt. Erst recht nicht, wenn sie mir helfen können.«
»Sie werden feststellen, dass es auf der ganzen Welt niemanden gibt, der mehr darauf brennt, Ihnen zu helfen, als Ihre Mitpatienten.«
Mir wurde das halluzinogene Medikament verabreicht, und ich fiel erneut in einen Wachtraum.
Ich saß hinter dem Steuer meines Magic Fire Chevrolet im Feierabendverkehr auf dem Freeway. Im Radio berichtete gerade jemand von einem Stau weiter vorn.
»Ob Straßengewirr, Baustelle oder Verkehrschaos«, sagte er. »Ich bring Sie da durch, liebe Hörer.«
»Danke«, erwiderte ich.
Neben mir auf dem Beifahrersitz fuhr Pris auf. »Hast du schon immer dem Radio geantwortet? Das ist kein gutes Zeichen. Ich wusste doch, dass es mit deiner geistigen Gesundheit nicht zum besten steht.«
»Pris, auch wenn du das Gegenteil behauptest, ich weiß, dass du mich liebst. Erinnerst du dich denn nicht mehr – wir beide in Colleen Nilds Wohnung in Seattle?«
»Nein.«
»Du weißt nicht mehr, wie wir uns dort geliebt haben?«
»Igitt!«
»Ich weiß, dass du mich liebst.«
»Lass mich lieber gleich hier raus, mitten im Verkehr. Mir wird speiübel.«
»Pris, warum sind wir hier zusammen unterwegs? Fahren wir gerade nach Hause? Sind wir verheiratet?«
»Herrgott!«
»Antworte mir.«
Sie rückte schaudernd von mir ab, presste sich gegen die Tür, so weit weg, wie es nur ging.
Als ich wieder erwachte, schien Doktor Shedd sehr erfreut. »Sie machen Fortschritte. Sie erzeugen eine äußere Katharsis für die regressiven Impulse Ihrer Libido – und genau da wollen wir hin.« Er klopfte mir ermutigend auf die Schulter, wie es vor gar nicht so langer Zeit Maury Rock getan hatte.
Während meines nächsten Wachtraums sah Pris deutlich älter aus. Es war Abend, und wir spazierten langsam über den Bahnhof von Cheyenne, Wyoming. Ich sah immer wieder zu ihr. Ihr Gesicht war voller – als würde sie erwachsen werden. Und sie wirkte gelassener.
»Wie lange sind wir jetzt verheiratet?«, fragte ich.
»Weißt du das denn nicht?«
»Dann sind wir’s also.« Mein Herz machte einen Sprung.
»Natürlich sind wir verheiratet. Meinst du, wir leben in wilder Ehe? Was ist denn los mit dir, leidest du an Gedächtnisschwund?«
»Lass uns in die Bar dort gehen.«
»Gut. Weißt du, ich bin froh, dass du mich von diesen Gleisen weggebracht hast. Die haben mich deprimiert. Ich habe mir vorgestellt, wie die Lok näherkommt und ich auf die Gleise falle, und sie fährt über mich drüber und schneidet mich in Stücke. Ich habe mich gefragt, wie es sich anfühlen würde, es so hinter sich zu bringen – einfach nur dadurch, dass man sich nach vorn fallen lässt wie beim Schlafengehen.«
»Sag doch so was nicht.« Ich legte meinen Arm um sie und drückte sie. Sie war steif, unnachgiebig, so wie immer.
Als Doktor Shedd mich aus dem Wachtraum holte, blickte er ernst drein. »Ich bin nicht allzu erfreut zu sehen, dass in der Projektion Ihrer Anima jetzt morbide Elemente zum Vorschein kommen. Aber das ist zu erwarten gewesen, es zeigt, was für ein langer Weg noch vor uns liegt. Beim nächsten Versuch, dem fünfzehnten…«
»Dem fünfzehnten! Sie meinen, das war eben schon der vierzehnte Wachtraum?«
»Ja. Sie sind jetzt seit über einem Monat hier. Mir ist bewusst, dass Ihre Episoden ineinander übergehen. Das ist zu erwarten gewesen, denn manchmal gibt es überhaupt keinen Fortschritt, manchmal wird das gesamte Material wiederholt. Machen Sie sich darüber keine Sorgen, Mr. Rosen.«
»Na schön.« Tatsächlich bedrückte es mich.
Beim nächsten Versuch – jedenfalls nahm mein Hirn ihn als den nächsten wahr – saß ich wieder mit Pris auf der Bank im Jack-London-Park in der Innenstadt von Oakland. Diesmal war sie still und traurig; sie fütterte die umherspazierenden Tauben nicht, sondern saß einfach mit verschränkten Händen da und starrte zu Boden.
»Was ist mir dir?«
Eine Träne rann ihr die Wange hinab. »Nichts, Louis.« Sie zog ein Taschentuch aus der Handtasche, tupfte sich die Augen ab und putzte sich die Nase. »Ich fühle mich einfach irgendwie leblos und leer, das ist alles. Vielleicht bin ich schwanger. Meine Periode ist schon eine Woche überfällig.«
Das versetzte mich in Hochstimmung. Ich zog sie in meine Arme und küsste sie auf die kalten Lippen. »Aber das ist doch wundervoll!«
Sie lächelte leicht und tätschelte meine Hand. »Ich bin froh, dass du dich darüber freust, Louis.«
Sie hatte sich eindeutig verändert. Sie hatte Falten um die Augen herum, die ihr ein abgekämpftes, erschöpftes Aussehen verliehen. Wie viel Zeit war vergangen? Wie viele Male waren wir jetzt zusammengewesen? Ein Dutzend Mal? Hundertmal? Ich konnte es nicht sagen; die Zeit floss nicht mehr ruhig vor sich hin, sondern bewegte sich in Sprüngen. Ich fühlte mich ebenfalls älter und wesentlich müder. Und doch – was waren das für gute Neuigkeiten!
Zurück im Therapieraum, erzählte ich Shedd von Pris’ Schwangerschaft. Er war ebenfalls erfreut. »Sehen Sie, Mr. Rosen, wie Ihre Wachträume immer mehr Reife zeigen, immer mehr Elemente einer wirklichkeitsbezogenen Überprüfung von Ihrer Seite? Am Ende wird der Reifegrad der Träume Ihrem tatsächlichen Alter entsprechen, und an diesem Punkt haben die Wachträume ihre Funktion erfüllt.«
Fröhlich ging ich nach unten zu meinen Mitpatienten, um mir ihre Erklärungen zu dieser neuen Entwicklung anzuhören. Ich wusste, dass sie eine Menge zu sagen haben würden, sobald sie sich die Abschrift der heutigen Sitzung durchgelesen hatten.
In meinem zweiundfünfzigsten Wachtraum bekam ich endlich meinen Sohn zu Gesicht, ein gesundes, schönes Baby, das Pris’ Augen und meine Haare hatte. Wir saßen im Wohnzimmer – Pris gab ihm gerade die Flasche –, und es war, als hätten mich meine ganzen Anspannungen, meine ganzen Ängste und Sorgen, endlich verlassen.
»Diese blöden Dinger.« Wütend schüttelte Pris die Flasche. »Sie fallen zusammen, wenn er trinkt. Das muss am Sterilisieren liegen.«
Ich trottete in die Küche, um eine frische Flasche aus dem Sterilisator zu holen.
»Wie lautet sein Name, Schatz?«, fragte ich, als ich zurückkam.
»Wie sein Name lautet?« Pris sah mich fassungslos an. »Bist du noch ganz dicht, Louis? Du willst allen Ernstes wissen, wie der Name deines Kindes lautet? Rosen natürlich, wie denn sonst?«
Ich konnte nur dümmlich lächeln. »Vergib mir.«
Sie seufzte. »Na ja, ich bin es ja gewohnt.«
Aber wie heißt er denn jetzt?, fragte ich mich. Nun, vielleicht erfahre ich es beim nächsten Mal, und wenn nicht, dann vielleicht beim übernächsten Mal…
»Charles«, sagte Pris leise zu dem Baby. »Hast du Pipi gemacht?«
Charles also. Ich war froh – es war ein guter Name.
Vielleicht hatte ich ihn ausgesucht, ja, er klang nach einem Namen, den ich ausgesucht haben könnte.
An diesem Tag eilte ich nach meinem Wachtraum gerade die Treppe zum Gruppenraum hinunter, als ich eine Reihe von Patientinnen erblickte, die durch eine Tür in den Frauentrakt des Gebäudes gingen. Eine von ihnen hatte kurze schwarze Haare und war viel schlanker und kleiner als die anderen Patientinnen um sie herum; sie sahen wie aufgeblasene Ballons aus im Vergleich zu ihr. Ist das Pris?, fragte ich mich und blieb stehen. Bitte dreh dich um, bettelte ich und ließ ihren Rücken nicht aus den Augen.
Als sie durch die Tür ging, wandte sie sich für einen Moment um. Ich sah die Stupsnase, die prüfenden grauen Augen – es war Pris!
»Pris«, rief ich und winkte mit den Armen.
Sie starrte mich an, mit zusammengekniffenen Augen und schmalen Lippen. Dann lächelte sie, ein wenig nur.
Du bist wieder hier, in der Kasanin-Klinik, sagte ich mir. Und das ist keine Phantasie, kein Wachtraum, ob nun kontrolliert oder nicht; ich habe dich gefunden, in der wirklichen Welt, der äußeren Welt, die kein Produkt einer regressiven Libido oder eines Medikaments ist. Seit dem Abend in Seattle, als du dem Johnny-Booth-Simulacrum eins mit dem Stöckelschuh verpasst hast, habe ich dich nicht mehr gesehen. Wie lange ist das schon her? Wie viel habe ich seitdem erlebt und getan – in einem Vakuum getan, ohne dich, ohne die authentische, wirkliche Pris. Zufrieden mit einem bloßen Phantom… Gott sei Dank, ich habe dich gefunden. Ich wusste, dass ich dich eines Tages finden würde.
Ich ging nicht zur Gruppentherapie, sondern blieb dort auf dem Flur und wartete.
Schließlich, Stunden später, kam sie durch die Tür direkt auf mich zu, das Gesicht ganz ruhig, ein amüsiertes Funkeln in den Augen.
»Hey«, sagte ich.
»Also haben sie dich gekriegt, Louis Rosen. Du bist schließlich auch schizophren geworden. Das überrascht mich nicht.«
»Ich bin schon seit Monaten hier.«
»Und? Setzt schon die Heilung ein?«
»Ja. Glaube schon. Die machen jeden Tag einen kontrollierten Wachtraum mit mir, und ich gehe immer zu dir, Pris, jedes Mal. Wir sind verheiratet und haben ein Kind namens Charles. Ich glaube, wir leben in Oakland.«
»Oakland?« Sie kräuselte die Nase. »Manche Gegenden von Oakland sind nett, aber manche auch grässlich.« Sie ging weiter den Flur entlang. »War nett, dich zu sehen, Louis. Vielleicht laufen wir uns wieder einmal über den Weg.«
»Pris«, rief ich voller Schmerz. »Komm zurück!«
Aber sie ging weiter und war bald am Ende des Flurs verschwunden.
Als ich sie das nächste Mal in meinem Wachtraum sah, war sie definitiv älter. Ihre Figur war rundlicher, und sie hatte tiefe Schatten unter den Augen. Wir standen zusammen in der Küche; Pris spülte und ich trocknete ab. Im grellen Licht der Deckenbeleuchtung sah ihre Haut trocken aus, mit feinen, winzigen Fältchen überall. Sie trug kein Make-up. Vor allem ihre Haare hatten sich verändert; sie waren nicht mehr schwarz, sondern rötlich braun und sehr hübsch. Ich berührte sie. Sie fühlten sich angenehm an.
»Pris, ich habe dich gestern auf dem Flur getroffen. Hier, wo ich bin – in der Kasanin.«
»Schön für dich.«
»War es real? Realer als das hier?« Im Wohnzimmer sah ich Charles vor dem 3-D-Fernseher sitzen. »Erinnerst du dich an diese Begegnung? War sie für dich so real wie für mich? Ist das hier gerade real für dich? Bitte sag es mir, ich verstehe es nicht mehr.«
Sie kratzte an einer Bratpfanne herum. »Kannst du das Leben nicht einmal so nehmen, wie es kommt, Louis? Musst du immer herumphilosophieren? Du führst dich auf wie ein Schuljunge. Da muss man sich ja fragen, ob du je erwachsen wirst.«
»Ich weiß bloß einfach nicht mehr, welchen Weg ich gehen soll.« Ein Gefühl von Einsamkeit überkam mich, doch ich trocknete weiter das Geschirr ab.
»Nimm mich, wo du mich findest. Wie du mich findest. Sei damit zufrieden. Stell keine Fragen.«
»Ja, das werde ich. Ich versuche es jedenfalls.«
Als ich aus dem Wachtraum kam, sagte Doktor Shedd: »Sie irren sich, Mr. Rosen. Sie können Miss Frauenzimmer hier in der Kasanin nicht über den Weg gelaufen sein. Ich habe die Patientenkartei überprüft und niemanden mit diesem Namen gefunden. Ich fürchte, die Begegnung auf dem Gang war ein Rückfall in die Psychose. Wir scheinen keine so vollständige Katharsis Ihrer libidinösen Triebe zu erreichen, wie wir gedacht haben. Vielleicht sollten wir die Dauer der täglichen kontrollierten Regressionen verlängern.«
Ich nickte. Aber ich glaubte ihm nicht – ich wusste, dass das dort auf dem Gang wirklich Pris gewesen war, keine schizophrene Phantasie.
In der folgenden Woche blickte ich durch das Fenster des Solariums nach unten in den Innenhof – und sah, wie sie dort mit ein paar Frauen Volleyball spielte, alle in hellblauen Sportsachen.
Sie sah mich nicht; sie war auf das Spiel konzentriert. Eine Weile stand ich da und genoss ihren Anblick… dann sprang der Ball vom Spielfeld und kullerte auf das Gebäude zu. Pris lief ihm nach. Als sie sich bückte und ihn aufhob, sah ich ihren Namen; er war in bunten Blockbuchstaben auf ihr Trikot gestickt:
ROCK, PRIS
Das erklärte es: Sie wurde in der Kasanin-Klinik unter dem Namen ihres Vaters geführt. Also hatte Doktor Shedd sie auch nicht in der Kartei finden können; er hatte unter ›Frauenzimmer‹ nachgesehen.
Ich werde es ihm nicht verraten, sagte ich mir; ich werde aufpassen, dass ich es während meiner Wachträume nicht erwähne. Auf diese Weise wird er es nie erfahren, und ich kann vielleicht irgendwann noch einmal mit ihr reden.
Und dann dachte ich: Vielleicht ist das alles Shedds Absicht, vielleicht ist es eine Technik, mich aus den Wachträumen zurück in die wirkliche Welt zu holen. Weil diese paar Blicke auf die wirkliche Pris mir mehr bedeuten als alle Wachträume zusammen. Das ist alles Bestandteil der Therapie, und es funktioniert.
Ich war mir nicht sicher, ob mir das gefiel oder nicht.
Nach meinem einhundertzwanzigsten kontrollierten Wachtraum gelang es mir, mit Pris zu reden. Sie kam gerade aus der Caféteria, als ich hineinging. Ich sah sie als Erster; sie war in ein Gespräch mit einer anderen jungen Frau vertieft.
»Pris.« Ich hielt sie auf. »Lass uns bitte ein paar Minuten reden. Sie haben nichts dagegen – es ist Bestandteil der Therapie. Bitte!«
Die andere Frau ging rücksichtsvoll weiter, und ich war mit Pris allein.
»Du siehst älter aus, Louis«, sagte sie nach einer Weile.
»Und du siehst toll aus, wie immer.« Ich hätte sie am liebsten in die Arme genommen; stattdessen stand ich wenige Zentimeter vor ihr und tat nichts.
»Du freust dich bestimmt zu hören, dass sie mich in den nächsten Tagen entlassen. Dann bekomme ich wieder ambulante Therapie. Ich mache gewaltige Fortschritte, sagt Doktor Ditchley. Ich bin fast jeden Tag bei ihm, er ist der beste Arzt hier. Du bist bei Shedd, nicht wahr? Der taugt nichts, ein alter Trottel, meiner Meinung nach.«
»Vielleicht gelingt es uns ja, zusammen von hier wegzugehen. Was würdest du dazu sagen? Ich mache auch Fortschritte.«
»Warum sollten wir zusammen von hier weg?«
»Ich liebe dich und ich weiß, dass du mich auch liebst.«
Sie gab keine Antwort; sie nickte nur ganz leicht.
»Ließe sich das machen? Du weißt so viel mehr über die Klinik als ich. Du hast praktisch dein ganzes Leben hier verbracht.«
»Einen Teil meines Lebens.«
»Könntest du dir was einfallen lassen?«
»Lass du dir doch was einfallen – du bist der Mann.«
»Wenn ich es schaffe, heiratest du mich dann?«
Sie ächzte. »Klar doch, Louis. Was du willst: Heiraten, wilde Ehe, ab und zu mal vögeln – such dir was aus.«
»Heiraten.«
»Und Kinder? Wie in deiner Phantasie? Ein Junge namens Charles?« Sie verzog amüsiert die Lippen.
»Ja.«
»Dann rede mit Shedd, dem Kliniktrottel. Er kann dich entlassen, er ist dazu befugt. Und ich gebe dir einen Tipp: Halt dich zurück, wenn du das nächste Mal zur Wachtraumtherapie gehst. Sag ihnen, dass du nicht weißt, ob sie überhaupt noch was bringt. Und wenn du dann drin bist, erzähl deiner Phantasie-Sexpartnerin, dieser Pris Frauenzimmer, die sich dein Hirn zurechtgesponnen hat, dass du sie nicht mehr überzeugend findest.« Sie grinste. »Vielleicht bringt dich das ja hier raus, vielleicht auch nicht – vielleicht reitest du dich auch nur noch tiefer rein.«
»Du würdest mich doch nicht…«
»An der Nase herumführen? Reinlegen? Probier es aus, Louis. Du findest es nur heraus, wenn du den Mut dazu aufbringst.«
Sie wandte sich ab, entfernte sich.
»Wir sehen uns«, sagte sie über die Schulter. »Vielleicht.« Ein letztes beherrschtes Grinsen, und sie war weg.
Ich vertraue dir, sagte ich mir.
Nach dem Abendessen lief ich Doktor Shedd über den Weg und fragte ihn, ob ich ihn kurz sprechen könnte.
»Was haben Sie auf dem Herzen, Mr. Rosen?«
»Es geht um meine Wachtraumtherapie. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir noch etwas bringt. Und ich finde meine Phantasie-Sexpartnerin nicht mehr überzeugend. Ich weiß, dass sie nur eine Projektion meines Unbewussten ist – sie ist nicht die wirkliche Pris Frauenzimmer.«
»Das ist ja interessant.«
»Was bedeutet das? Dass es aufwärts mit mir geht oder abwärts?«
»Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir werden es während der nächsten Wachtraumsitzung sehen. Ich werde mehr wissen, wenn ich Ihr Verhalten dabei beobachten kann.« Er verabschiedete sich und ging den Flur hinunter.
Während meines nächsten Wachtraums fand ich mich in einem Supermarkt wieder. Pris und ich erledigten den wöchentlichen Einkauf.
Sie war jetzt wesentlich älter, aber immer noch Pris, dieselbe attraktive, starke, klarsichtige Frau, die ich immer geliebt hatte. Charles rannte vor uns her und stöberte nach Sachen für das Wochenende, das er mit seiner Pfadfindertruppe im Charles-Tilden-Nationalpark in den Bergen von Oakland verbringen würde.
»Du bist ungewöhnlich still heute«, sagte Pris.
»Ich denke nach.«
»Du machst dir Sorgen, meinst du. Ich kenne dich, ich seh’s dir an.«
»Pris, passiert das hier wirklich? Reicht das aus, was wir hier miteinander teilen?«
»Weißt du, ich halte dein ewiges Herumphilosophieren nicht mehr aus. Entweder du akzeptierst dein Leben oder du bringst dich um. Aber hör endlich mit diesem Geschwätz auf.«
»Gut. Aber im Gegenzug möchte ich, dass du aufhörst, ständig abfällige Bemerkungen über mich zu machen. Die kann ich nämlich nicht mehr hören.«
»Du hast ja bloß Angst, dich der Wahrheit…«
Bevor ich wusste, was ich tat, hatte ich ausgeholt und ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Sie machte einen Satz von mir weg, stand dort, die Hand auf die Wange gepresst, und starrte mich verblüfft an. »Zum Teufel mit dir«, sagte sie mit heiserer Stimme. »Das werde ich dir nie verzeihen.«
»Pris, ich…«
Sie wirbelte herum, griff sich Charles und eilte den Gang hinunter, ohne sich noch einmal umzusehen.
Auf einmal bemerkte ich, dass Doktor Shedd neben mir stand. »Ich glaube, das war genug für heute, Mr. Rosen.« Der Gang mit seinen Regalen voller Kartons und Verpackungen verschwamm, löste sich auf.
»Habe ich falsch gehandelt?« Ich hatte es getan, ohne nachzudenken. Hatte ich alles ruiniert? »Das ist das erste Mal im Leben, dass ich eine Frau geschlagen habe.«
»Machen Sie sich keine Sorgen deswegen.« Shedd nickte den Schwestern zu. »Machen Sie ihn los. Und wir lassen die Gruppentherapie heute besser ausfallen, denke ich.« Zu mir sagte er: »An Ihrem Benehmen ist etwas Merkwürdiges, das ich nicht verstehe. Es passt überhaupt nicht zu Ihnen.«
Ich erwiderte nichts, ließ nur den Kopf hängen.
»Man könnte beinahe vermuten, dass Sie simulieren.«
»Nein. Ich bin wirklich krank. Ich wäre längst tot, wenn ich nicht hierher gekommen wäre.«
»Ich glaube, Sie kommen morgen besser in mein Büro. Ich möchte den Benjamin-Sprichworttest und den Vygotsky-Luria-Klotztest einmal selbst mit Ihnen durchführen. Wer den Test durchführt, ist wichtiger als der Test an sich.«
Ich nickte.
Am nächsten Tag bestand ich sowohl den Benjamin-Sprichworttest als auch den Vygotsky-Luria-Klotztest. Nach den Vorschriften des McHeston Act war ich frei – ich konnte nach Hause gehen.
»Ich frage mich wirklich, ob Sie überhaupt hier in der Kasanin hätten sein dürfen«, sagte Doktor Shedd, während er meine Entlassungspapiere unterschrieb. »Ich weiß nicht, was Sie sich davon versprochen haben, hierher zu kommen, aber jetzt werden Sie sich Ihrem Leben aufs Neue stellen müssen. Und zwar ohne eine psychische Erkrankung vorzuschieben.« Mit dieser brüsken Bemerkung war ich offiziell aus der staatlichen Kasanin-Klinik in Kansas City, Missouri entlassen.
Ich räusperte mich. »Es gibt hier eine Frau, von der ich mich gerne verabschieden würde. Ist es in Ordnung, dass ich einige Minuten mit ihr rede? Ihr Name ist Rock.« Vorsichtig fügte ich hinzu: »Ihren Vornamen weiß ich nicht.«
Shedd drückte einen Knopf auf seinem Schreibtisch. »Lassen Sie Mr. Rosen für einen Zeitraum von höchstens zehn Minuten mit einer Miss oder Mrs. Rock reden. Und dann bringen Sie ihn zum Haupteingang – seine Zeit hier ist um.«
Ein stämmiger Pfleger brachte mich zu Pris’ Zimmer im Frauenflügel. Sie saß auf dem Bett und malte sich mit einem orangefarbenen Stift die Fingernägel an. Als ich eintrat, blickte sie auf.
»Hi, Louis«, sagte sie leise.
»Pris, ich habe es getan – ich habe ihm alles so erzählt, wie du es wolltest.« Ich beugte mich vor und berührte sie sanft am Arm. »Ich bin frei. Sie haben mich entlassen. Ich kann wieder nach Hause.«
»Dann geh.«
Ich starrte sie perplex an. »Und was ist mit dir?«
»Ich hab’s mir anders überlegt. Ich habe keine Entlassung beantragt. Ich glaube, ich bleibe lieber noch ein paar Monate. Es gefällt mir hier – ich lerne Weben. Ich webe gerade einen Teppich aus schwarzer Schurwolle.« Sie schlug die Augen nieder. »Ich hab dich belogen, Louis. Ich werde so schnell nicht entlassen, ich bin viel zu krank. Ich muss hier noch lange Zeit bleiben, vielleicht für immer. Es tut mir leid, dass ich gesagt habe, ich würde bald rauskommen. Bitte verzeih mir.« Sie griff kurz meine Hand und ließ sie wieder los.
Ich konnte nichts erwidern.
Kurz darauf brachte mich der Pfleger zum Ausgang. Mit fünfzig Dollar in der Tasche, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Regierung der Vereinigten Staaten, wurde ich in die Welt hinausgeschickt. Die Kasanin-Klinik lag hinter mir, war nicht länger Bestandteil meines Lebens.
Es geht mir gut, sagte ich mir. Ich kann zurück nach Boise, zu meinem Bruder Chester und meinem Vater, zu Maury und der Firma.
Ich habe alles außer Pris.
Irgendwo in dem großen Gebäude der Kasanin-Klinik saß Pris Frauenzimmer und kämmte schwarze Schurwolle für einen Teppich. Sie ging völlig darin auf, ohne jeden Gedanken an mich oder an irgendetwas anderes.
Nachwort
Philip K. Dick war der großzügigste Mensch, den ich je kennen gelernt habe. Wenn man ihn anrief und sagte: »Phil, ich wurde aus meiner Wohnung geschmissen, ich brauche vierhundert Dollar und jemanden, der mir hilft, meine Couch zu tragen«, antwortete er: »Klar, gar kein Problem! Äh – wer spricht denn da überhaupt?«
Es wird manchmal gesagt, er wäre frauenfeindlich gewesen. Diese Behauptung ist wohl auf die, gelinde ausgedrückt, etwas schwierigen Frauenfiguren zurückzuführen, die in vielen seiner Romane auftauchen, wie etwa Pris Frauenzimmer in »Die Lincoln-Maschine«. Dick selbst wäre über diese Ansicht wohl mehr als verblüfft gewesen – schließlich liebte er diese Frauen, und zwar genau so, wie er sie dargestellt hat: Pris Frauenzimmer, Pat Conley aus »Ubik« oder Kathy Sweetscent aus »Warte auf das letzte Jahr«.
Der vorliegende Roman wurde zum ersten Mal in den Jahren 1969 und 1970 in zwei Teilen in Amazing Stories veröffentlicht. Der damalige Titel – »A. Lincoln, Simulacrum« – war die Idee des Herausgebers Ted White. (Dick und White waren enge Freunde. Als ein britischer Verlag Dick um ein Foto für die Rückseite von »Das Orakel vom Berge« bat, konnte er keines finden. Er schickte ihnen stattdessen ein Bild von White, das auch prompt auf den Umschlag gedruckt wurde.)
Ich denke, der Titel, den sich White ausdachte, beweist, dass er keine Ahnung hatte, worum es in diesem Roman überhaupt geht – denn er handelt nicht in erster Linie von dem Lincoln-Simulacrum.
Als der Roman in Amazing Stories veröffentlicht wurde, hatte er neunzehn Kapitel – also eines mehr als in der vorliegenden Ausgabe. Nur dass Dick dieses letzte Kapitel überhaupt nicht geschrieben hat.
Dick erzählte mir, dass ihn Ted White davon zu überzeugen versuchte, dass das Buch unmöglich so enden konnte, wie Dick es geplant hatte – ein weiteres Kapitel wäre nötig, das der Geschichte ein vernünftiges Ende geben und alle Handlungsfäden zusammenführen sollte. Als Dick sich weigerte, dieses Kapitel zu schreiben, verfasste White einen Entwurf und schickte ihn Dick, um ihm einige mögliche Richtungen aufzuzeigen und ihn doch noch dazu zu bringen, es selbst in die Hand zu nehmen.
Doch Dick wartete einfach, bis der Abgabetermin vor der Tür stand, und schickte den Roman inklusive Whites Schlusskapitel zurück, ohne es auch nur bearbeitet zu haben – und letztendlich veröffentlichte White ihn in dieser Form in seinem Magazin. Selbstverständlich nahm Dick das Kapitel wieder heraus, als der Roman dann in Buchform erschien. Das Buch also ist und bleibt diejenige Version, die er ursprünglich geschrieben hatte.
Trotzdem ist es sehr interessant, einmal Whites Vorschlag für das Ende der Geschichte zu betrachten.
In diesem apokryphen Kapitel fährt das Lincoln-Simulacrum zur Kasanin-Klinik, um den gerade entlassenen Louis Rosen zu treffen. Die Lincoln eröffnet ihm, dass Louis – genau wie sein Vater und sein Bruder – ebenfalls ein Simulacrum ist, das von Sam Barrows bezahlt und von Pris Frauenzimmer entworfen wurde. (Sie erklärt jedoch nicht, warum Pris Chester sein Gesicht verkehrt herum aufgesetzt hat; Whites Theorie dazu hätte mich wirklich sehr interessiert.) Außerdem erfährt man, dass Louis’ Freund und Partner Maury Rock von Anfang an mit Barrows unter einer Decke steckte. Das Kapitel endet damit, dass Louis auf dem Mond lebt und versucht, menschliche Immigranten für Barrows’ dortige Wohnprojekte zu gewinnen.
Dieses Ende verblüfft. Es beinhaltet, ähnlich wie Dicks »Ubik«, eine völlig überraschende Wendung. Aber meiner Meinung nach verliert der Roman dadurch viel von seiner Kraft. Alles, was Louis durchmachen musste, sein Schmerz und seine Leidenschaften sind nur diejenigen eines künstlichen Menschen. Damit gerät nicht nur der »vornehme Humanismus« von Louis’ Vater zur Parodie, auch die Freundschaft zwischen Louis und Maury Rock stellt sich als nichts weiter als eine große Täuschung heraus.
Ich erinnere mich, wie ich Dick gegenüber einmal aus seinem Roman »Nach der Bombe« zitierte. Ich gab die Gedanken einer der Hauptfiguren wieder:
Was für Probleme uns damals nur wichtig erschienen sind! Die Unfähigkeit, sich aus einer unglücklichen Beziehung zu lösen… Heute sind wir froh, dass wir überhaupt Beziehungen zu Menschen haben. Wir haben viel dazugelernt.
»Ich habe das geschrieben?«, fragte er mich und war ungemein erfreut, als ich ihm versicherte, dass es sich genauso verhalte.
Dick bringt Louis’ zwischenmenschlichen Beziehungen – sogar dem eher vergifteten Verhältnis zu Pris – ganz offensichtlich große Wertschätzung entgegen, auch dann, wenn Louis selbst dies nicht tut. Louis’ Vater hat in seinem Leben nicht viel erreicht; trotzdem ist sein halbherziges, aber zutiefst menschliches Mitgefühl eines der Bollwerke, in das sich Louis immer wieder zurückziehen kann. Genauso verhält es sich mit Maury Rocks oft auf die Probe gestellter Loyalität. Obwohl sie nicht viel Gutes bewirkt und auch niemanden retten kann, ist sie doch eine Art Anker, an den sich Louis das ganze Buch hindurch klammern kann. Was mich an ein Gedicht von Algernon Charles Swinburne erinnert:
Hoffnung stirbt und ihr tod lässt uns wissen
Ihr glück wie ihr leiden entschwand
Eh die zeit – allzerreißend – zerrissen
Um freunde das band.
Die Hoffnungen jeder einzelnen Figur dieses Romans sind zum Scheitern verurteilt – selbst Sam Barrows’ Bemühungen scheinen nicht von Erfolg gekrönt zu sein. Nichtsdestotrotz: Louis, sein Vater, Maury Rock und all die anderen gesellen sich zu jenen Charakteren Philip K. Dicks, die – so wie Mr. Tagomi aus »Das Orakel vom Berge«, Eric Sweetscent aus »Warte auf das letzte Jahr« und Jack Bohlen aus »Marsianischer Zeitsturz« – beharrlich und manchmal starrköpfig ihre menschlichen Beziehungen aufrechterhalten wollen. Selbst in einer Welt, die sie daran zerbrechen lässt.
Tim Powers
[i]
Nicht so in der klassischen deutschen Fassung. Christoph Martin Wieland (1733-1813) empfand den entsprechenden Abschnitt in Heinrich IV. als »ekelhaft«, »frostig«, ja sogar als »zum Theil von völlig unübersezlichem Zeug« wimmelnd und hat ihn weggelassen. So musste hier für das im englischen Sprachraum weithin bekannte Bild des »forked radish« eine Notübersetzung vorgenommen werden. – Anm. d. Übers.
[i]