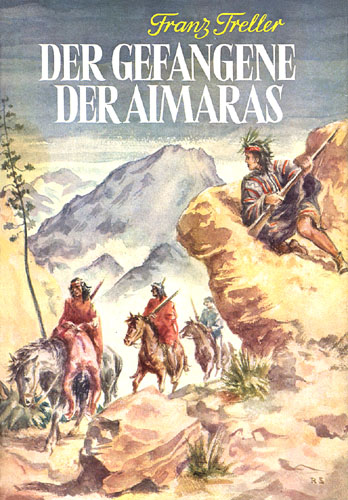
Das Schicksal eines weißen Jungen, der von den Aimaràs, einem wilden Indianerstamm in den südamerikanischen Anden, bei einem Überfall geraubt und verschleppt wird.
Die erste Buchausgabe erfolgt 1904 als zwölfter Band der kleinformatigen "Kamerad-Bibliothek" in der Union Deutsche Verlagsgesellschaft mit Illustrationen aus der Zeitschriftenfassung. Bis zur 31. Auflage erscheinen drei Varianten dieser Ausgabe: grünes Leinen mit Jugendstil-Ranken, grünes Leinen mit indianischer Verzierung sowie hellbraunes Leinen mit Figuren-Vignetten. Während das Bildmotiv bei den ersten beiden Varianten aufgedruckt wird, wird es bei der dritten montiert.
Mitte der 30er Jahre beginnt mit der 32. Auflage eine großformatige Ausgabe, die den Untertitel 'Abenteuer- und Indianererzählung aus den Anden', einen farbigen Schutzumschlag und neue Federzeichnungen als Textillustrationen erhält.
Ab 1951 wird diese Erzählung in einer "vollständigen Neubearbeitung" von Fritz Helke vom Union Verlag als Band 4 der neuen "Kamerad-Bibliothek" wiederveröffentlicht. Die Ausstattung wechselt bald von Halbleinen mit Schutzumschlag zu einem Pappeinband, insgesamt wird es drei verschiedene Titelbildmotive geben. Im Inneren enthalten die ersten Auflagen zwei verschiedene Sätze von vier Farbtafeln, die jedoch wie üblich bei späteren Ausgaben nicht mehr verwendet werden.
Von 1904 bis 1970 bringt es die Erzählung auf eine Gesamtauflage von 96 000 Exemplaren.
Der Gefangene der Aimaràs


Die Lassos flogen auf die Hörner widerspenstiger Tiere.
Erstes Kapitel.
Auf der Höhe der Anden
Im Westen und Norden des gewaltig dahinströmenden Orinoko, der, vom Äquator kommend, viele Meilen weit die Grenze zwischen Neugranada und Venezuela bildet, um dann in westlichem Laufe dem Atlantischen Ozean zuzueilen, nachdem er Venezuela durchquert hat, breitet sich die ungeheure Ebene aus, die der Spanier die Llanos nennt.
Den Pampas des Südens, den Prärien des Nordens gleicht sie nur in ihrer Bodengestaltung, nicht im Pflanzenwuchs, der durchweg tropisch ist, nicht in der Einförmigkeit, die jene Wüsten auszeichnet; Grasflächen wechseln mit Buschwerk ab, Haine sind eingestreut, in denen die Palmenarten vorwiegen, und vor allem bringen zahlreiche Wasserläufe reiches Leben in die Llanos. Und aus dieser endlosen Ebene steigen nach Westen hin Gebirgszüge empor, die sich in ihrer fast den ganzen amerikanischen Kontinent durchziehenden Kette nirgends höher erheben, als im Nordwesten Südamerikas, nirgends kompakter und gewaltiger auftreten. Da wo Ebene und Gebirge aneinander grenzen, findet man auf kleinem Raume alle Klimate vereinigt.
In der Ebene herrscht unter den sengenden Strahlen der Sonne des Äquators tropische Hitze, in den Vorbergen der Andenkette ein gemäßigtes Klima, und die Spitzen der Bergriesen, die bis zu siebentausend Meter aufragen, deckt ewiges Eis, trotz der sich oft bemerkbar machenden vulkanischen Tätigkeit ihres Innern.
In der heißen Ebene, die durch zahlreiche Wasserläufe, die dem Gebirge entquellen, befruchtet wird, wo die Agave gedeiht und die Königspalme ihre riesigen Blätter im Winde wehen läßt, hausen die mit ihren Pferden fast nur ein Wesen bildenden Llaneros, die in der Steppe ihre zahlreichen Herden weiden, ein wildes, rauhes, ausdauerndes Centaurengeschlecht, das seine Freiheit über alles liebt.
In den Bergen aber wohnt ein zäher Stamm von Ackerbauern, der durch seine mühsame Arbeit seinen Lebensunterhalt gewinnt, Mais, Weizen, Kartoffeln baut und seine Herden in den Bergen weiden läßt, die Montaneros; nicht minder mannhaft und trotzig als die Reiter der tiefer liegenden Steppe.
Ihnen gesellen sich in den Andentälern zahlreiche Kolonien Ureingeborener, die, für das Christentum gewonnen, friedlich ihren Acker bauen und wesentlich ihre Stammesreinheit wahren.
Hoch oben aber im Gebirge, in schwer ersteigbaren Felstälern wohnen einzelne, niemals unterworfene Indianerstämme, die, unzugänglich aller europäischen Zivilisation, noch treu die Überlieferungen ihrer einst mächtigen Vorfahren bewahren und den Weißen als ihren Todfeind betrachten.
Solange die spanische Regierung in jenen Ländern mit eiserner Faust herrschte, verhielten sich diese zerstreuten wilden Horden ruhig in ihrer Abgeschlossenheit, denn sie fürchteten den Zorn des spanischen Königs.
Als aber Anfang des neunzehnten Jahrhunderts der Unabhängigkeitskampf ausbrach und die weißen Bewohner dieser Länder, Nachkommen der eingewanderten Spanier, in jahrelangen blutigen Kämpfen mit der Macht des Mutterlandes rangen, um sich frei von dessen Herrschaft zu machen, kam auch Leben in diese abgelegenen Ansiedlungen der wilden Indianer und sie beteiligten sich an den Kämpfen der Parteien, wenn auch nur mit Rauben, Morden und Sengen, wobei es ihnen ganz gleichgültig war, ob sie königlich Gesinnte oder Liberale niedermetzelten.
Die Bruderkämpfe, in denen sich, nachdem endlich die Unabhängigkeit von Spanien errungen war, die Bewohner dieser Landstriche erschöpften und ihren Heimatboden mit Blut tränkten, dienten nicht dazu, die im Gebirge hausenden Indianer friedlich zu stimmen, umsoweniger als sie in ihren Felsenschluchten unangreifbar waren, auch die Parteikämpfe im Inneren des Landes jedes energische Auftreten gegen sie verhinderten.
Die friedlich gesinnten, halbzivilisierten ackerbauenden Indianer der Vorberge fürchteten ihre wilden Stammesgenossen im Hochgebirge gleich wie die Weißen diese scheuten, auch machten die Indios bravos (wilde Indianer) zwischen beiden kaum einen Unterschied, wenn sie räuberisch in das Land eindrangen.
Zum Glück für die Bewohner der Vorberge und der Ebene war die Zahl dieser Indios bravos eine geringe, und nur von Zeit zu Zeit wagten es die Nachkommen des einst mächtigen Aimaràvolkes, die in dem Gebirgsstock hausten, der nach Neugranada wie nach Ecuador hineinragt, aus ihren Schlupfwinkeln hervorzubrechen, um sich mit der errungenen Beute bald wieder in ihre unzugänglichen Berge zurückzuziehen.
- - - - - - - - - - -
Auf der Spitze eines rauh zerklüfteten Felsens, hoch im Gebirge, stand ein Knabe, der sinnend nach Osten über Berge, Hügel und Wälder hinwegblickte, bis weit hinaus, wo sich in bläulichem Schimmer Erde und Himmel zu vereinen schienen.
Der Anblick, der sich von hier aus dem Auge bot, war von seltener Großartigkeit, von einer feierlichen Erhabenheit, wie ihn die Erde nur an wenigen Stellen dem Menschen gewährt, und die tiefe Stille ringsumher machte ihn noch eindringlicher.
Der vor diesem Bilde weilende Knabe trug das Kleid der in den Bergen hausenden Ureingeborenen, eine bis an das Knie reichende ärmellose Tunika von Bikunjawolle, die ein Ledergürtel um den Leib zusammenhielt, und hohe lederne Gamaschen. Der kräftige Arm und das Antlitz zeigten, daß das Blut des Europäers unverfälscht in seinen Adern rollte, so sehr beides von Sonne und Luft auch gebräunt war.
Um das schön geformte sinnende Antlitz, aus dem dunkle Augen sehnsuchtsvoll in weite Ferne blickten, hing lang herab dunkles, welliges Haar, das ein Streifen Leopardenhaut, der um Stirn und Hinterhaupt geschlungen war, zusammenhielt.
Die Haltung des Knaben war von seltener Anmut, wie er dastand, den Blick in das Endlose gerichtet. Lange stand er so, bewegungslos. Ein Seufzer stieg aus der Tiefe der Brust hervor, hinweggetragen von dem lauen Luftzuge, der nach Osten wehte, der Heimat das Jünglings.
"Wann werde ich dich wiedersehen, mein Heimatland?" sagte er leise in sanftem Klagetone. "Findet dieser qualvolle Aufenthalt unter den räuberischen Wilden nicht bald ein Ende, so verlerne ich noch die Sprache meiner Väter. O Allmächtiger, rette mich - rette mich - ehe ich untergehe."
Er sank auf die Knie, neigte das Haupt und schien zu beten.
Endlich erhob er sich.
"Nur im Gebet kann ich noch Spanisch sprechen," flüsterte er tiefschmerzlich.

Der Mann hinter dem Busche betrachtete den ruhig dasitzenden Knaben.
Während sein Auge über die Schluchten nach Osten hinstreifte, zuckte er plötzlich zusammen und verschärfte den Blick der großen dunklen Augen. "Bei meinem Leben, sie bringen einen Weißen," sagte er in tiefer Erregung.
Einem gewöhnlichen Auge kaum wahrnehmbar, erkannte der Adlerblick des Jünglings zwischen einem noch fernen, sich langsam heranbewegenden Zug von Eingeborenen einen Europäer.
"Gott schütze ihn vor diesen grauenhaften Menschen."
Wie sein Auge, war auch das Ohr des Knaben ungewöhnlich scharf. Das Geräusch eines leichten Schrittes drang zu diesem, und augenblicklich sank der Jüngling zur Erde nieder und nahm eine ruhig nachdenkliche Stellung ein. Gleich darauf erschien das braune Gesicht eines jungen Indianers zwischen den Büschen, die den Fels bedeckten. Obgleich er ähnlich gekleidet war wie der weiße Knabe, zeichnete sich die Tracht des braunen Burschen doch durch größeren Reichtum aus. Stirnband und Gürtel zeigten reichen Schmuck von goldenen und silbernen Stickereien und Zieraten.
Das dunkle Gesicht des Indianers war unschön und hatte einen tückischen, lauernden Zug. Er betrachtete einen Augenblick den ruhig dasitzenden weißen Knaben, der seiner nicht achtete und sagte dann in den rauhen Kehltönen der Aimaràsprache: "Sinnt der Blanco wieder, wie er uns entlaufen könnte?"
Über das Gesicht des Angeredeten hatte sich, als er die nahenden Schritte vernahm, eine eherne Ruhe verbreitet.
Er wandte das Auge auf den jetzt vor ihm stehenden Indianer und erwiderte im gleichen Idiom: "Du weißt, Guati, daß mein Herz längst das eines Aimarà ist."
"Es ist gut, du bist der unsere. Erfahrung lehrte dich, daß es unmöglich ist, zu entrinnen. Du bist klug genug, Blanco, du hast das Leben lieb."
"Warum rufst du zurück, was vor Sommern geschah, als ich ein Kind war?"
"Du sehnst dich nach der verwünschten Rasse, der du entstammst, und darum suchst du die Höhen auf und richtest dein Auge immer nach Osten hin, wo die Deinen wohnen."
"Du irrst, Guati," entgegnete gleichmütig der Jüngling. "Die Vergangenheit ist ausgelöscht in meiner Seele - und ich gehöre zu euch."
Der forschende Blick des Indianers ruhte auf dem bewegungslosen Gesichte des jungen Spaniers, dann sagte er mit einem höhnischen Grinsen: "Gut, wenn du die Wahrheit sprichst, denn der Opferstein dürstet nach dem Blute eines Weißen." Die Züge des Jünglings blieben bewegungslos. "Im verflossenen Jahre mußte er es entbehren und die Unsichtbaren zürnten ihren Kindern."
"Sie werden ihr Angesicht, das Wolken beschatten, wieder enthüllen."
"Ich hoffe so," erwiderte der Indianer mit einem Ausdruck des Triumphes in seinem unschönen Gesicht, "die Aimaràs werden ihren Zorn besänftigen."
Durch des Knaben Seele zog ein schauervolles Bild. Vor zwei Jahren hatten die fanatisch an ihrem alten Aberglauben hängenden Indianer einen von ihnen gefangenen Spanier ihrem Götzen geopfert. Zwar hatte man den Knaben während der grausigen Zeremonie entfernt, ihn in eine abgelegene Schlucht gesandt, aber hatte den entstellten Leichnam des Mannes gesehen und den entsetzlichen Vorgang aus den Gesprächen der Indianer kennen gelernt. Im letzten Jahre war wegen Mangel eines geeigneten Gefangenen das Opfer unterblieben - jetzt aber - er hatte einen Weißen in der Mitte der von einem Raubzuge zurückkehrenden Krieger gesehen und wußte, was diesem bevorstand. Aber der Knabe hatte inmitten dieser rohen Horde sich eine Selbstbeherrschung zu eigen gemacht, die ihn befähigte, sein Fühlen und Denken unter gleichgültiger Außenseite zu verbergen.
Er gab an stoischer Haltung keinem Indianer etwas nach - er bewahrte äußere Ruhe, trotzdem sein Herz bebte.
"Du sollst vor dem Kaziken erscheinen, Techpo," sagte Guati, "ich bin ausgesandt, dich zu suchen."
Augenblicklich erhob sich der weiße Knabe. "Ich gehorche," sagte er.
Guati warf einen Blick über die Schluchten nach Osten hin, doch von dem Zuge, der den Weißen mit sich führte, war nichts mehr zu gewahren.
"Komm," sagte er kurz und schritt voran den Fels hinab. Ihm folgte der andere, ohne noch einmal nach Osten auszuschauen.
Bald hatten sie das von einem Bache durchrauschte Tal vor sich, in dem dieser Aimaràstamm hauste. Unregelmäßig zerstreute kleine Häuser, aus Adobeziegeln errichtet, zeigten sich hier dem Blick, von Gärten umgeben und Bäumen umstanden, auch Maisfelder gewahrte das Auge und Wiesen, auf denen kleine Gebirgspferde und Maultiere weideten.
Von den Bewohnern waren wenige zu sehen. Kinder spielten da und dort, und einige Frauen waren in den Gärten beschäftigt. Vor manchem der Häuser saß ein alter Indianer, stumpfsinnig vor sich hinstarrend.
Guati und der weiße Knabe schritten durch das Dorf auf eine größere Behausung zu.
Ein Pferd war an der Hecke angebunden, das einen langen Weg zurückgelegt haben mußte.
Unter einem Vordache saßen zwei Indianer, der Kazike Tucumaxtli und ein jüngerer Mann.
Techpo wußte, daß dieser eben auf dem Pferde angekommen sein mußte und gewiß das Herannahen der auf Raub ausgezogenen Krieger gemeldet hatte. Er gehörte einem unweit hausenden Teile des Stammes an.
Die beiden jungen Leute verharrten ehrerbietig, bis der Kazike sie bemerken würde.
Dieser, ein älterer Mann mit harten Gesichtszügen, dessen Oberleib von einem schön verzierten Gewand, in der Form ähnlich dem, wie es die Jünglinge trugen, eingehüllt war, das die sehnigen Arme, die an den Handgelenken von goldenen Spangen umfaßt wurden, nackt ließ, sah auf die Knaben schweigend hernieder.
"Ich wundere mich," sagte der neben dem Kaziken sitzende Mann, "daß du diesen jungen spanischen Wolf noch immer am Leben lässest, statt ihn den Göttern zu opfern."
Er sagte das in einem Dialekte der Aimaràsprache, von dem er annahm, daß der weiße Knabe ihn nicht verstände, doch dieser verstand ihn wohl, aber kein Zucken seines in eherner Ruhe verharrenden Gesichtes verriet davon.
"Ich hoffe noch viel Geld für ihn zu erhalten," erwiderte der Kazike in dem gleichen Idiom, "sein Leben ist für einige große Spanier gefährlich und sie müssen mir es abkaufen, ich habe ihn nicht grundlos so lange bewahrt."
"Aber warum willst du ihn in die Berge senden?"
"Er soll den Gefangenen nicht sehen, soll nicht Zeuge der Opferhandlung sein, es könnte zu unheilvollen Dingen führen, denn es ist nicht undenkbar," fuhr er leiser fort, so daß der Knabe es nicht hörte, "daß ich ihn den Seinen wiedergeben muß, wenn man ihn mit viel Geld auslöst, er soll deshalb nichts von dem Opfer erfahren, um nicht später den Weißen davon erzählen zu können."
"Aber kann er nicht entweichen, wenn du ihn in die Berge sendest mit der Büchse in der Hand?"
"Er entweicht nicht mehr, er ist ein Aimarà geworden und spricht kaum noch die Sprache seiner Väter. Flucht? Er hat es einmal versucht und weiß, daß kein Entrinnen ist, er kennt die Bergpfade nicht, die den Zugang zu unserem Lande bilden."
"Der Wolf wird größer und gefährlicher."
"Der ist gezähmt, sei unbesorgt. Er ist trotz seiner Jugend ein geschickter Jäger, er mag dem Wild nachstellen, während wir den Göttern dienen. Er soll fort, ehe die Krieger mit dem Weißen kommen."
Er winkte hierauf dem Techpo genannten Knaben, näher zu treten, und rasch nahte sich ihm dieser in ehrerbietiger Haltung.
"Du mußt zur Jagd aufbrechen, Techpo," sagte der Kazike in der Sprache der Aimaràs, "wir brauchen das Fleisch des Berghirsches."
In des Knaben starrem Gesicht erschien ein freundlicher Ausdruck.
"Du gehst gern, Knabe, wie?"
"Ja, Kazike, ich gehorche dir gern."
"Ich weiß es. Du mußt sofort aufbrechen, denn ich erwarte Gäste, denen ich den Hirsch zu kosten geben will. Ich gebe dir drei Tage zur Jagd."
Techpo neigte das Haupt.
"Guati wird dich begleiten, zwei Büchsen sind besser als eine, und die Hirsche werden selten."
Trotz aller Selbstbeherrschung, die dem Indianer eigen ist, verriet das Gesicht Guatis, daß ihm dieser Auftrag nicht angenehm war.
"Geh in das Haus, Techpo, nimm dir Waffen, fülle den Kugelbeutel und deine Jagdtasche."
Alsbald schritt der Knabe in das Innere des Hauses.
Der Kazike winkte Guati heran und sagte freundlich zu ihm: "Der kluge Sohn Tucumaxtlis muß mit dem Blanco gehen, damit der den Weg zurückfindet."
"Wo betet Guati zu den Göttern, wenn der Tag ihres Festes kommt?"
Der Kazike wußte wohl, daß der junge Mensch sich ungern während des Festes entfernte, aber Techpo mußte bewacht werden, und Tucumaxtli wählte den eigenen Sohn, um nicht Mißstimmung in den Kreisen des Volkes wachzurufen. Mit ernstem Nachdruck erwiderte er ihm, den Arm nach den von Nebel umhüllten Höhen im Westen ausstreckend: "Guati betet auf den Bergen zu den Göttern seines Volkes. Fort, rüste dich zur Jagd, es muß sein." Gehorsam entfernte sich der Jüngling, Zorn im Antlitz.
Nach kurzer Zeit ritten Techpo und Guati auf Maultieren, bewaffnet und ausgerüstet zur Jagd, ein drittes Maultier am Lasso mit sich führend, um die Jagdbeute zu tragen, in die Berge.
Sie waren kaum in den düsteren Hohlwegen, die nach oben führten, verschwunden, als vom Osten her ein Zug von einigen dreißig Reitern in das Tal einzog, die auf Saumtieren reiche Beute mitzuführen schienen.
Die Bewohner des Dorfes eilten ihnen entgegen, doch die stumpfsinnige Neugier der Wilden war nicht auf die beladenen Maultiere gerichtet, die in den braunen Gesichtern funkelnden Augen starrten allein mit dem Ausdruck grimmiger Freude auf den Weißen, der inmitten der rückkehrenden Krieger ritt.
Es war ein noch junger Mann, mit schönem, von einem leichten Bart eingefaßten Antlitz, der trotz seiner erkennbaren Erschöpfung in guter Haltung auf dem Pferde saß und die zusammengelaufenen Indianer kaum eines Blickes würdigte.
Der Zug hielt vor dem Hause des Kaziken. Der Führer stieg ab und begab sich in Begleitung des Gefangenen, dem man die Fußfesseln gelöst hatte, zu dem Häuptling.
Der junge Spanier stand in hochmütiger Haltung vor dem Häuptling, der ihn aufmerksam betrachtete. Dann gebot der letztere dem Indianer, zu reden, und dieser stattete kurzen Bericht ab über den Erfolg des Raubzuges, der ungemein günstig sich erwies und erwünschte Beute, vor allem aber einen Weißen als Gefangenen gebracht hatte.
Der Weiße harrte geduldig, bis der Indianer geendet hatte, und wandte sich dann mit nachlässiger Höflichkeit an den Kaziken in spanischer Sprache. "Ich vermute, du bist der Jèfe dieser Indios, hoffentlich sprichst du Spanisch?"
"Ich verstehe deine Sprache, was willst du?"
"Es wäre zwecklos, ein Wort über die Art und Weise zu verlieren, wie ich hierher gekommen bin, die Hauptsache für mich ist, möglichst bald wieder wohlbehalten in den Llanos zu sein, und da erlaubst du wohl, Caudillo, daß ich dir einige Vorschläge mache. Die braunen Caballeros, die mich gefangen nahmen und hierher führten, wiesen sie zurück und vertrösteten mich auf deine Weisheit."
"Sprich," sagte ruhig der Kazike als einzige Antwort.
"Es ist ganz natürlich, daß ihr für einen Gefangenen Lösegeld verlangt, denn was hätte eine Gefangennahme sonst für einen Zweck? Auch bin ich durchaus bereit, es zu zahlen, sprich nur, was du verlangst."
"Du bist mir als ein Geschenk der Götter willkommen, Weißer, und als solches allein wertvoll." Der Kazike sprach gar nicht übel Spanisch.
"Das klingt etwas dunkel. Hoffentlich habt ihr nicht die Absicht, mich hier zum Feldherrn, Minister oder gar König zu machen; so ehrenvoll das ja gewiß sein würde, so müßte ich es doch ablehnen. Also sprich kurz, edelster aller ureingeborenen Fürsten, was verlangst du für meine Freiheit? Gold, Silber, Pferde, Rinder, Waffen, es soll dir werden, laß mich nur so rasch als möglich aus deinen Bergen hinausgeleiten."
Der junge, bleich und angegriffen aussehende Mann sprach mit einer Art Galgenhumor, in der das Bewußtsein der gefährdeten Lage mit der Verachtung gepaart war, die er den Eingeborenen gegenüber fühlte.
Der Kazike schien ihn, was den Hauptinhalt seiner Auslassungen anging, gut zu verstehen, doch machte das Angebot eines Lösegeldes keinen bemerkbaren Eindruck auf ihn.
"Das weiße Gesicht macht viele Worte, doch es irrt sich, wenn es glaubt, daß wir sein Gold oder Silber nötig haben. Es ist unnütz, weiter darüber zu verhandeln; der Weiße wird sehen, was die Götter ihm beschieden haben."
Die Zurückweisung eines für diese Leute wertvollen Lösegeldes machte den jungen Mann stutzig, er warf einen forschenden Blick auf den finsteren Indianer und sagte dann mit großem Ernste: "Ich bin der Sohn eines großen Caudillos, Sennor, und es ist wahrscheinlich, daß mein Vater seine Krieger aussenden wird, um nach mir zu suchen."
Mit einem höhnischen Lächeln erwiderte der Kazike: "Mögen sie suchen. Werden sie finden? Ihre Gebeine werden in den Felsschluchten bleichen. Geh und spare deine Worte - uns droht man nicht."
Er befahl dann den Gefangenen fortzuführen.
"Was mögen diese räuberischen Menschen mit mir vorhaben?" murmelte der junge Mann, als er hinwegschritt.
Man geleitete ihn durch die Reihen der ihn in dumpfem Schweigen anstarrenden Bewohner des Dorfes, nach einigen entfernten Häusern, die sich in der Nähe eines terrassenartig ansteigenden Bauwerkes erhoben. Dort führte man ihn in einen halbdunklen viereckigen Raum, der sein Licht nur durch einige in über Manneshöhe angebrachten Luken empfing.
Ein Lager, mit Fellen bedeckt, zeigte sich darin, daneben ein niedriger Tisch; der Boden bestand aus viereckigen Steinplatten.
Einer seiner Begleiter sagte in verständlichem Spanisch: "Hier wird der Weiße wohnen. Man wird ihm Trank und Speise bringen, er möge sich stärken."
Man ließ den Gefangenen allein und schloß hinter ihm die Tür, ohne sie zu verschließen; doch blieben einige derer, die ihn hierhergeschleppt hatten, vor dieser als Wachen zurück.
Der junge Mann sah sich in dem düsteren Raum um. "Was bedeutet das alles? Was wollen diese Ladrones von mir?" Er sah einen Augenblick starr vor sich hin. "Was droht mir? Was können sie wollen außer dem Lösegeld?"
Er ließ sich erschöpft auf dem Lager nieder, denn er war todmüde von dem langen Ritt durch die Berge.
Herein trat eine alte Frau und setzte tönerne Schüsseln mit duftendem Braten, frischem Maisbrot und ein Gefäß mit Schokolade auf den Tisch an seinem Lager, auch einen Krug mit Wasser fügte sie hinzu.
Dann entfernte sie sich schweigend.
"Verhungern will man mich also nicht lassen," sagte der Gefangene mit einem Aufblitzen seiner guten Laune und griff trotz seiner Erschöpfung und der düsteren Stimmung, die ihn überkommen hatte - so stark ist der Erhaltungstrieb - herzhaft zu.
Dann aber sank er auf das Lager zurück und schlief ein.
Zweites Kapitel.
Techpo
Guati, der Sohn des Kaziken, und Techpo, wie der weiße Knabe genannt wurde, waren schon weit in das Gebirge nach Westen hin gelangt. Rauhe Berggipfel, mit hochragenden Nadelhölzern bedeckt, zeigten sich ringsum, als sie sich langsam durch ein Tal bewegten.
Beide hatten nicht ein Wort gewechselt während ihres Rittes.
Mürrisch ritt der Indianer einher, ernst sein jugendlicher Gefährte.
"Wir wollen uns nach links wenden," brach endlich Techpo das Schweigen. "Dort oben, wo die Lebenseichen stehen, sah ich vor einigen Sonnen die Fährte eines starken Hirsches."
"Gut, laß uns nach ihm spüren."
Sie wandten ihre Tiere auf einem Pfad zu ihrer Linken, der nach der angedeuteten Richtung führte.
Nach einiger Zeit äußerte Techpo mit leiser Stimme: "Sage mir, Guati, hast du die Berge schon einmal sprechen hören?"
Der Indianer zuckte merklich zusammen und schaute in das ernste unbewegte Gesicht seines Begleiters, nicht ohne einen Ausdruck des Schreckens in den dunklen weitgeöffneten Augen.
"Was meinst du damit?"
"Als ich zuletzt oben in diesen Bergen war, gerade da, wo ich die Spur des Hirsches erblickte, wurde es am hellen Tage plötzlich dunkel um mich her; doch es war nicht Nebel wie ihn die Berge erzeugen, es war ein Dunst, der aus der Erde zu kommen schien. Und nun begannen die Berge zu singen, wild und schauerlich in tiefen, langgezogenen Tönen."
"Es war der Wind," brachte Guati mit bebender Stimme hervor.
"Nein, kein Lüftchen regte sich. Gleich dem Chiko (Jaguar), wenn er seine Stimme in der Nacht erhebt, heulten die Berge, und ich zitterte bis ins Herz hinein. Dann zog eine weiße Gestalt an mir vorüber - riesengroß - ich warf mich zu Boden und glaubte hinabgeschlungen zu werden in die Tiefe. So lag ich lange. Als ich aber den Blick wieder erhob - war es hell und die Sonne schien herab und ein lauer Wind umfächelte mich. - Sag mir, Guati, was dies alles war."
Erst nach längerer Zeit fragte der Indianer, der trotz der ihm angeborenen und anerzogenen Selbstbeherrschung zitterte: "Und dort in jenen Bergen war es?"
Er wies nach der Gegend, zu der sie ihren Weg nahmen.
"Dort. Ich wollte schon die Priester danach fragen, doch ich fürchtete, sie würden mich einen Lügner schelten. Vielleicht weißt du die Erscheinung zu deuten?"
"Ich weiß nichts. Du hast geträumt."
Stumpfsinnig blickte Guati dann vor sich hin, und schweigend ritten sie weiter. Als sie in eine düstere Schlucht einbiegen wollten, die nach oben führte, sagte der Indianer: "Ich habe Druck im Haupte, so daß ich den Weg nicht klar sehen kann - und die Glieder schmerzen - ich werde Rast machen in der Höhle dort, wo die Jäger oftmals lagern. Sieh nach dem Hirsche und wenn du zurückkommst, hole mich ab."
"Ist mein Bruder krank, so wäre es gut, er ginge ins Dorf zurück."
"Nein, der Kazike würde die Stirn runzeln und mich Weichling nennen."
"Wäre es nicht besser, ich bliebe bei meinem Bruder, wenn er Fieber hat?"
"Nein, wir müssen mit Beute zurückkehren, sonst lachen die Männer. Du bist ein großer Jäger und triffst den Hirsch im Sprung; mein Bruder möge jagen und zu mir zurückkommen."
"Wie du willst, Guati; die Götter mögen dich bald gesund werden lassen. Aber ich kann nicht sagen, wann dein Auge mich wiedersieht."
"Ich warte bis du kommst."
"Gut."
Sie waren vor der Höhle angelangt. Guati stieg ab, band sein Maultier an und ließ sich im Grase nieder.
Techpo nahm die Zügel des Saumtieres und sagte: "Die Unsichtbaren mögen dich schützen und mich mit Beute zurückkehren lassen."
Dann ritt er davon. Unfreundlich schaute ihm der Indianer nach und murmelte: "Wenn sie dich nur nicht in den Abgrund stürzen, du weißer Hund! Ich gehe nicht dahin, wo der Erdgott zornig seine Stimme erhebt."
Als Techpo, der sich gar nicht umblickte, durch einen Felsvorsprung dem Gesichtskreise des Indianers entzogen war, veränderte sich sein starres Gesicht; ein spöttisches Lächeln zog darüber hin, und leise sagte er vor sich hin: "Habe ich dich von mir gescheucht, abergläubischer Indio? Fürchtest du deine Götzen? Hahaha! Wie er zitterte!"
Ernster fuhr er fort: "Sie werden den weißen Mann ihren Göttern opfern wollen, darum haben sie mich fortgeschickt. Aber es soll nicht geschehen, wenn ich es zu verhindern vermag; Techpo, wie ihr mich nennt, kennt die Geheimnisse der Priester.
"Die Stunde ist da, wo ich zu den Leuten meiner Farbe zurückkehre, ich bin jetzt stark genug, um den Weg zu finden, und gewinne mir hoffentlich in dem Gefangenen einen Freund und Kampfgenossen. Sie haben mich heucheln gelehrt, die Unmenschen, haben mich gelehrt, nichts von dem zu verraten, was im Herzen vorgeht - ich habe sie alle getäuscht, selbst den schlauen Kaziken. Sie gaben mir die Büchse in die Hand, sie sollen es bereuen. Die geheimen Pfade durfte ich nie betreten - aber ich bin aller Künste dieser schleichenden roten Tiere Meister geworden, sie sollen es erfahren.
"Gelingt es mir, den Weißen zu retten, und ich hoffe es, so suchen wir gemeinsam den Weg in das Land der Christen; vermag ich es nicht, trete ich ihn allein an, ich habe drei Tage Vorsprung. Lebendig kehre ich in dieses Tal nicht zurück. Ich will nicht länger unter diesen furchtbaren Menschen weilen."
Langsam ritt er weiter, bald durch Schluchten, deren Wände himmelan ragten, bald zwischen düsteren Föhrenwälder einher.
Ein Bach kreuzte seinen Weg.
"Sie haben übermorgen ihr dem Kriegsgott geltendes Fest, folgen wird mir deshalb niemand, und vor Guati bin ich sicher, aber es ist besser, ich verberge meine Spur."
Er ritt in den untiefen Bach und folgte seinem Laufe eine große Strecke. Als flacher, kahler Felsboden seine Ufer bildete, verließ er ihn.
"Nun sucht mich," sagte er.
Er nahm jetzt nicht mehr den Weg höher in die Berge, sondern wählte mit großer Sicherheit Schluchten und Waldstrecken, die ihn in fast gleicher Höhe am Gebirge entlang führten.
Als der Mittag nahte, erreichte er ein kleines Tal, in dem zwischen Büschen saftiges Gras sproßte und ein seichter, klarer Wasserlauf seinen Weg suchte.
Techpo stieg ab, pflockte die Tiere mit den Lassos an und suchte sich, den Beutel mit Nahrungsmittel, den er mitführte, an sich nehmend, ein schattiges Plätzchen aus, um zu speisen und zu ruhen. Auch den Tieren war die Rast notwendig. Während sie grasten, sann der Knabe nach.
"Ich hoffe, sie haben den Gefangenen in dem Hause der Priester untergebracht, wie den, den die blutdürstenden Menschen vor zwei Jahren töteten; ich muß es noch heute abend erfahren. Der Weg ist weit durch die Berge, zur Ebene, ich weiß es wohl, aber ich habe jetzt eine Büchse und besitze die Nase eines Spürhundes; ich werde nicht wieder vor Hunger umsinken, wie es geschah, als ich früher entfloh. Die Berge sind jetzt meine Freunde und werden mich schützen.
"Aber," fuhr er traurig fort: "Wenn ich zu den Leuten meiner Farbe komme, wer wird mich noch kennen? Ich bin ein Wilder geworden, und spreche kaum noch die Muttersprache. O arme Mutter, süße Mutter - die Unmenschen haben dich erschlagen - dich und den Vater - oh - oh! Aber hütet euch - der Tag der Vergeltung naht!"
Er versank in Brüten. Dann aber erhob er sich. "Man muß von hier das Dorf sehen können," sagte er.
Mit wunderbarer Kraft und Gewandtheit erstieg er den schroffen Felsen, in dessen Schatten er gelagert hatte.
Als er nach kurzer Zeit dem Gipfel nahte, riß er Gras, das spärlich dort in Spalten wuchs, aus, und zwängte es in das Band, das sein Haar zusammenhielt.
"Sie haben gute Augen, man muß vorsichtig sein."

Techpo folgte dem Laufe des Baches eine große Strecke.
Behutsam kroch er jetzt vorwärts, langsam das von Grashalmen eingefaßte Haupt erhebend, bis er das Dorf fernhin vor sich sah. Er hatte sich demselben allmählich wieder genähert.
Sein Falkenauge unterschied den Terrassenbau des Tempels und erkannte trotz der Entfernung menschliche Gestalten auf dessen Gipfel.
"Sie richten schon den Altar für das Opfer her."
Er stieg dann hinab, entfesselte die Tiere, die, nachdem sie Hunger und Durst gestillt hatten, wieder kräftig waren, schwang sich in den rohen Indianersattel, und das Saumtier am Lasso mit sich führend, setzte er seinen Weg fort.
Er beschrieb einen weiten Bogen um das Dorf, wiederholt Wasserrinnsel und rauhe Wege, die aus dem Dorfe in das Gebirge führten, mit großer Vorsicht kreuzend. Nur ein genauer Kenner der Bodengestaltung vermochte hier Pfade für Mensch und Tier zu finden. Schon senkte sich die Sonne, als er im Osten des Dorfes stand. Mächtige rauhe Felsgebilde, von Höhlen, deren dunkle Öffnungen zu sehen waren, durchsetzt, zeigten sich dem Blick. Darüber weg traf das Auge bewaldete Berge.
"So, wir sind da," sagte der Knabe und verließ den Sattel.
Er ergriff sein Tier am Zügel und führte es einen engen, schroffen Felspfad hinauf, zu einem dunklen Höhleneingang. Er betrat mit dem ängstlich schnaubenden Tier die Höhle, es streichelnd und ihm sanfte Worte in das Ohr murmelnd, um es zu beruhigen.
Willig folgte es seiner Leitung in das Dunkel; das Saumtier zog er am Lasso nach.
Nach kurzer Zeit wurde es hell vor ihm und es zeigte sich eine weite Öffnung, von der ein breiter Pfad in ein liebliches, nur von Felsen umrandetes Tal hinabführte.
Leicht gelangten er und die Tiere in die Tiefe. Gras und Wasser waren dort vorhanden. Er entledigte die Mulos der Sättel und Zäume und ließ sie laufen. Geduldig erwartete er dann die Nacht.
Dunkelheit umgab endlich den Knaben. Düstere Wolken bedeckten den Himmel und verbargen die Sterne. Die Tiere hatten sich niedergelegt.
Techpo erhob sich und schritt mit einer Sicherheit, als ob er im Dunkel zu sehen vermöchte, zu der Höhle empor. Nach einiger Zeit erschien er schattenhaft am anderen Eingang. Die Büchse hatte er zurückgelassen, aber im Gürtel stak die scharfe Machete. Über den Rücken hatte er ein großes Pantherfell geworfen und ein dunkles Tuch umwand sein Haupt.
Ohne Zögern ging er den schmalen Felspfad hernieder, wand sich rasch und geschickt durch Büsche und enge Felspfade hindurch, bis er den Weg erreichte, der von Osten her nach dem Dorfe der Aimaràs führte. Er lauschte. Sein Ohr war ungewöhnlich scharf, aber er vernahm nur das Rauschen des leichten Windes. Er beugte sich nieder und legte das Ohr auf den Boden. Kein Laut berührte es.
Geräuschlos und mit großer Schnelligkeit schritt er dann dem Dorfe zu, nur von Zeit zu Zeit haltend und lauschend; er schien den Weg wohl zu kennen. Endlich sah er das Dorf vor sich im Tale, wahrnehmbar durch einzelne in den Häusern brennende Feuer.
Techpo wandte sich nach links und mit der Geschmeidigkeit und Geräuschlosigkeit des Raubtieres bewegte er sich durch Büsche und kleine Waldstreifen, durch Maisfelder, bis er die Gärten der Bewohner in der Nähe des Tempels erreichte.
Hier hielt er in einem dichten Erlenbusch an, und suchte mit seinen Augen das Dunkel zu durchdringen.
Die Indianer sind keine Freunde der Nacht, vor allem nicht die, die noch im alten Aberglauben leben - der Knabe durfte annehmen, daß kaum jemand im Freien sein würde.
Er verließ sein Versteck und schlich nach den Gebäuden hin, die den Tempel umgaben. Durch eine roh gefügte Tür fiel Lichtschein.
Er brachte sein Auge an eine Öffnung und sah vier Indianer um ein niedergebranntes Feuer sitzen. Jetzt wußte er, der Gefangene wurde im Nebengemache verwahrt. Dann umkreiste er die niedrigen Häuser; die wenigen Bewohner schienen zu schlafen. Es waren die Priester der Horde, die hier hausten.
Unbemerkt wie er gekommen war, schlich er zurück. Er suchte das Haus des Kaziken auf, das von einem Garten umgeben war, er kannte die Lücke in der Hecke, glitt hindurch und betrat gleich darauf das ihm wohlbekannte Haus. Nach einiger Zeit erschien er wieder, eine Büchse, eine Machete und einen Kugelbeutel in der Hand.
Staunenswert war die Sicherheit, mit der sich der schlanke Knabe in der Dunkelheit einherbewegte. Er ging nach dem Erlenbusch und legte dort die Büchse nieder, nachdem er sie untersucht und sorgfältig geladen hatte.
Dann schritt er zu dem Tempel, der ganz verlassen dalag; die Priester schliefen in ihren Häusern, und die anderen hielt selbst am Tage ehrfurchtsvolle Scheu von dem Gebäude fern.
Er ging die Stufen hinauf, die zu der ersten Terrasse führten, und betrat dort eines der nur den Priestern zugänglichen Gemächer, die sich dort auftaten.
Mit der Sicherheit, die bisher jeden seiner Schritte geleitet hatte, erfaßte er hier, sich niederbückend, den an einer Steinplatte des Bodens befestigten eisernen Griff und hob die schwere Platte, die sich in Angeln bewegte, auf.
Nur ein an das Dunkel gewöhntes Auge vermochte zu erkennen, daß hier eine Treppe in die Tiefe führte.
Als er den Fuß hob, hinabzusteigen in das Erdgeschoß, machte ein Geräusch ihn beben; er glaubte Atemzüge zu vernehmen, die aus der Tiefe zu ihm empordrangen.
Er lauschte. Die Sinneswerkzeuge des Knaben waren in den Jahren seines Aufenthaltes unter diesen Indianern zu einer ungewöhnlichen Feinheit ausgebildet worden - es war kein Zweifel, unter ihm atmete es, es mußte ein Mensch sein, von dem die Laute stammten.
Wahrscheinlich war es ein Priester oder ein Tempeldiener, der dort unten weilte. Nur einer von diesen durfte es wagen, die unterirdischen Räume des Tempels zu betreten, von denen außer ihnen nur noch wenige der älteren Indianer Kenntnis hatten. Dem klugen und mutigen Knaben, der frei war von dem Aberglauben der Wilden und die Nacht nicht gescheut hatte, um, so oft es die Umstände erlaubt hatten, Untersuchungen überall da vorzunehmen, wo er sie in seinem Interesse für geboten hielt, waren weder diese Räume noch der unterirdische Gang verborgen geblieben, der zu den Häusern der Priester führte und direkt unter dem Zimmer endete, in dem der weiße Gefangene verwahrt wurde.
Schon wollte er die aufgehobene Platte vorsichtig in ihre wagerechte Lage zurückbringen, als von unten einige Worte zu ihm drangen, die zwar sicher einem indianischen Idiom, aber nicht der Aimaràsprache angehörten. Ein einziges Wort verstand er: "Ruha."(Wasser)
Er hielt die Platte fest, bereit, sie wenn nötig, sofort zuzuschlagen und fragte verwundert: "Wer bist du?"
Eine Entgegnung folgte, die Techpo nicht verstand, aber er zuckte zusammen, als es dann zu ihm emporklang: "O santissima madre!"
In spanischer Sprache tönte es zu ihm herauf: "Weißt du das nicht? Weißt du nicht, daß ich hier gefangen liege? O gib mir Wasser, wenn du ein Mensch bist."
"Ja, ja. Doch sage mir, wer du bist, du sprichst zu einem Freunde."
"Ich bin ein Mann aus den Niederlassungen am Cumana, wurde gefangen genommen und hierher geschleppt von den Heiden."
"Bist du ein Indianer?"
"Mein Vater ist ein Spanier, meine Mutter eine Indianerin; sie ist die Tochter des Alkalden in Arepa an der Sierra madre."
"Ich komme zu dir."
Rasch schritt der Knabe hinab in den dunklen Raum. Schattenhaft sah er dort eine menschliche Gestalt an der Wand kauern. Deren gezwungene Haltung fiel ihm auf. In flüsterndem Tone fragte er dann: "Bist du gebunden?"
"Ja, die Hände sind umschnürt und mit meinem Leibe bin ich an die Wand gefesselt."
"Wann bist du gekommen?"
"Heute, am Morgen."
Der Gefangene sprach geläufig die spanische Sprache.
"Bist du mit dem weißen Mann gekommen?"
"Nein, ich habe keinen Weißen gesehen. Ich bin, während ich in den Bergen der Sierra madre jagte, von diesen Banditen gefangen genommen, nachdem sie zwei meiner Begleiter meuchlerisch erschlagen hatten, und hierhergeführt worden. Deine Stimme klingt mir angenehm ins Ohr, du bist kein Indianer."
Techpo sann nach.
Wenn er den Fremden errettete, gefährdete er nicht dadurch seine Absicht, dem gefangenen Weißen Hilfe zu bringen? - Da der Fremde nichts von diesem wußte, mußte er nach ihm eingetroffen sein. Die Aimaràs hatten also zwei Gefangene gemacht. Sein Aufenthalt im Tempel ließ darauf schließen, daß auch er zum Opfertode bestimmt sei.
"Wenn du ein Christ bist," klang die klagende Stimme des Gefangenen zu ihm, "so rette mich."
"Ich will es versuchen. Gib mir deine Hände."
Der Gefangene reichte sie ihm. Techpo betastete die Umschnürung, fand den Knoten des Riemens, löste ihn mit leichter Mühe und lockerte die Fessel, ohne sie abzunehmen.
"Bleibe so, bis ich zurückkomme, ich hoffe deinen Wunsch erfüllen zu können und dich zu retten."
"Der Himmel möge es dir lohnen."
"Verhalte dich schweigend."
"Ja."
"Hier hast du auch Wasser für deinen Durst."
Er reichte ihm den Krug, den er trotz der Dunkelheit sah, dessen der Gefangene, selbst wenn er ihn bemerkt hätte, sich seiner Fesseln wegen nicht hätte bedienen können, und schlüpfte in den schmalen Gang, der in den kellerartigen Raum mündete, und verschwand geräuschlos.
Die Priester der Aimaràs benutzten diesen Gang, um ungesehen von der Menge sich nach dem Tempel zu begeben. Vermutlich sollte auch der weiße Gefangene diesen Weg nehmen, wenn er zum Opfertode geführt wurde.
Drittes Kapitel.
Die Befreiung der Opfer
Der junge Spanier war im Laufe des Nachmittags aus seinem festen Schlummer durch das Eintreten des Kaziken und zweier älterer Indianer mit grausamen Zügen, denen das lange Haar in Zöpfen geflochten um das Gesicht hing, erweckt worden.
Er starrte in dem Dämmerlicht, das ihn umgab, auf die vor ihm auftauchenden Gestalten. Als er den Kaziken erkannte, sagte er fröhlich: "Ah, mein Freund, du hast dir die Sache überlegt; sehr verständig. Also, was koste ich? Ich hoffe, du schätzest mich weniger hoch ein als ich mich selbst taxiere. Was verlangst du würdiges Oberhaupt dieser trefflichen Menschen?"
"Wir möchten erfahren, wie dich die Weißen nennen. Du sagtest, du seiest der Sohn eines großen Häuptlings deines Volkes."
"Ich sagte dir auch die Wahrheit, ich bin Fernando de Mosquera, der Sohn des Gobernadors von Santander, und mein Vater wird deine Wünsche erfüllen."
"Wir bedürfen deiner Schätze nicht," erwiderte der Kazike. "Die Priester sind hier, um dich zu sehen."
Don Fernando warf einen Blick auf die widerwärtigen, mit silbernen Zieraten geschmückten Gestalten, aus deren Gesichtern ein tierischer Stumpfsinn sprach, während sie ihn mit den dunklen Augen anstarrten, und sagte dann, seinen Widerwillen bekämpfend: "Es ist mir eine Ehre, die beiden geistlichen Herren bei mir zu sehen, obgleich sie mit unseren Curas recht wenig Ähnlichkeit haben. Indessen wird mein Vater nicht säumen, auch ihre Wünsche zu erfüllen, die beiden Herren sollen nur angeben, was sie bedürfen."
"Sie bedürfen nur deiner selbst, Spanier," sagte der Kazike. "Dir soll die Ehre zu teil werden, auf dem Altar des Kriegsgottes, dem wir in allem Unglück treu geblieben sind, zu sterben als Opfer für den Gott. Sie sind gekommen, um zu erkennen, ob du mit Mut sterben wirst."
Der junge Mann erschrak sichtlich.
"Als Opfer für euern Kriegsgott - die Ehre, teuerster Herr, ist gewiß sehr groß" - das Beben seiner Stimme bewies seine innere Erregung, denn ihm war nicht unbekannt geblieben, daß im Gebirge Stämme hausten, die noch ihren alten grauenhaften Opferdienst pflegten, "aber ich bin der Ehre durchaus nicht würdig. Sollte euer Kriegsgott nicht Gold, Silber, schöne Sättel und Zäume, Decken und Büchsen viel lieber als Opfer nehmen, als einen unbedeutenden Menschen wie mich?"
Der Kazike wechselte einige Worte in der Aimaràsprache mit den Priestern, deren Gesichtszüge nicht verrieten, ob sie verstanden hatten, was der junge Mann sagte. Diese erwiderten etwas und gingen hinaus.
"Der Gott braucht die Dinge nicht, die du aufzählst," sagte der Kazike, "aber er liebt das blutende Herz eines Weißen, und du mußt dich glücklich preisen, es ihm darbieten zu dürfen."
"Ich danke dafür," murmelte der junge Mann mit bitterer Ironie.
"Iß und trink und sei guter Dinge, Weißer," sagte der Kazike und folgte den Priestern.
Don Fernando blieb in leicht erklärlicher Aufregung zurück. Er hatte sich trotz der Schrecken der Gefangenschaft unter diesen indianischen Räubern doch mit der Hoffnung getröstet, daß ein Lösegeld ihn rasch befreien würde. Sollten diese entmenschten Wilden, die so einsam im Gebirge hausten, ihn wirklich ihrem Aberglauben opfern wollen?
Er schauderte zusammen - er hatte nicht die geringste Lust zu sterben.
Verzweiflungsvoll sah er sich in dem Raume um, der ihm zum Aufenthalte angewiesen war.
Kahle Wände - eine unerreichbare Fensteröffnung, draußen bewaffnete Wächter.
Flucht war augenscheinlich unmöglich. Selbst wenn es ihm gelang, sein Gefängnis zu verlassen, wo sollte er hin in dem wüsten Gebirge ohne Waffen, eine fanatische, blutdürstige Bevölkerung um sich her?
Die alten Weiber traten wieder herein und brachten reichlich Speise und Trank. Beim Öffnen der Tür sah Don Fernando seine Wächter, die ihn, wie es ihm schien, behaglich angrinsten. Die Lust zu essen hatte er verloren, aber er trank lange und hastig aus dem mit Wasser gefüllten Kruge.
Dann warf er sich auf sein Lager und Schreckensbilder durchzogen sein Gehirn.
Er hatte von der Grausamkeit der Gebirgsstämme, die seit der Revolution gänzlich verwildert und vollständig unabhängig geworden waren, erzählen hören. Wußte, daß diese von Zeit zu Zeit aus ihren Schlupfwinkeln herauskamen und dann weder Weiße noch auch ihre sich zum Christentum bekennenden Stammesgenossen schonten. Es war ihm jetzt kein Zweifel, daß er unter eine solche Horde geraten war. Er schauderte, wenn er sich das Bild der beiden Männer zurückrief, die der Kazike Priester genannt hatte und der Worte des Häuptlings. Geopfert? Das ist abgeschlachtet zu werden? Und keine Hilfe? Unaufhörlich düstere Gedanken durch den Kopf wälzend, warf er sich auf seinem Lager unruhig hin und her.
Die Nacht kam und er merkte es nicht.
Vor der Tür seines Gefängnisses hatte man Feuer angezündet, er sah es an dem Lichtschein, der durch die Ritzen drang.
Die Zeit ging hin und er gewahrte es kaum, unaufhörlich malte er sich ein grauenhaftes Ende aus.
Er begann voll tiefster Inbrunst zu beten.
Ängstlich lauschte er oftmals. Ringsum war alles totenstill.
Er erhob sich leise, schlich unhörbar zur Tür und legte sein Ohr daran. Er hörte die Wächter atmen, aber ob sie schliefen oder wachten, vermochte er nicht zu unterscheiden.
Er faßte den verzweiflungsvollen Gedanken, hinauszustürzen und zu versuchen, das Freie zu erreichen.
Ein seltsamer Laut, ein leises Knirschen berührte sein Ohr, es kam von der Wand hinter ihm. Was war das?
Wie ein Hauch drang es jetzt zu ihm her in spanischer Sprache: "Schläfst du?"
Er bebte in fieberhafter Erregung von oben bis unten.
Wo kam der Laut her? - Er schien aus der Erde zu dringen.
Don Fernando neigte das Haupt nach der Seite hin, woher der Ton kam und flüsterte: "Nein."
"Komme hierher - langsam - leise."
Es war, trotzdem Licht durch die Ritzen der Tür zu erkennen war, ganz dunkel in der Zelle. Zitternd, Schritt vor Schritt ging er vorsichtig nach der Ecke zu, von dort kam die Stimme.
"Wo bist du?"
"Hier."
"Was willst du?"
"Dich retten."
Mit Mühe unterdrückte Don Fernando einen Freudenschrei; schon die spanischen Laute hatten ihm gesagt, daß er einen Freund vor sich habe.
"Beuge dich zur Erde, vorsichtig, sprich nicht mehr."
Der junge Spanier ließ sich langsam nieder, eine Hand berührte ihn, und nur seinem angstvoll lauschenden Ohre verständlich erklang es: "Hier ist eine Öffnung am Boden, du findest eine Treppe. Taste und komm herab."
Don Fernando tastete mit den Händen, fühlte mit grenzenlosem Entzücken eine viereckige Öffnung im Boden und eine Stufe. Mit größter Vorsicht setzte er seine Füße auf die oberste Treppenplatte und stieg die Stufen hinab in das Dunkel. Wieviel wußte er nicht, er war halb betäubt. Jetzt fühlte er eine menschliche Gestalt neben sich.
"Bleibe," hauchte es in sein Ohr, "ich will die Öffnung schließen." Er erriet mehr als er es sah, daß sein unbekannter Freund die Stufen hinaufging und die Öffnung oben schloß, nur ein leises Knirschen gab davon Kunde.
Eine Hand faßte die seine.
"Folge mir."
Willenlos folgte der erregte Gefangene der Hand, die ihn führte, durch einen sich windenden Gang und betrat mit seinem Führer den Raum, in dem der Mestize weilte.
"Keinen Laut, noch ist Gefahr."
"Was hast du mit uns vor? Wer bist du?"
"Ein Gefangener dieser Roten, gleich euch. Ihr sollt morgen geopfert werden, abgeschlachtet zu Ehren ihres Götzen; ich rette euch oder wir sterben zusammen."
Techpo befreite den Mestizen von der Fessel, die ihn an der Wand hielt.
"Und nun folgt mir, es ist keine Zeit zu verlieren."
Techpo stieg rasch hinauf, eilig folgten Don Fernando und der Halbindianer.
Sie standen in dem Gemache auf der Terrasse des Tempels. Techpo schloß die Öffnung vorsichtig. Er flüsterte den beiden, die sich selbst in der Dunkelheit mit forschenden Blicken maßen und gleichzeitig ihren Retter zu erkennen suchten, zu: "Dicht hinter mir gehen, leise. Kommt jemand uns in den Weg, werft euch zu Boden; muß gekämpft werden, übt keine Schonung, unser Leben ist verfallen."
Er wandte sich nach der den Priesterhäusern abgewandten Seite des Tempels und schlich geräuschlos voran, dicht folgten ihm, lautlos, Don Fernando und der Mestize.
Sie erreichten das Erlengebüsch, Techpo hob die Büchse auf und übergab dem Mestizen die Machete.
"Fort, die Nacht schreitet vor, bald kommt der Tag, bleibt dicht hinter mir, lautlos."
Schnell schritt der Knabe voraus, mit unfehlbarer Sicherheit den Weg wählend.
Von den Priesterhäusern her tönten Stimmen durch die Nacht und eiliges Hin- und Herrennen von Menschen.
"Deine Flucht ist entdeckt," sagte Techpo zu dem Spanier.
"O, hätte ich eine Waffe," seufzte Don Fernando, "ich möchte nicht wehrlos sterben."
"Nimm meine Machete." Der Knabe reichte ihm die Waffe.
"Vorwärts - wir müssen die Felsen gewinnen - verfolgen wird uns niemand, sie werden an einen Zauber glauben."
Sie eilten weiter.
Vom Tempel her tönte jetzt durch die Nacht der dumpfe, aber weithin hallende Ton eines Hornes, der, ein Zeichen drohenden Unheils, alle Schläfer in dem Tale der Aimaràs weckte.
In den zerstreuten Häusern der Indianer flammten Lichter auf.
"Schnell."
Jetzt wurde es auch lebendig in den Gärten und man vernahm Stimmen.
Das Horn ließ sich fort und fort vernehmen. Eine Gestalt tauchte schattenhaft zu ihrer Rechten auf. Stimmen erklangen.
"Zur Seite! Hinter den Busch! Nieder!"
Dem Anruf gehorchend, schlüpften alle drei hinter den von Techpo bezeichneten Busch und beugten sich zur Erde.
Sieben bis acht Männer huschten an ihnen vorbei und liefen dem Tempel zu, von dessen Höhe immerfort das dumpfe Horn herabklang.
"Presto amigos, der Tag kommt heran."
Sie stürmten unter Techpos Führung dahin. Von neuem kamen ihnen Männer entgegen, diesen war nicht auszuweichen.
"Kämpfen!" sagte der Knabe.
Die Aimaràs stutzten, als sie die drei Gestalten der Flüchtlinge, die so eilig herankamen, erspähten, und einer rief ihnen zu: "Halt!"
Doch Techpo stieß einen gellenden, weithin hallenden Schrei, den Kriegsruf eines benachbarten in den Bergen wohnenden Stammes, der seit Menschenaltern mit den Aimaràs in Todfeindschaft lag, aus.
Dies erschreckte die Aimaràs, die, durch das warnende Horn von einer Gefahr unterrichtet, jetzt, als sie den Kriegsruf der Chibchas hörten, den Feind mitten im Dorfe glaubten. Sie verschwanden im Dunkel.
Mit aller Kraft weiter strebend, erreichten jetzt die Flüchtlinge den Rand der Felsen. Noch war es dunkel.
"Geht dicht hinter mir, wir dürfen keine Spur hinterlassen," flüsterte der Knabe, und gehorsam folgten ihm die beiden anderen auf den Fersen über nacktes Felsgestein.
Techpo bog nach links ein und stieg in einer schmalen Felsrinne nach oben.
Sie war sehr steil und der hinter ihm gehende Spanier kam schwer fort. Techpo, dies gewahrend, reichte ihm die Hand, der nachfolgende Mestize, der des Bergsteigens gewohnt schien, unterstützte Don Fernando und schwer atmend erreichten die drei nach Anspannung aller ihrer Kräfte endlich ein kahles Felsplateau. Sie überschritten es in einer geraden Linie, um dann über einen schmalen Felsgrad hin, der besonders in der Dunkelheit nur mit Lebensgefahr zu überschreiten war, auf ein anderes höher gelegenes Felsplateau zu gelangen.
"So, jetzt sind wir einstweilen sicher," sagte der Knabe, "hier werden sie uns nicht vermuten, und sollten sie unsere Spur haben, über den Felsgrad traut sich keiner von ihnen. Aber wir müssen weiter, ehe die Sonne aufgeht, wir haben noch eine gefährliche Stelle vor uns."
Mit ungeminderter Kraft schritt der Knabe voran, mit Mühe nur folgte ihm der erschöpfte Spanier und selbst der Mestize zeigte, daß seine Spannkraft nachließ.
Schon wich die Nacht und die ersten roten Strahlen zuckten über den Horizont, als die Flüchtigen den Rand des mit Steinen übersäten Plateaus erreichten und in eine Schlucht hinabsahen, die jenseits wilde Felsformationen zeigte, die von düsterem Koniferenwald überragt waren. Deutlicher konnten die drei Flüchtlinge, die ein seltsames Schicksal hier auf der Höhe der Kordilleren vereinigt hatte, sich gegenseitig betrachten.
Mit Staunen sah Don Fernando den schönen Knaben vor sich, dessen Gestalt durch die indianische Tracht sehr vorteilhaft gehoben wurde.
Techpo blickte in des erschöpften Spaniers Antlitz, glücklich einen Weißen zu sehen, einen Jüngling, dessen Äußeres ihn symphatisch anmutete.
Neben ihm stand der Halbindianer, dessen bronzefarbene Züge seine Verwandtschaft mit den Ureingeborenen verrieten. Sein gutgeformtes Gesicht zeigte Klugheit und Energie, seine schlanke, in einen einfachen Jagdanzug gehüllte Gestalt sehnige Formen. Sein dunkles Auge ruhte mit Staunen auf Techpos jugendlichem Äußeren, seinem indianischen Putz.
Doch nur einen kurzen Augenblick dauerte diese gegenseitige Musterung der drei jungen Leute, die hier im rötlichen Schein des kommenden Tageslichts auf kahler Felshöhe standen.
"Quer vor uns ist ein oft begangener Pfad," flüsterte Techpo, "ich will hinunter und spähen, dort ist der Weg, der hinabführt, er ist leicht zu begehen. Lasse ich den Schrei des kreisenden Adlers hören, folgt mir."
Hierauf stieg er hinab und entschwand den Augen der beiden anderen.
Nun lauschten diese auf das Zeichen, das sie hinabrufen sollte.
Nach kurzer Zeit erklang der täuschend nachgeahmte helle Schrei des Raubvogels.
"Laßt mich vorangehen, Sennor," sagte der Mestize, "ich bin mit den Felsen vertrauter als Ihr."
"Geh, Amigo, ich bin todmüde."
Der Mestize stieg hinab und vorsichtig folgte ihm der Spanier.
Sie gelangten ohne große Mühe in die Tiefe der Schlucht, wo der Knabe sie erwartete.
"Vorsichtig, wir müssen dort schräg hinüber," er deutete auf eine Einbuchtung in der gegenüberliegenden Felswand. "Tretet nur auf Steine, sie sind schlau, die Bandidos."
Seinem Winke folgend und mit großer Vorsicht die Füße nur auf die durch die Schlucht verstreuten Steine setzend, gelangten sie hinüber, wo ihrer in einer Felsenrinne, die dem strömenden Regen als Abfluß dienen mußte, ein neuer Aufstieg harrte, der sich glücklicherweise minder schwierig und anstrengend erwies als der erschöpfte Spanier befürchtet hatte.
Nach kurzer Zeit waren sie oben und alle drei verschwanden im Dunkel des Waldes.
"Habt ihr noch Kräfte, eine Legua zurückzulegen?" richtete Techpo die Frage an den Spanier - "dann sind wir in voller Sicherheit und können ruhen."
"Vorwärts, Amigo - ich halte noch aus. Ein gütiges Geschick hat mir in dir" - er blickte mit dem Ausdruck freudiger Rührung in des Knaben Gesicht - "den rettenden Engel gesandt."
"Ja, Sennorito - Sennor spricht wahr - und das Geschick sei gepriesen. Antonio Minas wird nie vergessen, was Ihr für ihn getan habt."
Lächelnd reichte Techpo beiden die Hand und sagte einfach: "Ich bin glücklich, euch den Ladrones entrissen zu haben, was noch kommt, tragen wir gemeinsam."
Nach einer Stunde erreichten sie das stille, liebliche Tal, in dem die Maultiere Techpos weideten.
"Hier ruht aus, hier sind wir sicher - kein Indianer wagt es, dieser Höhle und diesen Felsen zu nahen, sie glauben sie von bösen Geistern bewohnt."
Er entnahm dem Beutel, den er mitgeführt hatte, gedörrtes Fleisch und Maiskuchen.
"Eßt, wenn ihr Hunger habt - ich muß schlafen, ich eile seit vielen Stunden durch die Berge."
Er suchte eine geschützte Stelle, wo das Gras hoch wuchs, wickelte sich in seinen Poncho und war gleich darauf eingeschlafen.
Don Fernando, der sich kaum noch auf den Füßen halten konnte, und der Mestize folgten, ohne auch nur die dargebotenen Speisen zu berühren, seinem Beispiele und suchten im Schlafe Erholung nach großer Anstrengung.
Viertes Kapitel.
Die Flucht
Der klare Quell, der durch das Tal rann und seinen Abfluß durch Felshöhlungen unterirdisch suchte, murmelte sein eintöniges Lied - der Wind rauschte leise über die Felsen hin und freundlich schien die Sonne vom unbedeckten Himmel in das lauschige Tal hernieder, das die Flüchtlinge barg. - Erst nach Stunden erhob der Knabe das Haupt, schaute sich um und stand dann auf. Sein Auge weilte mit inniger Teilnahme längere Zeit auf den Schläfern, die er dem Tod entrissen hatte, besonders auf dem hübschen Gesicht des Spaniers. Dann nahm er seine Büchse und erkletterte an ihm bekannter Stelle die Felswand nach Norden hin. Sich zwischen Gräsern niederkauernd, durchspähte er die an deren Fuß hinführende Straße, den einzigen Weg auf viele Meilen hin, der Zugang zu dem Tale der Aimaràs gewährte.
Sein Auge gewahrte nichts Lebendes.
Er ging zurück und nahm den Weg nach der Straße, den er am Abend vorher eingeschlagen hatte. Vorsichtig betrat er ihn und forschte auf dem Grunde nach Spuren.
Weder Pferd noch Mensch hatten den Weg seit gestern betreten.
Hufschlag berührte sein feines Ohr - der vom Dorfe herkam. Die Felsen mußten ihm den Herannahenden verborgen haben, als er nach dem Dorfe hinblickte.
Schnell erkletterte er den Fels und verbarg sich hinter Büschen, er machte die Büchse schußbereit und legte sie neben sich. Dann ergriff er einen Stein von der Größe einer starken Mannesfaust.
"Sie senden Botschaft an die Wächter," sagte er leise vor sich hin - "sie darf nicht ankommen oder wir sind verloren."
Er lauschte.
"Es ist nur ein Pferd."
In scharfer Gangart nahte ein Reiter, dem das lange Haar wild um das Haupt flatterte. Techpo erkannte ihn, es war einer der älteren Bewohner des Tales, ein Mensch von finsterer, grausamer Gemütsart.
Auf kaum zehn Schritt jagte der Mann an ihm vorbei. Der Knabe hob den sehnigen Arm und schleuderte den Stein von oben hernieder.
Am Hinterhaupt getroffen, sank der Mann vornüber und fiel dann schwerfällig aus dem Sattel.
Techpo sprang in den Hohlweg, die blitzende Machete in der Hand, und stand neben dem gestürzten Mann, von dessen Hinterhaupt Blut triefte.
Der Flüchtling lauschte, bewegungslos harrend, auf ein Zeichen des wiederkehrenden Bewußtseins. Der Mann war tot.
Einen Augenblick dachte Techpo daran, dem Toten Büchse und Kugelbeutel zu nehmen, doch unterließ er es.
"Sie müssen glauben, ein Stein, der sich vom Berge gelöst hat, habe ihn erschlagen."
Das wohlgeschulte Pferd des Indianers war in einiger Entfernung stehen geblieben. Techpo, dem das Tier bekannt war, lockte es mit Schmeichelworten leicht an sich. Vorsichtig tilgte er seine Fußspuren, schwang sich dann in den Sattel und ritt langsam weiter.
In der nächsten Schlucht zu seiner Rechten bog er ein.
Als er auf Felsboden gelangt war, stieg er ab und leitete das Tier über rauhe Pfade zu der Höhle und durch diese in das Tal, in dem er die Schläfer zurückgelassen hatte.

Der Knabe hob den Arm und schleuderte den Stein.
Er fand seine Gefährten munter. Verwundert blickten diese auf das indianisch gezäumte Pferd.
Techpo erklärte, wie er in dessen Besitz gekommen.
Die Hörer staunten über die stoische Ruhe, mit der er den aufregenden Vorfall berichtete.
"Wir können uns glücklich schätzen," sagte er dann, "die Botschaft an die Wächter von unserer Flucht ist zunächst verhindert. Hoffentlich gelingt es, ihre Augen blind zu machen, denn sie behüten den einzigen Pfad, der nach Osten hin einem Pferd den Durchgang erlaubt." Er zündete dann mit Hilfe von Stahl und Stein und trockenem Reisig Feuer an und bereitete aus Vorräten, die er für seine geplante Flucht sorgfältig in der Höhle aufgespeichert hielt, aus gedörrtem Fleisch und Maismehl das Frühstück in einem irdenen Topfe, den er mit sich geführt hatte. Es mundete den Flüchtlingen, die ausgeruht hatten, vortrefflich. Der junge Spanier, dem der düstere Ernst des über seine Jahre kräftigen Knaben aufgefallen war, der so wenig zu seinen jugendlichen Zügen paßte, wie ihm dessen Energie und Entschlossenheit Bewunderung abnötigten, fragte nach beendetem Mahle, das schweigend verzehrt ward: "Wie nenne ich dich, mein teurer Retter?"
"Nenne mich Alonzo, so nannten mich einst die Meinen."
"Weilst du schon lange unter diesen Wilden?"
Die dunklen Augen des Knaben blickten traurig vor sich hin, dann erwiderte er: "Ja, lange, viele Jahre, wie viel weiß ich nicht."
"Doch du bist noch so jung."
"Ja, ich glaube."
"Wie bist du unter diese Wilden gekommen? Hat man dich geraubt?"
Mit einer eisigen Starrheit in den Zügen sagte Alonzo: "Sie haben die Meinen erschlagen und mich davongeführt." Nicht ein Zug bewegte sich in seinem Gesicht bei diesen Worten.
"Welch ein Schmerz für dich! Erschlagen?"
"Ja, Vater, Mutter, Geschwister - alle."
Entsetzlich wie die Mitteilung, die eine Welt von Jammer barg, war die stoische, finstere Ruhe, mit der sie gemacht wurde.
Don Fernando war davon so erschüttert, daß er erst nach einiger Zeit äußerte: "Aber du hast noch Angehörige, die sich nach dir sehnen?"
"Ich weiß es nicht, ich sehne mich nur fort von diesen Mördern." Der Ausdruck seines Gesichtes veränderte sich plötzlich. "Aber sie sollen es büßen, ich bin stark und werde stärker. Vater, Mutter haben sie mir getötet und meine Seele langsam in diesen Jahren gemordet, daß ich nicht mehr denken, kaum noch beten kann, sie sollen es büßen."
Er schüttelte die Faust nach dem Dorfe hin. Dieser Ausdruck des Zornes war umso überraschender, als er in schroffem Gegensatz zu der stoischen Ruhe stand, die der Knabe gleich den Eingeborenen sonst zur Schau trug.
Alonzos Züge nahmen ihren gewöhnlichen Ausdruck wieder an und fast weich sagte er: "Ich fühle mich glücklich, daß ich geschützt blieb vor völliger Umnachtung des Hauptes."
"Du wirst mit mir kommen, Don Alonzo, das Haus meines Vaters wird dir ein Asyl gewähren und fortan deine Heimat sein, er ist reich und mächtig."
"Ein gütiges Geschick wird dich zu ihm führen, aber der Weg ist lang durch die Berge zur Ebene hinab und die Aimaràs sind flink in der Verfolgung."
"Oh" - sagte gutgelaunt Don Fernando, "ich bin froh, daß ich durch deine Hilfe diesen unheimlichen Priestern entgangen bin, die mich anstarrten wie ein wildes Tier. Hatten sie wirklich die Absicht, mich ihren Götzen zu opfern?"
"Zweifle nicht daran, sie lechzten nach deinem Blute."
"Ich wundere mich, daß sie dich am Leben ließen."
"Sie warteten wohl, bis ich zum Manne erwachsen war, ehe sie mich opferten."
"Nun bin ich wie durch ein Wunder dem Messer dieser Baalspriester entronnen. Wird die Flucht aus den Bergen auch gelingen? Lebendig," setzte er entschlossen hinzu, "sollen sie mich nicht haben. Erreichen sie uns, wollen wir kämpfen bis zum letzten Augenblick."
"Ja," sagte der Mestize, "dann kämpfen wir, auch ich ziehe den Tod im Kampfe dem auf dem Opferaltare vor."
"Ich kenne den Weg, der nach den Llanos führt, nur noch eine Strecke weit," sagte Alonzo.
"Wir werden ihn weiter verfolgen, und tiefer hinab kenne ich die Berge und Schluchten, ich bin ein Montanero (Bergbewohner)."
"Doch du stammst aus den Llanos, Sennor, wenn ich dich recht verstand?" fragte Alonzo den Kreolen.
"Nicht ganz, ich entstamme dem Norden des Staates, da wo die Ostkordilleren sich erheben, doch habe ich freilich einen Teil meines Lebens in den Llanos zugebracht."
"Wie bist du in diese Berge gekommen?"
"Jägerlust und Freude am Umherstreifen trieb mich in das Gebirge."
"Doch warst du allein?"
"Nein, ich hatte drei Begleiter bei mir, Indios aus den Vorbergen, die ich dort gemietet hatte, als die Wilden, die du Aimaràs nennst, uns in einem Tale überraschten. Meine Begleiter entflohen und ließen mich in die Gewalt dieser braunen Räuber fallen."
"Sie werden nicht weit gelangt sein," sagte Alonzo ernst, "die Aimaràs lassen keinen entkommen, der es verraten könnte, daß sie einen Weißen in die Berge geschleppt haben."
"Oh," fragte erschreckt Don Fernando, "meinst du, daß sie sie getötet haben?"
"Ich zweifle nicht daran."
"Oh, oh, welche Bluthunde! Das tut mir doch leid, obgleich die Indios mich schimpflich verließen."
Es fiel bei dieser Unterredung sowohl Don Fernando als Antonio, dem jungen Mestizen, mehr als vorher, wo Aufregung ihre Seelen füllte, auf, daß ihr Retter nur mühsam das Spanische beherrschte, nach Ausdrücken suchte und oft plötzlich in die Sprache der Aimaràs überging, scheinbar ohne es zu merken. Sie erklärten sich dies aus seiner langen Gefangenschaft unter den Wilden leicht, doch sahen sie es nicht minder als ein beklagenswertes Zeichen an, welchen Einfluß die Umgebung des Knaben auf seine Seele geübt hatte. Auch das tiefinnere Wohlgefallen, mit dem er den spanischen Lauten lauschte, wenn sie sprachen, entging ihnen nicht.
"Wie denkst du nun der Falle, die uns erwartet, zu entschlüpfen, Don Alonzo?" fragte der Kreole.
"Wir müssen die Nacht abwarten und dann sehen, - der Weg, der am Wächterhaus vorbeiführt, ist sehr eng und sehr gefährlich, wenn die Krieger dort wachsam sind."
"Ich vertraue mich ganz deiner Führung an, amigo mio."
"Ist das Wächterhaus nicht zu umgehen?"
"Für Menschen wohl, obgleich der Weg sehr gefährlich ist, nicht für den Pferdehuf, und ohne Pferde kommen wir nicht weit, wenn wir die Aimaràs auf den Fersen haben."
"So daß wir also immer noch in einer schlimmen Lage sind?"
"Ja - doch wir sind drei entschlossene Kämpfer und wir müssen uns im Notfall den Durchgang erzwingen. Eure Flucht werden die Aimaràs sich schwerlich enträtseln können, sie werden sie bösen Geistern zuschreiben, denn keiner weiß, daß ich den unterirdischen Gang zu den Priesterhäusern kenne, auch glauben sie mich auf der Jagd. Vielleicht kommt uns ihr Aberglauben zu gute."
"Du bist klug und tapfer, junger Freund, ordne an, was du für das beste hältst. Kommt es zum Kampfe, wirst du sehen, daß ich meinen Mann stelle."
"Es ist gut. Haltet euch jetzt still hier, erklettert ja die Felsen nicht, man könnte euch sehen. Ich will den Weg beobachten und die Berge durchspüren."
"Sei vorsichtig, Freund, denn ohne dich sind wir verloren."
"Ich bin's, auch ich sehne mich danach, das Land der Weißen wieder zu sehen."
Alonzo entfernte sich durch die Höhle.
"Ein kühner, stolzer Knabe," sagte Don Fernando, "den ein so furchtbares Geschick unter diese Wilden geschleudert hat -, freilich zu unserem Glück, zu unserer Rettung."
"Er ist weit über seine Jahre besonnen, klug und tapfer," erwiderte der Mestize, "doch es deucht mir Zeit für ihn, daß er in sein Vaterland zurückkehrt, ehe er ganz zum Wilden geworden ist."
"Du magst da wohl recht haben, Don Antonio -, er hat mitunter ganz das Gebaren eines Indianers, obwohl sein Herz noch treu an unserem heiligen Glauben und an den Leuten seiner Farbe hängt."
"Welcher Familie er nur entstammen mag? Er sagte nichts davon."
"Vielleicht hat er es in diesem schauerlichen Dasein unter den Wilden vergessen und entsinnt sich nur noch seines Vornamens; mich sollte es nicht wundern. Wenn ich mir vergegenwärtige, was für einen Knaben ein jahrelanges Leben unter diesen rohen Menschenschlächtern für Folgen haben mußte, so ist es erstaunlich, daß er sich seine Geisteskraft so bewahrt hat."
"Ja, erstaunlich. Doch kehren wir glücklich zur Heimat zurück, so will ich es ihm vergelten und ihn sorgsam wieder zum Spanier machen. Hast du denn gewußt, Don Antonio, daß hier solche verwegene Räuber hausen gleich diesen Aimaràs! Du bist doch ein Montanero?"
"Es war mir nicht unbekannt, daß diese Wilden gelegentlich Raubzüge machen, um sich mit Vieh, besonders Maultieren und Waffen zu versorgen; daß sie Menschen gefangen davonführen, davon habe ich nie gehört."
"Aber wir haben davon einen sehr nachdrücklichen Beweis. Auch wir wären spurlos verschwunden im Gebirge wie die anderen Unglücklichen, die in ihre Hände fielen. Man schaudert, wenn man daran denkt. Diese Räuberhöhlen dürfen nicht länger geduldet werden, die Regierung muß sie zerstören und diese Wilden dem Gesetz unterwerfen."
"Zunächst, Don Fernando, wollen wir daran denken, aus diesen Felsenwällen möglichst unbeschädigt herauszukommen. Die Sache hat ihre Schwierigkeit, ich habe mir die Felsenpässe betrachtet, als ich hier heraufgeschleppt wurde."
"Ich sage dir, Don Antonio, sind wir dem Gefängnis entgangen, so werden wir auch auf der Flucht hoffentlich nicht elend umkommen."
"Mögest du die Wahrheit reden."
Während Don Fernando und der junge Halbindianer, der in seinem ganzen Benehmen, wie in seinem reinen Spanisch und der Art, sich auszudrücken, die Resultate einer guten Erziehung zeigte, so plauderten, war Alonzo über Felsen auf Stellen kletternd, die ungangbar schienen, zu dem Pfade zurückgekehrt, der zur Grenze des Tales nach Osten hin führte.
Er erreichte endlich einen Punkt, von wo aus er die roh aus Steinen hergestellte Behausung der Wächter, die den engen Felspfad zu bewahren hatten, sehen konnte. Rauch zeigte, daß darin gekocht wurde, und die nachlässig am Boden hingestreckte Gestalt eines Aimarà ließ darauf schließen, daß den Grenzwächtern keine beunruhigenden Nachrichten zugekommen seien.
Auch wurde deren Aufmerksamkeit selten auf eine Probe gestellt.
Nachdem Alonzo sich überzeugt hatte, daß kein weiterer Bote zu ihnen gelangt sei, kletterte er mit der Vorsicht und Geräuschlosigkeit, die ihm eigen waren, zurück und erreichte nach einiger Zeit die Stelle, wo er den Stein nach dem Aimarà geschleudert hatte.
Der Tote lag noch unberührt am Boden.
Während Techpo sinnend auf den Leichnam niederblickte, vernahm sein feines Ohr Hufschläge, die vom Dorfe her klangen. Er umwickelte sein Haupt mit Gras, legte sich platt nieder, die Büchse zur Hand und lauschte. Die Hufschläge kamen näher und verstummten dann. Die Reiter hatten den Leichnam erblickt und angehalten.
Mit äußerster Vorsicht schob Alonzo zwischen dem Gras und den Büschen, wie sie die Felsen bedeckten, den Kopf vor; er erblickte den Kaziken Tucumaxtli mit zwei anderen Aimaràs, die stumm auf dem Wege hielten.
Endlich stieg einer ab und untersuchte den Toten. Die Waffen waren da und als Verletzung zeigte sich nur die des Steinwurfs am Hinterhaupte. Verdächtige Spuren wies der steinige Boden nicht auf.
"Ein herniedersausender Stein hat unseren Bruder getötet, Kazike."
Auch Tucumaxtli verließ den Sattel und seine Untersuchung bestätigte die Wahrnehmungen des Kriegers.
"Nun wissen wir, warum Chiacam nicht zurückkehrte, der Berg hat ihn erschlagen."
Mit abergläubischer Scheu starrten die drei braunen Krieger auf die Wunde, die den Tod ihres Gefährten herbeigeführt hatte, dann zu den drohenden Felsen in die Höhe.
"Aber wo ist Chiacams Pferd?"
"Es wird zu den Wächtern gelaufen sein."
"Nein, dann hätten die den Boten gesucht und gefunden."
"So wird es zu einem Weideplatz zurückgekehrt sein."
"Wir forschen hier vergebens nach den Flüchtlingen, sie sind nach Norden entwichen."
"Sie können nicht entwichen sein, sie sind in den Felsen."
"Hast du vergessen, daß tückische Chibchas zwischen unseren Häusern waren, Kazike?"
"Torheit! Die Furcht hat Feiglinge den Schlachtschrei der Chibchas hören lassen. Kennen Chibchas die geheimen Wege der Priester?"
"Ein böser Geist ist aus der Tiefe der Berge aufgestiegen," äußerte jetzt der dritte, "den Aimaràs die Opfer zu entreißen, und wir werden sie nicht finden. Wir würden uns seinen Zorn zuziehen, gleich Chiacam, den der Stein getroffen."
Scheu schwiegen die beiden anderen. Endlich sagte Tucumaxtli, der Kazike: "Wir müssen die Wächter benachrichtigen, dann wollen wir Chiacam die Totenlieder singen."
Ein Windstoß erschütterte die Luft und unweit, in der Richtung nach dem Wächterhause hin, sauste ein Stein hernieder.
Die ohne Zweifel mutigen Männer, deren Aberglauben durch die geheimnisvolle Entweichung der Gefangenen, den jähen Tod des Boten stärker als je erregt war, bebten merkbar.
"Zu den Wächtern," sagte der Kazike entschlossen, "dann kehren wir um; die Unsichtbaren werden uns schützen."
Er ritt voran und seine Krieger folgten ihm. Waren die Wächter in Kenntnis gesetzt, so verschlimmerte das die Lage der Flüchtlinge sehr - dies wußte niemand besser als der Knabe. Eines ging ihm aus der belauschten Unterredung hervor, daß man kaum Verdacht auf ihn geworfen hatte. Der Aberglaube der Indianer war ihm bekannt. - Techpo harrte geduldig.
Nach einiger Frist kehrten die Reiter zurück, hoben den Leichnam auf, den einer der Krieger vor sich auf das Pferd nahm und ritten dann langsam weiter.
Wenn nicht ein günstiges Geschick den Flüchtlingen zu Hilfe kam, war jetzt kein Entrinnen aus dem Tale möglich, wenigstens nicht mit den Pferden, und es mußte die Flucht über die Felsen versucht werden, die unendlich schwierig war und wenig Aussicht auf endliche Rettung bot.
Alonzo zweifelte nicht, daß die Aimaràs alsbald Streifscharen ringsum in die Berge senden würden, wenn es nicht bereits geschehen war.
Zunächst war er mit seinen Gefährten in voller Sicherheit und Alonzo beschloß, ruhig die Nacht abzuwarten. Nur die Dunkelheit konnte den Fluchtversuch begünstigen.
Er kehrte in das Tal zurück und gesellte sich zu den seiner Harrenden mit unbewegter Miene.
Auf ihre Fragen erwiderte er: "Schlaft - wir werden vielleicht in der Nacht munter sein müssen."
Er selbst ließ sich zum Schlafen nieder, suchte aber, noch ehe der Tag sich neigte, den Weg wieder auf. Er erkannte jetzt an den Spuren auf dem Boden deutlich genug, daß eine Reiterschar dem Ausgang zugeritten war, seine Vermutung war also eingetroffen. Die Verfolger waren auf dem Wege, der nach den Llanos führte. Das war schlimm.
Er kehrte zurück und ließ die Tiere satteln, einen jeden seiner Gefährten so viel Mundvorrat nehmen als er unterbringen konnte.
Dann teilte er ihnen mit, daß Aimaràs bereits jenseits des Tales seien.
Beide erschraken.
"Sie sind weniger gefährlich als das Wächterhaus. Sie fürchten die Nacht, in deren Schatten böse Geister einherwandeln und werden einen Schlupfwinkel aufgesucht haben."
Als die Nacht ganz hereingebrochen war, nahm er das Pferd des erschlagenen Indianers am Zügel und hieß Fernando und Antonio ihm mit den Maultieren folgen. Sie kamen glücklich trotz der Dunkelheit durch die Höhle und erreichten die Schlucht, die nach dem Wege führte.
"Laßt uns hier harren, wir müssen zu allem bereit sein; die Nacht wird dunkel, wie ich sehe, kein Stern leuchtet am Himmel."
Schweigend harrten sie so geraume Zeit im Schatten der Felsen.
Mehrmals schlich Alonzo zur Straße und lauschte - kein Laut war zu vernehmen.
Als er zum dritten Male zurückkehrte, sagte er leise, triumphierend: "Die Umstände sind für uns günstig, der Sturm naht von Norden und er ist furchtbar in diesen Felsen."
Er hatte kaum ausgesprochen, als ein Sausen sich hören ließ, das vom Himmel herunter zu kommen schien.
"Ah, er kommt schon, unser Freund aus Norden, gebt acht, er wird sich noch ganz anders vernehmen lassen. O wie ich ihn liebe, wenn er einherjagt und die Wolken hetzt, wie ein Jaguar die Bergschafe." Das Sausen verwandelte sich in ein dumpfes Heulen und selbst in ihrer geschützten Stellung spürten sie den Lufthauch. Große Tropfen begannen hernieder zu fallen.
"O schön, auch der Regengott ist den Roten feindlich, denn sie können seine Tränen nicht ertragen. Brause, Sturmwind, weinet ihr Wolken - reitet voran auf Sturmesflügeln und scheuche die Feinde. Wir wollen es wagen, haltet die Machete bereit, der Büchsen wollen wir uns nur im Notfall bedienen. Überlaßt euch den Tieren und folgt mir. In den Sattel!"
Alle drei stiegen auf und Alonzo, sein unruhiges Tier mit indianischen Schmeichelworten beruhigend, ritt voran.
Als sie jetzt in den Felsweg einbogen, fühlten sie die ganze furchtbare Gewalt des Sturmes.
Von den mit ewigem Eise bedeckten Höhen der Bergriesen herab sauste er mit elementarer Gewalt über Felsen und Berge, durch Schluchten und Wälder hernieder, dunkle Wolken vor sich herjagend und Schauer kalter Regenstürme niedersendend.
Ein Heulen war ringsum vernehmbar, ein Pfeifen, Zischen, Sausen, das sinnbetäubend wirkte.
Die Erde schien ringsum zu beben.
Der Kreole und der Mestize zitterten vor der unheimlichen Macht der in wildestem Grimme entfesselten Naturgewalten, deren Toben umso schreckenvoller war, da eine Finsternis sie umgab, die kaum das Nächste zu erkennen erlaubte.
"Es ist gut so!" klang die Stimme des Knaben dumpf zu ihren Ohren.
Halb bewußtlos trieben sie ihre Pferde an, diese folgten zitternd, fast betäubt von der Wucht der Regentropfen.
Immer rasender brauste der Orkan einher, bald in tiefen langgezogenen Tönen heulend, bald hell klingende Laute den Felsen ringsum entlockend, ein Konzert voll grauenhafter Majestät.
In wenigen Augenblicken waren die Reiter durchnäßt bis auf die Haut und doch fühlten sie es kaum in dem Schrecken der Stunde.
Enger und enger wurde der ansteigende Weg, der zum Wächterhause führte und je mehr die Felsenwände zu ihren Seiten näher traten, umsomehr zischte es über ihnen, hinter ihnen, um sie her.
Den Gefährten Alonzos, denen die Stürme des Hochgebirges fremd waren, deuchte es, als ob die Welt zu Grunde ginge, und sie murmelten Gebete vor sich hin. Aber gehorsam, trotz allen Aufruhrs der Natur, schritten die angstvoll schnaubenden Tiere weiter. Jetzt nahte die gefährliche Stelle. Alonzo hielt sein Pferd an, und verzweiflungsvoll umklammerten die Männer ihre Waffen.
Aber was war der Zorn der Menschen gegen den Grimm der Naturgewalten? Als ob er Felsen entwurzeln wolle, sauste der Sturm einher.
Ein dumpfes Krachen und Poltern ließ sich hinter ihnen vernehmen, Felsstücke mußten herniedergesaust sein.

Immer rasender brauste der Orkan daher.
Stumm und dunkel lag das Wächterhaus da, vom Nordsturm umheult - mit Regenströmen übergossen - schattenhaft vermochte Alonzo es zu erkennen. Waren die Wächter aufmerksam, dann genügte ein Loslassen von Felsbrocken, die zu dem Zwecke aufgehäuft lagen, um in ihren Weg geschleudert zu werden, und dies war sichere Vernichtung; der Ausgang war dann versperrt und die Büchsen machten ihrem Leben ein rasches Ende, oder, was noch schlimmer war, lieferten sie in die Gewalt der grausamen Feinde zurück.
Einen Augenblick bebte auch der kühne Jüngling. Aber alles war still im Wächterhaus. Die Naturgewalten, die entfesselt einhertobten, bändigten die Wilden, füllten ihre Seelen mit abergläubischen Schauern, denn die Geister der Vernichtung schritten im Sturme einher. - "Vorwärts!" befahl der Jüngling.
Und eingehüllt in Nacht und Sturm, beschützt vom Grauen der Stunde, legten sie die gefährliche Strecke zurück.
Das Wächterhaus lag hinter ihnen.
Bald senkte sich der Weg und wurde breiter.
Jetzt schrie Alonzo seinen Begleitern zu, daß die größte Gefahr hinter ihnen liege.
Neue Hoffnung füllte die bebenden Herzen.
Sicher schritten die des Weges gewohnten Tiere weiter, trotz Sturm und Regen.
Um einen Felsen biegend, fühlten sie die Wucht des Orkanes weniger, auch der Regen ließ nach.
Alonzo, der die Bodengestaltung hier kannte, lenkte in eine Schlucht zu ihrer Rechten ein, wo sie unter dem Schutze eines überragenden Felsens Halt machten. Hier waren sie der Gewalt des Sturmes entzogen und den Regenströmen weniger ausgesetzt.
"Wir müssen hier harren, denn unseren Weg kreuzt ein Bach, der jetzt tobende Fluten in die Tiefe wälzen wird, wir müssen warten, bis seine Wasser abgelaufen sind."
Sie hatten Büsche und einige Bäume vor sich. Der Aufforderung Alonzos folgend, stiegen alle ab, banden die Tiere an, und suchten unter des Knaben Leitung eine enge, bedeckte Felsspalte auf, wo sie sich aneinandergedrängt fröstelnd niederkauerten.
Immer noch tobte draußen der Sturm durch die finstere Nacht, doch seine grimmigste Wut schien gebrochen zu sein. - Lange harrten sie so, schwächer und schwächer ward das Tosen der Lüfte, der Regen hatte längst aufgehört und schon waren einzelne Sterne zu erkennen.
Langsam dämmerte der Morgen herauf, und rötliche Strahlen zuckten über den jetzt klaren Himmel.
"Zu Pferde! Wir müssen versuchen, den Bach zu kreuzen."
Es war kühl geworden und Fernando, der an wärmere Temperatur gewöhnt war, zitterte vor Frost. Antonio, ein Bewohner der Vorberge, ertrug die Kälte leichter. Der Knabe in seinem dünnen Gewande schien unempfindlich zu sein.
Sorgfältig hatten sie nach den Büchsen gesehen. Deren Schlösser waren, dank der Vorsicht, mit der sie im Regen geschützt worden waren, trocken geblieben.
Alonzo ritt voran und befahl, daß die beiden anderen hundert Schritte hinter ihm reiten sollten.
Am Rande eines in steinigem Bette rinnenden Baches hielt er; das Gebirgswasser war schnell, wie es gekommen, zur Tiefe weiter gestürzt, der Bach war seicht.
Er winkte die beiden anderen heran, gab Fernando die Zügel seines Pferdes und sagte: "Wartet hier, ich will auf dem Wege ausschauen."
Dann schritt er durch das Wasser und verschwand um einen Felsen, an dem der Weg herlief.
Nach einiger Zeit kehrte er zurück.
"Der Weg ist frei, so weit ich sehen konnte." Vorsichtig leiteten sie dann ihre Tiere durch den mit Geröll gefüllten Bach, stiegen wieder auf und ritten weiter, Alonzo mit gleicher Vorsicht immer weiter voran.
Ringsum herrschte das tiefste Schweigen, das Schweigen des Hochgebirges. Die Sonne war über den Berggipfeln erschienen und sandte ihre wohltätig wärmenden Strahlen auf die Flüchtlinge.
So ritten sie eine Stunde einher, und neue Lebenskraft strömte durch die Adern der Männer, die eine so grauenhafte Sturmnacht hinter sich hatten.
Vor ihnen schien der Weg eine Biegung zu machen. Alonzo ließ seine Gefährten halten, gab den Zügel seines Tieres dem Kreolen und ging vor, um zu spähen.
Bald kam er zurück zu den seiner harrenden Gefährten.
"Sie sind vor uns am Wege, sie haben Feuer angezündet und lagern," sagte er ganz ruhig.
Fernando und Antonio erschraken in der Tiefe ihrer Seele; so war also der entscheidende Augenblick gekommen. Doch waren beide keine schwächlichen Menschen, und nach Überwindung des ersten Schreckens, den die zwar nicht unerwartete, aber doch immer überraschend kommende Nachricht wachgerufen, kehrte die Entschlossenheit zurück.
Es war immer noch besser, im Licht der Sonne mit den Waffen in der Hand zu sterben, wenn es denn gestorben sein mußte, als wehrlos unter dem Messer der gefühllosen Wilden.
Mit Bewunderung sahen die beiden erregten Männer auf den Knaben vor ihnen, der gleichem Schicksal ausgesetzt wie sie doch durch keinen Zug verriet, daß die nahende Gefahr ihn bewege.
"Nun ist die Stunde da, sie soll mich als Mann finden," sagte Fernando.
Sein Auge war feucht, als er fortfuhr: "Doch du, mein heldenhafter Knabe, wer heißt dich unser Geschick teilen? Geh - du vermagst dich zu retten - du hast genug für uns getan."
Mit einem Ausdruck so ruhig und entschlossen und so würdevoll zugleich, daß er dem jugendlichen Gesicht Alonzos den Schimmer echter Seelengröße lieh, sagte er: "Wir kämpfen und sterben zusammen, wenn es sein muß."
"Herzensjunge, kommen wir davon, ich will es dir vergelten. Aber was tun wir? Sage es. Sollen wir über sie herfallen? Überraschung ist halber Sieg."
"Es wäre vergeblich," erwiderte ernst der Knabe. "Wir könnten einige töten, aber die anderen würden sich in den Hinterhalt legen, uns erwarten und gleich Rehen niederschießen. Ich will dir sagen, was wir tun müssen. Während ihr hier harrt, will ich drüben in die Felsen klettern und mich den Aimaràs zeigen, ich glaube, sie werden mir begierig folgen. Diesen Augenblick benützt ihr und jagt auf dem Wege, der dort durch ein Wiesental führt, weiter. Bald seid ihr wieder von Felsen umgeben und der Weg ist eng, dort könnt ihr euch wehren, wenn sie euch folgen. Harret mein, da, wo der Weg wieder in ein grünes Tal mündet, das ein Bach durchfließt, ich werde über die Berge gehen und zu euch stoßen."
"Das ist verwegen, mein junger Freund - du setzest dein Leben auf das Spiel."
"Nein - ich klettere gleich einem Bergschafe und die Indios nehmen es darin nicht mit mir auf - für mich ist keine Gefahr. Folgen sie mir aber nicht alle, so müßt ihr hervorbrechen und euch durchschlagen. Nur mein Pferd dürft ihr nicht zurücklassen."
Der Plan des Knaben war verwegen, aber ausführbar, größer konnte die Gefahr dadurch nicht werden. Man beschloß danach zu handeln, obgleich die beiden jungen Männer nicht verkannten, daß der hochherzige Knabe sich von neuem für sie in große Gefahr begab.
Alonzo führte seine Gefährten jetzt vorsichtig weiter. Als sie einem Felsvorsprung nahten, wurden die Tiere an Sträucher angebunden, und auf dem Boden kriechend, bewegten sie sich, vorsichtig Deckung hinter Felsgestein suchend, vor, bis sie einen Ausguck in das Tal hatten.
In einiger Entfernung gewahrten sie etwa ein Dutzend Indianer um ein Feuer sitzend, während ihre Tiere grasten; die Wilden saßen ganz sorglos da.
"Von hier aus sollt ihr die Aimaràs beobachten. Ich zeige mich ihnen drüben auf den Felsen," er wies auf die Stelle; "sind sie mir gefolgt, reitet eilig voran, nur vergeßt mein Pferd nicht." Er zeigte ihnen auch die Schlucht, in der der Weg weiter lief.
"Nun gib mir deinen Poncho, Don Fernando, und deinen Hut, sie müssen mich für einen von euch halten."
Bereitwillig gab ihm der Kreole beides. "Gebt acht und behaltet vorsichtig eure Deckung; die Indios haben scharfe Augen."
Alonzo nahm seine Büchse und ging zurück, um eine geeignete Stelle zu suchen, die ihm gestattete, jenseits des Tales zu gelangen.
In tiefer seelischer Aufregung blieben die anderen allein, ungeduldig dessen harrend, was kommen würde.
Die Aimaràs, die wohl ihrer Pflicht vollkommen genügt zu haben glaubten, auch wohl der Ansicht sein mochten, daß ein Passieren des Wächterhäuschens unmöglich sei, gaben sich nach der unheilvollen Nacht der Ruhe hin. Einige hatten sich niedergestreckt, andere saßen und rauchten.
Immer länger wurde den Lauschern die Zeit, immer angstvoller harrten sie des Erscheinens des Knabens auf den bezeichneten Felsen.
Nur flüsternd wagten sie, trotz der Entfernung der Feinde, sich zu unterhalten und kaum sich zu bewegen, auch lauschten sie angstvoll auf jedes Geräusch.
So vergingen wohl zwei Stunden, der Weg des Knaben mußte schwierig sein.
"Seht dorthin -" flüsterte endlich der Mestize in fieberhafter Erregung - "dort ist er!"
Ja, erkennbar kletterte dort auf den Felsen jenseits des Tales ein Mensch in Poncho und Sombrero einher. Die Aimaràs gewahrten ihn nicht.
Die Augen Fernandos und Antonios waren auf Alonzo, auf die Wilden gerichtet. Noch immer wurde der Knabe nicht entdeckt.
Da rutschte er aus, eine Strecke hinab und mochte wohl Steine ins Rollen gebracht haben. Jetzt erhoben sich die Aimaràs wie ein Mann und starrten nach den Felsen.
Alonzo schien in Todesangst dort einherzuklettern. Der größere Teil der Aimaràs lief auf die Felsen zu mit einem Triumphgeheul, das bis zu den Lauschern drang. Drei blieben zurück, wohl um die Pferde zu bewachen.
Diejenigen, die Alonzo nachsetzten, waren verschwunden. Alonzo ebenfalls. Die zurückgebliebenen Indios schauten hinauf zu den Felsen.

Der Mestize legte seine Büchse an die Wange und schoß.
Jetzt war die Gestalt des kühnen Knaben wieder sichtbar. Die unten schrieen, Alonzo schlüpfte hinter einen Felsen.
Zitternd vor Aufregung sahen Fernando und der Halbindianer dem zu.
"Jetzt vorwärts," sagte Antonio, "es ist Zeit!"
"Ja, wir wollen es wagen!"
"Nehmt das Pferd des Knaben, Don Fernando, ich will schießen."
"Ja."
Eilig bestiegen sie die Mulos. Antonio ritt, die Büchse in der Hand, voran, Fernando folgte, das Pferd Alonzos am Zügel führend. Die Aufmerksamkeit der drei zurückgebliebenen Aimaràs war so ganz auf die Felsen gerichtet, daß sie das Erscheinen der Flüchtlinge nicht bemerkten. Wieder zeigte sich der verwegene Knabe an einer anderen Stelle -, er gewahrte die Freunde und war gleich darauf nicht mehr gesehen.
Jetzt wandte sich einer der Aimaràs um, und sein gellender Schrei belehrte die Flüchtenden, daß sie entdeckt waren. Sie waren bereits in Schußweite und der Mestize riß, dies erkennend, die Büchse an die Wange und schoß auf den, der geschrieen hatte. Er mußte getroffen haben, denn der Mann wankte und fiel ins Gras nieder. Die beiden anderen verschwanden mit großer Geschwindigkeit hinter den weidenden Pferden.
"Vorwärts! Vorwärts!" schrie Antonio; sie trieben die Tiere an und erreichten, das Tal rasch durchreitend, bald den engen Felspfad, der sie weiter führen sollte.
Fünftes Kapitel.
Die Grabstätte der Kaziken
Alonzo hatte es in der Tat schwierig gefunden, auf die andere Seite des Tales zu gelangen, und dazu mehr Zeit gebraucht, als er voraussetzte. Auch war ihm diese Seite der das Tal der Aimaràs umgebenden Berge nicht bekannt genug, um die kürzesten Pfade zu wählen. Endlich war er an der bezeichneten Stelle.
Seine Absicht, die Feinde zur Verfolgung zu bewegen, gelang, und er sah noch, wie seine Begleiter durch das Tal ritten, hörte auch den Schuß des Mestizen. Jetzt galt es also, zu der Stelle zu gelangen, die er mit den Freunden verabredet hatte.
Sein Gesicht hatte er, als er sich auf den Felsen zeigte, abgewendet gehalten, so daß er im Poncho und Sombrero für Don Fernando gehalten wurde.
Waren ihm diese Berge und Schluchten gleich nicht vertraut, verließ er sich doch auf seinen Jägerinstinkt und seine Kraft und Geschicklichkeit in Überwindung von Schwierigkeiten im Bereiche des Felsengebirges. Welche Richtung er einzuhalten hatte, um den Weg nach Westen zu erreichen, wußte er genau, ihn täuschte der wechselnde Stand der Sonne nicht.
In seinen Verfolgern hatte er aber Feinde, die diesen Teil des Gebirges kannten und das grimmige Verlangen fühlten, dessen, der sie so schmählich getäuscht hatte, habhaft zu werden.
Dies wurde Alonzo bald inne, als er sich zweimal die Richtung verlegt fand, die er einhalten wollte und einhalten mußte. Nur seine große Vorsicht verhinderte, daß er entdeckt wurde. Der Knabe, der so lange in der Gefangenschaft der Wilden geschmachtet hatte, war entschlossen, sich lieber in einen Abgrund zu stürzen, als sich von neuem in ihre Hände zu geben.
Da er den Verlauf der Schluchten nicht kannte und darum in diesen leichter der Gefahr ausgesetzt war, überrascht und umzingelt zu werden, mußte er sich auf den Höhen halten.
Wiederholt vernahm er Stimmen von unten und wurde hierdurch gezwungen, weiter von der Richtung, in der sein Ziel lag, abzuweichen, als es wünschenswert war. Im Begriff, einen abgeplatteten Felsen zu überschreiten, der mit dünnen Büschen bedeckt war, verriet ihm ein von der Seite kommender Ausruf, daß er gesehen worden sei.
Sein Auge gewahrte auf dem Nachbarfelsen, der durch eine steil abfallende Schlucht von dem getrennt war, auf dem er weilte, das Haupt eines Aimarà.
Der erregte Knabe riß mit Gedankenschnelle die Büchse an die Wange und feuerte. Krachend entlud sich die Waffe und der Kopf verschwand. Er lud seine Waffe rasch wieder und schaute, sich hinter Büschen deckend, um, jeden Augenblick erwartend, neue Feinde auftauchen zu sehen. Aber nichts zeigte sich.
Behutsam kroch er dann durch die Büsche dem Rande des Felsens zu, um einen Ausblick in die trennende Schlucht zu gewinnen. Vorsichtig blickte er über den Rand, gewahrte aber nichts Verdächtiges.
Eilig lief er nun nach der anderen Seite und hier war der Abstieg möglich. Er warf sich zwischen den Büschen nieder, um zu ruhen, denn seine Kraft war übermäßig in Anspruch genommen worden.
Er sah zur Sonne auf, die still ihre Bahn am weiten Himmelsbogen einherzog und dachte: "Werde ich die Heimat wiedersehen, auf die du jetzt auch deine goldenen Strahlen niedersendest? Oder muß ich fern von ihr in bitterem Herzeleid unter den Messern dieser Menschen sterben?"
Nichts regte sich um ihn, nichts Verdächtiges gewahrte sein forschendes Auge.
War der, auf den er schoß, allein gewesen? Hatten die anderen Aimaràs den Knall seiner Flinte vernommen? Daß der Schall eines Schusses, der in der Höhe abgegeben wird, schwer nach unten in die Schluchten dringt, wußte Alonzo.
Kannten aber jetzt die Aimaràs die Stelle, wo er weilte, so war es wahrscheinlich genug, daß bald von allen Seiten der Fels erstiegen werden würde. Geschah dies, war er entschlossen, zu kämpfen bis zum letzten Augenblick.
Still blieb es ringsum.
Er fühlte sich wieder kräftig und beschloß, den Abstieg zu wagen.
Er begann hinabzuklettern, fortwährend alles ringsum mit forschendem Auge überfliegend und von Zeit zu Zeit lauschend.
Er kam hinab und betrat eine mit Steingerölle bedeckte Schlucht.
Die Sonne sagte ihm, daß er sich nach rechts wenden müsse.
Eine andere Schlucht, breiter und mit Gras und Büschen bewachsen, kreuzte die, in der er einherging. Gebückt schritt er hindurch.
Ehe er sie noch hinter sich gebracht hatte, belehrten ihn gellende Rufe aus der Höhe, daß er entdeckt sei. Die Aimaràs schienen sämtlich oben zu sein. Sie hätten schießen können, denn einige führten Büchsen, aber zu sehr lag ihnen daran, den Gefangenen lebend zu haben, und er konnte ihnen nicht mehr entgehen.
Jetzt lief Alonzo, der immer noch den Sombrero und Poncho Don Fernandos trug, in der Fortsetzung der Schlucht, die er zuerst betrat, weiter. Er wußte, daß er die gewandten Verfolger bald auf seiner Ferse haben werde.
So mit aller Anstrengung vorwärts stürmend gewahrte er zur Rechten seines Weges auf einem Felsvorsprung einen gewaltigen, viereckig behauenen Stein und dahinter den Teil einer dunklen Öffnung im Felsen. Er wußte, daß ringsum in den Bergen Begräbnisstätten des einst zahlreichen Volkes der Aimaràs sich in den Felsen befanden, und hoffte, dies würde eine solche sein. Ein rauher Felspfad führte hinauf, Alonzo klomm ihn empor und verschwand in der Öffnung. Gleich darauf betraten zwei Indianer die Schlucht. Sie liefen weiter, die anderen kamen nach. Diese schenkten dem Orte, den Alonzo als Zuflucht aufgesucht hatte, mehr Beachtung als die ersten.
Sie blieben stehen und schauten hinauf.
"Dort schlummern die Toten früherer Zeiten," sagte ein älterer Mann, "als vor Jahren der Erdgeist zornig war und die Felsen schüttelte, verrückte sich der schließende Stein und öffnete die Pforte des Todes."
"Sollte der Weiße dorthin geflohen sein?"
Es war das wahrscheinlich, denn die Felsen ringsum stiegen jäh an, waren nicht zu erklettern und Alonzo hatte nicht Vorsprung genug gehabt, um die sich gerade hinstreckende Schlucht schon durchmessen zu haben, als sie von den ersten Verfolgern betreten wurde.
Man ließ drei Männer als Wache bei der Grabstätte und die anderen untersuchten eifrig jeden Strauch, jeden Winkel der Schlucht, wie auch die nächste nach Fußspuren, deren dort keine gefunden wurden, obgleich der weiche durchnäßte Boden sie da hätte aufnehmen müssen.
Alle kamen überein, daß der Flüchtling die Grabstätte aufgesucht habe, um sich darin zu bergen.
Diese selbst zu betreten, hinderte sie abergläubische Scheu.
Aber vielleicht erlaubte die gegenüberliegende Felswand einen Einblick. -
Schweratmend hatte Alonzo den dunklen Raum, zu dem eine geräumige, behauene Öffnung führte, betreten.
Es war, wie er vermutete, eine altindianische Gruft.
Ringsum standen in eingehauenen Nischen die verschnürten Ballen, die die Leichen der Indianer in hockender Stellung bargen. Die Trockenheit der Luft dörrt sie in diesen Felsgräbern zu Mumien aus. Alonzo hatte auf seinen Streifzügen durch die Gebirge dergleichen schon gesehen. Er atmete auf, denn er wußte, daß die Aimaràs in dieses Felsengrab nicht einzutreten wagen würden. Zunächst war er also gerettet.
Die Stimmen unten sagten ihm bald, daß man ihn hier oben vermutete, auch erkannte er, daß man von dem gegenüberliegenden Felsen einen Teil der Grabhöhle zu überschauen vermochte. Er setzte sich so, daß er nicht gesehen werden und doch nach dem Felsrande ausschauen konnte.
Nach einiger Zeit gewahrte er wirklich, wie drüben vorsichtig zwei Köpfe sich erhoben und deren funkelnde Augen das dunkle Grabmal durchforschten -, doch bald verschwanden sie wieder.
Den Knaben focht die schauerliche Umgebung nicht an, er streckte sich aus auf seinem Poncho und ruhte.
Der Hunger meldete sich und Durst quälte ihn. Aber der Beutel mit den Nahrungsmitteln war am Sattel seines Pferdes befestigt. Zu seiner Freude gewahrte er, wie in den Vertiefungen des Felsgesteins draußen noch kleine Pfützen Regenwasser standen. Hinter den Stein, der einst die Höhle verschloß, kriechend, vermochte er ungesehen seinen Durst zu löschen.
An Entbehrungen aller Art war er gewöhnt, seitdem er unter den Aimaràs weilte.
Aber was wurde aus den Gefährten, die jetzt seiner an dem verabredeten Orte harrten? Wie sie schmerzlich und angstvoll seiner harren würden, sie, die des Landes unkundig waren.
Ihm fiel jetzt auf, daß die Sonne trübe geworden war, er schaute vorsichtig hinaus und erkannte, daß der Nebel aus dem feuchten Tale aufstieg, der oft genug alles ringsum dicht in seinen Mantel einhüllte.
Immer matter war die Sonne, immer stärker der Nebel, schon konnte er die nahe gegenüberliegende Felswand nicht mehr sicher erblicken. Ein solcher Nebel nach einem starken Regengusse hielt oft tagelang an.
Bot ihm der Nebelschleier Rettung?
Der Gedanke kam ihm, daß die Aimaràs den Nebel benützen könnten, herauf zu schleichen, um ihn abzufangen. Vielleicht waren doch einige der Krieger weniger abergläubisch und wagten es, die Ruhestatt der Toten zu betreten. Zu heiß war ihr Verlangen, sich seiner zu bemächtigen.
"Ich will sie erschrecken, wenn sie kommen," sagte Alonzo. Er stieß einen der mit einer Decke von geflochtenem Bast umhüllten Ballen aus seiner Nische und durchschnitt die ihn zusammenhaltenden festen Faserstricke mit seiner Machete. Die Mumie, die zu Tage trat, stellte er dicht neben den Eingang an den Felsenpfad.
"Wenn die Abergläubischen davor nicht zurückschrecken, das würde mich wundern."
Der Nebel war jetzt so dicht, daß man nicht drei Schritte weit sehen konnte, die Sonne war nicht zu gewahren.
Alonzo horchte nach unten, kein Laut drang zu ihm. Vor der Höhle befand sich eine kleine Plattform, die einst für den schweren Schlußstein des Grabes hergestellt war. Beim Hinaufklettern hatte er gesehen, daß der Fels von hier fast senkrecht anstieg. Den Weg nach unten versperrten die Aimaràs, das wußte er, auch wenn er sie nicht sah, aber nach oben, gab es nach oben hin keinen Weg?
Er trat zur Seite des Eingangs bis an den Rand der Plattform und untersuchte den ansteigenden Fels.
Sein Auge erkannte leicht eingehauene Stufen, wahrscheinlich Reste einer ehemaligen in den Fels gemeißelten Treppe, die Regen und Frost noch nicht ganz zerstört hatten.
Er sann nach. Wenn ich meinen Lasso hätte -? Aber waren nicht die Mumien in lange, unendlich zähe Stricke eingehüllt, von deren Festigkeit er sich soeben überzeugt hatte?
Er entfernte einen zweiten Mumienballen von seinem Platze, löste den umschnürenden Strick und formte daraus einen Lasso. Das war auch in den Felsen ein nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel.
Er warf die Büchse auf den Rücken, rollte die Seitenteile des Poncho auf den Schultern zusammen und umschnürte ihn mit seinem Gürtel. So hatte er die Arme frei.
Er betrat die Plattform und lauschte nach unten. Sein feines Ohr vernahm trotz des dämpfenden Nebels schleichende Schritte. "Ah, sie kommen doch -?" Er trat zurück und spannte den Hahn seiner Büchse.
Ein Schrei des Entsetzens berührte sein Ohr, ein Schrei des tiefsten Schreckens, und deutlich vernahm er, wie eilige Schritte sich nach unten entfernten.
Der ernste Knabe vermochte nicht, ein Lächeln zu unterdrücken. "Dank dir, toter Kazike," sagte er, "du hast sie gescheucht."
In der Tat hatten zwei jüngere Krieger versucht, sich an den Eingang der Höhle zu schleichen, als sie plötzlich im Nebel die Mumie vor sich sahen. Diesem Anblick hielten sie nicht stand und entfernten sich in tödlicher Angst.
"Nun ist es Zeit." Alonzo nahm den Strick zusammengerollt in die Hand und begann vorsichtig den Anstieg.
Er fand Stufenreste in geeigneter Höhe genügend groß noch, um den Fuß zu stützen, und gelangte so langsam nach oben.
Rings umgab ihn dicht der Nebel.
Endlich aber hörten die Stufen auf und nur die glatte nackte Felswand war vor ihm, aber er mußte dem Rande des Felsens nahe sein.
Er wickelte seinen Strick los und warf die Schlinge nach oben.
Zweimal kam sie zurück - das dritte Mal haftete sie an einem Gegenstande, den er aber nicht zu sehen vermochte. Er zerrte, hing sich an den Strick, er hielt.
Entschlossen kletterte er empor und erreichte nach geringer Anstrengung den Rand des Felsens. Die Schlinge hing an der zähen, tief im Fels haftenden Wurzel eines Baumes, den wohl der Sturm gebrochen haben mußte.
Alonzo war oben und atmete auf.

Vorsichtig ließ sich Alonzo an dem Strick nieder.
Nebel, Nebel ringsum, über ihm, unter ihm undurchdringlicher Nebel. Er machte den Strick los und rollte ihn zusammen. Die Sonne konnte er nicht sehen, doch in einem rechten Winkel mit der Schlucht schritt er mit der Sicherheit eines indianischen Jägers, der seinen Weg nach unscheinbaren Merkmalen bestimmt, in gerader Linie langsam und mit großer Vorsicht vor.
So gelangte er erst nach geraumer Zeit an den gegenüberliegenden zerrissenen Rand des felsigen Berges. Der Abstieg schien möglich, ihn deuchte es, als ob die Wand hier terrassenförmig abfalle.
Vorsichtig, sich fortwährend des Strickes bedienend, den er um Stein- und Felszacken schlang, gelangte Alonzo Fuß für Fuß herab bis auf eine grasbewachsene Talsohle. Mit Entzücken vernahm er das Rauschen eines Baches, der zeigte den Weg und verbarg seine Spur.
Gleich darauf stand er an dem Gewässer. Er stieg hinein und ging vorsichtig mit dessen Strömung. Ihm kam es jetzt vor allem darauf an, Raum zwischen sich und den Aimaràs zu legen. Der Gang war schwierig auf dem glatten Gerölle in dem kalten Wasser. Nach wohl zwei Stunden fühlte er sich ermattet, er trat ans Land und fand eine Dickung von Nadelholz. Er hieb Zweige ab mit seiner Machete, wickelte sich in seinen Poncho und schlief ein. Seine letzten Gedanken waren die Gefährten, die wohl ratlos in dem Nebel seiner harren mochten. Er erwachte, immer noch hüllte der Nebel alles ein. Den Durst stillte er in dem kleinen Bache, den Hunger überwand er. Wieder schritt er, mit einem Stabe bewehrt, den er sich geschnitten, in dem Bache talabwärts, bis ihn ein dumpfes Rauschen stutzig machte.
Er suchte das Ufer, das von Büschen und Bäumen eingefaßt war, und ging an diesem langsam hin. Stärker wurde das dumpfe Rauschen und er erkannte, daß der Bach zu seiner Seite senkrecht in die Tiefe stürze.
Die Sonne hatte er, seitdem der Nebel aufstieg, nicht mehr gesehen, aber jetzt mußte er an der einbrechenden Dunkelheit erkennen, daß sie hinter den Bergen verschwand. Er suchte, soweit es Nebel und Dämmerung gestatteten, nach einem Platze, wo er die Nacht zubringen konnte. Er fand einen vom Sturm niedergestürzten Baum, der zwischen dichten Büschen lag; hier bereitete er sich nach Jägerart sein Lager aus Zweigen, deckte sich mit solchen zu und entschlief.
Sechstes Kapitel.
Allein durch die Kordilleren
Langsam hob sich der feuchte Nebel vom Boden empor und schwebte in langen Schwaden davon, die in phantastischen Gestalten die Höhen umflatterten und sich endlich unter einem leichten Lufthauche in die Ferne verloren. Die Sterne blickten vom klaren Himmel hernieder auf den einsamen Knaben, der schon so vieles und schweres erduldet und dort inmitten der pfadlosen Wildnis sich zur Ruhe gelegt hatte.
In wunderbarer Schönheit stieg Eos mit Rosenfingern empor - rötliche Glut hüllte die fernen Bergspitzen ein, so daß sie in überirdischem Schimmer weit in das Land hin leuchteten.
Über den Bergen erschien der Sonnenball und verwandelte mit seinen Strahlen die an Blätter und Grashalmen hängenden Tropfen in ein Meer glitzernder Brillanten. Still war es ringsumher, nur der Bach murmelte sein eintöniges und doch so melodisches Lied.
Endlich trafen die Sonnenstrahlen, die alles ringsumher verschönten und zu neuem Leben riefen, auch die Lider des stillen Schläfers und weckten ihn aus seinem ruhigen Schlummer.
Alonzo schlug die Augen auf - blickte um sich und erhob sich rasch, seine aus Zweigen bestehende feuchte Decke abschüttelnd. Sein erster Blick galt der Stellung der Sonne, sein zweiter dem Laufe des Baches.
Mit Schrecken erkannte er, daß dieser seine Richtung nach Süden nahm, daß er in seinem Bett, an seinem Ufer hingehend sich weit ab von der Straße entfernt hatte, die nach den Llanos führte, weit ab von dem Platze, den er den Gefährten seiner Flucht als Ort der Zusammenkunft bezeichnet hatte. Mit Schrecken dachte er dessen.
Er erkannte die Unmöglichkeit, den Ort der Zusammenkunft zu erreichen; er hoffte, daß ihre Tiere, die den Weg kannten, sie auch im Nebel weiter getragen haben würden, auf der Straße nach den Llanos.
Er blickte um sich.
Im fernen Hintergrunde ragten die steilen nackten Felshöhen, die er verlassen hatte, in Sonnenglut sich badend, rings um ihn erhoben sich waldige Hügel.
Seufzend beschloß Alonzo, seinen Weg allein fortzusetzen, er sah ein, daß er Fernando und dem Mestizen nicht mehr helfen konnte.
Er trank das Wasser des Baches und bändigte das nagende Gefühl des Hungers.
Dann nahm er seine Büchse auf, ging noch einige Zeit am Ufer des Baches her, in der Hoffnung ein seinen Hunger stillendes jagdbares Tier zu überraschen. Für diesen Fall war er entschlossen zu schießen, trotz der Gefahren, die das mit sich führen konnte. Nichts zeigte sich dem suchenden Auge.
Der Wald bestand aus Nadelhölzern, und Beeren oder Früchte, die seinen Hunger hätten stillen können, wuchsen hier nicht.
Nach einiger Zeit wandte sich der Bach nach Osten, das erfreute ihn, denn dort lagen die Llanos, dort lagen Leben, Freiheit und die Heimat. Er erkannte, daß er sich auf einer Hochebene befand, die nur schwach nach Osten abfiel.
Weiterschreitend sah er, aus den Büschen tretend, unerwartet ein gewaltiges Felsmassiv vor sich, dessen zerrissene Massen sich weit nach rechts und links ausdehnten; der Bach verlor sich in einer düsteren Spalte, deren schroff aufragende Wände sich nach oben hin verengten.
Alonzo stand und überlegte.
Sollte er die Felsen überklettern?
Allein er fühlte, daß seine Kraft nachließ und seine Füße waren bereits wund, zerrissen seine leichte Fußbekleidung aus Hirschleder.
Dem Wasser des Baches zu folgen war nicht ratsam, denn dessen Strömung wurde reißend, glatt war dessen Grund durch Gerölle und fast immer endeten diese Wasserläufe des Hochgebirges, da wo sie die Felsen durchbrechen, in jähem Absturz.
Er gewahrte an der Felswand, die zu seiner Rechten den Bach einfaßte, etwas wie einen schmalen Pfad auf einem vorspringenden Teil des Felsens.
Hier beschloß er den Durchgang zu versuchen. Bald umhüllte ihn die Dämmerung der schmalen Schlucht, deren Wände feucht waren. Unter ihm rauschte unheimlich das Wasser.
Gefährlich war der Pfad, jeder Fehltritt konnte den Tod bringen.
Schritt für Schritt legte der Knabe den Weg zurück, oft sich nur durch seinen Lasso vor dem Herabstürzen schützend. Lange währte die fast übermenschliche Anstrengung, die ungewöhnliche Kaltblütigkeit und großen Mut erheischte.
Mehrmals mußte er ruhen.
Endlich - endlich zeigte sich Tageslicht vor ihm, der Felsrücken war durchquert.
Der Weg, wenn man von einem solchen reden durfte, führte abwärts, und der Knabe sah eine von Bäumen durchsetzte freundliche Savanne vor sich, auf der Büsche und hohes Gras wuchsen. Er erreichte die Niederung und warf sich nieder, er war erschöpft.
Lange lag er so.
Dann erhob er sich, badete seine Füße in dem Wasser des Baches und umwickelte sie mit Streifen des Ponchos, die er mit zähen Gräsern befestigte.
Langsam schritt er dann weiter.
Trotz emsigen Suchens gelang es ihm nicht, pflanzliche Nahrungsmittel zu entdecken, und auch das Tierleben war hier gering. Er sah wohl hie und da kleinere Vögel, aber nirgends Spuren vierfüßiger Jagdtiere.
Der Hunger wurde ärger, der Knabe fühlte mehr und mehr seine Kräfte ermatten. Dennoch ging er weiter, oftmals auf seinem Wege ausruhend. Ohne Wimperzucken ertrug er die Schmerzen, die ihm seine wunden Füße bereiteten.
Bald stieg er tiefer, und die Vegetation um ihn ward eine andere, die Nadelhölzer zeigten sich nicht mehr, immergrüne Eichen und Platanen umgaben ihn, und höher und grüner wurde das Gras, durch das er schritt. Aber die Nacht kam und Alonzo mußte sich eine Schlafstätte bereiten. Er trug Blätter und Zweige nahe einer Sykomore zusammen, darauf legte er sich nieder und hungrig und erschöpft schlief er ein.
Matt erwachte er und setzte mit kranken Füßen mühsam seine Wanderung fort.
Er sah zu seinem Entzücken einen jungen Hirsch, der zur Tränke ging, eilig legte er die Büchse an die Wange, aber Hand und Auge waren unsicher. Der sonst so treffliche Schütze fehlte und das erschreckte Tier wurde flüchtig. Traurig schlich er weiter, sich begierig nach anderer Jagdbeute umsehend.
Er war endlich so erschöpft, daß er ruhen mußte.
Bald nach Mittag sah er ein langgestrecktes Felsental vor sich, das sich nach Osten öffnete, und ein warmer Lufthauch strömte ihm von unten entgegen.
Er ging hinein über Steingerölle hin, jeder Schritt bereitete ihm Qual.
Das Tal verlief in köstliche Wiesen, die von duftenden Wäldern umgeben waren. Aber er konnte sich des Anblicks nicht erfreuen, er war todesmatt und sank erschöpft am Fuße einer Eiche nieder. Die Luft war hier mild, wie er sie oben nur in abgeschlossenen Tälern kennen gelernt hatte, wenn die Sonne hoch stand.
Schwäche und Müdigkeit lullten ihn ein.
Am anderen Morgen vermochte er sich kaum zu erheben.
Aber mit Energie raffte er sich auf.
"Ich muß zu Wohnungen der Menschen kommen, sie wohnen am Abhange des Gebirges, ich weiß es."
Er schritt unsicher dahin, aber nach zwei Stunden mühevollen Marsches wollten ihn die durch Hunger und Anstrengung erschöpften Glieder nicht mehr tragen.
Er befand sich in einem Wiesental, das alte Bäume umgaben, zwischen denen Farnen und Schlingpflanzen wucherten. Er ließ sich an der Wurzel eines Baumes nieder, ihm war todeselend zu Mute.
"Muß ich hier sterben? So jung schon sterben? Mag es sein. Ich hatte wenig Freude auf der Erde. - O Vater, o liebe Mutter - bald werde ich bei euch sein."
Er versank in einen Zustand, der ihn der Außenwelt entrückte.
Wunderbare Träume von Glanz und Pracht durchfluteten tröstend sein armes Gehirn, er sah den Himmel vor sich offen und Melodien, süß und bestrickend, lullten ihn in Selbstvergessen ein.
Der laue Wind strich durch die Zweige der Bäume und die Blätter rauschten und flüsterten im Winde in jener geheimnisvollen Weise, die nur wenige der Sterblichen verstehen.
Beklagten sie den Knaben, der todesmatt zu ihren Füßen lag und die sonst so leuchtenden Augen vielleicht für immer geschlossen hatte?
Sangen sie ihm das Lied der Vergänglichkeit alles Irdischen?
Sie flüsterten und rauschten fort und fort.
"O, was sehe ich!" ließ eine rauhe Stimme sich vernehmen - "sieh dorthin, Felipe, dort liegt ein Toter."
Nach einiger Zeit sagte eine andere Stimme: "Nein, tot ist der Bursche nicht - er scheint ohnmächtig zu sein. Wie kommt der hierher?"
Alonzo vernahm diese Stimmen, wie aus weiter Ferne zu ihm dringend. Man schüttelte ihn und er schlug matt die Augen auf.
Verstört sah er sich um. Noch wirkten seine im wirren Hirn erzeugten Träume nach. Aber er sah den Himmel, die Bäume und die zwei Männer, die da vor ihm standen. Er war in diese Welt zurückgekehrt und mit dieser Erkenntnis empfand er auch wieder das ganze Elend seiner Lage.
"Oh" - stöhnte er leise - "bei der Liebe Gottes gebt - zu essen - erbarmt euch!"
"Der Junge ist dem Verschmachten nah - und ein hübscher kräftiger Bursche ist es."
"Dem können wir abhelfen."
Der eine der Männer setzte Alonzo eine kleine Flasche an die Lippen, die mit Wein gefüllt war und ließ ihn einen Schluck nehmen.
Der Jüngling fühlte, wie neues Leben durch seine Adern rann.
Dann reichte ihm derselbe Mann ein kleines Stück Maisbrot, das er vorher mit etwas Wein angefeuchtet hatte.
Alonzo aß. Einen gierigen Blick warf er auf das größere Stück in der Hand des Mannes, doch alsbald wandte er ihn auch wieder ab, trotz des nagenden Hungers, er fürchtete, unmännliche Schwäche zu verraten.
Mit klarerem Blicke sah er jetzt auch, daß zwei Männer in der Tracht der Montaneros vor ihm standen, die ein Maultier mit sich führten, das einen Saumsattel trug.
"Nur langsam, Muchacho - könnte dir schaden, zu viel auf einmal. Wie kommst du hierher? Hast dich verlaufen, wie?"
"Aus den Bergen," erwiderte schwach Alonzo.
"Kann mir's denken, sind nicht für jedermann die Berge."
Er gab ihm wieder Maisbrot und noch einen Schluck Wein. Alonzo fühlte mit Entzücken, welche Wirkung der Wein und die Nahrung ausübten.
"Du hast eine Büchse, wie ich sehe, verstehst sie auch zu gebrauchen, wie?"
Alonzo nickte.
"Nun, so kannst du nicht mehr zu Grunde gehen, hier in diesen Bergen ist Wild genug. Wo willst du denn hin, Knabe?"
"In die Llanos."
"Hm, ist noch weit genug. Erreichst aber bald Ansiedlungen, wo man dich gastfreundlich aufnehmen und dir weiterhelfen wird."
"Ihr habt mir das Leben gerettet, Sennores, ich war dem Tode nahe."
"Siehst du, der liebe Gott hat uns des Weges geschickt, solltest noch nicht sterben, Kind, mußt ihm dankbar sein."
"Ich bin es."
Wieder gab ihm der schwarzbärtige, bieder aussehende Mann etwas zu essen, der andere sah mit innigem Vergnügen zu. Beide sprachen dann leise miteinander.
"Wir müssen dich leider verlassen, Kind," sagte der, der ihn gespeist hatte, jetzt zu Alonzo, "haben wichtige Geschäfte, müssen die kostbare Chinarinde suchen. Wollen dir aber von unseren Nahrungsmitteln geben. Wenn du nach Osten gehst, triffst du bald Menschen. Mehr vermögen wir nicht zu tun."
"Ihr mögt mich getrost allein lassen, Sennores," sagte mit tiefer Dankbarkeit Alonzo, "schon fühle ich, wie die Kraft wiederkehrt, ich werde bald die Niederlassungen erreichen."
Sie legten Maisbrot, ein Säckchen mit Maismehl und einige Stücke getrockneten Fleisches neben ihn hin, die sie dem Packsattel ihres Tieres entnommen hatten, schüttelten ihm die Hand und empfahlen ihn dem Schutze des Allmächtigen. Dann zogen sie mit ihrem Maultiere davon und verschwanden im Walde.
In hoffnungsfreudiger Stimmung, an Leib und Seele gekräftigt, blieb Alonzo zurück.
Jetzt erst gewahrte er die Schönheit der Szenerie um sich her.
Trotz der Begierde nach Speise hatte er Willenskraft genug, sich zu bezwingen, einsehend wie gefährlich ihm deren Befriedigung werden könne. Aber mit neuer Lebenskraft ausgerüstet, sah er jetzt nach seiner Büchse, nach Pulverhorn und Kugelbeutel, und war befriedigt, sie in gutem Zustande zu finden.
Dann beschäftigte er sich mit seinen wunden Füßen.
Er kroch zu dem nahen Bache, wusch sie, hüllte sie in einen kühlenden Umschlag von Blättern und umwickelte sie wieder mit den Stücken des Poncho.
Von Zeit zu Zeit aß er einen Bissen.
Dann machte er sich ein Lager in den Büschen zurecht. Er mußte geduldig hier ausharren, bis seine Füße geheilt waren und sein Körper wieder Spannkraft erlangt hatte.
Von Zeit zu Zeit dachte er mit ernster Trauer seiner Gefährten auf der Flucht, hoffend, daß auch sie dem Tode entgangen seien.
Die Luft war milde, und hell schien die Sonne hernieder. Die Akazien und Weiden an dem Bache, die Farnen, die Blüten der Schlingpflanzen, der Fuchsien und Myrten, die Eichen und Platanen bildeten sein Entzücken; er war aus den finsteren Bergen des Hochgebirges in eine andere Welt geraten.
Gegen Abend sah er Hirsche am Bache, er hob die Büchse und erlegte jetzt mit sicherem Schusse einen Spießer. Er mußte frisches Fleisch, und mehr noch, neue Fußbekleidung haben.
Er kroch hin, nahm das Tier aus und schnitt aus der Decke Stücke heraus, die er, warm wie sie waren, mit der inneren Seite um die Füße legte und festband. Die Hirschhaut schmiegte sich so der Form des Fußes dauernd an.
Dann entzündete er Feuer, briet einige Stücke des jungen Hirsches und hielt ein köstliches Mahl. Ein Gefühl des Wohlbehagens durchströmte ihn und glücklich schlief er ein.
Siebtes Kapitel.
Das Tal der drei Quellen
Acht Tage sind vergangen. Auf einem Hügel, dem Myrten und Lorbeerbüsche entsprießen, den Fächerpalmen umgeben, hält auf einem Maultier Alonzo und schaut staunend auf die weite Ebene, die sich vor ihm ausdehnt.
Er hat sie einst gesehen als Kind, aber sie ist ihm neu nach seinem jahrelangen Aufenthalt in der großartigen Gebirgsnatur der Anden.
Mit Entzücken eilt sein Blick weithin über die hie und da von kleinen Gehölzen unterbrochene, mit Gras, Blumen und niedrigen Gebüschen bedeckte Fläche, bis zu dem fernen Horizonte, wo alles in violettem Schimmer verschwindet und Himmel und Erde sich zu berühren scheinen. Vogelstimmen tönen lieblich zu seinem Ohr und buntfarbige Schmetterlinge umkreisen ihn.
Es ist das Land seiner Sehnsucht, in das er hinabschaut, das Land, wo Weiße und Christen wohnen und auf der anderen Seite liegen die Berge von Bogotá.
Mit einem Gefühle unendlichen Glückes blickte er über die Llanos hin.
Die durch Hunger und Überanstrengung hervorgerufene Schwäche war bei guter Nahrung rasch gewichen und die kranken Füße in der Ruhe bald geheilt. Herabsteigend von den Bergen, hatte der Knabe, der aus indianischer Gefangenschaft zurückkehrte und so mühsam Spanisch sprach, in den Ansiedlungen der Montaneros freundliche Aufnahme gefunden. Man hatte ihm Kleider und ein Maultier gegeben.
So war er hinabgeritten zu den Llanos, immer nur von der einen Sehnsucht getrieben, unter seinen Stammesgenossen zu sein.
Er war der Gefangenschaft entronnen, er hoffte einer glücklichen Zukunft entgegen zu gehen.
Langsam ließ er sein Tier den Hügel hinabschreiten und ritt durch den sonnigen Wald, wo er die Llanos auf welligen Hügeln begrenzte.
Still und einsam lag alles um ihn her da. Nach einiger Zeit kreuzte ein Reiter seinen Weg, der, als er ihn erblickte, anhielt und ihn betrachtete.
Alonzo sah auf gutem Pferde eine hochgewachsene Gestalt vor sich, die in einen blaugestreiften Poncho gehüllt war.
Das Gesicht des Mannes, das von dem breiten Rande des Sombrero beschattet wurde, hatte wenig Vertrauenerweckendes, doch fiel das Alonzo, der an die finsteren Gesichter der Aimaràs gewöhnt war, nicht auf. Das scharf gezeichnete Profil des hageren Gesichtes, die Adlernase, neben der dunkle, stechende Augen funkelten, der Bart, der die Lippen bedeckte und lang herabfallend das Gesicht umhüllte, waren ihm nichts als das Antlitz eines Weißen, eines Stammesgenossen, deren er nicht oft genug sehen konnte.
Der Reiter, der eine Büchse auf dem Rücken trug, maß die jugendliche Erscheinung Alonzos mit forschenden Blicken.
Als der ihm näher gekommen war, fragte er ihn: "Bist du hier zu Hause, Sennorito?"
Mit der Vorsicht, die ihm seine Gefangenschaft zur zweiten Natur gemacht, erwiderte Alonzo: "In den Bergen, Sennor, nicht hier."
"Kannst du mir sagen, ob ich auf dem Wege zur Calugaschlucht bin?"
"Weiß es nicht, Sennor."
Mit einem in den Bart gemurmelten Schimpfwort ritt der Mann davon, ohne dem Knaben weitere Beachtung zu schenken.
Alonzo setzte seinen Weg fort, und als er auf eine kleine Richtung traf, die ein Bach durchrauschte, hielt er, stieg ab, pflockte sein Tier an und ließ sich unter einer Gruppe schattenspendender Ceibabäume nieder.
Der vereinsamte Knabe, der, unter den rohen Aimaràs lebend, mehr verwildert war, als er selbst es wissen konnte, war nur von dem einen Gedanken fortgetrieben worden, seine Freiheit zu gewinnen. Diese Freiheit hatte er erlangt, aber er war klug genug, sich nach der Aufregung der Flucht, nach dem ersten Rausche des Glückes, die Frage vorzulegen, was er nun damit beginnen solle?
Er entsann sich deutlich des glänzenden Hauses in der Stadt Bogotá, das er als Kind bewohnte, umgeben von der Liebe der Eltern und einer ergebenen Dienerschaft.
Er wußte auch, daß der Name seines Vaters ein hochangesehener war. Seine Geschwister standen vor seinem Geistesauge, ein jüngerer Bruder und zwei kleine Schwestern, die der Tod so früh und so jäh hinabriß.
Einem Traume gleich lag das alles hinter ihm.
Es waren fünf Jahre, ja fünf Jahre mußten seit dem Unglückstage vergangen sein, der ihm durch Mörderhand seine Lieben raubte, ihn einsam machte auf Erden und ihn in die Gewalt der Wilden brachte.
Und mit viel Liebe war er umgeben worden vom Vater, Mutter, Großvater und dem jüngeren Bruder seines Vaters, Don Miguel.

Alonzo ließ sich im Schatten einiger Bäume nieder.
Hatte er früher oft darüber nachgedacht, welche Schritte er tun würde, wenn es ihm gelänge, die Freiheit zu gewinnen, so noch mehr in den letzten Tagen. Vater, Mutter, Geschwister waren tot - ach, wer lebte noch von den Seinen?
Er hatte sich vorgenommen, nach Bogotá zu gehen und dort Blutsverwandte aufzusuchen. Vor allem seinen Onkel. Aber waren sie noch am Leben? Hatten die Feinde seiner Familie Don Miguel verschont? Es war eine ihm endlos dünkende Zeit verstrichen seit dem Unglückstage im Tale der drei Quellen.
Man hatte auch ihn, den damals noch nicht elfjährigen Knaben, sicher für tot gehalten.
Und wenn er nun kam, fast zum Jüngling erwachsen, wenn er kam, so unähnlich den Caballeros des Landes - er entsann sich der glänzenden Erscheinung seines Vaters und seiner eigenen schönen Kleidung - im zerrissenen Poncho und sagte: "Ich bin Alonzo d'Alcantara, den ihr für tot beweintet!" wie würde man ihn empfangen?
An Erbschaftsrechte dachte der unwissende Knabe nicht. Aber er hatte oft, seit er der Aimaràsprache mächtig war, die Gespräche des Kaziken mit anderen belauscht und erfahren, daß sein Vater dem Haß tödlicher Feinde erlegen sei, ein Haß, der auch ihm, dem Sohne gelte, und daß er, Alonzo, nur als Gefangener bewahrt werde, um zu geeigneter Zeit an diese verkauft zu werden.
Er war Alonzo d'Alcantara, der Sohn Don Pedros, eines großen Caballeros und selbst ein Caballero, das war etwas mehr als die Kazikenwürde eines rothäutigen Indianers, sagte er sich mit kindischem Stolze, aber der Name war gefährlich für den, der ihn trug, das wußte er. Seine indianische Vorsicht hatte ihn davon abgehalten, ihn selbst Don Fernando und dem Mestizen mitzuteilen.
War gleich sein Ziel Bogotá, so dachte er doch nicht daran, seinen Namen eher dort zu nennen, ehe er alle Umstände erkundet hatte und vor allem ermittelt, wer von seinen Verwandten noch lebe.
Sein Lebensunterhalt machte ihm wenig Sorge. Er war an Entbehrungen aller Art gewöhnt, abgehärtet, stark, ein geübter Jäger und sicherer Schütze. Das Wild, dachte er sich, gibt Nahrung, die Llanos Futter für das Tier, und der Himmel war sein Dach.
Dieses große Kind wußte wenig von der Welt, die ihn erwartete, noch weniger von den Veränderungen und Zerstörungen, die die grausamen Bürgerkriege unter Menschen und Dingen hervorgerufen hatten.
Er war in der Freiheit, die er so mühsam errungen, so glücklich, daß er die Zukunft getrost dem Walten einer höheren Macht überließ. Er hoffte die Stätten seiner Kindheit wieder zu sehen, in denen er so glückliche Tage zugebracht und rief sich in süß schmerzlicher Erinnerung die Bilder vergangener Zeiten zurück.
So seinen Gedanken hingegeben, vernahm er zu seinem nicht geringen Erstaunen ein leise zu seinem Ohr dringendes silberhelles Lachen.
Er lauschte - es kam von jenseits des kleinen Baches.
Er erhob sich, ging durch den seichten Bach und die Büsche, die ihn jenseits umsäumten, und hatte, vorsichtig durch den Rand lugend, ein liebliches Bild vor sich.
Auf einer Waldblöße, ähnlich der, die er verlassen, spielte ein junges, hellgekleidetes Mädchen mit einem kleinen Hunde.
Sein Herz bebte vor Entzücken, er glaubte nie etwas Lieblicheres gesehen zu haben, als das schöne Kind mit dem lockigen Haar, der zarten Gestalt, anmutig in jeder Bewegung, wie sie da mit dem hübschen Tier spielte.
Er sah eine Zeitlang wie bezaubert zu. Endlich warf sie dem Hund einen Ball hin und sprang mit dem Ausruf: "Such, Mignon," lachend in die Büsche. Der Hund lief dem Ball nach und erhaschte ihn.
Von dem Aste eines nahen Baumes schnellte ein Jaguar herab, ein Schlag seiner Pranke und mit grellem Wehschrei brach der Hund zusammen.
"Mignon!" rief hierauf eine angstvolle Stimme und das junge Mädchen trat aus den Büschen hervor, von jähem Schreck wie erstarrt stehen bleibend, als sie das Raubtier vor sich erblickte. Die gewaltige Katze zog sich vor der hellgekleideten Gestalt knurrend etwas zurück, ihre Beute verlassend, kauerte nieder und schlug mit dem langen Schweife die Erde, während ihre grünlichen Lichter unheimlich funkelnd auf das Mädchen gerichtet waren. Das Tier bemaß den Sprung.
Da hob sich Alonzos Büchse - entlud sich und durch den Kopf geschossen lag die Bestie regungslos da, nur ein krampfhaftes Zittern durchlief ihren Leib.
Der Schreckensruf eines Mannes ließ sich hören; ein alter Herr in dem Anzug der wohlhabenden Hacienderos des Landes tauchte aus den Büschen auf und kam zur rechten Zeit, um das zum Tod erschreckte Mädchen vor dem Umsinken zu bewahren. Sein Blick fiel bald auf die ihre Glieder von sich streckende Bestie, bald auf das bleiche Gesicht des Kindes. Er rief um Hilfe, um Wasser, und zwei Peons eilten herbei, die mit nicht geringem Staunen den toten Jaguar sahen.
Alonzo, der Jägerregel folgend, lud seine Büchse und trat dann aus den Büschen, so nah, daß er des Mädchens Angesicht sehen konnte, das bleich mit geschlossenen Augen an des alten Mannes Brust ruhte.
Niemand achtete seiner, denn alle Aufmerksamkeit galt dem ohnmächtigen Kinde. Mit leuchtenden Augen schaute Alonzo die Kleine an, ein Engel deuchte sie ihm in ihrer kindlichen Schönheit.
Da öffnete sie die Augen und ihr Blick traf auf den des Knaben, der sie so bewundernd anstarrte, schlossen sich aber dann wieder.
Die Peons liefen nach Wasser, eine ältere Sennora und ein dienendes Mädchen, eine Mulattin, eilten herbei - alle umdrängten das Kind.
Alonzo, um den sich niemand kümmerte, der bei der Erregung aller kaum bemerkt zu werden schien, warf noch einen Blick auf das Mädchen, nahm die Büchse in den Arm, ging zurück zu seinem Maultier, stieg in den Sattel und ritt langsam mit überaus glücklichem Gesicht nach Norden zu. Ein Zeltlager, das er in kurzer Entfernung erblickte, sagte ihm, daß hier eine vornehme Familie die Waldeinsamkeit aufgesucht habe.
Nach einiger Zeit hörte er den Galopp eines Pferdes hinter sich und gleich darauf erschien einer der Peons, die er eben gesehen hatte.
"Warte doch, Bursche," rief der Mann schon in einiger Entfernung, "was reitest du denn davon?"
Alonzo hielt und wandte dem Mann sein ernstes, stolzes Gesicht zu, denn der Ton, in dem er ihn anredete, mißfiel ihm.
"Vorwärts, du mußt gleich zurückkommen, Sennor will dir danken. Beeile dich, Bursche, man läßt keinen Sennor warten."
Alonzo maß ihn ernsten Blickes von Kopf bis zu den Füßen.
"Sage deinem Sennor, daß er mir keinen Dank schuldig ist, und daß ich ihm rate, künftig höflichere Diener mit Botschaften auszusenden."
Alonzo hatte außer der Haltung und dem kühnen, stolzen Ausdruck des Gesichts nichts vom vornehmen Herrn an sich, sein zerrissener Poncho, der vom Regen arg mitgenommene Hut, die rauhe Fußbekleidung deuteten mehr auf den Bettler als den Caballero.
Der verblüffte Peon erwiderte: "Du bist ja wohl nicht recht gescheit, du Estupido, du?"
Unter dem drohenden Blick der dunklen Augen Alonzos war dem Diener doch nicht recht wohl. Alonzo sagte aber ruhig: "Empfiehl mich der Sennorita, und ich machte ihr das Jaguarfell zum Geschenk. Fort!" herrschte er den Diener an, als dieser zögerte, und eingeschüchtert wandte der sein Roß und galoppierte zurück.
Alonzo ritt weiter, immerfort an das zarte Kind denkend, das er vor dem wilden Tiere beschützt hatte.
Er rastete während der Mittagshitze und setzte dann seinen Weg nach Norden weiter fort, bis die Sonne sich zu senken begann.
Er betrat ein Tal, lieblich und lauschig. Malerische Felsgruppen engten es ein, auf denen Wachs- und Fächerpalmen wuchsen; einige mächtige Ceiba- und Terebinthenbäume bildeten eine Gruppe in dessen Mitte. Blühende Sträucher ringsum, auf denen Kolibris und Schmetterlinge gaukelten, erfreuten das Auge.
Staunend hielt er an - fast erschreckt. Er blickte sich um - an drei Stellen der felsigen Einfassung rauschte in kleinen Kaskaden silberhell das Wasser der Berge herab.
Einem Blitze gleich zuckte es durch seine Seele - schaudernd erkannte er, daß er an der Stätte weile, an der seine Lieben den jähen Tod durch Mörderhand fanden. Ein unendliches Weh zog durch sein Herz. Das war das Tal der drei Quellen.
Endlich fand er Worte für den unsäglich herben Schmerz.
"O Vater, Mutter, o ihr Lieben alle!" entrang es sich seinen Lippen. "O warum muß ich leben und die Unglücksstätte sehen, die euer Herzblut trank?"
Der ganze Schrecken jener Stunde stand vor seiner Seele. Er sank vom Maultier auf die Knie, betete und weinte herzbrechend. Es war lange her, daß Tränen seine jungen Augen gefeuchtet hatten.
Langsam ließ die furchtbare Erregung seiner Seele nach.
"Ihr seid im ewigen Himmelslicht und seht auf mich herab. Bittet für mich am Thron des Ewigen."
Alonzo stand endlich auf.
Er beschloß, die Nacht an diesem ihm so schreckenvollen und doch für ihn geheiligten Ort zuzubringen.
Er nahm sein Maultier am Zügel und sah sich nach einer Lagerstatt um. Während er noch so stand, ritt ein Mann, der aus den Bergen kommen mußte, langsam durch das Tal der Ebene zu.
Er war auf der anderen Seite der Gruppe von Ceibabäumen hervorgekommen, und sah Alonzo nicht. Ein Schuß hallte an den Felsen wider, der Mann wankte und neigte sich nach vorn über.
Alonzos Auge überflog, trotz der jähen Überraschung, hierbei die umbuschte Felswand, sah den Pulverdampf und glaubte eine Gestalt in blau gestreiftem Poncho dort zu erkennen.
Ohne sich zu besinnen, nahm er seine Büchse zur Hand und lief auf den verwundeten Mann zu, der sich nur mühsam im Sattel hielt.
Während er ihn mit der linken Hand zu stützen suchte, schaute er nach der Stätte, woher der Schuß gekommen und legte mit der Rechten seine Büchse in dieser Richtung an. Doch nichts zeigte sich seinem Auge.
"Seid ihr verletzt?" fragte er dann den Mann, dessen runzelvolles, graubärtiges Gesicht sich über ihn neigte.
"Ja, und es wird für dieses Leben genug sein."
"Das möge ein gütiges Geschick verhüten!"
"Fort, oder wir bekommen den zweiten Schuß."
Alonzos Falkenblick glaubte eine Bewegung in den Büschen, von wo aus der Schütze gefeuert haben mußte, wahrzunehmen, und schoß nach der Stelle hin. Eine stärkere Bewegung zeigte dem Jüngling an, daß der Schütze noch da sei.
"Hast du gesehen? Getroffen? Wer war es?"
Alonzo sagte dem Verwundeten, warum er geschossen und was er bemerkt habe.
"Du bist ein entschlossener Knabe. Es wird einer von den farbigen Schuften gewesen sein."
"Gebt mir eure Büchse." - Der Alte trug sie auf dem Rücken.
"Nimm sie, sie ist geladen -"
Alonzo nahm dem Mann die Waffe vorsichtig ab und bemerkte, daß Blut sein Hemd auf dem Schulterblatt rötete.
Die Büchse schußfertig in der Hand, die Büsche im Auge, führte er rückwärts gehend das Pferd, an dessen Hals sich der Verwundete klammerte, aus dem Bereich des Waldes heraus.
Als sie einige einsam in der Ebene stehende Palmen erreichten, half er dem Manne aus dem Sattel.
"Erlaubt, daß ich nach eurer Wunde sehe." Alonzo lüpfte des Mannes Hemd.
"Blutet sie stark?"
"Ich kann nur ganz wenig Blut sehen."
"Hier in meiner Tasche ist Heftpflaster," der Mann trug eine Tasche am Gürtel - "lege es drüber."
Das tat der Knabe.
"So, es ist gut, die Kugel sitzt drin in der Brust, die holt kein Mensch heraus, lange mache ich es nicht mehr." Er stöhnte dumpf und sagte halblaut: "Ich hätte diesen Ort des Unheils vermeiden müssen." Er sah jetzt seinen Helfer genau an und fragte: "Wer bist du und wie kommt es, daß du Worte der Aimaràsprache in deine Rede mischest?"
In seiner Erregung war Alonzo mehr in das ihm geläufigere Indianeridiom gefallen, als er wußte.
"Ich komme von den Aimaràs her, nach jahrelanger Gefangenschaft. Auch für mich war dieses Tal einst ein Ort des Unheils, von hier führten sie mich fort in die Berge, die blutigen Mörder."
Des Alten Gesicht, das keineswegs etwas Freundliches oder Vertrauenerweckendes hatte, sondern einen Zug von Härte, den der energisch unterdrückte Schmerz der Wunde nicht milderte, zeigte nach diesen Worten einen Ausdruck, der fast dem des Entsetzens glich.
Mit weit aufgerissenen Augen starrte er Alonzo an.
Dann sagte er mit heiserer Stimme: "So bist du Don Pedros Sohn?"
Alonzo war von dieser Frage jäh überrascht und erwiderte: "Du sagst es, ich bin sein Erstgeborener, der einzige, der damals den Tag des Schreckens überlebt hat."
Er sah in schmerzlicher Erinnerung vor sich nieder und bemerkte nicht, wie der alte Mann sein Gesicht in der rechten Hand verbarg. Die andere hing gelähmt hernieder.
"O - es geschehen noch Wunder" - stammelte er vor sich hin in einem Tone, der eine tiefe seelische Erschütterung bekundete.
"Sie wissen von dem Schreckenstage, Sennor?"
"Ja, ja, ich weiß - ich weiß. Und du bist d'Alcantaras Erstgeborener - du?"
In des Mannes Gesicht, als er jetzt den Blick wieder auf Alonzo richtete, lag etwas Scheues, fast Ängstliches, das den harten Zügen sonst fremd sein mußte, und ein Zittern lief über seinen Leib. Leise wiederholte er: "Pedro d'Alcantaras Sohn!"
"Sie haben meinen armen Vater gekannt?"
Der Verwundete antwortete nicht, ein Stöhnen entrang sich seiner Brust, ein schmerzvolles Stöhnen. Alonzo schrieb es der schweren Verwundung zu.
"Hilf mir aufs Pferd," sagte der Mann dann hastig, "bringe mich nach Hause - ich wohne nicht weit - ich muß noch einige Stunden leben - ich habe noch etwas auf der Welt zu tun - hilf mir -"
Der Knabe, der wieder im vollen Besitz seiner Kraft war, half dem Mann in den Sattel. Stumm ertrug dieser den Schmerz und klammerte sich an dem Sattelknopf fest.
"Steig auf dein Tier, reite neben mir und stütze mich."
So tat Alonzo und beide bewegten sich im Schritt vorwärts, der Alte von Zeit zu Zeit dumpfe Klagelaute ausstoßend, die zu unterdrücken er sich vergeblich bemühte.
Nach einer Stunde erreichten sie ein kleines Haus am Ufer eines Flusses.
Eine alte Negerin erschien in der Tür und vernahm mit Schrecken, daß ihr Herr verwundet sei.
Alonzo und sie trugen den Kranken zu seinem Lager.
"Wasser!"
Man gab es ihm.
Dann lag er eine Zeit schweigend, ermattet da.
Endlich sagte er, kräftiger als man erwarten konnte: "Erbarme dich meiner, Kind, reite zur Hacienda Sennor Vivandas, nimm meinen Rappen, er ist rasch, und hole mir den Cura von dort. Rahel wird dir den Weg zeigen. Der Cura ist der Bruder des Sennors. Sage ihm, Enriquez Gomez liege im Sterben und wolle beichten. Sage ihm, es sei wichtig für den Staat und für viele Menschen, daß er meine Beichte höre und aufschreibe, er soll Papier und Tinte mitbringen."
"O, beides ist hier, Don Enriquez," sagte die Negerin.
"O, so - dann her damit - die rechte Hand ist noch zu gebrauchen. Reite, reite, mein Kind, laß mich nicht ohne Beichte und Absolution sterben."
Der erschütterte Knabe versprach sein Bestes zu tun.
"Noch eines," sagte der Verwundete im Flüstertone, "wenn du mich nicht lebend wieder siehst - nenne deinen Namen nicht - niemand - hüte dich vor de Valla - vor de Valla, er trachtet dir nach dem Leben - reite, reite -"
Den Kranken nicht noch mehr zu erregen, ging Alonzo hinaus; die Negerin folgte ihm und zeigte ihm den angepflockten Rappen. Alonzo sattelte ihn, nahm seine wieder geladene Büchse und stieg auf.
"In welcher Richtung liegt die Hacienda, Madrecilla?"
Sie zeigte ihm einen glänzenden Stern am Himmel. "Reite auf diesen zu, Söhnchen, du wirst dann bald, wenn der Boden ansteigt, die Lichter von Otoño sehen. Der Rappe kennt die Llanos auch bei Nacht, du reitest sicher."
Fort ritt Alonzo auf den Stern zu, das Pferd zur schnellsten Gangart nötigend. Schattenhaft sausten Sträuche und Bäume an ihm vorbei, das Pferd war feurig und ging sicher.
Nach einem scharfen Ritte sah er vor sich, unter ihm liegend, einzelne Lichter, er ließ das Tier etwas verschnaufen und jagte dann weiter. Bald ritt er zwischen Feldern auf gebahnten Wegen einher und hielt gleich darauf vor der Veranda eines erleuchteten Hauses.
Er fragte nach dem Cura und man führte ihn in ein Parterrezimmer, wo er einen älteren, würdig aussehenden Herrn in Priestertracht antraf. Er teilte diesem den Wunsch des schwer verwundeten Mannes mit.
Ernst, sehr ernst hörte ihn der Geistliche an und sagte dann: "Ich will seinen Wunsch erfüllen und mit dir reiten." Er klingelte, bestellte sein Maultier, befahl, daß ein Peon mit einer Fackel vorausreiten solle, packte, während diese Befehle ausgeführt wurden, Papier und Schreibzeug in eine Tasche, auch eine Flasche Wein und gleich darauf ritten er und Alonzo, der Fackel des Peons folgend, der Hütte des verwundeten Gomez zu. Dieser, der glücklicherweise bis jetzt nur leichtes Wundfieber hatte, war erfreut, als er die Ankömmlinge erblickte.
Er befahl, daß alle das Haus verlassen und sich diesem fern halten sollten, und blieb mit dem Geistlichen, der sein Schreibzeug hervorholte, allein.
Erst nach längerer Zeit wurden die Negerin und Alonzo hereingerufen.
Der Geistliche war sehr ernst und betrachtete Alonzos Züge mit großer Aufmerksamkeit. Mit dem Kranken war eine starke Veränderung vor sich gegangen -, er trug den Zug des Todes im bleichen Antlitz. Lange blickte er auf Alonzo. "Reiche einem Sterbenden die Hand, Kind."
Alonzo gab sie ihm.
"Was geschehen konnte, deinen ferneren Lebensweg zu ebnen, armer Knabe, ist geschehen. Vertraue hier dem Cura und folge ihm, er ist dein Freund, er weiß alles."
Es lag eine Weichheit in der Stimme, in den Zügen des Mannes, die umso eindringlicher wirkte, als der Todesengel zu seinen Häupten stand.
"Du hast mir beigestanden in der Not - Sohn Don Pedros, Gott segne dich dafür - sei glücklich, glücklich - erbarme dich - verzeihe -"; er schloß die Augen und lag da wie ein Toter - die letzte Ölung hatte er schon empfangen -, plötzlich hob er das Haupt wieder, öffnete die bereits glanzlosen Augen - "Cura - die Briefe - die Briefe von - ihm - die Brie-"; er sank zurück und war tot.
Der Geistliche betete für seine Seele und schloß: "Mag Gott ihm ein gnädiger Richter sein."
Die Negerin weinte.
"Don Enriquez hat dir sein Eigentum hinterlassen, Rahel. Morgen wollen wir ihn der Erde übergeben. Komm mit mir, Alonzo, zur Hacienda," wandte er sich an den Knaben, "du bist mir anvertraut, mein armes Kind, und ich werde das Vertrauen nicht täuschen."
"Ich folge dir, Cura."
Schweigend legten sie den Weg zur Hacienda zurück, wo man Alonzo ein Zimmer anwies.
Am anderen Tage wurde Enriquez Gomez beerdigt. Der Cura durchstöberte alles nach den Briefen, von denen der Sterbende gesprochen hatte, fand aber nichts.
Als sie zur Hacienda zurückkehrten, war eben der Haciendero Sennor Vincente Vivanda, der ältere Bruder des Geistlichen, angelangt, der mit seinem Töchterchen eine Fahrt in die Berge gemacht hatte.
Eine helle melodische Stimme erklang im Jubeltone: "Das ist er - Papa -, das ist er -, der mich gerettet hat -," und mit jäh emporschießender Freude sah Alonzo das zarte Kind vor sich, das er durch einen glücklichen Schuß auf die gefährliche Katze vor Unheil bewahrt hatte.
Achtes Kapitel.
Zwei Ehrenmänner
Das alte Santa Fé de Bogotá, die Hauptstadt Neugranadas, liegt hoch über den Llanos zwischen Bergen eingebettet. Überragt wird es von den nahen, mit Kapellen geschmückten schroffen Felskegeln Guadalupe und Monserate und weiterhin schimmern die schneebedeckten Riesen der himmelanstrebenden Kordilleren. Doch freundlich liegt es da inmitten einer gigantischen Umgebung.
Schräge rote Ziegeldächer und gelbe oder weiß getünchte Lehmwände geben der Stadt ein freundliches Kolorit, das durch die dazwischen aufragenden schlanken Eukalypten noch gehoben wird.
Die Doppeltürme der Kathedrale, die Kuppel von Santa Clara, der weiße Turm von San Franzisko grüßen schon auf weite Ferne hin, über die nach Ost und Süd sich ausdehnenden Hochebenen, nach den Bergen hinauf.
- Schon neigte sich die Sonne den unwirtlichen Höhen im Westen zu, sie mit ihren letzten Strahlen in einen goldigen Schimmer von seltener Schönheit hüllend, als auf müdem Pferde ein Mann, der einen langen Weg hinter sich haben mußte, von Süden her in die Stadt einritt.
Der breitrandige Hut, der hie und da durchlöcherte Poncho, die langen Reitgamaschen waren mit Sand und Staub bedeckt, gleich dem Fell des Tieres, das er ritt, und auch die Haltung des Mannes deutete auf Erschöpfung.
Seine Gestalt war lang und hager, das scharf geschnittene Profil wies eine starke Habichtsnase auf, zu deren Seiten unter dichten Brauen zwei dunkle Augen leuchteten, deren Blick etwas vom lauernden Raubtier an sich hatte.
Von dem unteren Teile des Gesichtes war wenig zu sehen, denn der Mann trug nach Art derer, die aus den Llanos kamen, ein seidenes Tuch um Mund und Kinn als Schutz vor dem Staube des Weges.
Er trug auf dem Rücken einen Karabiner und den landesüblichen Lasso am Sattelknopf.
Die Leute, die vor den Häusern saßen oder sich in der Straße bewegten, achteten des Reiters kaum; eine solche Erscheinung war ihnen nichts Neues.
Der Mann schien seinen Weg zu kennen, denn ohne zu fragen, bog er in eine Quergasse ein, die hier in der Vorstadt San Diego noch Häuser aus der Zeit Philipps II. aufweist, und hielt vor einer Posada, die durch eine Weintraube als solche kenntlich gemacht wurde.
"Wenn der Alte noch lebt," murmelte der Reiter vor sich hin, "können wir sogleich die Probe machen, ob mein Gesicht in Bogotá noch bekannt ist."
Als niemand kam, ihm das Pferd abzunehmen, begann er sich bemerkbar zu machen: "Ist denn in dieser Herberge niemand, der einem Caballero das Pferd abnimmt?" rief er.
Das brachte endlich den Posadero, eine fleischige Gestalt mit dickem, gutmütigem Gesicht, in den Torweg, der zum Patio führte.
"Sachte, sachte, Sennor," sagte der Posadero, "wir sind hier an Höflichkeit gewöhnt."
Der Reiter hatte das Tuch, das den unteren Teil seines Gesichtes einhüllte, entfernt. Lippe und Kinn zierten ein Schnurr- und Knebelbart, die das gebräunte Antlitz nur noch hagerer erscheinen ließen.
"Er ist es," murmelte er vor sich hin, während der Wirt ihn aufmerksam musterte. Und er fügte laut hinzu: "Nun, ich hatte mir in der berühmten Posada Don Geronimos einen freundlicheren Empfang erhofft."
Dies schien dem Wirt, der den Fremden immer noch anstarrte, zu schmeicheln, denn er sagte höflicher: "Seid willkommen, Sennor, möge es Euch in meiner schlechten Behausung gefallen. Pepe," rief er einem Peon zu, "nimm dem Caballero das Pferd ab."
Der Bursche nahm das Tier am Zügel, der Reiter stieg ab und folgte dem Wirt in ein Zimmer des Erdgeschosses, das als Schenkstube diente und in diesem Augenblick von Gästen leer war.
Der Fremde warf den Poncho ab, stellte den Karabiner in die Ecke und sagte: "Rasch einen Schluck Aguardiente, Mann, ich muß den Staub hinunterschlucken."
Der Wirt brachte ihm ein Glas des scharfen Getränkes, den Reisenden dabei fortwährend musternd. Dieser trank und verlangte dann nach Speise. Der Posadero stellte ihm ein gebratenes Huhn und frische Tortillas in Aussicht und begab sich hinaus, um das Abendbrot für seinen Gast zu bestellen.

"Seid willkommen, Sennor! Möge es Euch in meiner schlechten Behausung gefallen."
"Er hat mich nicht erkannt, der Brave," sagte der Reisende vor sich hin, als der Wirt fort war, "das ist mir doch lieb."
Er ging mehrmals auf und ab und murmelte vor sich hin: "Es ist des Löwen Höhle, in die ich mich wage, indessen hoffe ich, Don Carlos wird Vernunft annehmen. Mit den Häuptern der Liberalen will ich nichts zu tun haben, sie wissen einen Mann wie mich nicht zu schätzen, und ob sie Geld haben, ist fraglich. Don Carlos hat die Macht und Geld, wagen muß ich es."
Der Wirt kam zurück.
"Ihr müßt mir sagen, Sennor, wer Ihr seid und was für Geschäfte Euch hierher führen. Der Alkalde ist seit einiger Zeit sehr neugierig, was Fremde betrifft, wir Posaderos haben strenge Befehle."
"Gleich, Sennor, doch vorerst sagt mir, ob Excellenza de Valla in der Stadt ist?"
"Excellenza de Valla?" fragte erstaunt der Wirt, "unser hochgebietender Herr Minister? Ich glaube wohl."
"Das ist gut, denn ich muß Excellenza noch heute meine Aufwartung machen. Das ist mein Geschäft hier, und mein Name -," er sah mit einem spöttischen Lächeln in das dicke, gutmütige Gesicht des Wirtes, "mein Name lautet Sancho Tejada, ehemals Lugarteniente im Heere der Republik."
Wäre das Haus eingefallen, der Wirt hätte nicht erschrockener aussehen können, als bei Nennung dieses Namens.
Mit dem Ausdrucke des Entsetzens starrte er in das Gesicht des Fremden.
"Du scheinst wenig Gedächtnis für die Züge deines gehorsamen Neffen zu haben, mein teuerster Oheim, doch ich hoffe, dein Herz ist noch das alte geblieben."
Der Posadero schien sein Entsetzen überwunden zu haben, denn seine Miene wurde finster und drohend.
"Wie kommst du hierher? Was willst du hier?" Seine Stimme bebte vor innerer Erregung.
"Ah, mich trieb die Sehnsucht hierher, dein würdiges Antlitz wieder zu sehen."
"Verlaß augenblicklich die Schwelle meines Hauses. Wenn ich nicht nach den Alguacils rufe, verdankst du es nur der Erinnerung an meine Schwester."
"Das ist wahrlich ein schöner Empfang. Aber sei vernünftig, Oheim -"
"Was willst du hier?"
"Ich habe, wie ich dir schon sagte, Geschäfte mit Excellenza de Valla."
"Du?"
"Ich. Sei ruhig, Don Geronimo, ich werde dir nicht lange zur Last fallen."
"Wie kannst du dich hierher wagen; du Schandfleck einer ehrlichen Familie? Hierher, wo der Galgen auf dich wartet?"
"Pah, politischer Haß diktierte das Urteil, ich bin heute wie damals ein echter Caballero."
"Und du willst Excellenza de Valla aufsuchen? Er läßt dich hängen ehe du ein Ave Maria beten kannst."
Tejada erbleichte doch etwas, sagte aber dann: "Torheit, ich komme, ihm einen wichtigen Dienst zu leisten, und hoffe, mir seine volle Gunst zu erwerben."
"So? Merkwürdig. Was willst du denn nun bei mir?"
"Ich konnte es unmöglich vermeiden, dir meinen Besuch zu machen, als ich Bogotá betrat," erwiderte Tejada mit frechem Cynismus, "nächstdem aber wollte ich dich bitten, mir einen Poncho zu leihen für meinen Besuch bei Excellenza, denn der meinige ist durch die Reise etwas mitgenommen, und mir ein gutes Pferd für kurze Zeit anzuvertrauen, du sollst beides ehrlich wieder haben."
"Gut. Du sollst Poncho und Pferd haben, ich kaufe dich damit von deiner Gegenwart los. Betrittst du aber wieder mein Haus, oder sagst du, daß ich dein Onkel bin, so zeige ich dich dem Alkalden an."
"Ich sehe, daß deine verwandschaftlichen Gefühle nicht sehr stark sind, aber ich muß den Kummer darüber unterdrücken. Ah, da kommt das Huhn! Gestatte mir zu speisen und dann will ich dein Haus verlassen."
Ein Aufwärter setzte ihm die Speisen vor und der Posadero ging achselzuckend mit dem Ausdruck des Zornes in dem fleischigen Gesicht hinaus.
Sancho Tejada speiste mit vortrefflichem Appetit.
Don Geronimo kam wieder herein, warf ihm einen noch fast neuen Poncho zu und sagte: "Das Pferd steht draußen gesattelt."
Tejada erhob sich, warf den Poncho um und sagte: "Ich vermute, Excellenza wohnt im Hause der Alcantaras?"
Geronimo nickte.
"So sage ich dir meinen herzlichen Dank, teuerster Oheim, und verspreche dir, mich nicht wieder vor deine Augen zu bringen."
Er nahm seinen Karabiner und ging hinaus.
Don Geronimo sah ihm mit finsterer Miene nach.
"Muß mir dieser verkommene Bursche über den Weg laufen, ich hielt ihn längst für tot. Was hat er nur mit Sennor de Valla? Wahrscheinlich will ihm der Schuft einige echte Patrioten verraten und sie an das Messer liefern. Gott möge sie schützen."
Mit sorgenvollem Antlitz ging der alte ehrliche Posadero nach dem Patio, überzeugte sich, daß sein Gast davongeritten war, und ließ das Tor schließen.
Auf einem guten Pferde, mit einem sauberen Poncho umkleidet, ritt Sennor Tejada langsam durch die engen Straßen der Vorstadt. Seine Brauen waren nachdenklich zusammengezogen. "Er ist ein äußerst kaltblütiger Bursche," murmelte er, "und schlau wie ein Andenfuchs, aber ich muß es mit ihm versuchen." Er faßte in die Tasche seines weiten Beinkleides und fühlte nach einem kleinen Doppelpistol, das er darin verborgen trug.
"Ich muß hier wieder Fuß fassen oder ich werde zu Tode gehetzt, und Excellenza sollen ja in Neugranada allmächtig sein. Wie der Zufall spielt! Ich weiß eine Zeit, wo de Valla froh war, wenn ich ihm eine Doublone borgte. Aber vorsichtig, der Mann hat nicht nur die Macht, er versteht auch, sie rücksichtslos zu gebrauchen, und Freunde habe ich hier gerade nicht."
Er war bis zu den breiteren und neueren Straßen gekommen, die auch besser beleuchtet waren als die alten Gassen der Vorstadt San Diego, gab seinem Gaule die Sporen und galoppierte nach der Plaza, wo das Haus lag, wo der Minister wohnte. Tejada kannte das Haus, das vor Zeiten ein Alcantara gebaut hatte, und sah das vornehme, umfangreiche, im Stile des sechzehnten Jahrhunderts errichtete Gebäude bald vor sich. Einige Fenster waren erleuchtet und das eiserne Gittertor, das zum Patio führte, offen. Zwei Pechpfannen erhellten mit ihrem rötlichen Schein den Eingang.
Tejada ritt in leichtem Galopp an und befand sich gleich darauf im Hofe.
Er zuckte doch zusammen, als er dort im Scheine eines Feuers einige Lanceros gewahrte, deren gesattelte Pferde unweit angebunden waren.
"O, der Mann hat eine Leibwache?" Dennoch ritt er keck bis zu der Treppe, die zu dem Eingang ins Haus führte. Ein Peon nahte sich ihm, blieb aber in einiger Entfernung stehen, auf der Treppe erschien ein Diener.
"Melde mich Excellenza."
"Excellenza wird schwerlich zu sprechen sein. Wen soll ich melden?"
"Einen Mann, der eine Botschaft aus dem Tale der drei Quellen bringt, das wird genügen."
Die Diener des Ministers waren gewöhnt, allerlei Gestalten oft zu ungewöhnlicher Stunde bei ihrem Herrn erscheinen zu sehen, die nicht immer ihren Namen nannten; der Mann musterte den Reiter, so gut es bei der ungenügenden Beleuchtung gehen wollte, und ging ins Haus. Nach einiger Zeit erschien er wieder und sagte: "Excellenza wollen Euer Gnaden empfangen."
Der Peon nahm Tejada das Pferd ab. Dieser stellte seinen Karabiner an die Wand und folgte, seinen Schnurrbart drehend, um sich ein keckes, selbstbewußtes Ansehen zu geben, dem voranschreitenden Diener durch das hell erleuchtete Vestibül und einen Korridor nach einem Zimmer im Erdgeschoß, wo er ihn mit den Worten: "Excellenza wird gleich erscheinen," allein ließ.
Den indianischen Peon, der im Vestibül hinter einer Treppenwange kauerte, hatte Tejada nicht gesehen, nicht bemerkt, wie dessen Augen aufleuchteten, als er den Fremden erblickte, während seine Hand nach dem Messer griff, das er im Gürtel trug.
Tejada schaute sich in dem reich ausgestatteten Gemache, dessen kostbare Möbel, Teppiche und Portieren ihm nicht wenig imponierten, mit einiger Scheu um.
"Sehr vornehm, wohnt wie ein Grande, der gute Don Carlos und unsereins muß sich mühselig durch die Welt schlagen, immer die verwünschten Alguacils hinter sich. Ja, Glück muß der Mensch haben. Nun, vielleicht ist mir Fortuna diesmal hold; ich habe es satt, mich hetzen zu lassen wie ein wildes Tier. Hereingekommen bin ich - das Hinauskommen ist vielleicht schwieriger."
Er faßte in die Tasche und entfernte von dem Doppelpistol sorgfältig die Versicherung, so die Waffe zum sofortigen Gebrauch fertig machend.
Ein leises Rauschen, eine der Portieren öffnete sich und herein trat der Herr des Hauses.
Sennor Carlos de Valla, der erste Minister des Staates Neugranada (es ist das heutige Columbia, das aber zur Zeit, wo unsere Geschichte spielt, den Namen des ehemaligen spanischen Generalkapitanates auch als selbständiges Staatswesen führte), der Herr ergiebiger Silberminen und viele Quadratleguas umfassender Liegenschaften, war ein Mann von mittelgroßer, wohlproportionierter Gestalt und vornehmer Haltung. Der elegante Sommeranzug, nach neuester Pariser Mode gefertigt, stellte seine Erscheinung in schroffen Gegensatz zu der des sonngebräunten Mannes im Poncho. Das gut geformte bartlose Gesicht von jener Elfenbeinfarbe, wie sie vornehmen Spaniern eigen ist, zeigte eine eherne Ruhe, während seine Augen forschend und mißtrauisch auf den Besucher gerichtet waren.

"Es ist nur ein Konzept, wie Excellenza bemerken werden."
Tejada ward nicht ganz wohl diesem Manne gegenüber, dem das Machtbewußtsein aufgeprägt war, doch wußte er das zu verbergen und verbeugte sich mit der dem Spanier eigenen geschmeidigen Höflichkeit.
"Was führt sie zu mir, Sennor?"
"Wie ich sehe, habe ich nicht mehr das Glück, in Euer Excellenza Gedächtnis zu leben, obgleich Sancho Tejada das wohl hoffen durfte."
Bei Nennung dieses Namens erschrak der Minister sichtlich, was Tejada nicht entging.
"Ah," sagte de Valla gedehnt, während er die Augenlider etwas senkte und so den Mann im Poncho unter diesen hervor ansah, "ah, Sennor Tejada, das ist überraschend," und langsam, wie absichtslos, schob er die rechte Hand unter seinen Rock. Tejada entging diese Bewegung nicht und seine Hand senkte sich in die Tasche. "Es ist einigermaßen verwegen von Sennor Tejada, hier in Bogotà bei dem ersten Beamten des Staates zu erscheinen, denn mich dünkt, die Diener der Gerechtigkeit sehnen sich sehr nach Ihnen."
"Ich hoffe, mich unter den Schutz Euer Excellenza stellen zu dürfen, denn ich komme, um Euer Gnaden einen Dienst zu leisten."
"Ich hätte große Lust, Sie durch meine Lanceros festnehmen zu lassen," und de Vallas Hand bewegte sich unter dem Rocke.
Wie ein Blitz fuhr aber Tejadas Doppelpistole empor und richtete sich auf den Minister. "Lassen Euer Gnaden ja stecken, ich kenne Ihre Fertigkeit im Gebrauche dieser Waffe wohl -, aber ich verstehe sie ebenfalls zu handhaben."
"Pah, laß die Torheiten, Bursche," sagte de Valla verächtlich, "wenn ich dich nicht von den Lanceros niederstechen lasse, verdankst du es nur der Erinnerung an frühere Kriegskameradschaft."
Dabei zog er aber doch die Hand unter dem Rocke hervor.
"Excellenza würden dies auch bereuen, denn ich bin in der Tat Überbringer wichtiger Nachrichten," sagte Tejada mit einem Grinsen der Befriedigung.
"Also, was willst du? Was bedeutet das, was du mir durch den Diener sagen ließest?"
"Ich bin glücklich," sagte Tejada, der jetzt seine Sicherheit wieder gewann, "daß Excellenza unsere frühere Kameradschaft erwähnten, denn mich hat nur Anhänglichkeit an Eure Person hierhergeführt und der innige Wunsch, dem ehemaligen Gefährten zu seinen außerordentlichen Erfolgen meinen Glückwunsch darbringen zu können."
"Laß das Geschwätz und komm zur Sache."
"Euer Gnaden entsinnen sich wohl noch aus früheren Zeiten eines Mannes namens Gomez?"
Trotz der Gewalt, die de Valla über sich hatte, zuckte es in seinem Gesichte auf.
"Nun?"
"Ich bin der Erbe dieses Mannes geworden -"
"Er ist also tot?"
"Er starb und hinterließ mir einige Briefe von Ew. Excellenza Hand, die ein ganz absonderliches Licht auf die Vorgänge im Tale der drei Quellen vor zehn Jahren werfen. Die Häupter der liberalen Partei würden mir für diese Briefe viel Geld geben, ich zog es aber alter Kameradschaft wegen vor, sie Ew. Excellenza zu überbringen."
de Vallas Gesicht zeigte wiederum steinerne Ruhe.
Dann sagte er langsam: "Das heißt, du willst mir die wertlosen Schreibereien verkaufen?"
"Ob sie wertlos sind, mögen andere entscheiden; böswillige Menschen möchten herauslesen, daß Excellenza dem Morde an den d'Alcantaras nicht fern gestanden haben."
Der Minister wurde etwas blässer und seine Hand zitterte leicht.
"Du bist von einer unglaublichen Frechheit, Bursche!"
"Weil Anhänglichkeit an Eure Person mich trieb, Euch einen Dienst zu leisten? O, Excellenza sind undankbar. Ew. Gnaden haben ungewöhnliches Glück gehabt und sind sogar der Erbe der reichen d'Alcantaras geworden. In Don Pedro, der das Unglück hatte, unter der Hand räuberischer Aimaràs zu fallen, schwand auch der gefährliche politische Gegner dahin, ja, Excellenza hatten Glück und ich bin ein armer Teufel geblieben, der ein ruheloses Leben führt, wenn ihm nicht ein mächtiger Gönner ersteht, der ihm den Weg zu einem behaglichen Dasein ebnet. Ew. Excellenza haben es verstanden, in den Wirren der Zeit sich die verschiedenen politischen Strömungen dienstbar zu machen, gar manches andere trug zu Ew. Excellenza Erhöhung bei, die gewiß wohl verdient ist, und nicht zuletzt auch der Unglücksfall im Tale der drei Quellen."
de Valla, der in seinem von Parteien zerrissenen Vaterlande von einer zur anderen übergegangen war, immer nur seinen Vorteil im Auge, schwankte zwischen Grimm und Besorgnis bei diesem Hohne des vor ihm stehenden Bandidos. Die Briefe, die Tejada im Besitze haben wollte, hatte er vor ungefähr zehn Jahren geschrieben, er entsann sich also deren Inhaltes nicht mehr genau. Tatsache war, daß er seinen gefährlichen politischen Gegner, den gefeierten Pedro Alcantara, einen der edelsten Männer des Landes, aus seinem Wege hatte räumen wollen, und es war zwischen ihm und Gomez, der eines seiner Werkzeuge war, der Plan geschmiedet worden, d'Alcantara in die Hände der Aimaràs zu liefern, damit ihn die in ihren Schlupfwinkeln als Gefangenen bewahrten. Daß die Blutgier der Wilden kein Leben, auch das unschuldiger Kinder nicht schonte, hatte außer de Vallas Berechnung gelegen. Ihm hätte es genügt, wenn Pedro d'Alcantara auf einige Jahre von der politischen Schaubühne verschwand. Carlos de Valla hatte eine wilde Vergangenheit hinter sich, doch einen nutzlosen Mord zu begehen, war er nicht der Mann. Die entsetzliche Katastrophe hatte ihn damals tief erschüttert, doch im politischen Treiben, von ruhelosem Ehrgeiz getrieben, hatte sich sein Gewissen verhärtet. War es auch nicht auf den Tod d'Alcantaras abgesehen gewesen, noch weniger auf die Vernichtung der Seinen, so konnten die Briefe an Gomez, die er als das einzig mögliche Verständigungsmittel gezwungen schrieb, und dabei voraussetzte, daß dieser sie, seiner selbst willen, vernichten würde, immerhin Stellen enthalten, die eine schlimme Deutung zuließen, und in der Hand politischer Gegner gefährlich werden. Seinen Grimm bezwingend sagte de Valla ruhig: "Laß mich einmal die Briefe sehen."
"Excellenza sollen sie sehen, doch Excellenza begreifen, daß sie sehr wertvoll sind und -"
"Schwatz nicht, sind's meine Briefe, kaufe ich sie dir ab, obgleich nichts darin stehen kann, was nicht jeder Unbefangene lesen könnte."
Tejada zog ein Päckchen vergilbter Papiere aus der Tasche und hielt sie vorsichtig de Valla hin, so daß der die Schriftzüge erkennen konnte und in der Tat sofort seine Handschrift erkannte.
"Wie viel Briefe sind es?"
"Vier."
de Valla entsann sich nicht, wie viel Briefe er damals an Gomez geschrieben hatte, aber die Zahl vier mochte stimmen.
"Was verlangst du dafür?"
"Leider sind meine Finanzen sehr zerrüttet und unter 600 Pesos(etwa 2500 Mark) möchte ich sie nicht hergeben."
"Sei es!" de Valla ging zu einem Schreibsekretär, entnahm diesem eine Anzahl der schweren Goldstücke, die man Unzen nennt, einige Geldscheine und übergab sie Tejada, der sie schmunzelnd in die Tasche steckte und dem Minister die Briefe einhändigte. Erleichtert atmete dieser auf.
"So, das wäre abgemacht," sagte der verkommene Verkäufer der Briefe, der im stillen fürchtete, daß de Valla jetzt, wo er im Besitz der verdächtigen Papiere war, seine Macht ihm gegenüber geltend machen würde, "und nun will ich meinem verehrten Gönner, an den mich immer noch die frühere Anhänglichkeit kettet, erst recht einen Freundschaftsdienst erweisen."
de Valla, der eifrig in die Briefe gesehen hatte, schaute auf und fragte mit gerunzelter Stirne: "Was willst du noch, du Spitzbube? Vergiß nicht, daß Lanceros draußen meines Winkes harren."
Der Bandit zuckte zusammen und brachte trotz seiner Frechheit mit etwas bebender Stimme hervor: "Es wird für Excellenza gewiß von Interesse sein, zu erfahren, daß der Erstgeborene Pedro d'Alcantaras dem Blutbade damals entgangen ist und noch lebt."
Mit einem Gesicht, das tödlichen Schrecken verriet, sprang de Valla von seinem Sessel auf und starrte Tejada an.
"Was soll das? Was soll das Märchen?"
"Kein Märchen, Alonzo d'Alcantara lebt und Excellenza werden das bald erfahren."
"Hüte dich mit mir zu spielen -." Die Augen de Vallas funkelten unheimlich.
"Der Knabe ist damals von den Aimaràs als Gefangener in die Berge geschleppt worden, weilt aber seit einigen Jahren schon in den Llanos."
"Und das sollte ich erst jetzt erfahren?"
"Man muß es wohl nicht rätlich gefunden haben, den allgewaltigen Mann, den Erben des Eigentums der Alcantaras, davon in Kenntnis zu setzen," war die spöttische Antwort, denn der Schreck de Vallas hatte Tejada die Zuversicht zurückgegeben.
"Bursche, spiele nicht mit mir - oder -"
"Wie würde ich das wagen? Für die Wahrheit meiner Aussage bürgt dieses Stück Papier. Ew. Excellenza entsinnen sich wohl noch der Handschrift unseres gemeinschaftlichen Freundes Gomez."
Tejada entnahm seiner Tasche ein Stück Papier, auf dem einige Zeilen standen, und überreichte es de Valla. Begierig las dieser: "Und so schwöre ich bei Gott und seinen Heiligen, und so wahr ich im Angesicht des Todes auf Vergebung meiner Sünden und ewige Seeligkeit hoffe, daß dieser vor uns stehende junge Mensch, Alonzo, der Sohn Pedro d'Alcantaras ist, der dem Blutbade im Tale der drei Quellen entging und von den Aimaràs gefangen hinweggeführt worden ist. Enriquez Gomez."
"Es ist nur ein Konzept, wie Excellenza bemerken werden," sagte Tejada, der wohl gewahrte, wie erregt der Minister war, "aber das Original ist in guter Hand und wird wohl zu geeigneter Zeit vorgezeigt werden."
"Nicht möglich!" murmelte de Valla grimmig in sich hinein und starrte auf das Papier, dessen Schriftzeichen ihm, als von der Hand Gomez stammend, wohl bekannt vorkamen. "Enriquez Gomes, dieser Schurke, hätte das geschrieben?"
de Valla ging mehrmals im Zimmer in erkennbarer Erregung auf und ab.
"Das ist nichts als ein Machwerk meiner politischen Gegner, die seit langem mich zu stürzen trachten. Ich sehe jetzt klar. Man will mir eine Blutschuld aufbürden und in diesem angeblichen Alcantara einen gefährlichen Gegner entgegenstellen. Alonzo d'Alcantara ist seit zehn Jahren tot. Wo befindet sich der Betrüger, der sich für einen Sohn Don Pedros ausgibt?"
Mit seiner geschmeidigen Höflichkeit erwiderte Tejada: "Das, Excellenza, ist mein Geheimnis, das ich nach meiner Art zu verwerten gedenke."
de Valla warf dem Banditen einen Blick zu, der ihn erbeben machte.
"Dein Geheimnis?"
de Valla ging mehrmals auf und ab und schien zu überlegen.
"Weißt du," sagte er dann, "daß ich dir dein Geheimnis aus der Seele peitschen lassen könnte?"
"Excellenza würden das Übel nur vermehren und einen treuen Diener hart behandeln."
de Valla überlegte immer noch und warf hie und da einen forschenden Blick auf Tejada, den dieser ruhig aushielt.
"Die Sache ist von meinen Feinden schlau ausgedacht. Die Wahlen zur großen Junta stehen vor der Türe und eine Flut von Verleumdungen würde sich mit dem Auftauchen dieses Pseudoalcantara über mich ergießen. Im Interesse des Staates muß man diesen Betrüger verhindern, gegen mich aufzutreten, und du wirst das übernehmen."
"Hm," äußerte Tejada, "das ist eine bedenkliche Sache; der junge Mann hat einflußreiche Freunde in den Llanos."
"Wo man mir nicht hold ist."
"Wie meinen denn Excellenza, daß man gegen den Menschen vorgehen soll?"
"Das ist deine Sache, dem Angriff gegen mich muß die Spitze abgebrochen werden. Laß mich hören, daß diese Gefahr beseitigt ist und ich werde dich reich belohnen."
"Ja, Geld wird die Sache kosten, denn ich setze mein Leben dabei aufs Spiel. Wenn Excellenza fünftausend Pesos anwenden wollen, wird kein Alonzo d'Alcantara gegen Excellenza auftreten."
"Gut, ich will dieses Opfer bringen, aber wer bürgt mir für die Gewißheit?"
"Mein Vorteil. Euer Gnaden geben mir jetzt tausend Pesos, denn ich muß als Caballero auftreten können, und die fünftausend, wenn ich sie überzeuge, daß die Gefahr vorüber ist."
"Sei es."
Mit dem ihm eigenen Gemisch von Unverschämtheit und kriechender Höflichkeit setzte der Bandit hinzu: "Nur müssen Excellenza die Gnade haben, mir wegen Lebens und Sterbens eine Anweisung auf Dero Kasse zu geben."
de Valla zögerte.
"Du verlangst viel. Genügt dir mein Wort als Caballero nicht?"
"O Excellenza, vollständig - aber - für alle Fälle-"
"Sei es."
Der Minister setzte sich an den Schreibtisch und schrieb: Vorzeiger dieses ist von mir beauftragt worden. Nachforschungen nach dem angeblich von den in der Sierra Moreno hausenden Aimaràs gefangen gehaltenen Alonzo d'Alcantara anzustellen und erhält fünftausend Pesos von mir ausbezahlt, wenn er mir bis zum 1. Oktober dieses Jahres günstige Nachrichten von dem Sohn meines verstorbenen Freundes Don Pedro bringt.
Bogotá, 17. Juli 1853
Carlos de Valla,
Staatsminister.
Tejada steckte diese Anweisung, nachdem er sie aufmerksam gelesen, schmunzelnd ein.
"Meine Interessen sind jetzt die Eurer Excellenza. Dieser Alcantara wird Sie nicht belästigen."
"Diene mir treu und du wirst einen wohlwollenden Gönner an mir haben."
de Valla gab dem Banditen amerikanische Banknoten, die im Lande sehr gern genommen wurden, und mit grinsendem Behagen verleibte sie Tejada seiner schmutzigen Brieftasche ein.
"Verlasse rasch die Stadt und hüte dich vor den Alguacils."
"Euer Gnaden werden bald von mir hören."
Er verbeugte sich und ging, die Hand am Pistolenkolben, denn immer noch schwebte die Besorgnis über ihm, de Valla könnte ihn festhalten lassen. Erst als er auf der Plaza war, atmete er auf. Er hatte auch jetzt nicht den hinter der Treppe kauernden Indianer gesehen, und auch der Indianerknabe, der ihm folgte, während er eine Posada aufsuchte, fiel ihm nicht auf.
de Valla blickte ihm mit einem düsteren Gesicht nach.
"Schade, daß ich dich nicht hängen lassen konnte, Schurke. - Don Pedros Sohn am Leben? Hat dieser Gomez mich betrogen? Seine Handschrift ist es. Was ist das alles? Welche Rätsel sind hier zu lösen? Und das erfahre ich erst jetzt und durch diesen Banditen? Wer steckt dahinter? Du glaubtest klug zu handeln, Tejada, indem du mir den Aufenthaltsort des jungen Menschen vorenthieltest," murmelte er, "ich will dir einen Bluthund an die Ferse heften, der dich bewacht, und wenn es geboten sein sollte, zerreißt; hüte dich, wenn du mich betrügst."
Er klingelte und ein Diener trat ein.
"Ist der Indio Maxtla in der Nähe?"
"Er ist draußen, Excellenza."
"Schicke ihn herein."
Gleich darauf trat der Indianer, der hinter der Treppe gesessen hatte, in das Zimmer.
Der Mann, eine untersetzte breitschultrige Gestalt, mit dem traurigen, fast stumpfsinnigen Gesichtsausdruck, wie er den Indianer dieser Länder, als Nachwirkung Jahrhunderte alter Sklaverei, kennzeichnet, richtete die dunklen Augen auf den in Gedanken versunkenen Gebieter und harrte geduldig, bis er ihn bemerken würde.
Der Indianer mochte etwa vierzig Jahre zählen, sein Äußeres ließ auf Körperkraft schließen. Bewegungslos stand er da, selbst in seinem braunen Gesicht regte sich kein Muskel.
Endlich hob de Valla, dessen Gedanken in der Vergangenheit geweilt, die ihm Tejada so unerwartet zurückgerufen hatte, das Haupt.
"Ah, gut daß du da bist. Ich habe einen Auftrag für dich, der dir viel Geld einbringen wird, wenn du ihn treu ausführst."
"Maxtla hört."
"Hast du den Mann gesehen, der eben bei mir war?"
"Maxtla sah ihn."
"Gut, ein Indio vergißt kein Gesicht, das er einmal gesehen hat." - Nach einer Pause fuhr de Valla fort: "Du entsinnst dich, daß vor Jahren der große Sennor d'Alcantara von deinen wilden Stammesgenossen in den Bergen mit all den Seinen ermordet wurde?"
Hätte er in diesem Augenblicke den Indianer angesehen, würde er bemerkt haben, wie dessen dunkle Augen in einem seltsamen Glanze aufleuchteten, als er diese Erinnerung wachrief.
In dem gleichmäßig ruhigen Tone dieser Leute erwiderte er aber: "Maxtla weiß es noch."
"Der Mann, der eben bei mir war, brachte mir eine seltsame Kunde. In den Llanos soll ein junger Mann leben, der behauptet, der Sohn Don Pedros zu sein."
Auch jetzt gewahrte er nicht, wie der stoische Indio mit dem stumpfsinnigen Gesicht und der apathischen Haltung leise zusammenbebte.
"Ich traue weder dieser Nachricht, noch ihrem Überbringer, ich hege keinen Zweifel, daß der Knabe mit den Seinen umgekommen ist. Aber es ist möglich, daß meine Feinde eine zufällige Ähnlichkeit oder ein törichtes Gerücht benützen, um einen Fremdling gegen mich aufzuhetzen, damit er Anspruch auf das Erbe seines Vaters erhebt, das mir zugeteilt ward. Verstehst du mich?"
"Maxtla versteht."
"Ich will nun wissen, ob der Mann, der hier war, die Wahrheit berichtet hat, als er sagte, daß jemand den Namen Alonzo d'Alcantara in Anspruch nimmt."
"Was soll Maxtla tun?"
"Der Mann wird den Weg nach den Llanos einschlagen, du wirst ihm folgen und dich an seine Fersen heften, ohne daß er es gewahr wird, du bist schlau genug dazu. Triffst du auf einen Lügner, der sich Alonzo d'Alcantara nennt, so siehe meinen Todfeind in ihm."
"Gut, ich verstehe, er ist dein Todfeind, Sennor."
"Der Mann, den du hier sahst, versprach mir, den Betrüger unschädlich zu machen, aber ich traue ihm nicht. Entledigt er sich seines Auftrages, so laß ihn gewähren. Aber er ist leichtfertig, unzuverlässig und zu jedem Schurkenstreich fähig. Vor allem suche jenen d'Alcantara aufzufinden, damit ich im schlimmsten Falle weiß, wo er weilt und wer seine Freunde sind. Aber hoffentlich befreit mich ein Zufall von ihm, ehe ich genötigt bin, streng gegen den Betrüger vorzugehen."
"So kannst du mir nicht sagen, wohin ich den Kopf meines Tieres in den Llanos wende, um den Lügner zu finden?"
"Nein, das wollte der Mann, der sich Tejada nennt, in weiteren Kreisen aber unter dem Namen Coyote bekannt ist, nicht sagen, und eben das ist mir verdächtig und darum mußt du ihm wie sein Schatten folgen, er muß dir den Weg zeigen. Du hast jetzt deine Aufgabe begriffen?"
"Sei sicher, Herr, Maxtla ist hinter ihm her wie der Hund auf der Fährte des Jaguar, und der Betrüger wird sterben."
"Sollte aber der Coyote es wagen, falsch gegen mich zu handeln, so rechne ich auf deine Treue."
"Maxtla ist treu - der Coyote mag sich hüten."
"Ich sehe, du bist ein zuverlässiger Bursche."
de Valla ging an seinen Schreibtisch und entnahm diesem einen Lederbeutel, der mit Silbergeld gefüllt war.
"Hier hast du Geld, du wirst damit auskommen."
Der Indianer nahm den ziemlich schweren Beutel und ließ ihn unter seinem Poncho verschwinden.
"Nimm deine Mula und laß dir vom Majordomo geben, was du sonst noch brauchst. Mach dich auf den Weg und erfülle deinen Auftrag gut."
Der Indianer neigte das Haupt und ging hinaus.
"So, mein Freund Tejada, der Indio wird dir zu schaffen machen, wenn du mich betrügst."
Er blickte vor sich hin. "Ich wollte dich nicht töten, Don Pedro," sagte er leise, "aber wenn jetzt dein Schatten aus dem Grabe steigt, um gegen mich zu zeugen, so sende ich ihn zurück in die ewige Nacht. Ich habe nicht gerungen jahrelang, um mir den Preis im letzten Augenblick entreißen zu lassen."
Ein besonderes Klopfen ließ sich an der Tür vernehmen. "O, herein, Eugenio," rief de Valla rasch, und herein trat ein junger Mann von edler Gestalt, dessen sanftes, freundliches Gesicht unwiderstehlich für ihn einnahm.
"Ich störe doch mein Väterchen nicht?" fragte er mit einem Lächeln.
"Nein, mein Söhnchen, nur näher."
Der junge Mann war Don Eugenio, der einzige Sohn des Ministers.
Wunderbar war es, wie sich beim Erscheinen des jungen, vornehm gekleideten Mannes die Gesichtszüge de Vallas veränderten und einen selten gütigen, liebevollen Ausdruck zeigten, der den strengen Linien dieses Angesichts sonst fremd war.
Was der verhärtete Mann noch an Liebe im Herzen hatte, konzentrierte sich auf diesen ihm äußerlich und mehr noch innerlich so unähnlichen Sprößling, den er mit einer nahezu fanatischen Zärtlichkeit umgab.
"Nun, was führt denn meinen Infanten zu mir?" fragte er gütig. "Brauchen Sennorito Geld?"
"Nein, ich habe noch genug."
"Du mußt mehr ausgeben, Eugenio, das ziemt sich für einen de Valla."
"Ich habe erst gestern mehrere seltene Exemplare von Heliconiden(eine Schmetterlingsart) gegen schweres Geld gekauft, Padrazo."
"Ja, mein Kind, das ist ja ganz schön," sagte der Minister mit einem leichten Seufzer, "aber du mußt mehr den Grand Seigneur spielen, ich stelle dir ja bereitwillig die Mittel zu Gebote."
"Ich habe kein Talent dazu, Väterchen, laß mir meine stillen Freuden an den Erscheinungen der Natur, ich bin so glücklicher."
"Nun ja, ja, mein Junge, ich meine nur, in deinem Alter - hm - nun, Eugenio, führt dich ein besonderer Anlaß zu mir?"
"Ja, ich habe eine Bitte an dich - zwei Bitten."
"So laß mal hören."
"Man hat da Sennor Bonego plötzlich nach Buanamaria in die Wüste verbannt, weil er staatsgefährlich sein soll -"
de Valla wurde ernst.
"In was mischest du dich ein, Eugenio?"
"Ich kenne Sennor Bonego, er ist ein harmloser Gelehrter."
"Woher kennst du ihn denn?"
"Ich habe mit seinem Sohn das Liceo besucht, der war bei mir und legte mir nahe, deine Güte in Anspruch zu nehmen."
"Excellenza, der Herr Präsident sind sehr streng und Sennor Bonego soll sich durch aufrührerische Äußerungen bemerkbar gemacht haben."
"Glaube das nicht, er kümmert sich nur um seine Wissenschaft. Er ist außerdem krank. Bitte, Herzensvater, mache deinen Einfluß für ihn geltend, er ist gewiß ganz unschuldig und wohl nur beim Präsidenten verleumdet."
Der Sohn sah seinen Vater mit den sanften Augen so bittend an, daß diesem das Herz weich wurde.
"Gewähre mir die Freude, daß ich Bonego sagen kann, die Verbannung sei aufgehoben."
de Valla, der der eigentliche Urheber des Verbannungsdekretes war, weil er den Unabhängigkeitssinn des Gelehrten fürchtete, der ihm für seine ferneren Pläne im Wege stand, konnte doch Eugenio nicht widerstehen und erwiderte: "Er ist krank - hm - nun, ich werde morgen mit Excellenza seinetwegen sprechen und werde hoffentlich eine Milderung des Urteils zu erwirken vermögen."
"O, o - Dank - tausend Dank, Herzensvater - ja du bist gut, ich wußte es ja."
Innige Freude strahlte aus Eugenios Augen.
"Wollen sehen, wollen sehen. Was hatte mein gelehrtes Söhnchen denn noch zu erbitten?"
"O, noch eine wichtige Entscheidung aus deinem Munde."
"Hoffentlich betrifft sie nicht wieder die Politik?"
"Nein. Aber - Sennor Pinola unternimmt eine wissenschaftliche Reise in die Llanos, um deren Fauna und Flora zu durchforschen und -"
"Nun, und?"
"Ich möchte ihn begleiten."
"Ah - was du sagst?"
"Ich bin nicht wie du, Vater, bin kein Staats-, kein Kriegsmann, meine Freude ist das Studium der uns umgebenden Kleinwelt. Hier bietet sich eine Gelegenheit, unter tüchtiger Leitung umfangreiche Studien zu machen. Willst du mir eine zweite große Freude bereiten, so laß mich mit ihm ziehen, in einigen Wochen sind wir wieder zurück, reich mit Schätzen beladen."
Der gewiegte Staatsmann sagte sich, daß das Erscheinen seines sanften, liebenswürdigen Sohnes, der so leicht die Herzen der Menschen gewann, unter den Bewohnern der Llanos überaus vorteilhaft für ihn sein würde, und so ungern er sich auch von Eugenio auf längere Zeit trennte, denn der Jüngling war der Sonnenschein seines Lebens, so vermochte er ihm nur schwer eine Bitte abzuschlagen.
"Also, mein Söhnchen will in den Llanos Käfer und Schmetterlinge sammeln und Herbarien anlegen?"
"Ja, wenn du es gestattest."
"Und Sennor Pinola begibt sich in die Llanos?"
"Ja, in prächtiger Ausrüstung."
"Nun, nun, wir wollen überlegen, ich bin ja nicht ganz dagegen."
"O, du bist dafür, das sehe ich schon, du lässest mich reisen - ich habe es so lange schon innig ersehnt, die Llanos zu besuchen."
"Ich werde mit Sennor Pinola reden."
"O, Väterchen, wie danke ich dir!" und stürmisch umarmte der Jüngling seinen Vater.
"Schon gut, schon gut."
"Du bist nicht nur der größte Staatsmann der Zeit - Padrazo - du bist auch der beste aller Väter."
"Und der schwächste."
"Nein, der liebevollste. Tausend Dank. Jetzt will ich aber schnell zu Bonego eilen und ihm sagen, daß du dich seiner annehmen wirst."
"Versprich nicht mehr, als du versprechen kannst."
"Nein, und das ist schon genug."
Und hinaus eilte Eugenio, freudestrahlend. Lange sah ihm sein Vater nach.
"Wäre ich noch so wie du, Liebling," sagte er leise vor sich hin. "Vorbei! Ich bin nur wie ich bin und muß den Weg nun zu Ende gehen. Glücklicher Knabe!"
Neuntes Kapitel.
Maxtla
Vor Tagesanbruch verließ Tejada die Stadt. Er ritt das gute Pferd seines Oheims, dessen Sattelzeug er bei dem Posadero, bei dem er die Nacht zugebracht hatte, erneuert hatte, wie auch seine Kleidung vervollständigt war. Die Kruppe des Pferdes trug jetzt einen stattlichen Mantelsack.
Die rauhe Straße, die nach Süden führte, und hie und da von Gehöften eingefaßt wurde, war menschenleer.
"Ich muß doch sehen," murmelte Tejada vor sich hin, "ob mir Freund Carlos nicht einen Spürhund nachschickt," lenkte sein Pferd in ein kleines Gehölz von immergrünen Eichen und harrte dort geduldig.
Die Sonne ging auf, und die Straße begann sich zu beleben, Reiter und Wagen zeigten sich, Saumtiere, die bald nach der Stadt zogen, seltener von dort kamen.
Tejada harrte über eine Stunde und musterte aufmerksam alles, was von der Stadt kam. Doch nicht eine der von dort kommenden Personen erregte bei ihm auch nur den geringsten Verdacht, daß sie ihm nachgeschickt sein könne.
"Der gute Carlos vertraut mir, wie ich sehe," sagte er grinsend. "Wenn ich nur den jungen Burschen, auf dessen Konto ich lebe, erst ausfindig gemacht hätte. Wenn ich geahnt hätte, daß meine Kugel dem braven Gomez den Rest gegeben, würde ich mich früher um die Erbschaft bemüht haben. Ich dachte, ich hätte ihn nur verwundet, und der andere Halunke war sehr schnell mit der Büchse bei der Hand; seine Kugel sauste mir dicht am Ohre vorbei.
Tot und begraben schon seit fünf Jahren, das hätte ich wissen müssen. Fünftausend Pesos ist eigentlich doch zu wenig für diesen Handel. Nun, wenn ich den Sprößling d'Alcantaras erst ermittelt habe, können wir ja weiter sehen. Tausend Pesos muß der brave Carlos noch zugeben."
Tejada lachte vor sich hin.
"Es war doch ein genialer Streich, den großen Staatsmann mit den Briefen und dem Fetzen Papier zu ködern. Er muß doch große Angst vor dem Jungen haben, von dem ich gar nicht einmal weiß, wo er steckt. Hahaha! Ja, Don Carlos, so schlau du bist, Sancho Tejada bist du nicht gewachsen."
Mit einem Ausdruck hoher Selbstzufriedenheit zog er dann das Staubtuch um sein Gesicht, ritt auf die Landstraße hinaus, und setzte in leichtem Galopp seinen Weg nach Süden fort.
Er machte in einer Posada Mittagsrast und ritt, nachdem sein Pferd ausgeruht hatte, weiter.
Der Weg schien ihm mit allen Wirtshäusern bekannt zu sein.
Gegen Abend holte Tejada einen Indianer ein, der langsam einherritt, auch er ließ sein Pferd in Schritt fallen und redete ihn an: "Nun, mein Bursche, wo führt dein Weg dich hin?"
"Geradeaus," war die mürrische Antwort.
"Gut geantwortet, Schlaukopf," versetzte Tejada. Er wußte, wie man mit Indianern umzugehen hat, und reichte ihm eine Zigarrita, die der Reiter begierig ergriff und in Brand steckte.
"Kommst du von Bogotá?"
"Nein."
"Bist du hier in der Nähe zu Hause?"
"Nein."
"Bei wem dienst du denn?"
"Bei niemand."
"So bist du Landwirt?"
"Nein."
"Verzeihe die Neugierde, mein brauner Bursch, etwas mußt du doch sein."
"Vaquero."
"Und hast jetzt keinen Dienst?"
"Nein," und mit einer Verwünschung in indianischer Sprache, die aber Tejada verstand, setzte er hinzu: "Sennor Castillo hat mich fortgejagt."
"Warum denn?"
"Es sind mir einige Pferde von der Weide gestohlen worden."
"Hm, das ist 'ne schlimme Sache."
"Wo stammst du denn her?"
"Aus den Llanos."
"Aus den Llanos an den Bergen?"
"Nein, vom Flusse, vom Apure."
"Und wohin willst du jetzt?"
"Nach Hause, wenn ich nicht einen Dienst finde."
Tejada überlegte, ob ihm nicht bei den Nachforschungen, die er anzustellen hatte, die Hilfe eines Eingeborenen von Nutzen sein könnte, und kam zu dem Resultate, daß es vorteilhaft sein werde, den Mann, der aus den Llanos stammte, für kurze Zeit in seinen Dienst zu nehmen.
"Ich selbst habe einige Geschäfte in den Llanos, wenn du nichts Besseres vorhast, will ich dich für einige Zeit in Dienst nehmen und dich anständig besolden."
"Was verlangt der Sennor, daß ich tun soll?"
"Du sollst mein Peon sein, nicht mehr."
"Was wird der Sennor mir dafür geben?"
"Nun, Bursche, Caballeros meinesgleichen markten mit ihren Peones nicht, ich gebe dir einen Peso für die Woche und selbstverständlich Nahrung."
"Wird Sennor, wenn er mit mir zufrieden ist, mir einen Poncho schenken?"
Der Poncho des Mannes war in sehr üblem Zustande.
"Ja, das will ich."
"Gut, ich will mit Sennor gehen."
"Wie heißest du denn?"
"Juan Moro."
"Ist denn das Maultier, das du reitest, dein?"
Nach einigem Zögern erwiderte der Indianer: "Ich habe es von einem Freunde geliehen."
Tejada lachte.
"Nun, dein Freund hat recht gute Mulos!"
Er hatte sofort erkannt, daß ein gutes Tier unter dem Indio einherlief und war gar nicht ungehalten durch den Verdacht, daß der Indio es gestohlen haben könne.
Nach einer Weile sagte der vorsichtige Indio: "Wenn ich Sennor als Peon dienen soll, muß er mir auch Handgeld geben."
"Gut, mein Bursche, hier hast du einen Peso." Er griff in die Tasche und gab ihm das Silberstück, das der Indianer mit unverkennbarer Freude einsteckte. "So und nun reite hinter mir, wie es sich für einen Peon geziemt."
Demütig hielt der Rote sein Tier an und ließ dem neuen Herrn einigen Vorsprung.
Tejada strich seinen Schnurrbart: "So, nun kommen wir wirklich als Caballero in die Llanos. Hoffentlich macht sich das Geschäft dort."
Er ahnte nicht entfernt, daß ein auf seine Spur gesetzter Spürhund in dem Indio Maxtla hinter ihm ritt.
Zehntes Kapitel.
Alonzo und Eugenio
In wunderbarem Sonnenschein lag das Land da. Weithin dehnte sich nach Norden und Osten die unabsehbare Fläche aus, auf der zahlreiche Rinderherden, bewacht von wohlberittenen Hirten, weideten. Im Westen erhob sich in der Ferne das Gebirge - nach und nach hoch ansteigend, bis seine Gipfel in den Wolken verschwanden.
Die Landschaft belebend, rann der wasserreiche Fluß durch die Ebene, um seine Fluten dem Meta zuzuführen, der sie an den windungsreichen Orinoko abgab.
In weiter Ausdehnung lagen hier die Sennor Vivanda gehörenden Ländereien, die unter sorgsamer Bewirtschaftung einen überaus wohltuenden Eindruck hervorriefen und von dem Reichtum und der Macht des Gebieters sprachen.
In den Feldern zeigten sich die kleinen Häuser der Arbeiterfamilien, unter denen Indianer zahlreich vertreten waren.
Von parkartigen Anlagen umgeben, lag das niedrige, luftige, von schattigen Veranden eingefaßte, umfangreiche Herrenhaus da, unweit des langsam dahinströmenden Flusses. Weiterhin erblickte man Felder, die abwechselnd mit Tabak, Mais und Kaffeebäumen bestanden waren, zwischen denen sich hie und da eine stattliche Palme oder ein alter Ceibabaum erhoben.
Es war ein großer und stattlicher Herrensitz, den sich die Vivandas, die einer alten spanischen Familie entstammten, hier geschaffen hatten, und ihre Ländereien umfaßten mehrere Quadratleguas.
Die Bewachung der zahlreichen Herden, die Bewirtschaftung der ausgedehnten Ländereien erforderte eine zahlreiche Schar von Hirten und Feldarbeitern.
Auf der Veranda des Herrenhauses, die nach Norden hin lag, stand Alonzo, der Sohn Pedro d'Alcantaras, der hier, da niemand außer dem Sennor und dessen Bruder, dem Cura, seine Abstammung kannte, mit dem Namen des Herrn von Otoño Vivanda genannt wurde, was umso näher lag, als er wie der Sohn des Hauses behandelt wurde, und blickte sinnend ins Weite.
Fünf Jahre waren seit dem Tage verflossen, wo er den Jaguar niederschoß, und Alonzo war zu einem Jüngling von seltener Kraft und Anmut erwachsen. Hoch und schlank von Gestalt zeugten doch die breiten Schultern, die gewölbte Brust von einer vollendeten körperlichen Entwicklung. Und diese Gestalt trug ein Haupt von einer seltenen, ernsten Schönheit. Das Gesicht, nicht ganz dem spanischen Rassetypus entsprechend, erinnerte an die Bildnisse der Griechenjünglinge, die bei Marathon kämpften. Aber die frische Lebenslust, die die jungen Hellenen auszeichnete, fehlte diesem Gesicht. Die furchtbaren Jahre der Gefangenschaft bei den Wilden hatten ihm einen Ernst aufgeprägt, der nur selten einem Lächeln wich. Es war trotz aller Jugendlichkeit der Züge das Antlitz von männlichem Charakter, dem der feste Blick der dunklen Augen, die unter einer breiten, schön geformten Stirn leuchteten, den Ausdruck von Entschlossenheit gaben.
Dieser junge Caballero, dessen Haltung von der Gewöhnung an die Manieren der guten Gesellschaft zeugten, war der einstige Gefangene der wilden Aimaràs.
Sein gutes Geschick hatte ihn in die Obhut Don Sebastian Vivandas, des Curas gegeben, eines Mannes von seltener Herzens- und Geistesbildung, der, des mörderischen Parteihaders in der Hauptstadt des Landes überdrüssig, seine Stellung an der Kathedrale Bogotás als Pfarrer aufgegeben hatte, um auf den Besitzungen seiner Familie, unter den Bewohnern der Llanos seine geistlichen Funktionen in stillem Frieden weiter auszuüben.
Don Sebastian hatte den wilden, trotzigen Knaben, den Gefangenen der Aimaràs, den Retter seiner Nichte vor tödlicher Gefahr, alsbald in sein Herz geschlossen und ihn mit der Zärtlichkeit eines Vaters behandelt.
Er wußte dem jungen Wilden, der seiner Muttersprache nicht mehr ganz mächtig war, der weder lesen noch schreiben konnte, klar zu machen, daß, ehe er mit Erfolg als der Sohn und Erbe seines Vaters auftreten könne, er sich die Eigenschaften des jungen Caballeros zu eigen zu machen habe, und daß dann immer noch der geeignete Zeitpunkt abgewartet werden müsse, um seine Rechtsansprüche in den politischen Wirren des Landes gegen mächtige und einflußreiche Gegner zur Geltung zu bringen, die, taub gegen die Stimme des Rechtes, die Beweise seiner Abkunft als erlogen, ihn selbst als Betrüger brandmarken konnten.
Der Knabe sah beides ein und fügte sich geduldig dem klugen und gütigen Berater. Nicht ohne Mühe gewöhnte er, der so lange die Luft der Berge geatmet hatte, sich an die Hitze der Niederung und schwerer noch der Wilde sich an die Gewohnheiten zivilisierten Lebens.
Aber mit Feuereifer arbeitete er an seiner geistigen Ausbildung und bald fiel es wie Schuppen von seinen Augen; er unterschied wieder die Lautzeichen seiner Sprache, und die ungeübte Hand bequemte sich zum Schreiben, wie sie es in der Kinderzeit bereits gewohnt gewesen.
Eine wichtige Hilfe hatte der greise Cura ferner an seiner jungen Nichte, die dem Wilden im Schreiben und Lesen Unterricht erteilte.
Der emporwachsende Jüngling machte große Fortschritte, und der Cura lehrte ihm alles, was er selbst wußte.
Aber auch an Leibesübungen fehlte es Alonzo nicht, und hier erst in den Llanos lernte er wirklich reiten! Bald aber zwang er das wildeste Pferd, wußte seinen Lauf mit allen Hilfsmitteln zu beflügeln, handhabte Lasso und Lanze gleich dem geübtesten Reiter der Steppe. Seine staunenswerte Geschicklichkeit als Schütze, die von den Llaneros höchlichst bewundert wurde, war ihm geblieben.
Die beiden Brüder Vivanda waren dem stolzen, ernsten Jüngling, der so eifrig strebte, das, was er versäumt hatte, nachzuholen, von Herzen zugetan.
Vorsichtig waren Nachforschungen nach Alonzos Verwandten und seinem Eigentum angestellt worden. Seines Vaters Bruder hatte als Verbannter das Land verlassen müssen und lebte vermutlich in Mexiko, dessen Schwester war tot und ihr Gatte ergeben dem einflußreichsten Manne im Staate, dem Minister de Valla. Die Verwandten seiner Mutter lebten fern an der Küste.
Pedro d'Alcantaras Eigentum hatte der Staat, das ist die zeitige Regierung, eingezogen, und es de Valla für seine Verdienste um das Vaterland als Ehrengeschenk verliehen.
Der Präsident Don Manuel Obando war zwar ein ehrlicher Mann, aber er war nur Soldat, unfähig, die widerstrebenden Parteien seines Vaterlandes mit Klugheit zu beherrschen, und war ganz in der Hand des schlauen und erfahrenen de Valla.
So war es zunächst untunlich, Schritte für Alonzo zur Wiedererlangung seines Eigentums zu unternehmen, und der Cura hatte nur einige Freunde ins Vertrauen gezogen, die von dem zeitigen Regimente des Staates, das ist dem Regiment de Vallas, dachten wie er.
Alonzo, unter dem Schutze der beiden Vivandas herangewachsen, war der Liebling der Llaneros weit und breit und selbst die Indios waren dem Jüngling, dessen Herzensgüte und gerechter Sinn oft genug die stolze Zurückhaltung seines Wesens durchbrachen, aufrichtig zugetan.
Zu einem Ritt in die Steppe gekleidet, stand der Jüngling sinnend und harrend auf der Veranda.
Ein leises Geräusch machte ihn aufschauen, und sich wendend, sah er Elvira Vivanda vor sich, die aus einem Kinde zur anmutigen Jungfrau emporgeblüht war und ihn lächelnd anschaute.
"O, wollen Sennorito reiten, weil Sie sich so steppenmäßig gekleidet haben?"
"Ja, Elvira, ich muß nach Norden in die Llanos und wollte mich von dir verabschieden, ehe ich reise. Ich weiß ja, daß du den taufrischen Morgen liebst wie ich."
"Was willst du in den Llanos?"
"Der Sturm hat die Herden zerstreut und ich will mit einigen Leuten hinaus, um sie zusammenzutreiben. Ich werde wohl erst in einigen Tagen zurückkehren."
"O laß doch die Vaqueros allein reiten, warum willst du dich mit den Herden plagen?"
"Sennor wünscht es und es ist besser, die Leute haben einen Gebieter über sich, dessen Auge sie überwacht - ich werde mich beeilen zurückzukehren."
"Und Sennorito reiten natürlich sehr gern?"
"Ja, Elvira, es ist herrlich über die Steppe auf flinkem Rosse zu eilen, das Grenzenlose vor sich und den Himmel über sich."
"All meine Erziehung ist, wie ich sehe, vergeblich gewesen."
"Wenn du mich zum Stubenhocker machen wolltest, ja - aber ich werde der Ehrfurcht, die ich meiner Lehrerin schuldig bin, nicht vergessen und bald zurückkehren." Das letztere sagte er mit einem leichten Lächeln, das ihn sehr gut kleidete.
"Das hoffe ich," erwiderte sie, "es wäre ja schlimm, wenn meine Erziehungsmethode gar keine Resultate ergeben sollte. Übrigens haben wir denn unser französisches Exerzitium gemacht?"
Elvira hatte zwei Semester die höhere Mädchenschule in Bogotá besucht und war sehr stolz auf die dort erlangten Kenntnisse.
"Der Sturm hat meine Hefte verweht, verehrte Maëstra, aber ich sammele sie, wenn ich zurückkehre."
"Ich sehe, ich werde strengere Maßregeln ergreifen müssen."
Beide lachten.
"Ja, aber erst nach meiner Rückkehr. Beurlaube mich, gestrenger Schulmeister, denn meine Vaqueros warten, und ich wäre schon längst fort, wenn ich dir nicht hätte erst Lebewohl sagen müssen."
"So reite, Alonzo, und kehre glücklich zurück!" Sie reichte ihm die Hand, die er leicht drückte; dann wandte er sich, eine prächtige Büchse ergreifend, die neben ihm lehnte, von dem jungen Mädchen ab und verließ die Veranda.
Unweit harrten seiner vier Reiter, Rinderhirten, von Sonne und Luft gebräunte, sehnige Gesellen. Drei davon waren spanischer Abkunft, deren Gesichtsfarbe sich indessen nur wenig von der des vierten, eines Vollblutindianers, unterschied. Sie saßen bereits im Sattel, die langen Lanzen am Arm befestigt; einer von ihnen hielt ein mit Mundvorrat beladenes Maultier am Zügel, während ein Peon des Hauses den stolzen Rappen des jungen Sennors führte.
Alonzo warf die Büchse am Riemen über die Schulter, schwang sich auf, nickte noch einmal nach dem Gebäude zurück, denn er wußte recht gut, daß Elvira irgendwo stand, um ihn abreiten zu sehen, und mit einem: "Adelante!" sprengte er, gefolgt von seinen Leuten, durch die Felder den Llanos nach Norden hin zu.
Ein gewaltiger Südsturm, begleitet von wild dahergepeitschten Regenströmen hatte vorgestern die Herden vor sich her gejagt und weit zerstreut.
Erst gegen das Ende des anderen Tages trafen Alonzo und seine Begleiter auf die Rinder, die weit nach Norden getrieben waren.
Sie fanden die Vaqueros der Hacienda, die bei den Herden im Freien weilten, beschäftigt, die ihrem Herrn gehörigen Tiere zusammenzutreiben, zugleich mit einer Zahl Llaneros, denen ihre Tiere gleichfalls verjagt worden waren und sich nun mit denen, die anderen gehörten, vermischt hatten.
Die sehnigen, sonnverbrannten Steppenbewohner waren erfreut, zu sehen, daß der junge Sennor der Hacienda Otoño selbst gekommen war, um gleich ihnen tätig zu sein, wieder Ordnung in den Herden herzustellen.
Nach Landessitte war jedes Tier mit dem eingebrannten Zeichen des Eigentümers versehen und nur der jüngste Wurf war noch ungezeichnet, weil das im Jahre nur einmal geschah. Um die Tiere einzufangen und zusammenzutreiben, war die Reitergeschicklichkeit, die Kraft und Ausdauer dieser auf dem Pferderücken geborenen Rinderhirten notwendig. Doch war es unendlich schwierig, Ordnung in das Chaos der durcheinandergejagten Tiere zu bringen.
Als Alonzo, den alle kannten, auf seinem hohen Rappen erschien, ritten nicht nur die Vaqueros der Hacienda heran, ihn zu begrüßen, auch die Llaneros, ein trotziges, freiheitliebendes Geschlecht, kamen herbei, um den vornehmen Sennorito von Otoño, der es an kühner Reitergeschicklichkeit mit den Besten aufnahm und gleich ihnen Tag und Nacht in der Steppe liegen konnte, willkommen zu heißen. Rasch waren mehr als zwanzig dieser verwegenen Reiter um ihn versammelt.
"Es ist gut, daß du mit Hilfe gekommen bist, Don Alonzo," sagte ein älterer Llanero, "wir haben schwere Arbeit."
Alonzo begrüßte die einfachen Männer mit der ihm eigenen anmutvollen Würde.
"Der Sturm hat sein Ärgstes getan, amigos, aber ich hoffe, wir wollen unser Eigentum bald scheiden." Er überblickte die auf weite Entfernung zerstreuten Tiere. "Wie wäre es, Companeros," fuhr er fort, "wenn wir uns, statt daß jeder von uns für sich tätig ist, vereinigten und alle gemeinsam handelten. Wir sondern zunächst Eure Tiere aus, und Ihr würdet dann helfen, unsere Tiere nach Süden zu treiben."
"Du triffst es, Don Alonzo, du hast ein kluges Wort gesprochen," sagte der alte Llanero, "so kommt Ordnung in die Sache. Ich denke, Companeros, wir sind einverstanden damit?" wandte er sich an die anderen.
"Ja, es ist das beste, Don Alonzo hat ganz recht," stimmten diese zu, "das erleichtert uns die Arbeit. Sag nur, Don Alonzo, wie wir beginnen sollen."
Dies war leicht angeordnet.
Und nun begannen sämtliche Hirten in ausgedehnter Linie in die Herden hineinzureiten, mit der Anweisung, alles Vieh der Hacienda unberührt zu lassen, und nur die Tiere der Steppenbewohner auszuscheiden und nach Ost oder West, je nach der Wohnung des Eigentümers, zu treiben.
Jetzt flogen die Lassos aus und fielen auf die Hörner widerspenstiger Tiere, die Peitsche wurde gebraucht, und noch bevor die Sonne sank war so, unter einheitlicher Leitung, ein großer Teil der Arbeit vollbracht.
Dann aber wurden Feuer angezündet, ein junges Rind wurde geschlachtet und gebraten, Kaffee gekocht, Maiskuchen gebacken und die rauhen Hirten saßen um Alonzo in festlicher Stimmung nach dem rauhen Tagewerk, schmausten und freuten sich des Vollbrachten.
Daß die Gitarre nicht fehlte, war bei Leuten spanischer Abkunft selbstverständlich, und einige der jüngeren Llaneros sangen zu deren Begleitung bald lustige, bald melancholische Lieder zum Entzücken der Hörer, bis der Schlaf die von der Arbeit ermüdeten Leute umfing.
Alonzo saß noch lange an dem niederbrennenden Feuer, umfächelt von der milden Nachtluft, die in den Zweigen zu seinen Häupten rauschte, blickte zu den Sternen empor, die leuchtend vom dunklen Himmel herniederstrahlten, und in seiner Seele stieg die Frage empor: "Wie wird dein Schicksal sich in Zukunft gestalten?"
Er fühlte sich unter dem liebevollen Schutz der Brüder Vivanda glücklich; sie hatten ihn aus einem armen Wilden zu einem Manne gemacht, zu einem Caballero erzogen, und doch nagte an seiner Seele das ungelöste Rätsel des finsteren Schicksals, das die Seinen in dem Tale der drei Quellen getroffen. Er war eine trotzige, energische Natur und sein Aufenthalt unter den finsteren Wilden hatte, wenn Klugheit ihn auch zwang, seine innersten Gefühle zu verbergen, nicht dazu gedient, diese Charaktereigenschaften abzuschwächen. Er haßte die Mörder der Seinen und sehnte die Gelegenheit herbei, Vergeltung an ihnen zu üben.
In all den Jahren, die er in den Llanos weilte, hatte man nichts von den Aimaràs wieder vernommen, sie mußten ihre Raubzüge nach der anderen Seite der Anden gerichtet haben. Der beiden jungen Leute, die er befreite, dachte er hie und da teilnahmsvoll, doch zweifelte er nicht, daß sie umgekommen seien. Ob er gleich ihre Namen nicht behalten hatte, waren doch von den Vivandas Erkundigungen nach einem vermißten jungen Caballero und einem Mestizen angestellt worden, doch ohne Resultat, was bei der dünnen Besiedlung des Landes und den weiten Entfernungen nicht verwundernswert war.
Aber noch andere Betrachtungen stellte der schweigsame Knabe an, als er nach und nach reifer wurde. Ließen Äußerungen der Aimaràs ihn schließen, daß weiße Leute bei dem Untergange seiner Familie beteiligt sein mußten, so schwächte das Verhalten des alten Gomez diesen furchtbaren Verdacht nicht ab. Er wußte auch von den sehr vorsichtigen Vivandas, daß er als der Abkömmling und Erbe seines Vaters mächtige Feinde habe, und der Name de Valla, den ihm der sterbende Gomez warnend zurief, war fest in sein Gedächtnis eingeschrieben.
Er kannte durch seine Erzieher die Geschichte seines Heimatlandes, den langen Unabhängigkeitskampf der Kolonien gegen die spanische Macht unter Bolivar, dem Befreier, und die nach dem Tode dieses hervorragenden Mannes folgenden Bürgerkriege, die zu neuen Staatenbildungen führten. Er wußte, daß sein Vater im Dienste des Landes tätig gewesen, und daß der zur Zeit mächtigste Mann des Staates de Valla hieß -, war dieser der Feind, den er zu fürchten habe? Es mußte wohl sein, den warum sollte er, Alonzo, seinen Namen verborgen halten?
Er war entschlossen, dieser Frage endlich auf den Grund zu sehen.
Gleichaltrige Freunde hatte der Jüngling nicht.
Sein ganzes Wesen war zu abgeschlossen und unzugänglich - fast hart -, um Geschmack am vertrauten Umgang mit den jungen Leuten, die er kennen lernte, zu finden. Er hatte zu früh die Hand des ehernen Schicksals gefühlt, um nicht mit tieferem Ernste in das Leben zu sehen als sie, die unter dem sorgsamen Schutze liebender Eltern aufgewachsen waren.
Aber trotzdem erfreute er sich der Zuneigung der Altersgenossen, mit denen er in Berührung gekommen war; seine ruhige vornehme Art, die doch weit von jeder Überhebung entfernt war, gewann ihm die Herzen und seine Vorzüge wurden neidlos anerkannt.
An den Brüdern Vivanda hing Alonzo mit dankbarer Liebe, besonders an dem milden Cura, aber sein Herz ging nur Elvira gegenüber auf, die er bewunderte und mit der innigen Zärtlichkeit eines Bruders liebte. Doch auch ihr zeigte er nicht den düstern Haß, der in der Tiefe seiner Seele schlummerte, ein Dämon, der nur leichter Herausforderung bedurfte, um seine ganze Gewalt zu entfalten. Elvira war eine zu sonnige, milde Erscheinung, als daß in ihrer Gegenwart nicht jeder finstere Gedanke verscheucht worden wäre. Nur der Cura ahnte, daß in der Seele des schweigsamen Jünglings dieser Dämon der Rache schlummerte, und suchte durch Lehre und Beispiel ihn zu bannen. Doch war es unmöglich, auf des Jünglings Antlitz seine Gedanken zu lesen, wenn er sie verbergen wollte; die Schule, die er unter den Wilden durchgemacht, wirkte nach.
Was wird die Zukunft bringen, welche Aufgaben hat dir die Vorsehung vorbehalten?
Unter diesen Gedanken sank auch er endlich in Schlaf.
Früh am Morgen begann wieder die aufregende Tätigkeit der Vaqueros und Llaneros.
Alonzo, der erkannte, daß seine Anwesenheit nicht notwendig war, ritt weiter nach Norden zu, um vielleicht ein jagdbares Tier zum Schusse zu bekommen, und war auf seinem feurigen Rosse in der durch einzelne Haine und Waldstreifen unterbrochenen Ebene den Hirten bald aus dem Gesicht.
Nichts wollte sich dem forschenden Auge zeigen, auf das er seine Büchse hätte richten können, und so hatte er sich einige Leguas von seinen Leuten entfernt, als er, während er langsam einherschritt, zu seiner Überraschung die Abdrücke eines Menschenfußes vor sich sah. Er hielt und betrachtete sie aufmerksam. Es war nicht der Fuß eines Llaneros gewesen, der hier dahingeschritten war, er hatte die Einprägung eines Schuhwerks vor sich, wie es in der Stadt von vornehmen Leuten getragen wurde. Er wunderte sich darüber, wie auch, daß er nirgends einen Pferdehuf abgedrückt sah; in die Llanos kam man doch nur auf dem Rücken eines Reittieres und wohl sehr selten in den Stiefeln der Städter. An dem Tau, der auf der Spur lag, erkannte er, daß sie von gestern stammen mußte.
Langsam ritt er daneben her und erkannte an den unsicher geführten Schritten, daß der Mann sehr erschöpft gewesen sein müsse. Allein? Ein Stadtbewohner, allein, ohne Pferd in den Llanos?
Er schaute sich um und erkannte, daß die Spur zu einem kleinen Gehölze führte, das unweit von ihm lag. Ihr folgend ritt er darauf zu. Bald traf sein Auge auf eine menschliche Gestalt, die am Rande des Gehölzes zwischen den Farnen lag. Er war zu sehr Jäger und von zu guter indianischer Erziehung, um, obgleich in den Llanos weder mordlustige Indios noch räuberisches Gesindel zu fürchten waren, nicht eifrig den Saum des Gehölzes mit scharfem Auge zu durchforschen und seine Büchse schußfertig zu machen.
Aber nichts Verdächtiges bot sich dem Blicke, auch keine weitere Spur weder von Tier noch von Mensch.
Er ritt langsam näher.
Da lag ein Jüngling in seinen Poncho eingewickelt, mit geschlossenen Augen, bleich von Angesicht.
Alonzo hielt und schaute in die sanften Züge des jungen Menschen. Schlief er oder war er tot? Er lag ganz regungslos.
Alonzo stieg ab und befühlte die Stirn. Sie war warm - auch die Brust hob sich -, der junge Mann lebte.
Das Gesicht des Schlafenden hatte etwas ungemein Einnehmendes, trug aber die Spuren der Erschöpfung, des Leidens.
Alonzo berührte seine Schulter und schüttelte ihn etwas.
Der Fremde schlug die Augenlider auf und schaute wie ein Träumender um sich.
Endlich haftete sein Blick auf Alonzos Gesicht, das sich mit dem Ausdruck der Teilnahme über ihn beugte.
Mit sichtlicher Anstrengung richtete der Fremde sich etwas empor, immer noch sah er aus wie ein von tiefem Schlafe Erwachender. Dann aber zeigte sein Blick, daß er die Umgebung und den, der neben ihm kniete, erkannte.
"Ich bin verirrt in dieser schrecklichen Wüste," sagte er mit matter Stimme, "ich glaubte, das Licht der Sonne nicht wieder zu sehen, als ich mich gestern hier niederlegte. Hast du etwas zu essen?"
Alonzo führte etwas Mundvorrat mit sich, reichte dem Fremden seine Flasche, die kalten Kaffee enthielt, und ein Stück Maisbrot.
Begierig aß und trank dieser.
Alonzo betrachtete die zarte schlanke Gestalt, den modischen Sommeranzug, der unter dem Poncho sichtbar war, und den eleganten Reitstiefel des Verirrten, und schaute dann wieder wohlgefällig in sein Gesicht.
Endlich fragte er: "Auf welche Weise kommen Sie nur hierher, Sennor?"
Der junge Mann, dem das bescheidene Frühstück sichtlich wohlgetan hatte, musterte jetzt den vor ihm Sitzenden und Alonzo schien ihm zu gefallen.
"Ich bin durch den Sturm von den Meinen getrennt worden und mein Maultier ist mir entlaufen, so irrte ich in Verzweiflung umher. Todesmatt sank ich gestern abend hier nieder, ich glaubte sterben zu müssen."
"O, noch ist Ihre Stunde nicht gekommen, Sie sehen, die Vorsehung hat mich zu Ihnen gesandt."
"Ja, und wie bin ich dafür dankbar!"
"Aber wie kommen Sie in diesem seltsamen Aufzuge, der wohl für die Städte gut sein mag, so tief in die Llanos, und noch dazu ohne Waffen?"
"O Sennor, ich bin Naturalista und kam in guter Begleitung."
"Naturalista?" fragte nicht ohne Erstaunen Alonzo.
"Ja, ich bin hier, um die Tier- und Pflanzenwelt der Llanos zu studieren."
"O -. Ja, ich habe gehört, daß es solche Leute gibt," und ein heiterer Zug erschien in Alonzos Gesicht.
"Ich geriet auf der Schmetterlingsjagd von den Meinen ab. Dann kam der Sturm, mein Maultier ging durch und warf mich schließlich ab, jagte davon -, und einsam war ich in der endlosen Wüste, dem Hungertode preisgegeben."
"Schmetterlingsjagd?" Dem jungen Hünen kam dies komisch vor und er, etwas sehr Seltenes in seinem Wesen, er lachte. Er hatte wohl Kinder hinter Schmetterlingen herlaufen sehen und er selbst freute sich an ihrer bunten Pracht wie an der der Blüten, aber ein Mann und Schmetterlingsjäger? Das war drollig.
Der Fremde schien beleidigt und Alonzo gewahrte es.
"Verzeiht, Sennor, wenn ein Mann, der dem Hirsch und dem Jaguar nachstellt, die Jagd auf Schmetterlinge ungewöhnlich findet -," doch setzte er mit einladender Gebärde und freundlichem Lächeln hinzu, "wie wäre es, wenn wir frühstückten?"
Der Fremde lächelte auch, der Gedanke, das Frühstück fortzusetzen, war ihm sehr sympathisch und verscheuchte alsbald seinen Mißmut.
Jetzt ging Alonzo zu seinem wohlgezogenen Roß, das unweit ruhig graste, nahm den Beutel von dessen Sattel und bald saßen die jungen Leute zusammen und verzehrten kaltes Fleisch und Maisbrot. Dies schien dem Fremden sehr zu behagen.
Endlich sagte er: "Sie sind ein Llanero, Sennor?"
Die Kleidung Alonzos, das Pferd und sein Sattelzeug hatten ihm gesagt, daß er keinen der gewöhnlichen Bewohner der Ebene vor sich hatte.
"Llanero, Montanero, wie es kommt, Sennor."
"O, kennen Sie das Gebirge auch?"
"Bis zum ewigen Schnee hinauf."
"Aber Sie sind hier zu Hause?"
"Ja."
Nach einer Weile sagte der junge Fremde: "Aber wo finde ich nur meinen Professor und meine Peons wieder. Hoffentlich sind sie dem Sturme entgangen."
"Wo waren Sie, als der Sturm kam?"
"Wenn ich das wüßte."
"Da wird es freilich schwer halten, die Ihrigen zu finden."
"Aber was beginne ich, mein Freund, der Sie sich so teilnahmsvoll meiner annehmen, was beginne ich?"
"Ich will Sie zu den Meinigen bringen, ich denke, mein Cesar wird uns beide tragen, bis ich ein Reittier für Sie habe. Glauben Sie, den Ritt auszuhalten?"
"O, ich denke wohl."
Der Fremde erhob sich -, aber er wankte noch vor Schwäche.
"O, das wird nicht angehen -. Sie sind zu erschöpft, Sennor Naturalista. Wir haben einen langen und rauhen Weg vor uns."
Er stand auf und erkletterte gewandt die unteren Äste einer Tamarinde, um von erhöhter Stelle Umschau zu halten.
Wie er gehofft, gewahrte er am westlichen Horizont leichten Rauch, nur einem ungewöhnlich scharfen Auge wahrnehmbar.
Er kam herunter und sagte: "Dort wohnen Leute, ich will Sie dorthin bringen, wir finden da ein Reittier, und, wenn es sein muß, ein Nachtlager."
"Mille gracias, Sennor -, mir ist alles genehm."
"Also gut! Es ist Mittag vorüber und die Sonne steht nicht lange mehr am Himmel."
Alonzo rief seinem Cesar, der gehorsam wie ein Hund herankam, stieg in den Sattel und sagte: "Geben Sie mir die Hand, setzen Sie Ihren Fuß auf den meinen."
Der Fremde tat so und saß im Augenblicke, von Alonzos ehernem Arm gehalten, vor ihm auf dem Rosse. Alonzo ließ das Tier, das stutzend war, aber doch gehorsam die ungewöhnliche Belastung sich gefallen ließ, angehen, doch bald zeigte es sich, daß der aller Strapazen ungewohnte Körper des Fremden unter der Bewegung und dem unbequemen Sitze litt, so sehr er auch seine Schmerzen zu verbergen suchte.
Wiederholt mußte Halt gemacht werden.
So kam es, daß Cesar mit seiner doppelten Last erst kurz vor Sonnenuntergang vor der einfachen, von einigen Bäumen umstandenen Behausung eines Llanero anlangte, deren Rauch Alonzo von weitem gesehen.
Erschöpft stiegen beide ab, denn auch Alonzo hatte, besonders auf der zweiten Hälfte des Weges, seine ganze Kraft aufbieten müssen, um den erschöpften Verirrten vor sich auf dem Sattel zu halten.
Eine ältere Frau trat ihnen aus dem Hause entgegen und begrüßte sie freundlich, sah aber mit Erstaunen, daß zwei Reiter auf einem Pferde angelangt waren.
Alonzo gewahrte das wohl, und während sein halb geräderter Gefährte matt auf eine Bank sank, sagte er: "Ja, Madrecilla, sieh nur verwundert darein, die Mula meines Freundes hat der Sturm davon getragen und wir mußten uns mit einem Pferderücken begnügen."
"Geht auch," sagte die Frau, "ich sitze oft genug hinter meinem Manne, wenn wir die Nachbarn besuchen. Aber sattelt Euer Pferd ab, Sennor, dort ist Pferdefutter und macht's Euch bequem. Mein Mann ist den Rindern nachgeritten, aber darum soll Euch doch nichts fehlen."
"Gib was du hast, Mutterchen, wir sind dankbar für alles."
Er sorgte für das Pferd und setzte sich neben den Gefährten.
Gleich darauf kam Kaffee von der trefflichen Art, die das Land erzeugt, Eier, frisches Maisbrot und kalter Braten.
Das stellte die Lebensgeister der jungen Leute und selbst die des stillen Naturforschers her. Die Sonne sank und eine erfrischende Abendluft umfächelte sie, unendlich wohltuend nach dem heißen Tage.
Nach einiger Zeit sagte der Verirrte: "Erst jetzt beginne ich mich wieder als Mensch zu fühlen, und wenn ich die Besorgnisse um meine Begleiter los wäre, könnte ich guter Dinge sein."
"Warum solltet Ihr um diese in Sorge sein? Sie werden sich nicht auf der Schmetterlingsjagd verirrt haben, wie Ihr, der Ihr noch dazu der Llanos unkundig seid."
"Ihr mögt ganz recht haben und ich ängstige mich grundlos. Wie vielen Dank bin ich Euch schuldig, ohne Euch wäre ich in der Wüste umgekommen."
"Erwähnt das nicht, ich habe kein sonderliches Verdienst dabei. Doch laßt uns hineingehen, der Tau beginnt zu fallen und das könnte Euch schaden."
Sie traten in das durch eine sehr primitive Lampe erleuchtete einfache Gemach und ließen sich dort nieder.
Alonzos Blick suchte das Antlitz des Fremden, der ihm plötzlich in den Weg geworfen worden war, dessen Zartheit und Sanftheit fast etwas Mädchenhaftes an sich hatte.
Der Jüngling gefiel ihm ungemein.
"So haben Euch also Schmetterlinge und Käfer in die Llanos gelockt, Sennor?"
"Wenn Ihr wollt, ja, doch nicht sie allein. Es fehlt unserem herrlichen, gottgesegneten Vaterlande, das alle Klimate in sich vereinigt von der Terra caliente (heißen Zone) bis zur Terra fria (kalten Zone) noch an einer genauen Kenntnis seiner Tier- und Pflanzenwelt. Und Ihr müßt nicht glauben, Sennor, daß Forschungen auf diesem Gebiete unfruchtbar für das Land seien, nein, sie haben neben der Bereicherung der Wissenschaft auch ihren praktischen Nutzen. Ich hoffe nicht, daß Ihr von der Wissenschaft gering denkt."
"Gar nicht, Sennor, ob ich gleich ungelehrt bin; nur wundert es mich - verzeiht mir, wenn ich das sage - daß solche Forschungen einen Mann befriedigen können."
"O, ja," erwiderte der andere eifrig, "dieser Einblick in die wunderbaren Erscheinungen der schaffenden Natur, die doch alle einer ewigen Weisheit sich fügen und auch in dem Kleinsten und Unscheinbarsten die Majestät Gottes widerspiegeln, gewährt dem verständnisvollen Forscher unendliche Befriedigung."
Sein Auge leuchtete auf als er so sprach.
"Ich begreife es, ob ich gleich Eure Tätigkeit nicht nachahmen möchte."
"Ich bin zum Krieger, zum Staatsmanne verdorben und bin in meiner Welt unendlich glücklich."
"Wohl Euch. Mir muß das Leben andere Freuden bringen, wenn ich glücklich sein soll. Auf feurigem Roß durch die Llanos zu fliegen, die Büchse oder Lanze in der Hand, hoffentlich eines Tages dem Feinde unseres Landes in der Schlacht begegnend und den Gegner mit gewaltigem Arm niederwerfen in den Staub, das ist so mein Ideal vom Leben."
Mit Staunen blickte der sanfte Gelehrte in das stolze, kühne Antlitz Alonzos, in die feurig blitzenden Augen. Ja, das war der Mann, der voran stürmte in das Schlachtgetümmel.
Es mochten wohl die Gegensätze sein, die sich hier anzogen, denn jeder der beiden Jünglinge, der eine so sanft und mädchenhaft, der andere so wild und trotzig in vollster Lebenskraft, fand Gefallen an dem Gefährten, den er zufällig gefunden.
Der Fremde gab Alonzo eine kurze Übersicht von der Flora ihres Landes und der mannhafte Jüngling lauschte ihm mit der Aufmerksamkeit eines Schulknaben.
"O, was seid Ihr für ein Gelehrter, Ihr werdet noch recht berühmt werden und dicke Bücher schreiben."
"Wenn Liebe zur Wissenschaft und Fleiß berühmt machen können, so ist das nicht unmöglich."
"Nun, ich wünsche es Euch von Herzen."
"Doch wäre es nicht an der Zeit, ich erführe, wem ich das Leben verdanke?"
"O, Sennor, man nennt mich Alonzo Vivanda und ich hause an einem Nebenfluß des Meta."
"Sehr wohl, Don Alonzo; in mir seht Ihr Eugenio de Valla vor Euch."
Der Name de Valla, von diesem so liebenswerten jungen Manne in Anspruch genommen, zuckte mit scharfem Schmerz durch Alonzos Seele, und augenblicklich nahm sein, eben noch mit fast kindlicher Aufmerksamkeit dem jungen Gelehrten zugewendetes Gesicht den Ausdruck von Starrheit an, unter der er stets die Regungen seines Innern zu verbergen bemüht war.
"Der Sohn des Ministers in Bogotá?" fragte er.
"Ja, Carlos de Valla ist mein Vater, amigo mio."
Erst jetzt gewahrte Eugenio die Veränderung, die in seines Gefährten Gesicht vor sich gegangen war, aber er wußte sie nicht zu deuten.
"Ihr staunt, daß mein Vater, der so große Verdienste als Staatsmann und Krieger um das Land hat, mir gestattet, bescheiden der Wissenschaft zu leben? O, er liebt mich, der gute Vater, und weiß, daß ich nur so glücklich bin. Er ist der edelste und beste der Menschen und auch Ihr werdet ihn lieben, wenn Ihr ihn kennt."
Alonzo wiegte stumm das Haupt. Dann sagte er: "Es ist spät geworden, Sennor, wir müssen das Lager aufsuchen. Wo hofft Ihr Eure Freunde zu treffen?"
"Jedenfalls in Villavacencia am Rio Negro, dort wollten wir halt machen."
"Ihr könnt es von hier aus mit nicht allzu großer Mühe erreichen."
Während er noch sprach, trat der Llanero ein, der überrascht die Fremden sah.
"O, Don Alonzo" - er kannte den jungen Sennor Vivanda - "wie freut das mich, Euch bei mir zu sehen!"
Alonzo gab ihm rasch die Ursachen an, die ihn zu seinem Hause getrieben und sprach die Hoffnung aus, daß er Sennor de Valla nach Villavacencia führen könne.
Dies bejahte der Llanero in bereitwilligster Weise.
Auf Alonzos Bitte wies die Sennora den beiden jungen Leuten ihre Schlafstätten an, und sich gute Nacht wünschend, trennten sie sich.
Alonzo ging noch einmal hinaus, nach seinem Pferde zu sehen und sagte hierbei dem Llanero: "Ich will abreiten, ehe die Sonne aufgeht, und den jungen Mann nicht im Schlaf stören. Sage ihm, ich ließe ihm Lebewohl wünschen. Pflege ihn und bringe ihn, sobald er im Sattel sitzen kann, sicher zu den Seinen, ich werde dir dankbar sein, amigo."
"Verlaß dich darauf, Don Alonzo."
Alonzo suchte seine Lagerstätte auf und sagte leise vor sich hin: "Muß dieser Jüngling, zu dem mein Herz sich hingezogen fühlt, der Sohn jenes de Valla sein - der -" düstere Bilder stiegen vor seiner Seele auf - "o schade - schade - und ich hätte den jungen Mann so innig lieben können." - Noch ehe die Sonne sich wieder erhob, galoppierte Alonzo in die Llanos hinein.
Elftes Kapitel.
Sennor Tejada und sein Peon
In bester Laune ritt Sennor Sancho Tejada am felsigen Ufer des Rio Negro einher, um gleich dessen strömenden Wassern die Niederungen aufzusuchen. Hinter ihm ritt sein Peon Juan, und das Gesicht des Mannes sah stumpfsinniger aus als je.
Der Bandit - etwas anderes war Tejada nicht, denn, obgleich aus guter Familie stammend, war er in den blutigen Bruderkämpfen der kaum vom spanischen Joche befreiten Republiken des nördlichen Südamerika verwildert und rasch zum Spieler und endlich selbst zum Straßenräuber herabgesunken - rauchte behaglich seine Zigarette und sann nach, wie er seine Glücksumstände, die bereits eine so erfreuliche Wendung genommen hatten, noch mehr verbessern könne.
Für seinen Peon, der sich übrigens als brauchbarer Diener erwiesen hatte, war er Sennor Molino, ein Haciendero vom Magdalena; denn den Namen Tejada vermied er selbst in diesem Teile des Landes, wo er doch kaum bekannt war, zu führen. Auch glaubte er, daß seine Veränderung des Bartes - er hatte, ehe er Neugranada betrat, den Vollbart in einen kecken Schnurr- und Knebelbart verwandelt - ihn unkenntlich machen werde, für den Fall er einem früheren Bekannten, der ihm nicht wohl wollte, begegnen sollte.

In bester Laune ritt Sennor Sancho Tejada am Felsenufer des Rio Negro einher.
Seine Aufgabe bestand jetzt darin, den Sohn Don Pedro d'Alcantaras ausfindig zu machen. Das geheime Versteck seines früheren Spießgesellen Gomez hatte er, als er vor einigen Wochen es durchsuchte, zwar unberührt, und darin die Briefe de Vallas gefunden, nicht aber den Goldstaub, den er suchte. Der kleine Rancho Gomez' war, wie er dort erfuhr, in den Besitz eines unweit wohnenden großen Haciendero übergegangen, der ihn der langjährigen Dienerin des Gomez abgekauft hatte, und wurde von einem seiner Aufseher bewohnt.
Bei diesem, der des Lesens unkundig war, als harmloser Reisender einkehrend, hatte ihn der Zufall das Stück der Niederschrift der Bekenntnisse finden lassen, die der schwer verwundete Gomez, als Alonzo sich auf dem Wege nach dem Cura befand, zu Papier brachte.
Der geriebenene Bandit, der sofort begriff, welche Wirkung diese wenigen Zeilen von Gomez' Hand auf de Valla haben würden, selbst wenn die aufgefundenen Briefe eine solche verfehlen sollte, war spornstreichs nach Bogotá aufgebrochen und hatte dort durch sein freches Auftreten erlangt was er wünschte.
Tejada sagte sich, daß wenn dieser Alonzo d'Alcantara noch am Leben sei, er seine Spur von dem Orte aus verfolgen müsse, wo er aufgetaucht war, und das war Gomez' Hütte.
Auf dem Wege dorthin befand er sich mit seinem Peon.
Es war zehn Jahre her, daß Pedro d'Alcantara in dem Tale der drei Quellen von räuberischen Eingeborenen, die man für aus den Schlupfwinkeln ihrer Berge herab gekommene Aimaràs hielt, mit den Seinigen überfallen und erschlagen worden war. Nur einige von der Dienerschaft waren entkommen und hatten von dem grauenvollen Ereignis berichtet.
Pedro d'Alcantara, einem vornehmen spanischen Geschlechte entstammend, gehörte nicht nur zu den Großgrundbesitzern des nach Bolivars Tod neugebildeten Staates Neugranada, von dem sich Venezuela und Ecuador unter blutigen Kämpfen abgezweigt hatten, er war auch einer seiner edelsten und einflußreichsten Bürger von gemäßigt liberalen Anschauungen.
Der politische Parteihader ließ jene Länder damals nicht zur Ruhe kommen. Kaum hatte ein der liberalen Partei angehöriger Präsident einige Jahre das Regiment geführt, als sich ein blutiger Aufstand gegen ihn erhob und die Republikaner ihn stürzten, um einen Mann ihrer Partei mit dem höchsten Amte zu bekleiden. Carlos de Valla, öffentlich den Liberalen anhängend, hatte den Republikanern heimlich wichtige Dienste geleistet und stand in Ansehen bei ihnen.
D'Alcantara, der sich wegen seines echten selbstlosen Patriotismus der Achtung bei Freund und Feind erfreute, war der Verfolgung, die nach dem Siege der republikanischen Partei über die Libertados hereinbrach, zwar entgangen; selbst sein Eigentum hatte man respektiert, in der Hoffnung, ihn für die Sache der Republikaner zu gewinnen. Doch er hatte es vorgezogen, Bogotá zu verlassen und seinen Wohnsitz im Süden des Landes, in den Llanos, fern von allem Parteigetriebe zu nehmen.
Diese Reise brachte ihm und den Seinen ein schreckliches Ende im Tale der drei Quellen. Er selbst mit seiner Gattin, seinen Söhnen Alonzo und José, den Töchtern Juana und Maria fanden unter den Messern der Aimaràs, so lauteten die Nachrichten, den Tod. Alonzo, der Erstgeborene, war damals zehn Jahre alt - Juana, die Jüngste, kaum zwei.
Der Name Pedro d'Alcantaras war nicht vergessen worden, es war für alle ehrlichen Leute der Name eines edlen Patrioten, der für die liberale Ausgestaltung der Verfassung redlich gekämpft hatte.
Einen besonderen Klang hatte er noch für die Llaneros, die er wiederholt in blutigen Schlachten anführte. Tejada wußte dies alles, wußte auch, daß der wie durch ein Wunder am Leben gebliebene Sohn Pedro d'Alcantaras, immer vorausgesetzt, daß er noch auf Erden weile, hingebende treue Freunde in den Llanos gefunden haben mußte und zwar Freunde, die genau bekannt waren mit den Gefahren, die ihn bedrohten und ihn selbst vor dem mächtigen und allwissenden Manne in Bogotá jahrelang zu verbergen vermocht hatten.
Es war also nicht ganz leicht, Don Alonzo ausfindig zu machen.
Das waren so die Gedanken des Mannes, die sein Gehirn durchkreuzten, als er behaglich am Ufer des rauschenden Rio Negro hinritt.
Sein Denken wurde durch einen aus einem Seitenwege plötzlich auftauchenden Reiter gestört, der nach Art der Hacienderos des Landes gekleidet, auf einem vorzüglichen Maultier im raschesten Paßgange des Mulo erschien und, ohne Tejadas zu achten, seinen Weg nach den Llanos fortsetzte.
Rasch, wie er gekommen, verschwand der Mann an einer Biegung des Weges und war auch nicht mehr zu erspähen, als Tejada diese erreichte.
"Hm," murmelte Don Sancho, "der hat's eilig."
Nach einiger Zeit, während er behaglich weiterritt, hörte er Pferdehufe hinter sich und gewahrte, nicht ohne Schrecken, daß der erste der drei ihm folgenden Reiter die Uniform der Landespolizei trug und zwei bewaffnete Lanceros hinter sich hatte. Tejada fühlte große Neigung, seinem Rosse die Sporen zu geben, bezwang sich aber, sich sagend, daß er sich dadurch nur verdächtig machen würde. Mit einiger Beklemmung, denn Don Sancho Tejada kam sehr ungern mit der Polizei in Berührung, setzte er seinen Weg anscheinend ruhig fort.
Trotzdem die Pferde der ihm Folgenden sehr erschöpft waren, hatten sie ihn bald eingeholt.
Der Alguacil grüßte ihn höflich, was Don Sancho in guter Manier erwiderte, und fragte: "Haben Sennor vielleicht einen Reiter auf ungewöhnlich schnellem Maultier auf Ihrem Wege bemerkt, der nach Pflanzerart gekleidet war?"
Tejada, der jetzt erkannte, daß die Lanceros dem Manne nachsetzten, der so flüchtig vor ihm aufgetaucht war, und damit jede Besorgnis schwinden fühlte, war in seinem Widerwillen gegen die ausführenden Organe des Gesetzes sehr geneigt, zu leugnen, daß er jemand gesehen habe, bezwang aber diese Anwandlung und erwiderte: "Wohl, Sennor, vor eben einer Weile erblickte ich einen solchen Reiter, der in großer Eile nach Süden ritt."
"O, so ist er uns zunächst entkommen," sagte der martialische Polizeioffizier, "denn wir brauchen Stunden, ehe wir frische Tiere für unsere abgematteten bekommen."
"Es galt einem Verbrecher, Sennor?"
"Ja, und einem sehr gefährlichen. Sennor sind in den Llanos zu Hause?"
"Doch nicht, ich bin am Magdalena ansässig und werde nur durch vorübergehende Geschäfte nach dem Süden geführt."
"So suchen Sennor gewiß Naëva auf, des großen Jahrmarkts wegen?"
"Ich hege auch diese Absicht, obgleich mein Reiseziel am Ocoa liegt."
Der Alguacil, der einsehen mochte, daß mit den erschöpften Tieren, die er und seine Leute ritten, eine weitere Verfolgung des Mannes, den er suchte, untunlich sei, ritt langsam neben Tejada einher.
Dieser bot ihm höflich seinen Tabakbeutel, den der Polizeimann erfreut entgegennahm und sich mit der Geschicklichkeit der Spanier rasch eine Zigarito formte und in Brand setzte.
"Darf ich mir die Frage erlauben, Sennor," ließ Tejada, der sich ganz als Caballero fühlte, sich vernehmen, "was der Mann, dem sie folgen, auf dem Kerbholz hat?"
"Es ist kein Geheimnis und ich bin Ihnen sogar dankbar, wenn Sie verbreiten, was ich Ihnen mitteile. Die Bürgerkriege, die unser schönes Vaterland verwüsteten, die Vernachlässigung der südlichen Departementos haben es möglich gemacht, daß eine Bande von Flußpiraten sich in den Gewässern des Landes - leider sind wir nicht unterrichtet wo, doch jedenfalls am Orinoko oder in einem seiner größeren Zuflüsse - niedergelassen hat und von da aus ihre verderbliche Tätigkeit übt."
"O, was Sie sagen?" Tejada schien sehr erstaunt zu sein.
"Leider ist es so. Diese Departementos sind nur spärlich bevölkert, dichtere Ansiedlungen weisen nur die Flußläufe auf und unsere Pflanzer haben einzig den Wasserweg den Orinoko hinab, um ihre Produkte auszuführen und nach der Küste zu bringen, wie Ihnen im Norden jenseits des Gebirges der Magdalena zu diesem Zwecke dienen muß. Seit Jahren ist es bemerkt worden, daß eine ungewöhnlich große Zahl von Flußkähnen und Flößen auf dem Orinoko verschwunden ist, verschwunden mit ihrer reichen Ladung, ihrer ganzen Bemannung. Zwar ist der Orinoko ein wilder und durch seine Felsen, seine Schnellen, seine versunkenen Baumstämme sehr gefährlicher Strom, der alljährlich seine Opfer fordert, und seine Ufer sind auf Hunderte von Meilen von unzugänglichen Wäldern eingesäumt, in denen nur der Todfeind aller Weißen, der wilde Guarani haust. Schließlich wurde aber doch der Verdacht unter unseren Hacienderos rege, daß dies nicht ganz mit rechten Dingen zugehen könne, und man richtete jetzt auf die Stapelplätze an den Flußläufen, besonders am Meta, seine Aufmerksamkeit, ohne aber zu einem Resultate zu gelangen."
Tejada, der von dem räuberischen Treiben auf den Flüssen viel besser unterrichtet war, als der Alguacil ahnte, lauschte mit großer Aufmerksamkeit.
"Mir war endlich ein in Orocue ansässiger Handelsagent aufgefallen, der für eine Firma in Trinidad aufkaufte und die Hacienderos ermunterte, ihren Tabak, Kakao, Kaffee, ihre Häute u. s. w. nach der Küste zu senden. Die meisten von diesen Ladungen verschwanden auf dem Strom. Als aber endlich durch einen unserer Stromschiffer, der einem räuberischen Überfall auf dem Orinoko durch ein wohlbewaffnetes Piratenboot glücklich entgangen war, sichere Kunde über dieses unheimliche Treiben zu uns gelangte, hierbei auch Anzeigen gegen den Agenten in Orocue sich ergaben, suchte ich den Mann zu fassen, der sich nach allem als der äußerst gefährliche Zutreiber dieser Flußpiraten, als ihr verderbliches Werkzeug am Lande auswies. Leider verfolgte ich ihn vergeblich, trotzdem ich ihm die Flüsse verlegte, wo die Piratas ja überall ihre Helfershelfer haben, und setze ihm, wie es scheint, auch jetzt vergeblich nach."
Keiner von den beiden, weder der Alguacil noch Tejada beachtete, daß dicht hinter ihnen der Indianer ritt, teilnahmslos vor sich hinschauend.
"Das ist freilich eine große Gefahr für Leben und Eigentum, Sennor," sagte Tejada, "und ich wünsche, daß es Euch gelingt, diesem gefährlichen Treiben ein Ende zu machen."
"Ja," seufzte der Beamte, "wenn wir nur die Schlupfwinkel dieser Räuber kennen würden, aber die Ströme mit ihren einsamen Ufern bieten deren zu viele. Erwische ich den Burschen vor mir, wollen wir schon dahinter kommen."
"Nun, alles Glück dazu! Am Magdalena macht sich zwar hie und da auch ein Pirat bemerkbar, doch im ganzen selten. Das sind hier im Süden absonderliche Zustände."
"Ja, leider. Die Regierung in Bogotá hätte schon längst mit fester Hand eingreifen müssen, aber sie tut gar nichts, und das ist bei der Stimmung der Bevölkerung in den Llanos gar nicht gut."
Sie verließen bald darauf die Berge und erreichten eine Posada, die zur Seite ihres Weges lag.
Tejada beschloß dort zu übernachten.

Sancho Tejada und sein Peon vor der Posada.
Der Polizeibeamte aber, nachdem er sich nach dem, den er suchte, erkundigt hatte, freilich ohne Nachricht über ihn zu erlangen, ließ durch den Posadero frische Pferde herbeischaffen und entfernte sich mit seinen Lanceros, nachdem er gespeist hatte, nach Süden, um seinem Wilde zu folgen.
Don Sancho Tejada rauchte, nachdem er eine treffliche Mahlzeit eingenommen hatte, nachdenklich seine Zigarito. Das Piratenwesen auf dem Orinoko war ihm durchaus nicht unbekannt, er hatte einige ehemalige Genossen unter der verwegenen Bande, die die Flüsse unsicher machte in jenen Gegenden, wo das Gesetz seine Macht verlor.
Ja, er hatte selbst, wenn die Verfolger gar zu arg hinter ihm waren, Neigung verspürt, sich diesen Piraten anzuschließen, nur daß die Hoffnung, ein sicheres Asyl am Lande zu finden, ihn davon zurückgehalten hatte.
Aber diese Leute vom Orinoko, die auf irgend einer Insel eine geheime Niederlassung hatten, hielten weitverzweigte Verbindungen an den Flußläufen aufrecht.
Sie waren vielleicht zu brauchen, ihm bei seinem Vorhaben zu unterstützen oder ihm im Notfall eine Zuflucht zu gewähren, denn gefährlich schien ihm die Sache mit dem gesuchten jungen Alcantara doch.
Er kannte die Llaneros aus Erfahrung.
War Don Alonzo einer von den ihren, und das war ja wohl das Wahrscheinliche, so gehörte viel Vorsicht und viel Klugheit dazu, ihm einen Streich zu versetzen, ohne eigene Gefahr zu laufen.
Diese wilden Rinderhirten mit ihren langen Lanzen und ihrer Sicherheit im Gebrauche des Lassos, zugleich mit ihrer Fähigkeit, einer Spur zu folgen, waren furchtbare Gegner und Don Sancho Tejada, der ehemalige Teniente im Dienste der Republik Neugranada, verspürte wenig Lust, sich ihrem Grimme auszusetzen.
Vielleicht gelang es ihm, eine Verbindung mit den Flußpiraten herzustellen und in ihrer Mitte ein Werkzeug zu finden, das sich gegen Don Alonzo brauchbar erwies.
Es war ihm recht angenehm, durch die Begegnung mit dem Alguacil die Erinnerung an die Räuberinsel aufgefrischt zu sehen.
Tejadas nächstes Bestreben war darauf gerichtet, den Jüngling erst zu ermitteln.
Hoffentlich fand er in der Nähe von Gomez' Heim die Spur, die ihn weiter und bis zu dem ersehnten Opfer führte.
Das übrige mußten die Umstände geben.
Tejada, der im Besitz einer Summe Geldes war, wie er sie seit langem nicht besessen, und sich hier sicher fühlte, war in der rosigsten Laune und malte sich eine Zukunft aus, die er sich mit den fünftausend Pesos de Vallas zu schaffen hoffte.
Unweit von ihm saß sein indianischer Peon und blickte teilnahmslos, nach der Art der Ureingeborenen vor sich hin.
Zwölftes Kapitel.
Naëva
Alljährlich, sobald die Regenzeit vorüber war, fand in Naëva ein Markt statt, der die Leute von weit her anlockte. Da kamen die Hacienderos von den Flüssen, die Llaneros aus der Steppe, von den Bergen die Ackerbauer und Viehzüchter, die Indianer aus den Anden und der Ebene, um zu kaufen und zu verkaufen, Geschäfte zu besprechen und zu erledigen und Neues aus dem Lande zu erfahren.
Selbstverständlich fehlten Händler aller Art nicht, die den Landleuten und den Indianern ihre mannigfaltigen Waren anboten, von der Büchse bis zum Kinderspielzeug herab, oder Käufe mit ihnen abschlossen.
Dieser Zusammenschluß vieler Leute aus der Ferne wie aus der Umgebung nahm daneben den Charakter eines Volksfestes an, dessen Freuden nicht selten außer durch Vergnügungen aller Art auch durch Wettrennen, Preisschießen oder andere Wettkämpfe erhöht wurden.
Sennor Vivanda, der regelmäßig zu dem Markte in Naëva zu erscheinen pflegte, hatte diesmal darauf verzichtet und für die Geschäfte seinen Administrator und Alonzo mit der Repräsentation der Familie beauftragt. Sennor Vivanda hatte den Jüngling schon wiederholt nach Naëva genommen, um ihn in größerem Kreise bekannt werden zu lassen. Auch hatte der ernste junge Mann durch seine vornehme und doch bescheidene Haltung, seine Meisterschaft in allen körperlichen Übungen sich rasch die aufrichtige Zuneigung aller erworben, mit denen er in Berührung kam. Er galt für einen Anverwandten der Vivandas.
Der Sennor wollte in diesem Frühjahr wieder einmal mit seinem Liebling die Berge aufsuchen. Der Schreck, den Elvira durch das Auftauchen des Jaguars erlitten, hatte sie mehrere Jahre verhindert, nach den Anden zu gehen, doch diesmal hatte sie selbst den Wunsch danach ausgesprochen. Alonzo hätte sie am liebsten begleitet, doch Sennor Vivanda hatte ihm vorgestellt, daß seine Anwesenheit in Naëva umso wichtiger sei, als der Tag nahe, wo der Kampf um seine ererbten Rechte aufgenommen werden solle, daß hierfür eine Bekanntschaft mit den Bewohnern der Ebene wie mit denen der Berge vorteilhaft sein werde. Daß Alonzo nicht der Mann war, um Freundschaft oder Wohlwollen sich zu erwerben, wußten die Herren Vivanda wohl, aber auch ebensogut, daß seine Persönlichkeit sich leicht die Herzen der Menschen gewann. So sollte Alonzo als Vertreter des Hauses Vivanda auf der Versammlung der einflußreichsten Grundbesitzer des Departementos Cauca erscheinen und sich später nach den Bergen aufmachen, um dort mit Sennor Vivanda und Elvira einige Tage zu verbringen.
Alonzo hatte seinen väterlichen Freunden Mitteilung von seiner Begegnung mit Eugenio de Valla gemacht, ihnen auch nicht verhehlt, wie sehr der sanfte Forscher sein Herz gewonnen hatte.
Die beiden Herren waren von diesem Zusammentreffen in hohem Grade betroffen gewesen, doch mit nachdrücklichem Ernst hatte ihm der Sennor erklärt, daß ein Freundschaftsbund mit dem Sohne des Ministers unmöglich sei, die hierfür sprechenden Tatsachen würde er, sobald es Zeit sei, erfahren.
Alonzo hatte sich zu seinem Leidwesen schon Ähnliches sagen müssen. "Wie traurig," dachte er, "der Naturalista war ein solch herziger kindlicher Bursche."
Einige Tage nachdem Sennor de Vivanda mit Elvira nach den Bergen aufgebrochen war, machte sich Alonzo in Begleitung des Administrators und gefolgt von einigen Peons der Hacienda auf den Weg nach Naëva.
Das kleine Städtchen, dessen Behausungen vorwiegend aus Adobeziegeln aufgeführt und mit Stroh gedeckt waren, lag lieblich, in das Grün von Manga, Caibabäumen, Palmen und Bananen eingebettet, am Ufer eines Wasserlaufes. Fernhin erhoben sich im Westen die höher und höher ansteigenden Anden.
Alonzo fand das Städtchen bereits überfüllt von Fremden. Eine größere Zahl derer, die durch Handelsinteressen hierhergeführt wurden, hatte sich in Wagen und roh hergestellten Zelten und Hütten niedergelassen.
Für ihn war freilich längst ein Haus gemietet worden.
Ein buntes Gemisch zeigte sich dem Eintretenden. Die reichen Grundbesitzer der Llanos, die Landleute aus den Bergen, die rauhen Montaneros waren da, Kaufleute vom Meta, vom Orinoko und aus den Städten des Nordens, Pferde- und Rinderhirten in ihrer wilden malerischen Tracht, Indianer aus den Pueblos in den Bergen und von den Flußläufen, die verkaufen und kaufen wollten, Neger und Mulatten, zu allen Diensten brauchbar. Auch Spieler und Raubgesindel hatten sich eingefunden, denen eine besonders für den Jahrmarkt eingerichtete berittene Polizei auf die Finger sah.
In dem kleinen Städtchen herrschte ein Leben und Treiben, wie es nur ein auf kurze Zeit berechneter Zusammenfluß von Leuten, die besondere Interessen verfolgen, hervorrufen kann. Alonzo wurde bei seinem Einreiten jubelnd von einer Schar junger Leute, Söhne von Hacienderos der Llanos, begrüßt und selbst die graubärtigen Vaqueros schmunzelten, als sie ihn in der ihm eigenen stolzen und noch anmutigen Haltung erblickten; sie hatten ihn alle gern, den mannhaften Jüngling, dessen vornehme Gemessenheit doch nichts Verletzendes an sich hatte.
"Sei willkommen, Don Alonzo."
"Gut, daß du da bist."
Und sie schüttelten ihm die Hand.
"Wo ist Sennor Vivanda?"
"Und Donna Elvira?"
"Weißt du schon, Don Alonzo, daß wir um die Wette reiten wollen? Don Sylvio hat einen silbernen Becher ausgesetzt."
"Du reitest doch mit?"
"Die Montaneros, die ja nicht reiten können, wollen ein Schießen veranstalten."
Also durchkreuzten sich die Fragen, als die jungen Leute Alonzo zu seiner Behausung begleiteten, und waren erst zufrieden, als er Auskunft gegeben und vor allem zugesichert hatte, daß er sich am Wettrennen beteiligen wolle.
Alonzo war augenscheinlich sehr beliebt unter den Llaneros.
Vor der überfüllten Posada standen, als Alonzo mit seinen Begleitern vorüberritt, der ehrenwerte Haciendero Molino alias Tejada, der es für seine Zwecke vorteilhaft gefunden hatte, Naëva zur Zeit des Jahrmarkts aufzusuchen, in der Hoffnung, bei einem großen Zusammenstrom von Leuten leichter und unverdächtiger Nachforschungen nach dem jungen Alcantara anstellen zu können.
Hinter ihnen stand Maxtla, der Indianer, und schaute mit einem Blicke zu Alonzo empor, in dem für einen Augenblick Staunen mit Freude gemischt war, um gleich darauf wieder dem gleichgültigen Ausdruck zu weichen, der dem roten Mann in diesen Landen eigen ist.
"Wer ist der junge Mann?" fragte Tejada, der sich bei dieser Zusammenkunft von Bewohnern des Landes als Bogotaner ausgegeben hatte, einen neben ihm stehenden Vaquero.
"Sennorito de Vivanda, Sennor, einer der reichsten Erben des Landes," war die Erwiderung.
"Gutes Blut darin, man sieht's an Miene und Haltung, ein echter Caballero."
"Da sagt Ihr wahr."
Maxtlas dunkle Augen folgten Alonzo, solange seine Gestalt zu erblicken war.
Als Alonzo am Nachmittage seine Behausung verließ, um einige Besuche bei angesehenen Grundbesitzern zu machen, wie ihm von seinem Pflegevater empfohlen war, vernahm er eine Stimme: "O, Don Alonzo!" und vor ihm stand mit einem von inniger Freude belebten Gesicht Eugenio de Valla. "Welches Glück! Wie freue ich mich, Euch zu sehen -", er gewahrte im ersten Augenblicke gar nicht, daß Alonzos Antlitz trotz des warmen Strahles, der in seinen Augen aufleuchtete, eine fast eisige Haltung annahm.
Alonzo war bei diesem unerwarteten Wiedersehen bewegter, als er es sich selbst eingestehen mochte, wozu die unverhohlene Freude Don Eugenios nicht wenig beitrug.
"Auch ich freue mich, Euch wohlbehalten wieder zu sehen, Sennor," erwiderte er mit vollkommener Höflichkeit, doch gemessen.
"Ich habe immerwährend Eurer gedacht und darauf gesonnen, wie ich Euch etwas Freundliches erweisen könnte -"
"Ihr legt einem kleinen, ganz selbstverständlichen Dienste zu großes Gewicht bei, Sennor - Ihr seid mir keinen Dank schuldig."
Jetzt fühlte der so freudig überraschte und erregte Eugenio doch, mit welcher Kälte ihn der Mann begrüßte, dessen er so freundschaftlich gedachte, ja daß er ihm nicht einmal den Vornamen gab, sondern sich auf das formelle Sennor beschränkte.
Er sah in das ernste unbewegte Gesicht Alonzos und seine Miene wurde traurig.
Er fand dort nichts von dem Gefühl, das ihn belebte. Das war Eugenio sehr schmerzlich.
"Ich bin auf dem Wege in die Anden," sagte er dann, "um dort meine Studien fortzusetzen. Sennor Pinola, in dessen Begleitung ich mich befinde, wollte schon heute abend reisen, aber nun möchte ich noch gern länger hier weilen."
"Ihr werdet hier gewiß manch ungewohnte Erscheinung aus den Llanos wie aus den Bergen erblicken. Ich selbst bin leider während meiner Anwesenheit hier so beschäftigt, daß ich es unmöglich finden werde, Euch etwas von meiner Zeit zu widmen."
Bei dieser kalten und ganz unverdienten Zurückweisung traten Eugenio fast die Tränen in die Augen, aber er zwang sie zurück und sagte mit unverkennbarem Schmerze: "Das tut mir herzlich leid, Sennor Vivanda. Ich werde Euer Bild im Herzen bewahren und von einem gütigen Geschick erhoffen, daß es mir Gelegenheit gibt, meinen Dank für Eure Hilfe in Todesnot einst abzutragen. Lebt wohl, Sennor."
Tief gekränkt wandte Eugenio sich ab und verschwand gleich darauf in der Menge.
Mit einem Blicke, der erkennen ließ, wie teuer der Sohn de Vallas seinem Herzen geworden, und wie schwer es ihm ankam, ihn so scheiden zu lassen, sah ihm Alonzo nach. Aber er war der Sohn des Mannes, von dem er mehr ahnte als wußte, daß er an der grauenvollen Tragödie im Tale der drei Quellen schuldvoll beteiligt war, und er war der Anweisung Sennor Vivandas eingedenk. Nur die eiserne Kraft seines Willens und die Energie, mit der er sich beherrschte, hatte seine kalt abweisende Haltung ermöglicht. Der Tag der Vergeltung nahte und dieser mußte jede Rücksicht weichen.
Machtvoll schüttelte er die Gedanken, die ihn überkamen, ab und machte seine Besuche. Überall wurde er mit herzlicher Freundlichkeit aufgenommen. Er hörte da von einflußreichen Männern Worte des Unmuts gegen den allmächtigen Minister schleudern, der durch den schwachen Präsidenten mit eiserner Gewalt das Land beherrschte.
Er hörte da, daß nur die Furcht, von neuem die Furie des Bruderkriegs zu entfesseln, die besten Männer abhielt, die Waffen gegen diese Regierung zu erheben, die die Entwicklung des Landes hemmte und jede freiheitliche Regung unterdrückte. Er hörte auch mit bitteren Worten die dunkle Vergangenheit de Vallas und seine geschickte, aber charakterlose Mantelträgerei den sich bekämpfenden Parteien des Landes gegenüber erwähnen. Doch vernahm er auch, daß de Vallas Regiment, gestützt auf die Unterstützung der Farbigen aller Schattierungen, besonders der Indianer, überaus machtvoll sei, wie daß auch einflußreiche Kreise der weißen Bevölkerung zu ihm hielten.
Alonzo galt auch in diesen Kreisen für einen nahen Verwandten und mutmaßlichen Erben Sennor Vivandas.
Mit tiefer Rührung hörte er auch seines Vaters erwähnen, mit der Achtung, die dem Sohnesherzen so wohl tut.
Im Herzen bewegt schied er von den Herren.
Es war mittlerweile dunkel geworden. Doch die Nacht war lau.
Häuser und Posaden waren überall hell erleuchtet, die Leute saßen auf der Straße, plauderten, sangen zur Gitarre ihre Lieder und schmausten.
Auch das Lager, das sich um die kleine Stadt gebildet hatte, war erleuchtet und belebt.
Hier bewegten sich vorwiegend Farbige und die kleinen Besitzer von den Llanos.
Alonzo war von allem, was er bei seinen Besuchen vernommen hatte, erregt und schlenderte zu dem kleinen Orte hinaus in das Treiben des Lagers.
Er bemerkte nicht, daß ihm ein Indianer im Poncho vorsichtig folgte.
Alonzo betrachtete sich das bunte Treiben, die Händler, die unter roh gefertigten Zelten immer noch bemüht waren, bei mangelhafter Beleuchtung Geschäfte zu machen, und den Indianern ihre bunten Waren anzupreisen. Hie und da warf ein am Boden brennendes Feuer Licht in weiterem Kreise um sich.
Während Alonzo in der Nähe eines solchen Feuers stand, hörte er hinter sich Worte in der Sprache der Aimaràs. Jäh überrascht, gelang es ihm nur mit Mühe, seine Ruhe zu bewahren und den aufsteigenden Grimm, den die Laute seiner Peiniger in ihm aufsteigen machten, zu bändigen.
"Es ist genug," sagte die Stimme, "wir wollen weiter und sind mit Sonnenaufgang an den Bergen."
"Laß uns noch bis morgen bleiben, es ist schön hier bei den weißen Leuten."
"Es sind viel Chibchas hier und man könnte uns erkennen."
Langsam hatte sich Alonzo umgewandt und sah das von dem Feuer hell beleuchtete Antlitz Guatis vor sich und neben ihm das Tucumaxtlis, des Kaziken. Die Aimaràs trugen die einfache Tracht der umwohnenden friedlichen Indianer.
Der Blick Guatis, der hoch und kräftig aufgeschossen war, begegnete seinem funkelnden Auge.
Alonzos Hand zuckte - er fühlte das leidenschaftliche Bedürfnis, die Kehle des Kaziken zu fassen, trotzdem er unbewaffnet war -, da stürmte singend und johlend eine Schar betrunkener Neger einher, die umstehenden Indianer machten eilig den Trunkenen Platz, einen Augenblick entstand Verwirrung - und die beiden Aimaràs waren in der Dunkelheit verschwunden - einem Trugbilde gleich. Aber Alonzo hatte ihre Laute vernommen, ihre ihm nur zu wohl bekannten Gesichter gesehen - ihn täuschte kein Trugbild.
Ob sie ihn erkannt hatten? Möglich -, denn der Indianer Augen sind scharf und ihr Gedächtnis treu. In der Nacht und unter dem Zusammenschluß Fremder nach den Aimaràs zu suchen, wäre vergebliches Beginnen gewesen. Dennoch beschloß er, sofort den ersten Alguacil, dem die Marktpolizei oblag, aufzusuchen und ihm Kenntnis von der Anwesenheit der Aimaràs zu geben.
Doch mußte er sich gleich darauf sagen, daß dies nur mit Vorsicht geschehen könne, wenn er sich nicht verraten wollte.
Während er, überlegend, welche Schritte er tun sollte, um der Aimaràs habhaft zu werden, zwischen einigen dunklen Bäumen der Stadt zuschritt, vernahm er plötzlich ein leise gesungenes einfaches Lied, wie es die Maultiertreiber singen, wenn sie mit ihren Tieren gehen.
Eine Flut von Erinnerungen stürmte plötzlich bei diesen Klängen, die er seit seiner Knabenzeit nicht mehr vernommen hatte, auf ihn ein, und er blieb lauschend stehen.
Vor sich sah Alonzo plötzlich schattenhaft eine dunkle Männergestalt und vernahm in gebrochener Sprache die Worte: "Alonzo, der Sohn Don Pedros, kennt noch das Lied seiner Kinderjahre?"
Alonzo erschrak und fragte hastig: "Mann, wer bist du?"
"Dein Freund, Don Alonzo, dem dein Vater einst Gutes getan," war die Erwiderung des Mannes, der nicht genauer zu erkennen war, doch sicher ein Indianer sein mußte. "Ich wollte nur wissen, ob du der Sohn Don Pedros warest, nun weiß ich es. Nenne deinen Namen hier nicht, und hüte dich; du hast Feinde hier, nicht unter den Roten, unter den Weißen. Hüte dich vor dem Manne mit dem Gesicht des Raubvogels."

"Alonzo, der Sohn Don Pedros, kennt noch das Lied seiner Kinderjahre?"
Leute kamen von der Stadt her mit Fackeln und der Mann war im Schatten der Bäume verschwunden. Alonzo stand wie ein Träumender da. Die Erinnerung an seine Kinderzeit, die Nennung seines Namens, die Warnung des Unbekannten, das Auftauchen der Aimaràs, das ihm die schrecklichste Zeit seines jungen Lebens zurückrief -. Alles zog verwirrend durch sein Gehirn.
"O, da steht Don Alonzo," ließ eine muntere Stimme sich vernehmen, "und treibt Astronomie. Wir suchen dich, Hermano, komm mit uns, wir wollen die alten spanischen Lieder singen und vergnügt sein."
Er sah einiger der jungen Leute vor sich, mit denen er bekannt war, die von indianischen Peons, die Fackeln trugen, begleitet waren.
In der Erregung seiner Seele hatte er wenig Lust, sich der munteren Gesellschaft anzuschließen, doch konnte er nicht gut ablehnen, ohne die jungen Leute zu verletzen, und ging mit, hoffend, daß er den Aimaràs noch einmal, und zwar unter vorteilhafteren Umständen, begegnen oder den Alguacil sehen werde.
Die jungen Leute suchten eine im Felde errichtete Tienda auf, wo der an den Abhängen der Kordilleren gezogene Wein verschenkt wurde. - Auf dem Wege dorthin begegnete er dem Administrator Vivandas, den er als erfahrenen und zuverlässigen Mann erkannte, der fest im Vertrauen seines Herrn stand.
Alonzo ging einige Schritte mit ihm, sprach über einige gleichgültige Dinge und äußerte dann: "Wenn ich einige von den Montaneros vorhin recht verstand, Don Sebastian, treiben sich unter den Indios auch einige der Räuber aus den Anden umher. Ist das nicht gefährlich? Sollte man der Polizei nicht Anzeige machen?"
"O, Sie meinen Aimaràs, Don Alonzo? Die sind alljährlich hier, sie kommen hierher um Munition und Waffen zu kaufen; im übrigen sind sie ungefährlich."
"Glauben Sie? Ich hörte, es seinen gefährliche Bandidos?"
"Ja, sie bestehlen die angesiedelten Indios, selbst die Montaneros von Zeit zu Zeit."
"Aber, daß man sie dann hier duldet?"
"Sie sind schwer von Indio reducidos zu unterscheiden, wenn sie Spanisch sprechen, auch fürchten die christlichen Bergindianer sie anzugeben, um nicht ihrer Rache zu verfallen."
"Aber ermorden sie nicht auch von Zeit zu Zeit Weiße? Sie sollen uns doch tödlich hassen."
"In einer einsamen Bergwildnis möchte ich keinem von der Bande begegnen, aber hier haben sie nur die Absicht, ihre Einkäufe zu machen, und entfernen sich dann schleunigst wieder. Jeder Versuch, ihrer habhaft zu werden, wäre ganz aussichtslos, und im Falle es gelänge, noch mehr jedes Prozeßverfahren gegen sie. Waren Aimaràs hier und wurden sie als solche erkannt, so dürfen Sie versichert sein, daß sie bereits auf ihren flinken Tieren dem Gebirge zueilen."
Alonzo sah ein, daß der Administrator recht hatte, und war selbst erfahren genug, um einzusehen, daß jeder Versuch, sich des Kaziken und Guatis zu bemächtigen, fruchtlos sein werde, wenn nicht der Zufall sie ihm in die Hände lieferte. Hatten sie auch ihn erkannt, dann waren sie gewiß schon auf dem Heimwege.
In der luftigen Tienda, die er mit seinen Gefährten betrat, ging es munter her, doch sah man keinen Betrunkenen, denn der Spanier ist mäßig im Genuß geistiger Getränke und Farbige wurden hier, wo weiße Caballeros saßen, nicht geduldet.
Alonzo mit seinen Gefährten nahm an einem der roh gefertigten Tische Platz und bald herrschte die fröhlichste Stimmung unter den jungen Leuten, nur Alonzos Ernst ließ sich nicht verscheuchen, doch daran waren seine Gefährten gewöhnt.
Mitten durch das Gespräch hindurch hörte Alonzo hinter sich den Namen seines Vaters nennen. Mit großer Vorsicht änderte er seinen Sitz so, daß er die, die in seinem Rücken saßen, sehen konnte.
Er erkannte einige Hacienderos des Landes und zwischen ihnen einen Mann mit einer adlerartigen Physiognomie, die sich durch starken Schnurr- und Knebelbart auszeichnete. Sein Anblick überraschte Alonzo, er hatte dieses Gesicht gesehen -, aber wo? Der Mann schien seines Vaters Namen genannt zu haben, denn er sagte jetzt: "Ich habe unter Don Pedro gedient, Caballeros, als es gegen Venezuela ging - o, ein glorreicher Capitano. Ein Jammer, daß er so früh ein Ende finden mußte."
Das Gesicht des Mannes hatte etwas an sich, das Alonzo abstieß. Dennoch bewegte es ihn, einen Kriegsgefährten seines Vaters vor sich zu sehen und diesen rühmen zu hören.
"Bei uns in Bogotá," fuhr der Mann mit der Habichtsnase fort, "liefen einmal Gerüchte um, ein Sohn Don Pedros sei der Mörderfaust entgangen und die Freude darob war allgemein; leider scheint es sich nicht bewahrheitet zu haben."
"Nein," sagte einer der älteren Hacienderos, "bei jenem furchtbaren Gemetzel im Tale der drei Quellen ist niemand verschont worden -, Don Pedro und die Seinigen sind bei den Heiligen droben."
Alle bekreuzten sich.
"Was gäbe ich, was gäben wir alle darum, wenn noch einer seines Blutes lebte."
Die anderen schwiegen und mochten so denken wie er -, auch der Redende versank in Schweigen.
Jetzt durchzuckte es Alonzo wie ein erleuchtender Blitz. - Das war das Gesicht des Mannes, der ihm vor fünf Jahren im Walde begegnete, ehe er das Tal der drei Quellen betrat, des Mannes mit dem blau gestreiften Poncho, der, wie er fest glaubte, den tödlichen Schuß auf Gomez abgegeben hatte.
Der Mann hatte damals einen Vollbart getragen, aber Alonzo hatte das beobachtende Auge des Wilden, dem nichts entging; das war der Mann.
Jetzt erschienen ihm seine Äußerungen in einem ganz anderen Lichte. Auch die Warnung des Indianers fiel ihm ein.
Weshalb sprach der Mann hier von seinem Vater? Alonzo wußte, daß Ursache vorhanden war, seine Abkunft zu verbergen, wenn er auch nicht genau die Gefahren erkannte, die ihn bedrohten - und jetzt stimmten ihn die Äußerungen des Fremden mißtrauisch.
Er wandte sich wieder zu seinen Gefährten, horchte aber trotzdem nach dem anderen Tische hinüber, doch vernahm er nichts, was seinen Verdacht, daß er in dem Manne einen Feind zu sehen habe, verstärken konnte. Doch unzweifelhaft war es ihm, daß er ihn gesehen, ehe der tödliche Schuß auf Gomez fiel. Er gewahrte auch, daß der Fremde die Gesellschaft der jungen Leute mit verstohlener Aufmerksamkeit beobachtete und sich nach deren Namen erkundigte. Er nahm sich vor, den Mann im Auge zu behalten.
Nach einiger Zeit brach die Gesellschaft der jungen Leute auf und Alonzo suchte sein Haus auf.
- - - - - - - - - - -
Alonzo wäre am liebsten gleich den Bergen zugeritten, doch mußte er sich Sennor Vivandas Anweisung, sich in den Kreisen der einflußreichen Landbevölkerung zu bewegen, folgen und tat es auch mit vielem Anstande.
Wenn er die Stadt oder den Markt außerhalb überschritt, durchforschte sein scharfes Auge die Gruppen der Eingeborenen, doch kein Gesicht stieß ihm auf, das an die Züge der Aimaràs erinnerte.
Am darauffolgenden Tage fand das Wettrennen statt, an dem nur die Söhne reicher Hacienderos teilnehmen konnten, weil nur auf großen Gütern Rassepferde gezüchtet wurden.
Dieses Wettrennen war für die jungen Caballeros stets ein Hauptvergnügen, konnten sie doch in Gegenwart der Sennoras und Sennoritas ihre Reiterkünste zeigen.
Von den Veranstaltern des Wettrennens wurde stets eine höfliche Einladung an die Landleute aus den Bergen gerichtet, am Rennen teilzunehmen, die eines ironischen Beigeschmackes nicht entbehrte, denn diese waren weder in Bezug auf Pferdematerial, noch was ihre Reiterkunst betraf, den Bewohnern der Llanos gewachsen. Sie wurde stets abgelehnt und die Montaneros rächten sich dann durch eine Einladung zu ihrem Wettschießen mit der Büchse, von dem Llaneros wohlweislich zurückblieben.
Das war so uralter Brauch, der die fröhliche Geselligkeit nicht beeinträchtigte.
Die Reiterspiele begannen.
Für die Damen und die älteren Herren waren Sitze im Schatten von hochragenden Bäumen hergerichtet und die gesamte Bevölkerung des Lagers war versammelt.
Die Spiele begannen mit einem Ringstechen, es folgten die Künste, die im plötzlichen Herumwerfen eines Pferdes bestanden, das Nehmen von Hindernissen, staunenswerte Leistungen der Vaqueros im Lassowerfen. Alles bejubelt von den Zuschauern.
Alonzo nahm nicht daran teil, er hatte im verflossenen Jahre Siege davongetragen.
Sein Auge durchforschte die zuschauende Menge.
Dann aber kam der Glanzpunkt des Festes, das Rennen der jungen Caballeros auf ungesatteltem Pferde. Hieran, was die höchste Reitergeschicklichkeit erforderte, hatte Alonzo versprochen teilzunehmen und zu diesem Zwecke ein von ihm zugerittenes Pferd, einen Fuchs, mitgebracht.
Siebzehn junge Leute aus guter Familie ritten. Es galt, die rauhe ungeebnete Bahn entlang zu sprengen, einen Pfahl zu umkreisen und zurückzujagen. Vor der Damentribüne war der Zielpunkt.
Die schlanken Gestalten der Reiter nahmen sich gut aus auf den prächtigen Pferden und es war ein malerisches Bild, als sie jetzt auf ein gegebenes Zeichen abritten.
Das Terrain war nicht günstig, es zeigte Büsche und Vertiefungen, und eine Hauptschwierigkeit war, den fest eingerammten Pfahl zu umkreisen.
Einige der Reiter stürmten vor, um die ersten am Wendepunkt zu sein, denn dort entstand oft große Verwirrung.
Alonzo ritt auf seinem herrlichen Fuchs als letzter.
Dahin galoppierte die Schar der jugendlichen Reiter. Drei Pferde stürzten, zwei Reiter wurden abgeworfen, ehe nur der erste den Pfahl erreichte. Als dieser eben umgebogen hatte, trafen die drei zunächst folgenden so hart an dem Pfahl aufeinander, daß dem einen das Bein an dem Holze verletzt wurde, so daß er das Rennen aufgeben mußte, und das Roß eines anderen zu Boden geworfen wurde.
Die nächsten kamen ziemlich glatt um den Pfahl herum, als letzter Alonzo.
Kaum aber hatte der Reiter den Pfahl hinter sich, als er seinem Fuchs zuflüsterte: "Vorwärts, mein Liebling!" und nun die ganze Kraft und Schnelligkeit seines Pferdes zeigte. Vor ihm stürzten Reiter, Pferde strauchelten und blieben zurück. Noch liefen sieben Pferde vor ihm. Im Nu hatte er vier überholt und nur noch drei vor sich, freilich die besten Renner. Die Aufregung der Zuschauer war ganz unbeschreiblich, als jetzt diese vier dem Ziele nahten.
Voran war Leon Castillo auf seinem Rappen. Jetzt aber entfaltete Alonzo seine ganze Reitergeschicklichkeit und trieb seinen Fuchs zu rasendem Laufe an. Bald hatte er nur noch den Rappen vor sich. Vierhundert Schritte trennten ihn vom Ziele und Castillo ritt wohl zwanzig Schritt vor ihm.
Eine kleine muldenartige Vertiefung liegt vor den Reitern. Castillos Rappe, dessen Reiter ihm nicht rechtzeitig die Sporen gegeben, kommt mit den Vorderhufen hinein, aber wie ein Pfeil fliegt der Fuchs darüber hin.
Alonzo hat die Führung und unter dem tosenden Viva! der Zuschauer, dem Tücherschwenken der Sennoritas geht er als erster durchs Ziel, zwei Pferdelängen hinter ihm ist der Rappe.
Donna Juana de Mendoza überreichte dem stürmisch bejubelten Sieger den Lorbeerzweig und dem jungen Castillo einen schön verzierten silbernen Becher.
"Das nächste Mal werde aber ich siegen, Don Alonzo!"
"Gern will ich dir nachreiten, es war nur Zufall, daß ich als erster durchs Ziel ging."
Freundschaftlich schüttelten sich die Sieger die Hände.
Bald nahte eine Deputation der Bewohner der Berge und lud die edlen Donnas und Sennoras als Zuschauer beim Wettschießen ein, wer aber sich mit der Büchse versuchen wolle, sei willkommen in den Reihen der Schützen.
Daß Alonzo die Büchse mit Meisterschaft handhabe, wußten nur wenige; bei den Zusammenkünften mit den Landleuten der Berge hatte er sich stets der Teilnahme am Preisschießen enthalten.
Jetzt redeten ihm die, die wußten, wie er schoß, zu, der Aufforderung der Montaneros doch diesmal zu entsprechen, und Alonzo gab, eingedenk der Ermahnung, sich auch unter den Bergbewohnern Freunde zu suchen, ihrem Wunsche nach.
Eilig wurde der Deputation mitgeteilt, daß Don Alonzo Vivanda um die Ehre bitte, sich am Wettschießen beteiligen zu dürfen.
Dies erregte nicht geringes Erstaunen. Seit Jahren hatte es kein Llanero mehr gewagt, mit den trefflichen Schützen der Berge zu wetteifern -, doch hieß man selbstverständlich Don Alonzo willkommen.
Alonzo ließ seine Büchse und seinen Kugelbeutel holen und begab sich, begleitet von seinen Freunden und gefolgt von einer stattlichen Zahl Hacienderos und deren Damen, nach den Schießständen der Schützen.
Das Vorschießen war bereits beendigt. Das heißt mehr als hundert Schützen hatten nach einer Scheibe auf hundert Schritt Entfernung je sechs Schüsse abgegeben, doch nur wer unter diesen dreimal das Zentrum getroffen hatte, wurde zum Entscheidungskampfe auf eine dreihundert Schritt entfernte Scheibe zugelassen.
Nur elf Bewerber um den Preis waren aus diesen hervorgegangen. Erfüllte Alonzo die Bedingung und traf dreimal das Zentrum der näheren Scheibe, durfte er sich zu den Elfen als Zwölfter gesellen.
Die Ordner und Richter am Schießplatze empfingen den ehrerbietig sich ihnen nahenden Alonzo mit einem Lächeln. Sie sahen die Niederlage des Llaneros voraus.
Über das Feld aber hatte es sich mit Windeseile verbreitet, Don Alonzo, der Sieger im Wettrennen, schießt mit den Montaneros, und alles war nach den Schießständen gelaufen. Auch Tejada, gefolgt von seinem indianischen Peon, hatte sich dort eingefunden.
Alles war sehr begierig auf den Ausgang des Wagnisses, sich mit den berühmten Schützen der Berge messen zu wollen. Alonzo wurde mit den Bedingungen des Wettkampfes bekannt gemacht, nach denen er zunächst sechs Schüsse auf die nahe Scheibe abzugeben hatte, unter denen drei ins Schwarze treffen mußten, wenn er zum Hauptkampfe zugelassen werden sollte.
An dem Schießstande weilten die Richter und die elf aus dem bisherigen Wettkampf als die Besten hervorgegangenen Schützen, die Alonzo mit ironischer Höflichkeit begrüßten und sich für die Ehre bedankten, daß er als Bewerber um den Preis in ihre Reihen trete.
Alonzo erwiderte mit der ihm eigenen Ruhe, daß er sein Bestes tun wolle, um sich solch ausgezeichneter Schützen würdig zu zeigen.
Er lud hierauf sorgfältig seine Büchse und auf das Zeichen des Ordners hin trat er vor und schoß rasch.
"Zentrum" signalisierten die Leute von der Scheibe.
Dies erregte nicht geringes Aufsehen, denn Alonzo hatte kaum gezielt. Doch dieser trat bereits mit der wieder geladenen Büchse vor. Der Schuß krachte.
"Zentrum" zeigte man von der Scheibe an.
Die Verwunderung war außerordentlich, ein Llanero, der so schoß? Zufall konnte dies nicht sein.
Jetzt kam der dritte Schuß.
Alles war gespannt auf den Erfolg.
"Zentrum" zeigte die Scheibe an.
Die Freude der Llaneros war maßlos und die Montaneros machten ernste Gesichter. Das war ja ein Schütze ersten Ranges, dieser junge Llanero.
Tejada brummte vor sich hin: "In den Llanos hat der junge Mann das nimmermehr gelernt, so schießt man nur in den Bergen."
Er gewahrte nicht die leuchtenden Blicke seines Peons, mit denen er Alonzo anstarrte.
Da Alonzo die Vorbedingung zum letzten Wettkampfe erfüllt hatte, rüsteten sich jetzt die zwölf erlesenen Schützen zum Schusse auf die Entfernung von dreihundert Schritten.
Ein Schreiber war da, die Zahl der Ringe zu notieren, die absolute Mehrheit verlieh den Preis.
Das Schießen begann; drei Schüsse hatte ein jeder.
Während der Pausen unterhielt sich Alonzo mit den Preisrichtern, älteren Männern, die an dem Jüngling großen Gefallen fanden.
Nicht nur der Bergbewohner hatte sich jetzt, wo die Entscheidung nahte, Aufregung bemächtigt, alle erwarteten mit leidenschaftlicher Begierde das Resultat.
Es wurde von den jungen Leuten gut geschossen, doch nur einer von den zehn traf einmal das Zentrum. Dreihundert Schritte sind eine bedeutende Entfernung, um aus freier Hand nach dem Schwarzen in der Scheibe zu schießen.
Jetzt waren nur noch Christiano Montez und Alonzo übrig geblieben.

Alonzo zielte und feuerte.
Don Christiano war ein junger hübscher Mann von liebenswürdigen Formen und galt als der beste Schütze weit und breit. Wie Alonzo aus den Gesprächen um ihn vernommen hatte, war seine Braut anwesend, in der Hoffnung, ihn als Sieger zu begrüßen. Alonzo vereinbarte mit ihm, nicht jeder solle drei Schuß nacheinander abgeben, sondern sie wollten Schuß um Schuß feuern.
Don Christiano begann.
Alonzo bemerkte ein errötendes Mädchengesicht, als er vortrat.
Sorgfältig zielte der junge Montanero. Die Kugel entflog: Zentrum!
Freudiges Gemurmel der Montaneros, Don Christiano war ihr Stolz.
Mit gefälligem Anstand begab sich Alonzo auf den Schießstand. Krach - Zentrum!
Eine lebhafte Bewegung gab sich ringsum kund. Das waren zwei Schützen!
Wiederum schoß der junge Montez und zu grenzenlosem Jubel der Seinen zum zweiten Male Zentrum.
Das machte so leicht keiner nach.
Doch vor trat lächelnd Alonzo und auch seine Kugel saß im Schwarzen.
Totenstille herrschte ringsum, die Erwartung war auf das Höchste gespannt -, selbst die Freunde Alonzos waren so erregt, daß sie kein Beifallszeichen fanden.
Don Christiano trat vor; er war aufgeregt und seine Hand bebte als er anlegte.
Ein guter Schuß - zehn Ringe.
Als jetzt Alonzo vortrat, hätte man eine Nadel fallen hören können, solche atemlose Stille herrschte.
Sorgfältig zielte Alonzo und feuerte.
Begierig schaute alles nach der Scheibe.
Neun Ringe -, die Kugel saß dicht neben der Don Christianos.
Der junge Bergbewohner war Sieger und betäubender Jubelruf erhob sich ringsum, während Alonzo dem Rivalen mit freundlichem Händedruck gratulierte.
"Nein, Sennor, ihr habt mich geschont, Euch gebührt der Preis, Ihr seid mir überlegen."
"O, Don Christiano, wo denkt Ihr hin, ich werde einen solchen Schützen schonen! Nein, der Preis ist redlich von Euch verdient und ich bin stolz darauf, daß ich ihn dem besten Schützen der Berge fast streitig gemacht habe."
Diese echte Höflichkeit gewann ihm im Sturm die Herzen, denn es waren nicht wenige unter diesen erprobten Schützen, die aus dem sorgfältigen Zielen Alonzos und dem Sitz der Kugel schlossen, daß er Christiano des Preises nicht berauben wollte.
Beide wurden mit Lobsprüchen überhäuft und Christiano eine prächtige Büchse als Preis von den Richtern feierlich übergeben.
Hellauf jubelten die jungen Llaneros, Alonzo war nur mit einem Punkte geschlagen geworden. Die Montaneros aber begrüßten herzlich und in schmeichelhafter Weise einen so seltenen Schützen.
"Wo hat der Bursche so schießen gelernt?" brummte Tejada vor sich hin.
Dieses Wettschießen, an dem ein Llanero so ruhmvollen Anteil hatte, diente sehr dazu, die Bewohner der Berge und der Ebene einander zu nähern und bald saßen sie in herzlichem Einverständnis miteinander in weitem Kreise, währen die Vorstände reichlich Erfrischungen herumreichen ließen.
Alonzo saß neben Christiano Montez und dessen Braut, einem anmutsvollen Mädchen, die nicht wenig stolz auf den Erfolg ihres Verlobten war. Ihm sowohl wie Alonzo wurden donnernde Vivas gebracht.
Eine überaus fröhliche und harmonische Stimmung herrschte unter der zahlreichen Gesellschaft.
Lieder ertönten zu Gitarrenbegleitung und das junge Volk trat zu einem der so anmutigen nationalen Tänze an.
Selbst die umherlagernden, sonst so trübsinnig dreinschauenden Indianer waren heiterer als sonst, besonders als man auch sie mit Fleisch und Schokolade bewirtete.
Es war ein überaus anmutiges, buntes Bild, das die fröhlichen Menschen hier boten, und selbst der Himmel lachte freundlich hernieder. Die festliche Stimmung wurde plötzlich gestört, als um ein Gehölz ein Reiter hervorkam, der mit der letzten Kraft seines Pferdes, im Sattel wankend, in aller Eile den Festplatz zu erreichen strebte.
"Seht da! Was ist das? Was bedeutet das?"
"Ein zu Schanden gerittenes Pferd?"
"Der Mann kann sich ja kaum im Sattel halten."
Der Anblick dieses Reiters erregte Aufsehen und rief Unruhe hervor.
Der Tanz wurde unterbrochen, die Gitarren schwiegen; aller Augen waren auf den Reiter gerichtet, der vom Gebirge zu kommen schien.
Das Pferd stürzte ermattet nieder -, der Reiter kam glücklich aus dem Sattel - und hinkte heran.
Totenbleich stand Alonzo da; es war ein Peon Sennor Vivandas, der seinen Herrn in die Berge begleitet hatte, der dort herankam.
Tiefe Stille hatte sich auf der Menschenmasse gelagert.
"Don Alonzo -!" rief schwach der Peon. "Don Sebastian!" Dies galt dem Administrator.
Jetzt traten beide vor.
"Don Alonzo soll kommen zu Sennor -, Donna Elvira ist verschwunden - geraubt - fort -"
Der Mann konnte vor Erschöpfung nicht weiter reden.
Alonzo stand bleich aber bewegungslos gleich einer ehernen Bildsäule da, nur die Augen schienen zu leben und spiegelten die Erregung seines Inneren wider.
Der Administrator war ein Bild des Entsetzens.
Man gab dem Unheilsboten, der mit Alonzo und dem Administrator dicht von den Weißen umdrängt war, etwas Wein, worauf dieser berichtete, daß die Sennorita, gefolgt von dem Cazador(Jäger) der Hacienda, einen Spaziergang in den Wald gemacht habe. Hier seien sie plötzlich von roten Leuten überfallen, der Cazador schwer verwundet worden, Donna Elvira davongeführt. Alonzo, der Administrator und die in Naëva anwesenden Vaqueros sollen zu Sennor kommen, der krank darniederliege.
Die Umstehenden lauschten dem Bericht mit sich steigernder Teilnahme.
"Das sind die Aimaràs gewesen," rief ein junger Montanero, "es ist Zeit, daß mit diesen Räubern aufgräumt wird."
Während der Administrator, der seine junge Herrin sehr liebte, wie alle auf Otoño, seine schmerzlich leidenschaftliche Erregung nicht zu verbergen vermochte, bewegte sich in Alonzos Angesicht kein Muskel.
"Wann geschah das?" fragte er, und auch der Ton, in dem er sprach, zeigte jene erzwungene eiserne Ruhe, die sein Gesicht zur Schau trug.
"Vorgestern abend."
"Gut. Nehmen Sie sich des Burschen an, Don Sebastian, lassen Sie mir den Rappen satteln und die Vaqueros aufsitzen, Mundvorrat und Munition nehmen, wir wollen reiten."
Der verzweiflungsvolle Administrator ging eilig zur Stadt zurück.
Der Peon wurde ihm nachgeführt.
"Wir begleiten dich, Don Alonzo," riefen die jungen Leute aus den Llanos, "wir wollen deine Elvira wieder holen."
"Ja, ja, wir begleiten dich alle!"
"Meine teueren Freunde," sagte mit derselben Ruhe Alonzo, "ich danke euch herzlich für eure Teilnahme; ich weiß, ihr würdet fechten gleich Löwen gegen das Mordgesindel, aber ihr seid der Berge und Felsen, der kalten Luft der Höhen nicht gewohnt, ihr würdet bald unterliegen."
"Nimm uns mit, Don Alonzo," rief Christiano Montez, "wir kennen die Berge und haben schon lange ein Wort mit dem Raubgesindel dort oben zu reden. Wer ist dabei, Companeros?"
Wohl an dreißig junge Leute, wettergebräunte, eisenfeste Gestalten, drängten sich herzu und erklärten ihre Bereitwilligkeit, zur Befreiung der Sennorita mitzuwirken.
"Euer Anerbieten, ihr Freunde, nehme ich mit Dank an, denn nur Bergbewohner vermögen in jenen Schluchten mit den schlauen Wilden zu kämpfen. Ihr werdet euch ein Verdienst erwerben, wenn ihr die Hand erhebt, um eine Tochter des Landes diesen Schurken zu entreißen."
"Ja, wir sind dabei."
"Es ist unerhört, daß sie das gewagt haben."
"Sie müssen gezüchtigt werden."
"Das geht alle Montaneros an."
So durchkreuzten sich die Stimmen.
"So sattelt und laßt uns reiten."
Augenblicklich begaben sich die jungen Bergbewohner zu ihren Reittieren, um sich für die Fahrt auszurüsten.
Alonzo ging zur Stadt zurück und fand vor seiner Wohnung den Administrator und die Vaqueros zum Abreiten fertig.
Er ging in sein Zimmer, kleidete sich in seinen Jagdanzug, nahm Kugelbeutel und Pulverhorn an sich, steckte die Machete in den Gürtel, warf den Poncho über, nahm die Büchse und erschien so zwischen seinen Leuten.
Draußen fand er alle seine Freunde aus den Llanos und die älteren Hacienderos, die mit der innigsten Teilnahme die Schreckenskunde aufgenommen hatten.
Die jungen Leute waren traurig, daß sie nicht mitreiten sollten, aber sie waren einsichtsvoll genug, sich zu sagen, daß sie, die im Sattel und der Hitze der Llanos aufgewachsen waren, hier gegen die Jäger der Berge zurückstehen mußten.
Alle begleiteten Alonzo zur Stadt hinaus, zum Festplatz, wo fast alles versammelt stand, was hier zusammengeströmt war.
Alonzo fand seine kleine Schar Montaneros bereits im Sattel.
"Wer von den Sennores kennt den nächsten und besten Weg zu dem rauschenden Wasser?" Das war der Name eines Baches, der ungestüm in einzelnen Fällen aus den Felsen in die Ebene hervorbrach.
Ein junger Mann meldete sich.
"So führen Sie uns."
Unter den Segenswünschen aller Umstehenden ritt Alonzo mit seinen Gefährten davon.
Bald sank die Sonne über den Bergen und dunkle Nacht entzog sie den Blicken der ihnen Nachschauenden.
Dreizehntes Kapitel.
Der Rächer
Der Raub der jungen Dame hatte weit und breit in den Ansiedlungen der Berge großes Aufsehen und wilden Grimm erregt. Und lebhaft war der Wunsch, den Räubern, die der allgemeinen Meinung nach nur Aimaràs sein konnten, den Raub abzujagen und die Wilden gründlich zu züchtigen.
So kam es, daß Alonzo, als er mit den Seinen im Lager Sennor Vivandas eintraf, wohl an sechzig entschlossene und gut bewaffnete Bergbewohner antraf -, die bereit waren, den Zug in die Berge zu unternehmen.
Alonzo fand den alten Herrn ganz gebrochen von bitterem Herzeleid.
Er tröstete ihn, so gut er vermochte, besonders mit der Vesicherung, daß die Wilden beim Raube eines Mädchens es nur auf Lösegeld abgesehen haben könnten.
Sennor Vivanda führte ihn hinaus, wo die Montaneros, unter denen auch einige Indianer der benachbarten Ansiedlungen waren, am Feuer lagerten, um ihn diesen vorzustellen; er nannte ihn dabei den Sohn seines Herzens. Die mit Alonzo gekommenen jungen Männer hatten sich den anderen schon zugesellt.
Ein älterer erfahrener Bergbewohner, der als berühmter Jäger das Gebirge bis weit hinauf kannte, erhob sich, schüttelte Alonzo die Hand und sagte dann: "Wir haben überlegt, Sennor Vivanda, wie wir dir und deinem armen Kinde helfen können. Nichts wäre uns lieber, als diese Räuber oben in den Bergschluchten zu vertilgen, aber sie wohnen in solch sicheren natürlichen Festungen, daß sie jedes Angriffs spotten können. Außerdem haben sie deine Tochter als Geisel. Wir müssen den Weg der Unterhandlung versuchen."
"Ja," sagte Alonzo, "aber der Unterhändler muß dreißig tapfere Herzen und dreißig sichere Büchsen hinter sich haben. - Mit dreißig entschlossenen Männern unternehme ich es, den ganzen Stamm zu vertilgen."
"Du sprichst große Worte, Jüngling," erwiderte der Montanero. "Du kennst das Gebirge nicht."
"Ich kenne es, und weiß, was ich sage," erwiderte Alonzo ruhig.
"Und er ist ein wundervoller Schütze," rief einer der jungen Leute, die mit Alonzo gekommen waren, "wir haben es gesehen. Ist es nicht so, Companeros?"
"Ja, es ist wahr," bestätigten die anderen.
Mit hastigen Schritten kam ein junger Mann auf Alonzo zu und vor dem Jüngling stand Antonio, der Mestize, der ihn mit leuchtenden Augen anstarrte.
"Don Alonzo, bist du es?" fragte er mit bebender Stimme.
Durch Alonzos Herz zog ein freudiges Gefühl, als er den vor sich sah, dem er einst das Leben gerettet hatte. Er reichte dem Mestizen die Hand und sagte: "Ich bin es, amigo mio, und freue mich, dich noch unter den Lebenden zu sehen. Doch," setzte er leise hinzu, "sprich hier nicht von dem Beginne unserer Freundschaft."
"O, Don Alonzo," sagte Antonio, sehr bewegt von diesem Wiedersehen, "ein gütiges Geschick war uns gnädig -, ich gehöre Euch im Leben und im Tode, verfügt über mich. - Companeros," rief er dann laut, "wenn einer uns gegen die feigen Mörder in den Bergen führen kann, so ist es hier Don Alonzo, der Sohn dieses würdigen Herrn, ich weiß es aus Erfahrung, ich folge seiner Leitung unbedingt."
Da der Mestize, der sich großer Achtung erfreute, auch als geübter Bergsteiger und Jäger bekannt war, machten seine Worte einen sehr guten Eindruck auf die Montaneros.
"Gut so," sagte der ältere Mann, der aufmerksam die Begrüßung zwischen Antonio Minas, dem Halbindianer, und Alonzo beachtet hatte, und wohl wußte, gleich den Weißen hier, daß der Mestize durch die Klugheit, Tapferkeit und Hingebung eines bei den Aimaràs gefangen gehaltenen Knaben gerettet worden sei, "wenn Antonio Minas das sagt, bin ich bereit, Don Alonzo zu folgen."
"Wir gehen mit ihm," riefen die anderen.
Der Zuruf war kaum verklungen, als zwei Reiter auf die Versammelten zukamen, von denen der Vorankommende, ein älterer bebrillter Herr in leichtem Sommeranzuge, der nichts vom Jäger oder Landmann an sich hatte, in großer Erregung zu sein schien. Der ihm folgende war ein Peon.
"Ich suche Sennor Vivanda," sagte er hastig, sich umschauend.
Vivanda ging ihm entgegen und begrüßte ihn.
"Ich bin Professor Pinola von Bogotá, Sennor, und weile als Forscher in den Bergen. Ich habe von Eurem großen Unglück vernommen -, o -, auch wir haben Gleiches zu beklagen -, das jüngste Mitglied unserer Expedition, Don Eugenio de Valla, ist uns von Wilden in die Berge entführt worden. O, Sennor, der junge treffliche Mann ist mir von seinem Vater anvertraut worden, Sie sorgen um Ihre Tochter, ich höre, daß man Ihnen beistehen will -, o lassen Sie uns unsere Anstrengungen vereinen, um die Gefangenen zu befreien. Der Vater Don Eugenios, der Staatsminister de Valla, wird jedes Lösegeld für seinen Liebling bezahlen und jeden reich belohnen, der zu seiner Befreiung mitwirkt."
Der Professor brachte dies alles in nicht geringer Aufregung hervor.
Über die Züge Sennor Vivandas lagerte sich ein tiefer Ernst.
de Vallas Sohn in den Händen der Aimaràs?
"Strafst du schon hier, Allewiger?" flüsterte er vor sich hin.
Alonzo war schmerzlich überrascht von dieser Kunde, doch blieb sein Antlitz ruhig.
"Wann ist dies geschehen?" fragte jetzt der ältere Montanero, "und woher wissen Sie, daß Aimaràs den jungen Mann gefangen haben?"
"O Sennor," erwiderte der Gelehrte, "Don Eugenio ist ein eifriger Entomologe, und als er vor drei Tagen nicht zum Lager zurückkehrte, suchten wir ihn mit Hilfe der indianischen Jäger, die wir bei uns haben, denn wir fürchteten, er habe sich verirrt oder es sei ihm ein Unfall begegnet. Unser Suchen war vergeblich, doch durch einen Eingeborenen des Landes erfuhren wir, daß berittene Indios einen jungen Weißen, dessen Beschreibung auf Don Eugenio paßte, in die Berge geführt hatten. Da hörte ich gestern auch noch von der Entführung Eures Töchterchens, Sennor. Lassen Sie uns vereint handeln, um diese teueren Menschen zu befreien; kein Preis ist dafür zu hoch."
Die Montaneros, die sich um die Gruppe versammelt hatten, lauschten diesem Berichte mit sich steigerndem Ingrimm. Seit Jahren hatten die gefürchteten Räuber nichts von sich gewahren lassen und nun sich wieder in solch schreckenvoller Weise bemerkbar gemacht.
Der Zorn machte sich in manchem Ausrufe Luft.
"Diese Männer hier," sagte Sennor Vivanda zu Professor Pinola, "sind entschlossen, alles zu versuchen, um mein Kind zu befreien, und werden gewiß auch für Don Eugenio eintreten."
"Gewiß," beteuerten die Hörer, "wir werden ihn nicht verlassen."
"Das ist Ihr Sohn, Sennor?" fragte Pinola, Alonzo anblickend, der neben Vivanda stand.
"Ja, Don Alonzo."
"O, er hat schon einmal Don Eugenio das Leben gerettet -, sein Name ist in unser Herz geschrieben." Er reichte Alonzo die Hand und fuhr mit bewegter Stimme fort: "Wenn Sie wüßten, Sennorito, wie sehr Eugenio Sie liebt, Sie würden stolz darauf sein -, o, wir sind Ihnen ja schon auf das Tiefste verpflichtet -, verlassen Sie Don Eugenio auch jetzt nicht."
"Wir werden tun, was wir können, Sennor."
Rasch wurde jetzt beschlossen, daß unter des alten Jägers und Alonzos Führung die dreißig besten Bergsteiger und Schützen in die Berge ziehen sollten, um die Gefangenen durch Lösegeld, mit List oder Gewalt zu befreien. Die Leute wurden ausgewählt und rasch alle Vorbereitungen für den gefährlichen Zug getroffen.
Bald darauf ritten zweiundreißig entschlossene Männer auf guten Maultieren die Schluchten hinan, es waren nur Montaneros.
Voran ritt Geronimo Corazon, der Jäger. Etwas hinter den anderen ritten Alonzo und Antonio, der Mestize -, der, als sie allein waren, stürmisch seiner Freude Ausdruck gegeben, den jugendlichen Retter seines Lebens wiedergefunden zu haben.
"Glaubt nicht, Don Alonzo, daß wir Euch damals verlassen hatten -, wir haben lange im Nebel gewartet auf Euch, mußten aber endlich aufbrechen, um nicht in die Hände der Wilden zu fallen. Unsere Tiere führten uns sicher durch den Nebel den furchtbaren Weg nach unten. Ob wir verfolgt wurden, weiß ich nicht, wir haben nichts davon bemerkt. Am dritten Tage trafen wir auf Leute, die nach Chinarinde suchten, und waren gerettet."
"Und Euer Gefährte?"
"O Don Fernando? Bis auf die Besorgnis um Euch war er stets guter Laune, aber Euer Schicksal ging ihm sehr nahe. Ich habe, seitdem wir uns trennten, nichts wieder von ihm vernommen. Er war eines großen Mannes Sohn und wird wohl jetzt selbst ein großer Mann sein."
Alonzo teilte dem Mestizen jetzt die Vorgänge mit, die ihn gehindert hatten, den Ort des Zusammentreffens aufzusuchen; staunend und teilnahmsvoll lauschte Antonio Minas.
"Ihr habt ein goldenes Herz, Don Alonzo, Ihr habt für Fremde Euer Leben rücksichtslos gewagt. Ach, ich fürchtete, Ihr seid den Wilden zum Opfer gefallen und habe manche Messe für Euch lesen lassen -, glaubt es, ich habe oft mit inniger Dankbarkeit Eurer gedacht. Umsomehr freue ich mich, Euch wohlbehalten und den Eurigen wiedergegeben zu sehen. Wunderbar aber ist nur, daß ich, der ich doch den Llanos nicht gar so fern wohne, nie von Euch etwas vernommen habe."
"Es sind Gründe vorhanden, Don Antonio, zu verschweigen, daß ich aus der Gefangenschaft bei den Aimaràs zurückkehrte, daher gab ich Euch vorher einen Wink, nicht davon zu sprechen, und bitte Euch, es auch jetzt nicht zu tun."
"Seid versichert, ich schweige. - Eine unbändige Freude aber sollte es mir bereiten, jetzt in Eurer Gesellschaft den Roten die Angst, die ich einst ausgestanden habe, vergelten zu können."
- - - - - - - - - - -
Anstrengend für Mensch und Tier war das Emporsteigen in die höheren Regionen der Kordilleren. Gegen Abend des dritten Tages hatte die kleine Schar der Montaneros eine Höhe erreicht, zu der außer Antonio und Alonzo nur der Jäger Geronimo bisher gelangt war. Geronimo war bisher der Führer gewesen. Als er, nachdem sie ein kleines Tal durchritten, nach links abbiegen wollte, ritt Alonzo zu ihm und sagte: "Wir müssen unseren Weg genau in der entgegengesetzten Richtung nehmen, Don Geronimo, wenn wir das Dorf der Aimaràs erreichen wollen."
"Es gibt dort keinen Weg, Sennor."
"Seid versichert, es gibt einen solchen. Dort," er deutete nach links, "kommen wir ins Hochgebirge, doch nimmer zu den Aimaràs."
Geronimo sah ihn erstaunt an.
"Da wäre ich doch begierig."
"Seht Ihr dort, neben jenem Felszacken, die Gentiansträucher, Sennor?"
"Wohl."
"Dort ist der Weg zu den Aimaràdörfern."
"O -. Habt Ihr recht, Don Alonzo, so seid Ihr ein Zauberer, oder Ihr wißt mehr vom Hochgebirge als ich vermutete."
"Ich habe hier einen Teil meiner Jugendjahre zugebracht, Don Geronimo."
"Hier?" Das Erstaunen des Alten war nicht geringer nach diesen Worten des Jünglings, und mit einem scheuen Blicke sah er zu ihm auf.
"Wir sind bis jetzt unentdeckt von den Aimaràs hoch in die Berge gekommen, denn sie haben sich natürlich in aller Eile mit ihrem Raube zurückgezogen, fürchten auch keine Verfolgung, denn die Wege zu ihren Dörfern sind nur allein ihnen bekannt. Von jetzt ab aber beginnt die Gefahr, entdeckt zu werden, von jetzt ab sind Wachen aufgestellt, und Ihr werdet sehen, wie leicht die Schluchten zu verteidigen sind. Laßt unsere Gefährten lagern, doch dürfen keine Feuer angezündet werden, und kommt mit mir, ich will Euch zeigen, wo der Weg beginnt."
Es wurde der Befehl erteilt zu lagern, und die jungen kräftigen Burschen versorgten ihre Tiere, zogen ihren Mundvorrat hervor und ließen sich nieder; die Luft war mild und sie konnten die Feuer entbehren.
Alonzo winkte Antonio heran und mit diesem und Geronimo ging er zu den Gentianbüschen. Zu seinem Erstaunen erkannte der Jäger, daß hier ein Pfad in die Berge führte, gangbar für Maultiere, der sich bald erweiterte.
"Die Sonne sinkt," sagte Alonzo, "heute ist nichts mehr zu tun. Morgen wollen wir sehen. Nur List kann uns zum Ziele führen."
Sie begaben sich zu den anderen zurück und bald lagen alle bis auf zwei, die zu aller Vorsorge als Wachen aufgestellt waren, in tiefem Schlummer. Alonzo dachte noch eine Weile des armen Mädchens, das so rauh aus den Armen ihres Vaters gerissen war, und des jungen Eugenio. Vertrauensvoll sah er dem kommenden Tage entgegen.
Noch war es dunkel als er sich erhob und nach kurzer Verständigung mit den Wächtern der versteckten Schlucht zuschritt, in der er gleich darauf verschwand.
Die Schlucht erweiterte sich, schroff aber ragten rechts und links Felswände empor. Ein nur einem geübten Auge erkennbarer Felspfad führte zur Rechten nach oben. Diesen schritt Alonzo hinan, höher und höher.
Der Pfad war schmal, er gab nur Raum für ein Maultier. Rechts die senkrechte Wand, links der gähnende Abgrund.
Gewandt und sicher schritt Alonzo diesen Weg entlang. Endlich hielt er und betrachtete die Felswand zu seiner Rechten -, ging noch einige Schritte weiter, eine nach oben führende Rinne zeigte sich schattenhaft dem Auge. Kräftig und vorsichtig zugleich ging Alonzo den steilen Weg hinan.
Endlich war er oben. Zerrissene Felsen, Steinbrocken, Büsche zeigten sich seinem Auge -, schon begann die Nacht zu weichen.
Er ging noch einige hundert Schritte weiter und ließ sich dann in einem Busche nieder, der am Fuße eines Felsens emporschoß.
Hier harrte er geduldig.
Heller wurde es im Osten und die Sterne erbleichten; rötliche Strahlen, die am Himmelsbogen emporstiegen, verkündeten das Nahen des Tagesgestirnes. Schon schimmerten die Häupter der fernen Bergriesen in zauberhafter Glut - und Nebelschleier flatterten um sie her. Und nun stieg am klaren Horizonte der Sonnenball in feuriger Pracht empor und eine Flut von Licht ergoß sich über Felsen, Wälder und Berge, alles ringsum und weithin zu neuem Leben weckend.
Es war ein Anblick von so erhabener Schönheit, daß kein fühlendes Menschenherz sich dem Eindruck dieser feierlichen Pracht entziehen konnte.
Auch Alonzo empfand tief in der Seele, was in tausend Zungen von Himmel und Erde eindrucksvoll zu ihm redete. Doch dann erwachte der Krieger wieder in ihm, der ein Feindeslager beschlich und sein scharfes Auge durchforschte die Felsen, von wo aus man den Pfad und den Weg in die Schlucht entlang sehen konnte. Auf diesen ward in Zeiten, die Gefahr fürchten ließen, eine Wache ausgestellt. Das wußte Alonzo, dessen ungebändigter Freiheitstrieb als Knabe nichts unversucht gelassen hatte, die Geheimnisse seiner Peiniger zu erspähen.
Bewegungslos und geduldig wartete Alonzo, einem Jäger gleich, der auf dem Anstand sitzt. Auf ein leichtes Geräusch hin wandte er seine Augen nach rechts.
Ein bewaffneter Aimarà kam dort sorglos einher, warf einen Blick auf den Felspfad, ließ sich dann nieder, entnahm seiner Tasche Maisbrot und begann so zu frühstücken.
Es war ein noch junger Mann und Alonzo glaubte ihn zu erkennen.
Er saß kaum hundert Schritte entfernt und ein Schuß hätte leicht seinem Leben ein Ende gemacht. Aber Alonzo wollte nicht schießen, es war zu gefährlich wachsamen Feinden gegenüber. Unschädlich machen mußte er den Wächter, doch wollte er nur im höchsten Notfall die Waffe gegen jüngere Leute erheben, die schuldlos waren am Tode der Seinigen.
Jetzt erkannte er auch den Wächter, es war Junma, mit dem er oft gespielt hatte.
Geräuschlos verließ er den Busch, der ihn verbarg, und Schritt vor Schritt, Büsche und Felsbrocken als Deckung benützend, schleichend, einem Raubtiere gleich, nahte er sich dem Indianer.
Dieser war ganz sorglos und beschäftigte sich mit seinem Maisbrot.
Bis auf drei Schritt war Alonzo hinter ihn gelangt. Er zog die Machete und das Leben des Wilden hing an einem Haare, denn Alonzo war entschlossen, die Waffe zu gebrauchen, ehe er sein Opfer entfliehen oder auch nur schreien ließ.
Vorsichtig richtete er sich auf -, ein Sprung nach vorwärts und mit der Linken des Mannes Hals mit eisernem Griff umklammernd warf er den gänzlich Überraschten zu Boden, ihm in der Sprache der Aimaràs zuflüsternd: "Keinen Laut oder meine Machete macht dich stumm." Der auf solche Weise überraschte Mann lag regungslos auf dem Rücken, die Hand seines Feindes an der Kehle, die blitzende Waffe vor seinen Augen und schreckenvoll blickte er in Alonzos Gesicht.
Dieser lüpfte die linke Hand und ließ ihn Atem holen, ohne die Machete aus der Nähe seiner Kehle zu entfernen.
"Techpo," murmelte der Aimarà und sein braunes Gesicht drückte Entsetzen aus.

Während Alonzo bewegungslos und geduldig wartete, kam ein bewaffneter Aimarà sorglos des Weges.
"O, kennt mich Junma noch? Das ist gut. Junma weiß, daß ich sein Freund bin."
"Hat der Erdgeist dich zurückgeführt, der dich hinabriß, wie Guati sagte?" - "Nein, der Windgott hat mich davongeführt in das Land der Weißen, Guati täuschte dich." Trotz der den Indianern eigenen Selbstbeherrschung war der Schrecken des jungen Wilden, den wesentlich das Wiedererscheinen Alonzos hervorrief, deutlich erkennbar.
"Junma sieht, daß die Götter der Aimaràs dem jungen Weißen hold sind, sie haben ihn auch zurückgeführt in die Berge. Da ich nicht weiß, ob Junma noch Techpos Freund ist, muß ich ihn binden, es wird ihm kein Leid geschehen, wenn er nicht Widerstand leistet."
Der abergläubische, verblüffte Wilde, der Alonzo, was dieser mit Freuden wahrnahm, als Opfer des Erdgeistes betrachtet hatte - er war also auf der Flucht vor fünf Jahren nicht erkannt worden -, dachte bei diesem so unerwarteten Wiedererscheinen des Totgeglaubten gar nicht an Widerstand, ließ sich ruhig mit Lederriemen, die Alonzo seiner Jagdtasche entnahm, binden, die schreckenvollen Augen immer auf sein Antlitz geheftet.
"Wo hast du dein Maultier?"
"Es grast im Tale."
"Gib keinen Laut von dir, Junma, denn ungern würde ich dich töten."
Alonzo nahm die an die Felsen gelehnte Büchse des Mannes und stieg in das Tal hinab. Er fand dort das gesattelte Maultier und führte es auf den Felsenpfad bis jenseits der Rinne, in der er die Felsen erstiegen hatte.
Umkehren konnte es nicht, dazu war der Pfad zu schmal, und er ließ es stehen. Er ging wieder hinauf und fand den Gefangenen ruhig in seinen Banden liegen.
"Was willst du, Techpo?" fragte der junge Wilde. "Ich habe dir nie etwas getan."
"Nein, Junma, das hast du nicht und es wird dir auch nichts geschehen, ich bin nur gekommen, das weiße Mädchen zu holen, sie ist meine Schwester, und den jungen Blanco, den die Deinen fortgeführt haben."
Junmas Gesicht verriet Erstaunen.
"Wundere dich nicht, der Wind, der von den Bergen kommt, flüsterte es mir ins Ohr. Haben die Aimaràs den jungen Mann schon getötet?"
"Nein."
"Das Mädchen werden sie gern gegen blankes Silber hergeben, es nützt ihnen nichts."
"Guati will sie zu seinem Weibe machen."
Alonzo erschrak furchtbar, doch beherrschte er seine Züge besser als der Indianer.
"Junma muß mit mir gehen zu meinen Freunden, er würde sonst den Seinen sagen, Techpo sei da."
Junma blieb stumm.
Alonzo löste die Bande an den Füßen seines Gefangenen, half ihm aufstehen, legte ihm den Lasso um, und so gingen beide in der Rinne hinab bis zu der Felskante. Das Maultier stand noch da, wo Alonzo es gelassen hatte.
Einer Aufforderung des Jünglings entsprechend, hieß der, wie es schien, gänzlich willenlose Wilde es vorwärts gehen und kurze Zeit später traten beide unter die Montaneros. Jetzt erst schien der Bann von dem Aimarà genommen, als er die weißen Jäger sah; damit war das Unheimliche, das in Techpos plötzlichem Erscheinen gelegen, für ihn verschwunden und sein Auge flammte in wildem Haß auf. Alonzo gewahrte es recht gut.
Er sagte den Freunden, daß er in dem Aimarà einen gefährlichen Wächter beseitigt habe, daß Donna Elvira und Eugenio im Dorfe der Indianer weilten.
Er ließ Junma auch die Füße wieder binden und übergab ihn der Aufsicht zweier Leute, ihnen einschärfend, daß diese Wilden eine ungewöhnliche Schlauheit besitzen, und daß sein Entweichen gleichbedeutend sei mit dem Scheitern der Expedition, und große Gefahren über alle bringen werde.
Mit Geronimo, dem Mestizen und einigen der älteren Landleute beriet er nun, was zu tun sei. Er setzte seinen Hörern, die mit Ausnahme Antonios seinen Worten mit großem Erstaunen lauschten, auseinander, daß das Tal der Aimaràs drei Zugänge habe, deren einer nahe vor ihnen lag, und durch Bewaffnete besetzt sei. Der zweite öffnete sich nach Norden hin, und von ihm aus waren die höher gelegenen Niederlassungen des Stammes zu erreichen. Der dritte gestattete nur in die unfruchtbaren eisigen Höhen der Gebirgswelt zu gelangen, in der Flüchtlinge rettungslos zu Grunde gehen mußten. Diesen Ausweg würden die Aimaràs nur im Notfall wählen.
Um die Wilden zur Herausgabe ihrer Gefangenen zu zwingen, sie selbst, die vielleicht hundert bewaffnete Männer zählten, in Schach zu halten, schlug er vor, die beiden Ausgänge des Tales, den vor ihnen und den nach Norden hin zu besetzen, wo einige Schützen genügten, den Weg zu verteidigen. Er erbot sich, die geübtesten Bergsteiger auf gefährlichen Wegen zu dem Ausgang nach Norden zu führen, dann das Wächterhaus, das vor ihnen läge, in Besitz zu nehmen. Weiteres Eingreifen und Handeln müsse den Umständen überlassen bleiben. Am Tage wolle er die jungen Leute nach Norden führen, bei Nacht das Wächterhaus überraschen. Gegen Abend sollte Geronimo auf dem Pfade vor ihnen langsam emporrücken bis zu einem Bache und dort des weiteren harren.
Die Ausführungen Alonzos zeugten von einer Ortskenntnis, die, so überraschend sie war, doch Vertrauen erweckte.
Man beschloß, nach seinen Vorschlägen zu handeln, und zehn junge Männer wurden ausgewählt, die Alonzo begleiten sollten, während Geronimo den Befehl über die anderen übernahm. Antonio blieb bei ihm.
Alonzo ließ den Aimarà jetzt seiner Kleider entledigen und zog sie an bis auf das Fußzeug, ließ ihn in einen Poncho hüllen und überzeugte sich, daß er wieder fest gebunden wurde. Er verabschiedete sich von den übrigen und schritt, gefolgt von den zehn jungen Leuten, in die Schlucht, den Felspfad hinauf und führte sie dann über schwer zu ersteigende Felsen im Halbkreise um das Tal, bis sie nach mühevoller Wanderung den Eingang im Norden erreichten. Hier hielten sie an versteckter Stelle Rast.
Geduldig harrten sie aus, bis die Nacht hereinbrach.
Alonzo verteilte seine Gefährten dann an geschützten Stellen, von wo sie den Paß bestreichen konnten, mit der Aufforderung, vorzudringen, sobald sie schießen hörten, und dann nach den Umständen zu handeln.
Als es dann ganz dunkel geworden war, nahm er die Büchse und schritt im Gewande Junmas tiefer in das Tal hinein, treu den eigenartigen Gang der Indianer nachahmend.
Niemand begegnete ihm, die Aimaràs suchten mit der Nacht ihre Häuser auf.
Nichts hatte sich ringsum verändert und Alonzo kannte jeden Fuß breit der Niederlassung. Er sagte sich, daß man Elvira, und nur ihr galten zunächst seine Gedanken, wahrscheinlich im Hause des Kaziken untergebracht haben werde, und dorthin lenkte er seine Schritte. Während er so durch die bekannten Stätten schritt, wachten die Erinnerungen an seine jahrelange Gefangenschaft unter den stumpfsinnigen Wilden wieder auf und diese Erinnerungen füllten sein Herz mit Bitterkeit. Er war jetzt ein Mann, ein kräftiger junger Mann und wußte, daß er es mit grausamen mitleidslosen Feinden zu tun habe; er war entschlossen, im Notfall rücksichtslos zu handeln. Aber er bezwang seinen Grimm in dem Gedanken an Elvira. Nicht vergebens hatte er sich indianische Vorsicht und Schlauheit angeeignet, er war den Aimaràs immer noch gewachsen. Er ging an dem Corral vorüber, in dem die Aimaràs ihre Pferde und Maultiere bewahrten. Er trat hinein, die Tiere mit einigen Schmeichelworten beruhigend, und fand ein noch gesatteltes starkes Maultier, das er vorsichtig herausführte.
Kaum war er draußen, als eine Stimme aus der Dunkelheit zu ihm drang: "Wo willst du hin?" Doch Alonzo war darauf vorbereitet und erwiderte: "Zu den Wächtern im Osten, Tucumaxtli befiehlt es." Er führte das Tier an einigen Häusern vorbei und band es in der Nähe von des Kaziken Hause an einen Baum.
Sah es jemand, so konnte er doch nichts Verdächtiges daran finden. Boten gingen öfter ab von des Kaziken Hause.
Im Dunkel der Hecken und Büsche schlich er nun zu dem Eingang, der in den das Haus des Kaziken umgebenden Garten führte, die blanke Machete in der Hand.
Er schlich durch den Garten -, im Hause war Licht, er trat an eines der verhangenen Fenster und lauschte. Da vernahm er die tiefe Stimme des Kaziken.
"Du redest törichte Worte, Guati -, das weiße Mädchen wird viel Geld einbringen."
"Das weiße Mädchen wird Guatis Weib oder sie stirbt," war die in trotzigem Tone gegebene Antwort. "Guati hat sie mitgenommen, weil sie schöner ist als der Morgenstern, sie wird Guatis Weib." Alonzo kannte die Stimme wieder, es war die seines einstigen Gefährten. "Mit dem Weißen tue was du willst, verkaufe ihn oder opfere ihn den Göttern -, das Mädchen ist meine Beute und bleibt mein."
"Die Unsichtbaren zürnen den Kindern der Aimaràs, sie haben ihnen die Opfer entrissen vor fünf Sommern und keine mehr in ihre Hand gegeben seit jenem schwarzen Tage -, sie wollen keine Opfer mehr. Mehr aber werden sie noch zürnen, wenn der Sohn Tucumaxtlis ein Weib aus dem verfluchten Geschlechte der Weißen nimmt."
"Warum sollten sie zürnen? Sie haben die Weißen dem Opfermesser entrissen und die Augen der Aimaràs mit Blindheit geschlagen. Sie waren den Weißen hold. Die Blüte des Tales wird Guatis Weib. Guati hat gesprochen."
"Du hast Techpo in der Stadt der Weißen gesehen, er wird kommen und die weiße Blüte holen."
"Ich glaube nicht mehr, daß er es war; Techpo ist vom Erdgeist verschlungen, der Weiße sah ihm ähnlich. Laß ihn kommen, wir werden ihn empfangen."
"Du hast unrecht und übereilt gehandelt mit dem Mädchen, sie bringt alle Weißen gegen uns in Grimm."
"Was wollen sie? Ihre Gebeine in den Felsen lassen?"
"Die Götter zürnen uns, Guati -, errege ihren Grimm nicht noch mehr."
"Wo ist der Jüngling?" fragte der Kazike nach einiger Zeit. "Ist er bei den Priestern?"
"Nein, er schläft in der Hütte Huaxtlas, die Priester fürchten, ihn dem Tempel anzuvertrauen, seit der Weiße und der Halbindianer mit Hilfe der Götter entflohen."
"Wir reden morgen weiter, Guati," sagte der Kazike, "die Götter werden gute Träume senden."
Ein Geräusch deutete an, daß einer der Männer den Raum verließ, der rasche Schritt ließ auf Guati schließen.
Wo war Elvira? War sie nicht im Hause des Kaziken?
Alonzo umschlich das Haus und lauschte. Kein Laut drang von innen nach außen.
Das Haus hatte noch einen oberen Raum, der mehrere Gemächer unter dem Dach von Maisstroh enthielt. Alonzo wußte dies wohl. In einem schien Licht zu brennen. Eine Fichte stand unweit und Alonzo kletterte zwischen ihren Ästen empor. Das Gemach unter dem Dache war erleuchtet, aber das Fenster verhangen. Vergebens spähte, vergebens lauschte er. Schon wollte er mißmutig wieder herabsteigen, als der Vorhang gelüftet wurde und Alonzo in die Kammer sehen konnte. Ein altes Indianerweib blickte einen Augenblick aus der Fensteröffnung und ließ den Vorhang dann wieder fallen, aber Alonzos Auge hatte ein weißes Kleid erkannt, das eine auf einem Lager ausgestreckte Gestalt einhüllte - Elvira war da.
Er ahmte den Ruf der Bergeule mit täuschender Treue nach, der die Indianer stets mit abergläubischer Scheu erfüllte und diese jetzt dem Garten, selbst den nach diesem hin führenden Fensteröffnungen fern halten würde, und stieg nach einiger Zeit wieder hinab.
Er überzeugte sich, daß das Maultier noch am Platze war und harrte geduldig, bis die Lichter in den Häusern erloschen und die Bewohner zur Ruhe gegangen waren. Er sann und sann, wie er sich Elvira nähern könne, wie er sie unverdächtig aus dem Hause des Kaziken entführe.
In das Haus, selbst in das obere Stockwerk zu gelangen, war möglich -, aber Alonzo fürchtete das Geschrei des alten Weibes, das sicher der Gefangenen als Wächterin beigegeben war, und alles ringsum wecken würde.
Auch Eugenios gedachte er - auch ihn wollte er befreien, sobald Elvira in Sicherheit war.
Er sann und sann und die Nacht rückte vor, er sah es an den Sternen.
Da kam ihm ein Gedanke, der alle Männer aus den Häusern locken würde. Das Tempelhorn mußte sich hören lassen.
Flink schlich er zwischen den Hecken und Zäunen einher, jedes Anrufs gewärtig, und bald lag schattenhaft der in Pyramidenform aufsteigende Tempel vor ihm. Er wußte, wo das Horn hing, und war gleich darauf auf der Terrasse. Er tastete in der Nische -, das Horn war an seiner Stelle. Einen Augenblick zauderte er, denn leicht konnte die Erweckung der Aimaràs ihm das Leben kosten, ohne der Gefangenen Befreiung zu bringen. Aber er sah kein anderes Mittel, die Männer aus des Kaziken Hause zu locken.
Er setzte das gewaltige Horn an, blies mit aller Kraft seiner Lungen hinein und der dumpfe markerschütternde Ton hallte durch die Nacht und weckte das Echo der Schluchten.
Noch einmal dröhnte das Horn in langem, mächtigem Tone. Dann ließ Alonzo es fallen und glitt von der Terrasse herab, mit drei gewaltigen Sprüngen einen Eibenbusch erreichend, an dem er zur Erde sank.
Schon wurde es lebendig in den Häusern, Lichter erschienen, Stimmen wurden laut -, Alonzo wußte, alle würden nach dem Tempel eilen, um dort zu vernehmen, von wo Gefahr drohe. Außer sich, am meisten überrascht eilten die Priester aus ihren nahegelegenen Häusern herbei. Wer konnte es wagen, das Horn des Unheils zu berühren?
Einem Schatten gleich glitt Alonzo durch die Nacht, sich niederwerfend, wenn Männer nahten. Er erkannte Tucumaxtlis Stimme, der eilig von seinem Hause herkam, er vernahm die Stimme Guatis, der sich zu dem Kaziken gesellte.
Alonzo nahte sich dem Hause des Kaziken, nachdem er sich vorher überzeugt, daß das Maultier noch an seinem Platze sei, und ging keck zum Haupteingang hinein, die Treppe hinauf, er wußte wo das Gemach lag, in dem er Elvira gesehen. Es war Licht darin, er erkannte es durch den dichten Vorhang. Er lauschte, lüftete vorsichtig den Teppich. Da lag bleich und matt Elvira -, das alte Weib lauschte am Fenster hinaus. Mit raschem Schritt trat Alonzo ein, die blinkende Machete in der Hand.
Elvira sprang erschreckt empor, das Weib wandte sich -, vor ihnen stand ein hoher Aimaràkrieger, dessen Augen heller blitzten als die Waffe.
Einen kurzen Moment standen beide Frauen starr -, dann rief Elvira: "Alonzo!" - und das alte Weib flüsterte entsetzt: "Techpo."
Alonzo kannte die ganze Gefahr, die ein Hilferuf des Weibes mit sich führen würde, er trat mit finsterem Gesichte auf sie zu.
"Nieder, Catha -, der Gott des Windes sendet mich."
Nieder sank das Weib, zitternd.
Mit zauberhafter Schnelligkeit umschnürte Alonzo sie mit seinem Lasso, zwang ihr einen Lappen, den er Elviras Lager entriß, in den Mund und sagte zu Elvira, die stumm vor Überraschung dem eilig sich abspielenden Vorgang zusah, "komm!"
Er bot ihr die Hand, führte sie zur Tür, riß dort den Vorhang ab, wickelte ihn um ihre zarte Gestalt und leitete sie dann hinab. Niemand begegnete ihnen.
Draußen nahm er das schwache Mädchen auf den Arm und trug es zu dem Maultier, setzte es auf dessen Rücken und schwang sich hinter Elvira auf, das Tier mit freundlichen Worten in der Aimaràsprache ermunternd.
Vom Tempel her ertönten Stimmen.
Einen kurzen Augenblick hatte Alonzo gezweifelt, ob er den Weg zu dem nördlichen Ausgang des Dorfes nehmen sollte, aber der Weg über die Felsen war für das zarte Mädchen unmöglich, so war er entschlossen, den Weg nach dem Wächterhaus im Westen zu nehmen -, auf jede Gefahr hin. Blut mußte dort fließen, und er war entschlossen, es zu vergießen, wenn es nötig war. Niemand begegnete ihm und er ließ das starke Tier laufen.
"Alonzo!" flüsterte es vor ihm, halb ängstlich, halb freudig.
"Sei ruhig, Schwester, ich rette dich."
Und sie festhaltend stürmte er durch die Nacht den ihm wohlbekannten Weg entlang. Endlich hielt er, hob Elvira herab, band das Tier fest, nahm sie auf den Arm, trug sie durch die dunkle Schlucht sicher über Felsgeröll hin, in die Höhle, die er einst mit Fernando und dem Mestizen betrat und flüsterte ihr zu: "Harre hier, Schwester, hier bist du ganz sicher, harre, bis ich dich hole."
"O Alonzo, Bruder -, o komme bald, ich vergehe vor Angst."
"Bete, ich komme wieder." Fort eilte er. Keine Zeit war zu verlieren, denn die schützende Nacht nahte ihrem Ende.
In den Hohlweg tretend, sah er eine dunkle Gestalt neben seinem Maultier stehen.
"Wer bist du? Was tust du hier?" fragte eine rauhe Stimme in der Aimaràsprache.
Einen Augenblick erschrak Alonzo, aber dann fuhr im Zorn der Verzweiflung geschwungen blitzschnell seine Machete in des Mannes Brust. Lautlos sank dieser nieder. Alonzo schwang sich auf und ritt in voller Eile weiter. Es nahte das Wächterhaus. Er wußte, drei Männer wurden in Zeiten, wo es notwendig war, dorthin gestellt -, also zwei hatte er noch zu bewältigen, ehe der Eingang für die Freunde frei war. Er hoffte zwar, daß der Mestize Antonio, der den Weg kannte, die Dunkelheit benutzt haben würde, um weiter vorzudringen, aber er hatte keine Gewißheit. Er fürchtete auch das Zusammentreffen mit den Aimaràs nicht, aber es ging ihm gegen die Natur, unvorbereitete Feinde zu überfallen. Dennoch mußte es sein, das Leben Elviras stand auf dem Spiele. Da war das ruinenhafte Wächterhaus, es zeichnete sich bereits gegen den Morgenhimmel ab.
In vollem Laufe seines Tieres jagte er nach Botenart heran. Auf die Felsplatte traten zwei Männer, schattenhaft nur wahrzunehmen.
"Ho - ah?" schallte es ihm entgegen.
"Ein Bote des Kaziken."
Alonzo sprang ab und eilte hinauf zu dem Wächterhaus.
Ein älterer, grimmig aussehender Mann trat ihm entgegen, dessen Antlitz ihm von dem Schreckenstage im Tale der drei Quellen im Gedächtnis geblieben war, es war einer der Mörder der Seinen. Das Blut stieg ihm zu Kopf, jetzt stand er nahe vor dem Wilden -, dieser starrte in sein Gesicht und stieß einen Laut der Überraschung aus, er sah in das Gesicht Techpos, des so geheimnisvoll Verschwundenen. Mitleidslos fuhr dessen Machete empor, schwer getroffen stürzte der Mann zu Boden. Der andere stand wie versteinert. Doch als jetzt Alonzo eine Bewegung auf ihn zu machte, riß er die Büchse empor, Alonzo schlug sie zur Seite, aber in den Felsen widerhallend entlud sich der Schuß. Fernes Rufen antwortete dem Echo.
Alonzo stieß einen gellenden Schrei aus und warf sich so plötzlich auf den überraschten und wehrlosen Wilden, einen noch jungen Mann, daß dieser am Boden lag, ehe er wußte, wie ihm geschah.
"Rühre dich nicht," sagte Alonzo, "oder meine Machete fährt durch deine Kehle."
Der Indianer war still.
Draußen hörte man eilenden Huf der Mulos den Weg entlang kommen und gleich darauf standen Geronimo, Antonio und andere der Montaneros neben Alonzo.
"Dem Burschen eine Kugel durch die Schläfe," sagte der alte Jäger.
"Nein, binden, er ist mein Gefangener," erwiderte Alonzo gebieterisch.
Und allsobald wurde der Aimarà gebunden.
Von neuem ließ Hufschlag sich vernehmen. Diesmal aber kam er vom Dorfe her.
"Deckt euch und feuert, wenn sie erscheinen."
Schon war die Morgendämmerung angebrochen und man sah deutlich Reiter herannahen, denen das dunkle Haar wild um den Kopf flatterte.
Auf hundert Schritte ließ man sie herankommen.
"Feuer!"
Zehn Gewehre entluden sich, gellende Schmerzenslaute hallten in dem Hohlweg wider und wild wälzten sich Tier und Menschen durcheinander.
"Feuer!"

Die Büchsen der Montaneros entluden sich.
Noch einmal krachten die Büchsen, aber schon hatten sich die überraschten Aimaràs zur Flucht gewandt und nur noch fernher vernahm man den Hufschlag ihrer Tiere.
Die Montaneros jubelten Alonzo zu. Antonio drückte ihm die Hand und sagte leise: "Das war die verhängnisvolle Stelle hier."
Alonzo berichtete, daß Donna Elvira in Sicherheit sei, daß aber Sennorito de Vallas noch auf Rettung harre.
"Du kennst diesen Schlupfwinkel der Bandidos, Don Alonzo, was rätst du zu tun?"
"Wir können nicht gehen, ohne einen Versuch zu machen, den jungen Mann zu retten."
"Nein, nein, gewiß nicht!" riefen alle.
"So denke ich, rücken wir vor. Sind wir am Dorfe, werden unsere Freunde vom Norden her angreifen und bringen die Räuber zwischen zwei Feuer."
"Gesprochen wie ein großer Capitano, so sei es," sagte Geronimo.
Alonzo hielt es für nötig, daß drei der Büchsenschützen auf alle Fälle zurückblieben in dem Wächterhause. Auch dies wurde beschlossen und drei der älteren Leute dazu bestimmt. Die anderen zogen weiter die Schlucht entlang dem Dorf zu, nachdem sie einige tote Maultiere und mehrere Leichen zur Seite geräumt hatten.
Alonzo ritt zuletzt. Er hatte einen der drei, die im Wächterhause zurückbleiben sollten, mitgenommen. Als die Stelle gekommen war, holte er Donna Elvira aus ihrem Versteck und übergab sie ihm. Sorgfältig gegen die Morgenkälte in die Decke gewickelt, ward sie auf ein Maultier gesetzt.
Mit Tränen des innigsten Dankes sagte sie zu dem Jüngling: "Kehre glücklich zurück, mein Bruder."
Vorsichtig geleitete der Bergbewohner das junge Mädchen zu dem Wächterhause, wo man, so gut es anging, für ihre Bequemlichkeit sorgte. Die Toten und den Gefangenen hatte man beiseite gebracht.
In rascher Gangart trabten die Montaneros, die Büchsen in den Händen, auf das Dorf zu, Alonzo an ihrer Spitze.
Als sie der Stelle nahten, wo der Hohlweg in das Tal auslief, ließ Alonzo halten. Er erkletterte links den Felsen und ließ einen der jungen Leute rechts des Weges emporsteigen.
Sie gewahrten keine Feinde, sahen nur Weiber und Kinder bei den Häusern, die angstvoll umherliefen, stiegen herab und ritten jetzt in das Tal.
Da knallten die Büchsen von Norden her.
Da man nur von Osten her einen Angriff erwarten konnte, hatte Tucumaxtli zwanzig Krieger zu dem Wächterhause geschickt.
Als diese dort so rauh empfangen, dezimiert, in Todesangst in das Tal zurückjagten und die Unheilsbotschaft verbreiteten, daß das Wächterhaus im Besitz zahlreicher Weißer sei, verbreitete sich wilde Panik und alles strömte dem Ausgang nach Norden zu. Erst jetzt erfuhr Guati, als er nach des Kaziken Hause eilte, um Elvira zu holen, durch die gebundene Alte von der Anwesenheit Techpos.
Doch schon kamen auch die Aimaràs vom Nordeingang zurück; die Büchsen der versteckt liegenden Montaneros hatten sie blutig hinweggescheucht und jetzt erschienen auch die Feinde aus der Schlucht von Osten her.
Die überraschten Wilden wandten sich jetzt dem Talausgang nach Westen zu.
Schon krachten auch die Büchsen der Begleiter Alonzos.
Doch nicht alle Aimaràs hatten den Kopf verloren. Die erfahrenen Krieger hatten bald erkannt, daß die Schar der Angreifer nicht groß sei, und so schickten sie sich an, während Weiber und Kinder in der Flucht Rettung suchten, Widerstand zu leisten, und bald blitzten hinter Hecken und Häuser hervor ihre Büchsen, so daß auch die Montaneros gezwungen waren, Deckung zu suchen.
Nur Alonzo hielt in stolzer Haltung auf seinem Maultiere da, ein Bild trotzigen, verderbenbringenden Kriegsmutes, und schaute mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von Grimm, Stolz und Verachtung auf die Stätte, wo er so lange im tiefsten Elend unter den Mördern der Seinen geweilt hatte.
Der Tag der Vergeltung war gekommen, als Sieger war er eingezogen in das Tal, das ihn als Sklaven gesehen hatte.
Furchtlos bot er dem Feinde die Stirn.
Mit Bewunderung sahen die Montaneros zu ihm auf und scheu erblickten die Aimaràs den jungen Krieger in indianischer Tracht vor sich.
Weithinhallend aber rief Alonzo in der Sprache der Aimaràs: "Hört es, ihr Mörder aus dem Tale der drei Quellen, Techpo ist zurückgekommen, um euch zu vertilgen und eure Leiber den Geiern zur Speise zu geben."
Einen Augenblick herrschte Stille bei den Wilden, dann aber erhob sich wütendes Geheul, Büchsen krachten und Kugeln flogen um Alonzo her.
Drohend hob dieser die Rechte, riß die Waffe an die Wange, schoß und ein Todesschrei antwortete dem Schusse. Dann sprang er ab, sich den zu Fuße kämpfenden Montaneros zu gesellen.
Die Aimaràs, die entschieden stärker an Zahl waren, wehrten sich nachdrücklich und zwei der jungen Bergbewohner waren schon verwundet.
Die Flucht der Frauen und Kinder in die Felsen dauerte fort.
Wo Alonzos Büchse aufblitzte, verbreitete sie Verderben, er sah finster aus wie der Engel des Todes.
Da kamen die nächsten jungen Leute zu ihm und boten ihm ihre Gewehre dar: "Schieß du, Don Alonzo, wir wollen laden."
Und nun brach hinter dem Felsen, der sie deckte, ein Feuer hervor, das Entsetzen in den Reihen der Aimaràs verbreitete - jede Kugel traf.
Die Weiber, Kinder, die Alten waren verschwunden.
Unerwartet sprangen die Aimaràs auf, sich durch Büsche, Hecken und ihre Maultiere und Pferde so gut als möglich deckend, und eilten, den Kampf aufgebend, dem westlichen Talausgang zu.
Ein allgemeiner Schrei des Entsetzens ward bei den Montaneros laut; auf einem der fortgezerrten Maultiere saß, allen sichtbar, der gebundene Don Eugenio.
Ein jäher Schmerz zuckte durch Alonzos Herz, er hatte in der Aufregung des Kampfes des Jünglings ganz vergessen.
Einen Augenblick zögerte er, denn der Gedanke fuhr ihm durch sein Hirn: das ist der Sohn des Mannes, der Verderben über die Deinen gebracht hat -, aber siegend gewann das edlere Gefühl die Oberhand.
"Vorwärts! Rettet Don Eugenio!"
Und die Büchse schwingend sprang er, keine Gefahr achtend, vor.
Er wußte wohl, gewannen die Aimaràs die Felsen, war eine Verfolgung, war eine Rettung des Jünglings unmöglich -, der Eingang in die Schlucht war leicht zu verteidigen. Mit Sturmeseile lief er vor.
Die tapferen Jünglinge folgten ihm.
Auch die Abteilung, die im Norden focht, drängte vor.
Aber die Indianer bewegten sich auch in großer Eile dem Felsentor zu, das ihnen Rettung bot.
Es war eine Szene der wildesten Aufregung. Sichtbar war fast allein Don Eugenios Gestalt.
"Feuer! Feuer, auf die Maultiere!"
Die Montaneros gehorchten, ihre Kugeln schlugen in den Haufen der geängstigten Tiere, Verwirrung entstand dort, einige Aimaràs liefen den Felsen zu.
Schon war der atemlose Alonzo nahe, als er sah, wie sich eine Schulter und ein Arm, dessen Hand eine im Sonnenstrahl blinkende Machete hielt, über Eugenio erhob. Alonzo stand, schoß -, der Arm sank. Fort eilten die Wilden -, das Maultier, das Don Eugenio trug, sank zusammen.
Die erbitterten Montaneros drangen vor.
Schon war Alonzo dem halb unter dem Maultier liegenden Eugenio nahe, als er sah, wie Guati mit einem Blicke grimmigsten Hasses seine Büchse nach ihm abfeuerte; die Kugel verfehlte ihr Ziel, worauf Guati, die Machete ziehend, auf Eugenio losstürzte.
Aber schon war Alonzo da, ein Stoß seiner Büchse ließ Guati zurücktaumeln und gleich darauf umklammerten ihn die eisernen Arme des Jünglings.
Aber der junge Wilde war stark, gewandt und kämpfte um sein Leben.
Mit gewaltiger Kraft rangen die beiden Gegner am Boden - aber Alonzo war der Stärkere -, er riß plötzlich seinen rechten Arm aus der Umschlingung des unter ihm liegenden Gegners los und versetzte ihm so rasch und wuchtig einen Faustschlag zwischen die Augen, daß er betäubt wurde.
Alonzo hielt die erbitterten Montaneros zurück, als sie Guati töten wollten, und befahl, ihn zu binden. Und so groß war der Respekt, den Alonzo seinen Gefährten einflößte, daß sie selbst in diesem Augenblicke höchster Erregung ihm gehorchten.
Gleich darauf lag Guati in unzerreißbaren Banden fest.
Hochaufgerichtet, einen Zug stolzen Triumphes im Antlitz stand Alonzo da, das Schlachtfeld überschauend. Die Aimaràs, der Schrecken seines jungen Lebens, lagen zu seinen Füßen -, vollständig war die vollzogene Strafe an den Mördern im Tale der drei Quellen.
Leider hatten auch zwei der jungen Leute das Leben eingebüßt und viele der Montaneros waren verwundet.
Unverletzt, aber totenbleich und zitternd, stand Don Eugenio da, er hatte das Grauen der letzten Stunde noch nicht überwunden, aber sein Blick ruhte mit dem Ausdrucke von Liebe und Dankbarkeit auf Alonzo.
Mit stolzer Freude kam Antonio, der Mestize, heran, der wie ein Löwe gekämpft hatte.
"Das ist der Tag der Wiedervergeltung, Don Alonzo, sie haben die Qualen gebüßt, die sie dich und mich einst ausstehen ließen, sie sind gezüchtigt, die Mörder, für alle Zeit."
An eine Gartenwand gelehnt, saß finsteren, aber ruhigen Angesichts Tucumaxtli, der Kazike.
Alonzos Schuß hatte ihm die Schulter zerschmettert, als er die Machete erhob, um Eugenio zu töten, eine Kugel, die ihn in den Rücken traf, ihm eine tödliche Wunde zugefügt.
Zu ihm wandte sich jetzt Alonzo, um den sich alle seine Waffengefährten gesammelt hatten.
"Du kennst mich, Kazike?" fragte er ihn.
"Ja, und ich wollte, ich hätte dich getötet wie die anderen, Natter."
"Du siehst, Tucumaxtli, dort liegt Guati am Boden, dein Sohn. Du wirst bald vor dem höchsten Richter stehen, aber er kann noch leben, wenn du hier vor den Weißen sagst, wie du mich einst in deine Gewalt gebracht hast."
"Tucumaxtli hat nichts zu sagen."
"So wird Guati an seinem Halse aufgehängt werden an einem Baum, bis ihn die Geier verzehren."
Der sterbende Kazike zitterte. Nichts ist dem Indianer grauenvoller, als ein Tod durch Erhängen.
"Wird Guati leben?"
"Ja, wenn er bei seinen Göttern schwört, nie wieder den Arm gegen einen Weißen zu erheben."
"Er wird es tun, und ich will reden."
Alonzo bat die Umstehenden, den Worten des alten Kaziken zu lauschen, hinzufügend: "Euch allen, ihr Freunde, wird mein Vertrautsein mit der Örtlichkeit hier verwunderlich erschienen sein. Nun, ich habe fünf Jahre als Gefangener dieser Wilden hier zugebracht, bis ich mit Don Antonio vor fünf Jahren diesem Tale entfloh."
"Bis der heldenhafte Knabe mich vor einem grauenvollen Tode hier rettete; Don Alonzo danke ich es, wenn ich heute noch lebe," versetzte der Mestize feurig.
Mit matter Stimme sagte der Kazike in spanischer Sprache allgemein verständlich: "Tucumaxtli geht zu seinen Vätern und es ist gut so, Guati soll noch leben. Es sind zehn Sommer, da bewog mich Gomez, der Goldsucher und Jäger, einen großen spanischen Caudillo gefangen zu nehmen und in die Berge zu schleppen, und gab mir Gold dafür. Meine Krieger witterten Blut und erschlugen die Weißen bis auf den da," er deutete auf Alonzo, "den schleppte ich mit mir in die Berge, damit seine Feinde mir viel Geld gäben, wenn er erwachsen und ihnen gefährlich geworden sei als Sohn des großen Caudillo. Einen Panther führte ich mit mir, der mich, groß geworden, zerriß, mich und die Meinen. Vor fünf Jahren entfloh er, um heute zurückzukehren. Ich schwöre bei den Göttern der Aimaràs, ich habe die Wahrheit gesagt. - Ich habe gesprochen."
Alonzo erhob langsam das Haupt.
"Ich wünschte, ihr Freunde, daß ihr das vernehmet, was ihr eben hörtet. Bewahrt es in eurem Herzen, bis die Stunde kommt, wo ich euer Zeugnis brauche.
Alle gelobten es.
Tucumaxtli hauchte bald darauf seinen letzten Seufzer aus.
Nach so furchtbaren Anstrengungen bedurften die Montaneros der Ruhe. Sie fanden Nahrungsmittel, Futter für die Tiere, Wasser, und rüsteten sich, die Nacht in dem Aimaràdorfe zu bleiben. Auch Maultiere und Pferde fingen sie noch genug ein, um die Schar derer, die über die Felsen geklettert waren, beritten zu machen. Die Verwundeten, deren Verletzungen meistens leicht waren, wurden gepflegt und die beiden Toten unter einer Fichte begraben.
Hiernach entfernte sich Alonzo, um seiner inneren Erregung Herr zu werden.
Erst nach längerer Zeit kam er zu den schmausenden, siegesfreudigen Gefährten zurück, sah nach den Verwundeten und nach Eugenio, der sich von der überstandenen Todesangst erholt hatte, lehnte seinen Dank ernst-freundlich ab und sagte, daß er zu seiner Schwester reiten wolle, um sie zu trösten und zu beruhigen.
Für den nächsten Morgen wurde der Rückmarsch bestimmt.
Alonzo hatte Elvira nach der überstandenen Angst gefaßt, fast freudig wiedergefunden.
Er ließ dann den immer noch gebundenen Junma befreien und hieß ihn in die Berge zu gehen. Auch warf er die Indianertracht ab und zog seine Kleider wieder an. Er sorgte für Elviras ungestörte Nachtruhe und suchte selbst nach unerhörten Anstrengungen den Schlaf.
Als er mit Sonnenaufgang erwachte, machte er sich alsbald nach dem Dorfe auf den Weg. Er fand Tempel und Häuser in Flammen. Die erbitterten Montaneros wollten dieses Raubnest für immer zerstören.
Nachdem er eine sanfte Mula für Elvira ausgesucht und ihr eine Art Damensattel hergestellt hatte, ließ er Guati vor sich führen, ihn in der Weise seines Volkes schwören, Frieden mit den Weißen zu halten, und gab ihn dann frei.
Mit den Gefährten machte Alonzo sich dann auf, von der Grenze des Tales noch einen Blick auf die in Flammen gehüllte Stätte, wo er so traurige Tage verlebt hatte, werfend. Er holte dann Elvira und setzte sie, wohl in den Teppich eingewickelt, auf die Mula, worauf der Heimweg nach den Llanos angetreten wurde. Einen Boten, der Sennor Vivanda die Rettung seines Kindes melden sollte, hatte Alonzo vorausgesandt. Langsamer, der Verwundeten und Elviras wegen, bewegte sich der Zug nach.
Am dritten Tage trafen sie auf eine starke Schar der Bergbewohner, die ihnen zu Hilfe ziehen wollte. Mit Jubel nahmen diese die Nachricht von dem bestandenen Kampf und errungenen Sieg auf.

Auf dem Rückweg von den Llanos.
Bald trafen sie auf Sennor Vivanda, um den sich zahlreiche Llaneros gesammelt hatten, und Alonzo legte Elvira in des gerührten Vaters Arme.
Nicht minder erfreut war der Professor Pinola, als er seinen Pflegbefohlenen wieder hatte.
Der Ruf von Alonzos Taten verbreitete sich rasch unter den Llaneros und überall brachte man ihm aufrichtige Bewunderung entgegen.
Sennor Vivanda belohnte die Montaneros mit fürstlicher Freigebigkeit und versprach, für die Toten Messen lesen zu lassen.
Antonio de Minas, der Mestize, war von Alonzo, dem er das Leben dankte, entzückt und hing an ihm mit großer Dankbarkeit.
Der kluge Halbindianer hatte wohl erkannt, daß Alonzos Zukunft, dessen Eltern vor Jahren erschlagen worden waren, während er doch als der Sohn Vivandas galt, von Unheil bedroht sein mußte.
Als er sich von ihm verabschiedete, sagte er nur: "Braucht ihr mich einst, Don Alonzo, ruft mich und ich bin mit allem was ich bin und habe zur Stelle."
Ähnliche Versicherungen gaben ihm die anderen Bergbewohner, deren Herzen er für immer gewonnen hatte.
Als auch Eugenio tief betrübt von ihm Abschied nahm und herzinnig seinem Retter dankte, seinem Retter, den er so sehr liebte, sagte Alonzo mit tiefem Ernste: "Das war Menschenpflicht, Don Eugenio, aber sagt Eurem Vater, daß Alonzo d'Alcantara Euch gerettet hat, Alonzo d'Alcantara, der Sohn Don Pedros."
Mit zahlreichem Gefolge von allen Seiten begrüßt, betraten Vivanda und die Seinen die Llanos.
Alonzo war auch hier der Held des Tages.
Vierzehntes Kapitel.
Der Vater Don Eugenios
Sennor Carlos de Valla ging langsam, in tiefes Sinnen verloren, in seinem Arbeitszimmer auf und ab. Die düster zusammengezogenen Brauen deuteten an, daß seine Gedanken nicht freundlicher Natur waren.
Carlos de Valla, einer alten spanischen Familie entsprossen, hatte eine Laufbahn hinter sich, deren größerer Teil das Licht zu scheuen hatte.
Früh der Erbe eines großen Vermögens geworden, hatte er dieses in unerhörter Weise verschleudert und war zum Bettler geworden. Da begann die Erhebung der Kolonien im Norden Südamerikas gegen das Mutterland Spanien, und de Valla stellte sich auf die Seite der spanischen Unterdrücker und war bald als Offizier, bald als Führer einer unabhängigen Freischar tätig.
Als die Aufständischen Sieg auf Sieg errangen und Spanien Sterns in jenen Landen sank, sagte de Valla sich rechtzeitig von den spanischen Machthabern los und trat auf die Seite der sogenannten Patrioten. Der endlich folgende Friede ließ ihn tief bis in die Gesellschaft eines Tejada und seiner Genossen sinken, deren wenig ehrenvolles Dasein er teilte. Aber rüchsichtslos wie er war, jedes Mittel gut heißend, das er geeignet fand, seinem maßlosen Ehrgeiz förderlich zu sein, dabei begabt und von feinen Umgangsformen, gelang es ihm während des folgenden Bürgerkriegs, der nicht nur Verwirrung im gesamten staatlichen und bürgerlichen Leben, auch eine Korruption in moralischer Beziehung herbeiführte, eine immer glänzendere Rolle im öffentlichen Leben zu spielen und schließlich zu einer Machtstellung zu gelangen, die einen Mantel über sein dunkles Vorleben breitete.
So grimmig de Valla, der mit eiserner Hand im Sinne der Aristokratenpartei das Land beherrschte, von wirklichen Patrioten gehaßt wurde, eine Tatsache, die er gut genug kannte, so wagte man doch nicht, gegen ihn vorzugehen; er war gefürchtet und verstand mit Meisterhand das divide et impera anzuwenden und die Parteien gegeneinander auszuspielen. Das Ziel seines Ehrgeizes war, die höchste Würde des Staates zu gewinnen; der Präsident war alt und kränklich, und gelang es de Valla, seine Gegner in Schach zu halten, so war bei einer neuen Präsidentenwahl die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit gegeben, daß er dessen Nachfolger wurde.
Bot sich aber in dem Träger eines so hoch verehrten Namens wie der d'Alcantaras, seinen Gegnern ein gemeinsamer Mittelpunkt, so wurde ihre Feindschaft wirklich gefährlich für seine weiteren Pläne, abgesehen von den Beschuldigungen, die man gegen ihn schleudern konnte.
Tejada war ein zu jedem Verbrechen fähiger käuflicher Schurke und de Valla traute ihm nicht, mehr schon dem braunen Maxtla, den er als Indianer und ehemaligen Soldaten für Geld zu jedem Bubenstück fähig hielt. Er hatte den Mann auf den Gütern Don Pedros vorgefunden und bald ein brauchbares und gehorsames Werkzeug in ihm erkannt.
Der Name Alcantara, den Tejada in so beängstigender Weise vor de Valla auftauchen ließ, verursachte ihm peinliche Unruhe - besonders da der Bandit den Aufenthaltsort von dessen zeitigem Träger verschwieg. Daß der ihn selbst nicht kannte, ahnte de Valla nicht. Kurze Zeit nach Tejadas Erscheinen hatte er an einen seiner in den Llanos lebenden Vertrauten geschrieben und diesen zu Nachforschungen nach einem angeblichen Alcantara, der der Gefangenschaft der in den Bergen hausenden Indios bravos entgangen sein sollte, anzustellen.
Weder von diesem, noch von Tejada war Nachricht eingelaufen. Auch von Eugenio, seinem Sohne, vermißte er seit geraumer Zeit jede Botschaft.
Ein Klopfen des Kammerdieners unterbrach diese Gedankenreihe. Auf des Gebieters: Entra! trat der Mann ein und überreichte auf silbernem Teller ein Schreiben.
"Soeben von einem Espreso aus den Llanos gebracht."
Der Minister nahm das Schreiben und winkte dem Diener zu gehen.
Während er las, erschien auf dem eben noch freundlichen Gesicht ein Ausdruck rücksichtsloser Härte.
Das Schreiben lautete: "Euer Excellenza habe ich die Ehre auf das Gehorsamste mitzuteilen, daß jemand der den Namen d'Alcantara für sich in Anspruch nimmt oder sich gar auf eine Abstammung von Pedro d'Alcantara beruft, hier nicht existiert. Dieser Name würde in den weitesten Kreisen bekannt sein. Indessen ist es gelungen zu ermitteln, daß auf der Sennor Vivanda gehörenden Hacienda Otoño am Ocoa sich seit fünf Jahren ein junger Mensch befindet, der unter sehr eigenen Umständen dort aufgetaucht ist und bei seinem Erscheinen, wie ich vorsichtig von Leuten der Hacienda erkundet, mangelhaftes Spanisch neben einem indianischen Dialekte sprach. Vermittelt wurde die Bekanntschaft des Menschen mit den Vivandas durch einen gewissen Gomez, eine anrüchige Persönlichkeit, der seitdem verstorben ist. Der junge Mann führt indessen den Namen Alonzo Vivanda und gilt allgemein für einen entfernten Anverwandten des Hauses. Das ist alles, was ich zu ermitteln vermochte und mich beeile, Euer Excellenza auf das Ehrerbietigste mitzuteilen."
Das war der Inhalt des Schreibens seines Gewährsmannes.
"So," sagte de Valla mit einem grimmigen Lächeln, "also die Vivandas halten den jungen Panther in Gewahrsam, um ihn zu passender Zeit auf mich loszulassen? Gut, wenigstens weiß ich jetzt, wo der Feind im Hinterhalte liegt. Überfallen wollen wir uns nicht lassen. Sie waren mir nie gewogen, die Herren Vivanda, weder der Haciendero noch der Cura. Sie haben großen Einfluß dort auf die Llaneros und unter ihrem Schutze ist das Auftreten eines d'Alcantara wirklich gefährlich. Es kann nichts helfen, dieser junge Mensch muß unschädlich gemacht werden, ehe das Land sich zur Präsidentenwahl rüstet."
Er klingelte. Der Kammerdiener erschien.
"Ist Don Ignacio anwesend?"
"Ja, Excellenza."
"Schick ihn her."
"Das ist der rechte Mann," sagte de Valla vor sich hin.
Gleich darauf trat ein noch junger Mann ein mit nicht unschönen aber verlebten Gesichtszügen, dessen Haltung zeigte, daß er sich einmal in guter Gesellschaft bewegt haben mußte, wie auch seine Kleidung noch eine schäbige Eleganz zur Schau trug.
Der Minister maß ihn mit scharfem Blick und Don Ignacio senkte die Augen.
"Deine Verhältnisse sind etwas zerrüttet wie ich höre," sagte de Valla.
"Leider ist es so, Excellenza."
"Auch hat man allerlei Anklagen gegen dich erhoben."
"Es gibt Verleumder, deren böse Zunge nichts scheut, nicht einmal die höchsten Personen des Staates," entgegnete der Mann nicht ohne Frechheit.
Nach einer Weile fragte de Valla: "Ich habe einen Auftrag für dich, der dir tausend Pesos abwerfen und die gegen dich erhobenen Anklagen, von denen einige recht bedenklich sind, verstummen machen würde."
"Excellenza befehle."
"Es gehört eine feste Hand und ein entschlossener Sinn dazu."
"Excellenza weiß, daß ich beides besitze."
"Ja, ich weiß es, und darum habe ich dich ausersehen, dein späteres Geschick hängt von meinem Wohlwollen ab."
"Ich bin Euer Excellenza dienstwilliger Knecht."
"Es lebt da in den Llanos ein Mensch, der für unser Staatswesen sehr gefährlich werden kann."
"Euer Gnaden bezeichne ihn mir, ich bin ein guter Patriot und werde die Gefahr, die dem Lande droht, beseitigen."
Langsam sagte der Minister: "Du findest auf der Hacienda Otoño am Ocoa, die Sennor Vivanda zu eigen, einen jungen Mann, der sich Don Alonzo Vivanda nennt; von ihm droht dem Lande Unheil."
"Es ist mir Pflicht, dieses abzuwehren."
"Ich habe schon einen vertrauten Mann nach ihm ausgeschickt, doch konnte ich diesem damals nicht sagen, wo der gefährliche Mensch sich aufhielt und unter welchem Namen. Ich wußte wohl, daß er in den Llanos weilte, aber nicht mehr. Meines Abgesandten Schweigen läßt mich fürchten, daß er ihn vergebens sucht. Ich bin jetzt, wie du siehst, besser unterrichtet und deine Aufgabe ist leichter. Melde mir, daß die Gefahr für den Staat beseitigt ist und du erhältst tausend Pesos und darfst auf meinen ferneren Beistand zu deinem Emporkommen rechnen."
"Und wenn das Werk, während ich reite, um Euren Auftrag zu erfüllen, schon getan ist?"
"Gleichviel, bringe mir nur die absolute Gewißheit, daß die Regierung von diesem Menschen nichts mehr zu befürchten hat, und du erhältst die Belohnung."
"Ah, Excellenza sind immer ein vollendeter Caballero."
"Hier hast du Geld," er händigte ihm eine Summe ein, "brauchst du ein Pferd oder Mulo, laß es dir vom Majordomo geben, und vor allem laß mich bald günstige Nachrichten von dir erhalten."
"So rasch als meine Ergebenheit sie überbringen kann."
"Geh, mein Sohn."
Don Ignacio ging.
- - - - - - - - - - -
Am anderen Tage traf mit einem Boten, der mehrere Pferde zu Tode geritten hatte, ein Brief Professor Pinolas ein, worin dieser berichtet, daß Don Eugenio von den räuberischen Aimaràs gefangen und in die Berge geschleppt worden war.
Zum ersten Male in seinem Leben empfand der Mann, der rücksichtslos seinen Weg zur Höhe gesucht hatte, einen Schmerz, der sein Herz in jeder Faser erbeben machte. Wie sehr er den Jüngling liebte, fühlte er an der gewaltigen Erschütterung seines Innern, die selbst seine ehrgeizigen Träume verstummen machte. Eugenio in den Händen der Aimaràs, dieser fanatischen Feinde der Weißen? Das war der Tod seines Lieblings. Einem Wahnsinnigen gleich ging de Valla umher. Zugleich regte sich auf dem Grunde seiner verhärteten Seele etwas, das gewöhnliche Menschen Gewissen nennen. Den Aimaràs hatte er einst seinen gefährlichen politischen Gegner Pedro d'Alcantara überliefert, damit sie ihn in ihre unzugänglichen Berge schleppten, und unter den Messern dieser Bluthunde waren alle, auch unschuldige Kinder gefallen. Die Schuld war sein, so sehr er sich auch dagegen wehrte, sich das einzugestehen.
Er schauderte doch zusammen, wie er jetzt des gräßlichen Ereignisses gedachte, das oft genug seinen Schlaf unruhig gemacht hatte. Gab es doch etwas wie Vergeltung? Wurde er gestraft, wie er gesündigt hatte? - Sollte sein Kind - sein Eugenio, der einzige Mensch, den er liebte, als Sühnopfer für seine Blutschuld dargebracht werden?
Schaudernd erkannte er das Walten einer unerbittlichen Nemesis.
Sein Eugenio - sein sanfter Liebling - in der Hand dieser Unmenschen? Er litt ganz unerhört unter den Vorstellungen, die ihn folterten. Niemand erkannte den ruhigen entschlossenen Mann in ihm wieder.
Bote auf Bote flog auf eilenden Rossen nach dem Gebirge, unerhörtes Lösegeld wollte er zahlen - für seinen Eugenio - die Chibchas in den Bergen sollten gegen die Aimaràs aufgeboten werden - die Montaneros - nur mit Mühe ließ er sich zurückhalten, selbst aufzubrechen, um ihn zu befreien.
Ja, er war so gewaltig von Gemütsbewegungen aller Art durchschüttelt, daß er selbst des gefährlichen jungen Menschen vergaß, dessen Existenz ihn mit Gefahr bedrohte.
So vergingen dieser gemarterten Seele fünf grauenvolle Tage und schlaflose Nächte, die die Schatten der Ermordeten heimsuchten, die drohend ihn und das Bild seines Lieblings umschwebten.
Die Pein wurde dem gequälten Manne umso unerträglicher, als er sie verbergen mußte.
Da traf ein Correo ein mit Briefen an den Minister und dem fassungslosen Manne leuchteten - die Schriftzüge seines Eugenio entgegen.
de Valla sank tief erregt in fassungsloser Freude in einen Stuhl und es kostete Zeit, ehe er im stande war, zu lesen.
Und nun las er von dem schrecklichen Ende, das seinen Liebling in der Steppe bedroht hatte, vor dem ihm ein junger, dem Herzen des Jünglings unendlich sympathischer Mann bewahrte, er las, wie die räuberischen Indios Eugenio in die Berge geführt, wie derselbe junge Mann ihn mit Gefahr seines eigenen Lebens vor dem Mordstahl der Wilden gerettet, und daß dieser junge Mann, der zweimal das Leben Eugenios bewahrt hatte - Alonzo d'Alcantara, der Sohn Don Pedros war - derselbe Jüngling, nach dem er selbst, de Valla, die Mörder ausgeschickt hatte. Nichts hätte ihn mehr erschüttern können.
Lange dauerte es, bis de Valla das Gleichgewicht seiner Seele soweit wiedergefunden hatte, um seine Gedanken ordnen zu können.
Eugenio war gerettet - gleich einem sanften lindernden Balsam legte sich diese Kunde um seine Seele - gerettet - ja - aber was er seit langem nicht mehr kannte, die Qualen des wachgerüttelten Gewissens folterten ihn mit unerhörter Kraft - sein Liebling war gerettet von dem, den er kalten Blutes dem Tode durch Mörderhand geweiht hatte.
Selbst diese verhärtete Seele beugte sich schaudernd vor dem Walten der Macht, die der Menschen Geschicke leitet. Zum ersten Male fühlte sich der Mann besiegt, ratlos - verzweifelnd - niedergeschmettert durch eine Fügung, die da Segen brachte, wo schwerer Schuld die Strafe folgen mußte. Eugenio gerettet durch den Sohn Don Pedros? Immer und immer wieder wälzte er das Ungeheuere durch seine Seele und konnte es nicht fassen.
Und welche Bewunderung für seinen Retter atmeten die Zeilen Eugenios.
War er schon gefallen unter dem Mordstahl? Der Retter? de Valla besaß eine eiserne Kraft und er zwang sich jetzt, seine Gedanken logisch zu ordnen. Auch in des verderbtesten Menschen Seele ist immer noch ein tiefversteckter Winkel, wo das Gute wohnt, und wenn es sich auch nur durch bittere Reue geltend macht.
Alonzo durfte nicht sterben - jetzt nicht mehr. Brachte sein Dasein Gefahr für sein ehrgeiziges Streben, mochte es sein - gegen den Retter Eugenios konnte er die Hand nicht erheben.
Er befahl, die beiden zuverlässigsten Staatskuriere zu augenblicklichem Dienst herbeizurufen und setzte sich an den Schreibtisch.
de Valla schrieb mit zitternder Hand an Sennor Vivanda. Er schrieb ihm, wie er eben erfahren habe, daß ein Angehöriger seiner Familie seinem geliebten Sohne zweimal das Leben rettete und sprach seinen innigen Dank aus. Wie Eugenio ihm mitgeteilt hätte, nenne sich der Retter Alonzo d'Alcantara und gehöre vermutlich der Familie Pedro d'Alcantaras an. Sei dieses der Fall, so solle er ihm doppelt willkommen sein und könne in jedem Fall auf seine Dienste rechnen.
Als der Correo, ein klug und sehr energisch aussehender Mann vor ihm stand, sagte er: "Ich habe dir eine Frage vorzulegen; kennst du Don Ignacio Caldas?"
"Ja, Excellenza."
"Gut. Du bringst in höchster Eile diesen Brief an Sennor Vivanda auf Otoño am Ocoa."
"Es geschieht."

Der Correo mit der Botschaft des Ministers an Sennor Vivanda.
"Siehst du auf deinem Ritt oder in Otoño oder dessen Nähe Don Ignacio, so sagst du ihm, daß der Befehl, den ich ihm gegeben, aufgehoben sei und daß er zugleich zurückkehren möge. Verstehst du?"
"Zu Befehl."
"Kennst du meinen Peon Maxtla?"
"Ja, Excellenza."
"Siehst du diesen, so sagst du ihm, aber insgeheim und ohne ihn öffentlich als meinen Diener anzuerkennen, das gleiche."
Nach einigem Sinnen fuhr er fort: "Auf Otoño befindet sich ein junger Mann, Don Alonzo, dem ich sehr verpflichtet bin; diesem deute an und auch Sennor Vivanda, aber so, als ob es von dir ausginge, daß ihn Gefahr bedrohe, nahe Gefahr. Ich wünsche, daß der junge Mann allen Gefahren, die sein Leben bedrohen, entgehe, und ich werde dich doppelt belohnen, wenn du hierbei hilfst."
"Eure Excellenza darf sich auf mich verlassen."
"So reite."
Der Correo verbeugte sich und verließ das Zimmer.
Den zweiten der Staatsboten sandte er mit einem Schreiben an den Freund, der ihm Mitteilungen von Alonzo gemacht hatte, teilte diesem mit, daß er in Erfahrung gebracht habe, daß man dem Leben des jungen Mannes nachstelle und ersuchte ihn, alles aufzubieten, um ihn gegen solche Gefahr zu schützen. Auch dieser Correo bekam dieselben Aufträge für Don Ignacio und Maxtla wie der vorige, und ritt davon.
Drei Tage später traf Eugenio in Bogotá ein, mit einer Träne im Auge bewillkommnete ihn sein Vater. Dieses Auge hatte jahrelang keine Träne mehr geweint.
Fünfzehntes Kapitel.
Alonzo d'Alcantara
Mit großem Gefolge war Sennor Vivanda nach Otoño zurückgekehrt; denen, die ihm entgegengeritten waren, hatten sich mehrere angesehene Hacienderos aus den Bergen angeschlossen, unter ihnen der Mestize Antonio de Minas, dessen Vater ein wohlbegüterter und hochangesehener Mann war. Antonio hatte das Liceo in Bogotá besucht und stand bei Weißen wie bei Roten in großer Achtung.
Zahlreiche Llaneros gesellten sich auf dem Ritt von den Bergen zu dem Zuge, der die befreite Donna Elvira in ihre Heimat geleitete.
Mit Staunen vernahmen alle von dem verwegenen Ritt in die Anden hinauf, der Befreiung der Gefangenen, der Vernichtung der Aimaràs und den Heldentaten Don Alonzos. Antonio de Minas und die anderen Montaneros hielten mit ihrer Bewunderung nicht zurück.
Der Raub der Sennorita hatte ungeheures Aufsehen weit und breit erregt. Zwar war der Mord im Tale der drei Quellen nicht vergessen, aber nicht alle glaubten, daß er von Aimaràs verübt worden sei. Viele nahmen an, daß gemietete Bandidos den der republikanischen Partei gefährlichen Mann beseitigt hätten.
Hier aber war die unglaubliche Verwegenheit der Wilden aus dem Hochgebirge konstatiert, und man freute sich ihrer energischen Züchtigung, die nur mannhafte Montaneros vollziehen konnten. Daß Don Alonzo an deren Spitze gestanden, war verwundernswert genug.
Von Don Eugenio, der sich noch vor dem Aufbruch der Vivandas von diesen getrennt hatte, um nach Bogotá zurückzukehren, sprach man kaum.
Als der Zug sich Otoño näherte, strömte alles, was auf den Besitzungen der Vivandas lebte, der geliebten Herrin entgegen; die Vaqueros, die Feldarbeiter, Weiße, Rote, Schwarze. Der Jubel der Farbigen war grenzenlos.
Mit Tränen in den Augen schloß der greise Cura seine Nichte in die Arme und reichte dann die Hand Alonzo: "Dich hat Gott uns geschickt, Knabe, um Unheil von uns abzuwehren; er schütze auch dich in Gefahren, wie du diese hier."
Von allen Seiten strömten noch Nachbarn und Freunde herbei, um sich von dem Wohlbefinden der Sennorita zu überzeugen und ihr Glückwünsche darzubringen.
Otoño beherbergte Hunderte von Gästen und die Gastfreundschaft eines reichen Llaneros zeigte sich in ihrem vollsten Glanze.
Der Abend vereinigte alles, was das Haus an Gästen barg, in dem schönen kleinen Park der Hacienda, der mit bunten Laternen und leuchtenden Holzfackeln erhellt war.
Rings um den eingefriedigten Raum lagerten Hunderte von Indios, um sich des seltenen Schauspiels zu erfreuen.
Der Name Don Alonzo klang von Mund zu Mund, und immer erneut liefen die Erzählungen von seinen staunenswerten Taten, seiner Kraft, seiner Kühnheit durch die Menge. Schon improvisierten die jungen Llaneros Lieder zu seinem Lobe und sangen sie zur Gitarre.
"Ja," schrie der alte Cazador Geronimo, der von einem dichten Kreise von Männern umgeben war, die seiner Erzählung vom Kampf in den Hochtälern der Anden lauschten, "ja, Caballeros, ich lebe, jage, kämpfe seit vielen Jahren in den Bergen, ich habe gefochten in den Bürgerkriegen, doch einen solchen Bergkrieger, solch einen glorreichen Capitano wie Don Alonzo hat mein Auge noch nicht gesehen. Ohne ihn wäre alles vergeblich gewesen und unsere Leichen lägen jetzt vielleicht in den Abgründen der Felsen."
"Viva, Don Alonzo!"
"Viva, Don Alonzo!" hallte es donnernd durch den Park.
Alonzo, dem diese Huldigungen fast peinlich waren und der ihnen doch innerhalb der erregten Menge nicht entgehen konnte, nahm sie höflich und mit der echten Bescheidenheit hin, die den Mann ziert, der seines Wertes bewußt ist.
An einem Fenster der Veranda saß Donna Elvira, umgeben von einigen Damen der Nachbarschaft, und lauschte mit freudigem Lächeln den Kundgebungen, die ihrem heldenhaften Retter galten.
Auch sie vermochte den Freundinnen nicht genug von den Schrecknissen der Gefangenschaft, der Kühnheit Don Alonzos zu erzählen.
Doch während so in froher Feststimmung das Glück der Stunde und der Held des Kriegszuges in die unnahbaren Felsschluchten des Hochgebirges gefeiert wurden, hatte Sennor Vivanda eine längere Unterredung mit seinem Bruder, zu der bald einige erprobte Freunde des Hauses und auch Antonio de Minas hinzugezogen wurden. Es wurden hier in vertrautem Kreise ernste Dinge verhandelt.
Alonzo hatte in heroischem Stolze dem von ihm geretteten Don Eugenio de Valla seinen Namen genannt, für die Herren Vivandas fiel also die Rücksicht auf die Sicherheit des Jünglings durch Verschweigung seiner Abkunft fort; der, dem sie vor allem verborgen bleiben sollte, kannte sie nun. Manches vernahmen hier die ins Vertrauen gezogenen Freunde, das sie staunen und schaudern machte. Alle aber waren der Meinung, daß es geboten sei, jetzt das bisher gewahrte Geheimnis schwinden zu lassen, und vor einem großen, teilnahmsvollen Kreise den wahren Namen und die Abkunft Alonzos kund zu geben. So wurde die Existenz eines Sohnes und Erben Pedro d'Alcantaras gleich durchs weite Land bekannt.
Die Männer betraten den Park, und Sennor Vivanda, zu seiner Seite der ehrwürdige Cura, rief Alonzo zu sich, sagte ihm leise: "Die Stunde ist gekommen, Kind, wo die Leute dich kennen müssen," und bat dann die anwesenden Gäste eine Mitteilung von ihm entgegenzunehmen.
Der Ernst, mit dem dies geschah, versammelte sofort alle Anwesenden um ihn und begierig, mit aufmerksamem Schweigen, sahen die Anwesenden dem, was kommen würde, entgegen.
"Es ist niemand in diesem Kreise," begann Sennor Vivanda, "der nicht von dem grauenhaften Unglück gehört hätte, das vor zehn Jahren einen der besten Männer dieses Landes, Don Pedro d'Alcantara mit den Seinen traf."
Die tiefe Stille, die sich über den Kreis der Hörer bei diesen Worten verbreitete, der Ernst ihrer Mienen sprachen von der Teilnahme, die die Erinnerung an diese furchtbare Tat hervorrief.
"Wir alle im Lande," fuhr Vivanda fort, "glaubten damals, daß keiner der Alcantaras dem Mörderstahl entgangen sei, aber es war nicht so; der Erstgeborene Don Pedros war am Leben geblieben und in Gefangenschaft geschleppt worden."
Unter den Anwesenden erregte diese Mitteilung maßloses Erstaunen und Aufsehen.
Was war das: Ein Sohn Pedro d'Alcantaras lebte?
Ein dumpfes Summen der Erregung ging durch die Versammlung.
"Hier ist Don Antonio de Minas, der Sohn des Alkalden von Albumarge, er wird euch erzählen, wie er den Sohn Don Pedros fand."
Und nun begann der Mestize mit einer feurigen Beredsamkeit zu berichten, wie er von den Aimaràs gefangen, in ihre unzulänglichen Schluchten geschleppt worden sei, um dort nach dem alten Aberglauben dieser Wilden als Opfer für ihre Götzen - in schaudervoller Weise zu enden. Wie er in höchster Todesnot, er und Don Fernando, ein Caballero aus dem Norden, der gleichfalls in die Hände dieser Wilden gefallen war, durch einen von diesen gefangen gehaltenen weißen Knaben, der kaum noch des Spanischen mächtig war, mit einer unvergleichlichen Hingebung gerettet wurden, und, fuhr er fort, auf Alonzo deutend, dort steht der Knabe, der uns rettete, als Mann, der einzige von allen Weißen, der die Schlupfwinkel der Aimaràs und uns zur Befreiung Donna Elviras führen konnte, vor dem der sterbende Kazike der Aimaràs bei seinen Göttern, vor unseren Ohren, schwor, daß er ihn vor zehn Jahren aus dem Tale der drei Quellen davongeführt habe. Die leidenschaftliche Erregung der Hörer wurde immer größer bei des Mestizen Worten.
Und nun berichteten die Herren Vivanda, wie Alonzo zu ihnen gekommen, und daß schon vor fünf Jahren der sterbende Gomez Zeugnis für seine Identität abgelegt habe.
"Hatten wir Gründe," schloß Sennor Vivanda, "den Namen d'Alcantara zu verbergen, der in einer Zeit politischer Zerrissenheit und gefährlichen Parteigetriebes für seinen Träger hätte verhängnisvoll werden könne, so sind diese Gründe jetzt hinweggefallen. Hier steht Alonzo d'Alcantara, ihr Freunde, der dadurch, daß er mit eigener großer Lebensgefahr den Sohn des mächtigen Ministers dieses Staates vom Tode errettete, sich dessen Dankbarkeit und Freundschaft erworben hat."
"Was Minister? Was de Valla?" schrie einer der großen Nachbarn der Vivandas - "wir sehen nur den Sohn Don Pedros vor uns, den Gott so wunderbar erhalten hat. Heil, Alonzo d'Alcantara, Heil ihm für immer!"
Die "Vivas, Don Alonzo! Salve sea d'Alcantara!" mit aller Begeisterung der Südländer donnernd gerufen, wollten kein Ende nehmen.
Man drängte sich um Alonzo, umarmte ihn, drückte ihm die Hände, zeigte ihm auf alle Weise, wie sehr man ihn um seiner selbst und seines Vaters willen schätzte und liebte.
"Und," schrie ein sonngebräunter Llanero, "brauchst du Arme, Don Alonzo, um deine Rechte zu erlangen, so rufe nur, wir steigen in den Sattel und greifen zur langen Lanze."
"Und wir Montaneros," schrie ein junger Mann aus den Bergen, "greifen für dich zur Büchse; du bist ein Capitano, dem wir gerne folgen."
"Salve, Don Alonzo d'Alcantara!" Ein Gefühl stolzer Freude zog durch Alonzos Herz bei diesen feurigen, hingebenden Beteuerungen, und daneben stieg eine tiefe Wehmut empor mit der Erinnerung an den Vater, den alle so sehr schätzten und liebten, der ihm ein leuchtendes Vorbild durchs Leben war, und - so schrecklich enden mußte. Es kostete ihn Mühe, seine stürmischen Empfindungen zu verbergen, doch gelang es ihm, und er dankte für so viel Liebe in einer Weise, die allen wohlgefiel.
Elvira aber saß am Fenster und Tränen des Glücks rannen über ihre Wangen. Der Cura aber, der seinen Zögling kannte, flüsterte ihm zu: "Danke Gott für diese Stunde, Kind, und bändige den Dämon in deiner Brust."
Auch die Farbigen draußen, die Don Alonzo alle liebten, die wettergebräunten Vaqueros nahmen teil an der allgemeinen Freude und ihre "Vivas" klangen nicht minder herzlich als die der Sennores. Weit in die Nacht hinein, unter Liederklang und Saitenspiel, dauerte das seltene Fest - das dem Staate einen d'Alcantara wiedergab.
Sechzehntes Kapitel.
Die beiden Chibchas
Don Sancho Tejada war in Naëva zurückgeblieben, auch nachdem die Jahrmarktsgäste sich zerstreut hatten, was infolge der Unheilsbotschaft aus den Bergen rascher geschehen war, als es sonst der Fall gewesen sein würde. Dennoch waren immer noch eine Menge Gäste, vorzugsweise Farbige, in dem Städtchen anwesend, und selbst der Fluß zeigte zahlreiche fremde Fahrzeuge, die stromauf und stromab gekommen waren.
Don Sancho Tejada war trotz des behaglichen Daseins, das er in der Posada, die er zum Aufenthalt gewählt hatte, führte, sehr verdrießlich. Seine Hoffnung, hier etwas von dem jungen Alcantara zu erfahren, war gründlich getäuscht worden, niemand wußte etwas von ihm, niemand glaubte, daß ein Sohn Don Pedros noch am Leben sei.
Erfahren aber hatte er hier, daß der Name d'Alcantara überall Begeisterung erweckte und - daß Don Carlos de Valla gründlich gehaßt werde. Noch setzte er seine Hoffnung auf die Gegend am Ocoa, um dort die Spur des Jünglings zu finden. Wenn ihm dies nicht gelang, konnte er nur seinen Weg ins Ausland nehmen, denn de Valla würde ihm die Täuschung nie verziehen haben. Aber wohin? In Peru und Bolivia kannte man ihn; aus Peru war er eben entwichen, als er in Bogotá auftauchte. Er mußte dann schon seinen Weg nach Brasilien oder über das Meer nehmen, um dem Zorne des Ministers zu entgehen. "Der Junge lebt am Ende gar nicht mehr," sagte er vor sich hin, "und ich laufe einem Schatten nach. Meine fünftausend Pesos wären in diesem Falle verloren und meine Zukunft ist so gut wie zerstört. Carlos hätte mir am Ende doch noch ein Pöstchen im Staatsdienste gegeben."
Unweit von ihm saß still und mürrisch, wie immer, sein indianischer Peon. Der Mann war pünktlich in seinem Dienste, aber seine Kenntnis der spanischen Sprache war gering, und dann hatte er die Eigenschaft, stets im Freien zu schlafen, was bei einem Rinderhirten, der sein ganzes Leben im Freien zugebracht hatte, freilich nicht auffallen konnte.
Doch war Tejada das nicht angenehm, denn oft war der Mann nicht da, wenn er ihn rief. Daß der Indianer wenig Spanisch verstand, war ihm ganz recht, obgleich er von dem stumpfsinnigen Burschen wohl kaum zu fürchten hatte, daß er ihn belausche.
Während er noch saß und über die nächsten Schritte nachdachte, die er zu tun habe, um den übernommenen Auftrag auszuführen, nahte die Straße her ein Reiter auf einem erschöpften Maultiere. Kleidung und Sattelzeug ließen auf einen Mann von Stand schließen; das Gesicht beschattete der breite Hutrand.
Der Mann hielt, ohne von seinem Reittier abzusteigen, vor der Posada, auf deren Veranda Sancho Tejada saß.
"He, Posadero!"
Alsbald erschien auch der Wirt.
"Habt Ihr Unterkunft für Mann und Tier?"
"Sehr wohl, Sennor. Beliebe es Euer Gnaden nur abzusteigen."
"Gut. Doch vor allem sagt mir, ist Sennor Martinez noch hier?"
Es war der Name eines bekannten reichen Gutsbesitzers der Llanos, den der Fremde nannte.
"O, Euer Gnaden, die Caballeros haben alle Naëva verlassen, als die Unglücksbotschaft aus den Bergen eintraf, auch Sennor Martinez - -"
"So habe ich den beschwerlichen Weg umsonst gemacht und ich hoffte ihn so sicher hier zu treffen."
"So wißt ihr wohl nichts von dem Unglück, das -?"
"Erzählt mir das später. Schafft etwas zu essen und zu trinken. Wenn mein Peon kommt, meldet es mir; sein Tier lahmte und blieb zurück. Rasch etwas zu essen, ich komme um vor Hunger."
Er stieg ab und folgte dem Wirt auf dessen Einladung ins Haus, während ein Peon sein Tier nach den Stallungen führte.
Tejada hatte den Fremden gleichgültig betrachtet, er schien einer der Hacienderos des Landes zu sein. Maxtla aber erkannte beim ersten Blick in ihm den Mann, der, von dem Alguacil verfolgt, ihren Weg in die Berge gekreuzt hatte, er erkannte den Mann, so flüchtig er ihn gesehen, und das vortreffliche, aber, wie es schien, hart mitgenommene Tier.
Tejada irrte sich, wenn er glaubte, daß sein auf kurze Zeit angeworbener Peon das Spanische nur mangelhaft verstände; er verstand es sehr gut, wenn er es auch unbehilflich sprach. Dabei hatte der Mann ein ungemein feines Gehör und hatte jedes Wort von dem vernommen, was der Alguacil über den Verfolgten und die Räuberinsel in einem der großen Flüsse äußerte. Daß der im Freien schlafende Mann oftmals nächtlich umherschlich und die Fremden, die zu Pferde oder auf dem Flusse gekommen waren, sorgfältig beobachtete, wußte sein Herr nicht.
Die Nacht war herabgesunken, die Leuchtkäfer begannen zu schwirren und Fledermäuse schwebten durch die Luft.
Tejada, der an dem eben angekommenen Fremden einen Gesellschafter für den langen Abend zu finden hoffte, erhob sich.
"Morgen mit Tagesanbruch reiten wir," rief er seinem Peon zu.
"Sehr wohl, Sennor."
Damit trat Sancho in das Haus. Er begrüßte den Fremden, in dem er einen gut aussehenden Mann von vielleicht vierzig Jahren erblickte, dessen hageres Gesicht etwas Lauerndes hatte, und drückte den Wunsch aus, sich seiner Gesellschaft erfreuen zu dürfen. Der fremde Caballero lehnte dies indessen höflich ab mit dem Bemerken, er sei von einem sehr langen Ritt so ermüdet, daß er notwendig des Schlafes bedürfe und ließ sich gleich darauf vom Wirt in ein nach hinten gelegenes kleines Zimmer führen mit dem Befehl, ihn nicht früher zu stören, als bis sein Peon einträfe.
Tejada ließ sich grimmig nieder und versuchte sich mit einer Flasche Wein, wie er an den Abhängen der Kordilleren wächst, zu trösten, seinen Gedankengang von vorher weiterspinnend.

Maxtla an der Schenke.
Maxtla verharrte noch geraume Zeit in eherner Ruhe, dann stand er auf und ging langsam dem Flusse zu. Er erreichte, leise dahinschleichend und schattenhaft in der Dunkelheit nur wahrnehmbar, von niemand beachtet oder auch nur bemerkt, die Stelle, die Flößen und Fahrzeugen als Landungsplatz diente; hier hielt er an. In einer Einbuchtung lagen mehrere größere Kähne, wie sie die Landleute zur Befrachtung ihrer Bodenerzeugnisse benützen, dazwischen leichtere Boote und indianische Canoas. Trotz der Dunkelheit erkannte Maxtla, der diesen kleinen Hafen, wie alles ringsum scharf beobachtet hatte, sofort ein neu angekommenes größeres Boot, das dicht am Ufer lag und mit einem Halbverdeck versehen war. Das Boot war leicht vertaut und so gelegt, daß es mit leichter Mühe in den Strom zu bringen war.
Der Indianer schritt geräuschlos weiter, seine dunklen Augen auf alles richtend, was in seinen Gesichtskreis kam.
Am Ufer erhoben sich einige luftige, aus Bambusstauden und Palmenblättern hergestellte Tienden, in denen vorwiegend Farbige verkehrten; mäßig beleuchtet ließen ihre offenen Räume doch einen Überblick über die darin befindlichen Gäste gewinnen. Es waren Peons, Feldarbeiter, kleine Grundbesitzer, vorwiegend indianischen Stammes, die hier vereint waren, obgleich Mulatten und Vollblutneger nicht fehlten. Auch die Inhaber dieser Geschäfte, die halb Kaufläden und Warenniederlage, halb Schenke waren, entstammten den Eingeborenen.
Maxtla überschaute, langsam vorbeischlendernd, den Schenkraum und gewahrte eine von den anderen getrennt sitzende Gesellschaft von sechs Personen, von denen drei Indianer waren, zu deren Seite ein Neger und zwei Zambos saßen. Maxtla zweifelte keinen Augenblick, daß er die Bemannung des Bootes, das seine besondere Aufmerksamkeit erregt hatte, vor sich habe. Er trat bescheiden ein und ließ sich in der Nähe des Tisches, an dem die Gesellschaft Platz genommen, nieder, bestellte ein Glas Limonade und zündete sich eine Zigarrito an.
Verstohlen musterte er die nur in Hemd und Beinkleid gekleideten Gesellen, deren Häupter breitrandige Strohhüte bedeckten, besonders seine Stammesgenossen.
Da wenigstens zwanzig seinesgleichen in dem Raum umhersaßen, nahm man an dem Tische, den Maxtla im Auge hatte, keine Notiz von ihm.
Die Leute dort wechselten wenige Worte und in spanischer Sprache. Hie und da fiel aber auch von den Lippen der schweigsamen Indios ein Wort in der Chibchasprache.
Einer der drei Indianer, der schweigsamste von allen, weckte Maxtlas besondere Aufmerksamkeit; es war ein Mann mit ernsten, düsteren Zügen, der um den bloßen Hals eine dünne Schnur mit einem kleinen, kaum bemerkbaren Zierat daran trug.
Als er zufällig einmal nach der Seite blickte, wo Maxtla saß, nahm dieser nachlässig seinen Hut ab, als ob ihm zu warm sei und strich mit der rechten Hand sein Haar langsam von rechts nach links hinüber.
Erkennbar funkelte es in den Augen des fremden Indianers auf und nach einiger Zeit bewegten sich die Finger seiner linken Hand über seine linke Augenbraue, worauf Maxtla sein Haupt wieder bedeckte.
Diese Zeichen waren so unverdächtiger Natur, daß sie selbst Beobachtern nicht hätten auffallen können, aber niemand beachtete sie überhaupt.
Maxtla trank seine Limonade aus und ging langsam hinaus.
Nach einiger Zeit folgte ihm der andere und ging nach dem Flusse zu.
Forschend sah er sich um.
Ein eigenartiges Zischen lenkte seine Aufmerksamkeit auf ein Lorbeergebüsch und schattenhaft gewahrte er dort eine Gestalt.
Er ging darauf zu und sprach leise ein Wort; es war der Chibchasprache entnommen, doch einer älteren Form dieser heute noch weit verbreiteten Sprache eines ehemals mächtigen Volkes.
Ein anderes Wort aus demselben Sprachstamm kam ihm antwortend entgegen.
Er trat nun ganz nahe zu Maxtla und sagte: "Sind die Kinder der Felsen allein?"
"Sie sind allein, kein fremdes Ohr ist in der Nähe."
Darauf schüttelten sie sich die Hände.
"Ich erkannte dich als einen Sohn der heiligen Erde," sagte Maxtla, "ich bin der Sohn Jolols und im Schatten der Berge mit den Inschriften der Väter aufgewachsen."
"Ich bin Huatl, der Sohn Loxitls, vom Fuße des Berges des Erdgeistes."
"Wir sind Brüder, Sohn Loxitls, das reine Blut der Chibchas rollt in unseren Adern."
"Wir sind Brüder."
"Wie kommt der Sohn der Felsen in das Boot auf den Flüssen der Steppe?"
"Der Sohn Loxitls schlug einen großen Caudillo, der ihn beleidigt hatte, und mußte flüchtig werden, er fand Zuflucht auf den Flüssen. Wie kommt Maxtla hierher?"
"Ich lebe schon lange in den Städten der Llanos, fern den heiligen Felsen und habe gefochten in den Kriegen des Landes. Ich bin hier als Peon im Dienste eines Bandido, der sich für einen Caballero ausgibt. Er ist ausgesandt, das Leben eines jungen Weißen zu nehmen, doch ich halte schützend die Hand über ihn, denn sein Vater, ein großer Capitano, war mein Freund."
"Maxtla wird ihn schützen, die Kinder der Felsen sind dankbar."
"Was tut der Sohn Loxitls hier in der Stadt der Weißen, er sage es mir."
"Wir erwarten einen Mann, der uns hier treffen will und halten das Boot für ihn bereit, das im Flusse liegt."
"So gehörst du zu den Piratas des großen Stromes, Huatl?"
"Warum fragt Maxtla das?" äußerte der Gefragte überrascht.
"Ich hörte von den Piratas erzählen und von der Insel im Flusse, wo sie hausen, sah auch den Mann, den ihr erwartet, sah euer Boot zur schnellen Abfahrt bereit liegen; ich wußte, daß ihr ihn erwartet. Und warum ich frage? Siehe, Sohn Loxitls, ich muß den jungen Menschen schützen, ich liebe ihn wie meinen Sohn und darum muß ich alles wissen, was ihm Gefahr bringen könnte. Ich kann nicht überall sein; nicht alles hören, und weiß nicht, was mein Herr Böses sinnt; vielleicht ist er auch bekannt mit eurer Insel und den Piratas."
"Ich weiß von nichts, als daß wir einen Sennor hier erwarten sollen, der nur dann und wann auf der Insel erscheint und ein Caballero ist."
"Huatl wird mir sagen, wo seine Insel liegt."
Der andere zögerte mit der Antwort.
"Du sprichst zu deinen Bruder und nur zu ihm, ein Chibcha hat nur ein Wort."
"Im Meta liegt die Insel, die dritte ist es, stromab nach der Mündung des Icaho, dort wohnen die Piratas des Orinoco und fangen die Schiffe und Flöße, die mit dem Strom hinabfahren. Huatl sagt es nur seinem Bruder."
"Es ist gut, es bleibt verschlossen in meinem Herzen. Fühlt mein Bruder sich glücklich unter den Piratas?"
"Nein, der böse Geist hat mich zu ihnen getrieben. Aber ich fürchte, die Weißen töten mich, wenn ich ins Land komme."
"Sehnt Huatl sich nicht nach seinen Bergen?"
"O, Huatl träumt Tag und Nacht von den Bergen der Chibchas."
"Er wird sie wiedersehen. Maxtla hat große Freunde unter den Caudillos (Häuptlingen) der Weißen, er wird Huatl rufen, wenn es Zeit ist. Die Kinder der Berge müssen einander beistehen und Huatl soll die Berge wiedersehen, wo die Gebeine der Väter ruhen."
"Die Unsichtbaren mögen es geben."
"Huatl soll nicht bei den Piratas bleiben."
"Der Sohn Loxitls wird deines Rufes warten, Bruder, du gibst ihm das Leben wieder; in seinem Geiste war es Nacht, seit er von der Heimat getrennt ist."
Sie schüttelten sich die Hände und Huatl ging zu dem Boote hinab, zu dessen Mannschaft er gehörte.
Maxtla, der nur von einem Gedanken beherrscht wurde, den Sohn Don Pedros vor Gefahr zu schützen und der nicht wußte, was der schlaue Bandit, dem er folgte, vorhatte, ging nach der Stadt zurück; er hatte wenigstens etwas erfahren, das zu erfahren ihm wünschenswert war. Die Piratas und ihr Treiben waren ihm gleichgültig, er war in den grausamen Kriegen der Zeit abgehärtet.
Tejada schien zwar keine Ahnung davon zu haben, wer der gefeierte Don Alonzo Vivanda war, aber Maxtla wußte, daß der Mann klug war und sich auch verstellen konnte.
Das plötzliche Davoneilen Don Alonzos in die Berge konnte leicht nur eine Verzögerung in seinen verhängnisvollen Maßnahmen gegen den Jüngling bedeuten. War es ihm auch jetzt noch unbekannt, daß Alonzo Vivanda und Alonzo d'Alcantara eins seien, so konnte jeder Augenblick ihm diese Gewißheit geben. Und dann kannte er den furchtbaren Mann in Bogotá, dessen Rücksichtslosigkeit und Macht, und wußte, daß dieser nicht zögern würde, sie gegen jemand, der ihm im Wege stand, in vollem Umfange anzuwenden. Auch ihm konnte nicht lange verborgen bleiben, unter welchem Namen sich der Sohn Don Pedros verbarg. Am liebsten wäre Maxtla Alonzo in die Berge gefolgt, aber er wagte es nicht, Tejada zu verlassen, um nicht den seiner Wachsamkeit entschlüpfen zu lassen, von dem er die nächste Gefahr für Alonzo befürchtete. So klug der Indianer in seiner Art war und so sorgfältig er alles beachtete, was auf seinen Schützling Bezug haben konnte, so sehr er umherhorchte und umherspürte, so hatte er doch eine phantastische Vorstellung von der Klugheit der Weißen auf anderen Gebieten als dem, auf dem er zu Hause war. Eine seltsame Scheu hatte er vor den schriftlichen Mitteilungen der Spanier. Hätte er damit die Gefahr für Alonzo auf immer beseitigen können, würde er keinen Augenblick gezögert haben, die Waffe gegen Tejada zu erheben, mit dem er eine alte Rechnung auszugleichen hatte. Aber er sah in ihm zunächst nur den Mittelpunkt aller gegen Alonzo gerichteten Angriffe und heftete sich darum fest an seine Sohlen. Einstweilen war Alonzo in den Bergen und sicher vor seinen Feinden, und kam der zurück, so würde er ja sehen, was Tejada tat.
Ein Mann kam ihm eilig entgegen, in dem er trotz der Dunkelheit den von dem Alguacil Verfolgten erkannte.
Dieser sah ihn und fragte: "Wo liegt der Fluß, Indio?"
"Sennor gehe nur geradeaus und er wird ihn vor sich sehen."
Der Mann ging rasch weiter und Maxtla schlich ihm gebückt nach.
Er hörte, wie der Mann das Boot mit dem Halbverdeck anrief und einige Worte mit Huatl wechselte, die Maxtla indessen nicht verstehen konnte.
Darauf ging der Fremde, nachdem er durch die Anwesenheit des Bootes wohl beruhigt sein mochte, langsam zurück und auf die Tienda zu, in der Huatls Gefährten saßen.
Unbemerkt folgte ihm Maxtla wieder.
Der Fremde trat ein und ließ sich an dem Tische neben den Leuten des Bootes nieder. Er wurde augenscheinlich erkannt, denn der Zambo wechselte mehrere Zeichen mit ihm.
Doch der Fremde schien sich sicher zu fühlen und bestellte Limonade.
Zwei von den Leuten, die um den Zambo saßen, entfernten sich aber auf dessen Wink doch und gingen, wie Maxtla sah, nach dem Flusse.
Das plötzliche Eintreten eines Alguacils wirkte überraschend auf alle, selbst auf Maxtla, und tiefe Stille verbreitete sich in der Tienda. Maxtla erkannte in dem Ankömmling den Beamten, der ihm und Tejada in den Bergen begegnet war.
Mit einem gellenden Rufe sprang der, dem das Erscheinen des Polizisten galt, auf und sprang zu der Tienda hinaus. Ihm folgten, ihre Messer ziehend, die drei, die noch von der Mannschaft des Bootes anwesend waren und alle liefen dem Flusse zu.
Eine Pistole in der Hand, lief der Alguacil ihnen nach, rufend: "Fangt sie, hundert Pesos, wenn ihr sie fangt."
Aber die Verwirrung über das Unerwartete war zu groß, als daß sie nicht lähmend auf die Anwesenden gewirkt hätte.
Ein Schuß draußen belehrte den Alguacil, daß er den Verfolgten nicht ohne Lebensgefahr nahen könne. Jetzt liefen auch Leute zusammen.
Zu seiner Verzweiflung aber nahm der Beamte wahr, wie ein Boot mit schnellen Ruderschlägen sich vom Ufer entfernte und in die Mitte des Stromes hielt.
Die Aufforderung des tapferen Mannes an die Umstehenden, mit ihm im Boote den Flüchtigen nachzusetzen, fand keinen Anklang. Niemand verspürte Lust, sich den Schüssen der Verfolgten auszusetzen, und in der grimmigsten Laune ging der Alguacil zurück, während die Ruderschläge des schnellen Fahrzeugs in der Ferne verhallten.
Der Alguacil war, bald nachdem Maxtla sich entfernt hatte, auf abgemattetem Pferde vor der Posada erschienen, hatte auf seine Frage erfahren, daß ein Reisender auf einem Maultier angelangt sei, hatte sich zu dessen Zimmer führen lassen, das zum Erstaunen des Posadero leer war.
Der Fremde hatte sich durchs Fenster entfernt. Das Maultier überzeugte den Beamten, daß er seinen Mann vor sich habe, und alsobald begab er sich nach dem Flußufer, um sich dort nach seiner Beute umzuschauen. Leider hatte er seine beiden Lanceros, die nicht so gute Pferde ritten, als das seinige war, im Eifer der Jagd zurückgelassen und so war ihm der Pirat entkommen.
Mit teilnahmsvollem Erstaunen hatte Don Sancho Tejada erfahren, wen er in dem Fremden vor sich gehabt hatte und er beglückwünschte ihn innerlich zu der gelungenen Flucht.
"Und ich erreiche ihn dennoch, den Burschen, ehe er das elende Piratennest Orocué vor sich sieht," sagte der Alguacil grimmig und suchte erschöpft sein Lager auf, zu dem ihn der nicht wenig erschrockene Posadero führte.
Siebzehntes Kapitel.
Auf der Hacienda Otoño
Am anderen Tage ritt Don Sancho Tejada, gefolgt von seinem schläfriger als je aussehenden Peon Juan, nach Süden zu. War es auch ärgerlich, daß er auf dem Markte zu Naëva nichts erfahren hatte über den, den er suchte, so hoffte er doch am Ocoa, in der Nähe der drei Quellen Kenntnis von dem Verbleib des Sohnes Pedro d'Alcantaras zu erlangen.
Da er keine allzu große Eile hatte, ritt er gemählich durch die sonnbeglänzten Llanos, bald in einer Posada, wo er eine solche am Wege antraf, bald bei einem einsam wohnenden Llanero übernachtend.
Am dritten Tage, als er sich schon dem Ocoa näherte, fand er, als er am Abend einer aus wenigen Häusern bestehenden Niederlassung zuritt, in der am Wege liegenden Posada eine überraschend große Zahl von Gästen versammelt, zwischen denen es sehr lebhaft herging. Wohl an dreißig Pferde und Maultiere waren ringsum angepflockt und die Reiter, zwischen denen auch einige Reiterinnen zu sehen waren, hatten sich teils im Inneren des sehr luftigen Hauses, teils vor diesem niedergelassen.
Tejada warf den Zügel seines Tieres seinem gehorsamen Peon zu und trat zwischen die Gäste, die sich wenig um ihn bekümmerten, um den Posadero zu suchen.
Endlich traf er den Mann, der genug zu tun hatte, um die ungewöhnliche Zahl Gäste zu bedienen.
"Habt Ihr Nachtquartier für einen Caballero und seinen Peon?"
"Sicher, Sennor."
"Aber Euer Haus ist voll, wie ich sehen."
"Diese Caballeros reiten sämtlich heute abend noch ab, sie sind in den Llanos zu Hause. Kommt Ihr auch von Sennor Vivandas Fest?"
"Nein, ich komme von Norden."
"Sucht Euch einen Platz; sobald ich kann, werde ich nach Euren Befehlen fragen."
Damit verschwand der Mann in einer Art Küche, in der gebacken und gebraten wurde.
In nicht allzu günstiger Beleuchtung von Lampen, die aus Kokosschalen hergestellt waren, in denen ein von Palmöl genährter Doch brannte, sah Tejada die nervigen Gestalten der Steppenbewohner um sich her sitzen, die in verschiedenen Gruppen in lebhafter Unterhaltung begriffen waren.
Er suchte sich ein bescheidenes Plätzchen im Schatten eines hölzernen Pfeilers und lauschte. Ein Name, der unweit von ihm ausgesprochen wurde, erregte sofort seine Aufmerksamkeit.
"Die d'Alcantaras sind eines der ältesten Geschlechter des Landes," sagte einer der Männer, "ob aber außer Don Alonzo noch ein Glied dieser Familie lebt, weiß ich nicht - die Bürgerkriege haben aufgeräumt unter den alten Familien."
"Es ist doch ein Wunder," sagte ein anderer, "daß Alonzo diesen roten Mördern entgangen ist."
"Er hat ihnen heimgezahlt, was sie an den Seinen, an ihm verbrochen haben," äußerte lebhaft ein dritter, "der junge Espinoza aus den Bergen, der mit war, sagte, jeder seiner Schüsse habe getroffen."
"Und dabei kannte er das Dorf der Ladrones noch, als ob er es gestern verlassen hätte."
"Ja, er ist ein Mann, der Sohn Don Pedros, kein besserer Reiter, kein besserer Schütze weit und breit, seine Feinde mögen sich hüten."
Des biederen Tejada bemächtigte sich beim Anhören dieser Wechselreden ein ungemessenes Erstaunen. Da war ja der Gesuchte, offen vor aller Welt stand er da, der Sohn Don Pedro d'Alcantaras und er schien bei diesen Leuten sehr beliebt zu sein. Sollte er ihn bereits in dem Jüngling kennen gelernt haben, der in Naëva im Wettrennen den Sieg davontrug? Ja, der mußte es sein. Hm, ein verwegener Bursche, den zu beseitigen gar nicht so leicht sein würde.
"Mit welcher Klugheit ihn Sennor Vivanda verborgen gehalten hat."
"Er wird wohl seine Gründe dafür gehabt haben."
"Jetzt ist aber ein d'Alcantara da, mannhaft wie sein Vater, und wenn er ruft, reiten die Llaneros hinter ihm."
Tejada konnte es jetzt doch nicht unterlassen, sich an die neben ihm sitzenden Leute zu wenden und um Auskunft über das Schicksal von Sennorita Vivanda zu ersuchen, von deren Raub er in Naëva vernommen. Seine Teilnahme war unverkennbar.
Bereitwillig erzählten sie dem Fremden, der aus Norden kam und sogar unter Pedro d'Alcantara in den Bürgerkriegen gedient hatte, was sie wußten und gaben ihrer lebhaften Bewunderung für Alonzo Ausdruck.
Mit sichtlichem Interesse lauschte der Fremde der wunderbaren Mär von dem Gefangenen der so berüchtigten Aimaràs und hielt umsoweniger mit seiner freudigen Anerkennung der hervorragenden Eigenschaften des Jünglings zurück, als er eine so große Verehrung für seinen Vater hegte.
Der Mond war aufgegangen und beleuchtete mit seinem Silberschein die endlosen Llanos.
Die Gäste, die hierauf gewartet hatten, brachen auf, um ihre zerstreuten Gehöfte aufzusuchen, und bald war die eben noch so geräuschvolle Posada still und einsam.
Juan, der Peon Tejadas, hatte für die Tiere gesorgt und sich hierbei mit anderen Indios unterhaltend, schweigend die Wundermär des Tages von dem Auftauchen eines großen Capitanos, den die verachteten Indios bravos gefangen gehalten, mit angehört.
Er nahte sich seinem Herrn, um dessen letzte Befehle in Empfang zu nehmen.
Tejada sagte ihm, daß sie morgen bald nach Tagesanbruch reiten würden und ließ sich dann, während Maxtla sich eine Schlafstätte suchte, mit dem gesprächigen Posadero in eine längere Unterhaltung über die jüngsten Ereignisse, über Sennor Vivanda und dessen Familie und die Verhältnisse des Landes ein, auf diese Weise alles erfahrend, was er zu wissen wünschte.
Sehr nachdenklich gestimmt suchte auch er endlich die Nachtruhe.
Bald nach Sonnenaufgang verließ er in der Tat mit seinem Peon die Posada.
Sennor Sancho Tejada war immer noch nachdenklich gestimmt. Er hatte erfahren, daß der junge d'Alcantara, den zu suchen er ausgezogen war und an dessen Abkunft niemand zu zweifeln schien, eine viel gewichtigere Persönlichkeit war als er angenommen, und daß dieser junge Mann außerdem in den reich begüterten Vivandas mächtige Freunde zu haben schien.

Tejada begann behaglich sein Mahl einzunehmen.
"Ja, mein guter Don Carlos, jetzt begreife ich, daß du bereitwillig fünftausend Pesos gibst, um diesen Jungen aus dem Wege zu räumen. Aber fünftausend Pesos sind viel zu wenig. Der junge Mann ist wertvoll und die Sache gefährlich. Freilich werden die glorreiche Excellenza inzwischen von diesem Alcantara, der aus der Dunkelheit so plötzlich an das Licht getreten ist, erfahren haben, und sicher einen oder mehrere andere mit dem Geschäft beauftragen, das ich unternommen habe, wenn ich nicht bald günstige Nachrichten einsenden kann. Hm - hier muß rasch gehandelt werden. Wenn dieser stumpfsinnige Indio nur zu etwas gebrauchen wäre? Einen Messerstich weiß diese Rasse ganz gut im Dunkeln beizubringen. Hm - ja, die Sache muß ernstlich überlegt werden - ich möchte mich auch doch nicht unnütz in Gefahr begeben. Ich glaube, wenn ich dem Burschen hundert Pesos biete, er beseitigt ihn in Handumdrehen. Nun, wir werden sehen, doch vorerst wollen wir das Terrain erkunden und für einen gesicherten Rückzug sorgen."
Solch schwerwiegende Betrachtungen stellte der brave Mann an, als er gemessen durch das Steppengras ritt, zu seinen Füßen Blüten und umgaukelt von bunten Schmetterlingen. Als die Hitze des Tages größer wurde und sie ein schattendes Gehölz vor sich sahen, beschloß Tejada Rast zu machen. Wasser für die Tiere findet sich in diesen die Llanos durchsetzenden Gehölzen fast immer.
Sie fanden unter Palmen und Mangobäumen zwischen Lorbeerbüschen einen einladenden Ruheplatz, der unweit eines kleinen Wasserlaufes sich darbot.
Maxtla sattelte auf Befehl seines Herrn ab, pflockte die Tiere so an, daß sie weiden und zugleich ihren Durst stillen konnten und legte dann den ledernen Beutel, der Nahrungsmittel enthielt, vor Tejada hin.
Don Sancho war kein Freund von Entbehrungen und versorgte seinen Speisebeutel stets so gut als möglich; an einer Flasche Wein oder lieber noch Aquadiente, die Speisen zu würzen, fehlte es selten.
Er begann ganz behaglich sein Mahl einzunehmen und gab auch Maxtla Maisbrot und Fleisch, zu dem dieser sich einige nahegewachsene Limonen brach.
Ehrerbietig saß der Indianer in einiger Entfernung von seinem Herrn und verzehrte still die ihm gereichten Speisen.
Als Tejada sein Mahl beendet und sich eine Zigarrito angezündet hatte, fragte er seinen Peon leichthin: "Bist du im Kriege gewesen, Bursche?"
Maxtla grinste und erwiderte in seinem unbehilflichen Spanisch: "Wie sollte Juan in den Krieg kommen? Er kein Freund von Krieg."
"Wundert mich, daß sie dich nicht ausgehoben haben, als es mit Venezuela losging, alt bist du doch genug dazu."
"Ja, ihm wollen die Lugartenientes mitnehmen, er soll Soldado werden - aber lief in die Wälder, ihm nicht finden."
"Schade, du wärest gewiß ein tüchtiger Soldat geworden."
"Ihm nicht gefallen, zu viel schießen da."
"Das ist richtig, ohne Schießen geht's da nicht ab. Na, dein Messer wird ja wohl irgend ein Muttersohn schon zwischen den Rippen gespürt haben."
"O, Sennor, große Sünde mit Messer stechen, Juan das nie tun, er guter Christ."
"Na, Christen sollen das auch tun," brummte Tejada. "Also du würdest nie einem Menschen, auch deinem Feinde nicht, einen Messerstich versetzen? Hätte nicht gedacht, daß du so fromm wärest."
"Ihm nie tun, Sennor, das große Sünde."
Verdrießlich schaute Tejada geraume Weile vor sich hin.
"Kennst du diese Gegend hier?" fragte er endlich. "Du stammst doch von den Flüssen in den Llanos."
"Ja, ihm geboren worden am Humea, nicht hier."
"Ich wünschte, du wüßtest hier eine gute Posada, wo man längere Zeit verweilen könnte; wäre nicht abgeneigt, Land hier zu kaufen an den Flüssen; das Wasser bietet doch ein bequemeres Absatzgebiet als die rauhen Bergwege."
"Warum nicht gehen zu großen Haciendero? Ihm sehr gastfrei, er sich freuen, wenn Caballero kommen."
"Was weißt du von großen Haciendero hier?"
"Alle Indios in Posada gestern sagen, sie nie so viel Fleisch und Tabak bekommen, als bei großem Haciendero, der die Sennorita wieder gefunden, die schlechte Indios geraubt."
"Wahrhaftig, das ist ein Gedanke. Ich werde in der Tat Sennor Vivanda meine Aufwartung machen, dabei wird sich manches ergeben. Nun, Muchacho, wenn du so großes Verlangen nach den Fleischtöpfen des großen Hacienderos hast, die Freude bei ihm vorzusprechen, kann ich dir ja machen."
Dies schien dem Indianer durchaus angenehm zu sein.
"Weißt du, wo die Hacienda liegt?"
"Indios sagen, am Flusse - ihm kann nicht mehr weit sein."
"Wollen dort vorsprechen."
Hurtig sattelte Maxtla die Tiere und bald darauf galoppierten beide durch die Ebene. Angebaute Felder ließen, als sie eine Stunde geritten waren, auf die Nähe einer großen Pflanzung schließen, und nach kurzer Frist gewahrten sie auch den zwischen Bäumen verborgenen Herrensitz der Hacienda Otoño.
Tejada trug die Kleidung, die bei denen, die in den Llanos reiten, die übliche ist, und trotz seines abenteuerlichen und verbrecherischen Lebens waren ihm von früher noch einige Umgangsformen geblieben, die auf den Mann von guter Erziehung schließen ließen.
Er nahm seine ganze Keckheit zusammen, um den Sennores Vivanda, die ihm dem Rufe nach als wirkliche Caballeros bekannt waren, als gleichberechtigter Standesgenosse zu begegnen.
Als er sich dem Familiengebäude näherte und gewahrte, in welch vornehmem, in den Llanos seltenem Stile alles gehalten war, Wege, Gärten, Park, Baulichkeiten, fühlte er doch, daß er nicht mehr ganz in solche Umgebung passe, er hatte sich zu lange in der Posada und in der Spielhölle bewegt.
Aber er strich sich den dunklen Schnurrbart und ritt in guter Haltung vor.
Trotz des gestrigen aufregenden Festtages auf Otoño, der das Hauswesen stark in Unordnung gebracht hatte, trat nicht nur ein Peon zu ihm, um ihm das Pferd abzunehmen, alsbald erschien auch der Majordomo, um ihn zu bewillkommnen.
"Fragt, ob ein durchreisender Caballero Sennor Vivanda seine Glückwünsche darbringen dürfe zu dem glücklichen Ereignis, von dem ich gestern vernommen habe."
"Wolle es Euch gefallen, Sennor, näher zu treten, ich werde sogleich fragen, ob einer der Sennores bereit ist, Besuch zu empfangen. Sattle ab, Bursche," rief er Maxtla zu, "Fremde sind stets auf Otoño willkommen."
Er lud durch höfliche Gebärde Tejada in eine Pieza neben dem Haupteingang einzutreten und versprach, sofort zurückzukehren.
Kaum war er verschwunden, erschien schon ein Diener des Hauses mit Limonade und Rauchmaterial, welches beides er vor den Gast hinsetzte und zugleich nach seinen weiteren Befehlen fragte. Der Fremde hatte aber nur den Wunsch, die Herrschaft zu begrüßen.
Nach kurzer Zeit erschien auch der Majordomo wieder und meldete, daß Hochwürden, der Bruder des Sennors, sich eine Ehre daraus machen würde, Sennor zu empfangen und das alles, Haus und Hof zu der Verfügung Seiner Gnaden stehe.
Waren dies auch nur die üblichen Phrasen, die unter Spaniern gewohnheitsmäßig gebraucht werden, so war Tejada doch durch den vornehmen Ton des Ganzen verblüfft. Dennoch warf er sofort den Poncho ab, nahm den Hut in die Hand und folgte dem führenden Haushofmeister zu dem Zimmer des Cura.
Der alte Herr mit dem geistvollen, freundlichen Gesicht empfing ihn im bequemen Hauskleid, hieß ihn mit einigen Worten im Namen seines Bruders auf Otoño willkommen und dankte für die Ehre seines Besuches.
Dem Banditen war vor dem klugen Auge des Greises, das auf dem Grunde der Seele zu lesen schien, gar nicht wohl, doch nahm er seine Unverschämtheit zusammen und sagte mit sicherem Ton: "Hochwürdigster Herr, nicht nur der Wunsch, bei einer durch Geschäfte bedingten Anwesenheit in diesem Teile des Landes dem illustren Herrn Otoños meine Ehrerbietung zu bezeigen, führt mich hierher, auch die Freude, Euch meinen Glückwunsch zur Rettung der Tochter des Hauses aus großer Gefahr darbringen zu dürfen, doch mehr noch das Verlangen, den Sohn Don Pedro d'Alcantaras, des verehrten Mannes, unter dem ich als Teniente diente, begrüßen zu können. Gestern vernahm ich von diesem Wunder in einer Posada und beeilte mich, meine Schritte hierher zu lenken."
Dem Cura war die Erscheinung Tejadas sehr wenig sympathisch, doch wies das so oft durch Parteikämpfe und Bürgerkriege zerrissene Land eine solche Zahl abenteuerlicher Gestalten auf, daß ihm diejenige Tejadas weder neu noch überraschend war.
Er erwiderte höflich: "Ja, Sennor, durch des Himmels Gnade und die Tapferkeit unseres Pflegesohnes wie hingebender Freunde ist großes Unheil von unserem Hause abgewandt worden. Unser Zögling Alonzo d'Alcantara hat sich dadurch als echter Sohn seines heldenhaften Vaters in die Welt eingeführt."
"O, es ist rührend und staunenswert zugleich. Welch seltenes Geschick! Wie soll es mich freuen, einen Sproß meines teueren Coronel zu sehen."
"So habt Ihr auch für die Sache der Libertados gefochten, Sennor -?"
"Molino, wenn's beliebt, Hochwürdiger. - Ja," sagte mit der Miene eines Märtyrers Tejada, "gefochten und gelitten."
Ein Klopfen an der Türe beantwortete der Cura mit einem "Entra!" und herein trat Alonzo.
"O Väterchen, du hast Besuch? Entschuldige mich."
"Nein, komm nur, Kind, hier ist ein Gast, der sich freut, dich begrüßen zu können."
Alonzo hatte mit dem ersten Blick den Mann aus der Posada in Naëva erkannt, und sein Gesicht nahm den Ausdruck starrer Ruhe an, der keine Gefühlsbewegung mehr verriet.
Der Geistliche, der den verwilderten Knaben mit eines Vaters Liebe erzogen hatte, kannte dieses Gesicht und wußte, daß es dem Fremden gegenüber Bedeutung haben müsse.
Doch sagte er ohne zu Zögern: "Dies ist Don Alonzo d'Alcantara, Don Pedros Sohn, Sennor. Ein reisender Caballero, Kind, der uns die Ehre erwiesen hat, auf Otoño vorzusprechen. Sennor Molino, wenn ich recht verstand."
Tejada, der seit gestern wußte, daß er in Alonzo d'Alcantara den verwegenen Reiter und meisterhaften Schützen aus Naëva erkennen würde, war doch durch die Haltung und den Ernst des jungen Mannes, der hochaufgerichtet vor ihm stand, überrascht.
"O" - sagte er dann sich zusammennehmend - "ja, das ist meines teueren Don Pedros Blut, ich erkenne es, ich fühle es. O Sennor, gestatten Sie mir, daß ich Sie umarme."
Er erhob sich und wollte seine Absicht ausführen.
Alonzo, in dem wieder der Verdacht sich regte, in diesem Mann denjenigen vor sich zu haben, der den tödlichen Schuß auf Gomez abgegeben hatte, verbeugte sich, ohne daß ein Zug in seinem Gesicht sich bewegte, mit höflicher Kälte und sagte: "Es wäre dies zu viel der Ehre für mich, Sennor."
Selbst die Hände, die Tejada ihm entgegenstreckte, schien er nicht zu sehen.
Der Cura bemerkte es, Tejada aber war gewandt genug, schnell noch mit der Hand nach den Augen zu fahren, als ob er sich eine Träne abwische und sagte: "Verzeihen Sie, Sennores, wenn einem alten Soldaten, der für die Freiheit dieses Landes gefochten hat, bei der Erinnerung an seinen glorreichen Capitano die Weichheit überkommt. O, wie es mich freut, einen Sohn Don Pedros noch am Leben zu finden, o, das wird großes Aufsehen im Lande erregen."
"Jedenfalls bei allen Freunden der Familie," sagte der Cura, der den Fremden jetzt aufmerksamer betrachtete, nachdem ihm Alonzo mit solcher Kälte begegnet war.
"Sie waren schon früher in diesem Teile des Landes, Sennor?" fragte Alonzo, ohne auf die Gefühlsäußerungen des alten Soldaten Rücksicht zu nehmen.
Tejada stutzte bei dieser Frage, die ihm recht unerwartet kam, entgegnete aber doch gefaßt: "Mein wildes Kriegsleben hat mich wohl auch vorübergehend mit diesem Teile des Landes in Berührung gebracht; es gab eine Zeit, wo echte Patrioten nur in der Wüste sicher waren; doch das ist lange her."
"Sie kommen aus dem Norden, Sennor Molino?"
"So ist es, hochwürdiger Herr. Ich habe Eigentum am Magdalena, doch die Zeiten sind so unruhig, und man ist mir in Bogotá so wenig gewogen, daß ich in das Land geritten bin, um, wenn es möglich ist, mir eine Heimstätte im Süden zu suchen."
"O, drohen uns wieder Unruhen?" fragte der Cura.
"Das möchte ich nicht sagen," erwiderte Tejada ausweichend. "Doch gehört eine feste Hand dazu, um alle widerstrebenden Elemente des Landes im Zaum zu halten."
"Die wir ja glücklicherweise in Sennor de Valla haben," ergänzte der Cura.
"O ja, gewiß."
Zu welcher politischen Partei die Vivandas sich bekannten, wußte Tejada nicht, doch war klar, daß die Beschützer eines d'Alcantara nicht freundlich gegen einen Minister gesonnen sein konnten, der die Güter dieser Familie in Besitz hatte, abgesehen von allem anderen, was den Sprößling Don Pedros von de Valla trennte.
Da er, als vom Norden kommend, mit den Verhältnissen dort besser vertraut sein mußte als die Bewohner des Ocoaufers, obgleich er weniger davon wußte als sie, scheute er sich, durch Fragen sich Blößen zu geben und äußerte nur: "Ein gütiges Geschick möge unser teueres Vaterland vor Unglück behüten und ihm den Frieden erhalten."
"Amen," sagte der Cura.
"Sie werden gewiß bald Bogotá aufsuchen, Don Alonzo?" fragte Tejada dann.
"Das wird mit der Zeit gewiß geschehen," erwiderte der Cura freundlich an Stelle des Jünglings, "einstweilen wollen wir unseren Pflegesohn noch etwas in unserer Nähe behalten."
"Man wird den Sohn des edlen Don Pedro mit Freuden in Bogotá willkommen heißen, und wenn ich ihm dort etwas nützen kann -?"
"Sehr freundlich, Sennor, aber unsere Verbindungen genügen."
Er hieß Tejada noch einmal willkommen und befahl dem Majordomo, ihm ein Gastzimmer anzuweisen.
Als der Gast sich entfernt hatte, befragte der Cura den Jüngling um die Ursache seines abstoßenden Benehmens gegen diesen.
"Ich halte den Mann für einen Bandido, Vater," erwiderte er kurz.
Der alte Herr erschrak bei dieser schroffen Äußerung.
"O -o, Alonzo, womit begründest du ein solches Urteil?"
"Sieh dir sein Gesicht an, Vater, ich wittere die Nähe des Raubtieres."
Bei der Besorgnis, die die Vivandas für Alonzo hegten, die gestiegen war, seit er öffentlich als d'Alcantara proklamiert worden war, schoß jetzt dem Cura der Gedanke durch den Kopf, daß Alonzo von dem Menschen, der die unverkennbaren Zeichen des Abenteurers trug, eine Gefahr drohen könne, die der Jüngling instinktiv vorausfühle.
Daß ein Mann, gleich de Valla, nicht davor zurückschaudern würde, nach dem Erben Pedro d'Alcantaras den Meuchelmörder auszusenden, war dem Cura traurige Gewißheit; darum war ja dessen Abstammung ängstlich als Geheimnis bewahrt worden, bis zu dem Augenblicke, wo Alonzo selbst in hochherziger Aufwallung Eugenio Kenntnis davon gegeben hatte.
Bei einigem Nachdenken mußte sich der Cura indessen sagen, daß de Valla, wenn er von Alonzos Dasein jetzt erführe, zugleich auch wisse, daß dieser seinem Sohne mit eigener Gefahr heldenmütig Freiheit und Leben gerettet habe.
So verworfen war kein Mensch, um dem Retter seines Kindes nach dem Leben zu streben.
Außerdem konnte de Valla kaum Kunde von den Vorgängen im Gebirge durch Eugenio haben.
"Nein, nein," sagte sich tröstend der Greis, "meine Besorgnisse sind übertrieben, von diesem Fremden ist nichts für Alonzo zu besorgen."
Er ging deshalb auf seine Äußerungen nicht weiter ein, sondern ermahnte ihn, seine Antipathie gegen den Mann zu bekämpfen und die üblichen Höflichkeiten dem Fremden gegenüber nicht außer acht zu lassen, worauf er ihn in der gewohnten gütigen Weise verabschiedete.
Die Brüder Vivanda, die jetzt, wo Alonzo durch seinen verwegenen Zug gegen die fast unangreifbaren Aimaràs der Held des Tages geworden war, die Zeit gekommen glaubten, das Dunkel, das über seiner Abkunft schwebte, zu lüften, und die viel tiefer in die Bewegungen der politischen Parteien eingeweiht und besser über die Vorgänge in Bogotá unterrichtet waren, als es bei ihrer Zurückgezogenheit den Anschein erweckte, hatten lange Schreiben an den Präsidenten Alonzos wegen gerichtet. Abschriften aller Beweismittel über dessen Abkunft, für den Fall diese überhaupt bezweifelt werden sollte, waren beigefügt, um Alonzos Ansprüche auf Namen und Abstammung zu begründen und zwar im Einverständnisse mit den einflußreichsten ihrer Nachbarn, die wie sie bereit waren, diese Ansprüche zu vertreten.
Man mußte harren, was von Bogotá aus erfolgen werde, und freilich Alonzo d'Alcantara, dessen Name bei der herrschenden Partei sehr verhaßt war, gut bewachen. Schritte hierfür waren, obgleich für den Augenblick nichts zu besorgen war, durch Don Vivanda, freilich ohne Wissen Alonzos, schon getan. Und der Fremde? Nun auch ihm gegenüber konnte man ja vorsichtig sein.
Derselben Meinung war übrigens des Cura Bruder, als er zurückkehrte, er äußerte aber: "Wenn Alonzo diesen Menschen für einen Bandido hält, wird er sich schon vor ihm hüten, dennoch wollen wir auf unseren werten Gast acht geben, die Zeiten sind wild und wir sind in Bogotá nicht gut angeschrieben. Wer weiß, ob man uns den Herrn nicht von dort geschickt hat, um ein wenig zu spionieren."
Trotz dieser Stimmung der beiden Brüder wurde Tejada mit einer rücksichtsvollen Höflichkeit von ihnen behandelt, die nichts zu wünschen übrig ließ.
Tejada selbst aber war sehr ernst und nachdenklich geworden, und der ihm erteilte Auftrag schien ihm immer schwieriger zu werden.
Tejada war scharfsinnig genug, zu erkennen, daß er in den Vivandas lebenskluge, mächtige und einflußreiche Leute vor sich hatte, und daß es auf der reich mit Arbeitern versehenen Hacienda nicht leicht sein werde, einen Streich gegen Alonzo zu führen, abgesehen davon, daß der Bursche ungewöhnliche Kraft und viel Mut besaß. Und wie hatte ihn der Mensch behandelt? Dieser Knabe, ihn, einen Caballero? Geradezu mit Verachtung.
Sein Leben auf das Spiel zu setzen, um sich in den Besitz der fünftausend Pesos zu bringen, dazu verspürte der tapfere Kriegsmann keine Neigung und auf den stupiden Peon, den er sich angeworben hatte, war ja kein Verlaß.
Dabei tauchte ihm von neuem der Gedanke auf, daß de Valla, der ja in den nächsten Tagen Kenntnis von dem erlangen mußte, was auf Otoño in Gegenwart vieler Menschen vor sich gegangen war, einen anderen beauftragen möchte, Alonzo hinwegzuräumen, und dann entging ihm der Preis. Daß jetzt de Valla mehr als je daran gelegen sein mußte, den Träger eines Namens, der, wie er sich überzeugt hatte, von weithin hallendem Klang war, zu beseitigen, war klar. Doch für den Augenblick war nichts von de Vallas Seite zu besorgen, und man mußte zusehen; es war ja nicht das erste Mal, daß er mit Erfolg eine Kugel aus dem Hinterhalt abgefeuert hatte. Er bewegte sich auf Otoño mit großer Sicherheit, schwatzte von seinen Kriegsabenteuern, von den Gefahren, die er an der Seite Pedro d'Alcantaras überstanden, benahm sich gegen Donna Elvira mit einer caballeromäßigen Höflichkeit und gegen den kühl höflichen Alonzo mit einer gönnerhaften Zärtlichkeit.
Donna Elvira fühlte gleich Alonzo einen instinktiven Widerwillen gegen den geschwätzigen Menschen mit der ihr unheimlichen Physiognomie. Tejada aber schien das alles nicht zu bemerken. Sein Peon, der der Dienerschaft zur Pflege übergeben war, fühlte sich augenscheinlich sehr wohl auf Otoño und zwar umsomehr, als sein Herr seine Dienste kaum in Anspruch nahm. Maxtla oder Juan schlenderte auf der ausgedehnten Besitzung umher, teilte seine Zigaritos mit den indianischen Arbeitern und horchte aufmerksam ihren Erzählungen von dem Sennorito, den alle sehr zu lieben schienen. Von seiner Kühnheit und Kraft berichteten sie Wunderdinge. Alle wußten auch, daß Don Alonzo der Sohn eines großen Capitanos sei und jetzt selbst ein großer Capitano werde. Aber sie wußten auch, daß böse Menschen ihm nach dem Leben strebten und hatten oftmals große Angst um ihn, wenn er in die Llanos ritt.
Ein nicht minder scharfes Auge wie auf die Umgebung hatte Maxtla auf Tejada und Alonzo und beobachtete sie in einer so unscheinbaren Weise, daß dies selbst Alonzo entging, der die Wachsamkeit des wilden Indianers besaß und außerdem von ihm vor drohender Gefahr gewarnt worden war.
Maxtla saß auf einem Hügel, der sich zwischen den Gebäuden der Hacienda und dem Wald, der den Fluß einfaßte, erhob und rauchte nach seiner Gewohnheit. Er hatte von hier einen weiten Rundblick. Sein Maultier hatte er angepflockt.
Während seine dunklen Augen umherschweiften, fiel ihm ein Reiter auf, der von Westen kam und am Waldsaume herritt. Der Mann unterschied sich kaum von den Landbewohnern oder den Vaqueros, nur etwas in seiner Haltung, das nur den Caballeros eigen war, fiel dem scharfsichtigen Indianer auf, der auch erkannte, daß der Reiter nicht zur Hacienda Otoño gehöre.
Maxtla sank in das Gras zurück und bewegte sich dann mit einer staunenswerten Geschicklichkeit mit großer Eile vorwärts, um den Weg des Reiters zu kreuzen.
An einer Stelle angelangt, wo dieser vorüber mußte, setzte er sich nachlässig nieder.
Er harrte nicht lange, so kam der Reiter heran. Maxtlas funkelnde Augen erweiterten sich, denn er erkannte sofort in dem nach Vaqueroart gekleideten Manne Don Ignacio Caldas, den er in Bogotá und im Hause de Vallas oft gesehen und als verrufenen Schurken kannte.
Der Reiter hielt sein Pferd an, als er Maxtla, der schläfrig dasaß, erblickte.
"Sage mir, Muchacho," rief er Maxtla zu, "bin ich eigentlich auf dem Wege nach Esmeralda, der Hacienda Sennor Reals?"
"Du kannst auch am Flusse her hingelangen, Sennor, doch ist es ein Umweg, die Straße führt dort oben."
"So bin ich falsch berichtet worden. Welche Hacienda ist dies?"
"Es ist meines Sennors Hacienda."
"Nun ja, und der heißt?"
"O, du kennst Sennor Vivanda nicht?"
"O, so ist das Otoño, wo vor einigen Tagen das große Fest gefeiert wurde, von dem die Leute überall reden."
"O ja, es war schön."
"Es galt Eurem jungen Sennor, ich hörte davon erzählen. Das muß ein mächtiger Herr sein."
"O ja."
Don Ignacios Auge war forschend auf das Gesicht des Indianers gerichtet und plötzlich sagte er: "Ich habe dich schon gesehen, Bursche!"
"O, das sehr möglich," entgegnete ruhig Maxtla, "ihm werden viel gesehen, noch in Naëva zu Jahrmarkt gewesen."
"Nein, ich habe dich in Bogotá gesehen."
"Das sehr gut," entgegnete lachend Maxtla, "er oft in Bogotá, dreimal, zweimal mit Rindern von Sennor, o, Juan dich nicht gesehen."
"Diese Roten haben so verwünscht ähnliche Gesichter," brummte Caldas vor sich hin, und ein Verdacht, der in ihm aufgetaucht war, schien gewichen zu sein.
"Wie weit habe ich noch bis Esmeralda?"
"O, drei Leguas."
"Das ist weit und dazu die Hitze. Hätte fast Lust Rast zu machen, schon um euren berühmten Sennorito einmal zu sehen, von dem alle wie von einem Wundertier reden; mein Brief kommt noch zeitig genug nach Esmeralda. Wie heißt er eigentlich jetzt?"
"Er immer noch Don Alonzo heißen."
"Estupido," murmelte Don Ignacio.
"Du nur hinreiten, dort zu Castello, dann ihn sehen, o, er schöner Caballero."
"So," dachte Ignacio, "er ist also hier?"
Er sann einen Augenblick nach und sagte dann: "Ich muß mir die Freude jetzt doch versagen, ich könnte zu spät in Esmeralda eintreffen, aber auf dem Rückwege will ich bei euch vorsprechen, solche Heroes sieht man doch selten. Adios."
Und davon ritt Sennor de Caldas.
Der Indianer versank wieder in seine nachlässige Haltung. Kaum aber war der Reiter hinter den Bäumen verschwunden, als Maxtla mit einer staunenswerten Behendigkeit aufsprang und ihm zwischen Büschen, die ihn deckten, hastig folgte.
Bald hatte er ihn auch wieder im Auge.
Don Ignacio hielt, überschaute die Felder, blickte aufmerksam nach den Gebäuden der Hacienda hinüber und trieb sein Pferd in den Wald, der hier weniger Unterholz zeigte als an anderen Stellen.
Maxtla schlich durch die Büsche, was hie und da der Dornen wegen große Schwierigkeiten bereitete und sah den, dem er folgte, bald wieder.
Don Ignacio hatte den Sattel verlassen und band sein Pferd an. Dann schritt er auf einem kaum bemerkbaren Pfade dem Wasser zu; zu seiner Seite folgte mit der Geräuschlosigkeit des Waldkriegers Maxtla. Der Kreole mußte den Pfad kennen.
Nach kurzer Zeit, denn an dieser Stelle war der den Fluß umsäumende Waldstreifen dünn, erreichten sie Bambus und Schilf und Weiden, ein Zeichen der Nähe des Wassers. Auf dieses zu führte der Pfad weiter. Maxtla erkletterte einen jungen Kautschukbaum. Von seiner Höhe sah er ein Canoa im Schilf versteckt liegen, in dem ein alter Neger saß. Mit diesem wechselte Don Ignacio einige Worte. Der Schwarze reichte ihm eine Büchse und einem Kugelbeutel aus dem Boote, und so ausgerüstet schritt der Kreole den Pfad zurück, den er gekommen war. Maxtla wie vorher zu seiner Seite.
Der Indianer hatte keinen Zweifel, daß es Alonzo galt - daß Don Ignacio von Bogotá mit demselben Auftrag ausgesendet worden sei wie Tejada - und zwar mit genauer Kenntnis des Aufenthaltes des Jünglings. Don Ignacio besaß jedenfalls mehr Mut und mehr Geschicklichkeit als der Bandit, dem Maxtla diente und ihn zugleich überwachte.
Ignacio war gefährlicher.
Aus den dichten Tabakfeldern, den Kaffeesträuchern war leicht ein Schuß abzugeben, sie deckten den Schützen und dessen Rückzug nach dem Waldsaum und dem Wasser; der Plan war gut ausgeheckt. Der Ocoa war zu sicherer Flucht geeignet. Caldas mußte sich auf diese Art des Angriffs und des Rückzugs vorbereitet haben.
Mittag war vorüber, aber Arbeiter und Aufseher hielten noch ihre Siesta; es war leicht, ungesehen in die weit ausgedehnten Felder zu gelangen, die um diese Jahreszeit niemand betrat.
Don Ignacio führte sein Pferd etwas tiefer in den Wald zu einer Stelle, wo es nicht leicht gefunden werden konnte, sah sich vom Waldsaume aus aufmerksam um und schlüpfte dann mit großer Gewandtheit in ein nahe gelegenes Maisfeld, das an Tabaksfelder grenzte, die sich bis in die Nähe der Gebäude ausdehnten. Aber hinter ihm schlich der düstere Indianer einher, die blanke Machete in der sehnigen Hand, einem Schweißhunde gleich, der auf der Spur seines Wildes geht.
Don Alonzo war in den Gebäuden, das wußte Maxtla, er hätte ihn sonst abreiten sehen. Tejada war, wie er wiederholt getan, allein ausgeritten, um sich, wie er sagte, Land und Leute anzusehen.

Maxtla schlich hinter Don Ignacio einher, die blanke Machete in der Hand.
Während Don Ignacio und Maxtla sich durch die Tabakfelder bewegten, war Don Sancho Tejada, alias Molino, wohl eine Legua entfernt von jener Stelle und ritt verdrießlich am Waldsaume hin. Da er einsah, wie schwierig und auch gefährlich es sei, die Mordwaffe hier gegen Alonzo zu erheben, ging sein einziges Trachten dahin, einen verworfenen Gesellen zu finden, der gegen möglichst wenig Geld das Verbrechen ausführe.
Diese Leute waren zu jener Zeit gar nicht zu schwer aufzutreiben, doch mußte man sie in den Städten suchen. Die Arbeiter hier waren dem Sennorito alle auf Tod und Leben ergeben, es blieb also wohl nichts übrig, als einen der kleinen Hafenorte der Flüsse aufzusuchen, wo sich Raubgesindel genug herumtrieb, um dort einen Mann zu dem Meuchelmorde zu gewinnen. Seine menschenfreundlichen Betrachtungen wurden unterbrochen durch den unerwarteten Anblick eines Reiters, der ihm hier auf ungewohntem Wege am Waldsaum entgegen kam.
Der Mann ritt ein gutes Pferd und sah stattlich aus.
Tejada hielt und ließ ihn ruhig herankommen. Zu seinem nicht geringen Erstaunen erkannte er in dem Fremden den Flüchtling von Naëva, den der Alguacil so gern vertraulich sprechen wollte.
"Bin doch begierig, ob der mich auch erkennt," dachte er.
Der Reiter kam heran, grüßte höflich und fragte: "Habe ich die Ehre, den Herrn dieses Grund und Bodens vor mir zu sehen?"
Tejada erwiderte den Gruß in gleich höflicher Weise und entgegnete: "Nicht doch, Sennor, ich bin nur Gast hier."
"Aber, ich bin vom Wege abgekommen, auf wessen Eigentum befinde ich mich?"
"Auf dem Sennor Vivandas."
"O, da bin ich in der Tat weit ab von meinem Ziele."
Der Fremde hatte Tejada von der flüchtigen Begegnung in der Posada zu Naëva her nicht wieder erkannt. Seine Gedanken waren wohl damals hinreichend beschäftigt gewesen, um einem ihm gleichgültigen Fremden Aufmerksamkeit zu widmen.
"Hoffentlich haben Sie Ihr flinkes Boot in der Nähe, um zum rechten Wege zurück zu gelangen."
Der Fremde stutzte und warf Tejada einen drohenden Blick zu, fühlte auch zugleich nach seinem Pistolenhalfter.
"Lassen Sie ruhig stecken, Sennor, denn wenn ich Sie verraten wollte, konnte ich das in Naëva tun, wo Ihnen der Alguacil so nahe auf den Fersen war."
Der Genosse der Flußpiraten sah ihn an wie ein Fuchs den Hund, der ihn plötzlich gestellt hat.
"Euer Gnaden irren sich gewiß in der Person - ich bin -"
"Der Lockvogel der Ehrenmänner, die den Orinoko unsicher machen," ergänzte Tejada höhnisch, "und für den Strick längst reif."
Der Mann erbleichte und tastete wieder nach seiner Pistole.
"Der Alguacil, der das Unglück hatte, Sennor in Naëva zu verfehlen, ist ebenfalls in der Nähe und eine Nachricht von mir an ihn wird Sie überzeugen, ob es klug war, den Ocoa als Zufluchtsort zu erwählen. Jedenfalls sind die Pferde der Vaqueros ringsum sehr schnell, ihre Lanzen spitz und ihre Lassos unfehlbar. Euer Gnaden würden sich also in einer sehr gefährlichen Lage befinden, wenn Ihnen der Weg nach dem Meta verlegt würde."
Der Pirat gewann doch die Überzeugung, daß er es mit jemand zu tun hatte, der nichts Böses gegen ihn beabsichtigte. Er sagte: "Ich habe entschieden einen vollendeten Caballero vor mir, der unschuldig Verfolgten gern beisteht." Und da er voraussetzte, daß sein Gegenüber einen Gegendienst für sein Schweigen verlange, setzte er hinzu: "Ich würde es mir zur Ehre schätzen, wenn ich mich für Euer Wohlwollen dankbar erzeigen könnte."
"Hm," meinte Tejada, "eine Liebe ist der andern wert, ich behalte, was ich von Euer Gnaden werter Person weiß, für mich, der spürnasige Alguacil kann anderwärts suchen und Ihr erweist mit die Gegengefälligkeit und beseitigt einen höchst gefährlichen Menschen, der mich tödlich beleidigt hat. Ich nehme an, daß Ihr an Bord Eures Fahrzeugs die Leute dazu habt."
"Einem beleidigten Ehrenmann zu dienen ist mir stets Pflicht gewesen. Wollen sich Euer Gnaden nicht deutlicher ausdrücken?"
"Mir ist es aus Gründen, die kein Interesse für Euch haben, darum zu tun, daß der Erbe dieser Hacienda, Don Alonzo Vivanda, alsbald von hier entfernt werde, wo seine Anwesenheit sehr nachteilig wirkt. Versteht Ihr?"
"O - ist das derselbe, von dem jetzt überall die Ruhmesposaune tönt, als einem echten Alcantara?"
"Gleichviel ob Vivanda, ob Alcantara, ich stelle Euch Eure Aufgabe. Ist bis morgen zwölf Uhr dieser Alonzo nicht verschwunden, lasse ich Euch den Weg zum Meta verlegen und Euch in der Steppe zu Tode hetzen. Ist das klar?"
"Euer Gnaden reden sehr deutlich. Aber da mir sehr viel daran liegt, den Meta wohlbehalten zu erreichen, so darf ich Euch die Versicherung geben, daß der junge gefährliche Mann um zwölf aufgehört hat, Euch zu schaden."
"Versucht es nicht, mich zu täuschen," sagte Tejada drohend, "Ihr glaubt klug zu tun, als Ihr ein Seitengewässer aufsuchtet, aber Ihr habt Euch in eine Falle begeben, die zuklappt, wenn ich winke. Ist um zwölf Uhr morgen mittag Alonzo nicht beseitigt, versteht Ihr, so gehen Correos nach der Mündung des Ocoa ab, die Schiffer des Flusses und die Llaneros werden auf beiden Ufern aufgeboten und keiner von euch erreicht die Insel."
Der Piratengenosse, der einen äußerst gefährlichen Mitwisser seiner Tätigkeit in Tejada erkannte und doch nicht wußte, was er aus ihm machen sollte, dabei aber zu jedem Bubenstück bereit war, erschrak, als er die Insel erwähnt hörte.
"Nun, ich schwöre Euch -"
"Schwört nicht. Bis um zwölf Uhr morgen mittag habt Ihr einen Freund an mir, von da an, wenn Ihr Euer Wort nicht haltet, einen Todfeind, richtet Euch danach."
"Ihr sollt unser Freund bleiben, Sennor, verlaßt Euch darauf. Doch, darf ich nicht wissen, wem ich zu dienen die Ehre habe?"
"Nehmt an, Ihr hättet einen alten Soldaten vor Euch, der sein Blut für das Vaterland vergossen hat und den Staat gern vor neuen Verwicklungen bewahrt sähe," sagte Tejada mit Würde.
"Umso lieber diene ich Euer Gnaden," war die kriechend höfliche Antwort.
"Also Ihr wißt - Ihr spielt ums Leben. Adio."
Damit wandte Tejada stolz sein Roß und ritt dem Herrenhause zu, einen Ausdruck hämischer Freude auf seinem Banditengesicht.
"Es ist auf den Alcantara abgesehen," murmelte der Fremde. "Gib dich zufrieden - er soll beseitigt werden. Wer dieser Mensch nur ist?"
Nachdenklich ritt er dann zurück.
- - - - - - - - - - -
Auf der schattigen Veranda des Hauptgebäudes saßen Donna Elvira und Don Alonzo. Sie hatte eine Stickerei vor sich, ließ sie aber unberührt und handhabte nur mit der den Spanierinnen eigenen Grazie den Fächer.
"Du hast mir mehr als einmal versprochen, zärtlicher Bruder, mir einige von den großen blauen Faltern mitzubringen, die am Flusse umherstreifen."
"Versprochen," erwiderte Alonzo lächelnd, "ja, aber nur bedingungsweise; wenn sich mir einer auf die Hand setzte, versprach ich ihn dir mitzubringen."
"Ausflüchte. Aber natürlich seitdem Don Alonzo ein berühmter Mann geworden ist, ist er zu vornehm, seiner Schwester einen Schmetterling zu fangen."
"Talent habe ich dazu wirklich nicht, Elvira, aber ich will die Büchse nehmen und dir einen schießen."
"Sieht dir ähnlich, berühmter Krieger. Nein, ich bestehe darauf, daß du mir einige der blauen Falter fängst und wohlbehalten hierherbringst, wohlbehalten, verstehst du? Emilia Hormito hat mich darum gebeten, sie will ihren Fächer damit schmücken, und du als wohlerzogener Caballero wirst den Wunsch zweier Damen erfüllen."
"Du bist eine Tyrannin, mein liebes Schwesterchen."
"Nein, ich verlange nur, was ein guter Bruder zu tun schuldig ist."
"Gut, sei es wie du sagst, ich werde den Schmetterlingsjäger spielen, hoffentlich ist mir das Glück hold."
"So lasse ich es mir gefallen."
"Höre, Alonzo," fuhr sie nach einer Weile fort, "schaffe doch diesen greulichen Menschen, diesen Molino hinweg, mir graust, wenn ich dieses widerlich lächelnde Gesicht sehe."
"Dein Vater würde es für einen Flecken auf der Ehre seines Hauses halten, wenn Otoño selbst diesem seltsamen Herrn nicht alle Gastfreundschaft gewährte. Er ist übrigens nicht nur dir, er ist uns allen zuwider. Hoffentlich setzt er seinen Stab bald weiter - und sollte er damit zögern, werde ich ihm einen Wink geben."
"Nein, Alonzo, das darfst du nicht."
"O, er soll so zart, so gewählt und nur ihm verständlich sein, daß kein Caballero etwas dagegen einwenden kann."
In Alonzo stiegen mit den Erinnerungen an den Mann mit dem blaugestreiften Poncho auch die an das Tal der drei Quellen und das tragische Geschick der Seinen auf und seine Miene wurde finster.
"O, Alonzo, da machst du wieder dein böses Gesicht; ich fürchte mich vor dir."
"Du kennst das Geschick meines Lebens, Schwester, und darfst dich nicht wundern, daß ich ernst aussehe, wenn mir die Vergangenheit durch den Sinn zieht, und dieser Pseudocaballero, der sich hier herumtreibt, kein Mensch weiß warum, ruft sie mir zurück."
"O, bringst du diesen Menschen damit in Verbindung?" fragte sie erschreckt.
"Nur mittelbar."
"Ich habe aus den Andeutungen von Vater und Onkel gut genug verstanden, daß Alonzo d'Alcantara von Gefahren bedroht ist, die dem einfachen Vivanda erspart blieben - ist dieser Mensch vielleicht ein Spion - ist er gefährlich?" fragte sie ahnungsvoll.
"Gefährlich? Nein," erwiderte Alonzo mit verächtlichem Lächeln, "dieser Mann ist nicht gefährlich."
Nach einer Weile sagte Elvira, die auch ernst geworden war: "Aber du gehst nach Bogotá, wie ich höre."
"Sobald meine lieben Väter, die für mich und meine Zukunft denken, es für an der Zeit halten, ja, doch noch ist nichts bestimmt darüber."
"Doch dort," und ihr zartes Gesicht sah ängstlich und sorgenvoll aus, "bedrohen dich noch größere Gefahren als hier, Alonzo."
"Größere als die ich bereits überstanden habe? Ich glaube kaum. Übrigens, ich muß gehen - und -"
"Da machst du schon wieder ein Gesicht, das alle Menschen erschreckt."
"Ich gehe nach Bogotá, wenn die Zeit dazu gekommen ist, ich gehe in einer besonderen Mission, zu der ich ausersehen bin. Gefahren? Ich gehe als Richter, das Verbrechen zu strafen und die Strafe wird vollstreckt werden."
Er stand hoch aufgerichtet, und das schöne ausdrucksvolle Gesicht zeigte eine wilde Energie.
Sie kannte den stolzen, entschlossenen Zug, der in diesem Jünglingsantlitz erscheinen konnte, aber noch nie hatte sie ihn mit diesem Furcht einflösenden Ernst gepaart gesehen.
Das zarte Mädchen bebte.
Er gewahrte es und seine Miene wurde sanft.
"Verzeihe, Schwesterchen, wenn ich dir von Dingen spreche, die dir fern bleiben sollten - doch wird der Zorn öfters lebendig in mir, jetzt, wo die Stunde naht, die begangenes Unrecht sühnen soll."
"Du bist furchtbar, Alonzo, wenn du so zornig blickst, und ich zittere nicht allein vor dir, sondern auch für dich."
Mit einem liebenswürdigen Lächeln in dem Antlitz, das eben noch tödlichen Zorn widerspiegelte, sagte er: "Du weißt, Hermana, daß ich für dich nur Sonnenschein in meinem Herzen habe, nimm es hin, wenn auch einmal eine Wolke über die Stirne zieht."
"Ich weiß ja, wie gut du bist, Alonzo."
"Und damit du siehst, wie gut ich bin, und wie gehorsam der kleinen Tyrannin von Otoño, will ich dir auch einen der blauen Falter fangen. Bist du nun zufrieden?"
"Wie liebevoll du nun bist. Ich bin immer zufrieden, wenn du recht froh aussiehst. Und was die Tyrannin betrifft, so werde ich mich bei Papa über dich beschweren."
"Der ist kein unparteiischer Richter."
"Dann beim Onkel Cura."
"Der ist es erst recht nicht."
"So? Dann bist du wohl die einzige Instanz?"
"Ja, Hermana, die einzige."
"Nun warte, dann will ich dich wirklich tyrannisieren."
"Ich gebe mich bereitwillig zum Opfer hin."
Sie sah in Alonzos jetzt so freundliches Gesicht und lachte und der Jüngling lachte mit.
In einiger Entfernung erschien ein Peon mit Alonzos gesatteltem Pferde.
"Willst du reiten, Alonzo? Jetzt bei der Hitze?"
"Nur ein wenig die Felder abreiten, um zu sehen, ob alles an der Arbeit ist. Zwei von den Aufsehern sind krank und der Administrator kann nicht überall sein, also, wenn dein Vater sich erhebt, sage ihm, ich sei schon ausgeritten; mich ficht die Sonne der Llanos nicht an."
Elvira, welche wohl wußte, daß Alonzo ihrem Vater eine in der Hitze beschwerliche Mühe abnehmen wollte, nickte ihm freundlich zu und sagte: "So reite, aber erhitze dich nicht, und kommst du zurück, sollst du Limonade von meiner Hand zubereitet finden."
"Für diesen Preis tue ich alles. Ich bin bald zurück."
Er schwang sich in den Sattel und ritt davon.
Das bebaute Land von Otoño war sehr ausgedehnt, zwischen den Feldern erhoben sich überall kleine Gehölze, die den Umblick hemmten.
Alonzo ritt an den weit vom Hause abgelegenen, sich endlos ausdehnenden Tabakfeldern entlang, die völlig einsam dalagen, als sein scharfes Jägerauge gewahrte, daß die Wipfel einiger Stauden sich bewegten; er glaubte, ein Tier werde dort aufgescheucht - aber schon erhoben sich zwischen den Blättern der Kopf eines Mannes und die Mündung einer Büchse, die sich nach ihm zu senkte. Alonzo war so überrascht, daß er statt sich niederzubeugen oder sich aus dem Sattel zu werfen, regungslos saß - schon blitzte aber dort etwas Metallisches im Sonnenglanze auf, Kopf und Büchse verschwanden, ein dumpfes Stöhnen ward hörbar, und stärker bewegten sich die Tabakstauden. Dann war es still.
Das vollzog sich mit einer Schnelligkeit, die den Reiter kaum zur Besinnung kommen ließ. Jetzt aber zog Alonzo eine Pistole aus dem Sattelhalfter, die er seit einiger Zeit auf Wunsch Don Vincentes mit sich führte, und sprengte auf das Tabakfeld los.
Da trat ruhig Maxtla zwischen den Stauden hervor und wischte kaltblütig mit einem Tabakblatte Blut von seiner Machete. Alonzo erkannte den Diener Tejadas.
"Was machst du da? Was geschah da?"
"Er wollen Don Pedros Sohn erschießen - ich nicht dulden, er ganz tot."
Alonzo hatte den Kopf und die Büchsenmündung gesehen in weniger als fünfzig Schritt Entfernung. Ein Schuß aus solcher Nähe war sicherer Tod. Er hatte auch die emporblitzende Machete gesehen, die den Schuß verhinderte. Wie kam der Mann vor ihm dazu?
"Wer bist du?" fragte Alonzo, trotz seiner innerlichen Erregung, ruhig.
Mit einem Lächeln, das dem braunen Gesicht des Indianers sonst ganz fremd war, und einem hellen freundlichen Blick der dunklen Augen, sagte er: "Sennorito kennen wohl noch das Lied des Arieros, aber nicht mehr ihn selbst. Maxtla nie dulden, daß Don Pedros Sohn ein Leid widerfährt."
"Warst du der unbekannte Warner in Naëva?"
"Ja, ihn warnen."
"Und du bist der Maultiertreiber, der mich als Kind oft auf seinen Tieren reiten ließ; der dann mit meinem Vater in den Krieg ging?"
Vergnügt nickte Maxtla: "Ja, ihm selbst."
"Wer war es, der mir nach dem Leben strebte?"
"Ein Caballero aus Bogotá, ein Freund von Sennor de Valla. Ihn sehen, ihn kennen, er böser Mensch. Er glauben sehr klug, Maxtla Chibchakrieger aus den Bergen, er klüger, schleichen ihm nach - verhindern ihn, Sennorito zu töten."
"Weißt du seinen Namen?"
"Er, Don Ignacio de Caldas, kennen ihn gut."
"Und er ist tot?"
"Er ganz tot, Maxtla braucht die Machete nur einmal."
Alonzo betrat schweigend das Tabakfeld und stand bald darauf vor der Leiche des jungen Mannes, neben der die noch gespannte Büchse am Boden lag. Er warf einen Blick auf das Gesicht des Toten und ging in tiefem Ernste davon.
Der Todesengel war nah an ihm vorbeigeschritten.
"Du hast mir das Leben gerettet, Maxtla."
Der Indio nickte.
"Das gern tun."
"So nimmst du also teil an mir?"

Alonzo betrat das Tabakfeld.
Mit einem tiefen Ernste sagte Maxtla: "Ich Chibcha aus den Bergen, Sennor, nie vergessen, nicht Gutes, nicht Böses. Don Pedro gut gegen armen Indio, er ihn machen gesund als er krank, er ihm retten Leben im Krieg - nie vergessen. Maxtla armer Indio, aber geben gern Leben für Sennorito d'Alcantara."
Alonzo fühlte, wie der braune Mann, den die eben vollzogene Vernichtung eines Menschenlebens vollständig gleichgültig ließ, aus der Tiefe des Herzens sprach und das rührte ihn. Er reichte ihm die Hand und sagte: "Maxtla, ich danke dir." Begierig ergriff der rote Mann die Hand des Jünglings.
"Du bist der Peon dieses Sennor Molino?"
"Ja, aber er nicht Molino, er anders heißen, er Tejada, er Bandido. Ich ihm nachgeschickt, ich gern gegangen, um zu hüten d'Alcantaras Leben."
"Komm, setz dich zu mir, Maxtla," - beide ließen sich im Schatten einer Banane nieder, - "und nun erzähle mir, was du weißt, und sprich deine Muttersprache, ich verstehe sie."
Und nun hob der Indianer, der beredt wurde, als er im Chibcha reden konnte, an zu erzählen, wie er als Jüngling von den Bergen ins Land hinabgestiegen sei, um als Maultiertreiber sein Brot zu verdienen. Wie Don Pedro den an der Straße krank niedergesunkenen Menschen einigen Leuten zur Pflege übergeben und dafür bezahlt hatte. Wie er öfters als junger Maultiertreiber nach Bogotá gekommen und dankbar das Haus seines Wohltäters besucht und ihm, als der Krieg begann, willig ins Feld gefolgt sei.
Im Gefecht hatte ihm der Capitano das Leben gerettet, und seit jener Stunde gehörte dieses Leben Pedro d'Alcantara und den Seinen.
"O, junger Adler, ich weiß nicht, warum die Blancos miteinander streiten, und es ist mir gleichgültig. Ich war im Norden bei meinem Regimente, als Don Pedro nach Süden ging und mit den Seinen den Tod fand. Hätte ich gewußt, daß der junge Adler der Alcantaras bei den Aimaràs weile, ich hätte ihn längst aus ihrer Mitte geholt, aber ich wußte es nicht. Ich kam nach Bogotá zurück, suchte das Haus auf, in dem sie gewohnt hatten, die gut gegen den Indio gewesen waren, und blieb dort als Peon und Bote. Ich sah die Sennora, die kleinen Sennoritos und Sennoritas durch das Haus wandeln, wenn ich still in meiner Ecke saß, und hörte ihre Stimmen. Ich hatte sie lieb gehabt. Dein Oheim mußte fortgehen, und Sennor de Valla kam, ich blieb auch bei ihm, denn ich wollte im Hause der Alcantaras weilen. Die Leute sprachen schlecht von de Valla, Weiße und Rote, und manche flüsterten, daß seine Hand im Tale der drei Quellen fühlbar gewesen sei. Da blieb ich erst recht, denn sprachen sie wahr, mußte de Valla von Maxtlas Hand sterben."
Dann berichtete er weiter, wie er durch den Minister zuerst vernommen, daß ein Sohn Don Pedros lebe und wie dieser ihn Tejada und mit welchem Auftrag nachgeschickt habe. In Naëva hatte er alsbald den Sohn seines Capitanos erkannt.
"Ich sehe, Maxtla, daß mein Vater in dir einen dankbaren Freund gewonnen hat."
Auf seine Frage, ob der Indianer glaube, daß Tejada hinter diesem Mordanfall stecke und der Tote im Einverständnis mit ihm gehandelt habe, verneinte Maxtla dieses. Seine Ansicht ging dahin, daß Caldas ein ohne Wissen Tejadas abgesandter Mörder sei, der ganz unabhängig von diesem gehandelt habe. Er machte Alonzo auch Mitteilung von dem Neger und dem Boote auf dem Ocoa.
"Und würdest du mit Sennor Tejada umgegangen sein wie mit dem, der dort liegt, wenn er die Hand gegen mich erhoben hätte?"
Ein grimmiges Lächeln erschien in des Indianers Gesicht.
"Der Coyote war Lugarteniente unter deinem Vater und hat Maxtla geschlagen. Ein Chibcha vergißt das nicht, aber Don Pedro hatte Tejada als Spieler und Dieb schon fortgejagt aus dem Lager, ehe ich die Beleidigung sühnen konnte, und nach zehn Sommern sah ich ihn zuerst wieder im Hause der Deinen in Bogotá."
"Dies alles muß sofort Don Vincente erfahren. Ich reite voraus, Maxtla, komm mir nach."
Er rief sein Pferd und sprengte den Wohngebäuden zu. Er traf den alten Herrn in seinem Arbeitszimmer zugleich mit dem Cura und machte seinen väterlichen Freunden Mitteilung von dem, was geschehen und was er von Maxtla vernommen hatte.
Auch sagte er ihnen jetzt, daß er Tejada, genannt Molino, für den Mörder des Gomez halte.
Die beiden Herren waren nicht wenig erschreckt und erschüttert über einen grauenvollen Vorgang, der das Leben des Jünglings so nahe bedroht hatte. Da niemand das, was im hohen Tabakfelde sich abspielte, gesehen hatte, beschloß man, über den Vorfall und besonders Elvira gegenüber zu schweigen.
"Wenn du aber," sagte Don Vincente, "diesen Menschen, diesen Tejada in einem solchen Verdacht hattest, Alonzo, warum sagtest du das nicht?"
"Ich hatte keine Beweise, den blaugestreiften Poncho tragen noch mehr Leute, und du weißt, mein Vater," fügte er lächelnd hinzu, - "Indianer sprechen nur, wenn sie müssen - doch war ich vor dem Menschen auf der Hut."
"Er ist ein feiger, erbärmlicher Mensch, doch auch ein solcher trifft aus dem Hinterhalte. Er könnte den Mörder nach dir aussenden."
"Wo sollte er hier eine Hand gegen mich bewaffnen können?"
Nicht wenig überrascht war man auch von der Entdeckung, daß der schweigsame Indio eine so tiefe Dankbarkeit an Don Pedro und eine solche Anhänglichkeit an Alonzo besaß.
- - - - - - - - - - -
Maxtla saß wie gewöhnlich in der Nähe der Ställe und rauchte, wenn ihn sein Dienst nicht zwang, seinem Herrn zu folgen, als Tejada heranritt.
Der Indio erhob sich, um diesem das Pferd abzunehmen.
"Sattle dein Mulo und hole dann meinen Mantelsack, wir werden Otoño verlassen."
Maxtla gab zu erkennen, daß er verstanden hatte.
Tejada fragte, ob Don Vincente zu sprechen sei, und stand gleich darauf vor den beiden alten Herren, denen Alonzo zur Seite stand.
Er stutzte über den ernsten Ausdruck der Gesichter, sagte aber doch mit seiner gewöhnlichen unverschämten Vertraulichkeit: "Ich habe die Gastfreundschaft dieses Hauses doch schon zu lange in Anspruch genommen, meine sehr verehrten Freunde. Rasch von Entschluß, wie ich bin, habe ich mir vorgenommen, noch heute Otoño zu verlassen. Ich komme, Ihnen meinen herzinnigsten Dank zu sagen und mich zu verabschieden."
"Haben Sie eine besondere Veranlassung, so rasch aufzubrechen?" fragte Don Vincente ernst.
Der Bandit stutzte.
"Wie meinen Sennor das?"
"Sollte man es vielleicht an der schuldigen Aufmerksamkeit gegen Sie fehlen haben lassen?"
"O, keineswegs - im Gegenteil, Otoños Gastfreundschaft wird ewig in meinem dankbaren Herzen leben - aber Sie müssen mir verzeihen, es steckt immer noch etwas vom Soldaten in mir - ich bin zu dem Entschluß gekommen, das Land weiter nördlich auf meine Zwecke hin zu untersuchen."
Die beiden Vivandas neigten ernst das Haupt und sahen die dargebotene Hand Tejadas nicht.
"Gib unserem Gast das Geleite, Alonzo."
"Sennores, nochmals meinen besten Dank und meine Empfehlung an Donna Elvira."
Tejada verbeugte sich und ging innerlich unruhig über diese Verabschiedung hinaus, gefolgt von Alonzo, der sein "indianisches Gesicht", wie seine Freunde seine undurchdringliche Miene nannten, aufgesetzt hatte.
"Ich komme gleich," sagte Tejada draußen, "ich will nur noch einen Blick in mein Zimmer werfen, um zu sehen, ob mein Peon nichts vergessen hat."
Damit schritt er in den Korridor.
Alonzo ging hinaus.
Da stand Maxtla mit Tejadas Pferd und seinem Maultier.
Alonzo stellte sich mit dem Rücken nach dem Indianer hin und fragte leise in der Chibchasprache: "Hörst du mich?"
"Ich höre," erwiderte Maxtla ebenso leise und nach einer anderen Richtung blickend.
"Wirst du ihn begleiten?"
"Ich muß ihn überwachen, damit er nicht Unheil stiftet, aber ich kehre zu dir zurück."
"Es ist gut."
Schon kam Tejada aus dem Hause und schritt auf sein Pferd los.
"So muß ich auch von dem Sohne meines alten teueren Kriegsgefährten scheiden, doch ich hoffe auf ein glückliches Wiedersehen in Bogotá."
Mit seinem ernsten Gesicht sagte Alonzo: "Empfehlen Sie mich jedenfalls Ihrem Freunde Sennor Tejada, und sagen Sie ihm, daß ich selten mit der Büchse fehle, wie im Tale der drei Quellen vor fünf Jahren."
Der Bandit wurde fahl im Gesichte bei diesen Worten und griff unwillkürlich nach dem versteckt getragenen Doppelpistol.
"Wie, Sennor - ich verstehe nicht."
"Meine Worte sind auch nur Sennor Tejada verständlich."
Hastig schwang sich Tejada in den Sattel. "Adio, Sennor," murmelte er, und in seinen Augen zeigte sich unverkennbare Angst.
Alonzo zog grüßend den Hut.
Der Bandit sprengte hastig davon, und mit einem seltsamen Lächeln folgte ihm Maxtla.
"Was war das?" murmelte Tejada, dessen Gesicht immer noch fahl war, vor sich hin. "Wahrhaftig, da war ich in die Höhle eines Kuguar geraten. Woher weiß der junge Mensch, wer ich bin, was weiß er von dem Tale der drei Quellen? Wer mag hier geschwatzt haben? Man kennt mich hier? Hat dieser Picaro den Schuß damals abgefeuert? Gut, daß ich aus dieser Nachbarschaft fortkomme, das ist unheimlich. Nun, lange, Bursche, wirst du es nicht mehr treiben, wenn der Mann von der Pirateninsel sein Wort hält."
Er ritt so rasch, daß Maxtla auf seinem Maultiere ihm kaum folgen konnte.
Bald nach Dunkelwerden erreichten sie die Posada, in der sie, ehe sie nach Otoño gingen, Aufenthalt genommen hatten, und blieben da die Nacht.
- - - - - - - - - - -
Auf Otoño beriet man ernst, ob man versuchen sollte, des Negers, der auf Caldas wartete, habhaft zu werden, obgleich das bei der früh in jenen Gegenden hereinbrechenden Nacht schwierig sein mußte, und wie man den Leichnam des Erschlagenen still in die Erde senkte.
Alonzo erbot sich, seiner kühnen Natur entsprechend, den Neger zu fangen.
"Es ist zu gefährlich, Kind."
Alonzo lachte.
"Glaubst du, daß noch mehr Bandidos in den Feldern lauern? Tejada ist fort und Maxtla hinter ihm. Ich kenne den Wald und den Pfad nach dem Ocoa und will den Schwarzen vor meiner Büchse haben, ehe er es ahnt. Habe ich umsonst zwischen den schleichenden Kriegern der Wildnis gelebt?"
Die beiden Vivandas kannten die Klugheit ihres Schützlings, seine Vorsicht und seinen Mut, und es war nicht unwichtig, den Neger in die Gewalt zu bekommen.
"Nimm einige von unseren besten Leuten mit, Alonzo."
"Ja, ich will einige mitnehmen."
Nun stimmten die beiden alten Herren zu.
Alonzo rief drei der Indios an, befahl ihnen, sich vom Majordomo Büchsen geben zu lassen, nahm selbst seine Büchse und den Lasso, und alle vier ritten dem Waldsaum zu. An der Mündung des Pfades angelangt, sagte Alonzo seinen Begleitern, daß es darauf ankomme, einen spitzbübischen Neger auf dem Flusse zu fangen und befahl ihnen, ihm in hundert Schritt Entfernung zu folgen. Er wollte den Neger beschleichen und fürchtete das Geräusch, das die Indianer, die nicht gewohnt waren, sich im Walde anzupirschen, machen würden. Er mußte lautlos am Ufer ankommen und den Neger, ihn überraschend, vor der Büchse haben, ehe dieser das offene Wasser gewinnen konnte. Dann konnten seine Begleiter ihn binden und fortführen.
Man band die Pferde an, und Alonzo schritt leichten Fußes in das Dunkel des Waldes, geräuschlos, alle Sinne wach; der wilde Krieger war in ihm lebendig.
Eben wollten seine Leute ihm nachgehen, was des schmalen Pfades wegen hintereinander geschehen mußte, als dumpf der Hall eines Büchsenschusses an ihr Ohr schlug - einen Hilferuf glaubten sie zu vernehmen - erschreckt standen sie still. Aber nur einen Augenblick. Die Leute waren mutig und liebten ihren Sennorito.
"Vorwärts - es gilt Don Alonzo - vorwärts!" und in Eile drängten sie rücksichtslos vor, die Büchsen, die sie zu brauchen verstanden, in der Hand.
Das Schweigen des Waldes umgab sie bei ihrem eiligen Vormarsch, kein Laut außer dem Zwitschern eines Vogels war hörbar. Sie gelangten an das Schilf - vorsichtig gingen sie gebückt hindurch dem Wasser zu - endlich hatten sie die Wasserfläche vor sich. Kein Boot, kein Neger war zu sehen, nichts von dem jungen Herrn zu gewahren.
In heller Verzweiflung sahen sich die armen Menschen an.
"O, Don Alonzo!" stöhnte der eine.
"O, was wird Sennor sagen?"
Sie riefen laut, auf jede Gefahr hin - nichts antwortete - sie gingen in den Wald rechts und links von dem Pfade, suchten und schrieen sich heiser. Aber schon kam die Nacht, und trostlos schritten die Leute, die auf Otoño aufgewachsen waren, zurück. Als sie an den Waldsaum kamen, wieherte im Walde ein Pferd, und einer der drei Männer ging dem Laut nach und brachte Caldas Roß mit sich.
Schon lag auch die Nacht auf den Llanos.
Langsam, zum Tode traurig ritten sie zur Hacienda zurück, das Roß Alonzos und das des Erschlagenen mit sich führend.
Mit maßlosem Entsetzen lauschten die beiden alten Herren ihrem Berichte.
Der Cura, der den Jüngling wie seinen Sohn liebte, kniete nieder und betete in tiefem Jammer.
Don Vincente, der sich zuerst faßte, trotzdem auch er ungemein litt, schien es klar, daß der Mörder, den sein Schicksal so jäh erreicht, nicht allein gewesen sei. Die Feinde Alonzos mußten auf dem Rücken des einsam strömenden Ocoa gekommen sein, wie auch Caldas augenscheinlich diesen Weg gekommen und sich das Pferd irgendwo am Ufer verschafft hatte.
"Geh zu Elvira, Bruder, und bereite sie vor, ich will das Land und die Flußufer alarmieren," sagte er.
Während der tiefgebeugte Priester seine Nichte aufsuchte, ließ Don Vincente die Glocke läuten, deren Ton die Arbeiter nach den Herrschaftsgebäuden rief, und die Fanale entzünden, die die Vaqueros von den Llanos herbeiführten.
Während der Cura die in ihrem tiefen Schmerz tränenlose Elvira zu trösten versuchte, er, der selbst des Trostes bedurfte, kamen die Arbeiter zusammen. Der Majordomo hatte Pferde und Maultiere bereit gestellt. Schon nahten auch die Vaqueros, die in der Nähe ihre Herden geweidet hatten.
Don Vincente trat zwischen sie und teilte ihnen mit, Don Alonzo sei verschwunden, getötet oder fortgeführt worden.
Ein dumpfer Laut des Schreckens erhob sich unter den dicht um ihren Herrn gedrängten Leuten.
Er sagte ihnen dann von dem Mordversuche des Tages, ohne Maxtla dabei zu erwähnen, und daß die Mörder den Ocoa heraufgekommen sein müßten. Daß es jetzt gelte, das Schicksal des Jünglings aufzuklären und die Spuren der Verbrecher zu finden.
Ein Teil der berittenen Leute wurde den Fluß entlang geschickt, um überall auf jeder Hacienda, bei jedem Flußübergang das Verschwinden Alonzos zu verkünden und die Bevölkerung auf Flußpiraten aufmerksam zu machen. Die andere Hälfte wurde mit dem gleichen Auftrage in die Llanos geschickt, um auch hier die Bevölkerung zur Wachsamkeit und zum Beistand aufzurufen. Der Gedanke, daß der so plötzlich abgereiste Tejada mit dieser Gewalttat in Verbindung stehe, lag nahe. Don Vincente, der für einen ausgedehnten Distrikt polizeiliche Obergewalt hatte, fertigte einen Verhaftbefehl für ihn aus und sandte den Majordomo, einen entschlossenen Mann, dem Abgereisten mit einigen sicheren Leuten nach, ihm dabei mitteilend, wie Maxtla zu diesem und zu Don Alonzo stehe, und daß der Jüngling nur dem Indianer das Leben verdanke.
Auch der Majordomo sprengte in die Nacht hinein.
Kaum war die Sonne aufgegangen, so war Don Vincente mit einigen seiner Leute bereits selbst im Uferwalde, um nach Spuren Alonzos zu suchen, geängstigt von der schreckensvollen Vorstellung, seinen Leichnam zu finden.
Auch diese Nachforschung verlief in dem dicht von Schlingpflanzen und Stechpalmen häufig undurchdringlich gemachten Wald resultatlos.
Nichts ward gefunden.
- - - - - - - - - - -
Don Sancho Tejada war unruhiger, als es den Anschein hatte. Die mit Alonzo gewechselten Worte hatten ihn sehr verstimmt. Schien es ihm darum wünschenswert, möglichst rasch einen größeren Zwischenraum zwischen Otoño und seine werte Person zu legen, so hielt die Begierde, das Resultat von des verfolgten Piraten Tätigkeit kennen zu lernen, ihn wiederum in dessen Nähe gebannt, um hoffentlich gute Nachrichten zu empfangen und in aller Eile nach Bogotá bringen zu können.
Daß der Mann mit seinen Leuten ohne besondere Schwierigkeiten das finstere Werk auszuführen vermöge, daran zweifelte er nicht, obgleich dieser d'Alcantara ein äußerst gefährlicher Bursche war.
Die Posada lag nicht übel, um Neuigkeiten von Otoño zu erfahren, und Don Sancho hätte gern dort länger geweilt, wenn nur sein Name und wer weiß was noch nicht auf der Hacienda bekannt gewesen wären - das war ihm sehr unangenehm.
Er beeilte seine Abreise trotzdem nicht, so ungern verließ er den Schauplatz seiner Tätigkeit. Eben war er im Begriff, sich in den Sattel zu schwingen und sich von dem Posadero zu verabschieden, als in vollem Rosseslaufe ein junger Llanero herbeijagte.
"O, Don Jaquino," schrie er dem Posadero zu, während er sein vom rasenden Laufe zitterndes Pferd anhielt, "o, welches Unglück, welches Unglück für uns alle!"
Der Posadero, Tejada und Maxtla horchten auf und aus dem Hause traten Frau und Tochter des Wirtes und einer seiner indianischen Diener.
"Was ist geschehen?"
"Don Alonzo ist ermordet!"
"Don Alonzo?!" schrieen alle auf, mit Ausnahme von Maxtla, dessen Augen unter dem schattenden Hute gleich glühenden Kohlen leuchteten.
"Don Alonzo, der junge Alcantara von Otoño?"
"Ja, ja, ermordet. Die Peons und Vaqueros Sennor Vivandas jagen durchs Land und verkünden es; ich hörte es und bin davongejagt, es weiter zu sagen."
"Nun," sagte Tejada, "es wäre schrecklich, Mann, wenn du die Wahrheit sagtest; wann ist das geschehen, ich komme von Otoño und habe mich erst gestern mittag von Don Alonzo verabschiedet."
"Gestern abend - sie haben ihn gräßlich ermordet."
Tejada wurde jetzt in solcher Nähe der Hacienda unheimlich zu Mute. Daß der Verbündete der Flußpiraten sich so rasch seines Auftrages entledigen werde, hatte er nicht gedacht - doch sagte er mit vieler Ruhe: "Ja, das ist ein großes Unglück für alle, besonders für meine werten Freunde Vivanda. O, wie bedaure ich, daß mich ernste Pflichten nach Bogotá zurückrufen. Weiß man nichts Näheres über dieses schreckliche Verbrechen? Ist es vielleicht ein Racheakt der Leute der Hacienda?"
"Wo denkt Ihr hin, Sennor? Die waren Don Alonzo alle auf Tod und Leben ergeben."
"Wie gern würde ich nach Otoño umkehren, aber die Interessen des Staates gehen jedem persönlichen Interesse vor - wie leid tun mir seine sorgsamen Pflegeväter."
Er verabschiedete sich von dem Posadero und ritt langsam, gefolgt von Maxtla, davon, um erst in einiger Entfernung seinem Pferde die Sporen zu geben.
"So, Don Carlos, jetzt bist du mir fünftausend Pesos schuldig," murmelte er vor sich hin.
Hätte er einen Blick auf das düstere Gesicht seines Peons geworfen, dessen Blicke mit einem Ausdruck furchtbaren Hasses auf ihn ruhten, würde er sich weniger rosigen Zukunftshoffnungen hingegeben haben.
In des Indianers Seele wogte es heftig. Er zweifelte nicht an der Kunde, die der Llanero gebracht und machte sich bittere Vorwürfe. Er hatte Tejada während ihres Aufenthaltes mehrmals außer acht gelassen, wenn dieser die Umgebung durchritt und seine Wachsamkeit auf Alonzo beschränkt.
Sollte der verworfene Caldas, der vielleicht von Bogotá geflüchtet war, ihm auf einem dieser Ritte in den Weg gekommen und doch von ihm für das Verbrechen gewonnen worden sein?
Es war schwer denkbar.
Näher lag es, daß dieser ein Sendling von Bogotá war. Hatte de Valla außer diesem noch einen Bandido auf dem Wege gehabt?
So wogten seine Gedanken hin und her. Er wäre bei der ersten Kunde von Alonzos Geschick sofort nach Otoño umgekehrt, um sich auf die Spur der Mörder zu setzen, wenn er nicht in dem vor ihm reitenden Manne den Mitschuldigen vermutet hätte, von dem Aufschlüsse über die Tat zu erlangen waren.
Der Weg, den sie ritten, war einsam.
Einige Gehölze grenzten den Horizont an verschiedenen Stellen ein und Maxtla wußte, daß auf Leguas weit kein Haus sich erhob.
Er löste den Lasso vom Sattel seines Tieres und legte ihn bereit zum Wurfe.
Tejada, der Gewissensbisse nicht kannte und dem immer behaglicher zu Mute wurde, je weiter er sich aus der gefährlichen Nähe Otoños, wo seine Maske durchschaut war, entfernte, lächelte selbstzufrieden vor sich hin, als ein mit großer Sicherheit geschleuderter Lasso ihn umschlang und ein kräftiger Ruck ihn aus dem Sattel auf den Boden brachte, den er recht unsanft berührte.
Betäubt von der jähen Unterbrechung seiner Zukunftsträume, wie von dem jähen Sturz lag er, kaum seiner Sinne mächtig, da. Der Lasso schnürte ihm die Arme an den Leib. Die Augen öffnend sah er mit ebensoviel Staunen als Schreck Maxtlas drohendes Gesicht über sich gebeugt und die blinkende Machete in dessen Hand, deren Spitze seiner Kehle sehr nahe war. Mit ungemeiner Geschicklichkeit nahm Maxtlas linke Hand das Doppelpistol aus Tejadas Tasche, das Messer aus dessen Gürtel und warf beides fort, dann band er des verblüfften Mannes Hände.
Erst jetzt fand der Bandit, den der Lasso noch immer hielt, Worte: "Was tust du, Juan, willst du mich berauben? Ich will dir alles geben, was du haben willst, binde mich nur los."
"Maxtla ist kein Dieb," erwiderte finster der Indianer.
"Was habe ich dir getan? Willst du mich ermorden?" fragte zitternd Tejada.
"Nicht jetzt. Der Sargento wird den Teniente, der ihn vor den Soldados schlug, später töten."
Tejada wußte nicht, was er aus dem Benehmen und den Worten des Indianers, der ihn so unvermutet überfallen, schließen sollte, denn daß er vor Jahren einmal, während er als Offizier unter d'Alcantara diente, einen indianischen Sargento geschlagen vor den Augen der Soldaten, hatte er längst vergessen, wie auch das Gesicht Maxtlas.
Ihm kam der Gedanke, der Mann sein geistesgestört.
"Ich verstehe dich nicht, Juan, was willst du?"
"Don Sancho wird noch alles verstehen. Er ist von Excellenza ausgeschickt, um Don Alonzo zu töten, und Maxtla, um Don Sancho die Machete durch die Kehle zu ziehen."
Der gebundene Bandit sah ihn mit namenlosem Entsetzen an.

Vom Lasso umschlungen, sank Tejada aus dem Sattel.
Hatte er in dem stumpfsinnigen Indio den Henker vor sich, den ihm de Valla nachgesandt, um ihn hinwegzuräumen nach geschehener Tat? Nein, das war zu ungeheuerlich - und doch? - Kaltblütig untersuchte jetzt Maxtla Tejadas Taschen, nahm eine dicke Brieftasche und einen Beutel mit Geld und steckte beides in seine Ledertasche. Der Indianer hätte Tejada am liebsten gleich an der Posada verhaftet, aber kannte seine rechtlose Stellung einem Weißen gegenüber, kannte das Mundwerk Tejadas und mußte fürchten, daß man dort die Partei des Caballero ergreifen würde; so hatte er gewartet, bis er mit ihm allein war.
Er holte jetzt Tejadas Pferd herbei, befahl ihm aufzusteigen und half ihm in den Sattel, nachdem er ihn vom Lasso befreit hatte. Dann band er ihm die Füße unter dem Bauche des Pferdes zusammen.
Tejada, der einsah, daß es nicht auf seine augenblickliche Ermordung abgesehen war, schöpfte neuen Mut.
Maxtla legte seinen Lasso um des Pferdes Hals, bestieg sein Maultier und wandte dessen Kopf der Posada zu.
"Wo führst du mich hin?"
"Ihr alles erfahren, Galgen hier wie in Bogotá."
Das Pferd an der Fangschnur, das dieser ängstlich folgte, galoppierte er jetzt auf dem Wege zurück, den sie gekommen waren.
Tejada, der in seinem wüsten Leben schon in mancher dringenden Gefahr gewesen war, gewann Zeit zur Überlegung, auch hoffte er auf eine baldige Begegnung mit Weißen. Wer war dieser Indio, und was wollte er mit ihm beginnen? Wessen konnte man ihn überhaupt beschuldigen? Daß er Tejada sei, mußte noch bewiesen werden. Alonzo, der davon wußte, war tot und dieser Indio war als Zeuge belanglos. Hätte der ihn in die Wüste geführt, stand es schlimm um sein Leben, aber er führte ihn bewohnten Stätten zu. Die Frechheit Tejadas gewann wieder die Oberhand, was wollte man gegen ihn vorbringen?
Nach kurzer Zeit sahen sie Reiter sich entgegenkommen, es war der Majordomo von Otoño mit drei Vaqueros.
"O, du hast ihn schon, mein braver Indio," rief er Maxtla entgegen und hielt gleich darauf vor den beiden.
"Ah, welch ein Glück, daß Sie kommen, Sennor," sagte Tejada zungengewandt, "dieser Mensch hat mich heimtückisch auf dem Wege überfallen und mich beraubt. Ich stelle mich unter Ihrem Schutz, lassen Sie mich rasch losbinden."
"Später, Sennor. Ich habe da einen Haftbefehl auf Sancho Tejada, genannt Molino, ausgestellt von dem Alkalden dieses Territorio, verdächtig des Mordes an Don Alonzo d'Alcantara, den wollen wir erst vollstrecken. Ich verhafte Euch im Namen des Gesetzes!"
"Don Diego, das ist ein ganz greulicher Irrtum. Verhaften Sie lieber diesen Räuber, der mich angefallen hat auf offener Straße."
"Nimm ihn, Majordomo, und bewache ihn wohl," sagte in aller Ruhe Maxtla, "er ist ein grimmiger Mörder, auf den in Bogotá der Strick wartet. Hier hast du, was ich ihm abgenommen habe," er übergab dem Majordomo die Brieftasche und das Geld, "ich muß fort."
"Wo willst du hin?"
"Nach Otoño - die Mörder Don Alonzos sollen einen Chibchakrieger aus den Bergen noch heute auf ihrer Spur haben, sie sollen sterben wie Caldas, wie jener, der sie ausgesandt."
Damit gab er seinem Maultier die Sporen und jagte davon.
Der Majordomo folgte langsamer mit dem Gefangenen.
Achtzehntes Kapitel.
Die Pirateninsel
Nach langem erschöpfendem Ritte traf Maxtla auf zusammenbrechendem Tiere in Otoño ein und berichtete von Tejadas Gefangennahme. Man machte ihm mit dem bekannt, was man wußte, mit dem, was man getan hatte - keine Spur war von Alonzo gefunden - das Wasser mußte seinen Leichnam bergen.
Der Indio lauschte ernst und sagte dann: "Du, kleines Canoa auf dem Fluß?"
"Ja, da sind mehrere für die Fischer."
"Gut, mir geben. Mörder kommen von Wasser, dort nachsehen."
Der unermüdliche Mann wurde von einem jungen Arbeiter der Hacienda zum Flußufer gebracht, wo ein Canoa indianischer Arbeit lag. Maxtla sandte den Mann zurück, bestieg das Boot und ruderte langsam das Ufer des hier sanft dahinströmenden Flusses entlang nach der Stelle zu, wo der Pfad mündete, an dessen Ausgang der Neger Caldas erwartet hatte.
Mit allen Instinkten des Wilden begabt, war Maxtla in den blutigen Kämpfen der Parteien zu einem unvergleichlichen Krieger nach indianischer Weise geworden.
Während er so langsam dahinruderte, mit funkelnden Augen das Schilf und die Bambusstauden durchforschend, gewahrte er bald eine Stelle, an der ein größeres Boot sich den Weg zum Lande erzwungen haben mußte. Unschwer war das erkennbar.
Maxtla trieb sein leichtes Canoa an derselben Stelle an das Land.
Deutlich waren hier Fußspuren zu sehen, die sich dem weichen Boden tief eingeprägt hatten. Mit großer Vorsicht stieg Maxtla aus und betrachtete die Spuren aufmerksam. Das Schilf, das hier wuchs, war ringsum zerstampft, auch erkannte der Indianer deutlich, daß die Insassen des Bootes sich hier einen Weg durch das Schilf gebahnt hatten, auf dem sie auch wieder zum Wasser zurückgekommen waren.
Maxtla ging diesem Wege vorsichtig nach. Durch Weidengestrüpp gelangte er in hochstämmigen Wald. Hier hatte, das war deutlich zu erkennen, die Machete gearbeitet, um Bahn durch Schlingpflanzen und Unterholz zu brechen.
Maxtla ging den Spuren immer nach. Der Weg führte den Feldern zu.
Nach einiger Zeit traf er auf eine zerstampfte Stelle des Bodens, zerrissene Büsche und Schlingpflanzen.
Er ging weiter und kam auf den Pfad, den Caldas gekommen.
Hier sah er wieder stark zertretenen Boden dicht an dem Pfade.
Er betrat diesen, doch waren die Leute der Hacienda hier so hin und her gelaufen, daß keine Spur mehr zu erkennen war. Er ging auf der anderen Seite in den Wald, doch hier hatte kein Menschenfuß geweilt.
Zurückkehrend gewahrte er eine Stelle, an der fünf Leute ruhig dicht beieinander gestanden hatten und zwar hinter einem dichten Busche von Farnkraut. Unweit davon fand sich die erste Stelle, an der der Boden in so auffälliger Weise zerstampft war.
Maxtla suchte an Blättern und Halmen nach Blutspuren, doch nichts zeigte sich dem Auge.
"Es waren fünf Männer," murmelte der Indianer, "und sie haben dem arglosen Jünglinge einen Lasso oder einen Poncho übergeworfen und ihn dann in die Büsche gezerrt. Er hat sich gewehrt, der Sohn Don Pedros - aber er hatte fünf gegen sich und war machtlos. Hier ist ihm auch die Büchse losgegangen."
Wieder suchte er emsig nach Blutspuren, fand aber auch jetzt keine.
"Sie haben ihn lebend nach dem Flusse geschleppt."
Er ging auch den tiefen Spuren nach. Eine Gruppe Stechpalmen zeigte einige Wollfasern, ein Poncho mußte die Dornen gestreift haben.
Die Fußspuren, die roh und formlos dem Waldboden eingeprägt waren, ließen nur auf die Fußbekleidung schließen, wie sie allgemein von den Leuten der niederen Klassen getragen wurde.
Er gelangte wieder an das Wasser.
"Sie haben ihn lebend in das Boot gebracht."
Sein scharfes und geübtes Auge, das unablässig den Boden und die Umgebung durchforschte, stieß auf eine Stelle dicht am Ufer, die den Abdruck eines Stiefels zeigte, undeutlich, aber unverkennbar eines Stiefels.
Er forschte weiter und fand dessen vollen, deutlich erkennbaren Abdruck. Der Mann mußte im Boote gestanden und nur einen Augenblick das Ufer betreten haben, als man Alonzo brachte.
Der Indianer zischte leise.
"Bei den Unsichtbaren, es ist die Spur des Mannes, dem der Alguacil folgte, der zu den Piratas gehört."
"Sie haben Don Alonzo auf das Wasser geschleppt. Warum? Als Gefangenen? Welchen Wert hatte der Sohn Don Pedros für die Piratas? Um ihn in das Wasser zu versenken und so jede Spur zu verwischen. Armer Jüngling - ich kann dir nur das Totenlied singen. Du wärst groß geworden unter deinem Volke, Sohn Don Pedros. Du gingst zu früh dahin in das Land der Geister."
Er trat in das Canoa und ruderte still und traurig den Fluß hinab bis zu der Stelle, wo es gelegen hatte.
Am Lande blieb er stehen und blickte zur Erde nieder, dann hob er das Haupt empor, und eine eherne Entschlossenheit prägte sich in dem dunklen, von dem straffen schwarzen Haar umrahmten Gesicht aus. "Ich kann dich rächen, Sohn Don Pedros, dich und deinen Vater, der gütig gegen den armen Indio war, und ich will es tun, sie sollen alle sterben oder die Götter meines Volkes sollen mich in die ewige Nacht schleudern."
Er ging zurück und berichtete, was er ermittelt hatte, sprach auch seinen Verdacht aus, daß die Flußpiraten hier verderbenbringend eingegriffen hatten.
Die Mitteilungen des erfahrenen und Alonzo so ergebenen Mannes löschten den letzten Funken der Hoffnung in den Herzen der beiden tief betrübten Männer aus.
Es war ihnen jetzt kein Zweifel mehr, daß man ihren Liebling in den Fluß versenkt habe, um jede Spur zu tilgen.
"Es ist dem furchtbaren Manne in Bogotá sein finsterer Anschlag doch geglückt, o Gott, wo ist deine Gerechtigkeit?" stöhnte in bitterem Schmerze Don Vincente.
"Lästere nicht, Bruder, und zweifle nicht an Gottes Güte. Hat er den Jüngling vor der Zeit zu sich gerufen, so entsprach es einer ewigen Weisheit und er weilt jetzt in des Himmels Seligkeit. Wir dürfen nicht murren."
Nach einiger Zeit sagte der Indianer: "Maxtla jetzt schlafen gehen, er müde. Dann geben ihm gutes Pferd, geben ihm Büchse, geben ihm etwas Geld, er reiten."
"Du sollst alles haben, aber was willst du beginnen?"
"Ihr haben Don Alonzo lieb? Wie?"
"Du siehst es wohl."
"Maxtla ihn auch lieb. Maxtla gehen töten seine Feinde. Holen ihn ein mit Pferd, Pferd schneller als Boot, Fluß machen Windung, Pferd gerade aus!"
"Die Rache ist mein, spricht der Herr," sagte mit tränendem Auge abwehrend der Geistliche.
"Frommer Vater beten, das gut, Maxtla Chibchakrieger, rächen seinen Freund, das gut."
"Du wirst auch dein Leben verlieren."
"Kann nur einmal sterben, Tod nicht fürchten. Maxtla geht, Ihr von ihm hören."
Er ging hinaus und suchte seine Schlafstätte auf.
Als er am anderen Morgen sein Pferd bestieg, war außer den beiden Vivandas auch die bleiche Elvira da.
Man hatte ihr, um sie vor Verzweiflung zu bewahren, gesagt, daß Alonzo gefangen sei, und daß der Indianer ausziehe, ihn zu befreien.
"O, rette ihn, guter Indio, und ich will dir alles geben, was ich habe."
"Sennorita, jungen Adler der Anden lieb? Wie -"
"Ja, sehr lieb," erwiderte Elvira weinend, "er ist mein Bruder."
"Sennorita beten zu Donna Maria, ihr gewiß gütig sein."
Und davon ritt der Indianer der Mündung des Ocoa zu. -
Tejada wurde gefangen eingebracht, benahm sich aber höchst trotzig und leugnete jede Mitschuld an Alonzos Verschwinden als gänzlich sinnlos.
Der Meta, der nach der Aussage des fremden Chibcha die Pirateninsel bergen sollte, ist ein mächtiger Nebenfluß des Orinoko.
Sein Wasser ist da, wo er den Ocoa aufgenommen hat, trübe, sein Stromlauf öfter von Inseln und Felsen durchsetzt. Schilf, Bambus, Weide umsäumen die Ufer, die wie alle Gewässer der Llanos von dichten, hochstämmigen, mehr oder minder breiten Wäldern eingefaßt werden.
Gewaltige Alligatoren sonnen sich auf flachen Sandinseln, der Riesenotter läßt oftmals sein seltsames Gebell hören, und das Geheul der Brüllaffen hallt an den Stromufern wieder.
Die Wasserläufe sind die wichtigsten Lebensadern der Llanos, denn diese vermitteln den Verkehr mit dem Orinoko und so mit dem Ozean und geben Gelegenheit, die Produkte des fruchtbaren Bodens in den Welthandel zu bringen. Leichter war es damals, viel leichter, die Bodenerzeugnisse dem Meere zuzuführen, als die Einfuhr von Europa zu gewinnen, deren Transport die Strömung der Flüsse ernste Hindernisse bot, ehe das Dampfschiff in Gebrauch genommen wurde, das siegreich mit der Strömung kämpft.
Freilich befuhren Dampfer auch schon damals den Orinoko, doch waren seine Zuflüsse, auch wo sie schiffbar waren, nur auf Segel- und Ruderboote angewiesen.
Der gewaltige Orinoko mit seinen Felsen, seinen Stromschnellen verschlang alljährlich manches reich beladene Boot, manches Floß auf seinem oberen Laufe.
Dumpfe Gerüchte liefen um von Flußpiraten, die den reichbeladenen Booten und Flößen auf dem einsamen Strome Gefahr brächten, aber sichere Kenntnis von einer so unheimlichen Tätigkeit hatte man nicht, und jeder Versuch, Gewißheit zu erlangen, war mißglückt.
Unterhalb der Mündung des Icaho, eines wenig bedeutenden Flußlaufes, erhob sich mitten im Strome eine langgestreckte Insel, deren schroffe Felseneinfassung umsomehr der Schrecken der Schiffer war, als die durch ihre Lage bedingte Einschränkung des Fahrwassers dieses schneller zu ihren Seiten strömen ließ und verdächtige Klippen sich unter der Oberfläche erhoben.
Diese Insel, die hinter ihrem Felsengürtel Baumwipfel zeigte, vermieden alle Schiffer ängstlich.
Auf viele Leguas hin waren die Ufer des Flusses hier unbewohnt, und man mußte weit in die Llanos reiten, um einen Rancho zu finden.
Hätten die Fischreiher, die hie und da auf den hohen Bäumen der Ufer saßen, erzählen können, so würden sie von dem seltsamen Gebaren eines roten Mannes berichtet haben, der bald in einem kleinen Canoa versteckt im Schilfe liegend, bald hoch oben im Laube eines Baumes hockend, die Insel zu beobachten schien.
Mit stürmender Eile war Maxtla den Ocoa entlang geritten und hatte manche seine Windungen abgeschnitten. Er sagte sich, daß sein gutes Pferd das Boot, dessen Insassen Alonzo überfallen hatten, trotz dessen Vorsprung bald überholt haben müsse. Wiederholt hielt er am Ufer an, wo Häuser standen und Furten waren und erkundigte sich bei den Leuten seiner Farbe nach dem Boote, dessen Gestalt er gut im Gedächtnis hatte, fragte, ob sie es gesehen hatten. Keiner konnte ihm davon berichten.
In der Nacht zu fahren war zwar möglich, doch gehörte dann ein genauer Kenner des Stromlaufes an das Steuer. Leicht konnte es aber auch sein, daß die Gleichgültigkeit der Leute sie verhindert hatte, ein Fahrzeug wahrzunehmen, das eilig, ohne anzuhalten, den Fluß am Tage herabkam.
Auf seinen Kriegsfahrten im Norden am Magdalenenstrome und auf den Lagunen hatte Maxtla gelernt, ein Canoa auch unter schwierigen Stromverhältnissen zu handhaben.
In Cabuyaro hatte er sein Pferd einem Posadero zur Pflege übergeben und sich ein Boot gekauft. Mit diesem war er den Fluß hinabgegangen bis zu der ihm von seinem Stammesgenossen Huatl bezeichneten Insel.
Maxtla ließ sich, vorsichtig nach Dunkelwerden anlangend, im Schilfe nieder und lag auf der Lauer.
Daß die Insel bewohnt war, wurde, trotz aller Vorsicht dieser Bewohner, dem scharfäugigen Indianer bald klar, der von der Höhe eines Baumes aus den dünnen Rauch bemerkte, der sich von Zeit zu Zeit über den Baumwipfeln erhob. Nicht minder klar erkannte er, daß die Insel eine geschützte Anlegestelle haben müsse, obgleich er diese noch nicht hatte erkunden können, da er am Tage selbst die größte Vorsicht beobachten mußte.
In jeder Nacht lag er auf dem Wasser, indem er sein leichtes Canoa oberhalb der Insel an einer die Oberfläche wenig überragenden Felsspitze festlegte, an der einige Büsche wuchsen, die im Notfall selbst am Tage Deckung gewährten.
Vier Nächte hindurch lag er so mit der Geduld einer Rothaut, die auf den Todfeind lauert. Schon nahte sich zu Ende der vierten der Morgen, als er Ruderschläge oberhalb seiner Stellung vernahm. Bald erkannte er zu seiner grimmigen Freude das erwartete Boot.
Es kam rasch stromab.
Er lag im Canoa und lugte durch die Büsche.
Als das Boot sich in gleicher Höhe befand, ließ er in täuschender Nachahmung den Schrei des Adlers der Anden vernehmen. War Huatl an Bord, so wußte dieser, daß ein Chibcha aus dem Hochgebirge ihm zurief, denn der Adler der Anden kam wohl selten hier in die Niederung.
Begierig schaute er dem Boote nach, welche Stromseite es wählen würde, und ließ, als er erkannt hatte, daß es die rechte einschlug, sein Fahrzeug in derselben Richtung treiben, indem er das Ruder steuernd einsenkte und ihm so die Richtung nach dem Ufer zu gab. Es war hell genug, daß er das größere Boot erkennen konnte, während das seine, das so niedrig auf dem Wasser lag, auch für scharfe Augen unbemerkt bleiben mußte.
Schon war das Boot fast an der Insel vorbei, als er zu seinem Erstaunen gewahrte, wie es wendete und nun stromauf ging, unter kräftigen Ruderschlägen gegen die Strömung ankämpfend.
Maxtla war jetzt dicht am Ufer und so das Canoa auf dem dunklen Hintergrunde des Waldes gar nicht zu sehen. Allgemach kam das fremde Boot wieder auf gleiche Höhe, worauf es plötzlich zwischen zwei Felsspitzen der Insel verschwand. Also dort war die Anlegestelle. Des Indianers Auge hielt die Felsen fest, zwischen welchen der Weg genommen worden war.
Er wiederholte den Adlerschrei und ließ sein Fahrzeug in das Uferschilf laufen, gerade der Stelle gegenüber, wo das Boot zwischen den Felsen verschwand. Vorsichtig ging er an das Land, vorsichtig erkletterte er einen Ceibabaum, doch erkannte er von hier aus nur, daß zwischen der äußeren Felsumgürtung und einer inneren Felserhebung eine Wasserfläche sein müsse, die wohl als Hafen diente und nur stromauf zugänglich sein mußte.
Er hielt sich den Tag über ruhig. Die Insel lag wie tot da. Einige Kähne und ein Floß, die von oben kamen, hielten sich von der gefährlichen Insel in ängstlicher Entfernung. Maxtla harrte geduldig. Einigen Mundvorrat führte er mit, so daß er keinen Mangel litt. So kam die Nacht heran.
Auch jetzt harrte der Indianer noch stundenlang, denn früh kommt die Nacht in jenen Breiten. Dann aber trat er im Canoa in den Strom. Ein starker Wind kam stromauf, half ihm gegen die Strömung anzukämpfen und übertönte durch sein Rauschen in den Bäumen das leichte Geräusch seines Ruders.
Er gelangte trotz der Dunkelheit zu den Felsen, war in ihrem Schutze in ruhigem Wasser und erkannte bald, daß hier ein gewundener Gang durch die felsige Einfassung der Insel führte. Er legte das Ruder nieder und stieß sein leichtes Boot an der Felswand, mit den Händen tastend, vorsichtig und geräuschlos weiter.
Nach einigen Windungen, die er sich genau merkte, trat er in ein ziemlich geräumiges Bassin, in dem schattenhaft erkennbar einige Kähne lagen. Er gewahrte Feuerschein am Ufer, der durch Büsche drang, sah auch die unteren Äste der Bäume erleuchtet und vernahm Stimmen, die schwach zu ihm drangen.
Er lauschte, ob nicht ein Mensch in den Booten sei, die vor ihm lagen, aber sein Ohr vernahm nichts. Kein Atemzug verriet die Nähe eines Lebenden. Er ruderte vorsichtig mit der Hand und trieb so in dem stillliegenden Wasser das Canoa ans Ufer.
Langsam kroch er an dessen grasigem, mit Büschen besetztem Rande hinauf und endlich gelang es ihm, einen Blick durch die Zweige zu werfen. Er sah auf einem ebenen, von Strauchwerk befreiten Platze einige niedergebrannte Feuer, an denen noch Leute saßen und rauchten, sah mehrere roh hergestellte Hütten und ein etwas größeres Haus, das aus festerem Material hergerichtet war. Er kroch weiter und gelangte, immer durch Büsche gedeckt, in den Schatten eines höher stehenden Kautschukbaumes. Da sah er - selbst das Herz des eisernen Indianers stand einen Augenblick still bei diesem Anblick - sah er im Scheine eines Feuers an einen Baum gelehnt - Alonzo sitzen.

Maxtla erkannte, daß Alonzo mit einem Lasso an den Baum gebunden war.
Die Freude des Indianers war grenzenlos - der Sohn Don Pedros lebte.
Er erkannte bald, daß der Weiße mit einem Lasso an den Baum gebunden war.
Der Jüngling sah zwar bleich, aber trotzig und hochmütig aus.
Maxtla betrachtete die Umgebung. Es war möglich, ungesehen in seine Nähe zu gelangen. Schon wollte er sich vorsichtig dahin schleichen, als er Stimmen in seiner Nähe vernahm.
Er beugte sich nieder und verschwand im Grase.
"Ich verstehe nicht, wie du uns mit einem Gefangenen belästigen kannst, Don Ambrosio," ließ sich gedämpften Tones eine tiefe Stimme vernehmen.
"Er ist sehr wertvoll, Capitano, und de Valla muß uns seinen Kopf mit fünfzigtausend Pesos abkaufen."
Es war der Mann, der von dem Alguacil verfolgt, von Tejada zum Morde Alonzos angespornt worden war, der hier sprach. Maxtla erkannte die Stimme, trotzdem er sie nur einmal gehört hatte.
"Was? Fünfzigtausend Pesos?"
"Der junge Mensch ist im Augenblicke eine wichtige Person in dieser glorreichen Republik. Ich sende morgen früh sichere Boten ab; sind in zehn Tagen nicht fünfzigtausend Pesos in guten Wertscheinen der Amerikanos in Cabuyaro an sicherer Stelle, kannst du ihn in den Orinoko tauchen, wenn der junge Mann sich dann nicht selbst auslöst."
"Und unsere Zuflucht verrät."
"Er weiß nicht, wo er ist, er lag gebunden, den Kopf verdeckt, im Raume, die ganze Reise über. Kommt das Geld, wie ich glaube, und der Gefangene ist für de Valla eine Person von äußerster Wichtigkeit, nun - hungrige Alligatoren hat der Fluß ja genug. Capitano, der Bursche, den das Glück mir in die Hand spielte, ist Gold wert. Der Dummkopf, der mich antrieb, ihn zu beseitigen, es war, wie ich später nach der Beschreibung, die ich von ihm gab, ein gewisser Tejada, ein Gauner, hatte keine Ahnung von der Bedeutung des jungen Menschen, sonst hätte er ihn teuer verkauft." Mit einem heiseren Lachen setzte der Sprecher hinzu: "Ich war klüger, ich habe ihn meinem Versprechen gemäß 'beseitigt' und nun soll er uns Geld einbringen, viel Geld."
"Nun gut, warten wir es ab. Du weißt, daß ich nicht für Gefangene auf dieser Insel bin."
"Das ist hier etwas anderes, er ist am Lande gefangen genommen, fern von hier und weiß nicht von wem, noch weiß er, wo er sich befindet."
Die beiden entfernten sich von dem Baume, den sie wohl aufgesucht hatten, um von den anderen nicht gehört zu werden; der mit der tiefen Stimme war, wie Maxtla bei vorsichtiger Erhebung des Hauptes erkannt hatte, ein Zambo.
Maxtla überlegte, ob er sofort einen Befreiungsversuch machen oder diesen auf später versparen sollte. Vor allem aber mußte der Gefangene über seine Anwesenheit unterrichtet werden, um Trost zu finden in der Gewißheit, einen Freund in der Nähe zu haben, und einen Befreiungsversuch unterstützen zu können.
Wie viel Leute hier anwesend waren, vermochte er nicht zu ermitteln, er sah nur wenige - doch in den Hütten mochten noch andere sein. Huatl erblickte er nicht.
Er kroch langsam, durch Büsche und Farnkraut gedeckt, weiter und gelangte endlich in die Nähe Alonzos, der starr vor sich hin blickte. Nicht nur Buschwerk und Sträucher, auch die Dunkelheit schützten ihn hier.
Von hier aus hatte Maxtla einen freieren Überblick über den nicht großen freien Raum, der, mäßig durch einige Feuer beleuchtet, von den unter Bäumen stehenden Hütten umgrenzt war.
An einem der Feuer saßen mehrere Farbige, darunter ein riesenhafter Neger, die eine Rumflasche unter sich kreisen ließen und dieser schon stark zugesprochen haben mußten. Einige saßen oder lagen, stier vor sich hin blickend auf der Erde, die anderen schwatzten und belachten allerlei Dinge. In einer der Hütten, deren Inneres erleuchtet war, schien gespielt zu werden, denn auf das Spiel bezügliche Ausrufe drangen zu des Lauschers Ohr.
An einem anderen Feuer saßen einige Weiße, Menschen mit wahren Galgengesichtern, tranken und rauchten.
Von dem durch den Alguacil Verfolgten und dem Zambo gewahrte Maxtla nichts, ebenso vergeblich sah er sich nach Huatl um.
Wachen waren nirgends ausgestellt, die Leute schienen sich hier in völliger Sicherheit zu fühlen; selbst dem Gefangenen, der freilich mit einem unzerreißbaren Lasso an den Baum, vor dem er saß, gebunden war, schien man keine Aufmerksamkeit zu schenken.
Da kam Maxtla der Gedanke, sofort einen Befreiungsversuch zu machen, vielleicht fand er ein zweites Mal die Gelegenheit weniger günstig.
Schon wollte er sich kriechend auf Alonzo zu bewegen, als er Huatl erblickte, der langsam an seinem Versteck vorbeischlenderte.
Als der Chibcha das Zischen der Felsennatter vernahm, das aus dem Grase zu ihm drang, zuckte er zusammen, und sein dunkles Auge richtete sich auf den Busch, hinter dem Maxtla lag.
Mit einer ganz natürlichen Bewegung ließ sich Huatl hierauf in dessen Nähe nieder, den Rücken ihm zugekehrt.
Niemand war in der Nähe und die Gestalt des Indianers nur schattenhaft wahrzunehmen.
Des Chibcha Augen rollten unruhig suchend hin und her.
Leise drang es zu seinem Ohr in der Sprache der Chibchas aus dem Hochgebirge.
"Huatl hörte den Adlerschrei seines Bruders?"
Der Angeredete senkte bejahend langsam das Haupt.
"Maxtla ist gekommen, den Gefangenen zu befreien, er ist der Sohn seines Freundes."
Huatl, der sah, daß er ganz unbeachtet war, wandte langsam das Haupt nach dem Busche und flüsterte: "Maxtla ist sehr kühn, in die Höhle der Panther zu kommen; er wird sein Leben verlieren und den Gefangenen nicht befreien."
"Er wird ihn befreien, wenn sein Bruder ihm beisteht."
Der Chibcha schwieg.
"Huatl sehnt sich nach den Bergen, wo er aufgewachsen ist - er wird sie wiedersehen. Der Jüngling dort ist ein mächtiger Caudillo, darum haben sie ihn gefangen; er wird Huatl frei zurückkehren lassen zu den Seinen und ihm schöne Waffen, Ponchos, Mulos und Pferde geben, und Huatl wird, wenn die Unsichtbaren ihn rufen, zur Sonne gehen und sein Leib im Schatten der Felsen ruhen, die die Väter sahen."
"Was soll Huatl tun?" fragte der Mann, auf den die wohlberechneten Worte Maxtlas unzweifelhaft einen tiefen Eindruck gemacht hatten.
"Huatl wird dahin gehen, wo die Canoas liegen und sich in das Maxtlas legen; er wird es bereit halten, wenn Maxtla mit dem Jüngling kommt und ihm helfen, ihn über den Strom zu setzen. Huatl wird mit Maxtla gehen, er kann nicht länger unter den Piratas weilen."
"Sie haben Canoas und sind sehr geschickt auf dem Wasser."
"Wir werden sie blind machen. Huatl wird mit uns kommen und dann in seine Berge gehen."
Nach einiger Zeit erwiderte der Chibcha, in dem die Sehnsucht nach seiner bergigen Heimat sehr stark sein mußte, wie in den beiden Indianern die Lehren der christlichen Religion nur schwach nachwirkten: "Huatl wird tun wie Maxtla sagt."
Er erhob sich nach einer Weile und ging langsam den Hütten zu.
Die beiden Gruppen der Farbigen und der Weißen saßen noch um ihre Feuer. Alle schienen angetrunken zu sein, denn ihre Stimmen, wenn sie redeten, lallten nur. Der Lärm aus der erleuchteten Hütte dauerte an.
Langsam kroch Maxtla zu dem Baume, vor dem Alonzo saß.
Düster blickte der Jüngling vor sich hin, der so rauh dem Kreise der Seinen entrissen und in so qualvoller Weise gebunden auf dem Boden eines Kahnes liegend hierhergeführt worden war.
Er wußte nicht, was man mit ihm vorhatte, noch wo er sich befand; seinen Fragen hatte man die Vertröstung entgegengesetzt, daß er zeitig genug alles erfahren werde.
Er hatte längst erkannt, daß er in die Gewalt einer wohlorganisierten Räuberschar geraten war; daß seine Gefangennahme eine Fortsetzung des ihm geltenden Mordversuches sei, war ihm nicht zweifelhaft.
Es war die Hand des Todfeindes, die seit Jahren ihm drohte, die jetzt auf ihm lag.
Er dachte an Otoño, an die Angst seiner guten Pflegeväter, die Verzweiflung Elviras.
Gleich einem Blitze durchzuckte es ihn, als er jetzt hinter dem Baume hervor das Zischen der Bergnatter vernahm - die in der Niederung nicht heimisch war.
Es war dies ein von den Indianern der Anden oft gebrauchtes Verständigungszeichen.
Gleich darauf klang es in der Chibchasprache zu ihm; er bedurfte seiner ganzen Kraft, um seine Ruhe zu wahren, denn er glaubte die Stimme Maxtlas zu erkennen.
"Hört mich Don Alonzo?"
Alonzo war unter den Aimaràs durch eine furchtbare Schule gegangen, es gelang ihm auch jetzt, sich zu beherrschen und erst nach einiger Zeit vorsichtig und leise zu erwidern: "Ich höre eines Freundes Stimme."
"Kann der junge Adler die Flügel regen?"
Ja, es war Maxtla und er verstand, was der Indio meinte.
Zwar schmerzten ihn noch die so lange gefesselt gewesenen Hand- und Fußgelenke, aber die Glieder waren wieder brauchbar geworden.
"Ja, sie sind stark."
Alonzo schaute sich verstohlen um. Er wußte, in welcher Richtung der Hafen der Piraten lag; aber gerade da saßen die zechenden Farbigen und Weißen, obgleich die jetzt nicht gefährlich waren.
Aber es mochten wohl an die dreißig Mann hier versammelt sein, und der Zambo, der das Kommando über sie führte, war ein entschlossener, wachsamer Mann.
Alonzo hatte sich schon gewundert über die Sorglosigkeit, mit der man ihn behandelte und den Mangel an Wachsamkeit von seiten der Bandidos und daraus den Schluß gezogen, daß er sich auf einer Insel befinden müsse.
Wenn der kluge und tapfere Maxtla da war, welch ein Wunder hatte ihn hierhergeführt? So war Flucht gewiß möglich - er würde sie auch allein versucht haben, sobald die Gelegenheit sich bot. Sein Herz bebte jetzt in freudiger Erregung.
"Was soll ich tun?"
"Im Hafen liegt mein Canoa; wir müssen die Feinde blind machen und das Boot zu erreichen suchen."
"Wohl, Maxtla wird sagen, wie es geschehen soll."
Die im leisen Tone geführte Unterredung wurde unterbrochen durch das Herannahen des Zambo, dem ein Neger folgte. Maxtla verschwand im tieferen Schatten, und Alonzo saß ruhig mit ernstem, fast gleichgültigem Gesicht da.
"Folgen Sie diesem Mann," redete der Zambo Alonzo an, "er wird Sie in eines der Häuser führen."
Alonzo erhob sich mühevoll, es war klar, daß die Füße ihm den Dienst versagten, er wankte.
Der Neger löste den Lasso von dem Baum, hinter dem Maxtla lag, die Machete in der Hand.
Da erhob sich aus der Hütte, die erleuchtet war, wüstes Geschrei, und zur Türe heraus flog einem Ballen gleich ein Mann.
Die um die Feuer sitzenden Leute stierten stumpfsinnig nach jener Seite hin, der Neger, der Alonzo am Lasso hielt, mit gierigem Interesse. Ein Augenblick - und Alonzos Faust traf ihn mit so furchtbarer Wucht zwischen beide Augen, daß der Schwarze lautlos, wie ein Klotz, zu Boden sank. Mit einem Sprung war Alonzo hinter dem Baum und streifte den Lasso ab.
"Maxtla?"
"Hier! Mir nach!"
Und fort schlichen beide durch die Büsche, um mit Umgehung des Platzes das Canoa zu erreichen. Der wilde Lärm dauerte an.
Schon nahten sie dem Hafen, als eine gellende Stimme schrie: "El prisionero (Der Gefangene)!"
"Vorwärts," zischte Maxtla.
Schon standen sie am Wasser, vor sich das Canoa, Maxtla half Alonzo hinein, als der Zambo zwischen den Büschen erschien, der von allen Piraten allein Besinnung genug bewahrt hatte, um bei Entdeckung der Flucht Alonzos nach der einzig gefährlichen Stelle, dem Hafen zu laufen.
Mit Kraft stieß Maxtla das Boot in das Wasser, rief Huatl zu: "Rette ihn!" und wandte sich gegen den Zambo.
Huatl tauchte gegen den Willen Alonzos, der an das Land springen wollte, das Ruder in das Wasser und gleich darauf fuhr das Boot um die nächste Biegung.
Hier hielt Huatl.
"Fahre zurück, sofort zurück!"
"Ruhig, Sennor, Maxtla ist ein Chibchakrieger."
Gleich darauf rauschte es in dem Wasser, und Maxtla schwamm heran.
"O, dann ist es gut," sagte Alonzo inbrünstig, als er ihn erkannte.
Schwierig war es, Maxtla in das schwankende Fahrzeug zu bringen.
"Fort!" sagte er, das Wasser aus seinem Haar schüttelnd.
"Der Zambo?"
"Wird niemand mehr gefährlich werden," erwiderte ruhig Maxtla.
"Man wird uns folgen."
"Nein," sagte Huatl.
"Er ist ein Chibchakrieger, Don Alonzo," sagte mit freudigem Grinsen Maxtla, "er hat alle Boote der Piraten dem Flusse übergeben; sie werden nicht folgen."
Maxtla hatte mit dem ersten Blick erkannt, als er an das Wasser kam, was der schlaue Huatl getan, Alonzo war es entgangen.
Von der Landungsstelle her tönte wütendes Geschrei ihnen nach.
"Schreit nur," äußerte Maxtla, der unendlich glücklich war, Alonzo gerettet zu sehen, in ungewohnter guter Laune - "kein Schrei schafft euch Canoas herbei."
Gleich darauf traten sie in den Strom, wo sie jetzt in vollkommener Sicherheit waren.
Maxtla gab die Richtung zum linken Ufer an, dort, in ruhigerem Wasser - Huatl hatte für zwei Ruder gesorgt - trieben die beiden Indios das leichte Canoa eine große Strecke stromauf, bis der Chibcha die Zeit für gekommen hielt, an einer geeigneten Stelle zu landen.
Nachdem sie den Schilfsaum durchquert und festen Boden unter sich hatten, ließen sie sich zwischen Farnkräutern nieder, und Maxtla zündete Feuer an. Bei dessen Scheine stellten sie sich nach Jägerart, aus Gras und Baumrinde, eine Ruhestätte her.
Alonzo hielt Maxtlas Hand: "Zum zweiten Male verdanke ich dir mein Leben, wie vergelte ich dir das?"
"Nichts vergelten. Don Pedro gut gegen armen Indio, Indio gut gegen Don Pedros Sohn - das gut so. Hier, Huatl, müssen vergelten, er armer Indio, will wieder in Berge, da Don Alonzo helfen."
"Ja, wahrlich Mann," rief der glücklich Befreite, "wenn ich es vermag, werde ich alle seine Wünsche erfüllen."
Neunzehntes Kapitel.
Mariquita
Nach ruhig verbrachter Nacht erwachten die Schläfer im Morgensonnenschein. Alonzo erhob sich und nie, so schien es ihm, hatte er das Antlitz der Erde schöner gesehen als jetzt, wo er nach furchtbaren Tagen, die er in Banden am Boden eines Kahnes liegend, umgeben von rohen Mordgesellen, zugebracht, die Luft der Freiheit wieder atmete.
Der strahlende Himmel, der mächtige Strom, dessen Wasser die Sonnenstrahlen glitzernd widerspiegelte, die Pracht unzähliger Diamanten, die in Form von Tautropfen an Strauch und Gras hingen, das Umherschwirren der bunten Kolibris, der schöngefärbten Schmetterlinge, die Blütenpracht der Lianen, der Duft des Waldes, die köstliche, erfrischende Morgenluft - das alles erfüllte ihn mit unendlichem Entzücken. Die Wonne der wiedererlangten Freiheit gab sich darin kund. Nur eine Sehnsucht war in ihm lebendig, rasch nach Otoño zurückzukehren, um dort seine sorgenvollen Lieben zu beruhigen. Ihm gesellte sich Maxtla zu.
Nachdem er diesem mitgeteilt hatte, wie er in die Hände der Bandidos gefallen war, und es war genau so geschehen, wie der Indio aus den Spuren erraten hatte, verlieh er seiner Sehnsucht nach beschleunigter Rückkehr Worte.
Die Fahrt nach Cabuyaro im Canoa stromauf war anstrengend und zeitraubend, aber Maxtla hatte bereits vom Waldsaum aus einen einsamen Rancho entdeckt und sprach die Hoffnung aus, dort Reittiere zu erlangen, um so schneller den Ocoa zu erreichen.
Gleich darauf betraten die drei Männer die Llanos und schritten auf das einsam unter einigen Palmen liegende Gehöft zu.
Alonzo ging, als sie dort angekommen waren, um die Gastfreundschaft des Rancheros anzusprechen.
In der Tür des aus Adobeziegeln gebauten Hauses erschien ein Mädchen und Alonzo blieb stehen. Das Kind - es war noch ein Kind von vielleicht zwölf Jahren - stand in der Tür und ihre zarte, in das weiße tunikartige Gewand der Frauen des Landes gehüllte Gestalt hob sich einem Bilde gleich von dem dunklen Hintergrunde ab, das die Tür wie ein Rahmen einfaßte.
Er sah es vor sich, das sanfte, unschuldsvolle, von lockigem Haar umwallte Gesichtchen, die braunen Augen, die fromm zum Himmel gerichtet waren, und ein Gefühl, wie er es nie gekannt hatte, zog ihm durch Herz und Seele.
Eine hierniedergestiegene Himmelskönigin deuchte ihm die Erscheinung, Schauer der Andacht durchbebten sein Herz - und doch - er hatte ein gleiches holdes Gesicht schon gesehen - er hatte -? was war es doch, das seine Seele so erbeben machte?
Atemlos stand er und schaute auf das holde Menschenbild.
Da senkte die jugendliche Gestalt die Augen, und ihr Blick traf auf den fremden Mann - der sie so seltsam mit großen Augen ansah.
Ein leichtes Erstaunen zeigte sich in ihrem Gesicht, dann aber sagte sie mit freundlichem Lächeln in einem Tone, der ihn freudig berührte: "Komm näher, Amigo - sei willkommen!"
Er schritt auf sie zu - das Herz klopfte ihm ungestüm und er wußte nicht warum, - immer den Blick fast scheu auf ihr Antlitz gerichtet.
"Suchst du Don Esteban? Er ist ausgeritten - aber die Mutter ist im Garten, sei willkommen," und sie reichte ihm mit kindlicher Gebärde die Hand. Er erfaßte sie - und wiederum überlief ihn eine seltsamer Schauer. Was war es?
Welch wunderbares Gefühl flößte ihm dieses Kind mit den madonnenhaften Zügen ein?
"Ich bin Mariquita oder Maruja, wenn du willst - so ruft mich Mama. Wie heißest du?"
"Alonzo," sagte er leise, "Alonzo d'Alcantara."
Eine alte runzelvolle Indianerin kam um das Haus herum und störte den Zauber, von dem Alonzo sich dem Kinde gegenüber gefangen fühlte.
"O, Estrangeros?" ließ sie sich mit wenig melodischer Stimme vernehmen - sie hatte die beiden weiter zurückstehenden Indianer bemerkt - "Estrangeros? Wo sind eure Pferde? Estrangeros? Wie kommen sie hierher? Das muß Sennora wissen," und sie ging zurück hinter das Haus.
Alonzo hatte nicht bemerkt, wie auch Maxtlas Augen mit einem Ausdruck der Überraschung auf des Kindes Gesicht gerichtet waren, eine seltene Erscheinung bei einem Indianer.
"Komm, setz dich, Don Alonzo," sie wies auf einen Sitz in einer schattigen Laube, hinter der Bananen sich erhoben. "Du hast auch Indios bei dir? Laß sie herbeikommen. Ah, da ist die Mutter."

"Suchst du Don Esteban? Er ist ausgeritten!"
Eine Frau in mittleren Jahren trat herzu und schaute erstaunt, aber nicht unfreundlich auf Alonzos jugendlich männliche Erscheinung, die unverkennbar den Caballero verriet. Er begrüßte sie achtungsvoll und sagte, wie er es mit Maxtla verabredet hatte: "Verzeiht, Sennora, daß wir die Gastfreundschaft Eures Hauses in Anspruch nehmen, aber wir haben unser Boot auf dem Strom verloren und suchen den Weg nach Cabuyaro zurück."
Das Äußere Alonzos und seine Haltung schien der einfach gekleideten Frau sehr zu gefallen, und sie sagte freundlich: "Seid willkommen, Sennor - unser Haus ist das Eurige. Habt Ihr Unglück auf dem Strome gehabt? Ja, es ist ein tückisches Wasser. Laßt Euch nieder, mein Mann wird bald zurückkehren. Es ist selten, daß Fremde zu uns kommen, seid willkommen. Ich will Euch gleich Kaffee bringen. Die Indios können sich dort in den Schatten der Agave setzen. Habt Ihr schon Marujas Bekanntschaft gemacht, Sennor? Verzeiht ihr ihre Schüchternheit, aber sie sieht wenig fremde Menschen. Sei artig gegen Sennor, Maruja, wie eine wohlerzogene Sennorita, und unterhalte ihn. Ich komme gleich zurück."
Sie ging in das Haus und Maruja, die Alonzo gegenüber gar keine Schüchternheit zeigte, setzte sich neben ihn. Unter der Agave saß Maxtla und schaute sie unverwandt an.
"Du wirst ein paar Tage bei uns bleiben, Don Alonzo, nicht wahr? Es ist sehr schön hier, und Papa und Mama freuen sich, wenn Fremde kommen."
"Ich muß bald davonreiten, Mariquita, wenn dein Vater uns Tiere verkauft oder leiht."
"O, mußt du sobald wieder fort? O, wie schade! Ich wollte, du bliebest lange hier, du gefällst mir so, Don Alonzo."
Ihr holdes Gesichtchen zeigte aufrichtige Betrübnis.
"Es freut mich, daß ich dir gefalle - es freut mich sehr."
Ihm traten Tränen in die Augen als er fortfuhr: "Ich hatte einmal ein kleines Schwesterchen, das müßte jetzt so alt sein wie du." Vor seinem Geistesauge stand das kleine liebliche Kind.
"Ist es ein Engel im Himmel geworden?" fragte das Kind teilnahmsvoll und sah ihn an. "Weißt du, alle kleinen Kinder werden Engel, wenn Gott sie abruft."
"Ja, meine kleine Juana ist im Himmel."
Sie sah seine Tränen und sagte: "Du mußt nicht weinen, Don Alonzo, sie ist glücklich in den himmlischen Gefilden."
"Ja, du hast recht." Er wischte die Tränen aus den Augen und fragte ruhiger: "Wie alt bist du, Mariquita?"
"Zwölf Jahre."
"Hast du Geschwister?"
"Nein, ich bin allein. O, Papa und Mama lieben mich sehr und auch die alte Mali, sie lieben mich alle."
"Wer sollte dich auch nicht lieben?"
"Dir gefalle ich auch, nicht? - Mir ist so, als ob ich dich schon lange kenne, Don Alonzo, und doch sehe ich dich zum ersten Male."
Ihn rührten das kindliche Geplauder des in der Stille und Einsamkeit der Llanos erwachsenen Mädchens tief in der Seele.
Die Indianerin kam aus dem Hause und brachte ihren Stammesgenossen Maisbrot und Fleisch.
"Dienst du schon lange hier?" fragte Maxtla sie in der Chibchasprache.
"Viele Jahre, die Weißen sind gut."
"Hast du keinen Mann?"
"Er ist tot."
"Und Kinder."
"Sie sind - zur Sonne gegangen."
"Du stammst aus den Bergen," sagte Maxtla jetzt im Dialekt der Gebirgschibchas.
"Ja," antwortete sie, und ihre Augen leuchteten jetzt freudig bei dem Klange auf, - "aus den Bergen - und du auch, wie ich höre."
Die Sennora kam aus dem Hause und brachte Alonzo Kaffee, Brot und Eier.
Mit Erstaunen sah sie, wie vertraulich ihr Kind mit dem Fremden verkehrte.
"Nun, das ist ein Wunder, Sennor, Ihr habt rasch des scheuen Vögelchens Herz gewonnen."
"Ja, Madrecilla, er gefällt mir und ich ihm auch. Er hatte ein kleines Schwesterchen, das jetzt bei den lieben Englein im Himmel ist, und darum ist er mir gut."
Die Frau warf einen fast schreckensvollen Blick auf Alonzo.
"Es ist so, Sennora, sie ist mir in jugendlichem Alter durch eine schaudervolle Tat entrissen worden, von der das Tal der drei Quellen noch lange widerhallen wird - sie müßte jetzt im Alter Ihres Kindes sein."
Die beiden Indianer und Mali, die Indianerin, hatten den Worten, die in der Laube mit der Sennora gewechselt wurden, gelauscht. Als das Tal der drei Quellen erwähnt wurde, zeigte sich in dem Gesicht der Indianerin ein schreckenvolles Erstaunen. Maxtla bemerkte es wohl.
Er stand auf und sagte zu seiner Stammesgenossin in tiefem Ernste: "Die Tochter der Berge wird mit mir kommen, ihr Bruder hat eine Frage an sie zu richten."
Er schritt nach einer Baumgruppe, und scheu folgte sie ihm.
Der Llanero Esteban Mauricio ritt heran. Der Mann, ein ehrlich aussehender, derber Geselle, war erfreut, einen Caballero als Gast in seinem Hause zu finden und erstaunt gleich seiner Frau, zu sehen, wie zutraulich sein scheues Kind mit ihm verkehrte, und kein Auge von ihm wandte.
Alonzo sagte ihm, wie er hierhergekommen und fügte seine Wünsche hinzu.
Der Llanero erklärte sich alsbald bereit, ihn mit seinen Begleitern nach Cabuyaro zu bringen, und wenn er darauf bestehen sollte, ihm auch Pferde oder Mulos zu dem landesüblichen Preise zu verkaufen.
Mariquita saß still und traurig während dieser Verhandlungen da, und leise sagte sie: "Ich wollte, er ginge nicht."
Als der Llanero gegangen war, um in seinem Corral die Tiere auszusuchen, trat Maxtla zu Alonzo, zu dem er in der Chibchasprache sagte: "Weißt du, junger Adler der Berge, wem sie ähnlich sieht?" Er meinte Mariquita.
"Nun?" fragte Alonzo erstaunt.
"In deines Vaters Hause hing ein Bild von deiner Mutter, das zeigte, wie sie als Sennorita ausgesehen hat."
Wie Schuppen fiel es Alonzo vom Auge. Er sah im Geiste das lebensgroße Ölbild, das seine Mutter als sechzehnjähriges Mädchen darstellte, vor sich - ja - das war's - das hatte ihn so mächtig erschüttert - unbewußt als er das Kind sah - jetzt wußte er es, der Indianer hatte ihm die Augen geöffnet. Es war zehn Jahre her, daß er als zehnjähriger Knabe das elterliche Haus verlassen hatte, und vieles hatten die Gefangenschaft, die Zeit von seinen Jugenderinnerungen verwischt - aber jetzt stand das Bild lebendig vor ihm - und - er richtete einen angstvoll fragenden Blick auf Mariquitas Gesicht. Eine Flut von Gedanken und Ahnungen stieg ihm zu Haupte und betäubte ihn fast.
Erstaunt sah das Kind, das die Worte in der Chibchasprache nicht verstanden hatte, zu Alonzo auf, sie erkannte, wie sehr er bewegt war.
"O, amigo mio, fehlt dir etwas? Bist du traurig?"
"Ja, ja, nein - o welch ein Glücksgefühl durchzieht mich!"
Er riß das Mädchen an sich und küßte es auf die Stirn. - "Ebenbild der Mutter -" hauchte er vor sich hin und sah ihr in das kindliche Gesicht.
Im Hintergrunde stand die Indianerin Mali und schaute bald auf Alonzo, bald auf Mariquita.
Langsam sagte Maxtla, immer sich der Chibchasprache bedienend: "Diese Frau fand jenes Mädchen vor zehn Sommern im Tale der drei Quellen."
Gleich einem Irrsinnigen starrte Alonzo ihn an.
"Fand - im - Tale der - drei Quellen?" wiederholte er leise - "fand?"
"Der junge Adler sinne nach - zwei Schwestern nannte er sein - Maxtla weiß es - er kannte sie alle, die Kinder Don Pedros - zwei Sommer zählte Juana und jene Frau trug sie fort - aus dem Tale der drei Quellen."
Alonzo wurde totenbleich - der starke Jüngling zitterte - und mußte sich setzen.
"Ein großer Krieger muß die Freude ertragen können wie den Schmerz."
Stumm horchte Mariquita, den Blick voll tiefer Teilnahme auf Alonzo gerichtet, Maxtla aber fuhr in der Sprache der Chibcha zu reden fort: "Mali ist eine Chibcha aus den Bergen und schwor, mir die Wahrheit zu sagen bei den alten Göttern ihres Volkes."
Die Sennora trat hinzu und lauschte den ihr unverständlichen Worten, aber niemand achtete ihrer.
Und nun berichtete der Indianer, während die Indianerin mit niedergeschlagenen Augen neben ihm stand, daß sie mit ihrem Gatten auf der Flucht vor den Leuten der Regierung, die alle kräftigen Männer mit Gewalt zu Soldaten aushob, am Abend des Unglückstages über die blutige Stätte in den drei Quellen gekommen sei. Unter den Toten fand sie ein junges, blühendes Leben, ein zweijähriges Kind, das angstvoll um sich schaute. Eine Machete hatte es gestreift und betäubt niedergeworfen, die Mörder hatten es für tot liegen lassen. Mali, der ein Liebling gestorben war, nahm mitleidsvoll das kleine Mädchen mit. Bald aber bemächtigte sich ihrer die Angst, als der Mann erkundete, daß man Indios im Verdacht habe, die Tat vollbracht zu haben, daß man sie für die Täter halten könne, und da Mali von dem kleinen lieblichen Wesen nicht lassen wollte, flohen sie weiter und weiter durch Berge und Wälder, immer in Angst vor den Offizieren der Militäraushebung und den Alguacils, die nach den Mördern forschten.
Der Llanero war zur Laube getreten und lauschte Maxtlas Worten.
So kamen sie zu den hier einsam wohnenden Leuten und nahmen Dienste bei ihnen. Das Kind erklärten sie in einem Kahne auf dem Flusse treibend gefunden zu haben, immer in der Angst, für die Tat auf dem jetzt so weit entfernten Schauplatz verantwortlich gemacht werden zu können.
Sennora Mauricio nahm sich der Kleinen an, alle Nachforschungen nach ihrer Abkunft blieben natürlich vergebens. Spät erst und so entstellt gelangte die Nachricht von dem Morde im Tale der drei Quellen hierher, daß damit die Kleine nicht in Verbindung zu bringen war. Malis Mann, der aus den Llanos stammte, starb - das Kind wuchs im Schutze der kinderlosen Sennora als deren Tochter auf - und - "da steht es, das kleine Mädchen aus dem Tale der drei Quellen. Die Narbe, welche die Machete der Aimaràs zurückließ, ist, wie du siehst, noch zu erkennen."
In der Art und Weise, wie der Indianer sprach, in dem ungewöhnlichen Klange, der seine Worte belebte, lag etwas Feierliches.
Der Llanero, der Chibchasprache mächtig, war sehr bleich geworden und schaute mit Angst auf Mariquita. Als Maxtla schwieg, herrschte tiefe Stille in der Laube.
Da aber vermochte Alonzo sich nicht länger zu beherrschen, der Sturm in seinem Herzen durchbrach alle Schranken, warf allen künstlichen Stoizismus über den Haufen: "O - Gott - o Gott, Schwester - o - du bist gerettet worden - o Schwester -" er kniete neben dem Kinde nieder, schloß es in seinen Arm und weinte in einer Erregung, die sein ganzes Wesen erschütterte.
Ergriffen war Mariquita bei dem Gebaren des fremden, ihr so sympathischen Mannes, und weil sie ihn herzbrechend weinen sah, weinte sie mit.
Stumm stand die Frau, stumm der Herr des Hauses - der sehr niedergeschlagen aussah.
Endlich hatte Alonzo die Kraft zu sagen: "Ich bin Alonzo d'Alcantara - bis zu dieser Stunde glaubte ich all die Meinen im Tale der drei Quellen verloren zu haben - nun sendet mir Gott - die jüngste unseres Hauses - dies ist meine Schwester Juana."
Jetzt erschrak auch die Sennora, deren ganzes Herz an Mariquita hing, und das Kind selbst sah durch seine Tränen fragend bald zu denen, die sie für ihre Eltern hielt, bald zu Alonzo und Mali empor.
"Kind, Mariquita - Juana - du hörst, was ich sage, - daß mich ein gütiges Geschick zu dir - dem Ebenbild unserer Mutter geführt hat. Willst du gern mein Schwesterchen sein?"
"Ja, ja, ich habe dich gleich lieb gehabt."
Und nun gab es ein Fragen und Antworten, Mali mußte ihre Mitteilungen wiederholen, Alonzo sprach von den Seinen und seinem Schicksal, und das tiefbetrübte Llaneropaar mußte erkennen, daß eine höhere Fügung ihren Liebling an das Herz des Bruders geführt hatte.
"Ihr tragt einen großen Namen, Sennor," sagte der Llanero. "Ich habe von Eures Vaters Schicksal gehört, doch keine Ahnung davon gehabt, daß ich seine Tochter in meinem Hause berge. Gottes Wille geschehe - aber das Glück meines Hauses schwindet mit Maruja dahin."
Seine Frau weinte, und das Kind schmiegte sich zärtlich an sie.
"Nein, meine Freunde." sagte Alonzo. "Juana d'Alcantara muß die ihr gebührende Stellung in der Welt an der Seite ihres Bruders einnehmen, aber Ihr sollt sie nicht verlassen, Ihr habt Elternrechte an ihr erworben. Kommt mit an den Ocoa, Ihr sollt Haus und Land dort haben, und wie sich mein Schicksal auch gestalte, Ihr sollt in des Kindes Nähe, das Ihr zu einer schönen Menschenblüte erzogen, bleiben. Willst du mit mir kommen, mit mir, deinem Bruder?"
"Ja," sagte sie - "aber Mama muß auch mitgehen."
"Das soll sie, mein Liebling, mein Schwesterchen. O du holdes, rührendes Bild der teuren Mutter, o - o, wie bin ich glücklich, wie bin ich glücklich!"
Zärtlich drückte er sie an sein Herz.
"Reite voraus, Maxtla, nach Otoño und erzähle von mir, von ihr - ich komme mit dem Kinde nach."
Maxtla jagte bald darauf auf einem der Rosse des Llanero nach Cabuyaro, wo sein Pferd stand.
Nach eingehender Verständigung mit Juanas Pflegeeltern wurde beschlossen, daß die Sennora mit ihr und Alonzo nach Otoño reisen sollte, um das Kind hinzugeleiten und dort Vereinbarungen für die Zukunft zu treffen.
Am anderen Tage machten sie sich auf den Weg.
Mariquita küßte und streichelte die braunen Wangen des tiefbewegten Llanero: "Sei nur ruhig, Papa, wenn ich auch eine Sennorita werde, ich habe dich immer lieb - dich und Mama, sei nur ruhig - du sollst bald wieder bei mir sein."
Huatl folgte als Peon den Reisenden.
In Cabuyaro fanden sie eine aufgeregte Bevölkerung vor, die durch viele anwesende Landleute aus der Steppe vermehrt war.
Der Präsident des Landes, Don Manuel Obando, war gestorben, und es waren Wahlausschreiben erlassen worden, die große Junta des Landes zusammenzurufen, um einen Nachfolger für Don Manuel zu ernennen.
Alonzo traf in der Posada, in der er durch Maxtlas Verwendung Unterkunft fand, viele aufgeregte Landleute. Obgleich er seinen Namen nicht nannte und sich nur mit fast mütterlicher Zärtlichkeit der Schwester widmete, so drangen doch die behandelten Tagesfragen zu seinem Ohr.
Er hörte de Vallas Namen mit wilden Verwünschungen nennen, erkannte aber daneben auch, daß man selbst hier in der abgelegenen Stadt für seine Wahl als Präsident agitierte. Am meisten aber klang der Name des Generals Mosquera als der eines für den Präsidentenstuhl geeigneten Mannes an sein Ohr, ein Name, den er auch von beiden Sennores Vivanda mit großer Achtung hatte erwähnen hören.
Doch seine Seele war von dem Glücke, eine Schwester zu besitzen, so voll, daß die politischen Fragen für ihn bedeutungslos waren.
Am anderen Tage setzten sie die Reise nach Otoño, wo freudig erregte Menschen ihrer harrten, fort.
Zwanzigstes Kapitel.
Vergeltung
Bogotá konnte die Fremden nicht fassen, die herbeigeeilt waren, um während der Wahl des Staatsoberhauptes anwesend zu sein. Handelte es sich doch um die Zukunft des Vaterlandes.
Der Präsident hatte das Zeitliche gesegnet, der Vizepräsident lag schwer erkrankt auf seinem Landhause und de Valla hatte seit Wochen alle Macht allein in seinen Händen.
Die Erschütterung, die die Todesgefahr seines Lieblings und dessen Rettung durch den gefürchteten und gehaßten Sohn Don Pedro d'Alcantaras in ihm hervorgerufen, war gewichen. Die Nachricht von dem Verschwinden Don Alonzos, die ihm gleichbedeutend mit dessen Tode war, hatte ihn nicht nur gleichgültig gegen das Schicksal des Jünglings gelassen, sie war ihm, da die edlere Wallung seines Wesens längst verflogen war, sehr willkommen gewesen - er war eines Feindes ledig und sagte sich beruhigend, daß er das Seine getan habe, um ihn vor dem Verderben zu schützen.
Doch all dieses verschwand jetzt neben dem verzehrenden Wunsche des Mannes, die höchste Würde des Staates zu erlangen.
Er hatte die ganze Regierungsmaschinerie in der Hand, und er brauchte sie rücksichtslos, um die Wahlen zur großen Junta zu seinen Gunsten zu beeinflussen.
Sein Gegenkandidat, der General Mosquera, der ehemalige Gobernador von Santander, würde nur wenige Stimmen auf sich vereinen - wie de Valla mit Zuversicht annahm.
de Valla hatte den Pöbel der Hafenstädte, die Farbigen, für sich, und alle friedfertigen, ehrenwerten Leute waren eingeschüchtert. Daß die südlichen Gobernios, das heißt die Llaneros, Gegner seiner Wahl sein würden, hatte er vorhergesehen, aber sie mußten in der Minderheit bleiben.
Zu einer Präsidentenwahl vereinigten sich die Mitglieder des Staatsrates, von denen viele auf Lebenszeit, und einige als besondere Auszeichnung sogar erblich ernannt wurden, und die Junta des Staatsrates glaubte de Valla durchaus sicher zu sein, da er ihn größtenteils aus seinen Kreaturen zusammengesetzt hatte.
Bogotá wimmelte nicht nur von Fremden, ganz abgesehen von den Juntamitgliedern, auch von Soldaten. de Valla hatte zwei Regimenter des Staates, die zu neun Zehnteilen aus Farbigen bestanden, in die Hauptstadt beordert.
Sein Sohn Eugenio hatte sich die Nachricht von dem geheimnisvollen Ende seines Retters, dem er eine so innige Freundschaft entgegengebracht, die zu seinem Leidwesen nicht erwidert wurde, sehr zu Herzen genommen, und da ihm das Treiben, welches die Präsidentenwahl mit sich brachte, zuwider war, hatte er seinen Vater um Erlaubnis gebeten, nach Kuba reisen zu dürfen, was dieser umso lieber gestattet hatte, als er den dem Getriebe der Welt so fremden Jüngling nicht gern zum Zeugen der Vorgänge in Bogotá haben wollte.
Der Tag der Wahl kam.
Schon am frühen Morgen zeigten die Wege, welche auf Bogotá zuführten, sich sehr belebt.
Es war ein schöner heller Morgen, der den Tag eröffnete, an dem die Präsidentenwahl vor sich gehen sollte. In herrlicher Beleuchtung lagen die nahen Berge Guadalupe und Monserate da, und eine Flut von Licht ergoß sich über Straßen und Plätze und die bunten Häuser der Hauptstadt, des alten Santa Fé de Bogotá.
Auch die Bewohner der Stadt waren früh munter und lebhaft gestikulierende Gruppen standen auf den Straßen, aus denen man überall die Namen de Valla und Mosquera heraustönen hörte.
Die Plaza Bolivar, an der das Kapitol, das neue Parlamentsgebäude, sich erhob, war dicht gefüllt mit Menschen, so auch die benachbarten Straßen. Soldaten waren hier aufgestellt, um Ordnung zu erhalten. Unter der Menge sah man viele Leute aus den Gebirgen, das heißt Weiße; die Indianer Bogotás hielten sich fern von der Plaza. Hie und da sah man auch Llaneros zu Pferde, und vor dem Tore konnte man ein ganzes Lager der Steppenbewohner wahrnehmen, die über Nacht gekommen waren.
In der ganzen Stadt herrschte eine Stimmung, die etwas von der Schwüle an sich hatte, die einem Gewitter voranzugehen pflegt, und die Leute wagten nur in zurückhaltendem Tone miteinander zu reden.
Von zehn Uhr ab begannen die Juntamitglieder und die Staatsräte in der großen Sala des Parlamentshauses sich zu versammeln, unter ihnen die beiden Sennores Vivanda und der Mestize Antonio de Minas.
Gegen elf Uhr kam de Valla, er kam im Wagen. Schweigend empfing ihn die Menge, nur aus der Reihe der Soldaten begrüßten ihn einige Zurufe.
In der großen Sala hatten sich Staatsrat und Junta vereint, um unter dem Vorsitz des Präsidenten des Staatsrates die Wahlhandlung vorzunehmen.
Eben wollte man beginnen, als zu einer der großen Saaltüren ein hochgewachsener junger Mann eintrat, tadellos nach Pariser Mode gekleidet, dessen ganze Erscheinung großes Aufsehen erregte, vor allem das schöne, ungemein ernste Antlitz des Jünglings. In fester, fast hochmütiger Haltung schritt der so unerwartet Erscheinende zu dem Tische der Staatsräte, grüßte mit leichter Verbeugung die dort weilenden Sennores und ließ sich in einem Sessel nieder. Das Erstaunen war unter der Versammlung nicht gering.
"Darf ich fragen," nahm jetzt der Präsident das Wort, "mit welchem Rechte Sie hier erscheinen und Ihren Platz unter den Staatsräten nehmen?"
Bei der allgemeinen Stille, die in dem Saal herrschte, vernahm man überall deutlich die Antwort: "Mit dem Rechte, welches meinem Vater verliehen ward, als erblichem Mitgliede des Staatsrates. Ich bin Alonzo d'Alcantara, der Sohn Don Pedros."
Der Name zuckte wie ein Blitz durch die Versammlung.
de Valla starrte totenbleich auf das Gesicht Alonzos, das eine eherne Ruhe zeigte. Der Präsident unterbrach das Schweigen mit den unsicher gesprochenen Worten: "Das werden Sie uns beweisen müssen, Sennor."
Don Vincente erhob sich: "Ich bürge mit meiner Ehre für die Identität Don Alonzo d'Alcantaras."
Der Cura erhob sich: "Ich mit der Pflicht, die mir die Heiligkeit meines Amtes auferlegt."
Antonio de Minas stand auf: "Dort sitzt Alonzo d'Alcantara, der Gefangene der Aimaràs, der mich vom Tode errettete, von dem der sterbende Häuptling der Aimaràs unter Berufung auf seine Götter aussagte, daß er ihn aus dem Tale der drei Quellen fortgeschleppt hat."
Eine Anzahl Caballeros aus den Llanos erhob sich: "Wir verbürgen uns für die Person und den erhobenen Anspruch."
Stürmisch drängte sich ein junger Mann durch die Sitzreihen auf Alonzo zu: "Das ist mein kühner Retter aus Todesgefahr bei den Aimaràs," rief er, "o, Heil Euch, Don Alonzo, und Heil Euch doppelt, als der Sohn eines glorreichen Vaters."
Stürmisch umarmte ihn Don Fernando de Mosquera.
"Diesen jungen Caballero, hört es, Sennores, traf ich vor fünf Jahren in dem Dorfe der Aimaràs, wohin mich die Bandidos geschleppt hatten; seinem Heldenmute und seiner Hingebung danke ich es, daß ich noch am Leben bin. Ich bürge für ihn als den Sohn Don Pedros."
In dem kleineren Teile der Versammlung wurden diese Vorgänge mit inniger Teilnahme aufgenommen, deren größerer Teil aber saß stumm und finster da.
Der Präsident, der mit den Staatsräten geflüstert hatte, sagte: "Wir wollen diesen seltsamen Zwischenfall später aufklären und jetzt in der Verhandlung fortfahren."
de Valla saß bleich da mit zusammengebissenen Zähnen.
Jetzt erhob sich Don Alonzo rasch zu seiner ganzen Höhe und funkelnden Auges, mit weithin hallender Stimme sagte er: "Erlaubt Sennor, daß ich Euch auf die Anwesenheit eines dem Gesetze verfallenen Meuchelmörders in dieser hohen Versammlung aufmerksam mache; die Wahl könnte dadurch ungültig werden."
Neues Erstaunen malte sich in den Gesichtern der Mehrzahl.
"Vor den Sennores hier, vor Gott und Welt klage ich Carlos de Valla als Anstifter des Mordes meiner Eltern und Geschwister im Tale der drei Quellen an, klage ich ihn an, dreimal Meuchelmörder nach mir ausgesandt zu haben, denen ich nur durch Gottes Hilfe entgangen bin. Wollt Ihr den Mann in diesem Kreise dulden, macht Ihr Euch zu seinen Mitschuldigen und die Wahl ist ungültig. Und was ich sage, will ich beweisen."
Alle Augen waren jetzt auf de Valla gerichtet.
Dieser, dem es keineswegs an Mut fehlte, saß wie gebrochen da. Der Mann fühlte in dem Augenblicke, wo er das Ziel eines rastlosen Ehrgeizes endlich nahe vor Augen sah, das Walten einer unerbittlichen Nemesis. Die Geister der Erschlagenen standen wider ihn auf.
Aber seine nächsten Anhänger, verderbt gleich ihm, wußten, daß mit ihm, ihrem Oberhaupte, auch sie verloren seien.
"Wer wagt es," rief einer der Herren, "solche Beschuldigungen gegen einen Ehrenmann wie Excellenza zu schleudern? Wer ist dieser Knabe, der es wagt, uns hier Märchen zu erzählen?"
Dies gab den Anhängern de Vallas Mut, und trotzig schrieen sie auf und scharten sich um den, auf dem ihre Hoffnungen für die Zukunft beruhten.
Alonzo winkte, und herein wurde von seinen Vertrauten Tejada geführt, der frech um sich sah.
"Hier ist der Mann," sagte Alonzo, "der als Meuchelmörder nach mir ausgesandt wurde, hier," er hob die Schuldverschreibung empor, die de Valla dem Banditen gegeben, "ist die verklausulierte Lohnzusicherung, die wir dem gedungenen Manne abgenommen haben."
"Eine Lüge," zischte de Valla jetzt, dessen Augen grimmig funkelten, als er Tejada sah.
"Hier," fuhr Alonzo unerbittlich fort, "ist ein eigenhändiger Brief de Vallas, worin er einen gewissen Gomez auffordert, meinen Vater durch die Aimaràs unschädlich zu machen - hier, seht Sr. Excellenza Handschrift. Der Bandit dort hat ihm die anderen Briefe verkauft, den wichtigsten aber behalten."
Hätten Blicke töten können, der Bandido wäre vor denen des Ministers leblos hingesunken.
"Es ist so, edle Herren," sagte Tejada in dem allgemeinen Schweigen, "Ich habe Don Carlos behandelt wie meinen Bruder, und er hat auch hinter mir, einem ehrenwerten Manne, den er verführt hatte, einen Bandido in Gestalt eines schuftigen Indianers hergeschickt, der mir bald sehr gefährlich geworden wäre, wenn meine alterprobte Tapferkeit seine Tücke nicht vereitelt hätte. Pfui, Don Carlos, das war kein Freundschaftsdienst. Nun habe natürlich auch ich alle Rücksichten beiseite gesetzt."
Jetzt endlich ermannte sich der sonst so kaltblütige und redegewandte de Valla: "Will man mich hier von einem Narren und einem gemeinen Bandido, der schon längst dem Strick verfallen ist, beschimpfen lassen?"
Tobendes Geschrei seiner Anhänger unterstützte ihn, und man drängte auf Alonzo zu.
Da erhob sich der greise Cura, und seine hochgeachtete Persönlichkeit gebot auch den Freunden de Vallas Schweigen. "Hier ist das Bekenntnis eines sterbenden Mannes, namens Gomez, in meiner Gegenwart in seinen letzten Augenblicken gemacht, und von ihm mit einem Eide bekräftigt und unterschrieben, das Carlos de Valla als den intellektuellen Urheber des Verbrechens im Tale der drei Quellen bezeichnet. Den letzten Dienst im Leben erwies dem durch de Valla gedungenen Helfershelfer dieser Jüngling hier, der Sohn des Ermordeten."
Das war eine furchtbare Anklage, und selbst die Anhänger des Ministers schwiegen. Hier war der unanfechtbare Beweis geführt, daß die Verantwortung für die furchtbaren Vorgänge im Tale der drei Quellen in erster Linie de Valla traf.
Eine große tiefgehende Erregung hatte sich aller bemächtigt.
Da flüsterte einer der vertrautesten Genossen de Vallas einem anderen zu: "Soldados, oder wir sind verloren!"

Fünfzig Montaneros traten ein, die Büchsen in den Händen.
Eilig entfernte sich der Angeredete, aber Minas, der es gehört hatte, trat zu einem Fenster und winkte hinaus.
"Ich schlage vor," ließ der, der nach Soldaten gerufen hatte, sich vernehmen, "wir nehmen diesen jungen Mann, der sich d'Alcantara nennt, in Haft, bis seine Ansprüche an diesen Namen und die Beschuldigungen, die er erhoben hat, vor einem Gerichtshofe erwiesen sind."
"Ja, so sei es," brüllten die in ihren eigensten Interessen bedrohten Freunde des Ministers.
Minas, Fernando Mosquera, eine Anzahl junger Hacienderos aus den Llanos eilten zu Alonzo, der mit den Blicken der tiefsten Verachtung auf den zusammengebrochenen de Valla schaute. - Draußen dröhnten die Füße vieler Menschen, und herein drang eine Schar Soldaten.
Doch im gleichen Augenblicke öffnete sich die entgegengesetzte Türe, und fünfzig Montaneros traten, die Büchse in der Hand, ein.
Auf der Plaza hatte sich eine starke Schar Llaneros zusammengezogen, die langen Lanzen in der Hand, zahlreiche Montaneros flankierten sie, die Büchsen schußfertig.
Da rief Fernando de Mosquera: "Der Friede des Hauses ist gebrochen. Hinaus die Soldaten und Montaneros, im Namen des Gesetzes!"
Die Soldaten, denen beim Anblick der entschlossenen Bergschützen nicht wohl ward, entfernten sich - ihnen folgten die Montaneros.
Da erhob sich leichenblaß de Valla und sagte bebend: "Ich will nicht die Ursache des Unfriedens in dieser Versammlung sein, ich sehe, daß meine Feinde ein boshaftes Komplott gegen mich geschmiedet haben, ich überlasse die gegen mich erhobenen Beschuldigungen dem Urteile des Richters."
Unter allgemeinem Schweigen wankte er hinaus, ein innerlich und äußerlich gebrochener Mann. Seine Anhänger erkannten, daß ihre Sache verloren war.
Von neuem erhob Don Fernando die Stimme: "Die Wahlen zu dieser Junta sind unter ungesetzlichen Mitteln, unter dem furchtbaren Drucke des unheilvollen Mannes, der uns eben verlassen hat, zu stande gekommen. Es ist Zeit, daß unser schönes, leider von Parteien zerrissenes Vaterland eine Regierung an seiner Spitze sieht, die allein das Wohl des ganzen im Auge hat. Ich schlage vor, wir benutzen unser Mandat und ernennen eine provisorische Regierungskommission, die Neuwahlen anordnet, die deutlich den Willen des Volkes aussprechen."
Alle, die nicht unbedingte Kreaturen de Vallas waren, stimmten ihm bei, und die Gegner schwiegen.
Auf seinem Vorschlag wurde eine Kommission ernannt, in der die beiden Vivandas und auch Minas saßen - die sofort ihr Amt antraten und die Versammlung auflösten.
Gänzlich niedergedonnert entfernten sich de Vallas Anhänger.
Öffentlich wurde sodann Alonzo d'Alcantara als Sohn und Erbe Don Pedros anerkannt.
Das Volk von Bogotá nahm diese Wendung der Sache, den Sturz de Vallas, das Erscheinen eines Alcantaras mit stürmischer Begeisterung auf. Die Soldaten bekamen Befehl zum Abmarsch nach der Küste.
Als sie, aufgehetzt von den Freunden de Vallas, eine drohende Haltung annahmen und einige Häuser zu plündern begannen, versammelte Alonzo d'Alcantara rasch seine entschlossenen Freunde aus den Llanos und den Bergen. Und als die langen Lanzen der Steppenreiter sich zum Angriff senkten, die Montaneros unter Antonio de Minas Befehl sich zum Feuern fertig machten, die Bürger zu den Waffen griffen, zogen die eingeschüchterten Banden ab.
Als aber die gegen de Valla erhobenen Anklagen bekannt wurden, ergriff die Bewohner der Stadt ein grenzenloser Zorn, und nur mit Mühe wurde das Haus, das de Valla bewohnte, das Haus der d'Alcantaras, vor Zerstörung geschützt.
Der Minister selbst, der, ergriffen, unzweifelhaft der Volkswut zum Opfer gefallen sein würde, war verschwunden.
Tejada, dem man für seine Bekenntnisse freies Geleit zugesichert hatte, wurde über die Grenze gebracht mit dem Rate, sich anderswo hängen zu lassen. Die provisorische Regierung übte, unterstützt von einer aus Llaneros und Montaneros bestehenden Miliz, die unter Alonzos Kommando stand, ein kräftiges Regiment aus, und alle ehrenwerten Leute des Landes atmeten auf.
Eine der ersten Maßnahmen der provisorischen Regierung galt der Pirateninsel, zu der von Orocuë und Cabuyaro aus eine Anzahl tapferer Männer abgeschickt wurden.
Man fand das Nest ausgeflogen, und nur einzelne Leichname, wie die eines Zambo und eines Handelsagenten aus Orocuë, zeugten von blutigen Vorgängen auf dem Felseneiland. Die Piraten waren verschwunden und der Orinoko fortan frei von der Beunruhigung durch jene gesetzlose Bande.
Von de Valla wußte man nur, daß er in seinem Hause erschienen sei, einige Papiere und Geld an sich genommen und bei der in der Stadt herrschenden Aufregung diese unbemerkt verlassen hatte, ohne daß man wußte wohin. Man hat nie wieder etwas von ihm vernommen und vermutete, daß er sein Ende im Hochgebirge, wohin eine Spur leitete, in schreckenvoller Weise gefunden habe.
Von Don Eugenio, der die Nachrichten über die für sein Sohnesherz so entsetzlichen Vorgänge in der Junta noch im Lande empfangen hatte, trafen Briefe ein, in denen er allen Ansprüchen auf das ehemalige Eigentum der Alcantaras entsagte.
An Alonzo schrieb er, und dieser las es tiefgerührt: "Seien Sie glücklich, Sie, den ich so gern meinen Freund genannt hätte. Denken Sie milde, so milde Sie können von Carlos de Valla; er war mir stets der gütigste, zärtlichste der Väter; ich werde mein Leben lang für seine Seele beten."
Nun war der Tag gekommen, an dem wieder ein d'Alcantara in das Haus an der Plaza, das Haus seiner Väter einzog.
Von Otoño waren Donna Elvira mit Juana in Bogotá eingetroffen.
Alonzo, seine Schwester an der Hand geleitend, betrat mit ihr die Stätte, an der ihre Kindheit geschützt wurde, an der einst liebende Eltern sie umfangen, nach Jahren der Trennung, die voll Leid und rauher Schicksalsstürme gewesen waren.
Das Bild der Mutter hatte sich in einem abgelegenen Teile des Hauses wiedergefunden und seine alte Stelle eingenommen.
Tiefbewegt standen die beiden letzten Sprossen der Familie Hand in Hand vor dem Bilde, dem Juana so ähnlich war.
Das Kind weinte bitterlich, als es die treuen Züge der Mutter vor sich sah.
"Weine nicht, Juana, sie blickt vom Himmel auf uns nieder, ein seliger Geist, und fühlt wie wir das hohe Glück dieser Stunde. Vater und Mutter sollen uns als Vorbilder dienen im Leben, damit wir ihrer würdig werden."
"Ja, ja, Bruder," schluchzte sie, "ich will gewiß gut werden."
In herzlicher Teilnahme drängten sich dann die Freunde um das Geschwisterpaar. Da waren Elvira und Sennora Mauricio, die Pflegemutter des Kindes, und schlossen sie in die Arme; da waren Don Vincente und der Cura, stolz auf den jungen Löwen, den sie erzogen hatten; da war Don Antonio, der Mestize und Don Fernando, dessen gute Laune das Ergreifende der Situation milderte, und da stand auch Maxtla, und selbst auf seinem sonst so düsteren braunen Gesicht lag ein Strahl des sonnigen Glückes, das jetzt im Hause der Alcantaras eingezogen war.